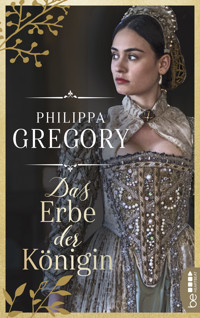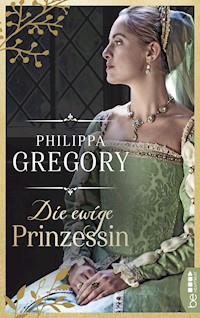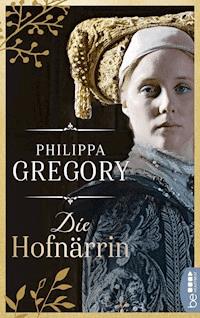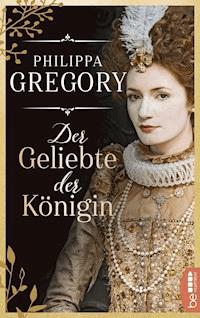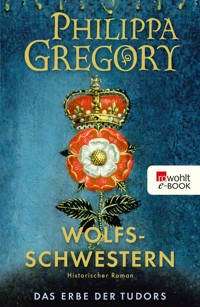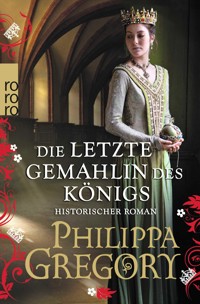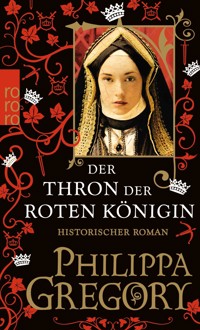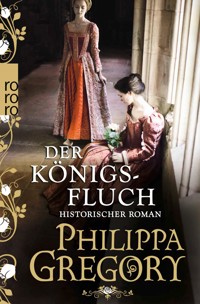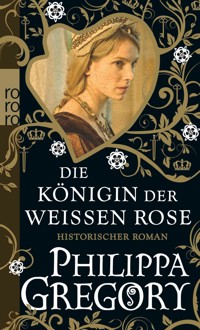
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rosenkriege
- Sprache: Deutsch
England, 1464: Die Adelshäuser York und Lancaster kämpfen erbittert um den Thron. Als König Edward, der Erbe der Weißen Rose, der schönen jungen Witwe Elizabeth Woodville begegnet, ist es um beide geschehen. Doch Elizabeth weigert sich, Edwards Mätresse zu werden. Da heiratet der König sie entgegen allen Standesschranken – ein ungeheurer Skandal! Und keine Frau im Königreich hatte je so viele Feinde. Neid, Missgunst und Intrigen bringen Elizabeth und ihre Familie in größte Gefahr. Ihre Widersacher nennen sie eine Hure. Sie nennen sie eine Hexe. Doch Elizabeth weiß: Sie ist die Königin. «Philippa Gregory ist wahrlich die Meisterin des historischen Romans! Geschichte kann kaum unterhaltsamer, lebendiger oder bezaubernder erzählt werden.» (Sunday Express) «Die Königin der Weißen Rose» ist der erste Band ihrer Trilogie über die Zeit der Rosenkriege. Mit diesem Buch gelang der Autorin in Großbritannien wie den USA auf Anhieb der Sprung an die Spitze der Bestsellerlisten. Die Folgebände der Reihe werden ebenfalls im Rowohlt Verlag erscheinen. «Gekonnt erzählt, mit Detailreichtum und Tempo. Gregorys Heerscharen von Fans werden begeistert sein.» (Booklist)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Philippa Gregory
Die Königin der Weißen Rose
Über dieses Buch
England, 1464: Die Adelshäuser York und Lancaster kämpfen erbittert um den Thron. Als König Edward, der Erbe der Weißen Rose, der schönen jungen Witwe Elizabeth Woodville begegnet, ist es um beide geschehen. Doch Elizabeth weigert sich, Edwards Mätresse zu werden. Da heiratet der König sie entgegen allen Standesschranken – ein ungeheurer Skandal!
Und keine Frau im Königreich hatte je so viele Feinde. Neid, Missgunst und Intrigen bringen Elizabeth und ihre Familie in größte Gefahr. Ihre Widersacher nennen sie eine Hure. Sie nennen sie eine Hexe. Doch Elizabeth weiß: Sie ist die Königin.
«Philippa Gregory ist wahrlich die Meisterin des historischen Romans! Geschichte kann kaum unterhaltsamer, lebendiger oder bezaubernder erzählt werden.» (Sunday Express)
«Die Königin der Weißen Rose» ist der erste Band ihrer Trilogie über die Zeit der Rosenkriege. Mit diesem Buch gelang der Autorin in Großbritannien wie den USA auf Anhieb der Sprung an die Spitze der Bestsellerlisten. Die Folgebände der Reihe werden ebenfalls im Rowohlt Verlag erscheinen.
«Gekonnt erzählt, mit Detailreichtum und Tempo. Gregorys Heerscharen von Fans werden begeistert sein.» (Booklist)
Vita
Philippa Gregory, geboren 1954 in Kenia, studierte Geschichte in Brighton und promovierte an der University of Edinburgh über die englische Literatur des 18. Jahrhunderts. In den USA und in Großbritannien feiert Gregory seit langem riesige Erfolge als Bestsellerautorin. Neben zahlreichen historischen Romanen schrieb sie auch Kinderbücher, Kurzgeschichten, Reiseberichte sowie Drehbücher und arbeitete als Journalistin für große Zeitungen, Radio und Fernsehen. Philippa Gregory lebt mit ihrer Familie in Nordengland.
«Die Königin des historischen Romans.» (Mail on Sunday)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Mai 2012
Covergestaltung any.way, Hamburg,
nach dem Original von Simon & Schuster
Coverabbildung Jeff Cottenden
ISBN 978-3-644-46271-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Anthony
In der Düsternis des Waldes konnte der junge Ritter das Plätschern der Quelle hören, lange bevor er das Schimmern des Mondlichts sah, das sich auf dem Wasser spiegelte. Er wollte näher treten, wollte den Kopf eintauchen, sich an dem kühlen Wasser laben, doch da erblickte er etwas Dunkles, das sich tief unter der Wasseroberfläche bewegte, und schnappte nach Luft. In dem Quellbecken war ein grünlicher Schatten, wie ein großer Fisch, wie eine Wasserleiche. Da bewegte sich der Schatten und stieg empor, und der junge Ritter sah, dass es eine badende Frau war, und sie war erschreckend nackt. Als sie auftauchte und das Wasser über ihre Flanken lief, war ihre Haut noch blasser als das weiße Marmorbecken der Quelle, ihr nasses Haar dunkel wie ein Schatten.
Es ist Melusine, die Wassergöttin. Man trifft in verborgenen Quellen und Wasserfällen überall in den Wäldern der Christenheit auf sie, selbst im fernen Griechenland. Auch in den maurischen Quellen badet sie. In den Ländern des Nordens, wo die Seen mit Eis überzogen sind und es knistert, wenn sie aufsteigt, kennt man sie unter einem anderen Namen. Ein Mann kann sie lieben, wenn er ihr Geheimnis hütet und sie allein lässt, wenn sie baden möchte, und sie kann ihn lieben, so lange, bis er sein Wort bricht – was Männer immer tun – und sie ihn mit ihrem Fischschwanz in die Tiefe reißt und sein treuloses Blut in Wasser verwandelt.
Die Tragödie von Melusine – in welcher Sprache sie auch erzählt, zu welcher Melodie sie auch gesungen wird – liegt darin, dass ein Mann einer Frau, die er nicht versteht, immer mehr versprechen wird, als er halten kann.
Frühjahr 1464
Mein Vater ist Sir Richard Woodville, Baron Rivers, ein englischer Edelmann, Grundbesitzer und Verbündeter der wahren Könige von England, der Könige des Hauses Lancaster. Meine Mutter stammt von den Herzögen von Burgund ab, in ihren Adern fließt das wässrige Blut der Wassergöttin Melusine, die mit ihrem bezauberten herzoglichen Geliebten dessen Fürstengeschlecht gegründet hat. In Zeiten äußerster Not macht sie sich noch immer bemerkbar, dann ruft sie eine Warnung über die Dächer des Schlosses, wenn der Sohn und Erbe stirbt und die Familie dem Untergang geweiht ist. So berichten jedenfalls die, die daran glauben.
Bei so einer unvereinbaren Abstammung – englische Bodenständigkeit und französische Wassergöttin – kann man von mir alles erwarten: Zauberin oder ganz gewöhnliches Mädchen. Manche sagen, ich sei beides. Aber heute, während ich mein Haar mit besonderer Sorgfalt kämme und es unter meinen höchsten Hennin stecke, meine beiden vaterlosen Jungen an die Hand nehme und mit ihnen zu der Straße gehe, die nach Northampton führt, würde ich alles geben, um nur dieses eine Mal einfach unwiderstehlich zu sein.
Ich muss die Aufmerksamkeit eines jungen Mannes wecken, der gegen einen unschlagbaren Feind zieht. Möglich, dass er mich nicht einmal bemerkt. Er wird nicht in der Stimmung sein, sich mit Bettlern oder koketten Frauen abzugeben. Ich muss seine Barmherzigkeit für meine Lage erregen, sein Mitgefühl für meine Bedürfnisse wecken und ihm so lange in Erinnerung bleiben, dass er sich für mich einsetzt. Und das bei einem Mann, der jeden Abend von schönen Frauen umgeben ist und von hundert Antragstellern für jedes Amt, das zu verleihen in seiner Macht steht.
Er ist ein Usurpator und Tyrann, er ist der Sohn meines Feindes und mein Feind, doch ich bin niemandem mehr treu außer meinen Söhnen und mir selbst. Mein Vater kämpfte in der Schlacht von Towton gegen diesen Mann, der sich jetzt König von England nennt, obwohl er kaum mehr ist als ein angeberischer Junge; und ich habe noch nie so einen gebrochenen Mann gesehen wie meinen Vater, als er von Towton zurückkehrte – das Blut seines Schwertarms sickerte durch den Stoff seiner Jacke, sein Gesicht war kreidebleich – und sagte, dass dieser Junge ein Feldherr sei, wie er noch nie einen gesehen habe, dass unsere Sache verloren sei und dass für uns keine Hoffnung bestünde, solange er lebe. Zwanzigtausend Männer wurden auf Befehl dieses Jungen hingemetzelt; nie zuvor hat England so ein gewaltiges Morden erlebt. Mein Vater sagte, das sei keine Schlacht gewesen, sondern ein einziges Abschlachten von Lancastrianern. Der rechtmäßige König Henry und seine Frau, Königin Margarete von Anjou, flohen erschüttert nach Schottland.
Wer von uns in England blieb, hat nicht freiwillig kapituliert. Wir haben weitergekämpft, um uns diesem falschen König, diesem Jungen aus dem Hause York, zu widersetzen. Mein Gemahl fiel vor drei Jahren in der Schlacht von St. Albans, als er unsere Kavallerie befehligte. Jetzt bin ich Witwe, und das Land und das Vermögen, das ich einst mein Eigen nannte, hat meine Schwiegermutter mir weggenommen, mit Zustimmung des Siegers, des Herrn dieses jungenhaften Königs, des großen Puppenspielers, den alle den Königsmacher nennen: Richard Neville, Earl of Warwick, der aus diesem eitlen Jungen, der gerade einmal zweiundzwanzig Jahre alt ist, einen König gemacht hat und der denjenigen von uns, die noch immer das Haus Lancaster verteidigen, das Leben in England zur Hölle macht.
In jedem Herrenhaus im Land sitzen jetzt Yorkisten, die an jedem profitablen Geschäft, an jedem Ort und jeder Steuer teilhaben. Ihr junger König sitzt auf dem Thron, und seine Anhänger bilden den neuen Hofstaat. Wir, die Besiegten, sind Arme in unseren eigenen Häusern und Fremde in unserem eigenen Land, unser König ist im Exil und unsere Königin eine rachsüchtige Fremde, die sich mit unserem alten Feind Frankreich verbündet hat. Wir müssen uns mit dem Tyrannen von York einigen, und gleichzeitig beten wir, dass Gott sich gegen ihn wenden und unser wahrer König mit einer Armee zu einer weiteren Schlacht gen Süden stürmen möge.
Inzwischen stehe ich, wie so manche Frau, deren Gatte gefallen und deren Vater besiegt ist, vor lauter Trümmern. Irgendwie muss ich mein Vermögen zurückgewinnen, obwohl es scheint, als könnten weder Verwandte noch Freunde etwas für mich erreichen. Wir sind alle als Verräter bekannt. Man hat uns verziehen, aber man liebt uns nicht. Wir sind machtlos. Ich muss meine eigene Fürsprecherin sein und meine Sache einem Jungen erklären, der es sogar wagt, mit einer Armee gegen seinen eigenen Cousin zu ziehen, einen gekrönten und gesalbten König. Was sagt man zu solch einem Barbaren, damit er einen versteht?
Meine Söhne, der neunjährige Thomas und der achtjährige Richard, tragen ihre besten Sachen, ihr Haar ist feucht und glatt gestrichen, ihre Gesichter glänzen sauber. Ich halte sie fest an den Händen, einen links, einen rechts, denn es sind richtige Jungen, die Schmutz anziehen wie von Zauberhand. Wenn ich sie nur eine Sekunde aus den Augen lasse, stößt der eine sich die Schuhe an, und der andere reißt sich ein Loch in die Hose, beide haben in Windeseile Laub im Haar und Dreck im Gesicht, und dann fällt Thomas bestimmt auch noch in den Bach. Jetzt, wo ich sie festhalte, hüpfen sie vor Langeweile von einem Fuß auf den anderen und stellen sich erst gerade hin, als ich sage: «Schsch, ich höre Pferde.»
Zuerst klingt es wie Regenprasseln, doch schon einen Augenblick später wie Donnergrollen. Die klirrenden Geschirre und die knatternden Standarten, das Rasseln der Kettenhemden und das Schnauben der Pferde, der ganze Lärm und der Geruch von hundert Pferden, die scharf geritten werden, überwältigen mich schier, und obwohl ich fest entschlossen bin, vorzutreten und sie zum Halten zu bringen, schrecke ich unwillkürlich zurück. Wie muss es sein, diesen Männern entgegenzutreten, wenn sie mit vorgehaltenen Lanzen in die Schlacht stürmen wie eine galoppierende Speerfront? Wie bringt ein Mann so etwas fertig?
Thomas sieht den unbedeckten blonden Kopf inmitten der Raserei und des Lärms und ruft, ganz der Junge, der er ist: «Hurra!», und beim Klang seiner hohen Stimme wendet der Mann den Kopf. Er sieht mich und die Jungen, zügelt sein Pferd und brüllt: «Halt!»
So jäh zum Stehen gebracht, bäumt sein Pferd sich auf, und der Reiterzug schiebt sich ineinander, bevor er ganz zum Halten kommt. Die Männer fluchen über den unerwarteten Halt, dann herrscht plötzlich Stille, in der der aufgewirbelte Staub auf uns herabsinkt.
Sein Pferd schnaubt, schüttelt die Mähne, doch der Reiter sitzt auf seinem hohen Rücken wie eine Statue. Er sieht mich an, ich sehe ihn an, und es ist so still, dass ich in den Ästen der Eiche über mir eine Drossel hören kann. Wie sie singt! Mein Gott, ihr Trällern gleicht einem Jubelgesang, einem Ausdruck reiner Freude. Ich habe noch nie einen Vogel so singen hören, als jubilierte er vor Glück.
Ich trete vor, meine Söhne noch immer an den Händen haltend, und öffne den Mund, um meine Sache vorzubringen, doch in diesem Augenblick, dem entscheidenden Augenblick, fehlen mir die Worte. Ich habe eine kleine Rede vorbereitet und sie sorgfältig einstudiert, aber jetzt bekomme ich kein Wort heraus. Und fast ist es, als bräuchte ich keine Worte. Ich sehe ihn nur an, und irgendwie erwarte ich, dass er alles versteht: meine Angst vor der Zukunft und meine Hoffnungen für meine Söhne, dass ich kein Geld habe und dass mein Vater es mir mit seiner Gereiztheit und seinem Mitleid unerträglich macht, unter seinem Dach zu leben, wie kalt mein Bett in der Nacht ist, wie sehr ich mich nach einem weiteren Kind sehne, wie beklemmend das Gefühl ist, mein Leben wäre vorbei. Lieber Gott, ich bin erst siebenundzwanzig, meine Sache ist verloren, mein Gemahl ist tot. Werde ich eine der vielen armen Witwen sein, die den Rest ihrer Tage an einem fremden Feuer verbringen, verzweifelt bemüht, als Gast nicht zu viel Aufhebens um sich zu machen? Soll ich nie wieder geküsst werden? Soll ich nie wieder Freude empfinden? Nie wieder?
Noch immer singt der Vogel, als wollte er sagen, Freude sei ein Leichtes für die, die sie suchen.
Der König gibt dem älteren Mann an seiner Seite ein Zeichen, und der bellt einen Befehl, worauf die Soldaten ihre Pferde von der Straße in den Schatten der Bäume lenken. Der König aber springt von seinem prächtigen Ross herunter, lässt die Zügel los und kommt auf mich und meine Jungen zu. Ich bin eine große Frau, doch er überragt mich um Haupteslänge; er muss größer als sechs Fuß sein. Meine Jungen recken die Hälse, um ihn besser zu sehen, für sie ist er ein Riese. Er hat blondes Haar, graue Augen und ein sonnengebräuntes Gesicht mit einem offenen Lächeln voller Charme, voller Anmut. Ein König, wie wir in England noch keinen gesehen haben: Diesen Mann werden die Menschen auf den ersten Blick lieben. Seine Augen sind unverwandt auf mein Gesicht gerichtet, als würde ich ein Geheimnis kennen, das er ergründen möchte, als würden wir einander schon immer kennen, und ich spüre, dass meine Wangen glühen, doch ich kann den Blick nicht von ihm wenden.
In dieser Welt senkt eine sittsame Frau den Blick und richtet ihn auf ihre Schuhe; eine Bittstellerin verbeugt sich tief und streckt flehend die Hand aus. Doch ich stehe hoch aufgerichtet da und bin gleichzeitig entsetzt über mein Betragen, denn ich starre ihn an wie eine ungebildete Bäuerin. Und doch kann ich die Augen nicht von ihm wenden, von seinem lächelnden Mund, seinem Blick, der auf meinem Gesicht brennt.
«Wer seid Ihr?», fragt er, während er mich immer noch ansieht.
«Euer Gnaden, dies ist meine Mutter, Lady Elizabeth Grey», sagt mein Sohn Thomas höflich, zieht seine Mütze und sinkt auf ein Knie.
Richard an meiner anderen Seite kniet ebenfalls nieder und murmelt: «Ist das der König? Ehrlich? So einen großen Mann habe ich noch nie gesehen!»
Ich sinke in einen Knicks, doch den Blick kann ich immer noch nicht von ihm wenden. Ich schaue vielmehr zu ihm auf, so wie eine Frau mit brennenden Augen einen Mann anstarrt, den sie anbetet.
«Erhebt Euch», sagt er mit leiser Stimme, sodass nur ich ihn hören kann. «Seid Ihr gekommen, um mich zu sehen?»
«Ich brauche Eure Hilfe», sage ich. Die Worte wollen mir nur schwer über die Lippen. Ich komme mir vor, als hätte der Liebestrank, in den meine Mutter den Schleier getaucht hat, der sich an meinem Hennin bauscht, mich betäubt und nicht ihn. «Ich bekomme mein Eigentum, meine Mitgiftgüter, nicht zurück, jetzt, da ich Witwe bin.» Ich stammele angesichts seiner lächelnden Aufmerksamkeit. «Ich bin Witwe und habe kein Einkommen.»
«Witwe?»
«Mein Gemahl war Sir John Grey. Er ist in der Schlacht von St. Albans gefallen», erkläre ich. Ich sage es, um seinen Verrat und die Verdammnis meiner Söhne zu gestehen. Der König wird den Namen des Kommandanten der feindlichen Kavallerie kennen. Ich beiße mir auf die Lippe. «Ihr Vater hat getan, was er für seine Pflicht hielt, Euer Gnaden; er war dem Mann treu, den er für den rechtmäßigen König hielt. Meine Jungen haben keine Schuld daran.»
«Er hat Euch diese beiden Söhne hinterlassen?» Lächelnd blickt er auf meine Jungen.
«Das Kostbarste, was ich besitze», antworte ich. «Dies ist Richard und dies Thomas Grey.»
Er nickt meinen Jungen zu, die zu ihm aufblicken, als wäre er ein hochgezüchtetes Pferd, zu groß zum Streicheln, doch ein Objekt ehrfürchtiger Bewunderung, und dann sieht er mich wieder an. «Ich bin durstig», sagt er. «Ist Euer Haus hier in der Nähe?»
«Es wäre uns eine Ehre …» Ich blicke zu seiner Leibgarde hinüber. Es sind sicher mehr als hundert Mann. Er lacht in sich hinein und bestimmt dann: «Sie können weiterreiten. Hastings!» Der ältere Mann wendet sich um und wartet. «Ihr reitet weiter nach Grafton. Smollet und Forbes können bei mir bleiben. Ich komme in einer Stunde nach.»
Sir William Hastings mustert mich von oben bis unten, als wäre ich ein hübsches Seidenband, das zum Verkauf steht. Ich erwidere seine Musterung mit eisernem Blick, und schließlich nimmt er seine Kappe ab und verbeugt sich vor mir, salutiert dem König und befiehlt der Leibgarde aufzusitzen.
«Wohin geht Ihr?», fragt er den König.
Der junge König sieht mich an.
«Wir gehen zum Haus meines Vaters, Baron Rivers, Sir Richard Woodville», erkläre ich stolz, obwohl ich weiß, dass der König den Namen eines Mannes erkennen wird, der hoch in der Gunst des Hauses Lancaster stand, der für Lancester in die Schlacht zog und einmal harte Worte von ihm persönlich zu hören bekam, als York und Lancaster gegeneinander kämpften. Wir kennen einander alle ziemlich gut, doch es gilt als allgemeine Höflichkeit, zu vergessen, dass wir einst alle Henry VI. treu waren – bis die Yorkisten zu Verrätern wurden.
Sir William Hastings zieht die Augenbrauen hoch, als er hört, wo der König rasten will. «Dann werdet Ihr Euch zweifellos nicht besonders lange aufhalten wollen», sagt er unfreundlich und reitet weiter. Die Erde bebt, als die Reiter vorüberziehen, und sie lassen uns in stiller Wärme zurück, in der sich der Staub legt.
«Meinem Vater wurde vergeben, und er hat seinen Titel zurückerhalten», sage ich rechtfertigend. «Ihr selbst habt ihm nach der Schlacht von Towton vergeben.»
«Ich erinnere mich an Euren Vater und Eure Mutter», erwidert der König ruhig. «Ich kenne sie seit meiner Kindheit, in guten Zeiten wie in schlechten. Ich bin nur überrascht, dass Ihr mir nie vorgestellt wurdet.»
Ich muss ein Kichern unterdrücken. Der König ist berüchtigt für seine Verführungskünste. Niemand, der auch nur das geringste bisschen Verstand besitzt, würde ihm seine heranwachsenden Töchter vorstellen. «Wollt Ihr mir hier entlang folgen?», frage ich. «Es ist nur ein kurzer Spaziergang zum Haus meines Vaters.»
«Möchtet ihr reiten, Jungen?», fragt er sie. Ihre Köpfe schießen hoch. «Ihr könnt beide aufsitzen», sagt er und hebt erst Richard und dann Thomas in den Sattel. «Haltet euch gut fest. Du dich an deinem Bruder und du – Thomas, richtig? – am Sattelknauf.»
Er nimmt die Zügel in die Hand und bietet mir den anderen Arm dar, und so gehen wir im Schatten der Bäume durch den Wald zum Haus meines Vaters. Seine beiden Männer folgen uns in einigem Abstand. Durch den geschlitzten Stoff seines Ärmels spüre ich die Wärme seiner Haut. Ich darf mich nicht an ihn lehnen. Ich richte den Blick nach vorn zum Haus und zum Fenster meiner Mutter und sehe an der winzigen Bewegung hinter den Fensterscheiben, dass sie Ausschau gehalten hat, weil sie wollte, dass genau dies hier geschieht.
Als wir näher kommen, erscheint sie in der Haustür, den Stallmeister an ihrer Seite. Sie knickst tief. «Euer Gnaden», sagt sie freundlich, als käme der König jeden Tag zu Besuch. «Herzlich willkommen in Grafton Manor.»
Ein Stallbursche kommt herbeigelaufen und nimmt die Zügel, um das Pferd in den Stallhof zu führen. Meine Jungen klammern sich die letzten paar Schritte noch fest, und meine Mutter tritt zurück und bedeutet dem König mit einer Verbeugung, in die Halle einzutreten. «Möchtet Ihr ein Glas Dünnbier?», fragt sie. «Wir haben aber auch einen sehr guten Wein von meinen Burgunder Cousins.»
«Ich nehme das Bier, wenn es Euch recht ist», erwidert er freundlich. «Reiten macht durstig. Ein ungewöhnlich warmer Frühlingstag. Guten Tag, Lady Rivers.»
Die Tafel in der großen Halle ist mit den besten Gläsern, einem Krug Ale und Wein gedeckt. «Erwartet Ihr Gäste?», fragt er.
Sie lächelt ihn an. «Kein Mann der Welt könnte an meiner Tochter vorbeireiten», sagt sie. «Als sie mir erzählte, sie wolle Euch ihre Sache vortragen, habe ich unser bestes Ale zapfen lassen. Ich dachte mir, dass Ihr anhalten würdet.»
Er lacht über ihren Stolz, wendet sich um und lächelt mich an. «In der Tat, nur ein Blinder könnte an Euch vorüberreiten», sagt er.
Ich möchte eigentlich etwas erwidern, doch da geschieht es wieder: Unsere Blicke begegnen sich, und mir will einfach nichts einfallen. Wir stehen nur da und starren einander eine ganze Weile an, bis meine Mutter ihm ein Glas reicht und leise sagt: «Auf Eure Gesundheit, Euer Gnaden.»
Er schüttelt den Kopf, als wäre er geweckt worden. «Ist Euer Vater hier?», will er wissen.
«Sir Richard ist zu unseren Nachbarn hinübergeritten», antworte ich. «Wir erwarten ihn zum Abendessen zurück.»
Meine Mutter nimmt ein sauberes Glas, hält es gegen das Licht und macht «Tz, tz», als hätte sie einen Fleck entdeckt. «Entschuldigt mich bitte», sagt sie und geht. Der König und ich sind allein in der Halle, die Sonne scheint durch das große Fenster hinter dem langen Tisch, das Haus ist still, als würden alle den Atem anhalten und lauschen.
Er geht um den Tisch herum und setzt sich auf den Stuhl des Hausherrn. «Bitte setzt Euch», sagt er und deutet auf den Stuhl neben ihm. Ich setze mich zu seiner Rechten, als wäre ich seine Königin, und lasse mir von ihm ein Glas Dünnbier einschenken. «Ich werde mich mit Eurem Anspruch auf Euer Land befassen», sagt er. «Wollt Ihr Euer eigenes Haus? Seid Ihr nicht glücklich hier bei Eurer Mutter und Eurem Vater?»
«Sie sind freundlich zu mir», erwidere ich. «Aber ich bin es gewohnt, meinen eigenen Haushalt zu führen und mein eigenes Land zu verwalten. Und wenn es mir nicht gelingt, die Ländereien ihres Vaters zurückzubekommen, werden meine Söhne eines Tages mit leeren Händen dastehen. Es ist ihr Erbe. Ich muss für meine Söhne eintreten.»
«Wir haben schwere Zeiten hinter uns», sagt er. «Aber wenn ich den Thron behalte, werde ich dafür Sorge tragen, dass wieder von einer Küste Englands zur anderen ein und dasselbe Landrecht gilt und Eure Jungen ohne Angst vor Kriegen aufwachsen.»
Ich nicke.
«Seid Ihr König Henry treu?», fragt er mich. «Folgt Ihr Eurer Familie als treue Lancastrianerin?»
Unsere Vergangenheit ist nicht zu leugnen. Ich weiß, dass es in Calais zwischen diesem König, der damals erst ein junger Sprössling aus dem Haus York war, und meinem Vater, zu jener Zeit einer der mächtigen lancastrianischen Lords, zu einem hitzigen Streit kam. Meine Mutter war die erste Hofdame von Margarete von Anjou; sie wird dem jungen, gutaussehenden Sohn des Hauses York ein Dutzend Mal begegnet sein und ihn von oben herab behandelt haben. Doch wer hätte damals ahnen können, dass die Welt auf den Kopf gestellt werden würde und dass die Tochter von Baron Rivers just diesen Jungen darum bitten müsste, ihr das eigene Land zurückzugeben? «Meine Mutter und mein Vater hatten herausragende Stellungen am Hofe von König Henry, aber meine Familie und ich haben uns jetzt Eurer Regentschaft unterworfen», antworte ich schnell.
Er lächelt. «Vernünftig von Euch allen, da ich gesiegt habe», findet er. «Ich nehme Eure Anerkennung an.»
Ich kann ein leises Lachen nicht unterdrücken, und sofort wird sein Gesicht weich. «Ich flehe zu Gott, dass es bald vorbei ist», sagt er. «Henry hat nur noch eine Handvoll Schlösser im gesetzlosen Norden. Wie jeder Vogelfreie kann er einen Haufen Banditen um sich scharen, aber er kann keine anständige Armee aufstellen. Und seine Königin kann nicht so weitermachen und die Feinde des Landes hier versammeln, um sie gegen ihr eigenes Volk antreten zu lassen. Wer für mich kämpft, wird belohnt werden, doch selbst die, die gegen mich gekämpft haben, werden sehen, dass ich ein gerechter Sieger bin. Ich setze meine Gesetze durch, auch im Norden Englands, selbst in ihren Festen, bis hinauf zur schottischen Grenze.»
«Zieht Ihr jetzt in den Norden?», frage ich und nippe an meinem Ale. Es ist das beste Ale meiner Mutter, aber es hat einen leichten Beigeschmack. Vermutlich hat sie ein paar Tropfen Tinktur hinzugefügt, einen Liebestrank, der Begierde wecken soll. Aber ich brauche nichts. Ich bin schon jetzt atemlos.
«Wir brauchen Frieden», meint er. «Frieden mit Frankreich, Frieden mit den Schotten und Frieden zwischen Brüdern und Cousins. Henry muss kapitulieren; seine Frau muss aufhören, französische Truppen ins Land zu holen, um gegen Engländer zu kämpfen. Wir sollten nicht mehr uneinig sein, York gegen Lancaster: Wir sollten alle Engländer sein. Nichts schwächt ein Land mehr, als wenn seine Bewohner gegeneinander kämpfen. Es zerstört Familien, es tötet uns jeden Tag. Dies muss ein Ende haben, und ich werde es beenden. Ich werde es dieses Jahr beenden.»
In mir steigt die Angst auf, die den Menschen in diesem Land nun schon seit einem Jahrzehnt allzu vertraut ist. «Muss es denn noch eine Schlacht geben?»
Er lächelt. «Ich werde versuchen, dafür zu sorgen, dass sie nicht vor Eurer Tür stattfindet, Mylady. Aber es muss sein, und zwar bald. Ich habe dem Duke of Somerset verziehen und ihm freundschaftlich die Hand gereicht, und jetzt ist er wieder zu Henry gelaufen, ein lancastrianischer Überläufer, treulos wie alle Beauforts. Das Haus Percy bringt den Norden gegen mich auf. Sie hassen die Nevilles, und die Nevilles sind meine stärksten Verbündeten. Es ist wie ein Tanz: Die Tänzer sind alle auf ihren Positionen, sie kennen ihre Schritte. Es wird zur Schlacht kommen, es ist unumgänglich.»
«Wird die Armee der Königin hier vorbeiziehen?» Auch wenn meine Mutter sie einst liebte und ihre erste Hofdame war, muss ich doch sagen, dass ihre Armee Angst und Schrecken verbreitet: Söldner, denen nichts an diesem Land liegt, Franzosen, die uns hassen, und Wilde aus dem Norden Englands, für die unsere fruchtbaren Äcker und wohlhabenden Städte nur zum Plündern gut sind. Das letzte Mal, als die Königin Schotten rekrutierte, durften sie alles, was sie stahlen, als Lohn behalten. Sie hätte genauso gut Wölfe anheuern können.
«Ich halte sie auf», sagt er einfach. «Ich trete ihnen im Norden von England entgegen, und ich werde sie besiegen.»
«Wie könnt Ihr Euch da so sicher sein?», rufe ich aus.
Er schenkt mir ein Lächeln, und ich schnappe nach Luft. «Weil ich noch nie eine Schlacht verloren habe», sagt er schlicht. «Nie. Ich bin flink auf dem Schlachtfeld und geschickt, ich bin mutig, und das Glück ist mir hold. Meine Armee bewegt sich schneller als jede andere; ich lasse sie rasch marschieren, und zwar in voller Rüstung. Ich sehe voraus, was meine Feinde vorhaben, und bin schneller als sie. Ich verliere nie eine Schlacht. Ich habe Glück im Kampf und Glück in der Liebe. In dem einen wie in dem anderen Spiel habe ich noch nie verloren. Ich werde gegen Margarete von Anjou nicht verlieren, ich werde sie besiegen.»
Ich lache über sein Selbstvertrauen, aber in Wirklichkeit bin ich beeindruckt.
Er trinkt sein Glas Ale aus und steht auf. «Habt Dank für Eure Gastfreundschaft.»
«Ihr geht? Ihr geht schon?», stammele ich.
«Wollt Ihr die Einzelheiten Eures Anspruches für mich niederschreiben?»
«Ja, aber …»
«Namen und Daten und so weiter? Das Land, von dem Ihr sagt, es gehöre Euch, und die Einzelheiten Eures Besitzanspruches?»
Es fällt mir schwer, ihn nicht wie eine Bettlerin am Ärmel festzuhalten. «Das will ich tun, aber …»
«Dann sage ich Lebewohl.»
Ich kann nichts tun, um ihn aufzuhalten, es sei denn, meine Mutter hat daran gedacht, sein Pferd lahmen zu lassen.
«Ja, Euer Gnaden, und habt vielen Dank. Aber Ihr seid herzlich eingeladen zu bleiben. Wir essen bald zu Abend … oder …»
«Nein, ich muss gehen. Mein Freund William Hastings wird mich schon erwarten.»
«Selbstverständlich, selbstverständlich. Ich will Euch nicht aufhalten …»
Ich bringe ihn zur Tür. Es quält mich, dass er so abrupt geht, und doch fällt mir nichts ein, womit ich ihn zum Bleiben bewegen könnte. Auf der Schwelle dreht er sich um und ergreift meine Hand. Er beugt seinen blonden Schopf tief darüber und dreht meine Hand um – wie köstlich. Dann drückt er einen Kuss hinein und schließt meine Finger über dem Kuss, wie um ihn sicher zu verwahren. Als er sich lächelnd wieder aufrichtet, sehe ich, er weiß genau, dass seine Geste mich berückt hat und dass ich die Hand bis zur Schlafenszeit fest geschlossen halten werde, bis ich sie an meine Lippen drücken kann.
Er schaut auf mein entzücktes Gesicht herunter, auf meine Hand, die sich unwillkürlich ausstreckt, um seinen Ärmel zu berühren. Da lässt er sich erweichen. «Ich komme morgen, um Euer Schriftstück abzuholen», verspricht er. «Natürlich. Was habt Ihr denn gedacht? Habt Ihr geglaubt, ich könnte von Euch gehen und nicht zurückkommen? Natürlich komme ich zurück. Morgen zur Mittagszeit. Treffe ich Euch dann an?»
Er muss mein Keuchen gehört haben. Die Farbe kehrt in mein Gesicht zurück, meine Wangen glühen. «Ja», stottere ich. «Mo … mo … morgen.»
«Zur Mittagszeit. Und ich bleibe zum Essen, wenn ich darf.»
«Es ist uns eine Ehre.»
Er verbeugt sich vor mir, dreht sich um und durchquert die Halle, geht durch die weit geöffnete Doppeltür und tritt hinaus in den strahlenden Sonnenschein. Ich halte mich an der schweren Holztür hinter mir fest, um mich zu stützen. Wahrhaftig, meine Knie sind weich wie Butter, sie geben unter mir nach.
«Ist er weg?», fragt meine Mutter, die leise durch die kleine Seitentür eingetreten ist.
«Er kommt morgen wieder», sage ich. «Er kommt morgen wieder. Er kommt morgen wieder, um mich zu sehen.»
Als die Sonne untergeht und meine Söhne ihr Abendgebet gesprochen haben – am Fußende ihrer Betten, die blonden Köpfe tief über die gefalteten Hände gebeugt – , geht meine Mutter mir voran zur Haustür hinaus und den gewundenen Pfad hinunter zur Brücke, die das Flüsschen Tove überspannt. Sie geht hinüber – dabei streift ihr Hennin die überhängenden Äste – und winkt mir, ihr zu folgen. Auf der anderen Seite legt sie die Hand an eine große Esche, und ich sehe, dass um die raue Rinde des dicken Baumstamms ein dunkler Seidenfaden gewickelt ist.
«Was ist das?»
«Zieh es an Land», ist alles, was sie sagt. «Zieh es an Land, jeden Tag einen Fuß.»
Ich nehme den Faden und ziehe behutsam daran. Er gibt leicht nach; am anderen Ende ist anscheinend etwas Leichtes und Kleines festgebunden. Was es ist, kann ich nicht sehen, denn der Faden führt über den Fluss ins Schilf, ins tiefe Wasser am anderen Ufer.
«Zauberei», sage ich rundheraus. Mein Vater hat ihre Ausübung aus dem Haus verbannt; die herrschenden Gesetze verbieten sie. Wer als Hexe überführt wird, ist des Todes, des Todes durch Ertrinken auf dem Tauchstuhl oder durch Erwürgen durch den Schmied an der Dorfkreuzung. Frauen wie meine Mutter dürfen solche Fertigkeiten in England nicht mehr ausüben. Sie sind verboten.
«Zauberei», stimmt sie mir gelassen zu. «Ein starker Zauber für eine gute Sache, das Risiko wahrlich wert. Komm jeden Tag hierher und zieh es an Land, jeden Tag ein Stück.»
«Was hängt daran?», frage ich sie. «Am Ende deiner Angelschnur? Welchen großen Fisch werde ich fangen?»
Sie lächelt mich an und legt mir eine Hand an die Wange. «Das, was dein Herz begehrt», antwortet sie sanft. «Ich habe dich nicht aufgezogen, damit du als arme Witwe endest.»
Sie dreht sich um und geht zurück über die kleine Brücke, und ich ziehe, wie sie es mir aufgetragen hat, an dem Faden, hole ihn einen Fuß ein, verknote ihn wieder und folge ihr.
«Und wofür hast du mich aufgezogen?», frage ich sie, als wir nebeneinander zurück zum Haus gehen. «Was soll ich werden, deiner Vorstellung nach? In einer Welt, in der Krieg herrscht und in der es, trotz deiner seherischen Fähigkeiten und deiner Zauberei, scheint, als stünden wir auf der Seite der Verlierer?»
Der Mond geht auf, eine schmale Mondsichel. Ohne ein Wort zu sprechen, wünschen wir uns beide etwas von ihm; wir machen rasch einen Knicks, und es klimpert leise, als wir die kleinen Münzen in unseren Taschen umdrehen.
«Ich habe dich aufgezogen, damit du das Beste aus dem machst, was in dir steckt», antwortet sie schlicht. «Ich wusste nicht, was das sein würde, und ich weiß es immer noch nicht. Aber ich habe dich nicht aufgezogen, damit du eine einsame Frau wirst, die ihren Gemahl vermisst und Mühe hat, ihre Jungen großzuziehen; eine Frau, allein in einem kalten Bett, ihre Schönheit vergeudet in menschenleerer Landschaft.»
«Amen», sage ich schlicht und blicke zu der schlanken Sichel hinauf. «Amen. Und möge der Neumond mir etwas Besseres bringen.»
Am nächsten Tag sitze ich zur Mittagszeit in einem einfachen Kleid in meinem Privatgemach, da stürzen die Mädchen herein, um mir zu sagen, dass der König die Straße herunter auf das Haus zugeritten kommt. Ich erlaube mir nicht, zum Fenster zu laufen und nach ihm Ausschau zu halten, ich erlaube mir nicht, ins Zimmer meiner Mutter zu gehen und mich vor den Spiegel mit dem Rahmen aus getriebenem Silber zu stellen. Ich lege mein Nähzeug zur Seite und steige die breite Holztreppe hinunter, sodass ich, als die Tür aufgeht und er hereinkommt, gelassen hinabschreite und es den Anschein hat, als wäre ich gerade von meinen Haushaltspflichten weggerufen worden, um einen Überraschungsgast zu begrüßen.
Ich trete lächelnd vor ihn, und er begrüßt mich mit einem höflichen Kuss auf die Wange. Ich spüre die Wärme seiner Haut und sehe mit halbgeschlossenen Augen, wie weich das Haar ist, das sich in seinem Nacken lockt. Sein Haar duftet leicht nach Gewürzen, und sein Nacken riecht sauber. Als er mich ansieht, erkenne ich Verlangen in seinem Gesicht. Langsam lässt er meine Hand los, und ich trete zögernd einen Schritt zurück. Ich drehe mich um und knickse, als mein Vater und meine beiden ältesten Brüder, Anthony und John, vortreten, um sich zu verbeugen.
Das Gespräch beim Essen ist gestelzt – wie es sich gehört. Meine Familie begegnet diesem neuen König von England mit Respekt, aber es ist nicht zu leugnen, dass wir unser Leben und unser Vermögen im Kampf gegen ihn eingesetzt haben, und mein Gatte war nicht der Einzige in unserem Haus und unserer Familie, der nicht zurückgekehrt ist. Doch so muss es sein in einem Krieg, den sie Rosenkrieg genannt haben, denn Brüder kämpfen gegen Brüder, und ihre Söhne folgen ihnen in den Tod, die weiße Rose von York kämpft gegen die rote Rose von Lancaster. Meinem Vater wie auch meinen Brüdern ist verziehen worden, und jetzt bricht der Sieger Brot mit ihnen, wie um zu vergessen, dass er in Calais über sie triumphierte, wie um zu vergessen, dass mein Vater geflohen ist und im blutbefleckten Schnee in Towton vor der siegreichen Armee davongelaufen ist.
König Edward gibt sich ungezwungen. Er ist charmant zu meiner Mutter und unterhält sich mit meinen älteren Brüdern Anthony und John und dann auch mit meinen jüngeren Brüdern Richard, Edward und Lionel, die sich später zu uns gesellen. Drei von meinen jüngeren Schwestern sind zu Hause, und sie verzehren schweigend ihr Mittagsmahl, die Augen weit aufgerissen vor Bewunderung, doch zu ängstlich, um ein Wort zu sagen. Anthonys Frau, Elizabeth, sitzt still und elegant neben meiner Mutter. Der König ist aufmerksam meinem Vater gegenüber und fragt ihn nach dem Wild und dem Land, nach dem Weizenpreis und ob es genug Arbeit gibt. Als eingemachtes Obst und Bonbons serviert werden, plaudert er wie ein Freund der Familie, und ich kann mich auf meinem Stuhl zurücklehnen und ihn beobachten.
«Und jetzt zu der Sache, deretwegen ich hier bin», sagt er zu meinem Vater. «Lady Elizabeth hat mir gesagt, dass sie ihre Mitgiftgüter verloren hat.»
Mein Vater nickt. «Es tut mir leid, Euch damit zu belästigen, aber wir haben versucht, vernünftig mit Lady Ferers und Lord Warwick zu reden, leider ohne Erfolg. Sie wurden nach», er räuspert sich, «der Schlacht von St. Albans konfisziert, wenn Ihr versteht. Ihr Gemahl ist dort gefallen. Und jetzt erhält sie ihre Mitgiftgüter nicht zurück. Selbst wenn Ihr ihren Mann als Verräter anseht, so ist sie selbst doch unschuldig und sollte wenigstens ihre Witwenzuwendung erhalten.»
Der König wendet sich mir zu. «Habt Ihr die Einzelheiten Eures Rechtsanspruchs niedergeschrieben?»
«Ja», sage ich. Ich gebe ihm das Schriftstück, und er wirft einen Blick darauf.
«Ich werde mit Sir William Hastings reden und ihn bitten, dafür zu sorgen, dass das erledigt wird», sagt er schlicht. «Er wird Euer Fürsprecher sein.»
So einfach ist das. Mit einem Streich bin ich der Armut entkommen und verfüge wieder über eigenen Besitz; meine Söhne werden ein Erbe haben, und ich falle meiner Familie nicht länger zur Last. Wenn jemand um meine Hand anhält, werde ich etwas in die Ehe einbringen können. Ich bin nicht mehr auf Barmherzigkeit angewiesen und werde nicht dankbar sein müssen für einen Heiratsantrag. Ich werde keinem Mann dafür dankbar sein müssen, dass er um meine Hand anhält.
«Ihr seid sehr großzügig, Sire», sagt mein Vater ruhig und nickt mir zu.
Gehorsam erhebe ich mich und mache einen tiefen Knicks. «Ich danke Euch, Euer Gnaden», sage ich. «Das bedeutet mir sehr viel.»
«Ich bin ein gerechter König», sagt er und sieht meinen Vater an. «Ich will nicht, dass auch nur ein Engländer leidet, weil ich auf den Thron gekommen bin.»
Mein Vater hat sichtlich Mühe, sich die Antwort zu verkneifen, dass einige von uns bereits gelitten haben.
«Noch etwas Wein?», wechselt meine Mutter rasch das Thema. «Euer Gnaden? Mein Gemahl?»
«Nein, ich muss aufbrechen», erwidert der König. «Wir rekrutieren in ganz Northamptonshire Soldaten und rüsten sie aus.» Er schiebt seinen Stuhl zurück, und wir alle – mein Vater und meine Brüder, meine Mutter, meine Schwestern und ich – schießen hoch wie Marionetten, um zu stehen, wenn er steht. «Wollt Ihr mir den Garten zeigen, bevor ich gehe, Lady Elizabeth?»
«Es ist mir eine Ehre.»
Mein Vater will uns seine Gesellschaft anbieten, doch meine Mutter sagt schnell: «Ja, tu das, Elizabeth», und wir beide eilen ohne Begleiter aus dem Raum.
Nach der düsteren Halle ist es draußen sommerlich warm, und er reicht mir seinen Arm. Wir gehen die Stufen hinunter in den Garten, Arm in Arm, schweigend. Ich wähle den Pfad um den kleinen Boskettgarten herum, und wir gehen an ihm vorbei, den Blick auf die gestutzten Hecken und die ordentlich gesetzten weißen Steine gerichtet, doch ich sehe nichts. Der König zieht meine Hand etwas enger unter seinen Arm, und ich spüre die Wärme seines Körpers. Der Lavendel fängt an zu blühen, und ich rieche seinen Duft, süß wie Orangenblüten, scharf wie Zitronen.
«Ich habe nicht viel Zeit», sagt er. «Somerset und Percy ziehen Truppen gegen mich zusammen. Henry selbst wird aus seinem Schloss kommen und seine Armee anführen, wenn er bei Verstand ist und den Oberbefehl führen kann. Die arme Seele, man sagt mir, im Augenblick sei er bei sich, aber er könne jeden Moment wieder den Verstand verlieren. Die Königin plant wohl, zu ihrer Unterstützung französische Truppen herüberzubringen, und wir werden uns auf englischem Boden einer französischen Streitmacht stellen müssen.»
«Ich werde für Euch beten», sage ich.
«Der Tod lauert in unser aller Nähe», entgegnet er ernst. «Aber er ist ein steter Gefährte eines Königs, der auf dem Schlachtfeld zu seiner Krone gekommen ist und jetzt erneut ins Feld zieht.»
Er bleibt stehen und ich mit ihm. Es ist ganz still, nur ein einziger Vogel singt. Sein Gesicht ist ernst. «Darf ich einen Knappen schicken, der Euch heute Abend zu mir bringt?», fragt er ruhig. «Mich verlangt nach Euch, Lady Elizabeth Grey, wie es mich noch nie nach einer Frau verlangt hat. Werdet Ihr zu mir kommen? Ich frage nicht als König, nicht einmal als Soldat, der womöglich in der Schlacht fällt, sondern als einfacher Mann gegenüber der schönsten Frau, die ihm je begegnet ist. Kommt zu mir, ich bitte Euch, kommt zu mir. Es könnte mein letzter Wunsch sein. Werdet Ihr heute Abend zu mir kommen?»
Ich schüttele den Kopf. «Verzeiht mir, Euer Gnaden, aber ich bin eine ehrbare Frau.»
«Ich werde Euch womöglich nie wieder darum bitten. Gott weiß, dass ich womöglich nie wieder eine Frau bitten werde. Darin kann doch keine Schande liegen. Ich könnte nächste Woche sterben.»
«Selbst dann.»
«Seid Ihr denn nicht einsam?», fragt er, und seine Lippen streifen fast meine Stirn, so nah ist er mir. Ich spüre die Wärme seines Atems an meiner Wange. «Und empfindet Ihr nichts für mich? Könnt Ihr sagen, Ihr begehrt mich nicht? Nur einmal? Wollt Ihr mich jetzt nicht?»
Betont langsam hebe ich die Augen zu seinem Gesicht. Mein Blick ruht auf seinen Lippen, dann schaue ich auf.
«Lieber Gott, ich muss Euch haben», haucht er.
«Ich kann Eure Geliebte nicht sein», sage ich ruhig. «Lieber würde ich sterben, als meinen Namen zu entehren. Diese Schande kann ich nicht über meine Familie bringen.» Ich unterbreche mich, ich darf ihn nicht zu sehr entmutigen. «Was auch immer ich mir im Herzen wünsche», füge ich ganz leise hinzu.
«So wollt Ihr mich denn?», fragt er jungenhaft, und ich lasse ihn die Wärme in meinem Gesicht sehen.
«Ach», sage ich. «Ich sollte Euch nicht sagen …»
Er wartet.
«Ich sollte Euch nicht sagen, wie sehr.»
Ich sehe den Schimmer eines Triumphs aufblitzen, rasch wieder verborgen. Er denkt, er kann mich haben.
«Ihr werdet also kommen?»
«Nein.»
«Dann muss ich gehen? Muss Euch verlassen? Darf nicht …» Er beugt sein Gesicht über mich, und ich hebe das meine. Sein Kuss ist so zart, als streifte eine Feder meine weichen Lippen. Mein Mund öffnet sich etwas, und ich spüre, dass er zittert wie ein Pferd, das fest am Zügel gehalten wird. «Lady Elizabeth … ich schwöre … ich muss …»
In diesem köstlichen Tanz trete ich einen Schritt zurück. «Wenn doch nur …», flüstere ich.
«Ich komme morgen», sagt er abrupt. «Am Abend. Bei Sonnenuntergang. Wollt Ihr mich dort treffen, wo wir uns zum ersten Mal begegnet sind? Unter der Eiche? Werdet Ihr Euch dort mit mir treffen? Ich möchte Euch Lebewohl sagen, bevor ich in den Norden ziehe. Ich muss Euch wiedersehen, Elizabeth. Wenigstens das. Ich muss.»
Ich nicke schweigend und sehe ihm zu, wie er auf dem Absatz kehrtmacht und zurück zum Haus geht. Ich sehe, wie er ums Haus zum Stallhof geht, und wenige Augenblicke später donnert sein Pferd den Weg hinunter, und seine beiden Knappen geben ihren Pferden die Sporen, um mit ihm mitzuhalten. Ich blicke ihm hinterher, bis er verschwunden ist, und dann nehme ich die kleine Brücke über den Fluss und suche den Faden, der um die Esche gebunden ist. Behutsam ziehe ich ihn einen Fuß ein und verknote ihn wieder. Dann gehe ich nach Hause.
Beim Mittagessen am nächsten Tag wird so etwas wie eine Familienkonferenz abgehalten. Der König hat einen Brief geschickt: Sein Freund Sir William Hastings wird meinen Anspruch auf mein Haus und mein Land in Bradgate unterstützen, und ich soll versichert sein, dass ich mein Vermögen zurückbekomme. Mein Vater ist erfreut, doch meine Brüder – Anthony, John, Richard, Edward und Lionel – sind sich mit jungenhaft wachsamem Stolz einig in ihrem Argwohn gegen den König.
«Er ist ein berüchtigter Lüstling. Er wird verlangen, sich mit ihr zu treffen, er wird Elizabeth vor Gericht zerren», glaubt John.
«Er gibt ihr das Land nicht aus Nächstenliebe zurück. Er wird seinen Preis dafür verlangen», meint auch Richard. «Es gibt am Hofe keine einzige Frau, der er nicht beigewohnt hat. Warum sollte er es nicht auch bei Elizabeth versuchen?»
«Einer Lancastrianerin», sagt Edward, als genügte das, um unsere Feindschaft zu garantieren, und Lionel nickt zustimmend.
«Ein Mann, dem man sich nur schwer verweigern kann», sagt Anthony nachdenklich. Er ist viel welterfahrener als John; er hat die ganze Christenheit bereist und bei großen Denkern studiert. Meine Eltern hören immer auf ihn. «Ich vermute, Elizabeth, dass du dich kompromittiert fühlst. Ich fürchte, du könntest dich ihm verpflichtet fühlen.»
Ich zucke die Achseln. «Keineswegs. Ich habe doch nur noch mich selbst. Ich habe den König um Gerechtigkeit gebeten, und die habe ich erhalten, wie es mir gebührt, wie es jedem Bittsteller gebührt, der das Recht auf seiner Seite hat.»
«Trotzdem wirst du nicht an den Hof gehen, sollte er nach dir schicken», sagt mein Vater. «Dieser Mann hat mit der Hälfte aller Frauen in London das Bett geteilt, und jetzt sind die Lancastrianerinnen dran. Er ist kein heiliger Mann wie der gesegnete König Henry.»
Und auch nicht schwachsinnig wie der gesegnete König Henry, denke ich, doch laut sage ich: «Selbstverständlich, Vater, wie du befiehlst.»
Er bedenkt mich mit einem scharfen Blick; so viel bereitwilliger Gehorsam erweckt sein Misstrauen. «Du glaubst nicht, dass du ihm deine Gunst schuldig bist? Dein Lächeln? Schlimmeres noch?»
Ich zucke erneut die Achseln. «Ich habe ihn als König um Gerechtigkeit gebeten, nicht um seine Gunst», sage ich. «Ich bin kein Diener, dessen Dienste erkauft werden können, und auch kein Bauer, den man in den Lehnsdienst zwingen kann. Ich bin eine Dame aus gutem Hause. Ich habe meine eigenen Loyalitäten und Verpflichtungen, die ich achte und ehre. Es sind nicht die seinen. Ich tanze keinem Mann nach der Pfeife.»
Meine Mutter senkt den Kopf, um ihr Lächeln zu verbergen. Sie ist eine Tochter aus dem Hause Burgund, Nachfahrin von Melusine, der Wassergöttin. Sie hat sich ihr Leben lang zu nichts verpflichtet gefühlt, und sie findet auch nicht, dass ihre Tochter zu irgendetwas verpflichtet ist.
Mein Vater blickt von ihr zu mir und zuckt die Achseln, wie um einzuräumen, dass eigenwilligen Frauen eine unverbesserliche Unabhängigkeit eigen ist. Er nickt meinem Bruder John zu und sagt: «Ich reite nach Old Stratford Village. Begleitest du mich?» Die beiden verlassen uns.
«Möchtest du an den Hof gehen? Bewunderst du ihn? Trotz allem?», fragt Anthony mich leise, als meine anderen Brüder sich nach und nach entfernt haben.
«Er ist der König von England», sage ich. «Natürlich gehe ich, wenn er mich einlädt. Was denn sonst?»
«Vielleicht weil Vater gerade gesagt hat, du sollst nicht gehen und ich dir auch davon abgeraten habe.»
Ich nicke. «Das habe ich gehört.»
«Wie will eine arme Witwe in dieser niederträchtigen Welt sonst ihren Weg machen?», neckt er mich.
«Genau.»
«Du wärst eine Närrin, wenn du dich so billig verkaufen würdest», ermahnt er mich.
Ich werfe ihm unter meinen Wimpern einen Blick zu. «Ich habe nicht die Absicht, mich zu verkaufen», widerspreche ich. «Ich bin kein hübsches Band und keine Hammelkeule. Ich werde nicht auf dem Marktplatz feilgeboten.»
Bei Sonnenuntergang warte ich unter der Eiche auf ihn, verborgen im Schatten. Ich bin erleichtert, als ich höre, dass sich auf der Straße nur ein Pferd nähert. Wäre er in Begleitung einer Wache gekommen, wäre ich, um meine Sicherheit bangend, still und leise wieder nach Hause geeilt. Wie zärtlich er auch in den Grenzen des väterlichen Gartens sein mag, ich vergesse nicht, dass er der sogenannte König der yorkistischen Armee ist, für die es eine Selbstverständlichkeit ist, Männer zu morden und deren Frauen zu vergewaltigen. Er wird sich abgehärtet haben, um Dinge mit ansehen zu können, deren Zeuge niemand werden sollte; er wird selbst Dinge getan haben, die tiefschwarze Sünden sind. Ich kann ihm nicht vertrauen. Wie überwältigend sein Lächeln und wie ehrlich sein Blick auch sein mag, wie sehr ich ihn auch als Jungen betrachte, der von seinem Ehrgeiz zu Größerem angetrieben wird, ich kann ihm nicht vertrauen. Wir leben nicht in ritterlichen Zeiten; dies ist nicht die Zeit der Ritter im dunklen Wald und der schönen Frauen in mondbeschienenen Quellen, nicht die Zeit der Liebesschwüre, die zu Balladen werden, auf ewiglich gesungen.
Doch als er sein Pferd zum Stehen bringt und in einer einzigen fließenden Bewegung absitzt, sieht er aus wie ein Ritter in einem dunklen Wald. «Ihr seid gekommen!», sagt er.
«Ich kann nicht lange bleiben.»
«Ich bin überglücklich, dass Ihr überhaupt gekommen seid.» Er lacht über sich selbst, fast ein wenig verwirrt. «Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, weil ich immer an Euch denken musste, und den ganzen Tag habe ich mich gefragt, ob Ihr überhaupt kommen werdet. Und siehe da, Ihr seid gekommen!»
Er schlingt die Zügel seines Pferds um einen Ast und legt die Hand um meine Taille. «Schöne Frau», flüstert er mir ins Ohr. «Seid nett zu mir. Würdet Ihr Euren Kopfschmuck abnehmen und Euer Haar herablassen?»
Ich hätte im Leben nicht erwartet, dass er das von mir verlangt, und ich bin so schockiert, dass ich augenblicklich gehorche und nach den Bändern an meinem Hennin greife.
«Ich glaube, Ihr treibt mich in den Wahnsinn. Den ganzen Tag konnte ich an nichts anderes denken als daran, ob Ihr mir erlauben würdet, Euer Haar zu sehen.»
Zur Antwort knote ich die enge Schnürung meines hohen Hennins auf und nehme ihn ab. Ich lege ihn behutsam auf den Boden und drehe mich zum König um. Sanft wie eine Zofe zieht er die Elfenbeinnadeln heraus und steckt eine nach der anderen in sein Wams. Ich spüre mein schweres Haar zart wie einen seidigen Kuss, als es mir wie ein blonder Wasserfall über das Gesicht fällt. Ich schüttele den Kopf und werfe es zurück wie eine schwere goldene Mähne, und er stöhnt auf vor Verlangen.
Er knüpft seinen Umhang auf und breitet ihn in einer schwungvollen Bewegung zu meinen Füßen auf dem Boden aus. «Setzt Euch zu mir!», befiehlt er, obwohl er «Legt Euch zu mir» meint, das wissen wir beide.
Ich setze mich vorsichtig auf den Rand seines Umhangs, ziehe die Knie an und schlinge die Arme darum, mein schönes Seidenkleid um mich herum drapiert. Er streichelt mein offenes Haar, und seine Finger dringen immer tiefer vor, bis er meinen Nacken liebkost. Dann dreht er mein Gesicht dem seinen zu, um mich zu küssen.
Behutsam beugt er sich über mich, bis ich unter ihm liege. Dann spüre ich, wie sich seine Hand an meinem Kleid zu schaffen macht, wie sie es hochzieht, und ich stemme mich sanft gegen seine Brust und schiebe ihn weg.
«Elizabeth», haucht er.
«Ich habe nein gesagt», sage ich fest entschlossen. «Und das habe ich auch so gemeint.»
«Ihr seid gekommen!»
«Ihr habt mich darum gebeten. Soll ich jetzt gehen?»
«Nein! Bleibt! Lauft nicht weg, ich schwöre, ich … erlaubt mir nur, Euch noch einmal zu küssen.»
Mein Herz pocht so laut, und mich verlangt so sehr nach seiner Berührung, dass ich schon denke, ich könnte mich doch zu ihm legen, nur das eine Mal, ich könnte mir diese Freude gönnen, nur dieses eine Mal … doch dann ziehe ich mich zurück und sage: «Nein. Nein.»
«Doch», sagt er nachdrücklicher. «Euch soll kein Leid geschehen, das schwöre ich Euch. Ihr sollt an den Hof kommen. Ihr sollt alles haben, worum Ihr bittet. Lieber Gott, Elizabeth, lasst mich Euch haben, ich muss Euch haben. Von dem Augenblick an, da ich Euch hier sah …»
Er liegt auf mir, drückt mich zu Boden. Ich drehe den Kopf zur Seite, doch seine Lippen sind an meinem Hals, an meiner Brust. Ich keuche auf vor Verlangen, und dann wallt unerwartet ganz plötzlich Zorn in mir auf, als mir bewusstwird, dass er mich nicht mehr umarmt, sondern zwingt, mich zu Boden drückt, als wäre ich ein Flittchen, das es hinter einem Heuhaufen mit ihm treiben will. Er zieht mir das Kleid hoch, als wäre ich eine Hure, er zwängt mir das Knie zwischen die Beine, als hätte ich zugestimmt, und mein Zorn macht mich so stark, dass ich ihn noch einmal von mir stoße, und dabei ertaste ich an seinem breiten Ledergürtel das Heft seines Dolches.
Er hat mir das Kleid hochgezogen und nestelt an seiner Kniehose herum; im nächsten Augenblick wird es zu spät sein für Einwände. Ich ziehe seinen Dolch aus der Scheide. Bei dem Geräusch schießt er vor Schreck hoch auf die Knie, und ich entwinde mich ihm und springe auf, den Dolch in der Hand, dessen Klinge in den letzten Sonnenstrahlen gefährlich aufblitzt.
Im nächsten Augenblick steht er fest auf den Füßen, wachsam, ein Krieger. «Zieht Ihr die Klinge gegen Euren König?», zischt er. «Wisst Ihr, was Verrat ist, Madam?»
«Ich ziehe die Klinge gegen mich, allein gegen mich», sage ich schnell. Ich halte mir die scharfe Spitze an den Hals und sehe, wie sich seine Augen verengen. «Ich schwöre, wenn Ihr einen Schritt näher kommt, wenn Ihr nur einen Zoll näher kommt, schneide ich mir vor Euren Augen die Kehle durch und verblute hier auf dieser Erde, wo Ihr mich schänden wolltet.»
«Nichts als Theater!»
«Nein. Für mich ist das kein Spiel, Euer Gnaden. Ich kann nicht Eure Geliebte sein. Ich bin zu Euch gekommen, um Gerechtigkeit zu erbitten, und heute Abend bin ich aus Liebe gekommen. Das war dumm, und ich bitte Euch um Vergebung für meine Dummheit. Aber auch ich kann nicht schlafen, auch ich kann an nichts anderes denken als an Euch, auch ich habe mich immer wieder gefragt, ob Ihr wohl kommen würdet. Doch trotz allem … trotz allem solltet Ihr nicht …»
«Ich könnte Euch das Messer mit einem Griff abnehmen», droht er.
«Ihr vergesst, dass ich fünf Brüder habe. Seit meiner Kindheit habe ich mit Dolchen und Schwertern gespielt. Ich schneide mir die Kehle durch, bevor Ihr bei mir seid.»
«Das wagt Ihr nicht. Ihr seid eine Frau und habt nicht mehr Mut als jede andere Frau.»
«Stellt mich auf die Probe, na los. Ihr wisst nicht, wie viel Mut ich habe. Womöglich bedauert Ihr, was dann geschieht.»
Er zögert eine Sekunde, auf seinem Gesicht spiegelt sich eine gefährliche Mischung aus Zorn und Lust, und dann reißt er sich zusammen, hebt in einer Geste der Kapitulation die Hände und tritt zurück. «Ihr habt gewonnen», sagt er. «Ihr habt gewonnen, Madam. Und Ihr könnt den Dolch behalten, als Siegesbeute. Hier …» Er schnallt das Futteral ab und wirft es auf den Boden. «Nehmt auch das verdammte Futteral dazu, warum nicht?»
Die kostbaren Steine und das emaillierte Gold funkeln in der Dämmerung. Ohne den Blick vom König zu wenden, knie ich nieder und hebe es auf.
«Ich begleite Euch nach Hause», sagt er. «Ich sorge dafür, dass Ihr sicher nach Hause kommt.»
Ich schüttele den Kopf. «Nein. Man darf mich nicht mit Euch sehen. Niemand darf wissen, dass wir uns heimlich getroffen haben. Ich würde Schande über mich bringen.»
Einen Augenblick habe ich das Gefühl, er will mir widersprechen, doch dann neigt er zustimmend den Kopf. «Dann geht voraus», sagt er. «Und ich folge Euch wie ein Page, wie Euer Diener, bis ich sehe, dass Ihr sicher das Tor erreicht. Dann könnt Ihr in dem Triumph schwelgen, dass ich Euch folge wie ein Hund. Da Ihr mich wie einen Narren behandelt, werde ich Euch dienen wie ein Narr, und Ihr könnt Euch daran ergötzen.»
Es hat keinen Sinn, gegen seinen Zorn anzureden, und so nicke ich und wende mich um, um vorauszugehen, wie er es mir vorgeschlagen hat. Wir gehen schweigend. Ich kann hinter mir das Rascheln seines Umhangs hören. Als wir den Waldrand erreichen, wo man uns vom Haus aus sehen könnte, bleibe ich stehen und drehe mich zu ihm um. «Von hier an bin ich sicher», erkläre ich. «Ich muss Euch um Verzeihung bitten für meine Torheit.»
«Ich muss Euch um Verzeihung bitten für meine Grobheit», erwidert er steif. «Ich bin vielleicht zu sehr daran gewöhnt, meinen Willen durchzusetzen. Aber ich muss sagen, ich bin noch nie mit vorgehaltenem Dolch abgewiesen worden. Und obendrein noch mit meinem eigenen.»
Ich reiche ihm den Dolch mit dem Heft voran. «Möchtet Ihr ihn wiederhaben, Euer Gnaden?»
Er schüttelt den Kopf. «Behaltet ihn als Erinnerung an mich. Es wird mein einziges Geschenk an Euch sein. Ein Abschiedsgeschenk.»
«Werde ich Euch denn nicht wiedersehen?»
«Niemals», sagt er schlicht, verbeugt sich leicht und geht davon.
«Euer Gnaden!», rufe ich, und er bleibt stehen und dreht sich um.
«Ich möchte nicht im Bösen von Euch scheiden», sage ich zaghaft. «Ich hoffe, Ihr könnt mir verzeihen.»
«Ihr habt mich zum Narren gehalten», sagt er mit eisiger Stimme. «Ihr könnt Euch gratulieren: Ihr seid die erste Frau, der das gelungen ist. Aber Ihr werdet auch die letzte sein. Und Ihr werdet mich nie wieder zum Narren halten.»
Ich sinke in einen tiefen Knicks und höre, wie er sich abwendet und sein Umhang über die Sträucher am Pfad streift. Ich warte, bis seine Schritte verklungen sind, dann erhebe ich mich, um nach Hause zu gehen.
Ein Teil von mir möchte ins Haus laufen, sich aufs Bett werfen und in den Schlaf weinen – schließlich bin ich eine junge Frau.
Doch das tue ich nicht. Ich bin nicht wie meine Schwestern, die schnell lachen und schnell weinen. Ich bin vernünftiger als ein dummes Mädchen. Ich bin die Tochter einer Wassergöttin. In meinen Adern fließt Wasser, und meine Abstammung verleiht mir Macht. Ich lasse Dinge geschehen, und noch gebe ich mich nicht geschlagen, nicht von einem Jungen mit einer frisch erworbenen Krone. Kein Mann soll je von mir gehen in der Sicherheit, dass er nicht zu mir zurückkehrt.
Und so wende ich mich nicht gleich nach Hause. Ich nehme den Pfad zu der kleinen Brücke über den Fluss, dahin, wo meine Mutter einen Faden um die Esche geschlungen hat, und ich ziehe ihn ein weiteres Stück heraus und knote ihn fest, und erst dann gehe ich nach Hause, nachdenklich im fahlen Mondschein.
Dann warte ich. Vierundzwanzig Tage lang gehe ich jeden Abend hinunter zum Fluss und hole den Faden einen Fuß ein, wie eine geduldige Fischersfrau. Eines Abends spüre ich, wie der Faden sich spannt, als der Gegenstand am anderen Ende – was auch immer es ist – am Saum des Wassers im Schilf hängen bleibt. Ich ziehe vorsichtig, als wollte ich einen Fang einholen, und dann spüre ich, dass sich der Faden lockert und höre ein leises Klatschen, als etwas Kleines, aber Schweres ins Wasser fällt, sich in der Strömung dreht und dann langsam zwischen die Kiesel im Flussbett sinkt.
Ich gehe nach Hause. Meine Mutter wartet am Karpfenteich auf mich, betrachtet ihr Spiegelbild im Wasser, silbern im grauen Licht der Abenddämmerung. Es sieht aus wie ein langer, silberner Fisch, der durch den See plätschert, oder wie eine schwimmende Frau. Am Himmel über ihr ziehen Wolkenfetzen vorüber wie weiße Federn auf blasser Seide. Fahl steigt der Mond auf. Das Wasser steht hoch heute Abend, leckt an dem kleinen Kai. Als ich neben sie trete und ins Wasser hinunterschaue, könnte man denken, wir seien die Geister des Sees und stiegen aus dem Wasser.
«Tust du es jeden Abend?», fragt sie mich. «Den Faden einholen?»
«Ja.»
«Das ist gut. Hat er schon ein Geschenk geschickt? Eine Nachricht?»
«Ich erwarte nichts. Er hat gesagt, er wollte mich nie wiedersehen.»
Sie seufzt. «Ja, ja.»
Wir gehen zum Haus zurück. «Es heißt, er zieht in Northampton Truppen zusammen», erzählt sie. «König Henry versammelt seine Streitkräfte in Northumberland, er will nach Süden gen London marschieren. Königin Marguerite d’Anjou ist mit einer französischen Armee in Hull an Land gegangen, um zu ihm zu stoßen. Wenn König Henry gewinnt, wird es keine Rolle spielen, was Edward sagt oder denkt, denn er wird tot sein, und der wahre König wird wieder regieren.»
Fast als wollte sie ihr widersprechen, fliegt meine Hand hoch, um sie am Ärmel zu fassen. Rasch packt meine Mutter meine Finger. «Was ist denn? Erträgst du es nicht, mich von seiner Niederlage reden zu hören?»
«Sag das nicht.»
«Was soll ich nicht sagen?»
«Ich ertrage es nicht, von seiner Niederlage reden zu hören. Ich ertrage die Vorstellung nicht, er könnte tot sein. Er hat mich als Soldat, der womöglich in den Tod geht, gebeten, bei ihm zu liegen.»
Sie stößt ein spitzes Lachen aus. «Natürlich hat er das. Welcher Mann, der in den Krieg zieht, hat je der Versuchung widerstanden, alles herauszuholen?»
«Ich habe mich geweigert. Und wenn er nicht zurückkommt, werde ich das für den Rest meines Lebens bedauern. Ich bedaure es jetzt schon. Ich werde es immer bedauern.»
«Warum bedauern?», verspottet sie mich. «Du bekommst dein Land so oder so zurück. Entweder erhältst du es auf Befehl von König Edward wieder, oder er stirbt, und König Henry ist König und gibt dir dein Land zurück. Er ist unser König, aus dem wahren Hause Lancaster. Ich dachte, wir wünschen ihm den Sieg und unserem Usurpator Edward den Tod.»
«Sag das nicht», wiederhole ich. «Wünsch ihm nichts Böses.»
«Egal, was ich sage, du musst gründlich nachdenken», rät sie mir schroff. «Du bist eine junge Frau aus dem Hause Lancaster. Du kannst dich nur in den Erben des Hauses York verlieben, wenn er der siegreiche König ist und in der Liebe für dich ein Vorteil liegt. Es sind harte Zeiten, in denen wir leben. Der Tod ist stets unser Gefährte, unser Vertrauter. Du brauchst dir nicht einzubilden, du könntest ihn dir auf Armeslänge vom Leib halten. Du wirst feststellen, dass er dir enge Gesellschaft leistet. Er hat dir deinen Gemahl genommen, hörst du? Er wird dir auch deinen Vater und deine Brüder und deine Söhne rauben.»
Ich strecke beide Hände aus, um sie am Weiterreden zu hindern. «Du klingst wie Melusine, die ihre Familie vor dem Tod der Männer warnt.»