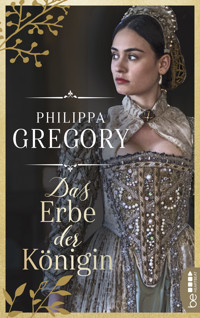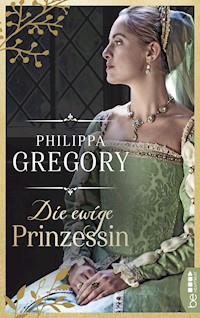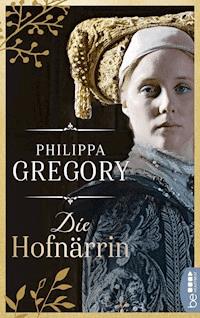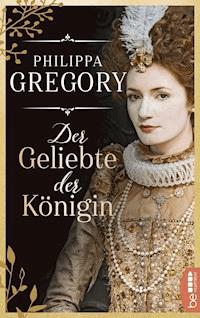
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane der New York Times Bestseller Autorin
- Sprache: Deutsch
Eine junge Königin zwischen der Pflicht zu ihrem Land und einer verbotenen Liebe
England, Herbst 1558: Elisabeth I. besteigt den Thron. Die jungfräuliche Königin wird von allen Seiten bedrängt, endlich zu heiraten. Doch es gibt nur einen Mann, den Elisabeth begehrt: ihren Jugendfreund Robert Dudley. Sir Robert ist allerdings bereits verheiratet - und ein verurteilter Verräter dazu. Keine guten Aussichten für das Verhältnis der beiden.
Inmitten der Intrigen, die um sie gesponnen werden, entwickelt sich schließlich für Elisabeth, Robert und das aufstrebende Königreich alles anders als geplant ...
Ein historischer Roman aus der Plantagenet und Tudor-Reihe von Bestsellerautorin Philippa Gregory. Ebenfalls bei beHEARTBEAT lieferbar: "Die Hofnärrin".
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 773
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungHerbst 1558Ein Jahr zuvor: Sommer 1557Winter 1558Sommer 1558Herbst 1558Winter 1558/1559Frühling 1559Sommer 1559Herbst 1559Winter 1559–1560Frühling 1560Sommer 1560Nachwort der AutorinAnmerkung der AutorinAnmerkung der ÜbersetzerinÜber dieses Buch
Eine junge Königin zwischen der Pflicht zu ihrem Land und einer verbotenen Liebe
England, Herbst 1558: Elisabeth I. besteigt den Thron. Die jungfräuliche Königin wird von allen Seiten bedrängt, endlich zu heiraten. Doch es gibt nur einen Mann, den Elisabeth begehrt: ihren Jugendfreund Robert Dudley. Sir Robert ist allerdings bereits verheiratet – und ein verurteilter Verräter dazu. Keine guten Aussichten für das Verhältnis der beiden.
Inmitten der Intrigen, die um sie gesponnen werden, entwickelt sich schließlich für Elisabeth, Robert und das aufstrebende Königreich alles anders als geplant …
Über die Autorin
Philippa Gregory, 1954 in Kenia geboren, studierte Geschichte in Brighton und promovierte an der Universität Edinburgh über englische Literatur des 18. Jahrhunderts. Sie arbeitete als Journalistin und Produzentin für Fernsehen und Radio und verfasste Kinderbücher, Kurzgeschichten, Reiseberichte sowie Drehbücher. Bekannt ist sie aber vor allem für ihre historischen Romane, darunter die Titel der Plantagenet und Tudor Reihe, in denen insbesondere die Rosenkriege und das elisabethanische Zeitalter thematisiert werden. Philippa Gregory lebt mit ihrer Familie in Nordengland. Homepage der Autorin: http://www.philippagregory.com.
PHILIPPA GREGORY
DerGeliebte derKönigin
Aus dem britischen Englisch von Barbara Först
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007, 2011 by Philippa Gregory
Titel der englischen Originalausgabe: »The Virgin’s Lover«
Originalverlag: HarperCollins Publishers Ltd., London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Andrea Kalbe
Covergestaltung: © Maria Seidel, atelier-seidel.de
Illustration: © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5286-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Anthony
Herbst 1558
Alle Glocken in Norfolk erklangen für Elisabeth. Ihr Geläut dröhnte in Amys Kopf. Zuerst kreischte die Sopranglocke wie ein dem Wahnsinn verfallenes Weib, dessen Aufschrei in einen lang gezogenen, misstönenden Seufzer überging, dann ertönte die große Glocke und warnte die Zuhörer, dass nun die Wiederholung des dissonanten Glockenspieles bevorstand. Amy zog sich das Kissen über den Kopf, um das Geläut nicht zu hören, doch es dauerte an, bis die Krähen ihre Nester verließen und sich wie ein Banner des bösen Omens gen Himmel schwangen. Und die Fledermäuse brachen als schwarze Rauchwolke aus dem Glockenturm hervor, wie eine Verkündigung, dass die Welt nun auf den Kopf gestellt sei, der Tag sich in ewige Nacht verwandelt habe.
Amy fragte sich gar nicht erst, was der Aufruhr zu bedeuten habe; sie wusste es bereits. Der Todeskampf der armen kranken Königin Maria war nun beendet, Prinzessin Elisabeth die unangefochtene Thronerbin. Lobet den Herrn! Ganz England musste in einen Freudentaumel verfallen. Die protestantische Prinzessin hatte den Thron geerbt und war Englands zukünftige Königin. Im ganzen Land würden die Menschen die Glocken läuten, mit ihren Bierhumpen anstoßen, auf den Straßen tanzen und die Kerker stürmen. Endlich hatte England seine Elisabeth bekommen. Die von Angst überschattete Herrschaft Königin Marias konnte vergessen werden. Ganz England feierte.
Ganz England – nur Amy nicht.
Das jubelnde Glockengeläut weckte in ihr keine Freude. Als einziger Mensch in England konnte Amy sich nicht an Elisabeths Thronbesteigung freuen. Für sie klangen die Glocken nicht rein, sondern wie ein Schrei der Wut, wie das Schluchzen einer verlassenen Frau.
»Gottes Schlag soll sie treffen!«, murmelte sie in ihr Kissen hinein, während ihr Kopf von den Glockenschlägen dröhnte. »Gottes Schlag soll sie treffen, in ihrer Jugend und ihrem Stolz und ihrer Schönheit. Gott möge ihre Züge verwüsten, ihr Haar lichten und ihre Zähne verfaulen lassen, auf dass sie einsam und verlassen sterbe! Einsam und verlassen, so wie ich.«
Amy war ohne Nachricht von ihrem Ehemann, doch sie erwartete auch keine. Ein weiterer Tag verging, nun war er eine volle Woche fort. Sie nahm an, dass er sogleich nach der Bekanntgabe vom Tod der Königin Maria in halsbrecherischem Tempo von London zum Schloss Hatfield geritten war, da er gewiss zu den Ersten zählen wollte, die vor der Prinzessin das Knie beugten und ihr mitteilten, dass sie nun Königin sei.
Amy war überzeugt davon, dass Elisabeth bereits eine Rede vorbereitet und eine Pose einstudiert hatte, während Robert mit einer Belohnung für seine Treue zur Prinzessin rechnete. Vielleicht feierten beide bereits gemeinsam ihren Aufstieg in die höchsten Positionen. Amy hingegen befand sich auf dem Weg zum Fluss, um die Kühe zum Melken in den Stall zu treiben, weil der Hütejunge krank war und es nicht genügend Bedienstete auf Stanfield Hall gab, dem Hof ihrer Familie. Sie hielt an und starrte auf die braunen Blätter, die von einer Eiche herabfielen und wie Schnee umherwirbelten: Wie ihr Ehemann flogen sie in südwestlicher Richtung nach Hatfield.
Im Grunde sollte sie sich freuen, weil nun eine Königin auf den Thron kam, die ihren Mann zum Günstling erheben würde. Um ihrer Familie willen sollte sie froh sein, denn dank Robert würde sich ihre Stellung verbessern. Als Lady Dudley würde sie einmal mehr den Kopf hochtragen können: Sie würde ihre Ländereien zurückerhalten, einen Platz bei Hofe einnehmen, vielleicht sogar zur Gräfin erhoben werden.
Doch Amy war nicht froh. Ihr wäre es lieber gewesen, Robert als verurteilten Verräter an ihrer Seite zu wissen und mit ihm die Mühen des Alltags und die warme Stille der Nächte zu teilen – lieber das, als mit einem Manne verheiratet zu sein, der von der Gunst einer anderen Frau geadelt wurde. Amy wusste: Dies war Eifersucht – und Eifersucht war eine Sünde vor Gott.
Sie ließ den Kopf hängen und wanderte mit schleppenden Schritten zu den Weiden, auf denen die Kühe das spärliche Gras abfraßen und mit ihren Hufen braune Erde und Kiesel aufwühlten.
»Wie konnte es nur so weit kommen?«, flüsterte sie zum stürmischen Himmel gewandt, an dem sich ein drohendes Wolkenschloss zusammenballte. »Wenn ich ihn doch so liebe und er mich! Wenn wir füreinander alles sind! Wie kann er mich hier allein lassen und zu ihr reiten? Warum hat alles so gut begonnen, in Reichtum und Herrlichkeit, um so einsam und quälend zu enden?«
Ein Jahr zuvor: Sommer 1557
Im Traum sah er wieder einmal die rohen Dielen des leeren Zimmers, den Kaminsims aus Sandstein, in den ihre Namen eingekerbt waren, und das bleigefasste Fenster hoch oben in der steinernen Mauer. Nachdem sie den großen Tisch zum Fenster geschoben und hinaufgeklettert waren, spähten die fünf jungen Männer nach unten auf den Rasen, wo ihr Vater langsam auf das Schafott zuschritt und die Stufen hinaufstieg.
Ein Priester der kürzlich wieder eingeführten römisch-katholischen Kirche begleitete ihn. Der Vater hatte seine Sünden bereut und seinen Glauben widerrufen. Er hatte Vergebung erfleht und sich feige entschuldigt. Er hatte alle Wahrhaftigkeit aufgegeben, um der winzigen Möglichkeit der Vergebung willen. Nun wandte er ängstlich den Kopf, um in die Gesichter der Versammelten zu spähen, hoffte selbst in diesem späten Moment noch auf einen Boten, der die Nachricht seiner Begnadigung überbringen würde.
Und er hatte allen Grund zu hoffen. Die neue Herrscherin war eine Tudor, und die Tudors wussten um die Macht des schönen Scheins. Die Königin war eine tiefgläubige Frau und würde einen reuigen Sünder gewiss nicht verdammen. Doch vor allem anderen war sie ein Weib, ein weichherziges, starrsinniges Weib. Sie würde niemals den Mut haben, einen so mächtigen Mann hinrichten zu lassen, sie würde ihren Beschluss keinesfalls ausführen.
Steht auf, Vater, drängte Robert stumm. Die Begnadigung muss jeden Moment eintreffen. Erniedrigt Euch nicht, indem Ihr darum bettelt.
Die Tür in Roberts Rücken ging auf. Der Kerkermeister trat ein und stieß ein heiseres Lachen aus, als er die fünf jungen Männer am Fenster sah, mit den Händen ihre Augen vor der grellen Sommersonne schützend. »Spring nicht«, scherzte er. »Bringt den Henker nicht um seine Arbeit, meine hübschen Knaben. Ihr seid die Nächsten, und dann kommt die hübsche Maid an die Reihe.«
»Das vergesse ich dir nicht. Warte nur, bis unsere Begnadigung kommt und wir freigelassen werden«, versprach Robert und wandte sich wieder dem Hof zu. Der Kerkermeister prüfte die Eisenstangen vor dem Fenster, und nachdem er sich überzeugt hatte, dass die jungen Männer kein Werkzeug hatten, mit dem sie das Glas zertrümmern konnten, entfernte er sich immer noch lachend und schloss die Kerkertür hinter sich ab.
Unten im Hof stieg der Priester zu dem Verurteilten auf das Schafott und las ihm Gebete aus seiner lateinischen Bibel vor. Der Wind fuhr in sein weites Messgewand und bauschte es wie die Segel einer feindlichen Flotte. Abrupt brach der Priester ab, hielt dem Mann ein Kruzifix zum Kuss entgegen und trat einen Schritt zurück.
Plötzlich spürte Robert die Eiseskälte der Scheibe, gegen die er Stirn und Hände presste. Es war, als würde seinem Körper durch das Schauspiel, das er mit ansehen musste, alle Wärme entzogen. Demütig kniete sein Vater vor dem Richtblock nieder. Der Henker trat vor und verband ihm die Augen, während er auf ihn einredete. Der Verurteilte wandte ihm den Kopf mit der Augenbinde zu. Dann schien es, als hätte die Bewegung ihn schrecklich verwirrt. Seine Hände fuhren ziellos herum, fanden den Richtblock nicht mehr, auf dem sie zuvor geruht hatten. Der Henker hatte sich umgedreht, um seine Axt aufzuheben, und als er sich dem Verurteilten wieder zuwandte, fiel dieser fast vom Schafott.
Erschrocken entfuhr dem Scharfrichter unter seiner Kapuze ein Fluch, doch Roberts Vater zerrte an seiner Augenbinde und schrie, dass er noch nicht bereit sei, dass er erst den Block wiederfinden müsse, dass der Henker warten solle.
»Schweigt!«, brüllte Robert und trommelte gegen die dicke Glasscheibe. »Vater, seid still! Um Gottes willen, seid doch still!«
»Warte!«, kreischte die kleine Gestalt auf dem Schafott an den wartenden Henker gewandt. »Ich kann den Block nicht finden! Ich bin noch nicht bereit! Noch nicht! Noch nicht!!«
Mit ausgestreckter Hand kroch er auf dem Stroh herum und tastete nach dem Block, während die andere Hand an der Augenbinde zerrte. »Rühr mich nicht an! Sie wird mir vergeben! Ich bin noch nicht bereit!«, schrie er – und schrie noch, als der Henker das Beil schwang und die Klinge in seinen bloßgelegten Nacken eindrang. Blut schoss in einem Schwall hervor. Der Schlag war so hart gewesen, dass der Mann auf die Seite geworfen wurde.
»Vater!«, rief Robert. »Mein Vater!«
Das Blut strömte weiter aus der Wunde, doch immer noch kroch der Verurteilte wie ein sterbendes Schwein im Stroh herum, immer noch versuchte er auf die Beine zu kommen in Stiefeln, die keinen Halt fanden, immer noch tastete er blindlings mit taub werdenden Händen nach dem Block. Der Scharfrichter verfluchte seine Ungeschicklichkeit und hob erneut die Axt.
»Vater!«, schrie Robert verzweifelt, als sie herabsauste. »Vater!«
»Robert? Mylord?« Da war eine Hand, die ihn sanft schüttelte. Er schlug die Augen auf, und da war Amy, die braunen Haare für die Nacht zu Zöpfen geflochten, die braunen Augen weit aufgerissen: die Wirklichkeit im Kerzenschein des Schlafgemachs.
»Meine Güte! Welch ein Albtraum! Gott bewahre mich! Gott bewahre mich davor.«
»War es wieder der gleiche Traum?«, fragte Amy. »Der Traum vom Tode Eures Vaters?«
Er konnte nicht einmal die bloße Erwähnung ertragen. »Nur ein Traum«, erwiderte er kurz angebunden und versuchte, wieder klaren Sinnes zu werden. »Nur ein furchtbarer Traum.«
»Aber war es der gleiche Traum?« Sie blieb hartnäckig.
Robert zuckte die Achseln. »Ist kaum überraschend, dass er mich immer wieder heimsucht. Haben wir Bier da?«
Amy schlug die Bettdecke zurück und stand auf, raffte ihr Nachtgewand um die Schultern. Doch sie ließ sich nicht von ihrem Thema abbringen. »Es ist ein böses Vorzeichen«, sagte sie geradeheraus, während sie einen Becher Bier einschenkte. »Soll ich es erwärmen?«
»Ich trinke es kalt«, sagte Robert.
Amy reichte ihrem Mann den Becher, und er stürzte das Bier herunter. Im Rücken fühlte er den Angstschweiß des Albtraums trocknen, und er schämte sich seiner Schwäche.
»Es ist eine Warnung«, beharrte sie.
Robert versuchte zwar, es mit einem sorglosen Lächeln abzutun, aber das Grauen über seines Vaters Tod, sein eigenes Versagen und die Trauer, die sich seit jenem schwarzen Tag an seine Fersen geheftet hatte, drohten ihn zu überwältigen. »Sagt das nicht.«
»Ihr solltet morgen nicht reisen.«
Robert nahm noch einen Schluck Bier, senkte sein Gesicht in den Becher, um ihrem anklagenden Blick zu entgehen.
»Ein böser Traum wie dieser ist eine Warnung. Ihr solltet König Philipp nicht begleiten.«
»Das haben wir doch bereits tausend Mal besprochen. Ihr wisst, dass ich gehen muss.«
»Aber nicht jetzt! Nicht, nachdem Ihr von Eures Vaters Tod geträumt habt. Dies kann nur eine Warnung sein, Euch nicht zu überschätzen! Er starb den Tod des Verräters, nachdem er versucht hatte, seinen Sohn auf den englischen Thron zu setzen. Nun maßt auch Ihr Euch zu viel an!«
Robert versuchte zu lächeln. »Nicht gar so viel«, meinte er. »Mir sind nur mein Pferd und mein Bruder geblieben. Ich könnte nicht einmal mein eigenes Bataillon aufstellen.«
»Euer Vater warnt Euch persönlich aus dem Grab heraus!«
Müde schüttelte er den Kopf. »Amy, dies ist zu schmerzlich. Erwähnt ihn bitte nicht. Ihr habt meinen Vater nicht gekannt. Er hätte gewollt, dass ich die Dudleys wieder zu Ehren und Würden bringe. Er hätte mein Vorhaben niemals angezweifelt. Er strebte immer nur nach unserem Aufstieg. Seid mir eine gute Ehefrau, Amy, Liebste. Nehmt mir nicht den Mut – er hätte es auch nicht getan.«
»Dann seid mir ein guter Ehemann!«, gab sie zurück. »Und verlasst mich nicht! Wohin soll ich denn gehen, wenn Ihr in die Niederlande segelt? Was soll aus mir werden?«
»Ihr werdet zu den Philips’ in Chichester gehen, wie besprochen«, sagte Robert ruhig. »Und wenn der Feldzug dauert und ich nicht bald wiederkehre, dann werdet Ihr nach Hause gehen, zu Eurer Stiefmutter auf Stanfield Hall.«
»Ich will mein eigenes Haus in Syderstone wiederhaben«, sagte Amy. »Ich will mit Euch ein Heim haben. Ich will mit Euch leben, als Eure Frau.«
Robert knirschte mit den Zähnen; selbst nach zwei Jahren hatte er sich noch nicht an seine beschämenden Lebensumstände gewöhnt. »Ihr wisst, dass die Krone Syderstone Hall annektiert hat. Ihr wisst, dass kein Geld da ist. Ihr wisst, dass wir es nicht können.«
»Wir könnten meine Stiefmutter bitten, dass sie Syderstone für uns von der Krone pachtet«, beharrte Amy. »Wir könnten das Land bebauen. Ihr wisst, dass ich arbeiten kann. Ich scheue mich nicht vor harter Arbeit. Ihr wisst, dass wir auch durch harte Arbeit wieder emporkommen würden, wir brauchen keinen ausländischen König und dessen Ambitionen. Es lohnt nicht, sich in Gefahr zu begeben, wenn der Lohn ungewiss ist!«
»Ich weiß, dass Ihr arbeiten würdet«, gestand Robert ihr zu. »Ich weiß, dass Ihr Euch bei Anbruch der Dämmerung erheben und vor Sonnenaufgang auf dem Feld sein würdet. Aber ich will nicht, dass meine Frau wie eine Bäuerin arbeitet. Ich bin zu Größerem geboren, und ich habe Eurem Vater ein besseres Leben für Euch versprochen. Ich will nicht ein halbes Dutzend Morgen Ackerland und eine Kuh, ich will die Hälfte Englands.«
»Man wird glauben, Ihr hättet mich verlassen, weil Ihr mich satt habt«, sagte Amy vorwurfsvoll. »Alle würden das glauben. Eben erst seid Ihr heimgekehrt und nun wollt Ihr mich schon wieder verlassen!«
»Ich bin doch zwei Jahre zu Hause gewesen!«, rief er aus. »Zwei ganze Jahre!« Er besann sich, versuchte die Gereiztheit aus seiner Stimme zu verbannen. »Vergebt mir, Amy, aber dies ist kein Leben für mich. Als verurteilter Verräter darf ich nichts besitzen, darf keinen Handel treiben. Alles, was meine Familie besessen hat, ist von der Krone eingezogen worden, und ebenso Euer gesamter Besitz: das Erbe Eures Vaters, das Vermögen Eurer Mutter. Alles, was Ihr besaßet, habe ich verloren. Es ist meine Pflicht, Euch den Verlust zu erstatten. Es ist meine Pflicht, uns beiden den Verlust zu erstatten.«
»Doch nicht um diesen Preis«, erklärte Amy kategorisch. »Immer sagt Ihr, dass Ihr es für uns tut. Doch ich will das nicht, für mich ist es nicht gut. Ich will, dass Ihr daheim seid, an meiner Seite, mir ist es gleich, was wir besitzen. Mir ist es gleich, ob wir bei meiner Stiefmutter leben müssen und von ihrer Mildtätigkeit abhängig sind. Mir ist alles gleich, solange wir beisammen sind und es Euch gut geht.«
»Amy, ich kann nicht von der Mildtätigkeit dieser Frau leben. Dieser Schuh drückt mit jedem Tag mehr. Als Ihr mich geheiratet habt, war ich der Sohn des mächtigsten Mannes in England. Wir hegten den Plan, dass mein Bruder König werden sollte und Jane Grey Königin, und wir haben unser Ziel nur knapp verfehlt. Ich hätte zur englischen Königsdynastie gehört. Dafür habe ich gekämpft, dafür hätte ich mein Leben gegeben. Und es hätte gelingen können. Unser Anspruch auf den Thron war ebenso legitim wie der der Tudors, die vor nur drei Generationen das Gleiche getan hatten. Die Dudleys hätten die nächste Herrscherfamilie Englands sein können. Und obwohl wir versagt haben und besiegt wurden …«
»Und gedemütigt«, fügte Amy hinzu.
»In den Staub geworfen«, stimmte er zu. »Doch ich bin immer noch ein Dudley. Ich wurde für die Macht geboren, und ich erhebe Anspruch darauf. Ich wurde geboren, um meiner Familie und meinem Land zu dienen. Ihr wollt doch keinen Bauern mit hundert Morgen Land zum Mann? Ihr wollt doch keinen Mann, der den lieben langen Tag am Ofen sitzt?!«
»Doch, das will ich«, beharrte Amy. »Ihr versteht mich nicht, Robert. Ein kleiner Bauer mit hundert Morgen Land trägt zu einem besseren England bei als jeder Höfling, der alles tut, um bei Hofe aufzusteigen!«
Fast hätte er laut gelacht. »Damit mögt Ihr Euch zufriedengeben. Aber so ein Mann war ich nie. Nicht einmal eine Niederlage, nicht einmal Todesfurcht könnte mich dazu machen. Ich wurde geboren und erzogen, um einer der Mächtigsten des Landes zu sein, wenn nicht gar der Mächtigste! Ich wurde zusammen mit den Kindern des Königs erzogen – ich kann nicht in einem Sumpf in Norfolk vermodern! Ich muss meinen Namen reinwaschen, ich muss von König Philipp ausgezeichnet, von Königin Maria wieder anerkannt werden. Ich muss mir meine Würde wieder erkämpfen.«
»Ihr werdet in der Schlacht fallen – und was dann?«
Robert blinzelte. »Liebste, dies zu sagen, bedeutet einen Fluch, und das in unserer letzten gemeinsamen Nacht. Morgen gehe ich an Bord, da mögt Ihr sagen, was Ihr wollt. Also wünscht mir nichts Schlechtes!«
»Aber Euer Traum!« Amy kletterte auf das Bett und nahm ihm den leeren Becher ab. Sie stellte ihn nieder, nahm Roberts Hände zwischen ihre, als wäre er ein Kind, das sie lehren müsste. »Mylord, der Traum bedeutet eine Warnung. Und nun mahne ich Euch. Fahrt nicht!«
»Ich muss«, gab er gleichmütig zurück. »Lieber würde ich mit meinem Tod meinen Namen reinwaschen, als dieses elende Leben zu fristen: als verurteilter Verräter aus einer entehrten Familie, in einem England unter Marias Herrschaft.«
»Ach? Wäre Euch Elisabeth als Königin lieber?«, schleuderte sie ihm zischend entgegen. Bejahte er die Frage, so war dies Hochverrat.
»Von ganzem Herzen!«, erwiderte Robert wahrheitsgemäß.
Da ließ Amy seine Hände los, blies ohne ein weiteres Wort die Kerze aus, zog sich die Decke über die Schultern und drehte Robert den Rücken zu. Schlaflos lagen beide und starrten in die Dunkelheit.
»Aber dies wird nie geschehen«, brach Amy schließlich das Schweigen. »Sie wird den Thron nie erhalten. Morgen schon kann die Königin ein zweites Kind empfangen, den Sohn Philipps von Spanien, einen Knaben, der Kaiser von Spanien und König von England sein wird, und sie wird nur eine Prinzessin sein, die niemand will oder braucht. Sie wird an einen ausländischen Prinzen verheiratet und für immer vergessen werden.«
»Oder nicht«, gab er zu bedenken. »Maria kann auch ohne Nachkommen sterben. Dann wird meine Prinzessin Elisabeth Königin von England, und sie wird mich nicht vergessen.«
Am Morgen schwieg Amy beharrlich. Schweigend nahmen sie ihr Frühstück im Schankraum des Gasthofes ein, in dem sie Quartier genommen hatten. Dann begab sich Amy nach oben in das Zimmer, um für ihren Mann zu packen. Robert rief hinauf, dass er sie am Kai treffen würde, und trat auf die lärmende, geschäftige Straße hinaus.
Die Stadt Dover, die König Philipp als Hafen für seine Fahrt gegen die Niederlande gewählt hatte, war ein Chaos. Händler boten alle möglichen Speisen und Waren an und bellten ihre Preise in die Menge. Weise Frauen priesen den Wert ihrer Bannsprüche und Amulette für die scheidenden Soldaten. Höker mit Bauchläden boten billigen Schmuck als Abschiedsgeschenk in letzter Minute, am Straßenrand hatten Barbiere und Zahnzieher alle Hände voll zu tun, und manche Männer ließen sich aus Angst vor Läusen die Köpfe nahezu kahl scheren. Ein paar Priester hatten sogar behelfsmäßige Beichtstühle eingerichtet, damit die Soldaten ohne schuldbeladenes Gewissen in den Krieg ziehen konnten, und mitten in der Menge betätigten sich Dutzende von Huren, die vor Lachen kreischten und alle möglichen schnellen Vergnügungen versprachen.
Am Kai drängten sich Frauen, um ihren Ehemännern und Liebsten Lebewohl zu sagen, gefährlich schwankende Karren und Kanonen wurden über die Relings gehoben und auf den kleinen Schiffen verstaut, scheuende und tänzelnde Pferde wurden von fluchenden Hafenarbeitern über die Planken geschoben, während vorn die Pferdeknechte an den Halftern zerrten. Als Robert aus der Tür des Gasthofes trat, legte ihm sein junger Bruder die Hand auf den Arm.
»Henry! Gut abgepasst!«, rief Robert erfreut und schloss den Vierzehnjährigen in seine Arme. »Ich habe mich schon gefragt, ob wir uns womöglich verpassen. Ich hatte dich bereits gestern Abend erwartet!«
»Ich bin aufgehalten worden. Ambrose wollte mich nicht reiten lassen, bevor das Pferd frisch beschlagen war. Du weißt ja, wie er ist. Aus heiterem Himmel wird er zum höchst autoritären älteren Bruder, und ich musste schwören, dass ich gut auf mich achtgebe und dich aus allen Gefahren heraushalte.«
Robert lachte. »Da wünsch ich dir viel Glück.«
»Ich bin heute Morgen angekommen und habe schon überall nach dir gesucht.« Henry trat einen Schritt zurück und betrachtete aufmerksam die dunklen attraktiven Züge seines älteren Bruders. Robert war erst dreiundzwanzig und ungemein anziehend, doch früher war er als verwöhnter Sprössling einer reichen Familie verweichlicht gewesen. Diesen Nachteil hatte das durchgemachte Leid wettgemacht. Nun war Robert rank und schlank und machte den Eindruck eines Mannes, mit dem nicht zu spaßen war. Er grinste Henry an, und die Gespanntheit seiner Züge löste sich in der Wärme seines Lächelns. »Mein Gott! Ich freue mich ja so, dich zu sehen, mein Junge! Welch ein Abenteuer, das uns erwartet!«
»Der Hofstaat ist bereits eingetroffen«, teilte Henry ihm mit. »König Philipp ist schon an Bord gegangen, und die Königin ist hier, und auch die Prinzessin.«
»Elisabeth? Sie ist hier? Hast du mit ihr gesprochen?«
»Sie sind auf dem neuen Schiff, auf der Philip and Mary«, erwiderte Henry. »Die Königin blickt äußerst erzürnt drein.«
Dudley lachte. »Elisabeth ist demnach fröhlich?«
»Fröhlich wie eine Heumacherin angesichts der Sorge ihrer Schwester«, gab Henry aufgekratzt zurück. »Stimmt es, dass sie König Philipps Geliebte ist?«
»Niemals«, erwiderte Dudley mit der Gewissheit eines Freundes, der die Prinzessin von Kindesbeinen an kannte. »Aber sie lässt ihn nach ihrer Pfeife tanzen, weil er ihre Sicherheit garantiert. Der halbe Kronrat der Königin würde ihr liebend gern den Kopf abschlagen lassen, wenn sie nicht beim König in Gunst stünde. Sie lässt sich von der Liebe nicht zu Dummheiten hinreißen. Sie benutzt Philipp, lässt aber nicht zu, dass er sie benutzt. Sie ist ein Prachtmädel. Ich würde sie gern sehen, wenn sich die Gelegenheit ergibt.«
»Sie hat schon immer eine Schwäche für dich gehabt«, sagte Henry grinsend. »Wirst du sogar den König ausstechen?«
»Nicht, solange ich ihr nichts zu bieten habe«, gestand Robert. »Sie ist ein berechnendes Weib, und Gott segne sie dafür. Können wir jetzt mit dem Einladen beginnen?«
»Mein Pferd ist schon an Bord«, sagte Henry. »Ich wollte mich nun um deines kümmern.«
»Wir holen es gemeinsam«, meinte Robert. Die beiden schritten unter einem steinernen Torbogen in den Hof des Gasthauses, in dessen Stall Roberts Pferd untergebracht war.
»Wann hast du sie zuletzt gesehen? Die Prinzessin?«, fragte Henry.
»Als ich noch in meiner vollen Pracht erstrahlte und sie desgleichen.« Robert lächelte wehmütig. »Es muss das letzte Weihnachtsfest bei Hofe gewesen sein. Als König Eduard im Sterben lag und unser Vater der eigentliche, heimliche König Englands war. Elisabeth war die protestantische Prinzessin und die Lieblingsschwester des Königs. Wir waren wie Zwillinge auf der Woge unseres Triumphes, und von Maria war nichts zu hören und nichts zu sehen. Weißt du noch?«
Henry runzelte die Stirn. »Ich kann mich nur schwach erinnern. Du weißt ja, ich konnte die Intrigen bei Hofe nie so richtig einschätzen.«
»Du hättest es gelernt«, sagte Robert trocken. »In unserer damaligen Familie hättest du es lernen müssen.«
»Ich weiß noch, dass sie unter Anklage des Hochverrats in den Tower gesperrt wurde, während wir auch dort einsaßen«, erinnerte sich Henry.
»Wie ich mich gefreut habe, als ich erfuhr, dass sie freigelassen worden war!«, meinte Robert. »Elisabeth hatte immer ein verteufeltes Glück!«
Das mächtige schwarze Pferd wieherte beim Anblick seines Herrn. Er streichelte seine Nase. »Nun komm, mein Schöner«, sagte er leise. »Komm, First Step.«
»Wie nennst du ihn?«, fragte Henry.
»First Step«, erwiderte Robert. »Als wir aus dem Tower entlassen wurden, als ich wieder zu Amy kam und wie ein Bettler im Hause ihrer Stiefmutter leben musste, sagte diese zu mir, dass ich kein Pferd kaufen und auch keines der ihren leihen dürfe.«
Henry stieß einen leisen Pfiff aus. »Ich habe Stanfield immer für ein freigiebiges Haus gehalten.«
»Nicht für einen Schwiegersohn, der als verurteilter Verräter heimkehrt«, sagte Robert kummervoll. »Mir blieb nichts anderes übrig, als in Reitstiefeln auf einen Rossmarkt zu gehen. Dort habe ich ihn mittels einer Wette gewonnen und First Step genannt. Er ist mein erster Schritt auf dem Weg zu dem mir rechtmäßig zustehenden Platz.«
»Und dieser Feldzug ist unser nächster Schritt«, fuhr Henry fröhlich fort.
Robert nickte. »Wenn wir in König Philipps Gunst steigen, können wir an den Hof zurückkehren. Einem Mann, welcher der spanischen Krone hilft, die Niederlande zu behalten, wird alles vergeben werden.«
»Dudley! Ein Dudley!«, stieß Henry den Schlachtruf der Familie aus und öffnete die Boxentür.
Sie führten das nervöse Tier über die kopfsteingepflasterten Straßen zum Kai und warteten in einer Reihe mit anderen Männern, die Pferde an Bord brachten. Kleine Wellen leckten an der Mole, und First Step blähte seine Nüstern und tänzelte unruhig auf der Stelle. Als er über den Steg gehen sollte, setzte er gehorsam einen Huf auf die Planke, blieb dann jedoch stocksteif stehen.
Hinter ihnen tauchte ein Hafenarbeiter mit erhobener Peitsche auf.
»Wage es nicht!«, fuhr Robert ihn mit lauter Stimme an.
»Ich sag Euch, ohne geht er nicht«, murrte der Mann.
Robert kehrte dem Pferd den Rücken zu, ließ die Zügel fallen und ging voraus in die Dunkelheit des Laderaums. Unruhig tänzelte das Tier auf der Stelle, seine Ohren gingen vor und zurück, mit hoch erhobenem Kopf hielt es Ausschau nach seinem Herrn. Da ertönte Roberts Pfiff aus dem Bauch des Schiffes, und das Pferd spitzte die Ohren und schritt vertrauensvoll vorwärts.
Nachdem Robert sein Pferd getätschelt und angebunden hatte, tauchte er aus dem Laderaum auf und erblickte Amy mit seinem Gepäck auf dem Kai. »Alles geladen und getakelt«, sagte er fröhlich, nahm ihre kleine kalte Hand und drückte sie an seine Lippen. »Vergebt mir«, sagte er leise. »Ich war von meinem Traum verstört und daher reizbar. Lasst uns nicht mehr streiten, sondern in Freundschaft scheiden.«
Tränen standen in Amys braunen Augen. »Oh Robert, bitte fahrt nicht!«, stieß sie hervor.
»Nun, nun, Amy«, sagte er entschlossen. »Ihr wisst, dass ich fahren muss. Während ich fort bin, werde ich Euch meinen ganzen Sold schicken, und ich erwarte, dass Ihr ihn weise anlegt und Euch nach einem Landgut umschaut, das wir kaufen können. Wir müssen wieder zu Ansehen kommen, Weib, und ich zähle auf Euch, dass Ihr unser Vermögen weise verwaltet und alles dafür tut.«
Amy versuchte zu lächeln. »Ihr wisst doch, dass ich Euch nie enttäuschen würde. Aber es geht um …«
»Die königliche Barke!«, rief Henry aus. Alle Männer am Kai schwenkten ihre Hüte.
»Entschuldigt uns«, sagte Robert hastig zu Amy. Er und Henry gingen rasch an Deck des Schiffes, um die königliche Barke vorbeifahren zu sehen. Die Königin thronte am Heck unter ihrem Prunkbaldachin, aber am Bug, wo jedermann sie sehen konnte, stand wie eine stolze Galionsfigur die zweiundzwanzigjährige Prinzessin Elisabeth, strahlend in den Tudor-Farben Grün und Weiß. Sie winkte und lächelte den Menschen zu.
Die Ruderer hielten die Barke sicher in der Strömung, beide Schiffe lagen Seite an Seite, und die Dudley-Brüder blickten vom Mitteldeck des Kriegsschiffes auf die Barke, die unter ihnen auf den Wellen schaukelte.
Elisabeth schaute herauf. »Ein Dudley!« Klar tönte ihre Stimme, begleitet von einem Lächeln, das Robert galt.
Robert neigte den Kopf. »Prinzessin!« Dann schaute er die Königin an, die seinen Gruß nicht erwiderte. »Euer Majestät.«
Kühl hob Königin Maria ihre Hand. Sie war mit Perlenschnüren behängt, trug Diamantenohrringe und eine mit Smaragden bedeckte Haube, doch ihre Augen waren stumpf vor Schmerz, und ihr Mund wirkte, als hätte sie vergessen, wie man lächelt.
Elisabeth trat näher an die Reling der Königsbarke heran. »Zieht Ihr nun in den Krieg, Robert?«, rief sie zum Deck hinauf. »Werdet Ihr ein Held sein?«
»Ich hoffe es!«, rief er mit klarer Stimme zurück. »Ich hoffe, der Königin im Herrschaftsgebiet ihres Gatten dienen zu können und wieder ihre huldreiche Gunst zu erwerben.«
Elisabeths Augen tanzten vor Übermut. »Ich bin sicher, sie würde keinen ergebeneren Streiter als Euch finden!« Fast wäre sie in Lachen ausgebrochen.
»Und keine hübschere Untertanin als Euch!«, gab Robert zurück.
Elisabeth biss sich auf die Lippe, um nicht loszuplatzen.
»Und befindet Ihr Euch wohl, Prinzessin?«, fuhr er, nun ein wenig leiser geworden, fort. Sie verstand den geheimen Sinn seiner Frage genau: Seid Ihr gesund? Denn Robert wusste, wenn Elisabeth in Angst lebte, bekam sie einen Anfall von Wassersucht, der ihre Finger und Knöchel anschwellen ließ, sodass sie das Bett hüten musste. Und seid Ihr auch sicher?, lautete der zweite Teil der verborgenen Frage, denn die Prinzessin befand sich auf der Barke der Königin, und Nähe zum Thron bedeutete immer auch Nähe zum Richtblock, und Elisabeths einziger Verbündeter in Marias Kronrat, König Philipp, zog nun in den Krieg. Doch der wichtigste Teil von Roberts Frage lautete: Wartet Ihr, so wie ich, auf bessere Zeiten, und betet Ihr wie ich, dass sie bald kommen?
»Ich befinde mich wohl!«, rief sie zurück. »Wie immer. Ich bin verlässlich. Und Ihr?«
Er grinste auf sie herab. »Ebenso verlässlich.«
Mehr brauchten sie einander nicht zu sagen. »Gott segne und erhalte Euch gesund, Robert Dudley«, sagte Elisabeth.
»Und Euch ebenso, Prinzessin.« Und ich wünsche Euch eine glückliche Reise zu Eurem rechtmäßigen Platz, der Euch zusteht wie mir, lautete seine unausgesprochene Erwiderung. Das freche Funkeln in ihren Augen verriet ihm, dass sie seine Gedanken erriet. Jeder von ihnen hatte immer schon genau gewusst, was der andere dachte.
Winter 1558
Nur sechs Monate später stand Amy in Begleitung ihrer Vertrauten Lizzie Oddingsell auf dem Kai von Gravesend und sah den Schiffen zu, die langsam in den Hafen einliefen. Tote und Verwundete lagen auf den Decks, die Relings waren versengt, die Großsegel durchlöchert, und die überlebenden Krieger hielten die Köpfe gesenkt, schämten sich ihrer Niederlage.
Roberts Schiff lief als letztes ein. Amy hatte bereits drei Stunden gewartet und allmählich die Überzeugung gewonnen, dass sie ihn nie wiedersehen würde. Aber das kleine Schiff näherte sich, wurde ins Schlepptau genommen und langsam an den Kai gezogen; es war, als sei selbst das Schiff nicht gewillt, mit Schande bedeckt nach England zurückzukehren.
Amy beschirmte ihre Augen und schaute zur Reling hoch. In diesem Augenblick, den sie so gefürchtet, doch zugleich so ersehnt hatte, weinte sie nicht, sondern suchte trockenen Auges das überfüllte Deck nach Robert ab. Sie wusste genau, wenn sie ihn nicht entdeckte, war er entweder gefangen genommen worden oder lebte nicht mehr.
Dann erblickte sie ihn. Er stand neben dem Hauptmast und machte den Eindruck, als habe er es nicht eilig, nach England zurückzukehren, als müsse er nicht rasch von Bord gehen, als sei er nicht erpicht darauf, seine Ehefrau zu begrüßen. Neben ihm standen ein paar Zivilisten und eine Frau mit einem dunkelhaarigen Baby auf der Hüfte; sein Bruder Henry jedoch fehlte.
Klappernd wurde die Planke auf das Deck geschoben. Amy wollte an Bord, um Robert in ihre Arme zu schließen, doch Lizzie Oddingsell hielt sie zurück. »Wartet«, mahnte sie ihre junge Freundin. »Beobachtet ihn erst einmal.«
Amy schob die Hand zurück, die sie behinderte, wartete aber, bis Robert selbst den Steg hinabgekommen war. Er bewegte sich so gemächlich, dass sie schon glaubte, er wäre verwundet.
»Robert?«
»Amy.«
»Gott sei Dank, Ihr seid wohlbehalten zurückgekehrt!«, brach es aus ihr heraus. »Wir haben gehört, dass die Belagerung furchtbar war, dass Calais verloren ist. Wir wussten ja, dass es nicht stimmen kann …«
»Aber es ist wahr.«
»Calais ist verloren?«
Es war unvorstellbar. Calais war das Juwel von Englands überseeischen Besitzungen. Dort wurde Englisch gesprochen, man bezahlte englische Steuern, handelte mit der kostbaren Wolle und den fertig gewebten Stoffen zwischen Calais und England, dem Mutterland. Calais war der Grund, warum die englischen Könige sich »König von England und Frankreich« nannten. Calais sollte der Welt beweisen, dass England eine Weltmacht darstellte. Diese Besitzung auf französischem Boden war ebenso ein englischer Hafen wie Bristol. Unmöglich, sich vorzustellen, dass sie an die Franzosen gefallen sein sollte!
»Calais ist verloren.«
»Und wo ist Euer Bruder?«, fragte Amy besorgt. »Robert? Wo ist Henry?«
»Tot«, erwiderte er knapp. »Bei St. Quentin erhielt er einen Beinschuss und starb bald darauf, in meinen Armen.« Er stieß ein kurzes, bitteres Lachen aus. »In der Schlacht von St. Quentin habe ich mich in den Augen des Königs ausgezeichnet«, fuhr er fort. »In Depeschen an die Königin ist mein Name lobend erwähnt worden. Dies war mein erster Schritt, den ich mir erhofft hatte, aber er kostete mich meinen Bruder. Und nun stehe ich an der Spitze eines geschlagenen Heeres und möchte bezweifeln, dass die Königin sich meiner Verdienste vor St. Quentin erinnern wird, da ich doch in Calais so schlimm versagt habe.«
»Oh, was macht das schon?«, rief Amy aus. »Solange Ihr wohlauf seid und wir wieder zusammen sind? Kommt mit mir nach Hause, Robert, wen kümmert die Königin oder Calais? Ihr braucht Calais nicht, aber wir können nun Syderstone zurückkaufen. Kommt heim mit mir, und Ihr werdet sehen, wie glücklich wir beide werden können!«
Robert schüttelte den Kopf. »Ich muss der Königin Depeschen überbringen«, weigerte er sich hartnäckig.
»Ihr seid ein Narr!«, fuhr Amy ihn an. »Soll doch ein anderer die schlechten Nachrichten überbringen!«
Seine dunklen Augen verschleierten sich, als er gewahrte, dass seine Ehefrau ihn öffentlich beleidigt hatte. »Bedauerlich, dass Ihr mich für einen Narren haltet«, sagte er gleichmütig. »Aber König Philipp hat mich persönlich zum Überbringer ernannt, und ich muss meine Pflicht erfüllen. Ihr könnt bei den Philips’ in Chichester bleiben, bis ich Euch besuchen komme. Und Ihr könnt mir einen Gefallen tun, indem Ihr diese Frau und ihr Kind mitnehmt. Sie hat ihr Heim in Calais verloren und benötigt für eine Weile Zuflucht in England.«
»Das werde ich nicht tun!«, entgegnete Amy voller Groll. »Was habe ich mit dieser Frau zu schaffen? Was bedeutet sie Euch?«
»Sie war einst die Hofnärrin der Königin«, antwortete Robert. »Ihr Name ist Hannah Green. Sie war mir eine ergebene und gehorsame Dienerin und Freundin in einer Zeit, da ich wenige Freunde hatte. Seid barmherzig, Amy. Nehmt sie mit Euch nach Chichester. Ich sehe zu, dass ich ein neues Pferd bekomme und zum Hof reite.«
»Ach, nicht nur Eure Pläne sind gescheitert, Ihr habt auch Euer Pferd verloren?«, stichelte Amy voller Bitterkeit. »Ihr seid heimgekehrt ohne Bruder, ohne Pferd, Ihr seid heimgekehrt, ohne reicher geworden zu sein. Im Gegenteil, Ihr seid in jeder Weise ärmer, wie meine Stiefmutter Lady Robsart vorhergesagt hat!«
»Ja«, gab er mit fester Stimme zu. »Mein schönes Pferd ist mir von einer Kanonenkugel unter dem Leib weggeschossen worden. Als er stürzte, begrub er mich unter sich, aber sein Körper diente mir als Schutzschild und rettete mir das Leben. Er starb in meinen Diensten. Ich hatte versprochen, ihm ein guter Herr zu sein, und dennoch habe ich ihn dem Tode ausgeliefert. Ich nannte ihn First Step, aber nun bin ich bereits bei meinem ersten Schritt gestürzt. Ich habe mein Pferd verloren, ich habe meinen Sold verloren, ich habe meinen Bruder verloren und alle Hoffnung. Es wird Euch freuen zu hören, dass dies das Ende der Dudleys ist. Ich kann keinen Weg erkennen, auf dem ich wieder zu Ansehen gelangen könnte.«
Robert und Amy gingen ihre getrennten Wege: Er zum Königshof, wo ihn als Überbringer schlechter Nachrichten ein verdrießlicher Empfang erwartete, Amy zu ihren Freunden nach Chichester für einen längeren Besuch. Doch dort fanden sie keine Bleibe, und so reisten beide widerwillig nach Stanfield Hall, dem Hause von Amys Stiefmutter. Sie hatten keinen anderen Ort, an dem sie bleiben konnten.
»Wir haben zu wenig Arbeiter auf dem Hof«, erklärte Lady Robsart am ersten Abend.
Robert hob den Kopf von der Betrachtung seiner leeren Schüssel. »Was?«
»Die Wiese muss umgepflügt werden«, erläuterte seine Schwiegermutter. »Sie bringt so wenig Heu, es nützt alles nichts. Und es fehlt uns an Knechten. Ihr könntet morgen aushelfen.«
Robert starrte sie an, als hätte sie Griechisch zu ihm gesprochen. »Ihr wollt, dass ich auf dem Feld arbeite?«
»Ich bin sicher, meine Stiefmutter meint, dass Ihr die Männer beaufsichtigen sollt«, schaltete sich Amy ein. »Nicht wahr?«
»Wie soll er denn die Männer beim Pflügen beaufsichtigen? Ich bezweifle, dass er etwas davon versteht. Ich dachte eher daran, dass er den Erntewagen fährt, mit Pferden kann er ja immerhin umgehen.«
Amy wandte sich an ihren Mann. »Das wäre doch gar nicht so schlecht.«
Robert brachte vor Empörung kaum ein Wort heraus. »Ich soll auf dem Felde arbeiten? Wie ein Bauer?«
»Was sonst könnt Ihr tun, um Euren Lebensunterhalt zu verdienen?«, fragte Lady Robsart. »Ihr seid wie die Lilien auf dem Felde, guter Mann. Ihr säet nicht und Ihr erntet nicht.«
Alle Farbe wich aus Roberts Antlitz, bis er so bleich war wie die von Lady Robsart erwähnten Lilien. »Ich kann nicht wie ein gemeiner Mann auf dem Feld arbeiten«, sagte er leise.
»Warum soll ich Euch versorgen wie einen Lord?«, lautete ihre eisige Entgegnung. »Euer Titel, Euer Vermögen, Euer Glück – nichts davon ist mehr vorhanden.«
Robert begann vor Wut zu stottern. »Auch wenn ich nie wieder zu Ansehen kommen sollte – auf einen Dunghaufen werde ich nicht herabsinken, so tief kann ich mich nicht erniedrigen.«
»Ihr seid bereits abgrundtief gesunken«, gab Lady Robsart ihm zu verstehen. »König Philipp wird nun nicht mehr nach England zurückkehren, und die Königin, Gott schütze sie, hat sich gegen Euch gewandt. Euer Name ist mit einem Makel behaftet, Euer Einfluss ist geschwunden, Euch ist nichts geblieben außer Amys Liebe und meiner Protektion.«
»Eure Protektion!«, rief er.
»Ich ernähre Euch – und bekomme nichts dafür. Deshalb ist mir der Gedanke gekommen, dass Ihr für Euren Unterhalt arbeiten könntet. Alle anderen arbeiten ja auch. Amy kümmert sich um die Hennen und näht und macht die Hausarbeit. Mir obliegt die Haushaltsführung, und meine Söhne kümmern sich um die Tiere und die Ernte.«
»Sie erteilen dem Schäfer und dem Pflüger Befehle!«, widersprach Robert.
»Weil sie wissen, welche Befehle sie geben müssen. Ihr versteht davon nichts, deshalb müsst Ihr Euch darein schicken, Befehle entgegenzunehmen.«
Robert machte Anstalten, sich vom Tisch zu erheben. »Lady Robsart«, sagte er mit erzwungener Ruhe, »ich warne Euch. Treibt es nicht zu weit! Noch bin ich ein Besiegter, aber Ihr solltet nicht danach trachten, mich noch tiefer zu demütigen.«
»Ach, und warum nicht?« Die Dame gewann Spaß an der Auseinandersetzung. »Die Macht Eurer Rache ängstigt mich kaum.«
»Ihr seid kleinlich«, hielt er ihr würdevoll entgegen. »Ich bin am Boden, wie Ihr richtig bemerkt. Ich bin ein Besiegter und trauere um drei geliebte Brüder, die ich in den vergangenen beiden Jahren durch eigene Schuld verloren habe. Bedenkt, was dies für einen Mann bedeutet! Ihr könntet mir ein wenig Nächstenliebe zeigen, wenn Ihr schon keine Freundlichkeit besitzt. Als ich noch Lord Robert war, hat es weder Euch noch Amys Vater je an etwas gefehlt.«
Lady Robsart antwortete nicht. Robert stand auf. »Kommt, Amy.«
Sie gehorchte nicht. »Ich komme, in einer Minute.«
Lady Robsart wandte den Kopf ab, um ein Lächeln zu verbergen.
»Kommt«, wiederholte Robert gereizt und hielt ihr seine Hand hin.
»Ich muss erst die Teller abräumen und den Tisch abwischen«, entschuldigte sich Amy.
Sie erkannte, dass er nicht noch einmal bitten würde. Robert machte auf dem Absatz kehrt und schritt auf die Tür zu.
»Morgen früh seid Ihr im Stall und fangt mit der Arbeit an!«, rief Lady Robsart ihm nach.
Mitten in ihrem triumphierenden Satz fiel die Tür zu.
Amy wartete, bis Roberts Schritte sich entfernt hatten, dann fiel sie über ihre Stiefmutter her. »Wie konntet Ihr nur?«
»Warum, sollte ich nicht?«
»Ihr werdet ihn vertreiben.«
»Ich will ihn ohnehin nicht hier haben.«
»Nun, ich schon! Wenn Ihr ihn vertreibt, gehe ich auch!«
»Ach Amy«, lenkte die Stiefmutter ein. »Nun nimm doch Vernunft an! Er hat abgewirtschaftet, der Mann taugt zu nichts mehr. Lass ihn gehen. Er wird wieder in Philipps Dienste treten oder zu einem anderen Abenteuer ausziehen, und in der einen oder anderen Schlacht wird er fallen, und du wirst frei sein. Deine Ehe war ein Fehler, von Anfang an, und so könnt ihr sie ehrenhaft beenden.«
»Niemals!«, fuhr Amy ihre Stiefmutter an. »Ihr seid verrückt, wenn ihr so etwas denkt. Wenn er mit dem Pflug über die Felder geht, werde ich an seiner Seite sein. Wenn Ihr sein Feind sein wollt, so bin ich Euer Feind. Ich liebe ihn, ich gehöre zu ihm, und er gehört zu mir, und nichts wird jemals zwischen uns kommen.«
Lady Robsart sah ihre Stieftochter entsetzt an. »Amy, das sieht dir gar nicht ähnlich!«
»Doch. Genau das bin ich. Ich kann nicht ruhig und gehorsam bleiben, wenn Ihr ihn beleidigt. Ihr versucht, uns auseinanderzubringen, weil Ihr überzeugt seid, ich liebte mein Heim so sehr, dass ich es nie verlassen würde. Nun, so hört mich an: Ich werde mein Heim verlassen! Für mich gibt es nichts Wichtigeres auf der Welt als Lord Robert, nicht einmal die Liebe zu meinem Heim oder die Liebe zu Euch. Und Ihr solltet ihn respektieren – wenn schon nicht um seiner selbst willen, dann um meinetwillen!«
»Hört, hört!«, sagte Lady Robsart mit widerwilliger Bewunderung. »Ein Gewitter für ein Nichts.«
»Es ist nicht für nichts«, widersprach Amy störrisch.
»Es kann aber nur ein Nichts sein.« Die Stiefmutter bot einen Waffenstillstand an. »Du hast ihn zwar vor der Feldarbeit bewahrt, aber er muss eine Beschäftigung finden. Er darf nicht tatenlos herumsitzen, Amy.«
»Wir besorgen ihm ein Pferd«, beschloss diese. »Es darf nicht viel kosten … ein junges Pferd, das er zureiten kann. Dann verkaufen wir es, und er kann sich ein besseres leisten. Er versteht sich auf Pferde, er spricht beinahe mit ihnen.«
»Und mit welchem Geld willst du dieses Pferd kaufen?«, fragte Lady Robsart. »Denn von mir bekommst du nichts.«
»Ich verkaufe das Medaillon meines Vaters«, sagte Amy entschlossen.
»Das tust du nicht!«
»Für Robert tue ich es.«
Die ältere Frau zögerte. »Ich leihe dir das Geld«, sagte sie schließlich. »Verkauf das Medaillon nicht.«
Amy lächelte über ihren Sieg. »Ich danke dir«, sagte sie.
Sie ließ Robert eine Stunde allein, damit er sich beruhigte. Dann ging sie nach oben in das enge Schlafgemach, da sie hoffte, ihn auf ihrem kleinen, mit Stricken überspannten Bett vorzufinden. Amy wollte Robert unbedingt von ihrem Sieg berichten, ihm sagen, dass er nicht auf dem Feld arbeiten müsse und dass er ein Pferd zum Zureiten bekommen würde, vielleicht das erste Pferd von vielen. Aber die Leintücher waren zurückgeschlagen, die Kopfbretter unberührt, das Zimmer leer. Robert war fort.
Sommer 1558
Mit grimmiger Entschlossenheit war Robert Dudley bei Hofe eingetroffen. Nach den Beleidigungen seiner Schwiegermutter hatte er nicht geglaubt, noch tiefer sinken zu können. Doch in dem neuen, schönen Palast in Richmond, den er liebte wie ein Heim, war er täglich neuen Demütigungen ausgesetzt. Nun gehörte er selbst zu den vielen Bittstellern, die er einst links liegen gelassen und sich dabei müßig gefragt hatte, ob sie nichts Besseres zu tun hätten, als um Begünstigungen zu betteln. Nun musste er sich in die Reihen derer begeben, die um die Aufmerksamkeit der Höhergestellten buhlten in der Hoffnung, eines Tages einer wirklich einflussreichen Persönlichkeit vorgestellt zu werden. Am Tudor-Hof hing alles vom Thron ab, wie aus einer Quelle flossen von dort Geld, Rang und Stellung. Macht strömte denjenigen zu, die den Mächtigen tributpflichtig waren, und wurde von dort weiter verteilt. Reichtümer sprudelten aus der schlecht verwalteten Staatskasse, aber man musste der Günstling eines Günstlings sein, um ein wenig davon für sich abzuzweigen.
Einst war Robert einer der mächtigsten Männer bei Hofe gewesen, er kam an zweiter Stelle nach seinem Vater, der wiederum den König beherrschte. Daher wusste er genau, wie das System an der Spitze funktionierte. Nun hatte er zu lernen, wie es in den Niederungen aussah.
Er verbrachte seine Tage bei Hofe, wohnte im Hause eines Freundes seines Schwagers, Henry Sidney, und bemühte sich um einen Posten, ganz gleich ob Stellung oder beratende Tätigkeit oder der Dienst im Hause eines Lords von niederem Adel. Aber niemand wollte ihn haben, mancher nicht einmal im Gespräch mit ihm gesehen werden. Für eine untergeordnete Tätigkeit war er zu gebildet; wie konnte man einen Mann, der drei Sprachen beherrschte, mit dem Erstellen von Warenlisten beschäftigen? Die herrschende Klasse der katholischen Lords verachtete Robert, da er und sein Vater in der Zeit der protestantischen Reformation unter König Eduard ihre Blütezeit erlebt hatten. Er war viel zu prächtig und schillernd, um am unteren Ende einer Tafel bei den Bediensteten zu sitzen oder als junger königlicher Stallmeister beschäftigt zu werden. Kein Vornehmer erntete einen Vorteil, wenn der auffallende Robert Dudley hinter seinem Stuhl stand, niemand konnte es sich leisten, von seinem eigenen Diener ausgestochen zu werden. Keine Dame, die auf ihren guten Ruf bedacht war, konnte einen Mann in ihr Haus aufnehmen, der einen so kraftvollen männlichen Charme ausstrahlte; kein Mann, der Töchter im Hause hatte, würde ihn einstellen. Niemand wollte einen Robert Dudley mit seinen verwirrenden dunklen Zügen und dem scharfen Verstand für ein persönliches Amt, und niemand wagte es, auf seine Loyalität zu vertrauen.
Er weilte bei Hofe wie ein gut aussehender Leprakranker und lernte die Stimme der Ablehnung bis zur letzten eisigen Note kennen. Viele Männer, die früher froh gewesen waren, Roberts Freunde oder Gefolgsleute zu sein, leugneten nun jegliche Bekanntschaft. Er begriff, dass das Gedächtnis der Menschen außerordentlich kurz war. Er war ein Ausgestoßener im eigenen Land.
Die Gunst Philipps von Spanien war nun keinen Pfifferling mehr wert. Der König schien England und dessen Königin endgültig verlassen zu haben, er lebte an seinem prachtvollen Hof in den Niederlanden, und man munkelte, dass er sich eine schöne Geliebte genommen habe. Alle sagten, er werde nie nach England zurückkehren. Seine verlassene Frau Königin Maria gestand, dass sie sich schon zum zweiten Mal geirrt habe – dass sie doch kein Kind von ihm empfangen habe und England keinen Erben schenken könne. Sie schien in ihren Kleidern zu schrumpfen und verbarg sich in ihren Privatgemächern, eher einer Witwe denn einer Regentin ähnlich.
Robert, der in seinem eigenen Namen keinen Handel treiben, der weder Schuldscheine ausschreiben noch sich einer Kaufmannsvereinigung anschließen durfte, war sich bewusst, dass er nicht vorwärtskommen würde, bevor die Schande des Hochverrats von seinem Namen genommen war, und die Einzige, die ihn davon erlösen konnte, war Königin Maria. Er borgte sich einen neuen Hut und Umhang von seinem Schwager Henry Sidney und stellte sich eines kühlen, nebligen Morgens vor das Empfangszimmer der Königin, um sie vor ihrem Kirchgang abzupassen. Mit ihm wartete ein halbes Dutzend Bittsteller. Als die Tür aufging, fuhr eine Bewegung durch die Wartenden. Die Königin, mit gesenktem Kopf und in Schwarz gekleidet, trat in Begleitung einiger weniger Hofdamen heraus.
Robert fürchtete schon, sie würde an ihm vorübergehen, ohne ihn anzusehen, doch da spürte er ihren Blick. Königin Maria erkannte ihn und verharrte. »Robert Dudley?«
Er verneigte sich. »Euer Hoheit.«
»Ihr wolltet etwas von mir?«, fragte sie argwöhnisch.
Robert fand, der gerade Weg sei der beste. »Ich wollte Euch bitten, den Makel des Verrats von meinem Namen zu nehmen«, begann er. »Ich habe Eurem Ehemann bei St. Quentin und Calais treu gedient. Diese Schlachten haben mich den Rest meines Vermögens gekostet sowie das Leben meines kleinen Bruders, Euer Hoheit. Mit diesem Makel auf meinem Namen kann ich weder Geschäfte tätigen noch meinen Kopf hoch tragen. Meine Frau hat ihr Erbe, einen kleinen Bauernhof in Norfolk, verloren und ich sämtliche Hinterlassenschaften meines Vaters. Ich möchte nicht, dass meine Frau erniedrigt wird und in Armut leben muss, weil sie mich zum Manne nahm.«
»Frauen müssen stets das Geschick des Mannes teilen«, erwiderte die Königin kategorisch. »Ob im Guten oder im Bösen. Und ein schlechter Ehemann ist die stete Verzweiflung einer Frau.«
»Ja«, gab Robert zu. »Aber sie war nie auf mein Vermögen aus. Alles, was sie wollte, war ruhig auf dem Lande zu leben, und ich hätte besser daran getan, wenn ich ihren Wunsch erfüllt hätte. Jetzt ist uns ein gemeinsames Leben verwehrt, denn ich kann ihre Familie nicht ertragen, und ich kann kein gemeinsames Haus für uns kaufen. Ich habe sie enttäuscht, Euer Hoheit, und das war sehr falsch von mir.«
»Ihr wart bei der Niederlage von Calais dabei«, entsann sich die Königin.
Robert erwiderte ihren freudlosen Blick. »Dies werde ich nie vergessen«, sagte er. »Der Feldzug war schlecht geplant. Die Kanäle hätten geflutet sein sollen, um einen zusätzlichen Verteidigungsgürtel zu bilden, aber sie hatten es versäumt, die Tore zum Meer zu öffnen. Und die Festungen waren nicht ausreichend befestigt und bemannt, wie sie uns versprochen hatten. Mein Bataillon gab sein Bestes, aber die Franzosen waren in der Überzahl. Ich habe immerhin den Versuch gemacht, Euer Hoheit. Euer Gemahl hat höchstpersönlich meine Verdienste vor St. Quentin anerkannt.«
»Ihr habt immer schon mit Engelszungen zu reden gewusst«, sagte sie mit dem Anflug eines Lächelns. »Eure ganze Familie beherrscht die Kunst, sich den Weg ins Paradies mit Worten zu bahnen.«
»Das hoffe ich«, erwiderte Robert. »Denn zu viele von uns weilen bereits dort. Und wer übrig blieb, hat die ärgste Demütigung erfahren. Einst hatte ich sieben Brüder und fünf Schwestern – zwölf gesunde Kinder. Nun sind nur noch vier übrig.«
»Auch ich bin gedemütigt worden«, machte Königin Maria geltend. »Als ich den Thron bestieg, Robert, nachdem ich Euch und Euren Vater besiegt hatte, war ich der Überzeugung, alle meine Sorgen hätten nun ein Ende. Doch sie fingen gerade erst an.«
»Es tut mir leid, dass die Herrschaft Euch so wenig Freude gebracht hat«, sagte Robert still. »Die Krone ist eine schwere Last, besonders für eine Frau.«
Zu seinem Entsetzen sah er, wie ihre dunklen Augen sich mit Tränen füllten, die über ihre welken Wangen rannen. »Besonders für eine einsame Frau«, ergänzte sie leise. »Auch Elisabeth wird das eines Tages herausfinden, obwohl sie ja derzeit die stolze Jungfrau herauskehrt. Es ist unerträglich, allein zu regieren – aber wie soll man einen Thron teilen? Welchem Mann könnte man so viel Macht anvertrauen? Welcher Mann könnte eine Königin samt Thron annehmen und doch ihr das Herrschen überlassen?«
Robert beugte das Knie, nahm die Hand seiner Königin und küsste sie. »Vor Gott schwöre ich, Königin Maria, es tut mir leid, dass Ihr so traurig seid. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so weit kommt.«
Einen Moment lang verharrte sie reglos, durch seine Berührung getröstet. »Ich danke Euch, Robert.«
Er schaute zu ihr auf, und die Königin stellte erstaunt fest, wie jung und schön er immer noch war: dunkel wie ein Spanier, doch eine Sorgenfalte hatte sich tief zwischen seine Brauen gegraben.
»Aber Ihr habt noch alles vor Euch«, sagte sie trocken. »Ihr habt Eure Jugend und Euer gutes Aussehen, und sollte Elisabeth die Krone erben, so werdet Ihr auch wieder zu Eurem Vermögen kommen. Aber Ihr müsst Eure Frau lieben, Robert Dudley. Das Leben ist zu schwer für eine Frau, wenn ihr Ehemann sie vernachlässigt.«
Er erhob sich wieder. »Das werde ich tun«, versprach er leichten Herzens.
Sie nickte. »Und schmiedet keine Ränke mehr gegen mich oder gegen die Krone.«
Diesen Schwur konnte Robert nicht leichtfertig leisten. Unverwandt sah er seiner Herrin in die Augen. »Diese Tage sind vorüber«, sagte er. »Ich bin mir bewusst, dass Ihr meine rechtmäßige Königin seid. Ich beuge mein Knie, Königin Maria, ich habe meinen Stolz bereut.«
»Nun gut«, sagte sie müde. »Hiermit bewillige ich, dass der Makel des Verrats von Eurem Namen genommen wird. Ihr könnt die Ländereien Eurer Frau zurückhaben und Euren Titel. Ihr sollt Gemächer bei Hofe erhalten. Und ich wünsche Euch alles Gute.«
Robert musste das Hochgefühl bezwingen, das ihn zu überwältigen drohte. »Ich danke Euch«, sagte er mit tiefer Verneigung. »Ich werde für Euch beten.«
»Dann kommt mit mir in die Kapelle«, befahl die Königin.
Ohne Zögern folgte Robert Dudley, der Mann, dessen Vater die protestantische Reformation in England unterstützt hatte, seiner Königin in die katholische Messe und beugte sein Knie vor den Heiligenbildern hinter dem Altar. Hätte er nur einen Augenblick gezögert, einen prüfenden Blick gewagt, wäre er sofort der Ketzerei bezichtigt worden. Aber Robert schaute weder argwöhnisch, noch zögerte er. Er schlug das Kreuzzeichen und folgte den Ritualen, kniete und stand, wie es verlangt wurde, verriet den Glauben seines Vaters. Aber es war dessen Fehleinschätzung gewesen, der Robert Dudley seine jetzige Lage verdankte, und er war gewillt, es besser zu machen.
Herbst 1558
Alle Glocken in Hertfordshire, alle Glocken in England läuteten für Elisabeth, dröhnten in ihrem Kopf. Zuerst kreischte die Sopranglocke wie ein dem Wahnsinn verfallenes Weib, dessen Aufschrei in einen lang gezogenen, misstönenden Seufzer überging, dann ertönte die große Glocke und warnte die Zuhörer, dass nun die Wiederholung des dissonanten Glockenspieles bevorstand. Elisabeth stieß das Fenster auf Schloss Hatfield auf. Sie wollte in dem Lärm ertrinken, wollte taub werden vom eigenen Triumph. Die Glocken lärmten, bis die Krähen ihre Nester verließen und sich wie ein Banner des bösen Omens gen Himmel schwangen. Und die Fledermäuse brachen als schwarze Rauchwolke aus dem Glockenturm hervor, wie eine Verkündigung, dass die Welt nun auf den Kopf gestellt sei, der Tag sich in ewige Nacht verwandelt habe.
Elisabeth lachte aus vollem Halse über den Tumult, der die Botschaft in den gleichgültigen Himmel hinausposaunte: Zu guter Letzt war die arme kranke Königin Maria gestorben und Prinzessin Elisabeth ihre unbestrittene Nachfolgerin.
»Gott sei Dank«, rief sie zu den wirbelnden Wolken empor. »Nun kann ich endlich die Königin sein, die ich nach dem Willen meiner Mutter sein sollte; die Königin, die Maria nicht sein konnte – die Königin, zu der ich geboren bin.«
»Und – was denkt Ihr?«, fragte Elisabeth schelmisch.
Amys Ehemann lächelte in das reizende junge Gesicht an seiner Schulter, während sie durch den kalten Garten von Schloss Hatfield spazierten.
»Ich dachte gerade, dass Ihr nie heiraten solltet.«
Erstaunt blinzelte ihn die Prinzessin an. »Tatsächlich? Alle anderen scheinen der Meinung zu sein, dass ich sofort heiraten sollte.«
»Ihr solltet nur einen sehr, sehr alten Mann heiraten«, fuhr er fort.
Der Prinzessin entfuhr ein Kichern. »Warum, um alles in der Welt?«
»Damit er so bald wie möglich stirbt. Denn Ihr seht so bezaubernd aus in schwarzem Samt. Ihr solltet wirklich nie etwas anderes tragen.«
Dies war der Abschluss ihrer mit Anspielungen gewürzten Unterhaltung, die Anbringung eines geschickt gewählten Kompliments. Es war das, worin Robert Dudley brillierte – abgesehen von seinen Reitkünsten, seinen politischen Fähigkeiten und seinem gnadenlosen Ehrgeiz.
Elisabeth war von der roten Nasenspitze bis zu den Lederstiefeln in Trauerkleidung gehüllt. Sie blies auf die Spitzen ihrer behandschuhten Finger, um sie zu wärmen, und sie trug einen schwarzen Samthut, der in kessem Winkel auf den rotgoldenen Locken saß. In gebührendem Abstand folgte ein Zug frierender Bittsteller. Lediglich William Cecil, Elisabeths langjähriger Berater, durfte es wagen, das Tête-à-Tête der beiden Freunde zu stören, die einander von Kindesbeinen an kannten.
»Ah, Spirit«, sagte Elisabeth freundlich zu dem älteren, in nüchternes Schwarz gekleideten Mann, der sich ihnen genähert hatte. »Welche Nachrichten bringt Ihr?«
»Gute Nachrichten, Euer Hoheit«, sagte er zu der Königin und nickte Robert Dudley kurz zu. »Ich habe Nachricht von Sir Francis Knollys. Ich wusste, Ihr würdet es unverzüglich erfahren wollen. Er und seine Gattin haben Deutschland verlassen und sollten um Neujahr bei Hofe eintreffen.«
»Sie kann demnach nicht an meiner Krönung teilnehmen?«, fragte Elisabeth. Sie vermisste ihre Cousine Catherine, eine glühende Protestantin, die während der Regierungszeit Königin Marias im selbstgewählten Exil gelebt hatte.
»So bedauerlich es ist«, meinte Cecil. »Sie können es einfach nicht pünktlich schaffen. Und wir können unmöglich warten.«
»Aber hat sie eingewilligt, meine Hofdame zu werden? Und dass ihre Tochter – wie heißt sie doch gleich? Laetitia – meine Ehrenjungfer wird?«
»Sie fühlt sich geehrt«, erwiderte Cecil. »Sir Francis hat mir bereits eine Mitteilung geschickt, in der er seine Einwilligung gibt, und Lady Knollys’ Brief an Euch wird folgen. Sir Francis schreibt, sie hätte so viel zu erzählen gehabt, dass sie nicht zu Ende kam und meinem Boten den Brief unvollendet mitgeben musste.«
Elisabeths strahlendes Lächeln war herzerwärmend. »Wir werden uns so viel zu erzählen haben!«
»Vermutlich müssen wir alle vom Hofe weisen, damit Ihr in Ruhe plaudern könnt«, bemerkte Dudley. »Ich kann mich noch gut erinnern, wie Catherine sich bei unseren ’Schweig-still’-Turnieren geschlagen hat. Wisst Ihr noch? Sie hat immer verloren.«
»Und bei den Anstarr-Turnieren war sie immer diejenige, die zuerst blinzeln musste.«
»Aber einmal hat sie auch das ganze Haus zusammengebrüllt – als Ambrose ihr die Maus in den Nähbeutel gesteckt hat.«
»Ich vermisse sie«, sagte Elisabeth schlicht. »Sie ist fast die einzige Familie, die ich noch habe.«
Keiner der beiden Männer erwähnte ihre hartherzigen Verwandten aus der Howard-Familie, welche Elisabeth, als sie bei Maria in Ungnade gefallen war, verleugnet hatten. Jetzt jedoch hefteten sie sich an ihren neu entstehenden Hofstaat und wurden nicht müde, die neue Königin an ihre Verwandtschaft zu erinnern.
»Ihr habt doch mich«, betonte Robert zärtlich. »Und meine Schwester könnte Euch nicht mehr lieben, als wenn sie Eure eigene Schwester wäre.«
»Aber Catherine wird wegen des Kreuzes und der Kerzen in der königlichen Kapelle mit mir schimpfen«, erwiderte Elisabeth schmollend, indem sie in der ihr eigenen Art auf das größte Problem anspielte.
»Auf welche Art Ihr in der königlichen Kapelle betet, bestimmt nicht Lady Catherine«, sagte Cecil, »sondern Ihr.«
»Nein, aber sie hat es vorgezogen, England zu verlassen, statt unter der Fuchtel des Papstes zu leben, und wenn sie nun mit all den anderen Protestanten zurückkehrt, erwartet sie ein wahrhaft reformiertes Land.«
»Wie wir alle, da bin ich sicher.«
Robert Dudley warf Cecil einen fragenden Blick zu, als wollte er ihm andeuten, dass nicht alle seine klaren Ansichten teilten. Doch der Ältere übersah es milde. Cecil war seit Beginn der Reformation einer der treuesten Anhänger des protestantischen Glaubens gewesen und hatte unter der katholischen Regentschaft gelitten, da er seinem Glauben und dem Dienst an der protestantischen Prinzessin treu geblieben war. Unter König Eduard hatte er den mächtigen protestantischen Lords gedient, den Dudleys, und war Roberts Vater in den Anfängen der Reformation ein verlässlicher Berater gewesen. Robert und Cecil waren somit alte Verbündete – Freunde waren sie jedoch nicht.
»An einem Kreuz auf dem Altar ist doch nichts Papistisches«, machte Elisabeth geltend. »Daran können sie sich nicht stören.«
Cecil lächelte nachsichtig. Elisabeth liebte den kirchlichen Prunk: Priester in reichen Gewändern, bestickte Altartücher, bunte Farben an den Wänden, Kerzen und all die anderen Symbole der katholischen Kirche. Doch er war zuversichtlich, dass sie der reformierten Kirche zugeneigt bleiben würde, da dieser Glaube von Kindesbeinen an der ihre gewesen war.
»Ich werde nicht dulden, dass die Hostie beim Sakrament der Wandlung hochgehalten wird, als wäre sie Gott in Person«, sagte Elisabeth mit fester Stimme. »Dies ist wahrlich papistische Götzendienerei. Das werde ich nicht zulassen, Cecil. Ich will es nicht sehen und werde nicht dulden, dass es mein Volk in Verwirrung stürzt. Es ist eine Sünde, das ist mir bewusst. Es ist ein Götzenbild, es legt falsches Zeugnis ab, und ich kann es nicht dulden.«