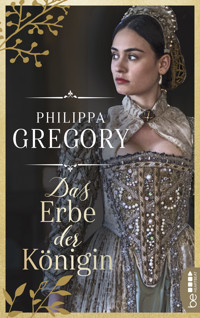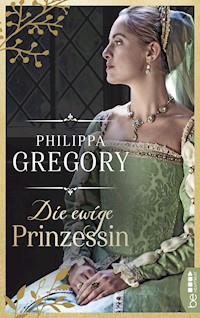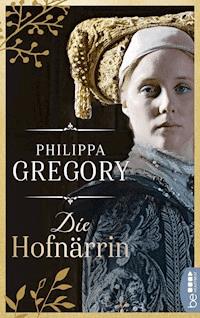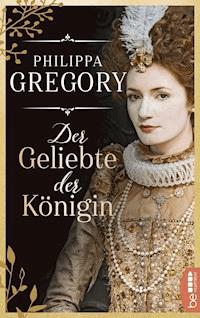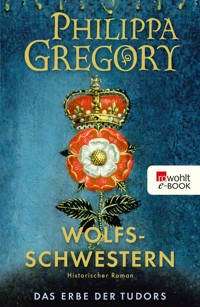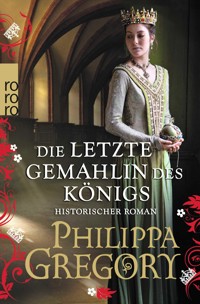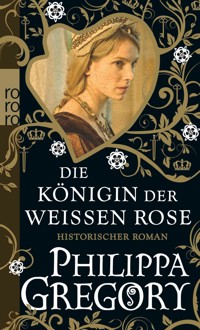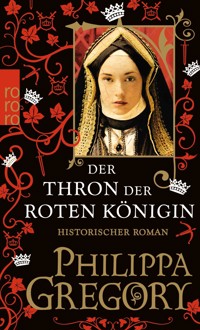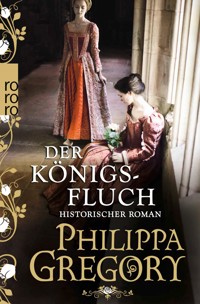9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Rosenkriege
- Sprache: Deutsch
Herrin der Flüsse, Seherin des Schicksals, Mutter der weißen Königin Sie sei so rein, dass sie ein Einhorn fangen könne, sagt man über Jacquetta von Luxemburg. Ihrer Vermählung mit dem mächtigen Duke of Bedford, dem engsten Berater König Henrys VI., sieht die junge Frau mit Furcht entgegen. Denn ihr Herz gehört Bedfords Junker Richard Woodville. Als der ungeliebte Gemahl unerwartet stirbt, schließen die beiden heimlich den Bund der Ehe – eine beispiellose Überschreitung der Standesgrenzen. Dann nimmt der König die junge Maguerite d'Anjou zur Frau, und Jacquetta steigt zur engsten Vertrauten der neuen Königin auf. Intrigen und Missgunst beherrschen bald das Leben zu Hofe. Doch mit unerschütterlicher Loyalität kämpft Jacquetta für das Herrscherpaar – und für ihre Tochter Elizabeth, die sie für etwas Höheres geboren sieht: die Krone des englischen Königreichs und die weiße Rose von York. «Perfekt recherchiert und grandios erzählt.» (The Times) «Philippa Gregory ist wahrlich die Meisterin des historischen Romans! Geschichte kann kaum unterhaltsamer, lebendiger oder bezaubernder erzählt werden.» (Sunday Express) «Niemand schreibt besser über die Tudors als Philippa Gregory. Sie stellt alle ihre Nacheiferer in den Schatten.» (Publishers Weekly) «Eine würdige Ergänzung dieser faszinierenden Serie.» (Library Journal)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 808
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Philippa Gregory
Die Mutter der Königin
Über dieses Buch
Herrin der Flüsse, Seherin des Schicksals, Mutter der weißen Königin
Sie sei so rein, dass sie ein Einhorn fangen könne, sagt man über Jacquetta von Luxemburg. Ihrer Vermählung mit dem mächtigen Duke of Bedford, dem engsten Berater König Henrys VI., sieht die junge Frau mit Furcht entgegen. Denn ihr Herz gehört Bedfords Junker Richard Woodville. Als der ungeliebte Gemahl unerwartet stirbt, schließen die beiden heimlich den Bund der Ehe – eine beispiellose Überschreitung der Standesgrenzen.
Dann nimmt der König die junge Maguerite d’Anjou zur Frau, und Jacquetta steigt zur engsten Vertrauten der neuen Königin auf. Intrigen und Missgunst beherrschen bald das Leben zu Hofe. Doch mit unerschütterlicher Loyalität kämpft Jacquetta für das Herrscherpaar – und für ihre Tochter Elizabeth, die sie für etwas Höheres geboren sieht: die Krone des englischen Königreichs und die weiße Rose von York.
«Perfekt recherchiert und grandios erzählt.» (The Times)
«Philippa Gregory ist wahrlich die Meisterin des historischen Romans! Geschichte kann kaum unterhaltsamer, lebendiger oder bezaubernder erzählt werden.» (Sunday Express)
«Niemand schreibt besser über die Tudors als Philippa Gregory. Sie stellt alle ihre Nacheiferer in den Schatten.» (Publishers Weekly)
«Eine würdige Ergänzung dieser faszinierenden Serie.» (Library Journal)
Vita
Philippa Gregory, geboren 1954 in Kenia, studierte Geschichte in Brighton und promovierte an der University of Edinburgh über die englische Literatur des 18. Jahrhunderts. In den USA und in Großbritannien feiert Gregory seit langem riesige Erfolge als Autorin historischer Romane. Daneben schreibt sie auch Kinderbücher, Kurzgeschichten, Reiseberichte sowie Drehbücher; sie arbeitet als Journalistin für große Zeitungen, Radio und Fernsehen. Philippa Gregory lebt mit ihrer Familie in Nordengland.
Weitere Veröffentlichungen:
Die Königin der Weißen Rose
Der Thron der roten Königin
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2012
Covergestaltung any.way, Cathrin Günther,
nach dem Original von Simon & Schuster, UK
Coverabbildung Jeff Cottenden
ISBN 978-3-644-47751-3
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für Victoria
Burg Beaurevoir in der Nähe von ArrasSOMMER–WINTER 1430
Wie ein braves Kind sitzt diese seltsame Kriegstrophäe auf einem kleinen Hocker in der Ecke ihrer Zelle. Im Stroh zu ihren Füßen liegen auf einer Zinnplatte die Überreste des Abendessens. Mein Onkel hat ihr gutes Fleisch schicken lassen und sogar das weiße Brot von seinem Tisch, doch sie hat es kaum angerührt. Ich starre sie an – die Reitstiefel, die Männerkappe, die sie auf dem kurzen braunen Haar trägt –, als sei sie ein exotisches Tier, zu unserer Kurzweil in Gefangenschaft gehalten, als hätte jemand ein Löwenjunges aus dem fernen Äthiopien geschickt, um die große Familie von Luxemburg zu unterhalten und unsere Sammlung zu bereichern. Hinter mir bekreuzigt sich eine Dame und flüstert: «Ist sie eine Hexe?»
Ich weiß es nicht. Woher soll man so etwas wissen?
«Das ist lächerlich», sagt meine Großtante energisch. «Auf wessen Befehl ist das Mädchen angekettet? Öffnet augenblicklich die Tür.»
Unter den Männern erhebt sich Gemurmel, jeder möchte die Verantwortung auf den anderen schieben, aber dann dreht einer den großen Schlüssel in der Zellentür herum, und meine Großtante stolziert hinein. Die junge Frau – sie muss ungefähr siebzehn oder achtzehn sein, nur ein paar Jahre älter als ich – sieht sie unter den kurzen Haarsträhnen hervor an, dann steht sie langsam auf, lüftet die Kappe und macht einen linkischen Diener.
«Ich bin Madame Jehanne, die Demoiselle von Luxemburg», sagt meine Großtante. «Wir sind auf der Burg des Herrn Johann von Luxemburg.» Sie deutet auf meine Tante. «Dies ist seine Gemahlin, die Herrin der Burg, Jehanne von Bethune, und das hier ist meine Großnichte Jacquetta.»
Die Gefangene sieht uns alle gefasst an und nickt uns der Reihe nach zu. Als ihr Blick auf mich fällt, spüre ich ihn wie eine Berührung, wie einen Lufthauch im Nacken, wie das Flüstern eines Zaubers, so aufmerksam ist sie. Ich frage mich, ob hinter ihr wirklich zwei Engel stehen, wie sie behauptet, und ob es deren Anwesenheit ist, die ich spüre.
«Kannst du sprechen, Mädchen?», fragt meine Großtante, als sie nichts sagt.
«O ja, meine Dame», antwortet sie in dem harten Akzent der Champagne. Es ist also wahr, was man sich über sie erzählt: Sie ist nur eine Bauerntochter, auch wenn sie eine Armee angeführt und einen König gekrönt hat.
«Gibst du mir dein Wort, dass du nicht fliehst, wenn ich dich von diesen Fußketten befreien lasse?»
Sie zögert, als sei sie in der Lage zu wählen. «Nein, das kann ich nicht.»
Meine Großtante lächelt. «Verstehst du mein Angebot? Ich will dir die Haft erleichtern. Ich kann dir die Freiheit geben, hier mit uns auf der Burg meines Neffen zu leben, aber du musst mir versprechen, nicht wegzulaufen.»
Die Gefangene wendet stirnrunzelnd das Gesicht ab – fast, als lauschte sie einem Rat, dann schüttelt sie den Kopf. «Ich weiß, was eine Hafterleichterung ist. Was ein Ritter dem anderen verspricht. Sie haben Regeln wie beim Tjosten. Aber ich bin nicht so wie sie. Meine Worte sind richtige Worte, nicht wie das Gedicht eines Troubadours. Und für mich ist dies kein Spiel.»
«Jungfer, Hafterleichterung ist kein Spiel!», unterbricht meine Großtante Jehanne sie.
Das Mädchen sieht sie an. «Doch, meine Dame. Adlige Herren nehmen diese Dinge nicht ernst. Nicht so ernst wie ich. Sie spielen Krieg und geben sich selbst die Regeln. Sie reiten aus und verwüsten das Land guter Leute, und wenn die strohgedeckten Dächer brennen, lachen sie. Außerdem kann ich nichts versprechen. Ich bin bereits versprochen.»
«Dem, der sich fälschlicherweise König von Frankreich nennt?»
«Dem König des Himmels.»
Meine Großtante überlegt einen Augenblick. «Ich trage ihnen auf, dir die Ketten abzunehmen und dich zu bewachen, damit du nicht fliehen kannst, dann kannst du uns in meinem Gemach Gesellschaft leisten. Was du für dein Land und für deinen König getan hast, war großartig, Johanna, wenn auch verblendet. Und ich dulde nicht, dass du unter meinem Dach als Gefangene in Ketten gehalten wirst.»
«Werdet Ihr Eurem Neffen sagen, er soll mich freilassen?»
Meine Großtante zögert. «Ich kann ihm nichts befehlen, aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit du wieder nach Hause kannst. Auf keinen Fall werde ich zulassen, dass er dich den Engländern ausliefert.»
Bei diesem Wort schaudert Johanna und bekreuzigt sich, schlägt sich auf lächerlichste Art gegen Kopf und Brust wie ein Bauer, wenn vom Beelzebub gesprochen wird. Ich muss mir das Lachen verkneifen. Sie sieht mich aus dunklen Augen an.
«Das sind nur normale Sterbliche», erkläre ich ihr. «Die Engländer haben keine übermenschlichen Kräfte. Du brauchst dich vor ihnen nicht so zu fürchten. Du musst dich auch nicht bekreuzigen, wenn man von ihnen spricht.»
«Ich fürchte mich nicht. Ich bin keine solche Närrin zu glauben, dass sie übermenschliche Kräfte besäßen. Das ist es nicht. Aber sie wissen, dass ich welche habe. Das macht sie gefährlich. Sobald ich ihnen in die Hände falle, werden sie mich umbringen, so viel Angst haben sie vor mir. Ich bin ihre Schreckensvision. Ich bin die Angst, die sie nachts umtreibt.»
«Solange ich lebe, werden sie dich nicht bekommen», versichert meine Großtante ihr. Johanna sieht mich wieder an, und in ihrem harten, dunklen Blick steht unverkennbar die Frage, ob auch ich in dieser ernsthaften Versicherung den Klang eines vollkommen leeren Versprechens gehört habe.
Meine Großtante glaubt, wenn sie Jeanne d’Arc in unsere Gesellschaft einführt, sich mit ihr unterhält, ihren religiösen Eifer beschwichtigt und sie vielleicht sogar ein wenig erzieht, könne das Mädchen mit der Zeit dazu gebracht werden, ein Kleid zu tragen wie alle anderen jungen Frauen, und die kämpferische Jugendliche, die man in Compiègne von ihrem weißen Pferd gezerrt hat, werde sich völlig verwandeln. So wie in einer umgekehrten Messe Wein zu Wasser wird. Sie glaubt, Johanna werde zu einer jungen Frau, die man zu den Hofdamen setzen kann, die einem Befehl williger folgt als dem Läuten der Kirchenglocken. Vielleicht vergessen die Engländer sie dann sogar, die jetzt verlangen, dass wir ihnen dieses Zwitterwesen ausliefern, diese mörderische Hexe. Wenn wir ihnen nicht mehr anzubieten haben als eine gehorsame Kammerzofe, geben sie sich vielleicht zufrieden und ziehen ihrer gewalttätigen Wege.
Johanna ist erschöpft von den Niederlagen. Außerdem beschleicht sie die Sorge, dass der von ihr gekrönte König das heilige Öl nicht wert war, dass der von ihr in die Flucht geschlagene Feind sich wieder sammelt und dass ihr die göttliche Mission entgleitet. All das, was sie zu der von ihrer Truppe bewunderten Jungfrau gemacht hat, ist unsicher geworden. Im Lichte der beharrlichen Freundlichkeit meiner Großtante wird sie wieder zu einer ungelenken Bauernmaid, zu einem ganz gewöhnlichen Mädchen.
Natürlich wollen die adligen Hofdamen meiner Großtante mehr über das Abenteuer wissen, das jetzt langsam und schleichend zur Niederlage wird. Als Johanna schon einige Tage mit uns verbracht und gelernt hat, ein Mädchen zu sein und nicht die Jungfrau von Orléans, nehmen sie all ihren Mut zusammen und fragen sie.
«Wie konntest du so tapfer sein?», will eine wissen. «Wo lernt man, so mutig zu sein, in der Schlacht, meine ich?»
Johanna lächelt. Wir sitzen zu viert im Gras am Wassergraben vor der Burg, faul wie Kinder. Die Julisonne brennt vom Himmel, und das Weideland um die Burg flirrt im Dunst der Hitze; sogar die Bienen sind faul, erst summen sie noch, dann verstummen auch sie – wie trunken von den Blumen. Wir haben uns den schattigsten Platz unter dem großen Turm gesucht, hinter uns im glasklaren Wasser des Grabens hören wir von Zeit zu Zeit ein leises Plätschern, wenn ein Karpfen an die Oberfläche steigt.
Johanna lümmelt sich wie ein Junge, eine Hand hält sie ins Wasser, die Kappe hat sie sich tief in die Stirn gezogen. Im Korb neben mir sind halbfertige Hemden, die wir für die armen Kinder im nahen Cambrai säumen sollen. Aber wir drücken uns vor der Arbeit, Johanna hat kein Talent, und ich halte das kostbare Kartenspiel meiner Großtante in den Händen, mische die Karten und betrachte müßig die Bilder.
«Gott hat mich gerufen», erklärt Johanna nur. «Ich wusste, dass er mich beschützen würde. Deswegen hatte ich keine Angst. Nicht einmal im schlimmsten Schlachtgetümmel. Er sagte mir voraus, dass ich verletzt, aber keinen Schmerz spüren würde, deswegen wusste ich, dass ich weiterkämpfen konnte. Ich habe sogar meine Männer gewarnt, dass ich an dem Tag verwundet werden würde. Ich wusste es, bevor ich in die Schlacht gezogen bin. So einfach war das.»
«Hörst du wirklich Stimmen, Jeanne?», frage ich sie.
«Und du?»
Die Frage erschrickt die anderen Mädchen derart, dass mich plötzlich alle anstarren. Ich werde rot, als schämte ich mich. «Nein! Nein!»
«Sondern?»
«Was meinst du?»
«Was hörst du denn dann?», fragt sie, als hörte jeder vernünftige Mensch irgendetwas.
«Jedenfalls keine Stimmen», antworte ich.
«Also, was hörst du dann?»
Ich sehe mich um, als würden die Fische aus dem Wasser steigen, um uns zu belauschen. «Wenn einer aus meiner Familie stirbt, höre ich etwas», erkläre ich. «Etwas ganz Besonderes.»
«Was?», fragt mich das Mädchen namens Elizabeth. «Das wusste ich ja gar nicht. Kann ich es auch hören?»
«Du entstammst nicht meinem Haus», antworte ich gereizt. «Natürlich kannst du es nicht hören. Du müsstest eine Nachfahrin von … und überhaupt dürft ihr nie darüber sprechen. Ihr solltet es gar nicht wissen. Ich hätte es euch nicht erzählen sollen.»
«Aber was ist es für ein Geräusch?», wiederholt Johanna die Frage.
«Es ist wie ein Singen», antworte ich, und sie nickt, als hätte sie es auch schon gehört.
«Man sagt, es sei die Stimme Melusines, der Urahnin des Hauses von Luxemburg», flüstere ich. «Man sagt, sie sei eine Göttin gewesen, die dem Wasser entstieg, um den ersten Herzog zu heiraten, doch sie konnte keine Sterbliche werden. Sie kehrte zurück, um den Verlust ihrer Kinder zu beweinen.»
«Wann hast du sie gehört?»
«In der Nacht, in der meine kleine Schwester gestorben ist. Da habe ich etwas gehört. Und ich wusste sofort, dass es Melusine war.»
«Woher?», flüstert das andere Mädchen, voller Angst, von der Unterhaltung ausgeschlossen zu werden.
Ich zucke die Achseln. Johanna lächelt. Sie weiß, dass es Wahrheiten gibt, die nicht erklärt werden können. «Ich wusste es einfach», sage ich. «Es war, als hätte ich ihre Stimme erkannt. Als hätte ich sie schon immer gekannt.»
«Das stimmt. Man weiß es einfach.» Johanna nickt. «Aber wie kannst du sicher sein, dass der Gesang von Gott kommt und nicht vom Teufel?»
Ich zögere. Spirituelle Fragen sollte ich mit meinem Beichtvater besprechen oder zumindest mit meiner Mutter oder meiner Großtante. Aber Melusines Gesang, der Schauder, der mir dabei die Wirbelsäule hinunterläuft, und dass ich gelegentlich etwas sehe, was eigentlich unsichtbar ist – etwas halb Vergessenes, etwas, das um eine Ecke verschwindet, etwas Hellgraues im Zwielicht, ein allzu klarer Traum, den ich nicht vergessen kann, ein flüchtiger Blick in die Zukunft, aber nichts, was ich beschreiben könnte … Diese Dinge sind zu zart für Worte. Wie soll ich nach ihnen fragen, wenn ich sie nicht benennen kann? Wie sollte ich es ertragen, wenn ein anderer ihnen unbeholfen Namen gibt oder sie sogar erklären will? Genauso gut könnte ich versuchen, das Wasser des Burggrabens in den hohlen Händen festzuhalten.
«Ich habe nie gefragt», erkläre ich. «Denn es ist doch eigentlich nichts. Stell dir vor, du kommst in ein Zimmer, in dem es still ist – aber du weißt, du spürst einfach, dass jemand da ist. Du kannst ihn zwar nicht hören oder sehen, aber du weißt es trotzdem. Mehr als das ist es kaum. Ich denke daran nie als an eine Gabe Gottes oder des Teufels. Es ist nichts weiter.»
«Meine Stimmen kommen von Gott», versichert Johanna mit Gewissheit. «Ich weiß es. Wenn dem nicht so wäre, wäre ich vollkommen verloren.»
«Dann kannst du das Schicksal vorhersagen?», fragt mich Elizabeth kindisch.
Meine Finger schließen sich um die Karten. «Nein», antworte ich. «Und mit diesen hier sagt man ohnehin nicht das Schicksal voraus, das sind nur Spielkarten. Außerdem würde meine Großtante es mir gar nicht erlauben, selbst wenn ich es könnte.»
«O bitte, sag meins voraus!»
«Es sind nur Spielkarten», beharre ich. «Ich bin keine Wahrsagerin.»
«Bitte, zieh eine Karte und sag mir mein Schicksal voraus», drängt Elizabeth. «Und eine für Jeanne. Was wird aus ihr? Bestimmt willst du doch auch wissen, wie es mit ihr weitergeht?»
«Sie haben nichts zu bedeuten», wende ich mich an Johanna. «Ich habe sie nur zum Spielen mitgebracht.»
«Sie sind wunderschön», findet sie. «Bei Hofe haben sie mir beigebracht, mit solchen Karten zu spielen. Wie bunt sie sind.»
Ich reiche sie ihr. «Geh vorsichtig mit ihnen um, sie sind kostbar», sage ich argwöhnisch, als sie sie in ihren schwieligen Händen auffächert. «Als ich klein war, hat die Demoiselle mir die Namen der Bilder erklärt. Sie borgt sie mir, weil ich so gerne mit ihnen spiele. Aber ich musste ihr versprechen, gut darauf aufzupassen.»
Johanna gibt mir die Karten zurück. Obwohl sie vorsichtig ist und meine Hände offen ausgestreckt sind, fällt eine der Karten mit dem Bild nach unten ins Gras.
«Oh, Entschuldigung!», ruft Johanna und hebt sie schnell auf.
Ich höre ein Flüstern, und ein kühler Atem fährt mir den Rücken hinab. Die Wiese mit den Kühen, die im Schatten des Baumes dösen, scheint in weite Ferne gerückt, als wären wir beide hinter Glas, Schmetterlinge in einer transparenten Kugel, in einer anderen Welt. «Jetzt kannst du sie dir auch anschauen», höre ich mich sagen.
Mit weit aufgerissenen Augen betrachtet Johanna das bunte Bild, dann zeigt sie es mir. «Was hat das zu bedeuten?»
Es ist das Bildnis eines Mannes in einer blauen Livree, der kopfüber an einem ausgestreckten Bein hängt, während das andere leicht gekrümmt ist, die Zehen gestreckt und gegen das gerade Bein gedrückt, als würde er in der Luft tanzen. Die Hände hält er hinter dem Rücken, als wollte er sich verbeugen. Wir sehen beide, mit welchem Schwung sein blaues Haar herabfällt und wie glücklich er lächelt.
«Le Pendu», liest Elizabeth. «Wie grässlich. Was bedeutet das? Oh, gewiss hat es doch nicht zu bedeuten, dass …» Sie unterbricht sich.
«Es bedeutet nicht, dass du gehängt wirst», sage ich schnell zu Johanna. «Bitte denk so etwas nicht. Es ist nur eine Spielkarte, die nichts zu sagen hat.»
«Aber was bedeutet die Karte?», will das andere Mädchen wissen, obwohl Johanna still ist, als sei es nicht ihre Karte, nicht ihr Schicksal, das ich nicht deuten will.
«Zwei Bäume bilden seinen Galgen», erkläre ich. Unter Johannas ernstem, dunklem Blick spiele ich auf Zeit. «Das deutet auf Frühling und Erneuerung des Lebens – nicht auf Tod. Der Mann hängt zwischen zwei Bäumen im Gleichgewicht. Er ist der Mittelpunkt der Wiederauferstehung.»
Johanna nickt.
«Die Bäume biegen sich zu ihm herab, er ist glücklich. Und sieh mal: Er ist nicht am Hals aufgehängt worden, um zu sterben, sondern an den Füßen», fahre ich fort. «Wenn er wollte, könnte er sich aufbäumen und sich losbinden. Wenn er wollte, könnte er sich befreien.»
«Aber er befreit sich nicht», bemerkt das Mädchen. «Er gleicht einem Stehaufmännchen, einem Akrobaten. Was soll das?»
«Er ist freiwillig dort, er wartet. Er hat nichts dagegen, am Fuß aufgehängt zu werden und in der Luft zu hängen.»
«Als lebendiges Opfer?», fragt Johanna langsam, die Worte aus der Messe wählend.
«Er wird nicht gekreuzigt», betone ich schnell. Als würde uns jedes Wort, das ich sage, zu einer anderen Todesart führen. «Das hat gar nichts zu bedeuten.»
«Nein», meint Johanna. «Es sind Spielkarten, und wir spielen nur mit ihnen. Es ist eine hübsche Karte, der Gehängte. Er sieht glücklich aus, so auf dem Kopf im Frühling. Soll ich euch ein Spiel beibringen, das wir in der Champagne spielen?»
«Ja», sage ich. Ich halte die Hand auf, damit sie mir die Karte zurückgibt. Sie betrachtet sie noch einen Moment.
«Ehrlich, es hat nichts zu sagen», wiederhole ich.
Sie lächelt mich an, ihr Lächeln ist klar und ehrlich. «Ich weiß genau, was es bedeutet.»
«Spielen wir?» Ich mische die Karten. Eine dreht sich in meiner Hand.
«Sieh mal, das ist eine gute Karte», bemerkt Johanna. «La Roue de Fortune.»
Ich zeige sie ihr. «Das Rad des Schicksals, das dich ganz nach oben oder ganz nach unten bringen kann. Die Botschaft der Karte ist weder Sieg noch Niederlage, denn beide kommen auf dem Rad vor.»
«In meinem Land haben die Bauern ein Zeichen für das Rad des Schicksals», erzählt Johanna. «Wenn etwas sehr Gutes oder sehr Schlechtes geschieht, zeichnen sie mit dem Zeigefinger einen Kreis in die Luft. Wenn jemand Geld erbt oder eine gute Kuh verliert, machen sie so.» Sie streckt den Finger in die Luft und zeichnet einen Kreis. «Und dazu sagen sie etwas.»
«Einen Zauberspruch?»
«Nicht direkt.» Sie lächelt verschmitzt.
«Was denn sonst?»
Sie kichert. «Sie sagen: Merde.»
Vor Lachen falle ich fast hintenüber.
«Was? Was ist?», fragt das jüngere Mädchen.
«Nichts ist», sage ich. Johanna kichert immer noch. «Jeannes Landsleute sagen zu Recht, dass alles zu Staub wird und dass man nur eines dagegen tun kann: gleichgültig zu werden.»
Johannas Zukunft hängt an einem seidenen Faden, sie schwingt vor und zurück wie der Gehängte. Meine gesamte Familie, mein Vater, Pierre Graf von St. Pol, mein Onkel, Louis von Luxemburg, und mein Lieblingsonkel, Jean von Luxemburg, sie alle sind mit den Engländern verbündet. Mein Vater schreibt aus St. Pol an seinen Bruder Jean und verlangt von ihm als dem Oberhaupt der Familie, Johanna den Engländern zu überstellen. Aber meine Großtante, die Demoiselle, besteht darauf, dass wir Johanna beschützen, und so zögert Onkel Jean.
Die Engländer fordern die Herausgabe der Gefangenen, und da sie über den Großteil Frankreichs herrschen und ihr Verbündeter, der Herzog von Burgund, den restlichen Teil kontrolliert, ist ihr Wille meist Gesetz. Die einfachen englischen Soldaten haben auf dem Schlachtfeld gekniet und dankend Freudentränen vergossen, als die Jungfrau gefangen genommen wurde. Sie haben keine Zweifel daran, dass die verfeindete französische Armee ohne die Jungfrau wieder zu dem verängstigten Haufen wird, der sie vor ihrer Ankunft war.
Der Duke of Bedford, der Regent über die englischen Besitzungen in Frankreich, beherrscht fast den gesamten Norden des Landes. Mehrmals täglich schickt er Briefe an meinen Onkel, um ihn an seine Loyalität den Engländern gegenüber und ihre lange Freundschaft zu erinnern. Er bietet ihm auch Geld an. Mir macht es Spaß, nach den englischen Boten Ausschau zu halten, die in der feinen Livree des königlichen Herzogs auf prächtigen Pferden angeritten kommen. Es heißt, der Herzog wäre ein großer Mann und sehr beliebt, der größte Mann in Frankreich und gewiss niemand, den man zum Feind will, doch bislang gehorcht mein Onkel seiner Tante, der Demoiselle, und weigert sich, ihm unsere Gefangene auszuhändigen.
Mein Onkel erwartet, dass der französische Hof ein Angebot für sie macht – schließlich hat er Johanna seine Existenz zu verdanken –, doch dieser bleibt merkwürdigerweise stumm, selbst nachdem mein Onkel dem König geschrieben hat, die Jungfrau sei in seinem Gewahrsam und sie sei bereit, an den Hof ihres Königs zurückzukehren und erneut in seiner Armee zu dienen. Mit ihr an der Spitze könnten sie ausreiten und die Engländer schlagen. Sie werden doch gewiss ein Vermögen bezahlen, um sie zurückzubekommen?
«Sie wollen sie nicht», erklärt ihm meine Großtante. Sie sitzen an ihrem privaten Esstisch, das große Abendessen für den ganzen Haushalt in der großen Halle ist bereits vorüber. Die beiden haben vor den Männern meines Onkels gesessen, die Gerichte gekostet und sie als Zeichen ihrer besonderen Gewogenheit ihren Günstlingen geschickt. Jetzt sitzen sie bequem an einem kleinen Tisch vor dem Feuer in den privaten Gemächern meiner Großtante, wo ihre persönlichen Bediensteten ihnen aufwarten. Während das Essen serviert wird, habe ich mit einer anderen Hofdame dabeizustehen. Ich muss die Diener im Auge behalten, sie nach Wunsch herbeirufen, die Hände bescheiden vor dem Körper gefaltet, und soll nicht zuhören. Aber selbstverständlich tue ich genau das.
«Jeanne d’Arc hat einen Mann aus Prinz Charles gemacht. Er war nichts, bevor sie mit ihrer Vision zu ihm gekommen ist. Erst sie hat diesen Jüngling zum Mann und zum König gemacht. Sie hat ihn gelehrt, sein Erbe einzufordern. Aus den Gefolgsleuten in seinem Lager hat sie eine Armee formiert und sie zum Sieg geführt. Wären sie ihrem Rat gefolgt, wie sie ihren Stimmen folgt, hätten sie die Engländer auf ihre nebligen Inseln zurückgejagt, und wir wären sie für immer los gewesen.»
Mein Onkel lächelt. «Oh, liebe Tante! Dieser Krieg dauert jetzt schon fast hundert Jahre. Glaubst du wirklich, dass er endet, weil ein dahergelaufenes Mädchen Stimmen hört? Sie hätte die Engländer nie und nimmer vertreiben können. Niemals wären sie abgezogen. Diese Gebiete gehören ihnen, durch Erbfolge und Eroberungen. Sie müssen nur den Mut und die Kraft aufbringen, sie zu halten. Und von beidem hat John von Bedford genug.» Er wirft einen Blick auf sein Weinglas, und ich winke dem Hofdiener, damit er nachschenkt. Ich trete vor, um dem Mann den Kelch hinzuhalten, dann setze ich ihn behutsam auf dem Tisch ab. Sie trinken aus feinem Glas; mein Onkel ist ein wohlhabender Mann, und für meine Tante ist das Beste gerade gut genug.
«Der englische König mag fast noch ein Kind sein, aber der Sicherheit seines Königreichs schadet das nicht, denn sein Onkel Bedford steht hier treu zu ihm, und sein Onkel, der Duke of Gloucester, ist ihm in England treu. Bedford hat den Mut und die Verbündeten, die englischen Besitzungen hier zu halten, und ich glaube, sie werden den Dauphin immer weiter nach Süden treiben. Bis ins Meer. Die Zeit der Jungfrau, so bemerkenswert sie auch gewesen sein mag, ist vorbei. Am Ende werden die Engländer den Krieg gewinnen und ihre rechtmäßigen Besitzungen halten. Und all unsere Lords, die sich jetzt gegen sie verschworen haben, werden die Knie beugen und ihnen dienen.»
«Das glaube ich nicht», beharrt meine Großtante. «Den Engländern graut vor ihr. Sie sagen, sie sei unbesiegbar.»
«Nicht mehr», widerspricht mein Onkel. «Sieh doch nur: Sie ist unsere Gefangene und sprengt keine Zellentüren auf. Sie wissen jetzt, dass sie eine gewöhnliche Sterbliche ist. Sie haben sie mit einem Pfeil im Oberschenkel vor den Mauern von Paris gesehen. Ihre eigene Armee ist abmarschiert und hat sie zurückgelassen. Es waren die Franzosen, die den Engländern beigebracht haben, dass sie zu Fall gebracht und verlassen werden kann.»
«Aber du übergibst sie den Engländern nicht», stellt meine Großtante fest. «Das würde uns für immer entehren – in den Augen Gottes wie in denen der Welt.»
Mein Onkel beugt sich vor. «So ernst nimmst du das? Du glaubst wirklich, sie ist mehr als eine Marktschreierin? Du glaubst wirklich, sie ist mehr als ein Bauernmädchen, das Unsinn erzählt? Du weißt doch, dass ich leicht ein halbes Dutzend von ihrer Sorte auftreiben könnte?»
«Du könntest ein halbes Dutzend auftreiben, die behaupten würden, zu sein wie sie», sagt sie. «Aber keine wäre wie sie. Ich halte sie für ein besonderes Mädchen. Wirklich und wahrhaftig, Neffe. Das spüre ich ganz genau.»
Er hält inne, als wäre ihr Gespür, selbst wenn sie nur eine Frau ist, doch etwas, das es zu berücksichtigen gilt. «Hattest du eine Vision von ihrem Erfolg? Eine Voraussage?»
Sie zögert einen kurzen Augenblick, bevor sie den Kopf schüttelt. «Nein, so deutlich war es nicht. Aber nichtsdestotrotz muss ich darauf bestehen, dass wir sie schützen.»
Er wartet, er möchte ihr nicht widersprechen. Sie ist die Demoiselle von Luxemburg, das Oberhaupt unserer Familie. Wenn sie stirbt, wird mein Vater den Titel erben, aber ihr gehören große Ländereien, über die sie frei verfügen kann: Sie kann sie nach Belieben vererben. Mein Onkel Jean ist ihr Lieblingsneffe, er macht sich Hoffnungen und möchte sie nicht kränken.
«Die Franzosen müssen einen guten Preis für sie zahlen», sagt er. «Ich habe nicht die Absicht, ihretwegen Geld zu verlieren. Sie ist das Lösegeld eines Königs wert. Und das wissen sie.»
Meine Großtante nickt. «Ich schreibe dem Dauphin Charles, er wird sie auslösen», erklärt sie. «Was seine Berater auch sagen, er hört immer noch auf mich, obgleich er sich von seinen Günstlingen wie ein Blatt durch die Luft pusten lässt. Schließlich bin ich seine Patentante. Es ist eine Frage der Ehre. Alles, was er ist, hat er der Jungfrau zu verdanken.»
«Gut. Aber tu es gleich. Die Engländer setzen mich unter Druck, und ich werde den Duke of Bedford gewiss nicht vor den Kopf stoßen. Er ist ein mächtiger Mann, und ein gerechter dazu. Wir könnten uns keinen besseren Herrscher über Frankreich wünschen. Wenn er Franzose wäre, würden ihn alle lieben.»
Meine Großtante lacht. «Ja, aber er ist keiner! Er ist der englische Regent, und er sollte auf seine eigene verregnete Insel zu seinem kleinen Neffen, dem armen König, zurückkehren, sich um sein Königreich kümmern und uns Frankreich in Ruhe regieren lassen.»
«Uns?», erkundigt sich mein Onkel, als wollte er sie fragen, ob sie glaube, unsere Familie, die bereits ein halbes Dutzend Fürstentümer regiert und mit den heiligen römischen Kaisern deutscher Nation verwandt ist, sollte auch die französischen Könige stellen.
Sie lächelt. «Uns», erwidert sie unbewegt.
Am nächsten Tag begleite ich Johanna in die kleine Burgkapelle und knie mich neben sie auf die Altarstufen. Sie betet inbrünstig, eine Stunde lang hält sie den Kopf gesenkt, bis der Priester kommt, die Messe liest und Johanna das heilige Brot und den geweihten Wein empfängt. Ich warte hinten in der Kirche auf sie. Johanna ist die Einzige, die jeden Tag Brot und Wein zu sich nimmt, als sei es ihr Frühstück. Selbst meine Mutter, die frömmer ist als die meisten Menschen, empfängt nur einmal im Monat den Leib Christi. Nach der Messe gehen wir zusammen zu den Gemächern meiner Großtante, unter unseren Füßen rascheln die ausgestreuten Kräuter. Johanna lacht, als ich mich bücke, damit mein Hennin unter den niedrigen Türen hindurchpasst.
«Er ist sehr schön», sagt sie. «Aber ich möchte so ein Ding nicht tragen.»
Ich bleibe stehen, dann drehe ich mich vor ihr im hellen Sonnenschein. Mein buntes Kleid schimmert: ein dunkelblauer Rock und ein türkisfarbener Unterrock, die weit vom hohen, engen Gürtel um meinen Brustkorb fallen. Mein Kopfschmuck sitzt mir wie ein Kegel auf dem Kopf. Ein blassblauer Schleier ergießt sich von der Spitze über meinen Rücken, er verdeckt und betont mein blondes Haar gleichermaßen. Ich breite die Arme aus, um ihr die ausladenden dreieckigen Ärmel vorzuführen, die mit dem schönsten Goldfaden bestickt sind, dann raffe ich die Röcke, um ihr meine scharlachroten Schnabelschuhe mit den nach oben gebogenen Spitzen zu zeigen.
«Aber in so einem Kleid kannst du weder arbeiten noch auf ein Pferd steigen, noch rennen», sagt sie.
«Es ist ja auch nicht zum Reiten, Arbeiten oder Rennen gedacht», antworte ich ganz vernünftig. «Es ist zum Prahlen gemacht. Es soll der Welt zeigen, dass ich jung und schön bin, bereit zum Heiraten. Und dass mein Vater so wohlhabend ist, mir Goldfäden in die Ärmel nähen und meinen Kopfschmuck mit Seide ausschlagen zu lassen. Weil ich von edler Geburt bin, werde ich in Samt und Seide gekleidet und nicht in Wolle wie ein armes Mädchen.»
«Ich könnte es nicht ertragen, in so einem Ding vorgeführt zu werden.»
«Man würde es dir auch gar nicht erlauben», bemerke ich verdrießlich. «Man muss sich seiner Stellung gemäß anziehen. Du hast dem Gesetz Folge zu leisten und dich in Braun und Grau zu kleiden. Hast du wirklich gedacht, du wärst wichtig genug, um Hermelin zu tragen? Oder willst du deinen goldenen Wappenrock zurück? Man erzählt sich, du hättest in der Schlacht so schmuck ausgesehen wie ein Ritter. Du hast dich wie ein Adliger gekleidet. Man sagt auch, du hättest deine schöne Standarte geliebt und deine glänzende Rüstung und hättest darüber einen schönen goldenen Wappenrock getragen. Man sagt, du hättest die Sünde der Eitelkeit begangen.»
Sie wird rot. «Ich musste an der Spitze meiner Armee doch gesehen werden», verteidigt sie sich.
«Gold?»
«Zu Ehren Gottes.»
«Auch wenn du Frauenkleider tragen würdest, bekämst du keinen solchen Kopfschmuck», sage ich. «Du würdest etwas Bescheideneres tragen, wie die Hofdamen, nicht so etwas Hohes oder Unbequemes, einfach eine hübsche Haube, die dein Haar bedeckt. Unter dem Kleid könntest du deine Stiefel tragen, dann könntest du laufen wie jetzt. Warum versuchst du es nicht einfach mal mit einem Kleid, Jeanne? Dann können sie dich nicht mehr bezichtigen, Männerkleider zu tragen. Es ist Ketzerei, wenn eine Frau sich wie ein Mann anzieht. Wenn du ein Kleid trägst, haben sie nichts mehr gegen dich vorzubringen. Irgendetwas Schlichtes?»
Sie schüttelt den Kopf. «Ich bin versprochen», sagt sie nur. «Dem Herrn versprochen. Und wenn der König nach mir ruft, muss ich bereit sein, in den Kampf zu reiten. Ich bin ein Soldat auf Abruf, keine Hofdame. Also kleide ich mich wie ein Soldat. Und mein König wird jeden Moment nach mir schicken.»
Ich sehe mich um. Ein Page, der einen Krug heißes Wasser trägt, ist in Hörweite. Erst als er mit einer Verbeugung vorbeigegangen ist, spreche ich weiter. «Scht», sage ich leise. «Du solltest ihn nicht König nennen.»
Sie lacht, als fürchtete sie sich nicht. «Ich habe ihn zur Krönung geführt, ich habe unter meiner eigenen Standarte in der Kathedrale von Reims gestanden, als er mit dem heiligen Öl von Chlodwig gesalbt wurde. Ich habe gesehen, wie er gekrönt vor sein Volk trat. Natürlich ist er der König von Frankreich. Er wurde gekrönt und gesalbt.»
«Die Engländer spalten jedem die Zunge, der das sagt», ermahne ich sie. «Und zwar beim ersten Mal. Wer es noch einmal sagt, dem brandmarken sie die Stirn, sodass er für sein Leben entstellt ist. Man muss den englischen König, Henry VI., König von Frankreich nennen. Der, den du als französischen König bezeichnest, soll Dauphin heißen, niemals anders als Dauphin.»
Sie lacht vergnügt. «Man soll ihn noch nicht einmal einen Franzosen nennen», ruft sie aus. «Euer großer Duke of Bedford sagt, er wäre ein Armagnake. Aber der große Duke of Bedford hat vor Furcht gezittert und in Rouen panisch nach Rekruten gesucht, als ich mit der französischen Armee – ja, ich spreche es aus! – vor den Mauern von Paris stand, mit der französischen Armee, um unsere Stadt für unseren König einzunehmen, unseren französischen König. Und fast hätten wir sie auch eingenommen.»
Ich halte mir die Ohren zu. «Ich höre dir gar nicht zu! Sprich nicht so! Sie peitschen mich aus, wenn ich dir zuhöre.»
Da nimmt sie mich sofort reumütig bei den Händen. «Ach, Jacquetta, ich will dich nicht in Schwierigkeiten bringen. Bestimmt nicht! Ich sage nichts mehr. Aber du verstehst doch, dass ich viel Schlimmeres getan habe, als mich mit Worten gegen die Engländer zu wehren. Ich habe sie mit Pfeilen und Kanonenschüssen, mit Rammböcken und Gewehren angegriffen! Mit den Worten, die ich sage, und den Hosen, die ich trage, werden die Engländer sich kaum aufhalten. Ich habe sie besiegt und allen gezeigt, dass sie kein Anrecht auf Frankreich haben. Ich habe eine Armee gegen sie angeführt und sie ein ums andere Mal besiegt.»
«Ich hoffe, sie kriegen dich nie in die Hände, um dich zu befragen. Weder über Worte noch über Pfeile, noch über Kanonen.»
Bei dem Gedanken wird sie blass. «Bitte, lieber Gott, das hoffe ich auch. Barmherziger Gott, das hoffe ich auch.»
«Mein Großtante schreibt dem Dauphin», erzähle ich ihr leise. «Sie hat gestern beim Abendessen davon gesprochen. Sie will ihn auffordern, sein Lösegeld für dich zu nennen. Dann überstellt mein Onkel dich den Fr… den Armagnaken.»
Sie senkt den Kopf und spricht ein stilles Gebet. «Mein König wird nach mir schicken», sagt sie vertrauensvoll. «Gewiss ruft er mich bald zu sich, und dann können wir wieder ins Feld ziehen.»
Im August wird es sogar noch heißer, und meine Großtante ruht sich jeden Nachmittag in ihrem privaten Gemach aus. Die feinen Seidenvorhänge sind mit Lavendelwasser getränkt, und die geschlossenen Läden werfen ein Gittermuster auf den Fußboden. Sie mag es, wenn ich ihr vorlese, während sie mit geschlossenen Augen und auf der Brust gefalteten Händen daliegt, als wäre sie das Stein gewordene Abbild ihrer selbst in einer schattigen Gruft. Die große Hörnerhaube, die sie immer trägt, legt sie zur Seite und lässt die langen, grauen Haare offen über die kühlen bestickten Kissen fallen. Sie gibt mir Bücher aus ihrer eigenen Bibliothek, große Liebesgeschichten von Troubadouren und Damen in dunklen Wäldern. Eines Nachmittags drückt sie mir ein Buch in die Hand und sagt: «Lies mir heute dieses vor.»
Es ist in Altfranzösisch geschrieben, ich stolpere über die Wörter. Es ist schwer zu lesen: Die Illustrationen am Rand sind wie dornige Ranken und Blumen, die sich um die Buchstaben winden, und ich kann die verschnörkelte Handschrift des Kopisten, der das Buch abgeschrieben hat, nur mühsam entziffern. Doch langsam entwickelt sich die Geschichte. Sie handelt von einem Ritter, der sich verirrt hat und durch einen finsteren Wald reitet. Als er ein Plätschern hört, reitet er darauf zu. Im Mondlicht erblickt er auf einer Lichtung einen hellen Teich, aus dem eine Fontäne emporsteigt. Im Wasser darunter badet eine wunderschöne Frau. Ihre Haut ist weißer als weißer Marmor, und ihre Haare sind dunkler als der Nachthimmel. Er verliebt sich augenblicklich in sie und sie sich in ihn, und so bringt er sie auf seine Burg und nimmt sie zur Frau. Sie stellt nur eine Bedingung: Einmal im Monat muss er sie alleine baden lassen.
«Kennst du diese Geschichte?», fragt mich meine Großtante. «Hat dein Vater sie dir schon einmal erzählt?»
«Eine ähnliche habe ich schon einmal gehört», sage ich vorsichtig. Meine Großtante ist berüchtigt für ihre Wutanfälle meinem Vater gegenüber, und daher weiß ich nicht, ob ich es wagen kann zu sagen, dass ich die Erzählung für die Gründungslegende unseres Hauses halte.
«In jedem Fall liest du jetzt die wahre Geschichte», sagt sie und schließt die Augen. «Es wird aber auch Zeit. Lies weiter.»
Das junge Paar ist unendlich glücklich, und von fern und nah kommen Besucher. Die beiden werden Eltern von schönen Mädchen und merkwürdigen wilden Jungen.
«Söhne», flüstert meine Großtante bei sich. «Könnte eine Frau vom Wünschen doch nur Söhne bekommen, die werden, wie sie sie sich erträumt.»
Die Jahre vergehen, aber die Frau bleibt schön wie eh und je, und ihr Gemahl wird immer neugieriger. Eines Tages erträgt er das Rätsel um ihre heimlichen Bäder nicht mehr, schleicht zu ihrem Badehaus hinunter und spioniert ihr nach.
Meine Großtante hebt die Hand. «Weißt du, was er sieht?», fragt sie mich.
Ich hebe den Blick vom Buch, mein Finger liegt noch unter der Abbildung des Mannes, der durch die Bretter des Badehauses späht. Im Vordergrund ist die Frau im Bad zu sehen, ihre schönen Haare schmiegen sich um ihre weißen Schultern. Und durch das Wasser schimmert … ihr großer, schuppiger Schwanz.
«Ist sie ein Fisch?», flüstere ich.
«Sie ist kein Wesen von dieser Welt», antwortet meine Großtante leise. «Sie hat versucht zu leben wie eine gewöhnliche Frau, doch manche Frauen können kein gewöhnliches Leben führen. Sie hat versucht, die normalen Wege zu gehen, aber einige Frauen können ihre Füße nicht auf diese Pfade setzen. Wir leben in einer Männerwelt, Jacquetta, und es gibt Frauen, die nicht nach dem Takt der Trommel eines Mannes marschieren können. Verstehst du das?»
Natürlich nicht. Ich bin zu jung, um zu begreifen, dass ein Mann und eine Frau sich so sehr lieben können, dass ihre Herzen im selben Rhythmus zu schlagen scheinen, sie zugleich aber genau wissen, wie hoffnungslos verschieden sie sind.
«Wie auch immer, du kannst weiterlesen. Es ist nicht mehr viel.»
Der Gemahl erträgt es nicht, dass seine Frau ein fremdes Wesen ist. Und sie kann ihm nicht vergeben, dass er ihr nachspioniert hat. Sie verlässt ihn und nimmt ihre schönen Töchter mit, während er mit gebrochenem Herzen bei den Söhnen zurückbleibt. Doch als er stirbt, kommt seine Frau Melusine, die schöne Frau, die eine Undine, eine Wassergöttin war, zu ihm zurück, und er hört sie an den Festungsmauern weinen um die Kinder, die sie verloren hat, um den Gemahl, den sie immer noch liebt, und um die Welt, in der kein Platz für sie ist – so wie sie es bis heute tut, wenn einer aus unserem Hause stirbt.
Ich schließe das Buch, und es breitet sich ein so langes Schweigen aus, dass ich glaube, meine Großtante sei eingeschlafen.
«Einige Frauen unserer Familie besitzen die Gabe des Voraussagens», bemerkt meine Tante leise. «Einige haben Melusines Kräfte geerbt, Kräfte der anderen Welt, in der sie lebt. Einige von uns sind ihre Töchter, ihre Erbinnen.»
Ich wage kaum zu atmen, so gespannt bin ich auf das, was sie mir zu sagen hat.
«Jacquetta, glaubst du, du könntest eine dieser Frauen sein?»
«Vielleicht», flüstere ich. «Ich hoffe es.»
«Du musst zuhören», sagt sie sanft. «Der Stille lauschen, nach nichts Ausschau halten. Und wachsam sein. Melusine ist eine Gestaltwandlerin, wie Quecksilber, sie fließt von einem Ding zum nächsten. Du kannst sie überall sehen, sie ist wie Wasser. Aber manchmal siehst du auch nur dein eigenes Spiegelbild auf der Wasseroberfläche eines Flusses, sosehr du auch in die grünen Tiefen starrst.»
«Wird sie mich lenken?»
«Das musst du selbst tun, aber es kann geschehen, dass du sie hörst, wenn sie mit dir spricht.» Sie hält inne. «Bring mir meine Schmuckschatulle.» Sie deutet auf die große Truhe am Fußende des Bettes. Ich öffne den knarzenden Deckel. Dort liegen Kleider, die in gepuderte Seide eingehüllt sind, und daneben steht eine große Holzkiste, deren Schubladen mit den kostbaren Juwelen meiner Großtante gefüllt sind. «Sieh in der kleinsten Schublade nach», sagt sie.
Darin liegt eine kleine Samtbörse. Als ich die quastenverzierten Bänder aufbinde und die Börse öffne, fällt mir ein schweres goldenes Armband in die Hand, mit gewiss zweihundert verschiedenen kleinen Glücksbringern behängt. Ein Schiff, ein Pferd, ein Stern, ein Löffel, eine Peitsche, ein Falke, ein Paar Sporen.
«Wenn du etwas wissen willst, das dir ganz besonders wichtig ist, dann wähle zwei oder drei Glücksbringer als Symbole für die Zukunft oder für die Dinge oder Wege, zwischen denen du wählen kannst. Binde jeden an einen Faden und wirf sie in einen Fluss, in den Fluss, der deinem Haus am nächsten ist, den du in der Nacht hörst, wenn alles verstummt ist, nur die Stimme des Wassers nicht. Dort bleiben sie bis zum Vollmond. Dann schneide alle Fäden bis auf einen durch und den ziehe heraus, um deine Zukunft zu erkennen. Der Fluss gibt dir die Antwort. Der Fluss wird dir sagen, was du zu tun hast.»
Ich nicke. Das Armband liegt kalt und schwer in meiner Hand, jeder Glücksbringer eine Wahl, eine Möglichkeit, ein künftiger Fehler.
«Und wenn du dir etwas wünschst: Geh hinaus und flüstere es dem Fluss zu – als würdest du beten. Wenn du jemanden verfluchst: Schreib es auf ein Stück Papier und lass es wie ein Papierschiffchen auf dem Fluss schwimmen. Der Fluss ist dein Verbündeter, dein Freund – verstehst du mich?»
Ich nicke, auch wenn ich gar nichts verstehe.
«Wenn du jemanden verfluchst …» Sie macht eine Pause und seufzt, als wäre sie müde. «Achte auf deine Worte, Jacquetta, vor allem beim Fluchen. Sag nur, was du wirklich meinst, sei sicher, dass du den Richtigen mit deinem Fluch belegst. Denn wenn du solche Worte in die Welt hinausschickst, können sie ihr Ziel verfehlen – ein Fluch kann wie ein Pfeil am Ziel vorbeischießen und einen anderen treffen. Eine weise Frau verflucht nur äußerst selten.»
Ich schaudere, obwohl es im Zimmer warm ist.
«Ich werde dich noch mehr lehren», verspricht sie mir. «Es ist dein Erbe, denn du bist das älteste Mädchen.»
«Wissen Jungen nichts davon? Mein Bruder Louis?»
Aus ihren halb geöffneten Augen fällt ein träger Blick auf mich, und sie lächelt. «Männer herrschen über die Welt, die sie kennen», erwidert sie. «Was Männer kennen, unterwerfen sie. Was sie in Erfahrung bringen, beanspruchen sie für sich. Sie sind wie Alchemisten, die nach den Gesetzen suchen, die die Welt regieren, um sie zu besitzen und geheim zu halten. Alles, was sie entdecken, eignen sie sich an, und ihre Erkenntnisse formen sie nach ihrem eigenen selbstsüchtigen Bild. Was bleibt uns Frauen da, außer dem Reich des Unbekannten?»
«Aber kann eine Frau keinen wichtigen Platz in der Welt einnehmen? Du tust es, Großtante, und Jolanthe von Aragón wird die Königin der vier Königreiche genannt. Werde ich nicht über weite Gebiete herrschen so wie ihr?»
«Vielleicht. Aber ich warne dich: Eine Frau, die nach großer Macht und Wohlstand strebt, zahlt dafür einen hohen Preis. Vielleicht wirst du eine große Frau wie Melusine, Jolanthe oder ich, aber es wird dir gehen wie allen Frauen, du wirst dich unbehaglich fühlen in der Welt der Männer. Du wirst dein Bestes geben – vielleicht kommst du durch eine Heirat oder ein Erbe an die Macht –, aber du wirst das Pflaster unter deinen Füßen immer hart finden. In der anderen Welt – nun, wer kennt sich da schon aus? Vielleicht werden sie dich hören und du sie.»
«Was werde ich hören?»
Sie lächelt. «Das weißt du. Du hörst es doch schon.»
«Stimmen?», frage ich und denke an Johanna.
«Vielleicht.»
Langsam ebbt die Hitzewelle ab, und im September wird es kühler. Die Bäume des großen Waldes am See wechseln die Farbe von müdem Grün zu einem vertrockneten Gelb, und die Schwalben schwirren jeden Abend um die Türmchen der Burg, als wollten sie sich bis zum nächsten Jahr verabschieden. Sie jagen sich in schwindelerregendem Taumeln, wie Schleier, die beim Tanzen durch die Luft gewirbelt werden. In den langen Reihen der Rebstöcke werden die Trauben schwer, und jeden Tag gehen die stämmigen Bauersfrauen mit hochgekrempelten Ärmeln hinaus, pflücken die Weintrauben und legen sie in große Weidenkörbe, die von den Männern in Karren geleert und zur Presse gefahren werden. Ein starker Geruch nach Obst und gärendem Wein liegt über dem Dorf, alle haben violette Füße und blaue Flecken an Hosen und Röcken. Es heißt, die Ernte sei gut dieses Jahr, reich und üppig. Wenn ich mit den Hofdamen durch das Dorf reite, rufen sie uns heran, damit wir den neuen Wein kosten, der hell und sauer ist und im Mund prickelt, und dann lachen sie über unsere zusammengezogenen Gesichter.
Meine Großtante sitzt nicht mehr aufrecht in ihrem Sessel, um ihre Frauen zu beaufsichtigen und über sie hinweg auf die Burg und die Ländereien meines Onkels zu blicken wie zu Beginn des Sommers. Während die Sonne ihre Kraft verliert, scheint auch sie blass und kalt zu werden. Vom späten Vormittag bis zum frühen Abend ruht sie im Liegen und erhebt sich nur, um an der Seite meines Onkels in die große Halle zu gehen. Wenn die Männer den Lord und die Lady kommen sehen und mit ihren Dolchen auf die Holztische klopfen, beantwortet sie die polternde Begrüßung mit einem Kopfnicken.
Johanna betet auf ihrem täglichen Kirchgang für sie, doch ich finde mich einfach wie ein Kind mit dem veränderten Tagesablauf meiner Großtante ab. Am Nachmittag setze ich mich zu ihr, um ihr vorzulesen und darauf zu warten, dass sie mir etwas über die Gebete erzählt, die wie Papierschiffchen auf dem Fluss ins Meer getrieben sind, bevor ich geboren wurde. Dann breite ich die Karten ihres Spiels aus, und sie erklärt mir deren Namen und Bedeutungen.
«Und jetzt lies für mich aus ihnen», sagt sie eines Tages und klopft mit ihren dünnen Fingern auf eine Karte. «Was ist das für eine?»
Ich drehe sie um. Der dunkle Kapuzenmann, der Tod, sieht uns an, das Gesicht im Schatten der Kapuze verborgen, die Sichel über der gebeugten Schulter.
«Ach», sagt sie nur. «Bist du also endlich gekommen, mein Freund? Jacquetta, bitte deinen Onkel zu mir.»
Ich führe ihn in ihr Gemach, wo er neben ihrem Bett niederkniet.
Sie legt ihm die Hand auf den Kopf, als wollte sie ihn segnen. Dann drückt sie ihn sanft weg.
«Ich ertrage dieses Wetter nicht», sagt sie gereizt zu meinem Onkel, als könnte er etwas dafür. «Wie hältst du es aus, hier zu leben? Es ist so kalt wie in England, und die Winter dauern ewig. Ich reise in den Süden, in die Provence.»
«Bist du sicher?», fragt er. «Ich dachte, du wärst müde. Möchtest du dich nicht lieber hier ausruhen?»
Missgelaunt schnalzt sie mit den Fingern. «Mir ist zu kalt», erwidert sie herrisch. «Bestell mir eine Eskorte. Ich lasse die Sänfte mit Fellen ausschlagen. Im Frühling komme ich zurück.»
«Du hättest es hier viel behaglicher», wendet er ein.
«Ich habe mir in den Kopf gesetzt, noch einmal die Rhône zu sehen», entgegnet sie. «Außerdem habe ich eine geschäftliche Angelegenheit zu regeln.»
Niemand widerspricht ihr – sie ist die Demoiselle –, und so steht ein paar Tage später ihre große Sänfte vor der Tür, Felle liegen auf den Polstern, ein Handwärmer aus Messing ist mit heißen Kohlen gefüllt, der Boden der Sänfte mit geheizten Ziegelsteinen bestückt, und der Haushalt steht bereit, um sie zu verabschieden.
Sie reicht Johanna die Hand, dann küsst sie meine Tante Jehanne und mich. Mein Onkel hilft ihr in die Sänfte, und sie klammert sich mit ihrer dünnen Hand an seinen Arm. «Pass gut auf die Jungfrau auf», bittet sie ihn. «Bewahre sie vor den Engländern. Das ist ein Befehl.»
Er senkt den Kopf. «Komm bald wieder zurück.»
Seine Frau, deren Leben leichter ist, wenn die große Dame nicht da ist, tritt vor, wickelt sie in die Felle und küsst ihre blassen, kühlen Wangen. Doch mich ruft die Demoiselle von Luxemburg mit einer Bewegung ihres mageren Fingers zu sich.
«Gott schütze dich, Jacquetta», sagt sie zu mir. «Du wirst dich an alles erinnern, was ich dich gelehrt habe. Und du wirst es weit bringen.» Sie lächelt mich an. «Weiter, als du dir vorstellen kannst.»
«Aber werde ich dich im Frühling wiedersehen?»
«Ich lasse dir meine Bücher schicken», erwidert sie nur. «Und mein Armband.»
«Und im Frühjahr besuchst du meine Eltern in St. Pol?»
Ihr Lächeln verrät mir, dass ich sie nicht mehr wiedersehen werde. «Gott segne dich», sagt sie noch einmal und zieht vor der kalten Morgenluft die Vorhänge ihrer Sänfte zu, als sich der Trupp durch das Tor in Bewegung setzt.
Im November erwache ich in tiefster Nacht, setze mich in dem kleinen Bett auf, das ich mir mit der Magd Elizabeth teile, und lausche. Es ist, als riefe jemand mit einer lieblichen, sehr hohen und sehr feinen Stimme meinen Namen. Dann bin ich mir sicher, dass ich jemanden singen höre. Merkwürdigerweise kommt es von draußen, direkt vor den Fenstern, obwohl wir doch hoch oben im Turm der Burg schlafen. Ich werfe mir den Umhang über das Nachthemd und gehe zum Fenster, um durch einen Spalt in den Holzläden nach draußen zu spähen. Keine Lichter sind zu sehen, die Felder und Wälder um die Burg sind so schwarz wie gefilzte Wolle, da ist nichts als diese klare Totenklage, hoch und rein wie eine Nachtigall. Keine Eule, dafür ist es zu musikalisch und andauernd, eher wie die Stimme eines Chorknaben. Ich rüttele an Elizabeths Schultern.
«Hörst du das?»
Sie wird nicht einmal richtig wach. «Ich höre nichts», sagt sie schlaftrunken. «Lasst das, Jacquetta. Ich will schlafen.»
Der Steinboden unter meinen Füßen ist eiskalt. Ich steige wieder ins Bett und schiebe die kalten Füße zwischen die warmen Decken neben Elizabeth. Sie knurrt missmutig und rollt sich von mir weg. Und obwohl ich überzeugt bin, dass ich noch lange in der Wärme liegen und der Stimme zuhören werde, schlafe ich doch bald wieder ein.
Sechs Tage später teilt man mir mit, dass meine Großtante, Jehanne von Luxemburg, in der dunkelsten Stunde der Nacht im Schlaf gestorben ist, in Avignon am großen Fluss, an der Rhône. Da weiß ich, wessen Stimme ich gehört habe, wessen Lied um die Türme erklungen ist.
Als der englische Duke of Bedford erfährt, dass Johanna ihre größte Beschützerin verloren hat, schickt er den Richter Pierre Cauchon mit einer Truppe Männer zu uns. Er soll ihr Lösegeld verhandeln. Sie wird unter der Anklage der Ketzerei vor ein kirchliches Gericht geladen. Es geht um ungeheuerliche Summen: zwanzigtausend Livre für den Mann, der sie vom Pferd gezogen hat, zehntausend Francs für meinen Onkel mit den besten Wünschen des Königs von England. Mein Onkel hört nicht auf seine Frau, die Johanna bei uns behalten will. Ich bin zu unwichtig, ich habe keine Stimme, und so muss ich stumm mit ansehen, wie mein Onkel einwilligt, Johanna der Kirche zur Befragung zu überstellen.
«Ich händige sie nicht den Engländern aus», sagt er zu seiner Frau. «Darum hat die Demoiselle mich gebeten, und ich habe es nicht vergessen. Ich lasse sie nur der Kirche überstellen. Dort kann sie ihren Namen von allen Anklagen reinwaschen. Sie wird von Männern Gottes angeklagt, und wenn sie unschuldig ist, werden sie es herausfinden und sie freilassen.»
Sie sieht ihn ausdruckslos an, als wäre er der Tod persönlich, und ich frage mich, ob er diesen Unsinn wirklich glaubt. Oder ob er denkt, wir Frauen wären solche Närrinnen, dass wir annehmen, eine Kirche, die von den Engländern abhängig ist, deren Bischöfe von den Engländern ernannt werden, werde ihren Herrschern und Geldgebern erklären, die Jungfrau, die ganz Frankreich gegen sie aufgebracht hat, sei nur ein ganz gewöhnliches Mädchen, vielleicht etwas vorlaut, vielleicht auch ein wenig ungezogen, man solle ihr drei Ave-Maria auferlegen und sie auf ihren Bauernhof zurückschicken, zu ihrer Mutter und ihrem Vater und ihren Kühen.
«Mylord, wer wird es Jeanne sagen?», ist alles, was ich mich zu fragen traue.
«Oh, sie weiß es schon», sagt er über die Schulter, während er aus der Halle geht, um Pierre Cauchon am großen Tor zu verabschieden. «Ich habe einen Pagen geschickt, der ihr ausrichten soll, sich bereitzuhalten. Sie muss jetzt gleich mit ihnen gehen.»
Als ich das höre, werde ich von abgrundtiefem Entsetzen gepackt. Ich habe eine Vorahnung und renne los, renne, als gelte es mein Leben. Nicht zu den Frauengemächern, wo der Page Johanna gefunden haben wird, um ihr mitzuteilen, dass die Engländer sie bekommen werden. Nicht zu ihrer alten Zelle, wo sie ihren kleinen Rucksack geholt haben könnte, in dem ihre Sachen sind: ihr Holzlöffel, ihr scharfer Dolch, das Gebetbuch, das meine Großtante ihr geschenkt hat. Nein, ich haste die gewundene Treppe zum ersten Stock hinauf, schieße durch die Galerie und durch die niedrige Tür, deren Torbogen meinen Kopfschmuck herunterreißt, dass die Nadeln an meinen Haaren ziehen, und stürme die Wendeltreppe hinauf. Meine Füße poltern auf den Steinstufen, mein Atem geht stoßweise, das Kleid halte ich mit den Händen gerafft, und so stürze ich hinaus auf das flache Dach des Turms und sehe Johanna, auf der Mauer balancierend, bereit, wie ein Vogel zu fliegen. Als sie die Tür knallen hört, sieht sie mich über die Schulter an, und ich schreie: «Nein! Jeanne!», und dann macht sie einen Schritt ins Leere.
Das Schlimmste von allem, das Allerschlimmste ist, dass sie nicht springt wie ein erschrecktes Reh. Ich hatte Angst, sie würde springen, doch sie tut etwas viel Schlimmeres. Sie macht einen Hechtsprung. Kopfüber springt sie über die Zinne, und als ich an die Mauerkrone haste, sehe ich, dass sie wie eine Tänzerin hinunterfliegt, wie eine Akrobatin, die Hände hinter dem Rücken, ein Bein ausgestreckt, das andere gebeugt, die Zehen zum Knie gerichtet, und ich sehe, dass sie in diesem atemberaubenden Moment, da sie fällt, die Haltung des Pendu, des Gehängten, angenommen hat. Und dass sie mit seinem ruhigen Lächeln auf ihrem ernsten Gesicht kopfüber in den Tod geht.
Das dumpfe Aufschlagen am Fuß des Turms ist entsetzlich. Es hallt mir in den Ohren wider, als würde mein Kopf dort unten im Matsch feststecken. Ich will hinunterrennen, um sie aufzuheben, die Jungfrau von Orléans, die dort unten liegt wie ein Bündel alter Kleider. Aber ich kann mich nicht bewegen. Meine Knie geben nach, ich klammere mich an den Steinzinnen fest, die so kalt sind wie meine zerkratzten Hände. Ich weine nicht um sie, auch wenn mein Atem immer noch stockend geht; ich bin erstarrt vor Entsetzen, mir zieht es den Boden unter Füßen weg. Johanna war eine junge Frau, die versuchte, in der Welt der Männer ihren eigenen Weg zu gehen, genau wie es mir meine Großtante erzählt hat. Und dieser Weg hat sie hierhergeführt, zu diesem kalten Turm, zu diesem Kopfsprung, in diesen Tod.
Sie heben die Leblose hoch, und vier Tage bewegt und rührt sie sich nicht, doch dann erwacht sie aus ihrer Erstarrung, steht langsam aus dem Bett auf und klopft sich ab, als wollte sie sichergehen, dass sie noch ganz ist. Erstaunlicherweise hat sie sich nichts gebrochen – sie hat sich weder den Schädel eingeschlagen noch auch nur einen Finger verrenkt. Als hätten Engel sie gehalten, als sie sich ihrem Element anvertraut hat. Das nützt ihr natürlich nichts. Bald erzählt man sich, dass nur der Teufel ein Mädchen retten konnte, das kopfüber von so einem hohen Turm gesprungen ist. Wenn sie gestorben wäre, hätten sie gesagt, Gottes Gerechtigkeit sei Genüge getan worden. Mein Onkel, ein mürrischer und praktisch veranlagter Mann, meint, der Boden sei nach dem wochenlangen Regen und der Überflutung durch den Wassergraben so aufgeweicht gewesen, dass ihr die größte Gefahr durch Ertrinken gedroht habe, aber nun hat er entschieden, dass sie uns sofort verlassen muss. Ohne die schützende Hand der Demoiselle will er die Verantwortung für die Jungfrau nicht länger tragen. Er schickt sie zunächst in sein Haus in Arras, und wir folgen ihr, als sie in der englischen Stadt Rouen vor Gericht gestellt wird.
Wir müssen daran teilnehmen. Ein großer Lord wie mein Onkel muss anwesend sein, um sich davon zu überzeugen, dass ihr Gerechtigkeit widerfährt, und sein Haushalt muss hinter ihm stehen. Meine Tante Jehanne nimmt mich mit, um das Ende der heiligen Führung des Dauphins mitzuerleben – der vorgeblichen Prophetin des falschen Königs. Halb Frankreich strömt nach Rouen, um das Ende der Jungfrau mitzuerleben, und wir müssen unter den Ersten sein.
Obwohl sie behaupten, sie sei nur ein wild gewordenes Bauernmädchen, gehen sie kein Wagnis ein. Sie wird in der Burg Bouvreuil gehalten, in Ketten, in einer Zelle mit doppelt verriegelter Tür und verbarrikadiertem Fenster. Alle haben Angst, sie könnte sich wie ein Mäuschen unter der Tür hindurchquetschen oder wie ein Vogel durch eine Ritze im Fenster davonfliegen. Sie soll ihnen das Versprechen geben, keinen Fluchtversuch zu unternehmen. Und als sie sich weigert, ketten sie sie ans Bett.
«Das wird ihr nicht gefallen», sagt meine Tante Jehanne traurig.
«Nein.»
Sie warten auf den Duke of Bedford, und in den letzten Dezembertagen marschiert er tatsächlich in die Stadt ein, mit seiner Eskorte in den Farben von Rosen, dem hellen Rot und dem Weiß Englands. Ein großer Mann hoch zu Ross, die Rüstung so poliert, dass sie glänzt wie Silber, das Gesicht unter dem gewaltigen Helm streng und hart. Seine Nase ist ein großer Zinken, was ihm das Aussehen eines Raubvogels verleiht, eines Adlers. Er ist der Bruder des großen englischen Königs Henry V., und er wacht über die Besitzungen, die dieser bei der großen Schlacht von Azincourt erobert hat. Jetzt ist der junge Sohn des verstorbenen Königs der neue Sieger von Frankreich, und Bedford ist dessen loyalster Onkel: immer gerüstet, immer im Sattel, niemals in friedlicher Mission.
Wir stehen alle am großen Tor von Bouvreuil Spalier, als er einreitet, und sein dunkler Blick gleitet über jeden Einzelnen von uns, als könnte er Verrat riechen. Meine Tante und ich sinken in einen tiefen Knicks, und mein Onkel lüftet seine Kappe und verbeugt sich. Unser Haus ist seit Jahren mit den Engländern verbündet. Mein anderer Onkel, Louis von Luxemburg, ist Kanzler des Herzogs, er schwört, Bedford sei der größte Mann, der Frankreich je regiert habe.
Schwer sitzt er ab, dann steht er wie eine Festung vor den Männern, die sich angestellt haben, um ihn zu begrüßen, die sich über seine Hand beugen oder sogar fast auf ein Knie niederlassen. Ein Mann tritt vor, und als Bedford ihm herrschaftlich von oben herab zunickt, geht sein Blick am Kopf des Vasallen vorbei und bleibt an mir hängen. Natürlich starre ich ihn an – seine Ankunft ist ein großes Spektakel an diesem kalten Wintertag –, doch jetzt erwidert er meinen Blick mit einem Funkeln, das ich nicht deuten kann. Es hat etwas von plötzlichem Hunger, so wie ein Fastender ein Bankett betrachtet. Ich trete zurück. Ich bin weder ängstlich noch kokett, aber ich bin erst vierzehn und möchte die Macht und das Feuer dieses Mannes nicht in meine Richtung lenken. Ich verberge mich hinter meiner Tante und beobachte den Rest der Begrüßung hinter ihrem Kopfschmuck und Schleier hervor.
Eine große Sänfte trifft ein, die dicken Vorhänge mit goldenen Kordeln gegen die Kälte zugezogen. Man hilft Bedfords Gemahlin, Herzogin Anne, heraus. Unsere Männer begrüßen sie mit gedämpften Hurrarufen. Sie stammt aus dem Hause Burgund, unseren Lehnsherren und Verwandten, und so verneigen wir uns vor ihr. Sie ist so unscheinbar wie die ganze Burgunder Linie, die armen Dinger, aber ihr Lächeln ist fröhlich, und sie begrüßt ihren Gemahl herzlich. Dann steht sie neben ihm, hat sich locker bei ihm untergehakt und sieht sich mit heiterem Gesicht um. Sie winkt meiner Tante zu und deutet zur Burg: Wir sollen später zu ihr kommen. «Wir gehen zum Abendessen», flüstert meine Tante mir zu. «Niemand speist besser als die Herzöge von Burgund.»
Bedford nimmt den Helm ab, verneigt sich vor der versammelten Menge und winkt den Menschen, die sich aus Fenstern lehnen und auf Gartenmauern balancieren, knapp mit einem Panzerhandschuh zu. Dann dreht er sich um und führt seine Frau hinein, und zurück bleibt das Gefühl, einer Schauspielergruppe bei der Eröffnungsszene eines Wandertheaters zugesehen zu haben. Doch ob es nun ein Maskenspiel ist, ein Fest, ein Begräbnisritual oder das Ködern eines wilden Tieres, was so viele der größten Häupter Frankreichs nach Rouen geführt hat: Es wird in Kürze beginnen.
RouenFRÜHJAHR 1431
U