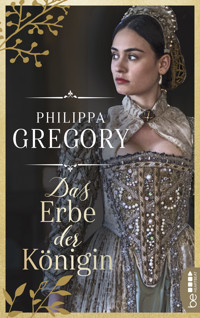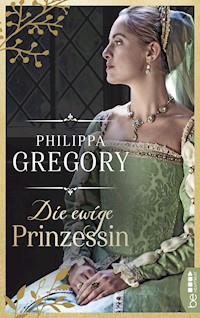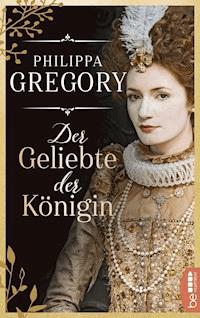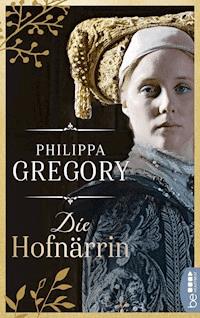
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Historische Romane der New York Times Bestseller Autorin
- Sprache: Deutsch
Die Treue zu einer Königin, die Liebe zu einem Verräter und die Furcht vor dem Tod auf dem Scheiterhaufen
Winter 1553: Die junge Jüdin Hannah flieht mit ihrem Vater vor der Inquisition aus Spanien nach England. Dort lernt sie Robert Dudley kennen - und lieben. Ihre Zuneigung macht sich der einflussreiche Adlige fortan immer wieder zunutze und führt Hannah als Junge verkleidet in den Hof der Tudors ein. Ihre Aufgabe: Als Narr soll sie Prinzessin Maria ausspionieren, die in einen unerbittlichen Machtkampf mit ihrer Halbschwester Elisabeth verstrickt ist. Gefangen in einem Netz aus Intrigen, Verrat und Ketzerei, muss sich Hannah zwischen einem sicheren Leben und ihren eigenen Wünschen und Sehnsüchten entscheiden ...
Ein historischer Roman aus der Plantagenet und Tudor-Reihe von Bestsellerautorin Philippa Gregory - jetzt erstmals als eBook erhältlich!
Ebenfalls bei beHEARTBEAT lieferbar: Der Geliebte der Königin.
"Wenn es um Autorinnen historischer Romane geht, ist Philippa Gregory in der Top-Liga." Daily Mail
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 964
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungSommer 1548Winter 1552/1553Frühling 1553Sommer 1553Herbst 1553Winter 1553Winter 1554Frühling 1554Sommer 1554Herbst 1554Winter 1554/1555Frühling 1555Frühling–Sommer 1555Herbst 1555Winter 1555Frühling 1556Sommer 1556Herbst 1556Winter 1556/1557Frühling 1557Sommer 1557Winter 1557/1558Frühling 1558Sommer 1558Herbst 1558Winter 1558Anmerkung der AutorinÜber dieses Buch
Die Treue zu einer Königin, die Liebe zu einem Verräter und die Furcht vor dem Tod auf dem Scheiterhaufen
Winter 1553: Die junge Jüdin Hannah flieht mit ihrem Vater vor der Inquisition aus Spanien nach England. Dort lernt sie Robert Dudley kennen – und lieben. Ihre Zuneigung macht sich der einflussreiche Adlige fortan immer wieder zunutze und führt Hannah als Junge verkleidet in den Hof der Tudors ein. Ihre Aufgabe: Als Narr soll sie Prinzessin Maria ausspionieren, die in einen unerbittlichen Machtkampf mit ihrer Halbschwester Elisabeth verstrickt ist. Gefangen in einem Netz aus Intrigen, Verrat und Ketzerei, muss sich Hannah zwischen einem sicheren Leben und ihren eigenen Wünschen und Sehnsüchten entscheiden …
Über die Autorin
Philippa Gregory, 1954 in Kenia geboren, studierte Geschichte in Brighton und promovierte an der Universität Edinburgh über englische Literatur des 18. Jahrhunderts. Sie arbeitete als Journalistin und Produzentin für Fernsehen und Radio und verfasste Kinderbücher, Kurzgeschichten, Reiseberichte sowie Drehbücher. Bekannt ist sie aber vor allem für ihre historischen Romane, darunter die Titel der Plantagenet und Tudor Reihe, in denen insbesondere die Rosenkriege und das elisabethanische Zeitalter thematisiert werden. Philippa Gregory lebt mit ihrer Familie in Nordengland. Homepage der Autorin: http://www.philippagregory.com.
PHILIPPA GREGORY
DieHofnärrin
Aus dem britischen Englisch von Barbara Först
beHEARTBEAT
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint von Bastei Entertainment
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2003 by Philippa Gregory
Titel der englischen Originalausgabe: »The Queen’s Fool«
Originalverlag: HarperCollins Publishers Ltd., London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2017 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Andrea Kalbe
Covergestaltung: © Maria Seidel, atelier-seidel.de
Illustration: © Richard Jenkins
eBook-Erstellung: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7325-5287-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Für Anthony
Sommer 1548
Kichernd und aufgedreht stürmte das Mädchen durch den sonnendurchfluteten Garten. Es lief seinem Stiefvater davon, doch seine Flucht war nur halbherzig. Aus einer Rosenlaube warf die Stiefmutter des Mädchens einen Blick auf die Vierzehnjährige und den gut aussehenden Mann, der sie auf dem weichen Rasen zwischen den mächtigen Baumstämmen zu fangen trachtete. Sie lächelte beifällig, fest entschlossen, nur Gutes über die beiden zu denken: Über das Mädchen, dessen Obhut ihr anvertraut war, sowie über den Mann, seit Jahren ihre große Liebe.
Nun schnappte der Mann den Saum des weit schwingenden Kleides und zog die Kleine zu sich heran. »Ein Pfand!«, rief er und näherte sein dunkles Gesicht den rosig überhauchten Wangen des Mädchens.
Beide wussten genau, welches Pfand er zu erlangen trachtete. Wie Quecksilber entwand sie sich seinem Griff und flüchtete auf die andere Seite eines großen, runden Zierbrunnens, in dem fette Karpfen träge umherschwammen. Elisabeths erhitztes Gesicht spiegelte sich im Wasser, als sie sich hinüberbeugte, um ihn zu necken.
»Fangt mich doch!«
»Wart’s nur ab!«
Sie beugte sich noch weiter vor, ließ ihre kleinen Brüste im viereckigen Ausschnitt des grünen Kleides sehen. Sie spürte seinen Blick, und ihre Wangen wurden noch eine Spur dunkler. Belustigt und erregt sah er zu, wie auch ihr Hals von Röte überzogen wurde.
»Ich kann dich fangen, wann immer ich will«, sagte er, an die Liebesjagd denkend, die im Bett endet.
»Dann kommt doch!«, lockte sie ihn, nur dunkel ahnend, wozu sie ihn einlud. Doch sie wollte seine Schritte hinter sich hören, wollte spüren, wie er seine Arme nach ihr ausstreckte – und sie wollte von diesen Armen gegen seinen faszinierenden Körper gepresst werden. Dann würde sie die raue Stickerei seines Wamses an ihrer Wange und den Druck seines Schenkels gegen ihre Beine fühlen.
Elisabeth stieß einen leisen Schrei aus und flüchtete erneut, diesmal über die Eibenallee, die den Garten des Chelsea-Palastes mit dem Fluss verband. Lächelnd blickte die Königin von ihrer Stickerei auf und sah ihre geliebte Stieftochter zwischen den Bäumen laufen, verfolgt von ihrem schönen Ehemann. Sie senkte den Blick wieder auf ihre Arbeit, und deshalb entging ihr, wie der Mann Elisabeth einfing, mit dem Rücken gegen die rote Rinde einer Eibe drückte und ihr die Hand über den Mund legte.
Elisabeths Augen wurden dunkel vor Erregung, sie wehrte sich nicht. Als der Mann gewahr wurde, dass sie nicht schreien würde, nahm er die Hand weg und beugte den dunklen Kopf.
Elisabeth spürte seinen Schnurrbart sacht über ihre Lippen streichen, sie roch den berauschenden Duft seines Haares, seiner Haut. Sie schloss die Augen und ließ den Kopf in den Nacken fallen, bot ihm ihre Lippen, ihren Hals, ihre Brüste. In dem Moment, als seine Zähne ihre Haut streiften, wurde sie vom kichernden Mädchen zu einer jungen Frau in der Hitze ihrer ersten Lust.
Vorsichtig lockerte er den Griff um ihre Taille, und seine Hand glitt verstohlen über das versteifte Mieder zum Halsausschnitt ihres Kleides, ein Finger schlüpfte unter ihr Hemd und streifte ihre Brustwarze. Diese hatte sich aufgerichtet, er rieb ein wenig, und das Mädchen stieß ein leises Stöhnen aus. Die Berechenbarkeit weiblicher Wollust brachte ihn zum Lachen, zu einem wissenden Glucksen, das aus den Tiefen seiner Kehle empordrang.
Elisabeth drückte sich eng an den Körper des Mannes und spürte, wie sich ein Schenkel zwischen ihre Beine schob. Die Neugier überwältigte sie. Was würde als Nächstes geschehen?
Als der Mann Anstalten machte, sich von ihr zu lösen, verschränkte sie die Arme hinter seinem Rücken und zog ihn wieder zu sich heran. Sie spürte sein triumphierendes Lächeln, denn schon hatte er seinen Mund wieder auf ihren gesenkt und spielte mit seiner Zunge sanft wie eine Katze an ihrem Mundwinkel. Zwischen Ekel und Lust über diese außergewöhnliche Berührung hin und her gerissen, öffnete sie nun ihrerseits den Mund und spürte die überwältigende Intimität des erfahrenen Mannes, der zu küssen verstand.
Doch mit einem Mal war es ihr zu viel. Sie wich vor ihm zurück. Aber Tom Seymour kannte den Rhythmus des Tanzes, den sie so leichtfertig entfesselt hatte, und der nun wie ein Taktgeber in ihren Adern pochen musste. Er packte den Saum ihres Brokatrockes und zog ihn hoch, bis er mit geübter Hand ihre Schenkel streicheln, unter ihr Unterkleid fassen konnte. Instinktiv presste sie die Beine zusammen, er aber strich mit dem Handrücken über ihr verborgenes Geschlecht. Sie schmolz dahin, er spürte förmlich, wie ihre Beine nachgaben. Das Mädchen wäre zu Boden gesunken, hätte er es nicht mit starkem Arm um die Taille gehalten. In diesem Augenblick wusste er, dass er des Königs Tochter, Prinzessin Elisabeth, nehmen konnte, an einen Baum im Garten der Königin gepresst. Dieses Mädchen war nur dem Namen nach eine Jungfrau – in Wahrheit war es kaum besser als eine Hure.
Leise Schritte auf dem Weg ließen ihn herumfahren. Er ließ Elisabeths Rocksaum fallen und stellte sich schützend vor sie. Die traumverlorene Bereitwilligkeit in ihrem Gesicht war allzu deutlich zu erkennen, und Tom Seymour fürchtete, die Königin könnte sie ertappt haben. Die Königin, seine Frau, deren Liebe er jeden Tag verriet, indem er versuchte, ihr Mündel zu verführen; die Königin, in deren Obhut die Prinzessin, ihre Stieftochter, gegeben worden war; Königin Katharina, die am Sterbebett Heinrichs VIII. gesessen hatte, aber von ihm, von Tom Seymour, geträumt hatte.
Doch dort auf dem Weg stand nicht die Königin, sondern ein kleines Mädchen von ungefähr neun Jahren mit großen, dunklen, ernst blickenden Augen und einer weißen spanischen Kappe, deren Bänder unter dem Kinn zusammengebunden waren. Die Kleine hielt zwei mit Kordel umwundene Bücher in der Hand und betrachtete ihn kühl, als ob sie alles mit angesehen und begriffen hätte.
»Was soll das, Liebchen?«, rief er mit gespielter Fröhlichkeit. »Du hast mich wahrhaftig erschreckt. Fast hätte ich dich für eine Fee gehalten, so wie du aus dem Nichts aufgetaucht bist.«
Die Kleine runzelte die Stirn ob der hastig hervorgesprudelten, überlauten Worte, doch dann antwortete sie, sehr langsam und mit starkem spanischen Akzent. »Verzeiht, Sir. Mein Vater bat mich, Sir Thomas Seymour diese Bücher zu bringen, und man hat mir gesagt, Ihr wäret im Garten.«
Sie hielt ihm das Bücherpaket hin, und Tom Seymour sah sich gezwungen, einen Schritt vorzutreten und es ihr abzunehmen. »Du bist die Tochter des Buchhändlers«, fuhr er mit gespielter Heiterkeit fort. »Des spanischen Buchhändlers.«
Das Mädchen neigte bestätigend den Kopf, ließ jedoch den forschenden Blick weiter auf ihm ruhen.
»Was starrst du denn so, Kleine?«, fragte er und dachte besorgt an Elisabeth. Das Rascheln in seinem Rücken verriet ihm, dass sie immer noch ihr Kleid ordnete.
»Ich habe Euch angeschaut, Sir, aber ich habe etwas ganz Furchtbares gesehen.«
»Was?«, herrschte er das Mädchen an. Einen Augenblick fürchtete er, sie werde sagen, sie habe ihn mit der Prinzessin von England gesehen, mit hochgeschobenem Rock gegen einen Baum gepresst wie eine gewöhnliche Hure, und die Finger eines Mannes, die ihr Intimstes berührten.
»Ich habe ein Schafott hinter Euch erblickt«, sagte das erstaunliche Kind. Dann machte es auf dem Absatz kehrt und lief davon, als habe es seinen Auftrag erledigt und nichts mehr in dem sonnendurchfluteten Garten zu suchen.
Tom Seymour fuhr zu Elisabeth herum, die mit vor Erregung zitternden Händen ihr zerzaustes Haar zu glätten versuchte. Sogleich streckte sie die Arme nach ihm aus, nach neuen Liebkosungen dürstend.
»Hast du das gehört?«
Elisabeths Augen waren schmale schwarze Schlitze. »Nein«, sagte sie leichthin. »Hat die Kleine etwas gesagt?«
»Sie hat gesagt, dass sie hinter mir ein Schafott gesehen hat!« Er war erschütterter, als er zugeben wollte. Er versuchte zu lachen, brachte jedoch nur ein gequältes Quieken zustande.
Bei der Erwähnung des Schafotts horchte Elisabeth plötzlich auf. »Warum?«, fuhr sie ihn an. »Warum sollte sie so etwas sagen?«
»Gott weiß warum«, erwiderte Tom Seymour. »Dumme kleine Hexe. Hat wahrscheinlich die Wörter verwechselt, sie kommt ja aus der Fremde. Hat wahrscheinlich den Thron hinter mir gesehen!«
Doch dieser Scherz war auch nicht erfolgreicher als sein Versuch, die Sache ins Lächerliche zu ziehen. In Elisabeths Vorstellung waren Thron und Schafott stets eng miteinander verbunden. Alle Farbe wich aus ihrem Gesicht.
»Wer ist sie?«, fragte sie mit schriller Stimme. »In wessen Auftrag war sie hier?«
Seymour drehte sich um und hielt Ausschau nach dem Kind, doch die Allee war leer. An ihrem fernen Ende konnte er seine Frau erkennen, die langsam auf sie zuschritt. Sie bog ihren Rücken durch, um die wachsende Last der Schwangerschaft zu tragen.
»Kein Wort!«, sagte er rasch zu dem Mädchen an seiner Seite. »Kein Wort von alledem, Liebchen. Du willst doch deine Stiefmutter nicht aufregen!«
Dieser Warnung hätte es kaum bedurft. Beim ersten Anzeichen von Gefahr war Elisabeth bereits wachsam geworden. Sie strich ihr Kleid glatt, spielte wie immer ihre Rolle, um zu überleben. Auf ihre Doppelzüngigkeit konnte er sich stets verlassen. Sie mochte zwar erst vierzehn Jahre zählen, war aber seit dem Tod ihrer Mutter in der Kunst der Täuschung geschult worden, jeden Tag in zwölf langen Jahren. Und sie war die Tochter eines Lügners – zweier Lügner, dachte er voller Verachtung. Sie mochte körperliches Verlangen spüren, doch war sie stets aufmerksam gegenüber Gefahren und überaus ehrgeizig. Er nahm ihre kalte Hand und führte sie die Allee entlang seiner Frau Katharina entgegen. Rang sich ein fröhliches Lächeln ab. »Habe ich sie doch eingefangen!«, rief er laut.
Argwöhnisch blickte er sich um, doch das Kind war nicht mehr zu sehen. »Was für ein Rennen!«, fügte er hinzu.
Dieses Kind war ich. Und es war das erste Mal, dass ich die Prinzessin Elisabeth zu Gesicht bekam: Wild vor Verlangen rieb sie sich wie eine Katze am Mann einer anderen Frau. Doch Tom Seymour sollte ich nur dieses eine Mal sehen. Innerhalb eines Jahres war er auf dem Schafott unter Anklage des Hochverrats gestorben, und Elisabeth hatte dreimal geleugnet, dass zwischen ihnen mehr bestanden hatte als die allergewöhnlichste Bekanntschaft.
Winter 1552/1553
Ich erkenne es wieder!«, sagte ich aufgeregt zu meinem Vater an der Reling der Themse-Barke, die flussaufwärts kreuzte. »Vater! Ich erkenne es! Diese Gärten, die bis zum Fluss gehen, und die großen Häuser … Und ich erinnere mich an den Tag, als Ihr mich mit Büchern zu diesem Lord, zu diesem englischen Lord geschickt habt, und ich habe ihn im Schlosspark gesehen, zusammen mit der Prinzessin!«
Mein Vater schenkte mir ein Lächeln, obwohl sein Gesicht nach der langen Reise von Müdigkeit gezeichnet war. »Du erinnerst dich, Kind?«, fragte er leise. »Das war ein glücklicher Sommer. Sie hat gesagt …« Er brach ab. Nie erwähnten wir den Namen meiner Mutter, nicht einmal, wenn wir allein waren. Am Anfang war es eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um uns vor jenen zu schützen, die sie ermordet hatten und auch uns verfolgen würden. Nun aber schützten wir uns sowohl vor unserem eigenen Kummer als auch vor der Inquisition – doch unser Kummer war ein hartnäckiger Verfolger.
»Werden wir hier wohnen?«, fragte ich hoffnungsvoll und betrachtete die prächtigen Paläste und ebenmäßigen Rasenflächen am Flussufer. Nach Jahren des Umherreisens sehnte ich mich nach einem Heim.
»Nicht gar so prächtig«, entgegnete mein Vater sanft. »Wir müssen klein anfangen, Hannah, wir eröffnen ein kleines Geschäft. Wir müssen uns ein neues Leben aufbauen. Und wenn wir es geschafft haben, kannst du die Knabenhosen ablegen und dich wieder als Mädchen kleiden und den jungen Daniel Carpenter heiraten.«
»Und ist unsere Flucht jetzt zu Ende?«, fragte ich leise.
Mein Vater zögerte mit der Antwort. Wir waren nun schon so lange auf der Flucht vor der Inquisition, dass es fast unmöglich schien zu hoffen, wir hätten nun einen sicheren Hafen erreicht. Unsere Flucht begann in der Nacht, als meine Mutter vom Kirchengericht schuldig befunden wurde, Jüdin zu sein – vielmehr eine »Marranin«, eine falsche Christin. Zu dem Zeitpunkt, als sie der weltlichen Gerichtsbarkeit ausgeliefert wurde, um bei lebendigem Leibe am Pfahl verbrannt zu werden, waren wir bereits weit fort. Wir ließen sie im Stich wie Judas Iskariot, verzweifelt bemüht, unser eigenes Leben zu retten, auch wenn mein Vater mir später immer wieder mit Tränen in den Augen versicherte, dass wir sie niemals hätten retten können. Wenn wir in Aragón geblieben wären, hätten sie uns ebenfalls verhaftet. So aber waren er und ich davongekommen. Wenn ich dann schwor, dass ich lieber hätte sterben wollen, statt meine Mutter zu entbehren, pflegte er, sehr langsam und traurig zu entgegnen, ich würde noch lernen, dass das Leben das kostbarste Gut sei. Eines Tages würde ich verstehen, dass sie mit Freuden ihr Leben gegeben hätte, um das meine zu retten.
Zuerst ging es über die Grenze nach Portugal, herausgeschmuggelt von Banditen, die meinem Vater jedes Geldstück abknöpften und ihm nur deshalb seine Bücher und Manuskripte ließen, weil sie damit nichts anzufangen wussten. Dann fuhren wir mit dem Schiff nach Bordeaux. Wir verbrachten die stürmische Überfahrt auf Deck, ohne Schutz vor strömendem Regen und wehender Gischt, dass ich schon fürchtete, wir müssten entweder erfrieren oder ertrinken. Die kostbarsten Bücher hielten wir an den Leib gepresst wie Säuglinge, die wir warm und trocken halten mussten. Weiter ging es über Land nach Paris. Stets gaben wir vor, jemand anders zu sein, als wir in Wirklichkeit waren: Kaufmann und Lehrjunge, Pilger auf dem Weg nach Chartres, fahrende Händler, ein Kleinadeliger mit jungem Pagen auf Vergnügungsreise, ein Gelehrter mit seinem Schüler auf dem Weg zur berühmten Universität von Paris – alles, nur um nicht zu verraten, dass wir frisch konvertierte Christen waren. Wir waren ein verdächtiges Paar, dem der Rauch des Autodafés noch in den Kleidern hing, und nachts wurden wir immer noch von Albträumen geplagt.
In Paris trafen wir die Vettern meiner Mutter, und diese schickten uns weiter zu ihren Verwandten in Amsterdam; von dort ging es nach London. Wir sollten unsere Abstammung unter englischen Himmeln verbergen, wir sollten Londoner werden. Wir würden protestantische Christen werden. Wir würden lernen, unseren neuen Glauben zu mögen. Ich musste es lernen.
Die Verwandten des Volkes, dessen Name nicht ausgesprochen werden darf, dessen Glaube verborgen ist, des zu ewiger Wanderschaft verdammten und aus jedem Lande der Christenheit verbannten Volkes lebten im Verborgenen, in London ebenso wie in Paris oder Amsterdam. Wir alle lebten als Christen und gehorchten den Geboten der Kirche, hielten die christlichen Feiertage und Fastenzeiten und Rituale ein. Viele von uns glaubten wie meine Mutter ehrlich an beide Bekenntnisse und hielten den Sabbat nur im Geheimen ab. Sie zündeten eine abgeschirmte Kerze an, bereiteten das Mahl vor und verrichteten die Hausarbeit am Vortag, damit der Sabbat geheiligt und dem Vortrag von halb vergessenen jüdischen Gebeten vorbehalten blieb – um dann am Sonntag vollkommen reinen Gewissens die christliche Messe zu besuchen. Meine Mutter gab sowohl das fromme Wissen der Bibel als auch Bruchstücke der Thora an mich weiter, die sie noch in Erinnerung hatte. Verbunden mit diesen Lektionen war die Warnung, dass unsere verwandtschaftlichen Bindungen und unser Glaube geheim seien, ein tiefes und gefährliches Geheimnis. Wir sollten vorsichtig sein und auf Gott vertrauen, wir sollten Vertrauen zu den Kirchen haben, die wir so reich beschenkt hatten, und zu unseren Freunden: den Nonnen und Priestern, die wir so gut kannten. Als die Inquisition kam, wurden wir gefangen wie unschuldige Hühner, denen man die Hälse umdreht, statt sie mit einem Hieb zu durchtrennen.
Andere folgten unserem Beispiel und flüchteten ebenfalls. Auch sie tauchten in den großen Städten der Christenheit unter, um Angehörige ihres Glaubens zu finden, um Zuflucht und Hilfe bei entfernten Vettern oder treuen Freunden zu suchen. Unsere Familie empfahl uns mit Geleitbriefen an die Familie d’Israeli in London, die dort unter dem Namen Carpenter lebte, arrangierte mein Verlöbnis mit dem Sohn, bezahlte meinem Vater eine Druckerpresse und fand für uns ein Ladenlokal nebst Wohnung in einer Seitenstraße der Fleet Street.
In den Monaten nach unserer Ankunft lernte ich, mich wieder einmal in einer neuen Stadt zurechtzufinden, während mein Vater seine Druckerei einrichtete mit dem festen Vorsatz, unseren Lebensunterhalt zu sichern. Von Anfang an bestand starke Nachfrage nach seinen Büchern, insbesondere nach den Abschriften der Evangelien, die er im Taillenbund seiner Kniehose verborgen ins Land gebracht hatte und nun ins Englische übersetzte. Er kaufte Bücher und Manuskripte aus den Bibliotheken von Klöstern und Abteien auf, die unter der Regentschaft des Vorgängers von Eduard VI. zerstört worden waren. Eduards Vater, Heinrich VIII., hatte die Weisheit von Jahrhunderten in alle Winde zerstreut, und so horteten alle möglichen Läden alte Manuskripte, die man im Dutzend erwerben konnte. Es war der Traum jedes Bücherliebhabers. Jeden Tag machte mein Vater die Runde und kehrte stets mit etwas Seltenem und Kostbarem zurück, und wenn er es gesäubert und katalogisiert hatte, fanden sich ausreichend Käufer. Die Menschen in London waren verrückt nach der Heiligen Schrift. Nachts noch setzte mein Vater trotz Müdigkeit den Text, er druckte kleinere Ausgaben der Evangelien und einfache Texte für die Gläubigen, alles in Englisch, alles sehr einfach und klar gehalten. Dies war ein Land, in dem die Menschen selbst lesen wollten und ohne Priester zurechtkamen, dies war immerhin eine Beruhigung.
Wir verkauften die Bücher fast zum Selbstkostenpreis, um das Wort Gottes zu verbreiten. Wir machten bekannt, dass wir unsere Arbeit taten, weil wir inzwischen überzeugte Protestanten waren. Wir hätten nicht bessere Protestanten sein können, wenn unser Leben davon abgehangen hätte.
Und natürlich hing unser Leben davon ab.
Ich erledigte Botengänge, las Korrektur, half bei den Übersetzungen, setzte die Lettern, nähte wie ein Sattler mit der spitzen Nadel des Buchbinders und las die Texte der in Spiegelschrift und auf dem Kopf stehenden Lettern in der Presse. An Tagen, wenn im Geschäft nicht viel zu tun war, stand ich vor der Tür, um Passanten herbeizulocken. Immer noch trug ich die Kleidung eines Knaben, und wie ich so dastand, hätte jedermann mich mit einem herumlungernden Burschen verwechseln können: Die Kniehosen flatterten um meine bloßen Beine, meine strumpflosen Füße steckten in alten Schuhen, die Kappe saß mir schief auf dem Kopfe. Sobald die Sonne herauskam, lehnte ich an der Wand unseres Geschäfts wie ein junger Landstreicher, sog die schwache englische Sonne auf und sah müßig die Straße auf und ab. Zur Rechten gab es einen Buchhändler, dessen Geschäft kleiner war als unseres und der billigere Waren führte. Zur Linken war ein Buchhändler, der Broschüren, Gedichte und Traktate für Hausierer und Balladenverkäufer führte, neben ihm saß ein Miniaturmaler und neben diesem ein Porträt- und Miniaturmaler. In dieser Straße arbeiteten alle mit Papier und Tinte, und mein Vater pflegte zu sagen, ich solle dankbar sein für ein Leben, bei dem ich mir nicht die Hände ruinierte. Ja, ich hätte dankbar sein sollen – doch ich war es nicht.
Es war eine enge Straße, armseliger noch als unser zeitweiliges Quartier in Paris. Jedes Haus hing wie verklammert an seinem Nachbarn und neigte sich wie ein torkelnder Trunkenbold dem Fluss zu, die vorspringenden Giebelfenster der Häuser hingen über dem Kopfsteinpflaster und verdeckten den Himmel, sodass der schwache Sonnenschein ein Streifenmuster auf den lehmbestrichenen Wänden erzeugte. Die Straße stank wie ein Misthaufen. Morgens beugten sich die Frauen aus den überhängenden Erkern und leerten Nachttöpfe und Waschschüsseln in das Rinnsal, das mitten auf der Straße dahinfloss. Die üble Brühe glitt träge weiter, bis sie schließlich im Schmutzteich der Themse landete.
Ich wollte an einem schöneren Ort leben, einem Ort wie dem Garten der Prinzessin Elisabeth mit seinen Bäumen und Blumen und dem wunderbaren Blick auf den Fluss. Ich wollte etwas Besseres sein als die, die ich war: Nicht der zerlumpte Lehrling eines Buchhändlers, eigentlich ein verkleidetes Mädchen, das einem ihm Unbekannten als künftige Braut versprochen war.
Wie ich so dastand und mich wie eine verdrossene spanische Katze in der Sonne wärmte, vernahm ich Sporenklirren auf dem Kopfsteinpflaster. Ich riss die Augen auf, plötzlich ganz wach. Vor mir, einen langen Schatten werfend, stand ein junger Mann. Er war prächtig gekleidet, trug einen hohen Hut auf dem Kopf, einen Umhang, der von seinen Schultern fiel, und eine dünne Klinge aus Silber an der Seite. Er war atemberaubend, der schönste Mann, den ich je gesehen hatte.
All dies war schon erstaunlich genug, ich spürte, dass ich ihn anstarrte, als sei er ein vom Himmel herabgestiegener Engel. Doch hinter ihm stand ein zweiter Mann.
Dieser war älter, mochte fast dreißig Jahre zählen, er hatte die blasse Haut eines Gelehrten und dunkle, tief liegende Augen. Leute seines Schlages kannte ich gut, sie hatten die Buchhandlung meines Vaters in Aragón besucht, zählten in Paris zur Kundschaft und waren uns auch hier in London nicht fremd. Dieser Mann war ein Gelehrter, ich erkannte es an seinem gebeugten Nacken, an den nach vorn fallenden Schultern. Er schrieb viel, das verriet mir der Tintenfleck am Mittelfinger seiner rechten Hand, doch er war viel mehr als nur ein Schreiber: Er war ein Denker, ein Mann, der das Verborgene hinter den Dingen herausfinden wollte. Ein gefährlicher Mann, ohne Scheu vor Häresie und Fragen, der stets mehr wissen wollte; ein Mann, der die Wahrheit hinter der Wahrheit suchte.
In Spanien hatte ich einen Jesuitenpriester gekannt, der diesem Mann ähnelte. Er war in das Geschäft meines Vaters gekommen und hatte gebettelt, er möge ihm Handschriften besorgen, alte Handschriften, älter als die Bibel, älter sogar als das Wort Gottes. Ich hatte einen jüdischen Gelehrten gekannt, der diesem Manne ähnelte. Auch er war in meines Vaters Buchladen gekommen und hatte nach verbotenen Büchern gefragt, nach Fragmenten der Thora, nach den Geboten. Der Jesuit und der Gelehrte waren oft gekommen, um Bücher bei meinem Vater zu kaufen; und eines Tages waren sie nicht mehr gekommen. Denn in dieser Welt konnten die Ideen gefährlicher sein als ein Schwert: Die Hälfte von ihnen war verboten, und die andere Hälfte konnte einen Menschen dazu bewegen, den Platz der Erde anzuzweifeln, die doch so sicher im Zentrum des Universums steht.
So beschäftigt war ich mit der Betrachtung dieser beiden Männer – des jungen göttergleichen und des älteren priesterhaften –, dass ich den Dritten fast übersehen hätte. Jener war ganz in Weiß gekleidet, ein Weiß, das glänzte wie emailliertes Silber. Ich vermochte ihn kaum anzuschauen, so hell spiegelte sich die Sonne auf seinem funkelnden Umhang. Ich suchte nach seinem Gesicht und fand nur ein Aufleuchten von Silber, ich blinzelte, vermochte ihn jedoch immer noch nicht zu erkennen. Dann kam ich wieder zu mir und merkte, dass die Herren, wer sie auch sein mochten, bereits vor der Tür unseres Nachbarn standen.
Ein rascher Blick auf unsere eigene Tür belehrte mich, dass mein Vater im Hinterzimmer war und frische Tinte herstellte. Er hatte mein Versagen, Kunden anzulocken, noch nicht bemerkt. Ich verfluchte mich selbst, weil ich so untätig und tölpelhaft dastand, sprang ihnen in den Weg und sagte artig mit meinem neu erworbenen englischen Akzent: »Guten Tag wünsche ich, Sirs. Können wir Euch behilflich sein? Wir haben die schönste Sammlung erbaulicher und moralischer Bücher, die Ihr in ganz London finden könnt, die interessantesten Manuskripte zu günstigen Preisen sowie bezaubernde Zeichnungen von bester Künstlerhand und …«
»Ich suche den Laden von Oliver Green, dem Drucker«, unterbrach mich der junge Mann.
Als seine dunklen Augen die meinen trafen, erstarrte ich – es war, als stünden unversehens sämtliche Uhren Londons still, als hätten ihre Pendel aufgehört zu schwingen. Ich wollte ihn festhalten, dort, wo er jetzt stand, in seinem roten Wams mit den geschlitzten Ärmeln im Wintersonnenschein. Ich wollte, dass er mich anschaute und mich sah, wie ich wirklich war: nicht als Straßenjungen mit schmutzigem Gesicht, sondern als Mädchen, fast eine junge Frau. Doch sein Blick glitt gleichgültig über mich hinweg zu unserem Laden, und ich besann mich und hielt den dreien die Tür auf.
»Dies ist das Geschäft des Gelehrten und Buchdruckers Oliver Green. Tretet ein, Mylords«, sagte ich einladend, dann rief ich ins dunkle Hinterzimmer: »Vater! Hier sind drei edle Lords, die Euch sprechen möchten!«
Ich hörte das Klappern, als er den hohen Druckerstuhl zurückschob. Dann kam er heraus, rieb sich die Hände an seiner Schürze ab, von einem Geruch nach Tinte und heißem gepressten Papier begleitet. »Willkommen«, sagte er. »Ich heiße Euch beide willkommen.« Er trug seinen üblichen schwarzen Anzug, die Manschetten waren voller Tintenflecke. Einen Moment lang sah ich ihn mit den Augen der Fremden: Ein Mann von fünfzig Jahren, das dichte, durch Sorgen und Leid weiß gewordene Haar, ein Gesicht voller tiefer Furchen, seine hohe Gestalt gebeugt durch die Last der Gelehrsamkeit.
Er gab mir mit einem Nicken ein Zeichen, und ich zog drei Hocker unter der Theke hervor. Doch die Herren setzten sich nicht, sie blieben stehen und schauten sich um.
»Und womit kann ich Euch dienen?«, fragte mein Vater. Nur ich erkannte seine Angst. Angst vor dem hübschen Adeligen, der nun den Hut abgenommen hatte und sich das dunkel gelockte Haar aus dem Gesicht strich, Angst vor dem schlicht gekleideten älteren Mann und Angst vor dem Dritten, dem schweigenden Lord, der hinter ihnen stand, gekleidet in blendend helles Weiß.
»Wir suchen Oliver Green, den Buchhändler«, sagte der junge Lord.
Mein Vater neigte bejahend den Kopf. »Ich bin Oliver Green«, sagte er leise mit seinem deutlichen spanischen Akzent. »Und ich werde Euch dienen auf jede Art, auf die es mir möglich ist. Auf jede Art, die den Gesetzen des Landes entspricht und seinen Gebräuchen …«
»Ja, ja«, fiel ihm der junge Mann ungehalten ins Wort. »Wie wir gehört haben, seid Ihr eben erst aus Spanien gekommen, Oliver Green.«
Wieder nickte mein Vater. »Ich bin in der Tat eben erst nach England gekommen, aber Spanien haben wir schon vor drei Jahren verlassen, Sir.«
»Ihr seid demnach Engländer?«
»Jetzt bin ich Engländer, wenn es beliebt«, sagte mein Vater vorsichtig.
»Aber Euer Name? Es ist doch ein sehr englischer Name?«
»Der Name war Verde«, erwiderte mein Vater mit einem schiefen Lächeln. »Es ist leichter für die Engländer, wenn wir uns Green nennen.«
»Und Ihr seid Christ? Und gebt christliche Theologie und Philosophie heraus?«
Meinem Vater wurde beklommen zumute, das sah ich deutlich, doch seine Stimme zitterte kein bisschen. »Aber gewiss, Sir.«
»Und gehört Ihr der reformierten oder der alten Tradition an?«, fragte der junge Mann sehr leise.
Mein Vater wusste weder, welche Antwort auf diese Frage erwartet wurde, noch konnte er wissen, wie viel von seiner Antwort abhing. Tatsächlich konnte unser Leben davon abhängen, für die falsche Antwort konnten wir gehängt, verbrannt oder auf den Richtblock geschickt werden – je nachdem, welche Strafe man zurzeit unter der Regentschaft des jungen Eduard den Ketzern zumaß.
»Der reformierten«, tastete sich mein Vater schließlich behutsam vor. »Obwohl wir in Spanien nach dem alten Glauben getauft wurden, befolgen wir nun die Gebote der englischen Kirche.« Er hielt kurz inne. »Gelobt sei Gott«, wagte er anzufügen. »Ich bin ein treuer Gefolgsmann König Eduards und will nichts weiter, als mein Handwerk ausüben und getreu seinen Gesetzen leben und in seiner Kirche beten.«
Ich roch seinen säuerlichen Angstschweiß so deutlich wie den Rauch eines Scheiterhaufens, und nun bekam auch ich es mit der Angst zu tun. Ich fuhr mir mit dem Handrücken über die Wange, als wollte ich ein Rußteilchen fortwischen. »Ist schon gut. Ich bin sicher, sie wollen unsere Bücher, nicht uns«, sagte ich in gedämpften Ton auf Spanisch.
Mein Vater nickte zum Zeichen, dass er verstanden hatte. Doch der junge Lord ging sofort auf mein Flüstern ein. »Was hat der Junge gesagt?«
»Ich habe gesagt, dass Ihr Gelehrte seid«, log ich, nun auf Englisch.
»Geh ins Haus, querida«, wandte sich mein Vater hastig an mich. »Ihr müsst dem Kind vergeben, meine Herren. Meine Frau starb vor gerade mal drei Jahren, und dieses Kind ist schwachsinnig, es taugt nur, um auf die Tür aufzupassen.«
»Das Kind spricht nichts als die lautere Wahrheit«, bemerkte nun der ältere Mann in heiterem Ton. »Denn wir sind nicht gekommen, um Euch zu erschrecken, Ihr braucht keine Angst zu haben. Wir sind gekommen, um Eure Bücher zu sehen. Ich bin Gelehrter, kein Inquisitor. Ich wollte nur Eure Sammlung sehen.«
Ich lungerte immer noch auf der Schwelle herum. Nun wandte sich der Ältere an mich. »Aber warum hast du von drei Herren gesprochen?«, wollte er wissen.
Mein Vater schnippte mit den Fingern zum Zeichen, dass ich gehen sollte, aber der junge Lord sagte: »Wartet. Lasst den Knaben antworten. Was soll das schaden? Hier sind doch nur zwei von uns, mein Junge. Oder siehst du noch mehr?«
Ich sah von dem älteren zu dem hübschen jungen Mann und stellte fest, dass es tatsächlich nur zwei waren. Der Dritte, der Mann in so blendendem Weiß, dass er geleuchtet hatte wie ein polierter Zinnkrug, war verschwunden, als hätte er niemals existiert.
»Ich habe einen dritten Mann hinter Euch gesehen, Sir«, sagte ich zu dem Älteren. »Dort draußen, auf der Straße. Es tut mir leid. Er ist nicht mehr da.«
»Sie ist eine Närrin, aber sie ist ein gutes Mädchen«, beteuerte mein Vater und gab mir wieder Zeichen, mich zu entfernen.
»Nein, wartet«, sagte der junge Mann. »Einen Moment noch. Ich hielt dieses Kind für einen Jungen. Ein Mädchen, sagt Ihr? Warum habt Ihr sie in Knabenkleidung gesteckt?«
»Und wer war der dritte Mann?«, wandte sich sein Gefährte an mich.
Mein Vater duckte sich unter dem Hagel ihrer Fragen immer tiefer. »Lasst sie doch gehen, Mylords«, bat er. »Sie ist nichts weiter als ein Mädchen, eine kleine Maid mit schwachem Sinn, die immer noch unter dem Tod der Mutter leidet. Ich kann Euch meine Bücher zeigen, und ich besitze auch ein paar schöne Manuskripte, die Euch vielleicht interessieren. Überdies kann ich Euch …«
»Ich möchte das alles wirklich gern sehen«, meinte der Ältere entschlossen. »Aber zuerst möchte ich mit dem Kind sprechen. Ihr erlaubt?«
Mein Vater gab nach, es war ihm nicht möglich, solch mächtigen Herren eine Bitte abzuschlagen. Der ältere Mann nahm mich bei der Hand und ging mit mir in unseren kleinen Laden. Durch das Bleiglasfenster fiel ein schwacher Lichtschimmer auf mein Gesicht. Er fasste mit der Hand unter mein Kinn und drehte mein Gesicht mal in die eine, dann in die andere Richtung.
»Wie sah der dritte Mann aus?«, fragte er leise.
»Er war ganz in Weiß gekleidet«, antwortete ich durch halb geschlossene Lippen. »Und er strahlte.«
»Wie war er gekleidet?«
»Ich habe nur einen weißen Umhang erkennen können.«
»Und was trug er auf dem Kopf?«
»Da habe ich nur etwas Weißes gesehen.«
»Und sein Gesicht?«
»Ich konnte sein Gesicht nicht erkennen, weil das Licht so hell war.«
»Glaubst du, dass er einen Namen hatte, Kind?«
Ich spürte, wie das Wort in meinen Mund kam, obwohl ich es nicht verstand. »Uriel.«
Die Hand unter meinem Kinn erstarrte. Der Mann schaute mir ins Gesicht, als läse er in einem von Vaters Büchern. »Uriel?«
»Ja, Sir.«
»Hast du diesen Namen vorher schon einmal gehört?«
»Nein, Sir.«
»Weißt du, wer Uriel ist?«
Ich schüttelte den Kopf. »Ich habe einfach geglaubt, das wäre der Name des Mannes, der mit Euch gekommen ist. Aber ich habe diesen Namen noch nie gehört, bevor ich ihn eben sagte.«
Der jüngere Mann wandte sich an meinen Vater. »Wenn Ihr behauptet, sie sei eine Närrin, wollt Ihr damit andeuten, dass sie das zweite Gesicht besitzt?«
»Sie sagt oft etwas Verdrehtes«, behauptete mein Vater stur. »Aber nichts Schlimmes. Sie ist ein gutes Mädchen, ich habe sie jeden Tag ihres Lebens in die Kirche geschickt. Sie meint es nicht böse, sie spricht, ohne vorher zu überlegen. Sie kann nichts dafür. Sie ist nur eine Närrin, weiter nichts.«
»Und warum kleidet Ihr sie wie einen Burschen?«, fragte der junge Lord.
Mein Vater hob die Schultern. »Oh, meine Herren, bedenkt die schweren Zeiten, in denen wir leben! Ich musste sie heil durch Spanien und Frankreich bringen, und durch die Niederlande, ohne die Hilfe einer fürsorglichen Mutter. Und nun muss sie Botengänge erledigen und ist überdies mein Schreiber. Ein Junge wäre wirklich besser für mich gewesen. Wenn sie erwachsen ist, darf sie wohl ein Kleid haben, aber was ich dann mit ihr anfangen soll, weiß ich nicht. Ein Mädchen ist mir zu nichts nutze, mit einem jungen Burschen ist das anders.«
»Sie besitzt das zweite Gesicht«, stieß der ältere Mann hervor. »Gelobt sei Gott, ich komme zu Euch auf der Suche nach Manuskripten und finde ein Mädchen, das Uriel sieht und seinen geheiligten Namen kennt.« Er wandte sich an meinen Vater. »Hat sie irgendwelche Kenntnis von heiligen Dingen? Hat sie mehr gelesen als die Bibel und ihren Katechismus? Liest sie Eure Bücher?«
»Um Gottes willen, nein«, beteuerte mein Vater, er log aus voller Überzeugung. »Ich schwöre Euch, meine Herren, ich habe sie als gutes, vollkommen unwissendes Mädchen erzogen. Sie weiß nichts, das verspreche ich Euch. Gar nichts.«
Der ältere Mann schüttelte den Kopf. »Bitte«, sagte er sanft an mich und an meinen Vater gewandt, »fürchtet Euch nicht vor uns. Ihr könnt mir vertrauen. Dieses Mädchen besitzt das zweite Gesicht, nicht wahr?«
»Nein«, behauptete mein Vater rundweg, stritt es zu meiner Sicherheit ab. »Sie ist nichts weiter als eine Närrin und die Last meines Lebens. Macht mehr Sorgen, als sie wert ist. Wenn ich nur Verwandte hätte, zu denen ich sie schicken könnte – ich würde es sofort tun. Sie verdient Eure Aufmerksamkeit nicht …«
»Beruhigt Euch«, sagte der junge Mann sanft. »Wir sind nicht gekommen, um Euch zu peinigen. Dieser Gentleman ist John Dee, mein Tutor. Und ich bin Robert Dudley. Ihr braucht Euch nicht vor uns zu fürchten.«
Bei der Nennung ihrer Namen wurde mein Vater noch furchtsamer, und er hatte auch allen Grund dazu. Der hübsche junge Mann war der Sohn des mächtigsten Mannes im Lande: Lord John Dudley, Lordprotektor des Königs von England. Falls ihnen die Büchersammlung meines Vaters gefiel, konnten wir vielleicht sogar unserem König, dem belesenen König, Bücher liefern und damit ein Vermögen verdienen. Waren ihnen unsere Bücher jedoch zu aufrührerisch oder blasphemisch oder ketzerisch, zu zweideutig oder mit zu viel neuem Wissen angefüllt, dann drohte uns der Kerker oder das Exil – oder sogar der Tod.
»Ihr seid zu gütig, Sir. Soll ich meine Bücher zum Palast bringen? Hier ist doch zu schlechtes Licht zum Lesen, es besteht keine Notwendigkeit, dass Ihr Euch in meinem armseligen kleinen Laden aufhalten müsst …«
Der ältere Mann ließ mich nicht los. Er hielt immer noch mein Kinn und blickte mir forschend ins Gesicht.
»Ich besitze Studien über die Bibel«, fuhr mein Vater hastig fort. »Manche sehr alte in Latein und Griechisch und auch Bücher in anderen Sprachen. Ich habe einige Zeichnungen römischer Tempel mit der genauen Erklärung ihrer Proportionen, ich habe eine Abschrift einiger mathematischer Tabellen für Berechnungen, die ich einst erhielt, aber natürlich besitze ich nicht das Wissen, um sie zu verstehen, ich besitze einige Anatomiezeichnungen des griechischen …«
Endlich ließ der Mann namens John Dee mein Kinn los. »Darf ich dann Eure Bibliothek sehen?«
Ich sah, wie sehr es meinem Vater widerstrebte, diesem Mann die Durchsicht der Regale und Schubladen mit seiner Sammlung zu gestatten. Er fürchtete, nach den neuen Gesetzen könnten einige seiner Bücher nun das Brandmal der Häresie tragen. Zwar waren die griechischen und hebräischen Bücher über geheimes Wissen stets hinter der Schiebewand des Bücherregals versteckt, doch selbst die Bücher, die offen herumlagen, konnten uns in diesen unsicheren Zeiten in Schwierigkeiten bringen. »Soll ich die Bücher herbringen, damit Ihr sie ansehen könnt?«
»Nein, ich komme mit Euch nach hinten.«
»Selbstverständlich, Mylord«, gab mein Vater nach. »Es ist mir eine Ehre.«
Er ging voraus ins Hinterzimmer, und John Dee folgte ihm. Der junge Lord Robert Dudley nahm auf einem der Hocker Platz und betrachtete mich teilnahmsvoll.
»Du bist zwölf?«
»Ja, Sir«, log ich eilfertig, obwohl ich in Wahrheit fast vierzehn Jahre zählte.
»Und eine Maid, obschon als Junge gekleidet.«
»Ja, Sir.«
»Noch keine Heirat für dich arrangiert?«
»Nicht so bald, Sir.«
»Doch ein Verlöbnis in Sicht?«
»Ja, Sir.«
»Und wen hat dein Vater für dich ausgesucht?«
»Ich soll einen Cousin aus der Familie meiner Mutter heiraten, sobald ich sechzehn bin«, erwiderte ich. »Ich will es aber eigentlich gar nicht.«
»Du bist eine junge Maid«, spottete er. »Alle jungen Mädchen sagen, dass sie eigentlich nicht wollen.«
Ich warf ihm einen Blick zu, der meinem Widerwillen nur zu deutlich Ausdruck gab.
»Oho! Bin ich dir etwa zu nahe getreten, holde Herrin – oder vielmehr, holder Knabe?«
»Ich weiß, was ich will, Sir«, gab ich ruhig zur Antwort. »Und ich bin keine Maid wie die anderen.«
»Das liegt auf der Hand. Was also willst du, mein holder Knabe?«
»Ich will nicht heiraten.«
»Und wie willst du dann satt werden?«
»Ich möchte mein eigenes Geschäft und möchte meine eigenen Bücher drucken.«
»Und glaubst du denn, dass ein Mädchen, selbst ein so hübsches in Kniehosen, ohne einen Ehemann zurechtkommen kann?«
»Ich bin sicher, dass ich es könnte«, erwiderte ich. »Die Witwe Worthing, die auf der anderen Seite der Gasse wohnt, hat auch ein Geschäft.«
»Eine Witwe hat aber schon einen Ehemann gehabt, der ihr ein Auskommen sicherte. So muss sie sich darum nicht mehr kümmern.«
»Ein Mädchen kann doch auch Geld verdienen«, beharrte ich. »Ich könnte mir vorstellen, dass auch ein Mädchen ein Geschäft führen kann.«
»Und was sonst könnte ein Mädchen führen?«, neckte er mich. »Etwa ein Schiff? Oder ein Heer? Ein Königreich gar?«
»Ihr werdet noch sehen, dass eine Frau ein Königreich beherrscht, Ihr werdet eine Frau als beste Herrscherin der Welt erleben«, entgegnete ich – und hielt jäh inne, als ich seine Miene gewahrte. Ich schlug die Hand vor den Mund. »So etwas wollte ich nicht sagen«, flüsterte ich. »Ich weiß, dass eine Frau immer der Führung ihres Vaters oder ihres Gatten bedarf.«
Er sah mich an, als würde er gern mehr hören. »Glaubst du, mein holder Knabe, dass ich noch erlebe, wie eine Frau ein Königreich regiert?«
»In Spanien ist dies schon geschehen«, sagte ich kläglich. »Mit Königin Isabella.«
Er nickte und beließ es dabei, als wollte er uns beide von gefährlichen Ufern fernhalten. »Nun denn. Weißt du, wie man zum Whitehall-Palast kommt, holder Knabe?«
»Ja, Sir.«
»Wenn Mr Dee die Bücher ausgewählt hat, die ihn interessieren, bringst du sie dann zu mir, in meine Gemächer? Einverstanden?«
Ich nickte.
»Wie gedeiht das Geschäft deines Vaters?«, erkundigte er sich unvermittelt. »Verkauft er viele Bücher? Habt ihr viele Kunden?«
»Ein paar«, erwiderte ich vorsichtig. »Aber wir stehen auch erst am Anfang.«
»Deine Gabe verhilft ihm demnach nicht zu besseren Geschäften?«
Ich schüttelte den Kopf. »Es ist keine Gabe. Es ist mehr eine Art Torheit, genau, wie er sagt.«
»Du sprichst aus, was dir in den Kopf kommt? Und du siehst etwas, das andere nicht sehen können?«
»Manchmal.«
»Und was hast du gesehen, als du mich angeschaut hast?«
Nun sprach er mit so leiser Stimme, als wolle er mich in eine Verschwörung hineinziehen. Ich hob meinen Blick von seinen Stiefeln, seinen kräftigen Beinen, zu dem schönen Überrock und den weichen Falten seiner weißen Halskrause, zu seinem sinnlichen Mund und den halb geschlossenen dunklen Augen. Er lächelte, als wüsste er genau, dass meine Wangen, meine Ohren, ja, selbst mein Haar in Flammen standen, heiß wie unter der Sonne Spaniens. »Als ich Euch zum ersten Mal sah, glaubte ich, Euch zu kennen.«
»Von früher?«, fragte er.
»Nein, aus einer Zeit, die noch kommt«, erwiderte ich linkisch. »Ich dachte, ich würde Euch kennenlernen, in künftigen Tagen.«
»Als Junge niemals!« Er grinste amüsiert ob der Schlüpfrigkeit seiner Gedanken. »Und welches Amt werde ich wohl bekleiden, wenn du mich kennenlernst, holder Knabe? Werde ich ein mächtiger Mann sein? Werde ich über ein Königreich herrschen, so wie du eine Buchhandlung leiten wirst?«
»Ich hoffe in der Tat, dass Ihr ein mächtiger Mann sein werdet«, erwiderte ich steif. Mehr wollte ich nicht preisgeben. Seine zärtliche Neckerei sollte mich nicht einlullen, sodass ich glaubte, ich könnte mich ihm anvertrauen.
»Was hältst du denn von mir?«, fragte er geradewegs.
Ich holte tief Luft. »Ich halte Euch für fähig, eine junge Frau, die keine Kniehosen trägt, ins Unglück zu stürzen.«
Darüber musste er laut lachen. »Weiß Gott, das ist eine wahre Voraussage«, scherzte er. »Aber vor den Mädchen fürchte ich mich nicht, es sind eher ihre Väter, die mich mit Schrecken erfüllen.«
Wider Willen musste ich sein Lächeln erwidern. Die Art, wie seine Augen beim Lachen tanzten, machte auch mich vergnügt, und ich sehnte mich danach, etwas besonders Geistreiches und Erwachsenes sagen zu können, damit er mich ansähe – und nicht als Kind wahrnähme, sondern als junge Frau.
»Und ist jemals nach einer deiner Prophezeiungen das Vorhergesagte eingetroffen?«, fragte er, plötzlich sehr neugierig.
Die Frage an sich war schon gefährlich in einem Land, in dem man ständig Ausschau nach Hexenzauber hielt. »Ich besitze diese Macht nicht«, beeilte ich mich zu sagen.
»Aber auch ohne die Macht dazu, kannst du die Zukunft voraussehen? Manche von uns besitzen diese Gabe, eine heilige Gabe, sie wissen, was sich ereignen wird. Mein Freund Mr Dee glaubt, dass die Engel die Menschen auf ihrem Weg führen und uns zuweilen vor der Sünde warnen können, ebenso wie die Sterne einem Manne sein Schicksal vorhersagen können.«
Zu diesem gefährlichen Geschwätz schüttelte ich lediglich tölpelhaft den Kopf, fest entschlossen, ihm darauf keine Antwort zu geben.
Nachdenklich sah er mich an. »Kannst du tanzen oder kannst du ein Instrument spielen? Kannst du eine Rolle in einem Maskenspiel lernen und deinen Text aufsagen?«
»Nicht sehr gut«, sagte ich wenig hilfreich.
Er lachte über meinen Widerwillen. »Nun, wir werden ja sehen, holder Knabe. Wir werden sehen, ob sich da etwas machen lässt.«
Ich machte vor ihm eine kleine Verbeugung in der Art eines Jungen und gab Acht, dass ich nichts mehr sagte.
Am nächsten Tag marschierte ich mit einem Bücherpaket und sorgfältig zusammengerollten Manuskripten durch die Stadt, vorbei an Temple Bar und an den grünen Wiesen von Covent Garden zum Whitehall-Palast. Es war kalt, und es fiel ein Schneeregen, der mich zwang, den Kopf gesenkt zu halten und die Kappe tief über die Ohren zu ziehen. Der Wind vom Fluss war so eisig, als käme er geradewegs aus Russland, und so stark, dass er mich förmlich die King’s Street entlang blies bis zu den Toren des Whitehall-Palastes.
Nie zuvor war ich in einem Königsschloss gewesen. Ich hatte geglaubt, ich würde die Bücher lediglich den Torwächtern übergeben, aber als ich ihnen den Brief zeigte, den Lord Robert geschrieben hatte und an dessen Ende das Dudley-Siegel mit Bär und Stamm abgebildet war, verneigten sie sich wie vor einer Edeldame und befahlen einem Mann, mich hineinzuführen.
Zunächst gelangten wir in den ersten einer Reihe von Innenhöfen, jeder einzelne wunderbar angelegt mit einem großen Garten mit Apfelbäumen in der Mitte und Lauben mit steinernen Bänken. Der Wachsoldat führte mich durch den ersten Garten. Er ließ mir keine Zeit, die prächtig gekleideten Lords und Ladys anzustarren, die, durch viel Pelz und Samt vor der Kälte geschützt, sich bei einem Kugelspiel auf dem Rasen vergnügten. Hinter der Tür, die wiederum von einem Paar Soldaten bewacht wurde, befand sich ein großer Raum mit noch mehr adeligen Herren und Damen, danach kam ein weiterer riesiger Raum, und dann noch einer. Mein Führer geleitete mich noch durch etliche Türen, bis wir in einen langen Wandelgang kamen, an dessen Ende ich Robert Dudley gewahrte. Ich war so erleichtert, ihn zu sehen, weil er der einzige Mensch war, den ich im ganzen Palast kannte, dass ich einige Schritte auf ihn zu rannte und laut »Mylord!«, rief.
Mein Führer machte Anstalten, mich zurückzuhalten, doch Robert Dudley winkte ab. »Holder Knabe!«, begrüßte er mich freudig. Er stand auf, und nun sah ich auch seinen Gefährten. Es war der junge König, König Eduard, ganze fünfzehn Jahre alt und wunderschön gekleidet in vornehmen blauen Samt, doch mit einem Gesicht von der Farbe entrahmter Milch und schmächtiger als alle Jungen, die ich bisher gesehen hatte.
Ich beugte mein Knie, hielt meines Vaters Bücher fest und versuchte gleichzeitig, meine Kappe zu ziehen. Lord Robert stellte mich vor: »Dies ist das Mädchen, das zugleich ein Junge ist. Meint Ihr nicht, sie würde eine wunderbare Schauspielerin abgeben?«
Ich wagte nicht aufzuschauen, aber ich hörte die Stimme des Königs, ganz schwach vor Schmerzen. »Ihr habt wunderliche Anwandlungen, Dudley. Warum sollte ausgerechnet sie eine Schauspielerin werden?«
»Wegen ihrer Stimme«, erklärte Dudley. »So eine wunderbar süße Stimme, und dann dieser Akzent, halb spanisch und halb Londoner, ich könnte ihr immerzu zuhören. Und sie hat eine Körperhaltung wie eine Prinzessin in den Lumpen eines Bettlers. Findet Ihr nicht, dass sie ein reizendes Kind ist?«
Ich hielt den Kopf gesenkt, damit er die Röte nicht sehen konnte, die mir ob dieses Lobes in die Wangen gestiegen war. Ich sog die Worte begierig in meine magere Brust auf. »Prinzessin in Bettlerlumpen«, »süße Stimme«, »reizend».
Die Stimme des jungen Königs holte mich in die Wirklichkeit zurück. »Nun, und welche Rolle soll sie spielen? Ein Mädchen, das einen Jungen spielt, der ein Mädchen spielt. Außerdem ist es nach der Heiligen Schrift verboten, dass sich ein Mädchen wie ein Junge kleidet.« Seine Stimme ging in einem Hustenanfall unter, der ihn schüttelte, wie ein Bär einen Hund schütteln mag.
Ich schaute auf und sah Dudley eine Bewegung zu dem jungen Mann hin machen, als wollte er ihn stützen. Der König nahm sein Taschentuch vom Mund, und ich sah flüchtig einen dunklen Flecken, dunkler als Blut. Rasch steckte er sein Taschentuch weg.
»Es ist keine Sünde«, sagte Dudley beschwichtigend. »Dieses Mädchen ist keine Sünderin. Sie ist eine heilige Närrin. In der Fleet Street hat sie einen leibhaftigen Engel wandeln sehen. Könnt Ihr Euch so etwas vorstellen? Ich war dabei – sie hat ihn wirklich gesehen.«
Der jüngere Mann wandte sich sogleich zu mir, und sein Gesicht strahlte vor Eifer. »Du kannst Engel sehen?«
Ich blieb auf meinem Knie und senkte den Blick. »Mein Vater sagt, ich bin eine Närrin«, versuchte ich auszuweichen. »Verzeiht mir, Euer Gnaden.«
»Aber du hast tatsächlich einen Engel in der Fleet Street gesehen?«
Ich nickte mit niedergeschlagenen Augen. Meine Gabe konnte ich nicht verleugnen. »Ja, allergnädigster Herr. Verzeiht. Ich hatte Euch missverstanden. Ich wollte niemanden kränken und …«
»Was kannst du in meiner Zukunft sehen?«, fiel er mir ins Wort.
Nun blickte ich auf. Jeder hätte den Schatten des Todes auf seinem Gesicht erkannt, an seiner wächsernen Haut, den geschwollenen Augen, seiner Magerkeit, selbst ohne den Beweis im Taschentuch. Ich versuchte, wieder auszuweichen, aber dann strömten die Worte gegen meinen Willen aus mir heraus. »Ich sehe, wie sich die Pforten des Himmels öffnen.«
Wieder machte Robert Dudley diese kleine Bewegung, als ob er den jungen König stützen wollte, doch dann ließ er die Hand sinken.
Der junge König war mir nicht böse. Er lächelte. »Dieses Kind sagt die Wahrheit, wo alle anderen lügen«, sagte er. »Ihr anderen lauft nur herum auf der Suche nach neuen Lügen. Aber diese Kleine hier …« Er geriet außer Atem und begnügte sich damit, mir freundlich zuzulächeln.
»Euer Hoheit, die Himmelspforten stehen offen seit Eurer Geburt«, sagte Dudley beschwichtigend. »Seit Eure Mutter zum Himmel aufgefahren ist. Mehr will dieses Mädchen damit gar nicht sagen.« Er warf mir einen wütenden Blick zu. »Oder?«
Der junge König streckte mir eine Hand entgegen. »Bleib hier am Hofe. Du sollst mein Hofnarr sein.«
»Ich muss heimgehen zu meinem Vater, Euer Hoheit«, wandte ich so ruhig und ergeben ein, wie mir möglich war, wobei ich Lord Roberts zornige Miene übersah. »Ich bin heute nur in den Palast gekommen, um Lord Robert seine Bücher zu bringen.«
»Du sollst mein Hofnarr sein und meine Livree tragen«, bestimmte der junge Mann. »Robert, ich bin Euch dankbar, dass Ihr mir dieses Mädchen gebracht habt. Ich werde es Euch nicht vergessen.«
Die Audienz war beendet. Robert Dudley verneigte sich und schnippte mit den Fingern, damit ich ihm folgte. Er drehte sich auf dem Absatz um und verließ den Raum. Ich zögerte noch, ich wollte das Ansinnen des Königs eigentlich ablehnen, konnte aber nicht mehr tun, als mich ebenfalls zu verneigen und rasch hinter Robert Dudley herzulaufen, der bereits in der Audienzhalle war und die Männer beiseitestieß, die sich ihm in den Weg stellten, um nach dem Befinden des Königs zu fragen. »Jetzt nicht«, wies er sie barsch ab.
Er schritt eine lange Galerie entlang auf eine Doppeltür zu. Soldaten mit Piken bewachten sie, stießen sie jedoch bereitwillig auf. Dudley durchschritt die Pforte, ohne ihr Salut zu erwidern, und ich folgte ihm auf den Fersen wie ein Schoßhund seinem Herrn. Endlich kamen wir zu einer hohen Doppeltür, deren Wachsoldaten die Livree der Dudleys trugen, und traten ein.
»Vater«, sagte Dudley und beugte sein Knie.
In dem großen Vorraum stand ein Mann vor dem Kamin und starrte in die Flammen. Er wandte sich um und schlug mit zwei Fingern gleichmütig das Kreuz über dem Haupt seines Sohnes. Auch ich fiel aufs Knie und verharrte in dieser Haltung, selbst als ich spürte, dass Robert Dudley neben mir wieder aufstand.
»Wie geht es dem König heute Morgen?«
»Schlechter«, erwiderte Robert in nüchternem Ton. »Hustet schlimm, hat sogar etwas schwarze Galle gespuckt. Kommt rasch außer Atem. Wird es nicht mehr lange machen, Vater.«
»Und dies ist das Mädchen?«
»Dies ist die Tochter des Buchhändlers, sie behauptet, zwölf zu sein, aber ich schätze sie älter, zieht sich an wie ein Junge, ist aber auf jeden Fall ein Mädchen. Besitzt laut John Dee das zweite Gesicht. Ich habe sie zum König gebracht, wie Ihr befohlen hattet, habe sie ihm als Hofnarr übereignet. Sie hat ihm gesagt, sie sähe die Himmelspforten für ihn geöffnet. Das hat ihm gefallen. Nun soll sie seine Hofnärrin werden.«
»Gut«, sagte der Herzog. »Und hast du sie über ihre Pflichten unterrichtet?«
»Ich habe sie geradewegs zu Euch gebracht.«
»Steh auf, Narr.«
Ich erhob mich und konnte nun einen ersten Blick auf Robert Dudleys Vater, den Herzog von Northumberland, werfen, den mächtigsten Mann im Königreich. Er hatte ein langes, knochiges Pferdegesicht mit dunklen Augen, auf seinem kahl werdenden Kopf saß eine prächtige Samtkappe mit einer großen Silberbrosche, die das Dudley-Wappen darstellte, den Bären und den Stamm. Bart und Schnurrbart, die seinen vollen Mund einrahmten, trug er nach spanischer Mode. Dann schaute ich ihm in die Augen und sah – nichts. Das Gesicht dieses Mannes verriet nicht das Geringste über seine Gedanken, es war, als habe er ein Abkommen mit sich selbst getroffen, nichts über sich preiszugeben.
»Nun?«, sprach er mich an. »Was siehst du mit deinen großen schwarzen Augen, mein junger Narr – oder vielmehr, meine junge Närrin?«
»Nun, Engel kann ich keine hinter Euch entdecken«, gab ich zurück und erntete ein belustigtes Lächeln vom Herzog sowie ein abgehacktes Lachen von seinem Sohn.
»Ausgezeichnet«, lobte der Herzog. »Gut pariert.« Er überlegte kurz. »Höre, Hofnarr – wie ist dein Name?«
»Hannah Green, Mylord.«
»Höre, Hannah die Hofnärrin, du bist dem König als Narr in Leibeigenschaft gegeben worden, und er hat dich in seinen Dienst genommen, getreu unseren Gesetzen und Gebräuchen. Weißt du überhaupt, was das bedeutet?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Du wirst sein Eigen, wie einer seiner jungen Hunde oder einer seiner Soldaten. Doch anders als bei einem Soldaten besteht deine Aufgabe darin, du selbst zu sein. Du sollst sagen, was dir in den Sinn kommt, und tun, wonach es dich gelüstet. Das freut ihn, und uns führt es die heilige Einfalt vor Augen, was wiederum den König freut. An diesem Hofe der Lügner und Speichellecker wirst du als Einzige die Wahrheit sagen, wirst du die Stimme der Unschuld sein. Verstehst du?«
»Wie soll ich sein?« Ich war vollkommen verwirrt. »Was verlangt Ihr von mir?«
»Du sollst ganz du selbst sein. Sprich, wie deine Gabe es dir eingibt. Sag alles, was dir in den Sinn kommt. Der König hat zurzeit keinen heiligen Narren, und es gefällt ihm, wenn bei Hofe auch eine Stimme der Unschuld spricht. Er hat dich zu seinem Hofnarren bestimmt. Nun sei es auch! Du gehörst zum Hofstaat. Du wirst für deine Dienste als Hofnärrin bezahlt werden.«
Ich wartete.
»Verstehst du, Hofnarr?«
»Ja. Aber ich nehme den Dienst nicht an.«
»Du kannst den Dienst nicht verweigern. Du bist ihm als Hofnarr übereignet worden, du besitzt keine rechtliche Stellung, du hast keine Stimme. Dein Vater hat dich Lord Robert übergeben, und dieser hat dich dem König gegeben. Du bist nun das Eigentum des Königs.«
»Und wenn ich mich weigere?« Ich hatte angefangen zu zittern.
»Du kannst dich nicht weigern.«
»Und wenn ich fortlaufe?«
»Dann wirst du nach der Maßgabe des Königs bestraft: geprügelt wie ein junger Hund. Einst warst du Eigentum deines Vaters, nun gehörst du uns. Und wir haben dich dem König als Hofnarr angeboten. Du bist nun sein Eigentum. Verstehst du?«
»Mein Vater würde mich niemals verkaufen«, sagte ich störrisch. »Er würde mich nicht hergeben.«
»Gegen uns kommt er nicht an«, ließ sich Robert leise in meinem Rücken vernehmen. »Und ich habe ihm versprochen, dass du hier sicherer seist als auf der Straße. Ich gab ihm mein Wort, und er erklärte sich einverstanden. Diese Vereinbarung wurde während der Buchbestellung getroffen, Hannah. Alles ist bereits arrangiert.«
»Allerdings«, fuhr der Herzog fort, »hast du noch eine weitere Aufgabe zu erfüllen.«
Ich wartete.
»Du sollst unser Vasall sein.«
Als das mir unbekannte englische Wort fiel, sah ich Robert Dudley fragend an.
»Ein Lehnsmann, ein Knecht auf Lebenszeit«, erklärte er.
»Unser Vasall. Alles, was du hörst, alles, was du siehst, teilst du mir umgehend mit. Wofür der König betet, was ihn zum Weinen bringt, was ihn zum Lachen bringt – alles berichtest du sofort Robert oder mir. Du sollst für uns Auge und Ohr an der Seite des Königs sein. Verstehst du?«
»Mylord, ich muss heim zu meinem Vater«, beharrte ich verzweifelt. »Ich kann weder Hofnärrin des Königs noch Eure Vasallin sein. Ich muss doch in unserem Buchladen arbeiten!«
Der Herzog warf seinem Sohn einen bedeutsamen Blick zu. Robert neigte sich vertraulich zu mir und redete beschwörend auf mich ein.
»Holder Knabe, dein Vater kann sich nicht um dich kümmern. Das hat er in deinem Beisein gesagt, erinnerst du dich nicht?«
»Ja, aber, Mylord, er wollte doch nur sagen, dass ich eine Last für ihn bin …«
»Holder Knabe, ich vermute, dein Vater stammt gar nicht aus einer guten christlichen Familie, sondern ist Jude. Ihr seid aus Spanien geflohen, weil man Juden in diesem Lande nicht duldet. Und wenn eure Nachbarn und die braven Londoner Bürger wüssten, dass ihr Juden seid, würdet ihr euer neues kleines Heim nicht mehr lange euer Eigen nennen können.«
»Wir sind Marranen, unsere Familie ist schon vor Jahren konvertiert«, flüsterte ich fieberhaft. »Ich bin getauft, ich bin einem jungen Mann, einem englischen Christen, den mein Vater ausgesucht hat, zur Braut versprochen …«
»Diese Richtung würde ich nicht einschlagen«, warnte Robert Dudley freimütig. »Führe uns nur zu diesem jungen Mann, und ich stelle mir vor, dass wir auf eine in England versteckte Judensippe stoßen, und von dort aus geht es nach – wo seid ihr vorher gewesen – Amsterdam? Und weiter nach Paris?«
Ich öffnete den Mund, um zu leugnen, brachte aber vor Angst keinen Ton heraus.
»Eine verschworene Gemeinschaft heimlicher Juden, die vorgeben, Christen zu sein. Alle stecken sie am Freitagabend eine Kerze an, essen kein Schweinefleisch, leben in ständiger Furcht vor der Schlinge, die sich um ihren Hals legen könnte.«
»Sir!«
»Sie haben sich zusammengetan und geholfen, euch nach England zu bringen, nicht wahr? Die Juden leben über alle Länder verstreut, praktizieren im Verborgenen die Riten ihrer verbotenen Religion, doch sie helfen einander stets. Es ist ein geheimes Netz, wie die Furchtsamsten unter den Christen immer behauptet haben.«
»Mylord!«
»Willst du wirklich der Schlüssel sein, der unseren hoch christlichen König in die Lage versetzt, dieses Netz auszuheben? Weißt du nicht, dass die reformierte Kirche ebenso helle Scheiterhaufen anzünden kann wie die Papisten? Willst du deine Familie auf den Scheiterhaufen bringen? Und alle eure Freunde? Hast du jemals den Gestank von brennendem Menschenfleisch gerochen?«
Nun zitterte ich wirklich furchtbar, und meine Kehle war so ausgedörrt, dass ich kein Wort herausbrachte. Ich wusste, dass man mir die Angst ansah. Und auf meiner Stirn hatte sich ein feiner Schweißfilm gebildet.
»Wir wissen es also beide. Und dein Vater weiß, dass er dich nicht beschützen kann. Aber ich kann es. Genug. Mehr werde ich dazu nicht sagen.«
Er verstummte. Ich versuchte zu sprechen, brachte aber nur ein leises Krächzen zustande. Robert Dudley nickte zufrieden, als er sah, wie eingeschüchtert ich war. »Doch zum Glück für dich hat deine Gabe dir den sichersten und höchsten Platz beschert, von dem du nur träumen kannst. Diene dem König zu seiner Zufriedenheit, diene uns, und dein Vater hat nichts zu befürchten. Versagst du jedoch, wird er zur Strafe so lange in einer Decke geschüttelt, bis ihm die Augen in den Kopf hineinrutschen, und du wirst verheiratet mit einem bigotten Schweinehirten, dessen einzige Lektüre in der Lutherbibel besteht. Du hast die Wahl.«
Einen winzigen Augenblick herrschte Schweigen. Dann bedeutete mir der Herzog von Northumberland mit einer Handbewegung, ich möge mich entfernen. Er wartete meine Antwort nicht einmal ab. Er benötigte nicht die Gabe der Vorhersehung, um zu wissen, wie meine Entscheidung ausfallen musste.
»Und du sollst tatsächlich bei Hofe leben?«, erkundigte sich mein Vater.
Wir saßen beim Abendessen, das aus einer kleinen Pastete von dem Backhaus am Ende der Straße bestand. Der ungewohnte Geschmack des englischen Backwerks steckte sperrig in meiner Kehle, während mein Vater den Fleischsaft hinunterwürgte, der nach Speckschwarten schmeckte.
»Ich soll bei den Mägden schlafen«, antwortete ich verdrießlich. »Und die Livree eines königlichen Pagen tragen. Ich soll dem König Gesellschaft leisten.«
»Es ist besser als alles, was ich dir hätte bieten können«, sagte mein Vater im Bemühen, sich zu freuen. »Ohne Lord Robert, der so viele Bücher bestellt hat, könnten wir nicht einmal genug verdienen, um die nächste Quartalsmiete zu bezahlen.«
»Ich kann Euch meinen Lohn schicken«, bot ich an. »Ich werde nämlich bezahlt werden.«
Er tätschelte meine Hand. »Du bist ein gutes Kind«, lobte er. »Vergiss das nie. Vergiss nie deine Mutter, und denke immer daran, dass du ein Kind Israels bist.«
Ich nickte und schwieg. Ich sah ihm zu, wie er ein wenig von dem ekelhaften Fleischsaft auf seinen Löffel nahm und hinunterschluckte.
»Morgen muss ich wieder im Palast erscheinen«, flüsterte ich. »Ich soll nämlich morgen anfangen. Vater …«
»Ich werde jeden Abend ans Tor kommen, um dich zu sehen«, versprach er. »Und wenn du unglücklich bist oder schlecht behandelt wirst, gehen wir fort. Wir können wieder nach Amsterdam, wir könnten sogar in die Türkei. Irgendeinen Platz werden wir schon finden, querida. Du musst Mut haben, Tochter. Du bist eine aus dem Auserwählten Volk.«
»Wie soll ich denn die Fastentage einhalten?«, fragte ich, plötzlich sehr traurig. »Sie werden mich zwingen, am Sabbat zu arbeiten. Wie soll ich dann beten? Sie werden mich zwingen, Schweinefleisch zu essen!«