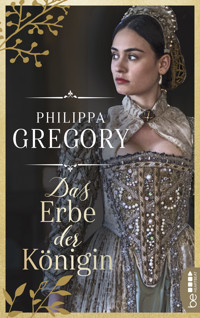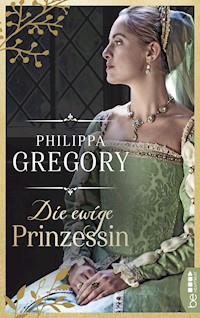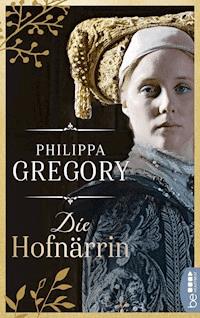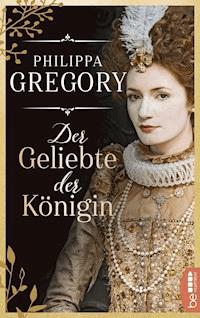9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Liebe und Intrige am Hofe Heinrichs VIII.
Als Mary Boleyn mit vierzehn an den Hof von Heinrich VIII. kommt, fällt sie dem König sofort ins Auge. Schon bald ist sie seine Geliebte. Zuerst genießt Mary ihre Rolle als inoffizielle Königin, doch schnell muss sie erkennen, dass sie nur ein Spielball in den Machtplänen ihrer Familie ist.
Der König interessiert sich mit der Zeit mehr und mehr für ihre Schwester Anne Boleyn. Weder Korruption noch Ehebruch oder Mord können den Aufstieg der neuen Favoritin aufhalten. Der Hof, die Kirche und das Land sind gespalten in ihrer Sympathie für die alte Königin Katherine von Aragón und Anne Boleyn. Doch das Allerwichtigste für Heinrich VIII. ist ein Thronfolger. Als Anne schwanger wird, trennt sich der König von der Kirche Roms, um sie heiraten zu können. Mary muss sich damit abfinden, nur noch eine Nebenfigur am Hofe zu sein ...
„Ein Kronjuwel von Geschichtsroman.“ Gala.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1009
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Philippa Gregory
Die Schwester der Königin
Roman
Aus dem Englischen von Ulrike Seeberger
Impressum
Die Originalausgabe unter dem Titel
The Other Boleyn Girl
erschien 2001 bei HarperCollinsPublishers, London.
ISBN E-Pub 978-3-8412-0417-2
ISBN PDF 978-3-8412-2417-0
ISBN Printausgabe 978-3-7466-2225-5
Aufbau Digital, veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, Novermber 2011
© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, Berlin Die deutsche Erstausgabe erschien 2004 bei Rütten & Loening; Rütten & Loening ist eine Marke der Aufbau Verlag GmbH & Co. KG Copyright © Philippa Gregory Ltd 2001
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischenSystemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
www.buerosued.de unter Verwendung eines Fotos von © Richard Jenkins
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH, KN digital –
die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
www.aufbau-verlag.de
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsübersicht
Frühling 1521
Frühling 1522
Sommer 1522
Winter 1522
Frühling 1523
Sommer 1523
Winter 1523
Frühling 1524
Sommer 1524
Winter 1524
Frühling 1525
Herbst 1525
Frühling 1526
Sommer 1526
Herbst 1526
Winter 1526
Frühling 1527
Sommer 1527
Herbst 1527
Winter 1527
Sommer 1528
Herbst 1528
Frühling 1529
Sommer 1529
Herbst 1529
Weihnachten 1529
Sommer 1530
Herbst 1530
Weihnachten 1530
Frühling 1531
Sommer 1531
Herbst 1531
Frühling 1532
Sommer 1532
Herbst 1532
Winter 1532
Frühling 1533
Sommer 1533
Herbst 1533
Winter 1533
Frühling 1534
Sommer 1534
Winter 1534
Frühling 1535
Sommer 1535
Herbst 1535
Winter 1535
Frühling 1536
Mai 1536
Anmerkung der Autorin
|5|Für Anthony
|7|Frühling 1521
Ich hörte gedämpften Trommelwirbel. Sehen konnte ich nichts außer der Schnürung am Mieder der Dame vor mir, die mir den Blick auf das Schafott versperrte. Ich war nun schon über ein Jahr am Hof und hatte Hunderte von Festlichkeiten miterlebt, aber noch keine wie diese.
Wenn ich ein wenig zur Seite trat und den Hals reckte, sah ich, wie der Verurteilte in Begleitung seines Priesters langsam vom Tower zu der Wiese schritt, wo die hölzerne Plattform wartete und mitten darauf der Holzblock. Der Scharfrichter trug schon die Kleidung seines Amtes, stand in Hemdsärmeln da, mit der schwarzen Kapuze über dem Kopf. Alles schien eher ein Maskenspiel als Wirklichkeit zu sein. Ich schaute zu, als würde ein Theaterstück für den Hof gegeben. Der König saß auf dem Thron und wirkte zerstreut, als ginge er im Kopf noch einmal die Rede durch, mit der er die Begnadigung verkünden würde. Hinter ihm standen mit ernster Miene William Cary, mein Ehemann seit einem Jahr, mein Bruder George und mein Vater, Sir Thomas Boleyn. Ich wackelte in meinen Seidenschuhen mit den Zehen und wünschte mir, der König würde sich beeilen und endlich seinen Gnadenerlaß aussprechen, damit wir alle frühstücken gehen konnten. Ich war erst dreizehn Jahre alt und hatte ständig Hunger.
Am anderen Ende des Holzgerüstes legte der Herzog von Buckinghamshire seinen dicken Umhang ab. Wir waren nah genug miteinander verwandt, daß ich ihn Onkel nennen durfte. Er war zu meiner Hochzeit gekommen und hatte mir ein goldenes Armband geschenkt. Mein Vater erklärte mir, er hätte den König auf ein Dutzend verschiedene Arten beleidigt: In seinen Adern floß königliches Blut, und er hielt sich ein viel zu großes Gefolge, als daß es einem König gefallen |8|konnte, der sich seines Throns noch nicht vollkommen sicher war. Am schlimmsten aber war, daß er angeblich gesagt hatte, der König habe bis jetzt keinen Sohn und Erben, würde auch sicher keinen mehr bekommen und wahrscheinlich ohne männlichen Thronfolger sterben.
Derlei Gedanken durfte man nicht laut äußern. Der König, der Hof, das ganze Land wußten, daß die Königin unbedingt einem Sohn das Leben schenken mußte, und zwar bald. Etwas anderes auch nur anzudeuten, das war der erste Schritt auf dem Pfad, der zu den hölzernen Stufen des Schafotts führte, die mein Onkel, der Herzog, jetzt gerade furchtlos und mit festen Schritten hinaufstieg. Ein guter Höfling spricht niemals unbequeme Wahrheiten an. Bei Hof hatte man stets fröhlich zu sein.
Onkel Stafford trat vorne an die Plattform, um ein paar letzte Worte zu sprechen. Ich war zu weit weg, um sie hören zu können. Ich hatte ohnehin nur Augen für den König, der sicherlich auf das Stichwort wartete, um endlich vorzutreten und den königlichen Gnadenerlaß zu geben. Dieser Mann, der da im Sonnenlicht des frühen Morgens auf dem Schafott stand, hatte gegen den König Tennis gespielt, war in Turnieren gegen ihn geritten, war sein Kumpan bei Hunderten von Trinkgelagen und Glücksspielen gewesen. Seit ihrer Kinderzeit waren die beiden Freunde. Der König wollte ihm gewiß nur eine Lektion erteilen, eine eindrucksvolle öffentliche Lektion, und dann würde er ihn begnadigen, und wir konnten alle frühstücken gehen.
Die kleine, ferne Gestalt des Herzogs wandte sich jetzt dem Beichtvater zu. Er beugte den Kopf, um den Segen zu empfangen, und küßte den Rosenkranz. Er kniete sich vor den Block, umfaßte ihn mit beiden Händen. Ich fragte mich, wie es wohl sein mußte, die Wange an das glatte, gewachste Holz zu schmiegen. Selbst wenn er wußte, daß alles nur eine Maskerade war und nicht die Wirklichkeit, mußte es doch für meinen Onkel ein seltsames Gefühl sein, den Kopf auf den Block zu legen und zu wissen, daß hinter ihm der Scharfrichter stand.
Der Henker hob das Beil. Ich blickte zum König. Sein Einspruch |9|ließ sehr lange auf sich warten. Ich schaute auf das Gerüst zurück. Mein Onkel, den Kopf auf dem Block, breitete die Arme weit aus, als Zeichen der Zustimmung, als Zeichen, daß das Beil fallen konnte. Ich blickte wieder zum König, der jetzt sofort aufspringen mußte. Aber er saß immer noch da, das hübsche Antlitz zu einer grimmigen Miene verzerrt. Und während ich auf ihn blickte, erscholl ein weiterer Trommelwirbel, der plötzlich abbrach. Dann hörte man den dumpfen Schlag des Beils: einmal, dann noch einmal und ein drittes Mal. Das Geräusch klang heimelig und vertraut wie Holzhacken. Ungläubig starrte ich auf den Kopf meines Onkels, der ins Stroh rollte, und auf den blutroten Strom aus dem Hals. Der Scharfrichter mit der schwarzen Kapuze legte das große, blutverschmierte Beil aus der Hand und hob den abgeschlagenen Kopf am dicken, lockigen Haar hoch, so daß wir ihn alle sehen konnten: Eine schwarze Binde verdeckte Stirn und Nase, darunter waren die Zähne zu einem letzten trotzigen Grinsen gefletscht.
Langsam stand der König auf, und ich dachte in meinem kindlichen Gemüt: Großer Gott, wie furchtbar peinlich das wird. Er hat zu lange gewartet. Es ist alles schiefgegangen. Er hat vergessen, rechtzeitig einzugreifen.
Aber ich irrte mich. Er hatte nicht zu lange gewartet, er hatte nichts vergessen. Er wollte, daß mein Onkel vor den Augen des gesamten Hofstaats starb, damit alle wußten, daß es nur einen König gab, nämlich Henry. Es konnte nur einen König geben, nämlich Henry. Und diesem König würde ein Sohn geboren werden – etwas anderes auch nur anzudeuten, bedeutete einen schmählichen Tod.
Schweigend ließ sich der Hofstaat in drei Barken flußaufwärts zum Palast von Westminster zurückrudern. Einige Männer am Flußufer zogen den Hut und fielen auf die Knie, als die königliche Barke mit flatternden Wimpeln rasch an ihnen vorüberglitt. Ich saß mit den Hofdamen in der zweiten Barke, der Barke der Königin. Meine Mutter war in meiner Nähe. In einem seltenen Augenblick der Anteilnahme blickte sie zu mir herüber und bemerkte: »Du bist sehr blaß, Mary, ist dir übel?«
|10|»Ich hätte nicht gedacht, daß er wirklich hingerichtet würde«, erwiderte ich. »Ich dachte, der König würde ihn begnadigen.«
Meine Mutter beugte sich ganz nah zu meinem Ohr, damit niemand uns über das Knarren des Bootes und die Trommeln der Ruderer hinweg hören konnte. »Dann bist du eine Närrin«, meinte sie knapp. »Und schlimmer noch, du sprichst es auch noch aus. Schau nur gut hin und lerne, Mary. Bei Hof kann man sich keinen Fehler leisten.«
|11|Frühling 1522
»Morgen reise ich nach Frankreich und bringe deine Schwester Anne mit nach Hause«, verkündete mir mein Vater auf den Stufen des Palastes von Westminster. »Sie soll in den Hofstaat der Königin Mary Tudor aufgenommen werden.«
»Ich dachte, sie würde in Frankreich bleiben«, erwiderte ich. »Sie würde einen französischen Grafen heiraten oder so.«
Er schüttelte den Kopf. »Wir haben andere Pläne mit ihr.«
Ich wußte, es wäre sinnlos, ihn nach der Art dieser Pläne zu fragen. Am meisten befürchtete ich, daß die Familie für Anne eine bessere Heirat plante als meine. Dann müßte ich den Rest meines Lebens dem Saum ihres Kleides folgen, während sie vor mir herstolzierte.
»Schau nicht so mißmutig«, sagte mein Vater bissig.
Sofort setzte ich mein Höflingslächeln auf. »Selbstverständlich, Vater«, antwortete ich gehorsam.
Er nickte, und ich machte einen tiefen Knicks, während er sich bereits von mir abwandte. Ich erhob mich wieder und ging langsam zum Schlafgemach meines Mannes. An der Wand hing ein kleiner Spiegel, und ich stellte mich davor und starrte mein Ebenbild an. »Es wird alles gut«, flüsterte ich mir zu. »Ich bin eine Boleyn, und das ist keine Kleinigkeit. Meine Mutter ist eine geborene Howard, stammt aus einer der großartigsten Familien im Lande. Ich bin ein Howard-Mädchen, ein Boleyn-Mädchen!« Ich biß mir auf die Lippen. »Anne allerdings auch.«
Ich lächelte mein leeres Höflingslächeln, und das Spiegelbild lächelte zurück. »Ich bin zwar das jüngste Boleyn-Mädchen, doch bei weitem nicht das geringste. Ich bin mit William Carey verheiratet, einem Mann, der hoch in der Gunst des Königs steht. Ich bin der Liebling der Königin, ihre jüngste |12|Hofdame. Das kann mir niemand verderben. Nicht einmal sie kann mir das nehmen.«
Anne und Vater wurden durch Frühjahrsstürme aufgehalten. Ich hegte die kindische Hoffnung, ihr Schiff würde sinken und Anne würde ertrinken. Beim Gedanken an ihren Tod verspürte ich eine seltsame Mischung aus aufrichtiger Trauer und Freude. Ich konnte mir keine Welt ohne Anne vorstellen, und doch war auf dieser einen Welt auch kaum Platz für uns beide.
Schließlich traf sie unversehrt ein. Ich sah, wie mein Vater mit ihr vom königlichen Landesteg über die kiesbestreuten Pfade zum Palast schritt. Sogar aus dem Fenster im ersten Stock konnte ich den Schwung ihres Kleides und den eleganten Schnitt ihres Umhangs erkennen, und ich verspürte einen Augenblick lang puren Neid, als ich sah, wie weich der Stoff ihre Gestalt umspielte. Ich wartete, bis die beiden aus meinem Blickfeld verschwunden waren. Dann eilte ich an meinen Platz im Audienzsaal der Königin.
Anne sollte gleich sehen, wie sehr ich in den reich mit Wandteppichen ausgehängten Gemächern der Königin zu Hause war. Ich würde mich außerordentlich erwachsen und elegant erheben und sie begrüßen. Doch als die Tür aufging und sie hereintrat, überwältigte mich die Freude, und ich rief unwillkürlich laut »Anne!« und rannte mit wehenden Gewändern auf sie zu. Und Anne, die mit hoch erhobenem Kopf eingetreten war und mit ihren arroganten dunklen Augen pfeilschnell den ganzen Raum überflogen hatte, fiel genauso aus der Rolle, war plötzlich keine großartige junge Dame von fünfzehn Jahren mehr und breitete die Arme aus.
»Du bist gewachsen«, sagte sie atemlos, während sie mich fest umarmte und ihre Wange an die meine drückte.
»Ich trage so hohe Absätze.« Ich sog ihren vertrauten Duft ein: Seife und Rosenessenz auf der warmen Haut, Lavendel aus ihrer Kleidung.
»Geht es dir gut?«
»Ja. Und dir?«
»Bien sûr! Und wie ist es? Der Ehestand?«
|13|»Nicht schlecht. Schöne Kleider.«
»Und er?«
»Sehr vornehm. Immer beim König, hoch in seiner Gunst.«
»Hast du es schon mit ihm gemacht?«
»Ja, vor Ewigkeiten.«
»Hat es weh getan?«
»Sehr.«
Sie trat ein wenig zurück, um mein Gesicht zu mustern.
»Nicht zu sehr«, wandte ich ein. »Er versucht, sanft mit mir zu sein. Er gibt mir immer Wein. Es ist eigentlich alles ziemlich scheußlich.«
»Wieso scheußlich?«
»Er pißt in den Topf, gleich neben mir, wo ich es sehen kann.«
Sie bog sich vor Lachen. »Nein!«
»Nun, Kinder«, sagte mein Vater, der hinter Anne auftauchte. »Mary, stelle der Königin deine Schwester Anne vor.«
Gehorsam führte ich sie durch das Gedränge der Hofdamen zur Königin, die aufrecht auf einem Stuhl beim Kamin saß. »Sie ist sehr streng«, warnte ich Anne. »Hier geht es nicht zu wie in Frankreich.«
Katherine von Aragon musterte Anne mit ihren klaren blauen Augen, und plötzlich durchfuhr mich beinahe schmerzlich die Angst, sie könnte mir meine Schwester vorziehen.
Anne sank vor der Königin in einen tadellosen französischen Hofknicks und erhob sich, als läge ihr der ganze Palast zu Füßen. In ihrer Stimme schwangen verführerische Untertöne mit, jede ihrer Gesten kündete vom französischen Hof. Voller Freude stellte ich fest, daß die Königin auf Annes elegante Manieren mit eisiger Ablehnung reagierte. Ich führte meine Schwester zu einem Fenstersitz.
»Sie haßt die Franzosen«, erklärte ich. »Sie wird dir niemals erlauben, dich in ihrer Nähe aufzuhalten, wenn du so weitermachst.«
Anne zuckte die Schultern. »Das ist die neueste Mode in der Etikette. Ob es ihr gefällt oder nicht. Was denn sonst?«
»Spanisch?« schlug ich vor. »Wenn du dich unbedingt verstellen mußt.«
|14|Anne lachte lauthals auf. »Und diese scheußlichen Hauben tragen! Sie sieht aus, als hätte ihr jemand ein Dach auf den Kopf gesetzt.«
»Psst«, zischte ich tadelnd. »Sie ist eine wunderschöne Frau. Die schönste Königin Europas.«
»Sie ist eine alte Frau«, erwiderte Anne grausam. »Trägt wie eine alte Frau die häßlichsten Kleider Europas, kommt aus der dümmsten Nation Europas. Wir haben für die Spanier nichts übrig.«
»Wer ist wir?« fragte ich kühl. »Nicht die Engländer.«
»Les Français!« sagte sie zu meinem Ärger. »Bien sûr! Ich bin inzwischen beinahe selbst Französin.«
»Du bist in England geboren und aufgewachsen, genau wie George und ich«, antwortete ich nüchtern. »Und ich wurde genau wie du am französischen Hof erzogen. Warum mußt du immer so tun, als wärst du etwas Besseres?«
»Weil jeder schließlich irgend etwas tun muß.«
»Was meinst du damit?«
»Jede Frau braucht etwas, das sie von allen anderen unterscheidet, etwas, das ins Auge fällt, das sie in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückt. Ich werde eben Französin sein.«
»Du gibst also vor, etwas zu sein, was du nicht bist«, sagte ich mißbilligend.
Sie funkelte mich an, musterte mich mit ihren dunklen Augen, wie nur sie es konnte. »Ich verstelle mich nicht mehr und nicht weniger als du«, erwiderte sie ruhig. »Meine kleine Schwester, meine kleine goldene Schwester, meine Milch-und-Honig-Schwester.«
Ich schaute mit meinen helleren Augen in ihre dunklen und begriff, daß ich ihr Lächeln lächelte, daß sie mein dunkler Spiegel war. »Oh, das«, meinte ich und weigerte mich, den Treffer anzuerkennen. »Oh, das.«
»Genau«, antwortete sie. »Ich werde dunkel und französisch und modisch elegant und kapriziös sein, du dagegen lieb und nett und naiv und englisch und blond. Was wir für ein Paar abgeben! Welcher Mann könnte uns wohl widerstehen?«
Ich lachte. Sie brachte mich immer zum Lachen. Ein Blick |15|aus dem bleiverglasten Fenster verriet mir, daß die Jagdgesellschaft des Königs in den Stallhof zurückkehrte.
»Ist das der König? Kommt er hierher?« fragte Anne. »Sieht er so gut aus, wie man sagt?«
»Er ist wunderbar. Wirklich. Er tanzt und reitet und – oh, ich kann dir gar nicht sagen, was alles noch!«
»Kommt er jetzt her?«
»Wahrscheinlich. Er kommt immer zu ihr.«
Anne schaute abschätzig dorthin, wo die Königin mit ihren Hofdamen saß und nähte. »Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum.«
»Weil er sie liebt«, antwortete ich. »Es ist eine wunderbare Liebesgeschichte. Er hat sie seinem Bruder zur Frau gegeben, und sein Bruder ist ja so früh gestorben, so jung, und dann wußte sie nicht, was sie machen und wohin sie gehen sollte, und da hat er sie zu seiner Frau und Königin gemacht. Es ist eine wunderbare Geschichte, und er liebt sie immer noch.«
Anne zog eine ihrer vollkommen geschwungenen Augenbrauen hoch und schaute sich im Raum um. Alle Hofdamen hatten den Lärm der zurückkehrenden Jagdgesellschaft gehört, ihre Gewänder um sich ausgebreitet und sich auf ihren Stühlen zurechtgesetzt, so daß sie wie ein lebendes Bild da saßen, das man vom Eingang her gut betrachten konnte. Da flog die Tür auf, und Henry, der König, stand auf der Schwelle und strahlte in der übermütigen Freude eines verwöhnten jungen Mannes. »Jetzt habe ich euch alle überrumpelt!«
Die Königin fuhr auf. »Was für eine Überraschung!« erwiderte sie herzlich. »Und was für eine Freude!«
Das Gefolge und die Freunde des Königs traten hinter ihrem Herrn in den Raum. Zuerst kam mein Bruder George, hielt beim Anblick von Anne auf der Schwelle inne, verbarg seine große Freude hinter seiner hübschen Höflingsmaske und neigte sich tief über die Hand der Königin. »Majestät.« Er hauchte einen Kuß auf ihre Finger. »Den ganzen Morgen habe ich mich in der Sonne aufgehalten, aber erst jetzt bin ich geblendet.«
Die Königin lächelte höflich, während sie auf seinen |16|gebeugten dunklen Lockenkopf blickte. »Ihr dürft jetzt Eure Schwester begrüßen.«
»Mary ist hier?« fragte George gleichmütig, als hätte er uns nicht beide längst gesehen.
»Eure andere Schwester Anne«, verbesserte ihn die Königin. Mit einer winzigen Bewegung ihrer mit Ringen überladenen Hand gebot sie uns beiden vorzutreten. George verneigte sich in unsere Richtung, ohne von seinem bevorzugten Platz gleich beim Thron zu weichen.
»Findet Ihr sie sehr verändert?« erkundigte sich die Königin.
George lächelte. »Ich hoffe, sie wird sich noch mehr verändern, jetzt, da sie Euch als Beispiel vor Augen hat.«
Die Königin ließ ein kleines Lachen hören. »Sehr hübsch«, meinte sie anerkennend und hieß ihn sich zu uns gesellen.
»Seid gegrüßt, mein kleines Fräulein Wunderhübsch«, sagte er zu Anne. »Seid gegrüßt, gnädige Frau Wunderhübsch«, warf er mir zu.
Anne blickte ihn unter ihren dunklen Wimpern hervor an. »Ich wünschte, ich könnte dich umarmen«, sagte sie.
»Wir verlassen den Raum, sobald es geht«, bestimmte George. »Gut siehst du aus, Annamaria.«
»Es geht mir auch gut«, erwiderte sie. »Und dir?«
»So gut wie nie.«
»Wie ist denn der Mann unserer kleinen Mary?« erkundigte sie sich neugierig und beobachtete William, der gerade eintrat und sich über die Hand der Königin beugte.
»Urenkel des dritten Grafen von Somerset und sehr hoch in der Gunst des Königs.« George verriet nur die Dinge, die für ihn von Interesse waren: die Familie und die hervorragende Stellung bei Hof. »Sie hat es gut getroffen. Wußtest du, daß man dich nach Hause geholt hat, um dich zu verheiraten, Anne?«
»Vater hat nicht gesagt, mit wem.«
»Ich glaube, Ormonde soll dich bekommen«, antwortete George.
»Herzogin«, meinte Anne mit einem triumphierenden Lächeln in meine Richtung.
|17|»Aber nur in Irland«, konterte ich unverzüglich.
Mein Mann trat einen Schritt vom Stuhl der Königin zurück, erblickte uns und zog dann unmutig eine Augenbraue in die Höhe, weil Anne ihn so durchdringend und provozierend anstarrte. Der König nahm seinen Platz neben der Königin ein und ließ seinen Blick durch den Raum schweifen.
»Die Schwester meiner lieben Mary Carey hat sich zu uns gesellt«, sagte die Königin. »Das ist Anne Boleyn.«
»Georges Schwester?« fragte der König.
Mein Bruder verneigte sich. »Jawohl, Majestät.«
Der König lächelte Anne zu. Sie versank kerzengerade in einen Hofknicks, hoch erhobenen Hauptes und mit einem kecken kleinen Lächeln auf den Lippen. Der König war davon sichtlich nicht sonderlich eingenommen. Er bevorzugte entgegenkommende Frauen, freundlich lächelnde Frauen. Frauen, die ihn mit finsterem Blick herausforderten, mochte er dagegen nicht.
»Seid Ihr glücklich, wieder mit Eurer Schwester vereint zu sein?« fragte er mich.
Ich machte einen tiefen Hofknicks und errötete ein wenig. »Natürlich, Eure Majestät«, antwortete ich liebreizend. »Welches Mädchen würde sich nicht nach der Gesellschaft einer solchen Schwester sehnen?«
Er runzelte über diese Worte ein wenig die Stirn. Der offene, derbe Humor der Männer war ihm lieber als der stachelige Witz der Frauen. Er blickte von mir zu Annes leicht fragendem Gesichtsausdruck, verstand dann meinen Scherz und lachte lauthals, schnippte mit den Fingern und streckte mir die Hand entgegen.
»Keine Sorge, mein Herz«, sagte er. »Niemand vermag eine junge Ehefrau in den ersten Jahren ehelichen Glücks in den Schatten zu stellen. Und Carey und ich, wir beide haben eine Vorliebe für blonde Frauen.«
Darüber lachten alle, ganz besonders Anne, die dunkles Haar hatte, und die Königin, deren rötliches Haar inzwischen zu einem Gemisch aus braun und grau verblichen war. Sie wären Närrinnen gewesen, wenn sie sich nicht herzlich über |18|den Scherz des Königs mitgefreut hätten. Und ich fiel ebenfalls ein, wenn auch mit mehr Freude im Herzen als sie, denke ich.
Die Musikanten spielten einen Tusch, und Henry zog mich zu sich. »Ihr seid ein sehr hübsches Mädchen«, lobte er mich. »Carey sagt mir, er fände an seiner jungen Braut solchen Gefallen, daß er in Zukunft nur noch mit zwölfjährigen Jungfrauen das Bett teilen will.«
Es fiel mir schwer, mit hoch erhobenem Kopf weiterzulächeln. Wir drehten uns im Tanz, und der König blickte freundlich zu mir herunter.
»Er hat Glück«, sagte er gnädig.
»Er hat Glück, weil er in Eurer Gunst steht«, stolperte ich ungelenk in ein Kompliment.
»Mehr Glück, weil er in Eurer Gunst steht, denke ich!« erwiderte er und lachte plötzlich lauthals los. Dann zog er mich an sich, und ich wirbelte durch die Reihe der Tanzenden und bemerkte den anerkennenden Blick meines Bruders und, was noch schöner war, Annes neiderfüllte Augen, als der König von England an ihr vorbeitanzte und mich in den Armen hielt.
Anne fügte sich rasch in das Alltagsleben des englischen Hofes ein und wartete auf ihre Vermählung. Noch hatte sie ihren zukünftigen Gatten nicht kennengelernt, und die Verhandlungen über die Mitgift schienen sich endlos hinzuziehen. Nicht einmal der Einfluß von Kardinal Wolsey, der wie in jeder anderen Angelegenheit im großen, weiten England seine Finger auch hier im Spiel hatte, konnte die Sache beschleunigen. Inzwischen flirtete Anne mit der Eleganz einer Französin, bediente die Schwester des Königs mit nonchalanter Anmut und vertrödelte jeden Tag viele Stunden mit Klatschgeschichten, Reiten und Glücksspielen mit George und mir. Wir hatten den gleichen Geschmack und waren uns im Alter recht nah: Ich war mit meinen vierzehn Jahren das Nesthäkchen, jünger als Anne mit ihren fünfzehn und George mit seinen neunzehn Jahren. Wir waren die engsten Verwandten und einander doch beinahe fremd. Ich war mit Anne am französischen Hof gewesen, |19|während George in England den Beruf des Höflings erlernt hatte. Jetzt waren wir wieder vereint und bei Hof schon bald als die drei Boleyns bekannt, die drei wunderbaren Boleyns. Der König rief oft, sobald er seine Privatgemächer erreichte, nach seinen drei Boleyns. Und dann kam jemand zum anderen Ende des Schlosses gerannt und holte uns.
Unsere wichtigste Aufgabe im Leben war, die vielen Feste des Königs durch unsere Gegenwart zu bereichern: Lanzenstechen, Tennis, Reiten, Jagen, Falknerei, Tanz. Henry liebte es, in einem ständigen Taumel der Erregung zu leben, und wir hatten dafür zu sorgen, daß er sich niemals langweilte. Aber manchmal, selten genug, in der ruhigen Zeit vor dem Abendessen oder wenn es regnete und er nicht jagen konnte, kam er in die Gemächer der Königin. Dann legte sie ihre Näharbeit oder ihre Lektüre aus der Hand und entließ uns mit einem einzigen Wort.
Wenn ich mir beim Gehen ein wenig Zeit nahm, konnte ich manchmal noch einen Blick darauf erhaschen, wie sie ihn anlächelte wie sonst niemanden, nicht einmal ihre Tochter, Prinzessin Mary. Einmal, als ich ins Zimmer getreten war, ohne zu wissen, daß der König bei ihr weilte, sah ich ihn wie einen Liebenden zu ihren Füßen sitzen. Sein Kopf ruhte in ihrem Schoß, und sie strich ihm die rotgoldenen Locken zart aus der Stirn und wand sie sich um die Finger, wo sie so strahlend leuchteten wie die Ringe, die er ihr geschenkt hatte, als sie noch eine junge Prinzessin war, deren Haar so hell glänzte wie das seine, und als er dem Rat aller getrotzt und sie geheiratet hatte.
Ich schlich mich auf Zehenspitzen wieder fort, ehe sie mich gesehen hatten. Sie waren so selten zusammen allein, und ich wollte den Zauber nicht zerstören. Ich machte mich auf die Suche nach Anne. Sie spazierte gerade mit George durch den kalten Garten.
»Der König ist bei der Königin«, sagte ich, als ich mich zu ihnen gesellte. »Allein.«
Anne zog fragend eine Augenbraue hoch. »Im Bett?« erkundigte sie sich neugierig.
|20|Ich errötete. »Natürlich nicht. Es ist zwei Uhr nachmittags.«
Anne lächelte. »Mußt du aber eine glücklich verheiratete Frau sein, wenn du glaubst, daß man nicht vor Einbruch der Dunkelheit ins Bett gehen kann.«
George streckte mir seinen freien Arm entgegen. »Sie ist eine glücklich verheiratete Frau«, antwortete er für mich. »William hat dem König erzählt, er habe nie ein lieberes, süßeres Mädchen gekannt. Aber was haben die beiden gemacht, Mary?«
»Sie saßen einfach nur zusammen«, erwiderte ich. Ich hatte das Gefühl, daß ich Anne die Szene lieber nicht beschreiben sollte.
»So bekommt sie niemals einen Sohn«, meinte Anne derb.
»Still«, sagten George und ich gleichzeitig. Wir drei rückten näher zusammen und flüsterten.
»Sie muß allmählich die Hoffnung verlieren«, vermutete George. »Wie alt ist sie jetzt? Achtunddreißig? Neununddreißig?«
»Erst siebenunddreißig«, erwiderte ich entrüstet.
»Hat sie noch Monatsblutungen?«
»O George!«
»Ja, die hat sie«, antwortete Anne sachlich. »Aber das nutzt ihr wenig. Es liegt an ihr. Ihm kann man keinen Vorwurf machen, denn sein Bankert mit Bessie Blount lernt schließlich gerade auf einem Pony das Reiten.«
»Es ist immer noch viel Zeit«, verteidigte ich sie.
»Zeit, daß sie stirbt und er sich wieder verheiratet?« überlegte Anne laut. »Ja. Ihre Gesundheit ist nicht besonders robust, oder?«
»Anne!« Diesmal war meine Abscheu echt. »Das ist widerwärtig!«
George blickte sich noch einmal um, ob sich auch niemand im Garten in unserer Nähe aufhielt. Ein paar Seymour-Mädchen spazierten mit ihrer Mutter umher, doch wir schenkten ihnen keine Beachtung. Die Seymours waren die größten Rivalen unserer Familie im Kampf um Macht und Ansehen bei |21|Hof. Wir taten gern so, als nähmen wir sie überhaupt nicht zur Kenntnis.
»Abscheulich, aber wahr«, sagte George knapp. »Wer soll denn der nächste König sein, wenn Henry keinen Sohn bekommt?«
»Prinzessin Mary könnte doch heiraten«, schlug ich vor.
»Einen ausländischen Prinzen, der dann England regiert? Das würde niemals gutgehen«, erwiderte George. »Und noch einen Krieg um die Thronfolge dürfen wir auf keinen Fall zulassen.«
»Prinzessin Mary könnte unverheiratet bleiben und selbst Königin werden«, antwortete ich wütend. »Sie könnte das Land regieren.«
Anne schnaufte ungläubig. »Ach ja«, meinte sie spöttisch. »Sie könnte im Herrensattel reiten und Turniere fechten. Ein Mädchen kann ein Land wie das unsere nicht regieren. Die großen Lords würden sie bei lebendigem Leibe auffressen.«
Wir drei blieben vor dem Brunnen mitten im Garten stehen. Anne ließ sich mit gekünstelter Anmut am Beckenrand nieder und schaute ins Wasser. Ein paar Goldfische näherten sich ihr hoffnungsfroh, und sie zog den bestickten Handschuh aus und plätscherte mit den langen, schlanken Fingern im Wasser. Mit weit aufgerissenen kleinen Mäulern schwammen die Fische herbei, um an der Luft zu knabbern. George und ich beobachteten Anne, wie sie ihr eigenes bebendes Ebenbild betrachtete.
»Denkt der König über diese Dinge nach?« fragte sie ihre Spiegelung.
»Ständig«, erwiderte George. »Ihm ist nichts auf der Welt wichtiger. Ich glaube, er würde sogar Bessie Blounts Jungen anerkennen und zum Erben machen, wenn die Königin keine weiteren Nachkommen zur Welt bringt.«
»Ein Bankert auf dem Thron?«
»Man hat den Jungen nicht ohne Grund auf den Namen Henry Fitzroy getauft«, antwortete George. »Der König hat ihn als Sohn anerkannt. Wenn Henry lange genug lebt, um dem Land Sicherheit zu verschaffen, wenn ihn die Seymours unterstützen und wir Howards uns hinter ihn stellen, wenn |22|Wolsey es schafft, die Kirche und vielleicht noch ausländische Mächte auf seine Seite zu ziehen … Was sollte ihn dann noch daran hindern?«
»Nur ein einziger kleiner Junge, und der ist ein Bankert«, sagte Anne. »Dazu ein kleines Mädchen von sechs Jahren, eine alternde Königin und ein König in der Blüte seiner Jahre.« Sie blickte zu uns beiden auf, riß die Augen nur mit Mühe von ihrem bleichen Ebenbild im Wasser los. »Was wird wohl geschehen?« fragte sie. »Es muß etwas geschehen. Aber was?«
Kardinal Wolsey schickte der Königin eine Botschaft und lud uns alle zu einem Maskenspiel ein, das er am Fastnachtsdienstag in seinem Haus veranstalten wollte. Die Königin bat mich, den Brief vorzulesen. Meine Stimme bebte vor Erregung bei den Worten über ein großes Maskenspiel, eine Festung namens Château Vert und fünf Hofdamen, die mit den fünf Rittern tanzen sollten, die diese Festung belagern würden. »Oh! Eure Majestät …« begann ich und verstummte dann.
»Oh! Eure Majestät was?«
»Ich habe mich eben nur gefragt, ob ich wohl die Erlaubnis bekomme, dort hinzugehen«, antwortete ich sehr bescheiden. »Um die Festlichkeiten zu sehen.«
»Ich glaube, Ihr habt Euch ein bißchen mehr als nur das gefragt?« erwiderte sie mit einem Funkeln in den Augen.
»Ich habe mich gefragt, ob ich eine der Tänzerinnen sein dürfte«, gestand ich. »Es klingt wirklich wunderbar.«
»Ja, das dürft Ihr«, sagte sie. »Wie viele Tänzerinnen fordert der Kardinal von mir an?«
»Fünf«, antwortete ich leise. Aus dem Augenwinkel sah ich Anne, die sich auf ihrem Stuhl zurücksetzte und kurz die Augen schloß. Ich wußte genau, was sie machte. Ich konnte ihre innere Stimme so laut hören, als hätte sie geschrieen: »Nimm mich! Nimm mich! Nimm mich!«
Ihr Wunsch ging in Erfüllung. »Mistress Anne Boleyn«, sagte die Königin nachdenklich. »Königin Mary von Frankreich, die Herzogin von Devon, Jane Parker und Ihr, Mary.«
Anne und ich warfen einander einen flüchtigen Blick zu. |23|Wir würden ein bunt zusammengewürfeltes Quintett sein: die Tante des Königs, seine Schwester Königin Mary und die Erbin Jane Parker, die unsere Schwägerin werden würde, falls die Väter sich je auf die Mitgift einigten, und dazu wir beide.
»Werden wir Grün tragen?« fragte Anne.
Die Königin lächelte ihr zu. »Oh, das würde ich wohl meinen«, antwortete sie. »Mary, warum schreibt Ihr nicht dem Kardinal einen Brief und teilt ihm mit, daß wir seine Einladung mit Freuden annehmen. Bittet ihn, uns seinen Festmeister zu schicken, damit wir unsere Kostüme auswählen und unsere Tänze einstudieren können.«
»Das mache besser ich.« Anne erhob sich und ging zu dem Tisch, auf dem Feder, Papier und Tinte bereitlagen. »Mary hat eine solche Krakelschrift, daß der Kardinal wahrscheinlich glaubt, wir hätten ihm eine Absage geschickt.«
Die Königin lachte. »Ah, ganz die französische Gelehrte«, sagte sie sanft. »Dann schreibt eben Ihr an den Kardinal, Mistress Boleyn, in Eurem wunderschönen Französisch. Oder möchtet Ihr ihm lieber auf Latein schreiben?«
Annes Blick wankte nicht. »Was immer Eure Majestät vorziehen«, sagte sie standhaft. »Ich spreche beide Sprachen leidlich fließend.«
»Teilt ihm mit, daß wir alle darauf brennen, unsere Rolle im Château Vert zu spielen«, antwortete die Königin geschickt. »Wie schade, daß Ihr nicht auch Spanisch könnt.«
Mit der Ankunft des Festmeisters, der uns die Tanzschritte beibringen sollte, entbrannte eine erbitterte Schlacht um die Rollen im Maskenspiel, die mit Lächeln und den süßesten Worten ausgetragen wurde. Schließlich griff die Königin ein und wies uns unsere Rollen zu, ohne Widerspruch zu dulden. Sie gab mir den Part der Güte, die Schwester des Königs erhielt die wunderbare Rolle der Schönheit, Jane Parker sollte die Treue verkörpern. »Na ja, sie hängt ja wirklich wie eine Klette an einem«, flüsterte mir Anne zu. Anne selbst spielte die Ausdauer. »Da siehst du, was sie von dir hält«, flüsterte ich zurück. Anne machte gute Miene und kicherte.
|24|Wir sollten von indischen Frauen angegriffen werden – in Wirklichkeit waren das Chorsänger der Königlichen Kapelle –, ehe uns der König und einige ausgewählte Freunde retteten. Man warnte uns, der König werde sich ebenfalls kostümieren, und sagte uns, wir sollten sorgsam darauf achten, seine durchsichtige Verkleidung nicht zu schnell zu durchschauen: Er würde eine goldene Maske tragen, größer als die Masken aller anderen im Raum.
Es wurde schließlich ein ungeheures, wildes Vergnügen, ein viel größerer Spaß, als ich je erwartet hätte, eher ein gespielter Kampf als ein Tanz. George überschütte mich mit Rosenwasser. Die Chorsänger waren kleine Lausbuben, die sich so sehr in die Sache hineinsteigerten, daß sie die Ritter wütend angriffen und dann vom Boden hochgehoben, herumgewirbelt und schwindelig und kichernd wieder auf die Beine gestellt wurden. Als wir Damen aus der Burg hervortraten und mit den geheimnisvollen Rittern tanzten, schritt der größte Ritter, der König selbst, auf mich zu und führte mich zum Tanz. Ich war noch außer Atem von meinem Kampf mit George, hatte Rosenblätter im Kopfputz und im Haar. Ich lachte, reichte ihm die Hand und tanzte mit ihm, als wäre er ein ganz gewöhnlicher Mann und ich kaum mehr als eine Küchenmagd auf einem ländlichen Tanzvergnügen.
Als das Signal zur Demaskierung hätte kommen sollen, rief der König: »Spielt weiter! Laßt uns noch ein wenig tanzen!« Anstatt sich umzudrehen und eine neue Partnerin zu wählen, führte er wieder mich zum Tanz, einem Bauerntanz, bei dem wir uns an der Hand hielten und ich seine Augen durch die Schlitze in der goldenen Maske funkeln sehen konnte. Selbstvergessen lächelte ich zu ihm auf und spürte, wie die Sonne seiner Wertschätzung meine Haut wärmte.
»Ich beneide Euren Ehemann, wenn Ihr heute abend Euer Gewand abstreift und ihn mit Süßigkeiten überschüttet«, sagte er mit leiser, verführerischer Stimme, als der Tanz uns gerade wieder einmal nebeneinander brachte.
Mir fiel keine witzige Antwort ein. Dies waren nicht die |25|förmlichen Komplimente der höfischen Liebe. Das Bild von meinem Ehemann, der mit Süßigkeiten überschüttet wurde, war zu intim, zu erotisch.
»Ihr solltet doch sicher niemanden beneiden«, erwiderte ich. »Euch gehört schließlich alles.«
»Wieso sollte das so sein?« fragte er.
»Weil Ihr der König seid«, begann ich und vergaß, daß er angeblich eine undurchschaubare Verkleidung trug. »König des Château Vert«, berichtigte ich mich. »König für einen Tag. König Henry sollte Euch beneiden, denn Ihr habt heute Nachmittag eine große Belagerung gewonnen.«
»Und was haltet Ihr von König Henry?«
Ich schaute mit Unschuldsmiene zu ihm auf. »Er ist der größte König, den dieses Land je hatte. Es ist eine Ehre, sich an seinem Hof aufzuhalten, und ein Privileg, in seiner Nähe zu sein.«
»Könntet Ihr ihn als Mann lieben?«
Ich senkte den Blick und errötete. »Daran würde ich nicht zu denken wagen. Er hat noch nicht einmal in meine Richtung geblickt.«
»Oh, geblickt hat er schon«, erwiderte der König mit fester Stimme. »Des könnt Ihr sicher sein. Und wenn er mehr als einmal blickte, Fräulein Güte, würdet Ihr dann Eurem Namen alle Ehre machen und gütig zu ihm sein?«
»Eure …« Ich biß mir auf die Lippen und unterdrückte gerade noch ein »Majestät«. Ich hielt Ausschau nach Anne. Mehr als alles andere wünschte ich mir, daß sie jetzt an meiner Seite wäre und mir mit ihrem wachen Verstand zu Hilfe käme.
»Ihr nennt Euch doch Güte«, erinnerte er mich.
Ich lächelte ihn an, blinzelte durch meine goldene Maske zu ihm auf. »Das stimmt«, erwiderte ich. »Und ich denke, ich wollte ihn wohl gütig behandeln.«
Die Musikanten beendeten den Tanz und warteten gespannt auf die weiteren Befehle des Königs. »Die Masken ab!« rief er und riß sich die Maske vom Gesicht. Vor mir stand der König von England, und ich keuchte vor Entzücken und Verwunderung und geriet ins Taumeln.
|26|»Sie fällt in Ohnmacht!« rief George. Es war eine schauspielerische Glanzleistung. Ich sank dem König in die Arme, während Anne schnell wie eine Schlange meine Maske losband und – großartig – meinen Kopfschmuck löste, so daß mein goldenes Haar sich wie ein Wasserfall über den Arm des Königs ergoß.
Ich schlug die Augen auf, sein Gesicht war mir sehr nah. Ich konnte das Duftwasser auf seinem Haar riechen, und sein Atem streifte meine Wange. Ich blickte auf seine Lippen. Er war mir nah genug, um mich zu küssen.
»Ihr müßt gütig zu mir sein«, erinnerte er mich.
»Ihr seid der König …«, erwiderte ich in ungläubigem Staunen.
»Und Ihr habt mir versprochen, gütig zu mir zu sein.«
»Ich wußte nicht, daß Ihr es wart, Majestät.«
Er hob mich sanft auf und trug mich zum Fenster. Er öffnete es mit eigener Hand, und kühle Luft strömte herein. Ich schüttelte den Kopf und ließ mein Haar in der Brise wehen.
»Ist Euch vor Schreck schwindelig geworden?« fragte er nun mit sehr leiser Stimme.
Ich senkte die Augen auf die Hände. »Vor Entzücken«, flüsterte ich, unschuldig und süß wie eine Jungfer bei der Beichte.
Er neigte den Kopf herab und küßte mir die Hände, erhob sich dann wieder. »Jetzt wollen wir dinieren!«
Ich blickte zu Anne. Sie band ihre Maske los und beobachtete mich mit einem langen, abschätzenden Blick, dem Boleyn-Blick, dem Howard-Blick: Was ist hier geschehen, und wie kann ich daraus meinen Vorteil ziehen? Es schien mir, als wäre unter ihrer goldenen Maske noch eine weitere wunderschöne Maske und erst darunter die wirkliche Frau. Als ich sie anschaute, warf sie mir ein winziges Verschwörerlächeln zu.
Der König reichte der Königin den Arm. Sie erhob sich und war so unbekümmert, als hätte sie es genossen, mit anzusehen, wie ihr Mann mit mir schäkerte. Aber als er sich abwandte, um sie fortzugeleiten, hielt sie ein wenig inne und |27|blickte mich mit ihren blauen Augen lange und durchdringend an, als verabschiedete sie sich von einer lieben Freundin.
»Ich hoffe, Ihr erholt Euch bald von Eurem Unwohlsein, Mistress Carey«, sagte sie sanft. »Vielleicht solltet Ihr Euch in Euer Gemach zurückziehen.«
»Ich glaube, ihr war nur schwindelig, weil sie nicht genug gegessen hat«, warf George rasch dazwischen. »Darf ich sie zu Tisch führen?«
Anne trat vor. »Der König hat sie erschreckt, als er die Maske abgenommen hat. Niemand hätte auch nur einen Augenblick lang vermutet, daß Ihr es wart, Eure Majestät.«
Entzückt lachte der König, und der ganze Hofstaat lachte mit. Nur die Königin hatte bemerkt, daß wir drei Boleyns ihren Befehl so geschickt gewendet hatten, daß ich nun entgegen ihrem ausdrücklichen Wunsch doch am Essen teilnahm. Sie schätzte unsere Stärke ab: Ich war nicht Bessie Blount, die war beinahe ein Niemand. Ich war eine Boleyn, und die Boleyns hielten immer zusammen.
»Kommt mit uns speisen, Mary«, sagte sie. Die Worte waren eine Einladung, aber es lag keinerlei Wärme darin.
Wir sollten uns hinsetzen, wo es uns gefiel. Die Ritter des Château Vert und die Damen sollten eine bunt gemischte Tischrunde bilden. Kardinal Wolsey, der Gastgeber, saß beim König und der Königin am Tisch. George zog mich neben sich, und Anne rief meinen Ehemann an ihre Seite und lenkte ihn ab, während der König, der mir gegenübersaß, mich anstarrte und ich sorgsam bedacht war, in eine andere Richtung zu schauen. Anne zur Rechten saß Henry Percy von Northumberland. Auf Georges anderer Seite hatte Jane Parker Platz genommen, die mich eingehend musterte, als wolle sie ergründen, wie man es anstellte, eine so begehrte junge Frau zu werden.
Ich aß nur wenig, obwohl Pasteten, Gebäck und Wild gereicht wurden. Ich nahm nur ein wenig Salat, das Lieblingsgericht der Königin, und trank Wein und Wasser. Während des Essens gesellte sich mein Vater zu uns an den Tisch und setzte |28|sich neben meine Mutter, die ihm rasch etwas ins Ohr flüsterte. Ich sah, wie sein Blick kurz zu mir wanderte, der Blick eines Pferdehändlers, der den Wert eines Fohlens abschätzt. Immer wenn ich aufschaute, bemerkte ich, daß die Augen des Königs auf mich gerichtet waren, und sogar wenn ich den Blick abwandte, war mir noch bewußt, daß er mich anstarrte.
Nach dem Essen schlug der Kardinal vor, wir sollten uns in den Saal begeben und der Musik lauschen. Anne ging an meiner Seite und dirigierte mich so, daß wir beide auf einer Bank an der Wand saßen, als der König eintraf. Nun konnte er ganz ungezwungen und selbstverständlich bei mir stehenbleiben und sich nach meinem Befinden erkundigen. Und es war nur natürlich, daß Anne und ich uns erhoben, als er an uns vorüberschritt, daß er sich auf die nun frei gewordene Bank setzte und mich einlud, neben ihm Platz zu nehmen. Anne schlenderte davon und schwatzte mit Henry Percy, schirmte den König und mich vor den Blicken des Hofstaats ab, besonders vor dem lächelnden Blick Königin Katherines. Mein Vater trat zu ihr hin und sprach mit ihr, während die Musikanten spielten. Alles geschah mit vollkommener Leichtigkeit und Ruhe. Der König und ich saßen so in einem Raum voller Menschen beinahe im Verborgenen. Die Musik war laut genug, um unser Flüstern zu übertönen, und alle Mitglieder der Familie Boleyn waren so geschickt plaziert, daß sie alles abschirmen konnten, was geschah.
»Geht es Euch jetzt besser?« erkundigte sich der König mit einem liebevollen Unterton in der Stimme.
»So gut wie noch nie, Sire.«
»Ich reite morgen aus«, sagte er. »Würdet Ihr mir die Freude machen und mitkommen?«
»Wenn Ihre Majestät, die Königin, auf meine Dienste verzichten kann«, erwiderte ich, entschlossen, nicht das Mißfallen meiner Herrin zu erregen.
»Ich werde die Königin bitten, Euch für den Morgen aus Euren Pflichten zu entlassen. Ich werde ihr sagen, daß Ihr frische Luft braucht.«
Ich lächelte. »Was für ein guter Arzt Ihr wärt, Majestät. Ihr |29|stellt die Diagnose und bietet die Medizin – und alles an einem Tag.«
»Ihr müßt eine artige Patientin sein, was immer ich Euch anrate«, warnte er mich.
»Das will ich versprechen.« Ich senkte die Augen auf die Hände, spürte, wie sein Blick auf mir ruhte. Meine Seele schwang sich hoch in die Lüfte, höher, als ich je zu träumen gewagt hätte.
»Vielleicht verschreibe ich Euch ganze Tage Bettruhe«, murmelte er sehr leise.
Ich erhaschte einen kurzen Blick auf seine unverwandt starrenden Augen, spürte, wie mir die Röte ins Gesicht schoß, stammelte ein paar Worte und verstummte. Unvermittelt hörte die Musik auf. »Spielt weiter!« befahl meine Mutter. Königin Katherine hielt Ausschau nach dem König und sah ihn bei mir sitzen. »Wollen wir tanzen?« fragte sie.
Es war ein königlicher Befehl. Anne und Henry Percy nahmen ihre Plätze ein, die Musikanten begannen zu spielen. Ich erhob mich, und Henry verließ mich, um sich neben seine Frau zu setzen und uns zuzusehen. George war mein Partner.
»Kopf hoch«, herrschte er mich an, als er meine Hand nahm. »Du siehst aus wie ein begossener Pudel.«
»Sie beobachtet mich«, flüsterte ich zurück.
»Natürlich. Aber viel wichtiger: Er beobachtet dich. Und am wichtigsten: Vater und Onkel Howard beobachten dich auch, und sie erwarten von dir, daß du dich benimmst wie eine junge Frau, deren Stern aufgeht. Hoch hinauf, Mistress Carey, und wir alle steigen mit auf.«
Ich hob den Kopf und lächelte meinen Bruder an, als hätte ich keine Sorgen auf der Welt. Ich tanzte so anmutig, wie ich nur konnte, ich knickste und drehte mich und wirbelte unter Georges geschickter Führung herum. Sooft ich zum König und zur Königin aufblickte, ruhten beider Blicke auf mir.
Im großen Londoner Haus meines Onkels Howard tagte der Familienrat. Wir versammelten uns in seiner Bibliothek, die mit ihren dunklen Bänden vom Lärm der Straße abgeschieden |30|war. Zwei unserer Männer in der Livree der Howards standen vor der Tür Wache, um Unterbrechungen zu unterbinden und sicherzustellen, daß niemand stehenblieb und lauschte. Wir wollten Familienangelegenheiten, Familiengeheimnisse besprechen. Außer den Howards durfte sich niemand in der Nähe aufhalten.
Anlaß und Thema dieser Versammlung war ich. Um mich würden sich die Ereignisse drehen. Ich war der Boleyn-Bauer, der in diesem Schachspiel so vorteilhaft wie möglich eingesetzt werden mußte. Alles konzentrierte sich auf mich. Ich spürte, wie mir der Puls in den Handgelenken pochte – ich fühlte mich wichtig und hatte gleichzeitig Angst, zu versagen und alle zu enttäuschen.
»Ist sie fruchtbar?« fragte Onkel Howard meine Mutter.
»Ihre Monatsblutungen sind regelmäßig, und sie ist gesund.«
Mein Onkel nickte. »Wenn sie mit dem König schläft und seinen Bankert empfängt, steht für uns viel auf dem Spiel.« Mit ängstlicher Konzentration betrachtete ich den Pelz am Saum seines Ärmels, der über das Holz des Tisches strich, den üppigen Stoff seiner Jacke, der satt im Flammenschein des Feuers leuchtete. »Sie darf jetzt nicht mehr in Careys Bett liegen. Diese Ehe muß ruhen, solange ihr der König seine Gunst schenkt.«
Ich konnte mir nicht vorstellen, wer meinem Ehemann diese Mitteilung machen würde. Außerdem hatten wir vor Gott geschworen, daß wir stets zusammenbleiben würden, daß die Zeugung von Nachkommen der Zweck unserer Ehe war, daß Gott uns vereint hatte und kein Mensch uns trennen sollte.
»Ich kann nicht …«, hob ich an.
Anne zerrte unsanft an meinem Kleid. »Psst«, zischte sie. Die Staubperlen an ihrer französischen Haube zwinkerten mir zu wie Mitverschwörer.
»Ich rede mit Carey«, sagte mein Vater.
George nahm mich bei der Hand. »Wenn du ein Kind bekommst, muß der König sicher sein, daß es seines ist.«
|31|»Ich kann nicht seine Mätresse werden«, flüsterte ich.
»Du hast keine Wahl.«
»Ich kann das nicht«, sagte ich laut. Ich drückte ganz fest die tröstende Hand meines Bruders und schaute über den langen dunklen Holztisch hinweg zu meinem Onkel, der einem Falken glich, dessen scharfen schwarzen Augen nichts entging. »Sir, ich bin zutiefst betrübt, aber ich liebe die Königin. Sie ist eine große Dame, und ich bringe es nicht übers Herz, sie zu hintergehen. Ich habe vor Gott versprochen, treu zu meinem Ehemann zu stehen, und sicherlich sollte ich auch ihn nicht betrügen? Ich weiß, der König ist der König, aber das könnt Ihr doch nicht von mir verlangen? Gewiß nicht? Sir, ich kann das nicht tun.«
Er antwortete mir nicht. Seine Macht war so ungeheuer, daß er eine Antwort nicht einmal in Erwägung zog. »Was soll man nur mit einem so überempfindlichen Gewissen machen?« fragte er in die Luft über dem Tisch hinein.
»Überlaßt das nur mir«, sagte Anne schlicht. »Ich kann Mary die Lage erklären.«
»Ihr seid doch wohl ein wenig zu jung dazu.«
Sie hielt seinem Blick mit ruhigem Selbstvertrauen stand. »Ich bin am elegantesten Hof der Welt aufgewachsen«, sagte sie. »Und ich bin dort nicht untätig gewesen. Ich habe alles genau beobachtet. Ich habe alles gelernt, was es zu lernen gab. Ich weiß, was hier not tut, und ich kann Mary beibringen, wie sie sich zu verhalten hat.«
Er zögerte einen Augenblick. »Ich hoffe, Ihr habt die frivole Tändelei nicht aus allzu großer Nähe studiert, Miss Anne.«
Sie behielt die heitere Gelassenheit einer Nonne. »Natürlich nicht.«
Ich spürte, wie sich meine Schultern hoben, als wollte ich Anne mit einem Achselzucken abtun. »Ich sehe nicht ein, daß ich machen soll, was Anne mir sagt.«
Ich war unsichtbar geworden, obwohl es bei der ganzen Versammlung angeblich nur um mich ging. Anne hatte die Aufmerksamkeit aller auf sich gezogen. »Nun, ich vertraue |32|Euch die Aufgabe an, Eure Schwester zu unterweisen. George, Euch auch. Ihr wißt, wie der König mit Frauen umgeht. Haltet Mary immer in seinem Blickfeld.«
Sie nickten. Einen Augenblick lang herrschte Stille.
»Ich werde mit Careys Vater sprechen«, erbot sich mein Vater. »William wird es nicht anders erwarten. Er ist kein Narr.«
Mein Onkel warf einen Blick über den Tisch hinweg zu Anne und George, die neben mir standen, eher Gefängniswärter als Geschwister. »Ihr helft Eurer Schwester«, befahl er ihnen. »Was immer sie braucht, um den König einzufangen, ihr gebt es ihr. Welche Künste ihr fehlen, welche Güter sie braucht, welche Talente ihr noch mangeln, ihr verschafft sie ihr. Wir verlassen uns darauf, daß ihr beide sie in sein Bett bekommt. Vergeßt das nicht. Der Lohn ist groß. Aber wenn ihr versagt, stehen wir alle mit nichts da. Vergeßt das nie.«
Der Abschied von meinem Ehemann fiel mir seltsam schwer. Ich kam in unser gemeinsames Schlafzimmer, als meine Zofe gerade meine Sachen packte, um sie in die Gemächer der Königin zu bringen. Inmitten der Unordnung befand sich mein Mann, auf sein junges Gesicht stand der Schreck geschrieben.
»Ich sehe, Madam, Euer Stern geht auf.«
Er war ein gutaussehender junger Mann, dem jede Frau gern ihre Gunst geschenkt hätte. Hätten uns nicht unsere Familien in diese Heirat hineingedrängt und jetzt aus dieser Heirat befohlen, überlegte ich, dann hätten wir einander liebgewinnen können. »Es tut mir leid«, sagte ich verlegen. »Ihr wißt, daß ich tun muß, was mir mein Onkel und mein Vater befehlen.«
»Das ist mir bekannt«, antwortete er barsch. »Ich muß auch tun, was angeordnet wird.«
Zu meiner Erleichterung erschien Anne mit ihrem kecken, strahlenden Lächeln in der Tür. »Nun, William Carey! Wie schön, Euch zu sehen!« Es bereitete ihr offenbar größte Freude, ihrem Schwager mitten zwischen den Trümmern seiner Hoffnung auf eine Ehe und einen Sohn gegenüberzustehen.
»Anne Boleyn.« Er verneigte sich kurz. »Seid Ihr gekommen, um Eurer Schwester bei ihrem Aufstieg zu helfen?«
|33|»Natürlich.« Sie strahlte ihn an. »Wie wir das alle machen sollten. Keiner von uns wird zu leiden haben, wenn Mary die Gunst des Königs genießt.«
Sie hielt unerschrocken seinem Blick stand, bis er sich schließlich abwandte, um aus dem Fenster zu schauen. »Ich muß fort«, sagte er. »Der König hat mich gebeten, mit ihm auf die Jagd zu gehen.« Er zögerte einen Augenblick, dann kam er durch das Zimmer zu mir, die ich inmitten meiner verstreuten Habe stand. Sanft nahm er meine Hand und küßte sie. »Es tut mir leid um Euretwegen. Es tut mir leid um meinetwegen. Wenn man Euch zu mir zurückschickt, vielleicht in einem Monat, vielleicht in einem Jahr, werde ich versuchen, mich an den heutigen Tag zu erinnern, als Ihr aussaht wie ein kleines Mädchen und ein wenig verloren zwischen all diesen Kleidern standet. Ich werde versuchen, mich daran zu erinnern, daß Ihr an diesen Intrigen keinen Anteil hattet, daß Ihr zumindest heute mehr Mädchen als Boleyn wart.«
Wortlos nahm die Königin zur Kenntnis, daß ich nun eine alleinstehende Frau war und mir mit Anne einen kleinen Raum in der Nähe ihrer Gemächer teilen würde. Nach außen hin änderte sich ihre Einstellung mir gegenüber nicht im geringsten. Sie sprach weiterhin leise und höflich mit mir. Wenn sie wollte, daß ich ihr einen Gefallen tat – eine Notiz schrieb, sang, ihren Schoßhund aus dem Zimmer führte oder jemandem eine Botschaft überbrachte –, bat sie mich so höflich darum, wie sie das immer getan hatte. Aber nie wieder ließ sie sich von mir aus der Bibel vorlesen, nie wieder bat sie mich, zu ihren Füßen zu sitzen, während sie stickte, nie mehr segnete sie mich, ehe ich zu Bett ging. Ich war nicht mehr ihre liebste kleine Hofdame.
Ich war immer erleichtert, wenn ich abends mit Anne zu Bett gehen konnte. Dann zogen wir die Vorhänge rings um uns zu, so daß wir im Dunkeln miteinander flüstern konnten, ohne belauscht zu werden. Es war wie in unserer Kinderzeit in Frankreich. Manchmal kam George aus den Gemächern des Königs und gesellte sich zu uns, kletterte auf das hohe Bett, |34|stellte die Kerze gefährlich schwankend auf das Kopfende und hatte Karten oder Würfel dabei, um mit uns zu spielen, während in den Nebenräumen die anderen Mädchen schliefen und nicht ahnten, daß wir in unserer Kammer einen Mann verbargen.
Die beiden hielten mir keine Vorträge darüber, wie ich meine Rolle zu spielen hatte. Schlau warteten sie, bis ich ihnen von mir aus zu verstehen gab, daß ich mich überfordert fühlte.
Ich sagte nichts, als meine Kleider von einem Ende des Palastes zum anderen geräumt wurden. Ich sagte nichts, als der Hofstaat seine Sachen packte und im Frühjahr in den Lieblingspalast des Königs nach Eltham in Kent zog. Ich sagte nichts, als mein Ehemann im königlichen Troß neben mir ritt und freundlich mit mir über das Wetter und den Gesundheitszustand meines Pferdes plauderte, das mir Jane Parker widerwillig geliehen hatte, als ihren Beitrag zu den ehrgeizigen Zielen unserer Familie. Aber als ich im Garten von Eltham Palace endlich George und Anne für mich allein hatte, sagte ich zu George: »Ich glaube nicht, daß ich es fertigbringe.«
»Daß du was fertigbringst?« fragte er. Eigentlich sollten wir den Hund der Königin ausführen, der von dem Tagesritt auf dem Sattelknauf noch völlig durchgeschüttelt war und sehr elend aussah. »Komm schon, Flo!« ermunterte George das Tier. »Such! Such!«
»Ich kann nicht gleichzeitig mit meinem Ehemann und dem König zusammen sein«, erwiderte ich. »Ich kann nicht mit dem König schäkern, während mein Mann zusieht.«
»Warum nicht?« Anne rollte einen Ball über den Boden, den Flo jagen sollte. Der Hund schaute ihm teilnahmslos nach. »Ach, mach schon, du dummes Ding!« rief Anne ihm zu.
»Weil es mir ganz verkehrt scheint.«
»Du weißt es also besser als deine Mutter?« fragte Anne barsch.
»Natürlich nicht!«
»Besser als dein Vater? Als dein Onkel?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Sie planen eine großartige Zukunft für dich«, verkündete |35|Anne feierlich. »Jedes Mädchen in England würde sein Leben darum geben, deine Möglichkeiten zu haben. Du bist auf dem besten Weg, die Favoritin des Königs von England zu werden, und du jammerst herum. Du hast ungefähr soviel Verstand wie Flo hier.« Mit der Spitze ihres Reitstiefels versetzte sie Flos widerspenstigem Hinterteil einen kleinen Tritt und schob das Hündchen sanft vorwärts. Flo hockte sich hin, genauso störrisch und unglücklich wie ich.
»Sachte«, ermahnte George sie. Er nahm meine kalte Hand und schmiegte sie in seine Armbeuge. »Es ist alles halb so schlimm«, sagte er. »William ist heute neben dir geritten, um dir zu zeigen, daß er seine Zustimmung gibt, nicht um dir Schuldgefühle einzuflößen. Er weiß, daß man dem König seinen Willen lassen muß. Das wissen wir alle. William ist ganz zufrieden damit. Auch er wird Gunstbezeugungen genießen, die er dir zu verdanken hat. Du erfüllst auch ihm gegenüber deine Pflicht, indem du seine Familie voranbringst. Er ist dir dankbar. Du tust nichts Unrechtes.«
Ich zögerte. Ich blickte von Georges aufrichtigen braunen Augen zu Anne, die ihr Gesicht abgewandt hatte. »Da ist noch etwas«, bekannte ich widerwillig.
»Was?« fragte George. Anne folgte Flo mit den Augen, aber ich wußte, daß ihre ganze Aufmerksamkeit auf mich gerichtet war.
»Ich weiß nicht, wie ich es anstellen soll«, gestand ich leise. »Wißt ihr, William hat es ungefähr einmal in der Woche mit mir gemacht, und immer im Dunkeln und ganz schnell, und ich habe nie besonderen Spaß daran gehabt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was da von mir erwartet wird.«
George lachte kurz auf, legte mir den Arm um die Schultern und drückte mich fest an sich. »Oh, es tut mir leid, daß ich lache. Aber du hast alles ganz falsch verstanden. Er will keine Frau, die weiß, was sie zu tun hat. Davon gibt es in jeder Badestube der Stadt Dutzende. Er will dich. Dich mag er. Und es wird ihm gefallen, wenn du ein wenig schüchtern und ein bißchen unsicher bist. Das ist gut so.«
»Hallo!« rief jemand hinter uns. »Die drei Boleyns!«
|36|Wir wandten uns um und sahen auf der oberen Terrasse den König, der noch seinen Reiseumhang trug und den Hut keck auf dem Kopf sitzen hatte.
»Los geht’s.« George machte eine tiefe Verneigung. Anne und ich sanken in den Hofknicks.
»Seid ihr nicht müde von der Reise?« fragte der König. Die Frage war allgemein gestellt, aber mich schaute er dabei an.
»Überhaupt nicht.«
»Ihr reitet da eine sehr hübsche kleine Stute, aber sie ist doch ein wenig kurz in der Hinterhand. Ich werde Euch ein anderes Pferd schenken.«
»Majestät sind zu freundlich«, erwiderte ich. »Ich habe mir das Pferd nur geliehen. Es würde mich freuen, ein eigenes zu haben.«
»Ihr sollt Euch in meinem Stall eines nach Eurem Geschmack aussuchen«, versprach er. »Kommt mit, wir wollen uns die Pferde gleich ansehen.«
Er reichte mir den Arm, und ich ließ die Finger sanft auf dem kostbaren Tuch seines Ärmels ruhen.
»Ich spüre Eure Berührung kaum.« Er legte seine Hand über die meine und drückte sie fest. »So. Ich möchte doch wissen, ob ich Euch bei mir habe, Mistress Carey.« Seine Augen strahlten sehr blau, und er blickte auf meine französische Haube, mein zurückgekämmtes goldblondes Haar und dann auf mein Gesicht.
Ich merkte, wie mein Mund ganz trocken wurde, und lächelte, obwohl ich zwischen Furcht und Verlangen schwankte. »Ich freue mich, bei Euch zu sein.«
»Wirklich?« fragte er plötzlich sehr eindringlich. »Wirklich? Von Euch möchte ich keine falsche Münze. Viele drängen Euch, bei mir zu sein. Ich möchte, daß Ihr aus freien Stücken kommt.«
»Oh, Majestät! Als hätte ich nicht bei Kardinal Wolsey mit Euch getanzt, ohne überhaupt zu ahnen, daß Ihr es wart!«
Er freute sich an dieser Erinnerung. »O ja! Und Ihr seid beinahe in Ohnmacht gefallen, als ich die Maske abnahm und Ihr erkanntet, daß ich es war. Für wen hattet Ihr mich denn gehalten?«
|37|»Ich habe gar nicht darüber nachgedacht. Ich weiß, das war töricht von mir. Ich hielt Euch wohl für einen Fremdling bei Hof, einen neuen, gutaussehenden Fremdling, und es bereitete mir solches Vergnügen, mit Euch zu tanzen.«
Er lachte. »Oh, Mistress Carey, so ein süßes Gesichtchen und so unartige Gedanken! Ihr hattet gehofft, ein gutaussehender Fremdling sei an den Hof gekommen und habe Euch zum Tanze aufgefordert?«
»Ich wollte nicht unartig sein.« Einen Augenblick lang befürchtete ich, meine Antwort sei selbst für seinen Geschmack zu süßlich gewesen. »Ich habe einfach nur meine gute Erziehung vergessen, als Ihr mich zum Tanz aufgefordert habt. Ich bin sicher, ich würde niemals etwas Unrechtes tun. Es war nur einen Augenblick lang so, daß ich …«
»Daß Ihr was?«
»Daß ich es vergessen habe«, sagte ich leise.
Wir erreichten den steinernen Torbogen, der zu den Ställen führte. Im Schutz des Bogens hielt der König inne und drehte mich zu sich herum. Ich spürte, wie mein ganzer Körper zu prickelndem Leben erwachte.
»Würdet Ihr es wohl noch einmal vergessen?«
Ich zögerte. Und dann trat Anne vor und sagte leichthin: »An welches Pferd hatten Eure Majestät denn für meine Schwester gedacht? Ich glaube, Ihr werdet feststellen, daß sie eine gute Reiterin ist.«
Henry ließ mich los und ging in die Stallungen voraus. George und er schauten sich zusammen ein Pferd an, dann ein anderes. Anne trat an meine Seite.
»Du mußt ihn an dich herankommen lassen«, sagte sie. »Laß ihn immer näher heran, aber vermittle ihm nie den Eindruck, daß du auf ihn zugehst. Er möchte das Gefühl haben, daß er dich verfolgt, nicht, daß er dir in die Falle geht. Wenn du die Wahl hast, ob du auf ihn zugehst oder wegläufst, wie gerade eben – dann mußt du immer weglaufen.«
Der König wandte sich um und lächelte mich an, als George einem Stallburschen befahl, ein schönes kastanienbraunes Pferd aus dem Stall zu führen. »Aber lauf nicht zu schnell«, |38|mahnte mich meine Schwester. »Vergiß nicht, er muß dich fangen können.«
An diesem Abend tanzte ich vor versammeltem Hofstaat mit dem König. Am nächsten Tag ritt ich an seiner Seite auf meinem neuen Pferd zur Jagd aus. Die Königin, die am Ehrentisch saß, beobachtete uns beim Tanz, und als wir losritten, winkte sie dem König zum Lebewohl vom Hauptportal des Palastes aus zu. Alle wußten, daß er mir den Hof machte, alle wußten, daß ich ihn erhören würde, sobald man mir den Befehl dazu gab. Die einzige Person, die es nicht wußte, war der König. Er wähnte, die Geschwindigkeit seiner Werbung werde einzig und allein durch seine Begierde bestimmt.
Einige Wochen später kam im April der erste Zahltag: Mein Vater wurde zum Schatzmeister des königlichen Haushalts ernannt. Auf diesem Posten hatte er Zugriff auf die täglichen Einnahmen des Königs, die er nach seinem Gutdünken verteilen konnte. Mein Vater wartete auf mich, als wir zum Abendessen gingen, und bat mich aus dem Gefolge der Königin zur Seite, um in aller Ruhe mit mir zu reden, während Ihre Majestät, die Königin, zu ihrem Platz am oberen Ende des Tisches schritt.
»Dein Onkel und ich, wir sind sehr zufrieden mit dir«, sagte er knapp. »Laß dich stets von deinem Bruder und deiner Schwester leiten. Sie berichten mir, daß du dich gut führst.«
Ich machte einen kleinen Knicks.
»Das ist erst der Anfang«, erinnerte er mich. »Du mußt ihn auch halten, in guten und in schlechten Tagen, vergiß das nicht.«
Ich zuckte ein wenig zusammen, als ich diese Worte aus der Trauzeremonie hörte. »Ich weiß«, erwiderte ich. »Ich vergesse es nicht.«
»Hat er schon irgend etwas gemacht?«
Ich warf einen Blick in den großen Saal, wo der König und die Königin gerade Platz nahmen. Die Trompeter hatten sich schon aufgestellt, um die lange Prozession von Servierenden aus der Küche anzukündigen.
|39|»Noch nicht«, antwortete ich. »Nur mit Blicken und Worten.«
»Und wie reagierst du?«
»Mit Lächeln.« Ich erzählte meinem Vater nicht, daß ich beinahe trunken vor Wonne war, weil mir der mächtigste Mann im Königreich den Hof machte. Es fiel mir nicht schwer, dem Rat meiner Schwester zu folgen und ihn immer und immer wieder anzulächeln. Es fiel mir nicht schwer, zu erröten und das Gefühl zu haben, daß ich gleichzeitig weglaufen und ihm näherkommen wollte.
Mein Vater nickte. »Das reicht. Du kannst dich jetzt auf deinen Platz setzen.«