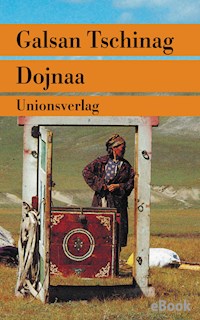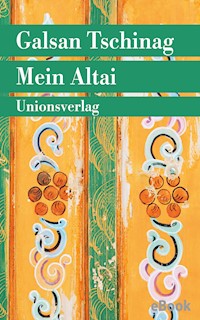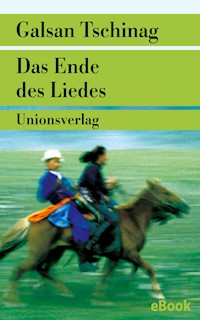6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als der Junge aus der mongolischen Steppensiedlung in Deutschland ankommt, gibt es viel zu staunen und zu lernen. Es treten in sein Leben: die verrückten Kommilitonen aus aller Herren Länder auf der Suche nach dem Absoluten. Verena und ihre Kunst, glücklich zu machen. Ein Schriftsteller und Pferdenarr mit Namen Strittmatter, dem der Jurtenjüngling zeigt, wie man ein Pferd mit dem Lasso fängt. Und eine neue Sprache mit wundersamen Wörtern: Topinambur! Nach Tau und Gras setzt Galsan Tschinag die Kette seiner Lebensbilder fort: funkelnde Geschichten, in denen er die Zeit und ihren Geist einfängt und die Menschen auf seinem Weg unvergesslich werden lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 191
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Als der Junge aus der mongolischen Steppensiedlung in Deutschland ankommt, gibt es viel zu staunen und zu lernen … Nach Tau und Gras setzt Galsan Tschinag die Kette seiner Lebensbilder fort: funkelnde Geschichten, in denen er die Zeit und ihren Geist einfängt und die Menschen auf seinem Weg unvergesslich werden lässt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag
Auf der großen blauen Straße
Geschichten
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Diese Erzählungen und Erinnerungen entstanden während der letzten zwanzig Jahre.
© by Galsan Tschinag 2007
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Amélie Schenk
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30345-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 22:57h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
AUF DER GROSSEN BLAUEN STRASSE
UnterwegsEine NamensgeschichteAn einem MaientagTempoWanzenEine Geschichte in zwei Verpackungen1967: Der unmögliche Traum1981: Die drei AbsolutenTopinamburDer AnfängerDer ZufallAn mein FahrradAuf der großen blauen AsphaltstraßeAuf der HeimreiseBegegnungen und Abschiede1 – In jenem Sommer ist der Sommer im obersächsischen …2 – Ich fahre sieben Tage und sieben Nächte und …3 – Der Fahrer ist ein junger, hitziger Mensch …4 – Die Autoinspektion ist eher eine Hütte als ein …5 – Ich schlage die Augen auf und erschrecke …6 – Am ersten August hat die Heuernte begonnen …7 – Ich streiche ihr eine Haarsträhne zurück, die ihr …8 – Die Sonne geht unter. Sie weint nicht mehr …Die Tuwa sagenEinfälleGeburtstagsgeschenkKünstlerHirnmadenEin Zug fährt wegI – Er taumelt ihnen schwerfällig hinterher. Das kommt von …II – Da steht der ZugKalendergeschichten von einem JahrJanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezemberAgiro und das große Blau1 – Agiro sagte seinen Namen noch einmal. Es war …2 – Das Blau lag dicht und lastete schwer über …3 – Das Himmelsblau dauerte an, trotz des ständigen und …4 – Ihre Liebe war noch kein fester Zweig …5 – Agiro lebte angespannt, von Ungewissheit geplagt, und wurde …Aibes — Ein ZukunftsmärchenMehr über dieses Buch
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Deutschland
Zum Thema Asien
Zum Thema Kindheit
Unterwegs
Wieder einmal hab ich mich verfangen in dem end- und haltlosen Meer des Lebens. So wenig gleiche ich dem, der am Morgen jauchzend ins Wasser gesprungen und davongeschwommen ist, auf die traumblaue Ferne zu, dorthin, wo sich Wasser und Himmel mischen. Die Muskeln sind erschlafft, der Geist ist trübe – ich bin wohl schon im Versinken.
Da erreicht mich der Ruf, der mich schon so manches Mal zur Besinnung gebracht hat. Ich bin erschreckt wie erfreut: Ist dein Schlaf so seicht gewesen, mein Weiser, dass dich mein Untergang wiedererweckt hat? Oder hat deine Sohnliebe die schlafende Hülle verlassen und ist meiner gefahrvollen Reise gefolgt? Als Antwort kommt eine Welle, die mich der stickigen Tiefe entreißt und oben hält, bis die nächste kommt und mich wieder auffängt. Ich bekomme eine Gelegenheit, nach Luft zu schnappen und zur Besinnung zu kommen.
Es ist Mittag. Ich schwimme weiter. Nun bin ich nicht mehr der vom Morgen, aber ich bin mit ihm verwandt wie der Ast mit der Knospe. Vielleicht gebe ich eines Tages doch einen Baum ab, der seinen Knospen zu Ästen und seinen Ästen zu Bäumen verhilft?
Eine Namensgeschichte
Das Gefüge aus sechs Lauten, von Fremden für meinen Namen gehalten und von mir, dessen Träger, bislang recht gleichgültig behandelt, soll im Tibetischen das gute Geschick bedeuten. Das habe ich erst heute, nach nun genau drei vollen Jahrzehnten, erfahren. Der Offenbarer dieses Geheimnisses ist ein Mensch, dem der große Wunsch, die tibetische Stadt Lhasa anzupilgern, bereits erfüllt ist und dem jetzt nur noch der Hauptwunsch, das buddhistische Paradies, das Nirwana, zu erreichen, offen steht. Ich soll weiterhin bei dem Namen bleiben und ihn rein erhalten, dann würde das gute Geschick mir treu bleiben, meint der Mann, der solches, wie mir scheint, nicht ohne Grund sagt.
Da ich mich beschenkt fühle, greife ich zu einer Flasche und sage, um mein Unternehmen zu rechtfertigen: »Auf den guten alten, schließlich doch noch erkannten und angenommenen Namen!« Da in unserer Welt zur Sitte geworden ist, alles, was einem neu in den Besitz kommt – eine Wohnung, ein Auto, eine Frau oder selbst Peinlichkeiten wie eine endlich erheuchelte Stellung oder einen endgültig erlisteten Titel – zu begießen, das heißt, sich deswegen in Schulden zu stürzen und zu besaufen, kann mich davon selbst ein so ausgereifter, mit allen Fetten beschmierter Mensch nicht zurückhalten. Und dieser entpuppt sich bald als ein angenehmer Trinkgenosse. Denn er trinkt überlegt, schweigt, und, wie ich ihm ansehe, gehen dabei seine Gedanken weit weg. Auch ich gehe innerlich auf Wanderschaft, durchstöbere Zeiten und Personen, die in mir versunken sind.
Dshurukuwaa hieß und heiße ich immer noch in der Wetterecke, die ich mir Heimat nenne. So heiße ich auch woanders für alle, die mich von früher kennen. Dshuruk heißt Fell, uwaa Säugling. Also war meine erste Kleidung ein Fetzen weich gegerbtes Schaffell, und es blieb lange nicht bekannt, was aus dem Inhalt des Fellbündels eines Tages werden würde. Ich finde die Benennung in Ordnung, weil ehrlich, und überdies auf keinen Fall weniger wohlklingend als Julius, Alexander, Radna, Gantömör …
Außer diesem meinem Hauptnamen hatte ich eine Vielzahl von Nebennamen. Die Auswahl war kaum kleiner als die in einem durchschnittlichen deutsch-demokratischen Wurstgeschäft; jeder, der mich im Sinne hatte, durfte nicht nur nach dem ihm am meisten zusagenden, sondern auch für den Augenblick am passendsten erscheinenden der Namen zugreifen. So war ich, der ich bei den beiden älteren Geschwistern zu Hause Dshuruk hieß, für den Vater Galdarurug, aber dies nur, wenn er weder ärgerlich noch besonders fröhlich war. Ärgerte er sich, so wurde daraus Galdaruwaa. Und war er, wie an den meisten Tagen des Jahres und wie Mutter ihn neckend nannte, liebesströmend, so wurde daraus Galdardshiwe. Mutter gebrauchte zwei Namen: Dshuruk oder Waantschik, jeden aber mit vielerlei Endungen. Je nachdem, welcher Name mit welcher Endung daran war, wusste man, auf welcher Stufe und Unterstufe sie mit ihren Gefühlen gerade stand. Was wichtig war bei ihr, denn sie war in der Stimmung leicht schwankend, ganz im Gegenteil zu Vater, der von den vierundsiebzig Jahren, die ihm auf Erden beschieden waren, gewiss siebzig in bester Stimmung verbrachte.
Für Onkel Sa, Tante Pü und ihre vielen Kinder war ich Galdarool. Bei Tante Galyj hieß ich, solange sie in guter Stimmung war, Dshuruunaj, und wenn nicht, was ganz selten vorkam – oder genauer nur einmal, wie ich mich entsinnen kann, und zwar in dem Jahr und an dem Tag, an dem Vater, ihr ältester Bruder, ihr keine Dreifußfesseln für ihre einzige Stute, die allerletzte direkte Nachkomme von der großen dunkelbraunen Herde des Großvaters übrigens, geben wollte –, da nannte sie mich anders: Dshurr. Als sie dann aber die Fesseln doch noch bekam, nannte sie mich nicht nur wieder beim alten Namen, sie verriet mir auch, wie ihre Mutter, unsere Großmutter, geheißen hatte – eines jener Familiengeheimnisse. Zu den Fesseln aber sei dieses noch schnell zugefügt: Sie hatte innerhalb eines Jahres drei davon verloren, und Vater war der Meinung gewesen, sie sollte erfahren, dass Fesseln keine Sonnenkringel sind, wovon der Himmel voll hängt; dieser Meinung war auch sie, andersrum aber: Fesseln seien nichts weiter als vertrocknete Yakhautfetzen, die nicht mal Hunde fressen – und schließlich seien ja auch die den Altai füllenden Herden ihres Vaters weggekommen …
Onkel Stalin nannte mich Galdarbuwaa. »Her, Galdarbuwaa!«, rief er mich so manches Mal zu sich, und wenn ich vor ihm stillstand, sagte er: »Hier, Galdarbuwaa!« Dabei ließ er auf meine mit der Innenfläche nach oben fest aneinandergelegten Hände eine Schafniere oder eine halbierte Zunge oder sonst einen Happen Kindern zustehendes Fleisch fallen, und dann: »Geh, Galdarbuwaa!« Seine Stimme war hell donnernd, seine Augen blitzten, und dabei schien in seinem grauen Schnauzbart ein Lächeln verborgen, nur es kam dort nie heraus. Onkel Stalin schenkte keine Süßigkeiten, er verachtete sie wie den Tabak zum Rauchen – dass er schnupfte, wie jeder ehrwürdige ältere Tuwa-Mann, versteht sich; das Rauchen aber hasste er auf den Tod. Ganz im Gegensatz zu seinem Namensvetter – oder ich sage gerechtigkeitshalber: Namensvater –, der im Kaukasus und auch über seine Grenzen hinaus recht berühmt geworden sein soll. Unser Stalin galt im Volk auch geizig, aber er schenkte mir einmal einen Drei-Tugrik-Schein, und das war in jenem Sommer des Jahres 1960, da ein ausgewachsener Hammel für zwanzig Tugrik angeboten wurde. Erst suchte der Onkel lange in einer seiner beiden roten Holztruhen, dann holte er den Schein, der zwischen seinen gewaltigen Fingern leise knisterte, ja, fast tönte, heraus und streckte ihn mir einhändig, aber nicht gelassen, sondern sehr gewichtig hin. Ich eilte ihm entgegen, hielt beide Hände aneinander und streckte sie aus, empfangsbereit, und wartete, bis die Gabe darauffiel.
Vier Jahre später brachte ich aus Deutschland eine Sonnenbrille für Onkel Stalin mit. Diese hatte, wie mir Herr Kleinhempel, der Optiker am Rossplatz zu Leipzig, versicherte, wertvolle Gläser. Seltsamerweise schien das der von mir Beschenkte sogleich zu erkennen. Nachdem er die Brille erst besehen, befühlt, dann auf- und schließlich abgesetzt hatte, sagte er: »Eine edle Gabe, sehr gut, Galdarbuwaa!«
Andere nannten mich anders.
Die Schulzeit kam, wie so manches im Leben zu einem kommt: sich von weit her kündend und am Ende doch überraschend. In Lehrbüchern steht, wie man Kinder jahre- und monatelang auf die Schule vorbereitet, sodass sie am ersten Schultag empfangsbereit wie ein abgewaschenes Gefäß zur Schule eilen. Bei mir war es umständlicher und doch einfacher.
Am ersten September 1951 lag ich mit einem verbrühten Oberschenkel auf dem Krankenlager und kreischte, wenn sich gerade nicht der Schlaf meiner wieder einmal bemächtigt hatte – eine Geschichte, die anzurühren mir schwer fällt. An einem gewittrigen Abend war Mutter draußen mit dem Melken beschäftigt, auch die Geschwister waren draußen. Vater war nach den Kamelen geritten, denn der Sommer war zu Ende und die Umzugszeit war gekommen. Ich als jüngstes Kind hatte in der Jurte bleiben dürfen, was aber meine Seele irgendwie belastet haben musste, denn ich begann zu arbeiten, für alle – bereitete das Abendmahl zu. Alles ging gut, bis ich den Herd für das Nächste, die Milch, frei machen wollte: Ich nahm den Kessel, in welchem Fleisch kochte, vom Herd herunter und wollte ihn in das Küchenregal stellen, wie Mutter es zu tun pflegte. Allein der gusseiserne Kessel, der seine acht Kilo gewogen haben mochte, der nun außerdem Brühe und Fleisch in sich barg, war zu schwer und zu heiß für mich. So entglitt er kurz vor dem Ziel meinen Fingern, und dann geschah, was ich nicht benennen möchte.
Das muss um den zwanzigsten August herum geschehen sein. Meinetwegen verspätete sich unser Ail in jenem Jahr um fast einen Monat, und was das für einen vom Wetter diktierten Lebensrhythmus bedeutete, werden vielleicht manche verstehen. Doch alle Schulkinder, darunter auch meine Geschwister, waren noch rechtzeitig abgereist, wie immer in Begleitung eines Erwachsenen, der am nächsten Tag die Pferde zurückbrachte.
Nach einer kleinen Ewigkeit erhob ich mich vom Krankenbett. Und da war auch unser Ail am Ak-Hem, unserem milchweißen Mutterfluss, angekommen. Das waren jene Tage und Nächte, da die Yaks und Pferde ihren Verstand zu verlieren scheinen, vor so viel Gras, plötzlicher Wärme wieder und der neuen Umgebung überhaupt. Auch ich lebte in jenen Tagen mit – wie ich damals glaubte – neuen und – wie ich heute weiß – geschärften Sinnen. War doch einen ganzen Monat lang von der Erde, dem Himmel, den Winden und den Sternen getrennt und durfte nun endlich wieder an sie heran. Alles schien anders, erhabener und geheimnisvoller geworden zu sein. Ich hockte zunächst auf dem Dungkorb, vom frühen Morgen bis in den langen, gelb-rot-blau-grauen Abend hinein, bis in die schwarze Nacht, in der die fernen Welten wirklich wurden und zu leben begannen, und konnte mich an dem, was meine Sinne einfingen, nicht sattleben. An die Schule dachte ich nur selten, doch jedesmal, wenn ich es tat, beschlich mich eine sanfte, zähe Trauer.
Da hieß es eines Tages, Vater würde die Geschwister im Kreiszentrum besuchen, bevor wir ins Gebirge zogen und uns von ihnen so weit entfernten. Ich sagte, ich käme mit. Das war mein gutes Recht, und ich wusste auch von vornherein, man würde es mir erlauben – ich war nicht nur das Jüngstkind, sondern nun auch noch das kranke Kind.
Wir ritten los, ich vorn im Sattel und Vater hinten, auf einem gerollten Tonn, dessen Schoß den hinteren Sattelbogen bedeckte. Ritten durch unseren sanften Mutterfluss, das Gebüsch, die Steppe und schließlich den mächtigen, gefahrvollen Homdu. Schon von der Flussmitte aus sah ich das Kreiszentrum. Die Häuser inmitten der Jurten erinnerten an Yaks in einer Schafherde. Ich muss gestehen, in diesem Augenblick verschwanden für meine Augen Deedis und Delegej – Himmel und Erde, genauer: das Universum – und es blieben nur noch diese Häuser übrig. Dazu muss ich wohl sagen, es waren insgesamt sieben Blockhütten aus entrindeten, ockergetränkten Lärchenstämmen. Aber es waren andere Zeiten, und ich hatte andere Bilder im Kopf. So erstand beim Anblick der ersten Häuser meines Lebens sogleich die Stadt, die ich aus Epen kannte, vor meinen Augen. Später sollte ich echte Städte sehen, vier Jahre später die Kreisstadt, sechs Jahre darauf die Landeshauptstadt und etwas später Moskau, Berlin und viele andere Ansammlungen von Häusern und Menschen. Aber keine entzückte mich wie diese an jenem Oktobertag vor dreißig Jahren.
Der Ausritt verlief ganz nach meinem Wunsch. Dabei nannte Vater, wo was war, und erklärte mir alles, wenn wir dann davor standen. Zuerst stiegen wir beim Kaufhaus ab, wo ich mir eine Packung Würfelzucker kaufen ließ, obwohl ich keine Süßigkeiten mochte. Darauf gingen wir um das Warenlager herum, sahen uns die Berge von Kisten und Säcken an, und da trafen wir den Wächter Kanabaj, der mit Vater einen ausführlichen Gruß austauschte und ihn dabei um seine Schnupftabakflasche bat. Das machten alle Kasachen, und nicht nur sie; es hieß, Vaters Tabak sei immer sehr scharf zubereitet gewesen. Der sonnenblonde, knochendürre Mann schüttete aus der Flasche auf seine hohle Hand einen Haufen, den Vater bestimmt in zehn Mal geschnupft hätte, und schüttete ihn darauf in den Mund mit einem Ruck, dass der Kopf für einen Augenblick im Nacken hing. Denn dieser nahm den fein gemahlenen Tabak nicht in die Nase, sondern in den Mund und behielt ihn, solange noch der bittere Geschmack zu spüren war, zwischen Lippe und Zahn. Eine Zeit lang verfolgte ich mit dem Blick die Bewegungen seiner Zunge: Sie schob und stopfte und verteilte den Haufen hinter die Zähne, in die Rillen. Währenddessen spuckte er immer wieder gelblich braune Stränge aus, die mir unglaublich reichlich und gekonnt erschienen. Bald aber verlor das seinen Reiz, und so drängte ich Vater zum Weiterritt.
Unser nächster Halt war das Tierkrankenhaus. Dort arbeitete Onkel Schöödün, der mich wieder anders – Gidisuwaa – nannte. Wir trafen ihn in einer riesigen Schachtel, die aber Kontor, Büro, hieß. Der Onkel saß gebückt über einem gelblichen Pulver und verteilte es mit einer winzigen Schaufel auf handtellergroße Papierfetzen, die um ihn herum in Reihen lagen. Das Pulver war Arznei, denn Onkel Schöödün war Tierdoktor. Er hatte von meiner Verbrühung gehört. So sagte er, nachdem er Vater, den Neffen seines Vaters, aufs Umständlichste begrüßt und mich an beiden Schläfen berochen und noch über die Backen gestreichelt hatte, dass wir, nun einmal hier, unbedingt zum Menschendoktor gehen sollten, denn die Verbrühung könnte, wer weiß, schlechte Folgen auf mein Wachstum hinterlassen.
Der Menschendoktor war ein Kasache, hatte einen mongolischen Namen, hieß Borhüü und sprach mit uns auf Tuwa. Ja, solches war damals möglich. Der Doktor besah die verbrühte Stelle, tadelte Vater, dass man ihn nicht sofort benachrichtigt habe, sagte, er wäre doch für uns da, es sei nicht in Ordnung, dass er von so einer Verbrühung nichts gehört habe. Doch er schien mit der Heilung der Wunde recht zufrieden zu sein, denn er lächelte, während er die schorfige Stelle abtastete und darauf mit einer scharf riechenden, angenehm kühlenden und harzgelben Flüssigkeit bestrich. Den Rest, die halb volle grüne Flasche, die später der Buckligen Großmutter als Schnupftabakbehälter dienen sollte, gab er uns mit.
Onkel Schöödün lebt heute nicht mehr. Borhüü aber lebt, dazu noch in der Bezirksstadt. Nur sagt man zu ihm nicht mehr »Doktor«, so wie man es auch zum anderen nicht mehr gesagt hätte, würde er noch leben. Denn nach der neuen Berufs- und Standesbezeichnung sind beide um einiges weniger: Arztgehilfe, oder wie es wörtlich heißt, Kleine Ärzte, im Gegensatz zu den Großen Ärzten, denen mit Hochschulbildung.
Vater meinte, wir sollten zu Großmutters Jurte am unteren Rand der Siedlung reiten. Doch meine Neugier war noch nicht gestillt. Also widersetzte ich mich. Was sollte man mit Großmutter? Die kannte man mehr als zur Genüge. Dafür wollte ich zur Schule, wollte sehen, wo und wie die Geschwister lernten. So lenkte Vater die Zügel auf das rötliche Haus zu, um welches herum ein niedriger Holzzaun stand, der, wie sich mit einem Mal herausstellte, weitere vier Häuschen, alle kalkweiß und recht niedrig, umschloss. Das waren die Küche, das Bad und zwei Schülerwohnhütten. Das Schulhaus war sehr groß, so groß, dass selbst ein beladenes Kamel da hineingepasst hätte. Bezaubert von alldem und gleichzeitig eingeschüchtert vom Widerhall der eigenen Schritte trat ich in den Gang, besah es mir von innen her, zählte acht Türen, hinter welchen man lautes unverständliches Gerede hörte. In der Zeit, in der ich so meine künftige Schule bestaunte, saß Vater draußen auf einem Lärchenklotz und unterhielt sich mit dem Schulwächter Galsan, den ich aus den Erzählungen der Geschwister bereits als einen lieben Menschen kannte.
Eine der Türen flog auf. Ein großer Junge trat heraus und hielt, wie ich zunächst dachte, einen weißen, euterrunden Stein vor den Mund. Da röhrte es, es war die Muschel, die das Zeichen zur Pause gab. Alle Türen flogen auf, jede spuckte eine Schar Kinder heraus. Ich vermochte keines am Gesicht zu erkennen, es war so ein Tumult, fast so schlimm, wie wenn eine Herde Lämmer plötzlich mit ihren Müttern zusammenkam. Ich rannte zurück, sah draußen aber Vater machtlos mitten in der Menschenflut stehen. Ich begann mich auf ihn hinzubewegen, und als ich dann endlich bei ihm angelangt war, entdeckte ich mit einem Mal neben uns die Geschwister, dünn und blass erschienen sie mir. Vater beroch und betätschelte sie umständlich, wovon die beiden recht beschämt dastanden. Allein er fuhr in seiner Liebkosung unbekümmert weiter, mit einem dumpfen, ölig weichen Laut, der aus der Tiefe seiner sehnsüchtigen väterlichen Seele zu sprudeln schien. Also merkte er entweder nichts von der Scham der Kinder, oder er machte sich nichts daraus.
Plötzlich bemerkte ich Dshetschek, meine gleichaltrige Base. Sie fasste mir, so schüchtern sie auch war, herzlich die Hand. Dabei kam auch sie mir schmal und blass vor, und spätestens an dieser Stelle muss ich erläutern, dass Blässe für uns Landvolk damals als Schönheitsmerkmal zählte. Ja, Dshetschek, was ja ohnehin Blume hieß, erschien mir sehr schön in diesem Augenblick. Und sie verduftete mit mir. Und wie mir irgendwann bewusst wurde, saßen wir in der Klasse, hinter einem Tisch und auf einer Bank. Dass die hohle Schachtel Klassenzimmer und die Dinger darin Tische und Bänke hießen, wusste ich damals natürlich noch nicht. Ebenso unbekannt war mir der Name der zusammengeleimten, schwarz bemalten Bretter auf zwei Stelzbeinen.
Doch die weißen Ornamente darauf kannte ich als Buchstaben, mehr noch, ich wusste ein jedes davon zu benennen. Was ich den Geschwistern verdankte, sie hatten sie aus der Schule mitgebracht und nach und nach auf mich übertragen. Wird man mir Eigenlob unterschieben, wenn ich hierbei noch verrate, dass ich so manches Mal an die Geschwister sogar Briefe geschrieben habe? Ich weiß doch, dass sie die mehrfach gefalteten Zeitungsränder mit dem, was ich darauf gemalt hatte, empfangen und den darin wohnenden Sinn sogar erkannt hatten. Doch ich sage, um jeden Zweifel gleich zu beseitigen, rundheraus: Ich hatte bei alldem nie die Ähnlichkeit mit einem Wunderkind.
Doch waren meine Vorkenntnisse an diesem Tag von Bedeutung. Denn ein halbes Dutzend Kinder saß in der Klasse und lernte im Chor die Buchstaben auf der Tafel ausrufen, anstatt, wie die meisten, die Pause zu genießen.