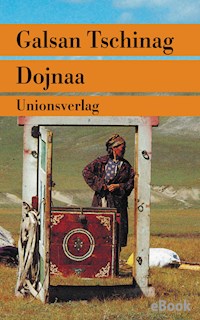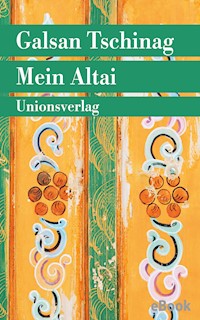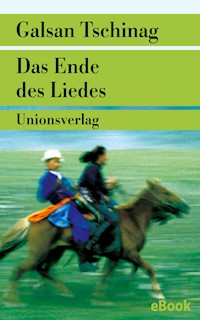11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach den prägenden Leipziger Lehrjahren kehrt Galsan Tschinag bang und freudvoll auf den kräftigenden Boden der Mongolei zurück. Die Jahre in der Ferne jedoch haben ihn verändert. In einem von der kalten, kargen Altaibergsteppe geformten Körper steckt ein im unnachgiebigen Europa geweckter Geist. Das neue Leben führt ihn durch die Lehrstätten seines Landes, beengt von der strammen Ordnung aus Parteigruppen und Komitees, bisweilen erschüttert von politischen Erdbeben. Er bereist die Weiten der Steppe, wo die sengend heißen Spitzen der Sonnenstrahlen die Luft durchbohren und man den Himmel zum Wind reizt. Begleitet wird er von einem unstillbaren Wissensdurst und seiner Liebe zum Nomadentum.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Nach Jahren in der Fremde kehrt Galsan Tschinag bang und freudvoll in die Mongolei zurück. Gänzlich gibt er sich einem neuen Leben hin, dass ihn durch die Lehrstätten seines Landes führt und durch politische Erdbeben leitet. Er bereist die Weiten der Steppe, begleitet von einem unstillbaren Wissensdurst und seiner Liebe zum Nomadentum.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag
Kennst du den Berg
Mongolische Wanderjahre
Die Lebensromane (2)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Erstausgabe
Zweiter Band im Zyklus der autobiografischen Romane: Kennst du das Land; Kennst du den Berg; Kennst du das Haus.
Lektorat: Maria Kaluza
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Ilona Kryzhanivska (Alamy Stock Foto)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31021-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.06.2024, 00:04h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KENNST DU DEN BERG
1 – Meine Brust ist voll von Freude, aber auch …2 – Das Zimmer, drei mal vier Meter nach Augenmaß …3 – Die späteren beiden Kinder, getrennt durch drei Jahre …4 – Die Spindel der Fahnder nach Schuld an meiner …5 – Eine Entlassung trifft den Betroffenen in alle Richtungen …6 – Ich bin fest entschlossen, meine Fähigkeiten zu beweisen …7 – Die Nacht verbringen wir in der Jurte eines …8 – Wir bewegen uns auf der kahl geschabten Spur …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Revolution
1
Meine Brust ist voll von Freude, aber auch Bangigkeit. Freude, weil ich nach so langer Zeit in der Fremde nun wieder den Halt bietenden Boden des eigenen Landes unter mir spüre, angekommen in Ulan-Bator im Oktober 1968. Bangigkeit, weil mir die Stadt fremd ist, mich niemand erwartet und ich nicht einmal weiß, wo ich die kommende Nacht verbringe.
Ich suche die Bushaltestelle. Dort angekommen, sehe ich: Es wird schwer werden, mit zwei großen Koffern und einem Rucksack einzusteigen, denn eine lange Schlange steht vor mir, und noch ist kein Bus in Sicht. Nach geraumer Zeit kommt ein kleiner Bus angefahren. Die Menschen quetschen sich hinein, doch es gelingt bei Weitem nicht allen. Einige vor und alle hinter mir bleiben zurück. Sosehr ich ob meines sperrigen Gepäcks weiter bangen muss, spüre ich in mir doch auch einen gewissen Hoffnungsfunken glimmen und eine Bewunderung für die Disziplin des Volkes, sich in die Schlange zu stellen und die Reihenfolge einzuhalten.
Der nächste Bus kommt. Hastig steigen die Leute vor mir ein. Ich bemühe mich, mit dem gesamten Gepäck schwerfällig, aber genauso hastig, voranzukommen, dabei nicht wissend, wie ich durch die schmale Tür in den Bus gelangen soll. Da höre ich hinter mir die Stimme eines Mannes: »Versuche, mit dem Rucksack durchzukommen, Junge. Den Rest nehmen wir mit rein.« Erleichtert lasse ich die Koffer stehen, klettere die steile Stufe hoch und nehme im nächsten Augenblick wahr, dass zwei erwachsene Männer hinter mir die Koffer hochwuchten. Das ist das allererste, allerschönste Erlebnis, das mir auf dem heimatlichen Boden widerfährt! Mehr von hinten geschoben als selber gehend, rutsche ich immer weiter nach vorne. Dabei versuche ich, hin und wieder einen verstohlenen Blick nach meinen Koffern zu werfen, und meine, hinter einer Wand aus Menschen da und dort die eine oder andere Ecke von ihnen zu erspähen. Die Schaffnerin, eine rundliche Frau in mittleren Jahren, zwingt die Passagiere, einen nach dem anderen, sogleich mit einer barschen Stimme zur schnellen Lösung des Fahrscheins. Ihre Hand, einen der dünnen hellen Wische haltend, zielt auf mich. Mit einem Ton, den man mindestens als spöttisch bezeichnen könnte, wenn nicht gar als feindselig, sagt sie: »Und was ist mit dir, junger Mann?«
Ich bekomme einen Schreck, vermengt mit Scham, und sage mit zittriger Stimme: »Große Schwester! Ich komme gerade vom Ausland, nach beendetem Studium, und habe noch kein Geld.«
Sogleich ändert sich der Ausdruck auf ihrem recht rauen Gesicht, und sie sagt in einem völlig veränderten Ton: »Leute! Lasst doch den Jungen durch, ganz nach vorne, damit er wenigstens seinen sperrigen Rucksack weglegen kann!«
Ich spüre meine Augenränder heiß anlaufen vor Dankbarkeit. Versuche aber mit zittriger Stimme, ihr zu erklären, dass ich nicht nach ganz vorne gehen will: »Vielen Dank, große Schwester. Aber mein Gepäck ist dahinten.«
Sie fragt mich, immer noch freundlich: »Wie groß ist es denn? Und wieso hast du dich davon getrennt?«
Ich, nun etwas mutiger: »Zwei Koffer sind es. Beim Einsteigen haben mir liebe Leute geholfen.«
Sie klingt nun wieder gebieterisch: »Noch zwei Koffer, meine Güte! Sie dürfen nicht hinten bleiben, den Einsteigenden im Weg! Ihr dahinten, schaut, dass die beiden Koffer nach vorne kommen! Na, du begüterter Auslandsstudent, geh nach vorne! Dein Gepäck wird dir schon folgen!«
Ich zwänge mich an Leuten vorbei, die versuchen, mir Platz zu machen. Bald sind auch die Koffer in meiner Nähe. Ich bin fassungslos. Wie mühselig wäre es gewesen, mit solchem Gepäck durch das von mir so oft und überschwänglich gelobte Germanien zu reisen. Habe ich mich all die Jahre deswegen so nach der Heimat gesehnt, obwohl dieses Land viel weniger entwickelt ist?
Nun beginnt der Fahrer ein Gespräch mit mir. Aus welchem Ausland ich denn zurückkomme, wie lange und was ich dort studiert habe, wie die Leute dort leben? Wir fahren lange, halten viele Male, ständig gibt es Aus- und Einsteigende. Der Bus bleibt bis zuletzt so voll wie am Anfang. Ich antworte auf jede Frage geduldig und treuherzig. Dann fragt er, wo ich denn aussteigen wolle. Ich überlege eine ganze Weile und sage dann: »An der Mongolischen Staatsuniversität.«
Nun gerät er ins Schweigen, und ich sehe, er überlegt auch. Schließlich schaltet er das Mikrofon an, spricht laut: »Zur Aufmerksamkeit der Passagiere! Heute fahren wir auf folgenden Strecken anders: Vom Dramentheater biegen wir, anstatt nach links, nach rechts ab und halten am Lenin-Klub, von dort weiter zur Universität und dann wieder auf der alten Route am Lebensmittelkaufhaus Nr. 4 vorbei.«
Erneut bin ich sprach- und fassungslos vor Dankbarkeit. Schaue von der Seite, wie gebannt, auf den älteren Menschen mit dem hageren, dunklen Gesicht. Hätte so gern gesagt: Vielen, vielen Dank, großer Bruder! Ich kann aber keinen Laut herausbringen, ohne in Tränen auszubrechen. So starre ich nur auf die paar deutlich herausragenden, immer noch tiefschwarzen Bartstoppeln auf der ziemlich herabhängenden Haut unterhalb des Kinns, hinter dem deutlich verschmutzten Rand des Hemdkragens. Und presse dabei meine zitternden Lippen gegeneinander, und da es mir nicht gelingen will, beiße ich auch noch auf die untere Lippe. Der Fahrer schweigt und schaut starr vor sich hin. Möglich, dass der lebenserfahrene Mann meine Seelennot längst wahrgenommen hat und mir jetzt nicht mehr zusetzen will. Ich denke: Bestimmt hat er selber Kinder in meinem Alter, und wer weiß, vielleicht ist eines von ihnen auch weit weg von zu Hause.
In diesem seltsam sich dehnenden Augenblick erwacht vor meinen Augen wieder einmal jenes Bild, das mich schon so lange begleitet: mitten in einer Winterlandschaft … Ich klebe auf einem schmalen zusammengerollten Sitzpolster am Rücken meines Vaters. Er nötigt mich, herunterzuklettern, weil da unten irgendeinem Hütekind einer Herde, die wohl zu einer der Kasachenjurten am anderen Rand der Steppe gehört, die Nase läuft. Dann steigt er selber vom Sattel herab und putzt dem kleinen Hirten die Nase, hält ihm eine Weile auch die gefrorenen Hände und Backen warm. Während wir dann unseren Ritt fortsetzen, erzählt er, dass er bei jedem Kind, das ihm begegnet, an uns, seine Kinder, denkt. Wenig später fügt er hinzu, wir sollten lernen, bei allen älteren Menschen, die uns begegnen, an unsere Eltern zu denken.
Diese Busbesatzung bewohnt seither meine Innenwelt. Später werde ich zur Einsicht gelangen, dass sie der Beweis für die unausrottbare Fortsetzung des Nomadengeschlechts ist – selbst dann, wenn der Fahrer und die Schaffnerin nicht unter Gelärm und Staubwolken von Tierherden geboren und herangewachsen sein sollten. Aber ihre Eltern oder Großeltern müssen gewiss Nomaden gewesen sein und ihnen ihre Gene mit all dem eingespeicherten Gedächtnis weitervererbt haben: an das weite mongolische Land, diese unvergängliche Wiege, in welcher unzählige Geschlechter gediehen sind und dabei ihre Abdrücke als Farben, Gerüche, Töne, Freuden, Leid, Träume und Sehnsüchte zurückgelassen haben. Als ein Strom, der zu einem Ganzen mit einem gewaltigen Kraftfeld zusammenfließt. So bricht die nomadische Prägung immer wieder durch, mit der Fähigkeit, alles im Zusammenhang zu wissen und im Vergleich zu erwägen, in jedem von uns, den Nachkommen des zur Rundheit geklopften, blausteißigen Geschlechts.
Die Universität taucht auf. Ich erkenne sie an der Glaskuppel und den vielen Säulen wieder. Noch hundert Meter sind es bis zur Haltestelle, erkennbar an der Menschenschlange. Der Bus hält aber direkt vor dem Eingang des gewaltigen Gebäudes, am Denkmal des Marschalls Tschoibalsan. Ich steige mit dem Rucksack aus, die Koffer werden mir von Passagieren nachgereicht. Ich bleibe stehen, mit beiden Händen winkend, bis der Bus sich wieder in Bewegung setzt und dann gänzlich an mir vorbeigezogen ist. Daraufhin verneige ich mich mit zusammengelegten und an die Brust gepressten Händen, in der Art betender Buddhisten, richte mich wieder auf, führe beide Hände an die Lippen, strecke dann die Arme aus und schüttle die gespreizten Finger dem Bus hinterher, der in diesem Augenblick die eigentliche Haltestelle erreicht. In diesem Augenblick war ich von einem so großen, ja betörenden Dankesgefühl erfüllt und wollte ganz einfach auf irgendeine Weise meinen Dank ausdrücken, den beiden hilfsbereiten Männern, der Schaffnerin, dem Fahrer, jedem und allen gegenüber.
Nun versuche ich, mich zu beruhigen und zu sammeln. Schaue empor zum aschgrauen Steindenkmal des Marschalls in der Uniform und empfinde eine Mischung von Ehrfurcht und Grausen. Als Grundschüler stand ich einst in gleicher Entfernung vor Stalin. Der eine wie der andere sollte uns Vater sein, also besangen wir in den Pausen aus vollem Hals und im Marsch-Schritt abwechselnd die beiden. Dabei schwellten unsere schmalen Kinderbrüste vor patriotischer Kampfbereitschaft. Wir fühlten in unseren kleinen Kinderherzen echte Dankbarkeit, denn die Erde des Schulhofes mit aller Kraft und Gedröhn tretend, konnten wir unsere eiskalten Füße ein wenig warm bekommen. Außerdem fiel die ganze angestaute Ermattung durch das erzwungene Stillsitzen weg – brüllend und Beine und Arme hinüber- und herüberwerfend, schleuderte man alles, was einem nicht behagte, aus sich heraus. Später hieß es dann von diesen beiden fernen Aller-Menschen-Vätern, sie hätten neben ihren unschätzbaren Verdiensten auch einige Fehler begangen – hätten viele unschuldige Menschen erschießen lassen. Zu ihren Verdiensten kann ich nichts sagen als das, was in den Lehrbüchern steht. Zu den Fehlern allerdings mehr, denn unter den Erschossenen waren auch zwei Onkel mütterlicherseits, und auch am frühen Tod des Vaters von meinem Vater haben die Massenerschießungen unmittelbar mitgewirkt.
Doch noch bin ich nicht gewillt, diese traurige Seite der Geschichte aufzurollen. Heute bin ich einfach von Dank erfüllt, da ist kein Platz für anderes. Ich danke meinem Vaterland, bin stolz auf das mongolische Volk. Bin bereit, dem mongolischen Staat nach meinen Kräften zu dienen, und in diesem Augenblick entschlossener denn je.
Ich gehe zur Kaderabteilung der Universität, die mich vor sechs Jahren zum Studium in Leipzig vorgeschlagen hat. Erdgeschoss, Zimmer 118. Ich stelle mein sämtliches Gepäck neben die Tür, klopfe leise und vernehme ein herrisches Ja. Derselbe Mann, der mich damals mit meinen Papieren an das Hochschulkomitee weitergeleitet hat, sitzt noch an demselben Platz. In der Zimmerecke gegenüber, wo damals seine Sachbearbeiterin, die mütterliche Frau Ajusch saß, sehe ich jetzt eine wesentlich Jüngere sitzen. Der Mann ist freundlich und großzügig. Als er hört, dass ich nach meinem beendeten Studium in Germanien gerade vom Flugplatz komme, sagt er, ich soll mich erst ein paar Tage ausruhen und gegen Ende der nächsten Woche wieder vorbeikommen.
Ich sage: »Das brauche ich nicht, ich weiß ja gar nicht, wohin ich gehen soll. Deswegen möchte ich gleich erfahren, wo ich angestellt und auch, wo ich unterkommen werde.«
Beide schauen mich an, als hätte ich einen ganz und gar unmöglichen Wunsch geäußert. Der Leiter mustert mich: »Aber Genosse!« Wenn Chefs ihr Gegenüber so anreden, wird dienstliche Strenge gezeigt. Dann fährt er fort: »So einfach geht das nicht mit deiner Anstellung. Wir müssen vorher wenigstens dein Zeugnis prüfen, dann dich durch die Sitzung des Rektorats bringen. Nun zum zweiten Teil deines Wunsches: Die Universität hat keinerlei Möglichkeit, dir eine Wohnung zu geben – das kannst du vergessen!«
Ich erschrecke zutiefst. Denke traurig: Will denn der so schön begonnene erste Tag in der Heimat nun doch ungut enden?
Die Sachbearbeiterin hat mir meine Gedanken wohl vom Gesicht abgelesen und fragt mit deutlich wärmerer Stimme: »Dich wird doch jemand vom Flugplatz abgeholt und zu sich nach Hause mitgenommen haben?«
Ich sage gedämpft: »Niemand hat mich abgeholt. Ich bin mit dem Bus vom Flugplatz gekommen.«
»Wenn du für immer gekommen bist, musst du eine Menge Gepäck mitgeschleppt haben?«, fragt sie argwöhnisch.
»Die Bücher und einen Teil meiner übrigen Sachen habe ich vorher zur Eisenbahn gebracht. Der Rest steht draußen vor der Tür«, gebe ich Auskunft.
»Du hast deine Sachen einfach draußen stehen lassen?«, fragt sie fast wütend. »Und was ist, wenn etwas wegkommt?!« Sie steht schleunigst auf, eilt zur Tür und öffnet sie. Weicht daraufhin einen halben Schritt zurück und stößt einen leisen Ruf aus: »So viel, meine Güte!«
Sie befiehlt mir, sofort die Koffer ins Zimmer zu tragen. Sie greift selber einen der Koffer, ich den anderen. »So feine Stücke! Sie einfach unbeaufsichtigt draußen stehen zu lassen – das geht doch nicht, Junge!«, tadelt sie mich.
Da meldet sich der Chef wieder zu Wort: »Du hast das alles wirklich mit dem Linienbus hergebracht?« Nun klingt seine Stimme freundlicher.
Ich erstatte treuherzig Bericht: »Ja, und der Bus war sehr voll. Aber die Menschen waren so lieb zu mir. Zuerst haben zwei Männer hinter mir in der Schlange, ohne dass ich sie darum bitten musste, von selber die beiden Koffer in den Bus hineingetragen. Dann hat die Schaffnerin mich nicht nur kostenlos fahren lassen, weil ich doch noch kein Geld hatte, sondern auch mich ganz nach vorne gesetzt und meine Koffer nachschieben lassen. Auch der Fahrer hat sich sehr lieb mit mir unterhalten, zu guter Letzt auch noch meinetwegen die Fahrstrecke geändert und mich bis vor das Tor gebracht.«
Aber vertraue den beiden auch an, was ich daraufhin dachte: »Germanien ist ein schönes Land, mit einem hoch kultivierten und auch lieben Volk. Doch dort wäre das, was mir heute im öffentlichen Bus widerfahren, nicht möglich gewesen. Über die Hilfe von allen Seiten habe ich mich so sehr gefreut, dass ich meinen Dank gar nicht aussprechen konnte, weil ich den Tränen nah war. War einfach so dankbar, dass ich mir angesichts des Denkmals da vorne etwas geschworen habe.«
Im Zimmer herrscht Stille, beide schauen an mir vorbei. Ich werde unsicher. Vielleicht habe ich im Büro einer öffentlichen Institution, zu Staatsangestellten etwas ausgeplaudert, was zu unserer Ideologie nicht passt?
Der Chef fragt: »Was hast du dir geschworen?«
»Ich werde dem mongolischen Staat dienen, mit der Ausdauer eines Pferdes und mit der Treue eines Hundes!«, antworte ich. Und füge einen Herzschlag später leise hinzu: »Wie es doch bei den Recken in den Epen heißt.«
Die Blicke der beiden meiden mich weiterhin. Wieder beschleicht mich Unruhe. Vielleicht denken sie, ich sei nicht normal? Ich grüble: vielleicht nicht ganz ohne Grund? Wieso habe ich das alles diesen beiden Unbekannten so einfach anvertraut? Das ist doch höchst anormal!
Ein Gedanke – Erklärung? Entschuldigung? – zuckt mir durch das Hirn: Die Heimat muss mich durcheinandergebracht haben. Die Vorstellung: Nun bin ich wieder in meiner eigenen Familie, und alle, die dieses Land bewohnen, sind meine Verwandten …
Der Chef fragt, ob er mein Hochschuldiplom sehen kann.
Schnell schnüre ich meinen Rucksack auf und ziehe die steife Mappe heraus, der ich mein Diplom anvertraut habe. Die Frau eilt herüber, und beide bestaunen voller Neugier mein Diplom. So etwas haben sie noch nie gesehen.
»Es sieht schon beeindruckend aus. Kannst du uns das Wichtigste dort kurz übersetzen?«, fragt der Chef schließlich.
»Das Wichtigste wäre«, sage ich, meinen Blick auf den Text des Diploms gerichtet, »ich habe das Studium mit summa cum laude abgeschlossen und den akademischen Titel eines diplomierten Germanisten erlangt.«
»Steht das wirklich da geschrieben?«, fragt er etwas verunsichert.
Etwas gereizt antworte ich: »Ich bin zwar der erste Diplomgermanist der Mongolei, aber mittlerweile gibt es ja bei uns Leute genug, die Deutsch verstehen. Sie können es jederzeit nachprüfen lassen!«
»Aber Junge, ich sage das nicht, weil ich es bezweifle, sondern weil sich das wirklich nach einer unglaublichen Leistung anhört. Also gratuliere ich dir wohl als Erster in deinem Heimatland, das dich, wie du sagtest, so lieb empfangen hat.«
Er streckt mir seine Rechte entgegen. Ich schaue einen Pulsschlag lang verwirrt auf die ausgestreckte Hand und schicke ihr dann, ein wenig beschämt, die meinige entgegen. Seine Hand fühlt sich knochig und ein wenig feucht an. Aber es geht von ihr ein kräftiger, überzeugender Druck aus. Sogleich schließt sich ihm die Sachbearbeiterin an, kommt mit ebenso ausgestreckter Hand auf mich zu. Die ihrige ist klein und weich und warm, dennoch auch ziemlich feucht. Unter dem Druck meiner Hand schießt eine feine Röte in die Wangen ihres runden, vollen Gesichts, obwohl ihre Augen mich gar nicht anschauen.
Da meldet sich der Chef wieder: »Mein Freund, hör zu. Ich werde einen Beschluss fassen, der eigentlich der Ordnung hier widerspricht. Und dies aus dreifachem Grund: erstens, weil du ein außerordentlich gutes Zeugnis vorlegst. Zweitens, weil du, wie ich an deiner Aussprache höre, aus der fernen westlichen Ecke des Landes stammst und daher in der Hauptstadt offensichtlich keine Verwandten hast. Und drittens, weil du ein sehr offenherziger Mensch zu sein scheinst. Du bist vom heutigen Tag an als Lehrer für Germanisch an der Mongolischen Staatsuniversität angestellt!«
Ich vermag nur leise und kurz meinen Dank zu äußern. Hätte ich es mit kräftigeren und persönlicheren Worten getan, wäre ich wohl wieder an den Rand der Tränen gekommen, denn ich fühle in mir eine gewaltige Aufwallung. Vor allem deshalb, weil der unerwartete Misston von vorhin verschwunden ist, sodass dieser schönste erste Tag im eigenen Land ungefährdet fortdauern darf und die Spuren meiner ersten Schritte in das so lang ersehnte Berufsleben frei von jeglichem Fleck bleiben.
Der Chef sagt noch: »Heute schaffen wir es zeitlich nicht mehr, aber morgen wirst du einen Vorschuss von deinem ersten Gehalt bekommen.«
Die Frau fragt mich, ob ich was zum Essen und Trinken mithabe. Ich sage: »Ja, Kekse vom Flugzeug, zum Trinken nichts mehr. Aber ich werde es bis morgen schon aushalten, das bin ich noch aus meiner Jäger- und Nomadenzeit gewohnt.«
Worauf die beiden ein kleines, wohl mitleidiges, aber nicht spöttisches Lächeln miteinander tauschen. Er sagt zu ihr: »Ich habe heute beim Entrichten der Parteibeiträge mein Portemonnaie so gut wie geleert. Hast du einen Schein für unseren frischgebackenen Fremdsprachenlehrer, damit er bis morgen, bis zu seinem unvergesslichen Erstlingsgehalt, keinen Hunger und Durst leiden muss?«
Sie sucht in ihrer Handtasche und streckt mir einen Geldschein entgegen: »Hier ist ein Dreier. Das reicht für eine Vorspeise, eine Suppe, ein Hauptgericht und eine Schale Milchtee. Dann bekommst du immerhin 20 Möngö als Restgeld zurück.«
Ich zögere zuerst, die Gabe anzunehmen, aber dann strecke ich den Arm doch hinüber, damit keiner gekränkt sei, und sage artig, den Schein in der Hand: »Danke sehr. Ich werde es zurückbringen, sobald ich zu Geld komme.«
Sie lacht fröhlich: »Ich habe sagen hören, dass die Germanen sehr genaue Menschen sind. Meinetwegen kannst du das gern tun, wenn du es bis morgen nicht vergessen hast. Aber solltest du es wegen deiner vielen Verpflichtungen als Neuling nicht schaffen, hier reinzuschauen, dann darfst du mich demnächst zu einem Essen in einem vornehmeren Lokal als unsere Lehrer- und Studentengaststätte Nummer 18 einladen. Ich werde es genießen, an der Seite eines bestverdienenden Universitätslehrers und eines gut aussehenden jungen Mannes auszugehen!«
Er lacht mit, sodass auch ich dazu wenigstens mitschmunzeln muss. Da fragt er mich, ob die Germanen ein lustiges Volk seien und auch so viel lachen wie die Mongolen. Ich muss zuerst überlegen und sage dann: »Lustig würde ich sie nicht unbedingt nennen. Eher genau und ernsthaft. Und auf alle Fälle sehr darauf bedacht, Wort zu halten. Sie lachen bedeutend weniger als unsere Menschen.«
»Soso«, sagt er, wie für sich, dann zu mir: »Ich hoffe doch, du hast aus diesem Wunderland Germanien ein Lichtbild für deinen Ausweis mitgebracht?« Ich ziehe aus einem Innenfach meines Portemonnaies zwei verschiedene Größen heraus. Das kleinere wird genommen. Er erklärt ihr: »Ich mache den Ausweis und den Zuweisungsschein an den Lehrstuhl für Fremdsprachen bei Dr. Lüdündshib fertig. Und du füllst den Fragebogen für die Neuangestellten aus!«
Das alles ist schnell erledigt. Ich bekomme ein handtellergroßes, in der Mitte zusammengeklapptes Mäppchen aus steifem Material mit grellrotem Überzug – meinen Dienstausweis. Die beiden gratulieren mir von Neuem und wünschen mir viel Glück auf meinem beruflichen Weg.
Nun will ich gehen und greife nach meinem Gepäck. Die Frau sagt, ich soll noch warten, und geht selber hinaus. Der Mann tritt an mich heran, steckt etwas in die Außentasche meines Jacketts und sagt lachend: »Ich habe noch ein paar Münzen bei mir gefunden. Damit kannst du dir morgen ein bescheidenes Frühstück leisten. Das brauchst du mir nicht zurückzubringen. Ihr aber«, deutet er zum Tisch seiner Kollegin, »sollst du den Schein unbedingt zurückgeben. Sie ist eine alleinstehende Mutter mit drei Kleinkindern, die sie tapfer durchs Leben bringt.«
Sie kommt wieder ins Zimmer. Drei junge Männer stehen hinter ihr. Sie sagt zu mir: »Die Jungs bringen dich samt deinem Gepäck zur Tür von Haus Zwei, zum Lehrstuhl für Fremdsprachen. Ich wünsche dir gutes Gelingen auf den weiteren Strecken des heutigen, für dich so denkwürdigen Tages!«
Ich murmle abermals ein, zwei trockene Dankesworte und schicke den beiden einen kurzen, dankbaren Blick zu. Das alles kommt mir so merkwürdig und bewegend vor. So verpasse ich auch, den gütigen Jungen, die mein schweres Gepäck tragen und wahrscheinlich deswegen ihren Unterricht verpassen, etwas Liebes zu sagen.
Am Eingang von Haus Zwei werden wir von einer älteren Frau mit einer dienstlichen Miene angehalten. Ich zeige erstmalig meinen Dienstausweis. Sie schaut lange und angestrengt hinein und fragt schließlich streng: »Neu angestellt?«
Ich sage gedämpft: »Ja.«
Dann schaut sie auf die Begleitung und sagt, ebenso streng: »Und ihr?«
Einer antwortet für alle drei artig: »Wir sind Physikstudenten im ersten Semester und sind von der Kaderabteilung beauftragt worden, das Gepäck des neuen Lehrers bis vor die Tür des Lehrstuhls für Fremdsprachen zu bringen.«
»Er kann durchgehen. Aber von Gepäck steht hier nichts. Daher bleibt es hier unten, und ihr könnt wieder gehen!« Nun klingt die Stimme eisern, genau passend zur Miene.
Ich erkläre vorsichtig: »Große Schwester! Ich bin erst heute vom Ausland in der Heimat gelandet und direkt vom Flughafen mit dem Linienbus gekommen. Da ich niemanden in der Hauptstadt kenne und nicht weiß, wo die Nacht verbringen, haben mir die Genossen in der Kaderabteilung empfohlen, meine Sachen im Lehrstuhl zu lassen, bis eine Bleibe für mich gefunden ist.«
Eine kleine Lüge, ich weiß. Aber man wird es mir verzeihen, denke ich, sollte es irgendwann auskommen.
Der kalte Blick der Frau in ihrem verwitterten und auch fleckigen Deel bohrt mir ins Gesicht, schweigend und prüfend. Manduhai, die Königin, hat wohl mit demselben kalten, starren Blick auf ihre Untertanen geschaut, ehe sie ihr Urteil fällte: Strafe? Oder Gnade?
Ich versuche, dieser so unmenschlichen, aber auch so alltäglichen Tortur standzuhalten. Als diese kleine Manduhai die ihr zugefallene bittersüße Droge Macht genügend ausgekostet und sich daran wohl auch berauscht haben mag, winkt sie mit dem Kopf ins Innere und brummt wichtig: »Genehmigt!« Erst, als die unsichtbare Sperre etliche Schritte hinter uns liegt, ruft sie uns nach: »Vierter Stock, rechts!«
Vor der Tür mit dem Schild Lehrstuhl für Fremdsprachen verabschiede ich mich von den dreien. Ehe sie gehen, erkundige ich mich nach ihren Namen und ihren Bezirken. Alle drei haben wohlklingende und auch inhaltsvolle Namen: Saenbair (Gute Freude), Enktaewin (Frieden) und Ariunbat (Heiligfest), und alle drei sind vom Land. Ein weiteres Geschenk dieses besonderen Tages! Also sage ich zu ihnen: »Ich danke euch, Brüderchen. Bestimmt werden wir uns wieder begegnen. Denkt an das Sprichwort unserer Vorfahren: Könige sind selten streng, aber die Pförtner!« Sie schmunzeln, aber ich, frischgebackener, sozusagen noch ofenwarmer Lehrer, bin noch nicht am Ende mit meiner Botschaft: »Was ich als Älterer nebst meinem Dank euch noch auf den Weg mitgeben möchte: Betretet ihr einen Hof, achtet immer auf den Hund, betretet ihr eine Behörde, achtet immer auf den Wächter!« Ich reiche ihnen die Hand zum Abschied. Ein jeder von ihnen hat eine warme, feste Hand, von der ein schüchterner Druck ausgeht.
Ich schaue auf meine Armbanduhr. Es ist noch früher Nachmittag, 2.47 Uhr. Diesen Augenblick will ich in mein Gedächtnis gut einprägen. Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Uhr zwei Minuten später gezeigt hätte, da Zahlen für mich große Bedeutung haben. Doch, was solls, es ist, wie es ist, denke ich und klopfe an die Tür. Stille. Ich lege das Ohr ans Holz, horche. Höre das Klappern einer Schreibmaschine. Ich drücke die Klinke und öffne die Tür. Und nehme wahr: in der Mitte ein blau gestreifter langer Sitzungstisch, um diesen verteilt ein halbes Dutzend Personen, alle in gebückter Haltung, wohl lesend oder schreibend. An der Stirnseite am fernen Ende des Tisches ein quer gestellter, kürzerer Tisch und hinter diesem eine männliche Person, ebenso in seine Tätigkeit versunken. In einer hinteren Ecke, zwischen Schränken, nur halb sichtbar ein weiterer Tisch, darauf die Schreibmaschine und dahinter eine weitere Person. Eine Atmosphäre voller Spannung und Arbeit.
Zuerst weiche ich zurück, um nicht zu stören, und will die Tür wieder schließen. Dann fasse ich doch Mut und frage hörbar laut, ob ich eintreten darf.
Die Person hinter dem quer stehenden Tisch – jetzt erkenne ich, es ist ein Mann, das muss der Doktor Lüdündshib sein! – schaut auf, und nach zwei, drei Wimpernschlägen nickt er bejahend. So peinlich es mir auch ist, ihn bei seinen Gedanken gestört zu haben, trete ich ein und gehe auf ihn zu. Kein Zweifel, er muss der Chef sein. Denn er ist der Älteste in der Runde, und nur er schaut mir entgegen, während alle anderen so tun, als würden sie von der Störung nichts merken. Nur die Person hinter der Schreibmaschine, eine junge Frau, hat ihre Beschäftigung unterbrochen und ihren unverhüllt neugierigen Blick auf mich gerichtet.
Nach einem Gruß lege ich behutsam den Zuweisungsschein samt meinem Dienstausweis auf den Tisch vor dem Lehrstuhlinhaber – Herrn? Genossen? Lüdündshib? – und stelle mich vor. Der hagere Mann mit einem deutlich südländischen Einschlag in seinem schmalen, beinah zieselgelben Gesicht schaut sich beide Papiere peinlich genau an und sagt schließlich, ich soll mich setzen. Ich schaue mich um, entdecke in einiger Entfernung einen freien Stuhl, hole ihn herbei und setze mich darauf. Währenddessen hat er ein dickes Schreibheft aufgeschlagen und ist dabei, darin in altmongolischer Schrift von oben nach unten zu schreiben. An der Art, wie sich seine Hand bewegt, ist zu erkennen, er beherrscht diese Schreibkunst tadellos.
Er fragt nach meinem Abschlusszeugnis. Ich bitte um Erlaubnis, mein Gepäck in den Raum hereinzuholen. Ich weiß nicht, ob er mir gut zugehört hat, denn er sagt: »Ja, natürlich.« Ich eile zur Tür und fange an, alle drei Gepäckstücke, eines nach dem anderen hereinzuschleppen und in die freie Ecke zu stellen. Schließlich hole ich die Dokumentenmappe aus dem Rucksack und kehre zu meinem Stuhl zurück. Nun haben die bisher so Disziplinierten ihre Blicke von dem, was sie fesselte, gelöst und auf mich gerichtet.
Die erste Frage des Chefs betrifft mein Gepäck. Ich sage, dass ich direkt vom Flugplatz hierhergekommen bin.
»Aber doch nicht heute?«
»Doch«, sage ich und schaue ihn unschuldig an.
»Aber du hast ja schon einen Dienstausweis?«
»Ja, er ist vor einer halben Stunde in der Kaderabteilung ausgestellt worden.«
»Dann muss dich ein Mächtiger von ganz oben mitgebracht haben?«
»Ich kam allein, mit dem öffentlichen Bus.«
Da sagt er in die Runde: »Die meisten von euch haben wochenlang an viele Türen klopfen müssen. Und er schafft es innerhalb weniger Stunden. Ist das nicht toll?«
Ich fühle, wie alle Blicke auf mich gerichtet sind. Doch am stärksten spüre ich den Blick dieses Mannes, der mich bis vor wenigen Minuten nie gesehen hat und von mir nichts weiß. So denke ich jedenfalls. Es ist ein schräger und dabei auch bohrender und wühlender Blick. Er fühlt sich an, als sei er, wie eine giftige Kugel, durch mich hindurchgegangen und habe mir bleibendes Leid zugefügt.
Nun hält der Doktor mein Diplom in der Hand und starrt hinein. Seine Lippen bewegen sich, woraus ich schließe, er kann Deutsch lesen.
Er fragt, was »summa cum laude« bedeute. Ich sage: »Mit Auszeichnung. Das ist wohl die höchste Note.«
Seine Augenbrauen ziehen sich deutlich zusammen. Auch glaube ich zu erkennen, wie sich eine Blässe von der Stirne aus über das ganze Gesicht ausbreitet.
Ich bin fassungslos. Überlege, was ich verkehrt gemacht habe. Mir fällt nichts ein. Denke für mich: O kugelrunde Welt! Wie schön war dieser Tag bis zur Schwelle zu diesem Raum! Dasselbe, wozu andere mir gratuliert haben, scheint in diesem Menschen Groll auszulösen! Was wäre wohl geworden, wenn ich vorhin draußen noch zwei Minütchen gewartet und erst bei 49 an die Tür geklopft hätte? Hat mir die schamanische Mutter nicht ans Herz gelegt, ich solle mich bei der Zahl 7 immer in Acht nehmen, während ich mich der 9 jederzeit anvertrauen dürfe? Doch sogleich bezichtige ich mich des Aberglaubens aus der Steinzeit.
Die Disziplinierten stehen einer nach dem anderen auf und verlassen das Zimmer mit einem kurzen, dumpfen Brummen im hinteren Rachenraum, das ich erst bei der vierten oder fünften Person als Bairtae, einen Abschiedsgruß erfasse.
Endlich legt der Chef das Diplom aus der Hand und fängt an, mich auszufragen. Er will von mir vieles wissen. Ohne zu zögern, antworte ich auf alle seine Fragen. Alles, was ich sage, schreibt er in sein Heft.
Irgendwann klappt er das Heft wieder zu und fängt an zu reden. Er ist ein geschickter und brutaler Redner. Gesteht lässig, dass er wenig liest, nur das Wichtige des eigenen Faches, und auch da nur die Stellen, die Nutzen versprechen. Seine Lebensmethode sei herumschauen und herumhorchen, seine Arbeitsmethode, der grammatischen Struktur einer jeden Sprache nachzugehen und die Grundregeln zu begreifen. Danach wisse er, die Sprache ist gebändigt, er kann sie nutzen. Um das Erlernen des Wortschatzes mache er sich keine Gedanken, dafür gäbe es Wörterbücher, in denen er alles nachschlagen könne. Er rühmt sich, auf diese Art und Weise die Strukturen aller Weltsprachen erforscht und begriffen zu haben. Er beziffert die Zahl der Sprachen, die er sich so angeeignet hat, auf bisher siebzehn.
Als Erstes habe er in fünf Tagen Englisch gelernt, während einer Zugfahrt von Ulaanbaatar nach Moskau. »Als ich hier in den Zug einstieg, steckte ich in eine Seitentasche meines Mantels ein Grammatikbuch und in die andere ein Wörterbuch. Die Mitreisenden schlugen sich die Tage und Nächte mit Saufen und Fressen, Spielen und Quatschen und mit Schlafen und abermals Schlafen die Zeit tot. Ich kletterte gleich nach oben, zündete die Bettlampe an, las und las und steckte mir zwischendurch ein Stück Aaruul in den Mundwinkel, was sich dort langsam auflöste und so meinen Durst löschte und gleichzeitig auch meinen Hunger stillte. Da brauchte ich nicht einmal Zeit zu verlieren, für meine Blase oder meinen Darm, blieb eisern an der Sache, die ich in Angriff genommen hatte. Irgendwann hieß es, wir seien am Ziel angekommen. Ich stieg aus mit meinem Köfferchen in der Hand, meinen beiden Büchern in den Taschen und mit meinem Englisch im Hirn.«
So ist er also, mit seinen Methoden, Zielsetzungen und Erfolgen. Mit seiner Geradlinigkeit, um zum Kern einer Wahrheit zu kommen – seiner Wahrheit. Was mich schon beeindruckt. Doch muss ich unwillkürlich an eine Kunstfigur aus einer Tragikomödie denken. Der Gedanke verschafft mir ein wenig Erleichterung. Denn jetzt glaube ich, besser zu wissen, mit wem ich es zu tun habe. Wenn er das ist, sein will, brauche ich alles, was er mir vielleicht antun wird, nicht ganz so ernst zu nehmen.
Aber er redet weiter. Während die Worttiraden auf mich zurollen, begegne ich weiteren Zügen von ihm. Es ist eine brutale Überschätzung der eigenen Möglichkeiten und eine Selbstenthüllung, welcher eine ebenso brutale, ja, zynische Unterschätzung anderer Individuen zugrunde liegen muss. Er breitet eine seiner Theorien vor mir aus: »Kollektiv und Genie sind wie Feuer und Wasser. Das eine verträgt das andere nicht. Mittelmäßige sind die besten Ziegel für das Kollektiv, während das Genie der Nährboden ist. Darum ergibt ein richtig geführtes Kollektiv von zehn Mittelmäßigen im Endergebnis mehr als alle Genies dieser Welt zusammen. Darum stelle ich mir den Lehrkörper meines Lehrstuhls immer aus Mittelmäßigen zusammen. Denn sie sind frei von Selbstgefälligkeit und tragen in sich die natürliche Bremse, die sie in der zugewiesenen Bahn hält. Wer zu mir kommt, weiß von vornherein, was ihn erwartet: halbmilitärische Disziplin und mikroskopische Kleinarbeit. So gewöhnt er sich daran, jeden Tag, auch an allen unterrichtsfreien Wochentagen, ständig von 9 bis 15 Uhr hier zu sein und seinen Beitrag zu einer der zeitgleich laufenden, zahlreichen Forschungsaufgaben zu leisten. Jedem steht es frei, noch länger zu bleiben, nötigenfalls auch die Nacht über. Und der Erfolg gibt mir recht: Seit Jahren ist unser Lehrstuhl führend an der Universität in der Anzahl der Veröffentlichungen!«
Ich staune und bin doch beeindruckt. Noch wichtiger: Ich glaube, endlich begriffen zu haben, warum er etwas gegen mich und mein Diplom hat.
Doch der Doktor fährt fort und öffnet mir die Augen, schärft meine Sinne um ein Weiteres: »Ich bin über entsprechende Kanäle zu mancherlei Auskünften über Ihre Person gelangt.«
Erst später, als ich im Salz des Lebens meine Erfahrungen gemacht hatte, werde ich den Sinn in diesem Satz, der gar nicht so kompliziert ist, wie er klingt, begreifen. Noch fehlt mir, dem Himmel sei Dank, die Erfahrung dazu. Um es aber hier vorwegzunehmen: Hinter »entsprechenden Kanälen« lauerte der Geheimdienst, und »Ihre Person« war Geheimdienst-Jargon aus den berüchtigt-blutigen Dreißigerjahren, der gegenüber jedem Beschuldigten anstatt »du« verwendet wurde.
Obwohl mir also manche seiner Offenbarungen im Dunkeln bleiben, erfahre ich doch vieles. Genosse Doktor Lüdündshib weiß von meiner Feldforschung bei den Tuwa mit Frau Dr. Schwan während der Studienzeit, was mir einen kleinen Schrecken einjagt. Denn die Schwans haben mich gebeten, in der Mongolei mit dieser Geschichte vorsichtig zu sein. Ich wusste damals nicht recht, warum. Nun aber höre ich, dieser Mongole weiß alles.
Aber nicht nur das. Der allhörende und allwissende Mann sagt mit nun gelockerter Zunge: »Ich darf an dieser Stelle Ihre Person davon in Kenntnis setzen, dass Mitarbeiter höherer staatlicher Stellen hier im Lehrstuhl wiederholt angefragt haben, ob die gewisse Person aufgetaucht sei. Sie wussten, jene hat das Studium schon vor Monaten beendet. Also sind gewisse Konsequenzen zu erwarten, schon wegen dieser Überziehung der genehmigten Aufenthaltsfrist im Ausland. Noch schwerwiegender aber ist die wiederholt begangene willkürliche Überlassung geistigen Eigentums des mongolischen Volkes gegenüber einer fremdländischen Person ohne jegliche Genehmigung vonseiten der zuständigen Behörden!«
Soll das eine Drohung sein? Wohl ja. Mir wird unheimlich!
Von der Mongolei hat es schon immer geheißen, sie gleiche einem aufgestülpten Sack, da selbst die heikelsten Geheimnisse sehr bald an die Öffentlichkeit gelangen. Weder die proletarische Diktatur noch die Parteidisziplin haben das in der neueren Zeit ändern können. Denn sie ist eine Sippengesellschaft, deren Mitglieder durch verschiedenste Fädchen miteinander verknüpft sind. So erfahre selbst ich, der ich von der eigenen Sippe durch riesige geografische Weiten getrennt und am Außenrande einer Ansammlung fremder Gemeinschaften zu leben scheine, recht bald den Grund der Abneigung des Genossen Lehrstuhlinhabers gegen meine Person: Ein Neffe seiner Frau sei unter Anleitung unseres Sprachgenies seit Längerem dabei, sich die germanische Sprache anzueignen, und habe kurz davorgestanden, an der Universität als Lehrer angestellt zu werden.
Während dieser ganzen Folter mit Worten hört, soweit es bei dem Geklapper der Schreibmaschine überhaupt möglich, die Maschinenschreiberin von ihrer Ecke aus mit. Doch irgendwann steht sie auf, deckt die Maschine zu und verlässt stumm und leise den Raum, auf Zehenspitzen, wie mir scheint.
Seit einer ganzen Weile vernehme ich ein dumpfes Knurren und überlege, von wem dieses unangenehme Geräusch ausgehen könnte. Wohl von mir, denn mir wird bewusst, dass seit der letzten Mahlzeit im Flugzeug viele Stunden vergangen sind. Bei diesem Gedanken spüre ich denn auch den Hunger.
Unvermittelt schaut der Chef auf seine Uhr und fängt sogleich an, die ausgebreiteten Papiere zu ordnen und im Schränkchen seines Schreibtischs zu verstauen.
Und was wird mit mir?, denke ich panisch. Wo soll ich unterkommen?
Also spreche ich, nicht panisch, eher richtig zornig, den Menschen an, der mein Chef sein soll und darum auch wissen muss, wo ich, sein Mitarbeiter, unterkomme: »Ich brauche eine Wohnung! Sie sehen doch mein Reisegepäck, wo soll ich diese Nacht verbringen?«
Er feixt spöttisch: »Oh, gleich eine ganze Wohnung? Am besten gleich drei Zimmer, mit heißem Wasser und einer Innentoilette, nicht wahr?« Dann schießt er los, schnell und laut, wie ein Diktator: »Ich sage dir eines, mein Bursche: Die wirst du auch in zehn, zwanzig Jahren nicht haben! Grauhaarige, die dreißig, vierzig Jahre hier gelehrt haben, namhafte Gelehrte, Professoren und Doktoren, selbst diese wohnen in Jurten oder hausen in selbst gebastelten Bretterschuppen!«
Ich schaffe es, in eine kleine Lücke seiner Tirade ein paar Worte zu schieben: »So habe ich es nicht gemeint. Der kleinste und schäbigste Raum ist mir recht. Wenn ich nur mein Gepäck hineinstellen und ein paar Nächte darin schlafen könnte. Ich bin weder faul noch dumm, kann mit Axt und Säge umgehen, werde mir die nötigen Bretter und Balken kaufen und recht schnell ein Hüttchen zusammenzimmern!«
»Vielen Dank für die Seifenblasen, die du gerade ausgespuckt hast. Die bestätigen mir die Auskünfte seitens gewisser Behörden, die dich als eine sture und überhebliche Person beschrieben haben!«
Ich werde hellhörig. Eindeutig, er will mir Angst machen!
In mir erwacht aber der Trotz. So sage ich, nun betont ruhig und fast spöttisch: »Dass Sie Beziehungen zu gewissen Stellen pflegen, haben Sie bereits gesagt. Deswegen bitte ich Sie aufs Inständigste, mir zu sagen, wo soll ich diese Nacht verbringen?«
Er platzt fast und schreit mich an: »Woher soll ich es wissen? Stelle die Frage lieber denen, die dich angestellt haben!« Dann springt er hoch, reißt die Tür auf und lässt sie hinter sich laut zuknallen.
Oje!, denke ich, laut stöhnend. Lasse mich daraufhin auf einen abseitsstehenden Stuhl niedersacken und fasse beidhändig meinen Kopf. Mir ist zum Weinen. Doch weiß ich, Tränen bringen nichts, werden mir nur die Sinne trüben. So erteile ich mir selbst den Befehl, den Kopf kühl zu behalten und gut zu überlegen, was zu tun sei. Ein paar tiefe Atemzüge, und schon treffe ich die erste Entscheidung: rausgehen und etwas essen! Die prickelnd frische Luft des beginnenden Abends tut gut.
Egal, wo ich diese Nacht und die nächsten Nächte verbringen werde, Hauptsache, ich bin wieder im eigenen Land!, denke ich trotzig, auf die so geräumig wirkende Stadt mit den großzügig breiten, sauberen Straßen und farbenprächtigen Häusern im gleißenden Licht der untergehenden Sonne schauend. Dem hell tröpfelnden Geräusch des Verkehrs der wenigen Autos in der Ferne, vermischt mit dem Gelächter einer Handvoll Studenten in der Nähe lauschend, spinne ich den Gedanken weiter: Ich bin jung und gesund, habe mindestens ein halbes, und wer weiß, sogar ein ganzes Jahrhundert Leben vor mir. Was bedeutet da die kleine Unklarheit dieses Augenblicks, ha!
Die Studentenmensa ist wesentlich kleiner als die in Leipzig. Sie kommt mir aber unvergleichlich gemütlicher vor und lässt mich an einen großfamiliären Treffpunkt und Essraum denken. Heitere Stimmung herrscht, es wird viel gelacht und gescherzt. In der Ecke gegenüber üben drei Studenten an einem Lied: Zwei Mädchen singen leise, und ein Junge zupft dazu kaum hörbar die Gitarre. Ich bekomme ein komplettes Menü, genau so, wie die gute Seele der Kaderabteilung es mir aufgezählt hat, und genau zum genannten Preis. Es ist die erste Mahlzeit, die ich wieder im eigenen Land bekomme, ich genieße jeden Bissen und jeden Schluck. Nur eines behagt mir nicht ganz. Ich sitze ganz hinten, in einer Ecke, allein an einem Tisch. Den Platz habe ich mir selber ausgewählt, weil ich mir das bei fremden Leuten angewöhnt habe. Hätte ich an einem der halb besetzten Tische in der Nähe Platz genommen, wäre ich bestimmt ins Gespräch gekommen. Ich habe zwar das Gefühl, dass die in der Nähe Sitzenden hin und wieder einen verstohlenen, neugierigen Blick herüberschicken, aber ich bleibe bis zum Schluss allein sitzen.
Zurück in meiner Notbleibe, wo die Koffer stehen, rüste ich mich zur Nacht. Vor allem will ich mich vom Schweiß der langen Reise und dann des ebenso langen, anstrengenden Tages wenigstens einigermaßen befreien. Vor sechs Jahren, 1962, als ich für ein paar Monate hier eine kurze Studentenlaufbahn durchlief, hat man seine Notdurft draußen in Bretterbuden auf längs liegenden Bohlen stehend oder hockend über einem tiefen Graben verrichten müssen. Inzwischen gibt es im Haus Wassertoiletten und im Vorraum davor auch ein Waschbecken, vorerst nur mit kaltem Wasser. Doch dieses ist für mich hilfreich genug. Nur muss ich gegen große Hemmungen ankämpfen, während ich mich stückweise ausziehe und die frei gewordene Haut mit einem nassen, eingeseiften Lappen abreibe und höllisch genau nach einem möglichen Geräusch im Gang lauschen. Doch bekomme ich zum Schluss den ganzen Körper sauber, einschließlich Kopf und Haar und die Füße. Ach, habe ich je nach einer Dusche, ja, selbst nach einem Vollbad dieses Wohlgefühl gehabt?
Nach dieser Waschaktion hätte ich mir ruhig meinen bequemen Schlafanzug anziehen können. Doch mir reicht dazu der Mut nicht. Was wäre, wenn in der Nacht jemand vorbeikäme!
So kleide ich mich für den nächsten Tag vollständig an – auch in eines meiner beiden bügelfreien, schneeweißen Dederon-Hemden. Und lege dazu die passende Krawatte bereit.
An dieser Stelle muss ich eine Kleinigkeit zu weißen Hemden und bunten Krawatten einschieben. Die allermeisten Tage meiner sechs Jahre als Student und die anschließenden acht Jahre als Hochschullehrer verbrachte ich in dieser obligatorischen Uniform der Intellektuellen. So war es damals üblich im Osten. Die vornehme Bekleidung hob einen nicht nur äußerlich ab, sondern auch innerlich, und sie verpflichtete zur Sauberkeit.
Sauber gewaschen und öffentlichkeitstauglich bekleidet, lösche ich das Licht, lasse mich am Fenster in einem der Armlehnstühle aus gut poliertem Holz nieder und schlafe bald ein.
Gut drei Stunden später erwache ich. Es ist erst Mitternacht. Hals und Rücken sind mir steif geworden, das Gesäß tut weh, mir ist kalt. Aus Angst, das große Licht anzumachen, nehme ich im Schein meiner Taschenlampe den Sportanzug aus dem Koffer, lege ihn als Polster auf den Stuhl und ziehe meinen Übergangsmantel an. Im Dunkeln mache ich etliche gymnastische Bewegungen, wie sie mir einfallen, und lasse mich, einigermaßen gelockert, erneut auf meinem Stuhl nieder, näher am Heizkörper.