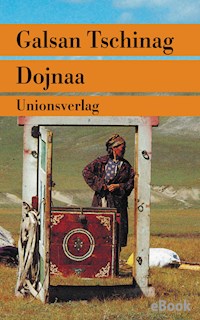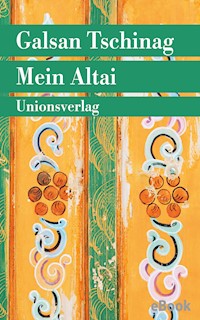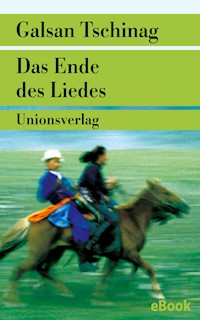12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In diesem funkelnden, ebenso heiteren wie nachdenklichen Roman führt Galsan Tschinag uns in den innersten Kreis seines Lebens in der mongolischen Steppe. Ein Jahrhundertgedanke hat sich in seinem Hirn festgesetzt: Mit einer Million Bäume will er die Steppe begrünen. Der erste Schritt: Der öde, zerfallene Friedhof der Ahnen soll wieder hergerichtet werden. Doch dabei tun sich zahlreiche Hindernisse auf. Die Stammesleute fürchten die Geister der Toten, es fehlt an Geld, Material und Durchhaltewillen. Da taucht in der Jurte des Stammesführers eine rätselhafte, blonde, berückend schöne Kasachin auf. Ihre Klugheit und Leidenschaft lässt ihn vergessen, dass sie ein eigenes, bedrohliches Ziel verfolgt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
In diesem funkelnden, ebenso heiteren wie nachdenklichen Roman führt Galsan Tschinag uns in den innersten Kreis seines Lebens in der mongolischen Steppe. Ein Jahrhundertgedanke hat sich in seinem Hirn festgesetzt: Mit einer Million Bäume will er die Steppe begrünen. Doch dabei tun sich zahlreiche Hindernisse auf.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag
Gold und Staub
Roman
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Christopher Meder
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30351-5
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 23:44h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
GOLD UND STAUB
PrologDer Anruf, der an eine Lawine rührtDer Aufbruch, der Wunden aufreißtDie Nacht, der TagDrei Verrückte und eine GesundeEndlich gebe ich den Bruder dem Tod freiGlück will nicht ertappt seinTötung der TotenstilleBemähnte Unschuld, behufte OhnmachtRajas GeständnisDas GoldfieberReden Tote, haben Lebende zu schweigenTrüber, turbulenter TagPrüfungen, bestanden durchfallendEin Hügel wird geschlachtetVon Menschen verwundet, von der Zeit geheiltSchwert über der Nabelgrube des Hohen AltaiNimm dein Kind wieder zu dir, MuttererdeEpilogWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Nomaden
Zum Thema Schamanismus
Zum Thema Asien
Zum Thema Liebe
Prolog
Das Jahr des Ehernen Tigers, rau wie sein Träger, hat klirrend frostig und windstürmisch angefangen und verspricht auch gegen Ende des zweiten Monats keinerlei Milderung. So dauern am Rande der mittelmongolischen Berg- und Waldsteppe Anfang April die winterlich kalten Nächte immer noch an und münden, sobald sich die Erdkugel auf die Sonnenseite wälzt, gleich in ebenso ungemütliche Tage unter wirbelndem Staub mit allerlei Dreck, herübergeflutet aus der Stadt, die längst aus allen ihren Nähten geplatzt ist.
Doch was macht das – ein jedes Lebewesen kämpft ums Dasein unerschütterlich weiter, und so werden oben, wenn sich im wallenden, grauen Staubmeer blaue Himmelsspalten auftun, Schwärme heimkehrender Wasservögel sichtbar, und unten, an den windgeschützten, sonnigen Rändern von Mulden und Bülten zeigen sich, kaum erkennbar, blasse Narben in Richtung Grün. Und dazwischen, unter dem Himmel und über der Erde, Menschen, wie gerade aus ihrem Versteck gekrochen, mit einem Mal sind sie da und gehen nun ihren Lebensgeschäften nach, da hastend, hier schleichend.
Und ich, ein lebendes Wesen wie alle anderen auch, sehe, aus dem nun einmal Gegebenen das Beste zu erzielen: Verbringe viele Stunden der Nacht in einem geschützten Winkel meines Obdachs, bei wackligem Kunstlicht am Schreibtisch, grübelnd und schwitzend. Die größere Hälfte des Tages aber draußen, Erde buddelnd, Steine lesend und fortschleppend, Wasser schöpfend und sprengend, dabei schwitzend und prustend. Denn dort liegt das Grundstück, wo ich, nach langen Jahren Lakaiendasein unter einer gleichgeschalteten, verängstigten Menschenherde inmitten eines aschgrauen, überwachten Gettos, vor Kurzem erst einen Unterschlupf für mich und die Meinigen gefunden habe. Ihn gilt es nun weiter auszubauen, zu beseelen und zu begeisten.
Der Anruf, der an eine Lawine rührt
Mitten in einem solchen arbeitsreichen Tag zwischen zwei schlafarmen Nächten geschieht es. Mein Handy wispert. Keine Nummer ist in dem Fensterchen erschienen. Doch eine Frauenstimme, jugendlich und unbefangen, spricht. Sie grüßt und redet mich mit Namen an und meint, ich würde sie noch nicht, dafür aber sie mich gut kennen. Dann sagt sie: »Ich mache Ihnen ein Angebot. Seien Sie bitte am zweiten Maisonntag in Ihrer Altaiheimat. Dort werde ich Sie aufsuchen.«
Ich merke, meine Stirnenhaut zuckt, und mein Hirn fängt an zu arbeiten. Merkwürdig, dass mir eine Wildfremde aus dem Unsichtbaren, dazu noch von einer versteckten Nummer aus, so einen Befehl erteilen will. Aber was vermag man als gewöhnlicher Sterblicher, erst recht als amtloser Rentner, da zu tun? Nichts. Daher ist es am besten, ruhig Blut zu bewahren. Denn es gibt Schlimmeres: dreiste offene Verhöhnungen, grobe Anfälle, aber auch in süße, schmierige Worte verpackte Betteleien, die letzten Endes nichts anderes sind als ein versteckter Versuch, einen für dumm zu verkaufen, um dich am Ende öffentlich ausrauben zu dürfen. Und schließlich gibt es auch noch die blutrünstigen Drohungen und raubtierischen Überfälle.
Also bewahre ich Ruhe und lasse das Gespräch weiterlaufen, anstatt es abzubrechen, wie ich es in früheren Zeiten wohl getan hätte. Frage sachlich, wer sie sei.
»Das brauchen Sie noch nicht zu wissen«, sagt sie bestimmt und fügt sogleich hinzu: »Zum gegebenen Zeitpunkt werde ich vor Ihnen erscheinen. Dann werden Sie gewiss mehr erfahren als nur meinen Namen.«
Ich frage weiter, wozu sie mich braucht.
»Als Millionär und auch als Weisen.«
Da sage ich und versuche, meiner Stimme einen belustigten Ton zu geben, dass ich weder das eine noch das andere bin.
»Das sagen Sie. Bescheidenheit nennt man das wohl. Ein verzeihliches Überbleibsel aus den Zeiten der Zwangserziehung zu grauen, menschlichen Mäusen, die von solchen hohlen Begriffen satt werden mussten.«
Das wurmt mich irgendwie. Daher wohl sage ich, immerhin sei ich ein Dichter mit Namen und Rang, und dann noch ein Mann.
Sie lacht auf, kurz und leise. »Da Sie meinten, mir das sagen zu müssen, nehme ich das mit der Bescheidenheit zurück. Nur, ich brauche den Dichter, der Sie zu sein behaupten, in dieser Sache herzlich wenig und noch weniger den Mann.«
Ich stutze. Vielleicht bin ich, ohne es mir eingestehen zu wollen, in meiner Ehre als Dichter wie als Mann angekratzt worden. Aber in demselben Augenblick stelle ich, wie mir zu einer armselig kleinen Rückenstütze und ihr gleichzeitig zu einem anlastbaren Mangel, etwas fest: Sie ist Kasachin. Eine kleine Unvollkommenheit in der Aussprache hat es mir verraten. In dem Sekundenbruchteil, wie es mir bewusst wird, komme ich mir vor, als hätte ich sie bei einem kleinen Gebrechen erwischt. Worüber ich mich wenig später leise schämen muss, freilich. Doch in jenem Augenblick der neuesten mir zugefügten Wunde, vielleicht der zehn- oder hunderttausendsten, ist damit ein klein wenig geholfen, das dumpfe Zwicken auf der Haut meiner empfindsamen Seele zu ertragen, das will ich gern zugeben.
So rede ich mit dem Anschein betonter Ruhe, dabei aber mit einem Happen Spott, indem ich mich zum Berater aufspiele: »Du scheinst, meine Schönste, eine Geschäftsfrau zu sein. Es gehört einfach zur Geldmacherei, dass einem im Fieber, auf noch höheren Gewinn zu kommen, hin und wieder Fehleinschätzungen unterlaufen. Doch wer Grips genug in seiner Birne hat, versteht es, sich rechtzeitig abzufangen, damit keine Fehleingriffe erfolgen. Gib also den kleinen Flitz, mit mir deine Pimperlinge vermehren zu wollen, auf. Lass uns in Frieden als Unbekannte weiterleben, aber als Gräser einer und derselben Steppe und als Steine eines und desselben Berges.«
Die gute Frau im Unsichtbaren befürchtet wohl, ich würde das Gespräch sogleich abbrechen, denn sie fällt mit einem Mal aus ihrer bisherigen ruhevollen, daher erhaben wirkenden Haltung und ruft mit einer leicht schrillen Stimme: »Bitte, noch nicht. Das Allerwichtigste ist noch nicht gesagt.«
»Nanu?«
Ich vernehme aus dem Unsichtbaren ein erleichtertes Aufatmen. Darauf die wieder beruhigte, selbstsichere Stimme: »Vorher nur noch eine Frage, aus bloßer Neugier. Also. Sie haben mich vorhin Ihre Schönste genannt. Dann noch ein Gras aus derselben Steppe und einen Stein aus demselben Berg wie Sie auch. Nun, meine Frage: Kennen Sie mich etwa doch? Haben Sie mich vorhin an meiner Stimme wiedererkannt?«
»Nein, ich kenne dich nicht. Warum ich dich trotzdem meine Schönste genannt habe? Ganz einfach, weil jede Frau sich für die Schönste hält, bekanntlich.«
»Und jeder Mann hält sich für den Tollsten. Doch gerade haben Sie von mir gesagt bekommen, Sie würden mich als Mann gar nicht interessieren – da müssen Sie, Ärmster, an Ihrer Ehre schwer verletzt worden sein.«
»Quatsch. Aber ich muss meine Schönste loben, denn sie verfügt über ein schnell arbeitendes Hirnchen. Sicher hat sie von manchem Einfaltspinsel von Männchen bereits viel süßes Lob wegen ihrer hohen Intelligenz eingesteckt.«
Sie kichert vergnügt, und ihre Worte, die auch mich schmunzeln lassen, zeugen von einem gehörigen Batzen Stolz: »Ja, ja. Das ist wahr. Alle sagen, ich würde über einen merkwürdig hohen IQ verfügen. Schon in der Schule hatte ich wegen meiner Intelligenz den Spitznamen Die Kleine Lehrerin.« Nach einer kurzen Atempause, benötigt ebenso von mir, fährt sie munter fort: »Und Sie, der Sie die Kehren und Kurven im Lebenshaus so genau kennen, wollen es trotzdem nicht gelten lassen, wenn ich sage: Sie sind ein Weiser?«
Soll nun auch ich der Eitelkeit erliegen? Der Anlass ist gegeben und die Gefahr, ihr im Spaß und daher gut getarnt zu erliegen, reizend nah. Doch diesmal wenigstens scheine ich ihr zu entkommen. Denn mir fällt die Frage ein, die noch beantwortet werden muss. Also sage ich: »Du bist doch eine Kasachin.«
Und das erschlägt sie wohl fast. Denn wieder wird die Stimme schrill: »Woher wissen Sie denn das? Überall, wo ich auftrete, hält man mich für eine gebürtige Mongolin.«
»Ach, Mädchen«, sage ich, »es gibt eben Dinge, die man in meinem Alter und in meiner Lage zu kennen hat. Du hast doch behauptet, du würdest mich ausreichend gut kennen. Wenn das stimmt, dann solltest du doch wissen, was ich noch alles kann.« Daraufhin halte ich inne und muss mir auf die Lippen beißen. Bin ich dabei, der Eitelkeit, der ich vorhin entgangen zu sein glaubte, doch noch zu erliegen?
Da aber meldet sich schon die Frau, die mit dem angekündigten Allerwichtigsten noch nicht herausgerückt ist: »Sie wollten bestreiten, dass Sie ein Millionär sind – gut, Ihre Sache, wenn Sie die Stellung, die in der heutigen Gesellschaft Ihnen zusteht, einer unzeitgemäßen Bescheidenheit opfern wollen, zumindest nach außen. Doch gewiss sind Sie sich Ihres Wertes bewusst. Langer Rede kurzer Sinn – in Zahlen ausgedrückt: Ich kann Ihnen dazu verhelfen, vom Millionär zu einem Milliardär aufzusteigen.«
Nicht, dass ich nach dem Milliardärdasein lechze, aber die Neugier, auf welchem Wege sie das erreichen will, verlockt mich. Also heuchle ich Interesse und rufe leise aus: »Sieh da.«
Sie eilt mir entgegen und legt los: »Sie könnten es schnell, sagen wir, innerhalb eines Sommers werden.«
»Wie denn das?«
»Ja, das ist die Frage. Die Antwort lautet: Sie brauchen mich.«
»Vielleicht wären wir der Wahrheit näher, wenn ich sage, du brauchst mich mehr als ich dich?«
Während ich solches ausspreche, komme ich mir absonderlich vor, etwa so, als wenn ich mir Mühe gebe, neuzeitiges Stadtmongolisch zu reden. Kaum habe ich die fertige, schartige Aussage auf den Weg geschickt, weiß ich: Ich habe mit einer Händlerin in der Sprache der Händler gesprochen. Beklemmend, wie leichthin das geht. Soll das heißen, in mir steckt auch ein Händler? Ganz bestimmt, so wie in jedem Menschen ein kleines, graues Teufelchen neben einer leuchtenden Zwerggottheit hockt.
Meine Gesprächspartnerin bewahrt aber Fassung und lässt sich nichts anmerken von den Scharten der Aussage, die soeben zu ihr hinüberflog. Ist sie eine von jenen berühmt-berüchtigten Händlernaturen des neuen Zeitalters? Kann sie, solange es um ihren Nutzen geht, das Feuer mucksmäuschenstill im Mund brennen und dabei den Rauch aus den Nasenlöchern hinaussprudeln lassen? Denn ihre Stimme klingt ruhig und sachlich, während sie auf meine unüberlegten, aus mir herausgebrochenen und hinübergeschleuderten Worte die Antwort herüberschickt: »Wollen wir nicht lieber sagen, dass wir beide einander brauchen? Denn im Geschäft redet man nicht gern von mehr und weniger, sondern von der Gegenseitigkeit. Sie sind mit dem, was Ihre Person darstellt, der goldene Schlüssel zu einer Schatzkammer. Um das Schloss aufschließen zu können, braucht es aber ein zweites Schlüsselchen, und dieses bin ich.«
Mich beeindruckt die Bildhaftigkeit ihrer Redeweise. Ein weiterer Grund, am Strang zu bleiben? Die Frage schürt die Glut der Unruhe, die ich seit ein paar Pulsschlägen in mir verspüre, und entfacht sie zu einem winzigen, aber deutlich erkennbaren Flämmchen. Unmutig darüber schüttle ich den Kopf und denke: Ach, was solls. Und da halte ich es schon für eine beschlossene Sache, dass ich aus dem zeitraubenden Spiel aussteige. So sage ich: »Tut mir leid. Ich mache da nicht mit.«
Natürlich will sie gleich wissen, warum das.
Keine Zeit, sage ich. Was muss ich aber darauf hören?
»Keine Zeit? Sie werden sie dafür machen.« Nicht etwa haben oder finden, sondern machen – ich würde mir Zeit machen, um mich ihrem Zeug anzupassen. So klar und einfach – eine Frechheit.
Es platzt aus mir heraus: »Wie kannst du dich erdreisten, Menschenskind, darüber bestimmen zu wollen, wie ich mit meiner Lebens- und Schaffenszeit verfahre?«
Noch unglaublicher, was ich darauf höre: »Weil mein Computer es mir als Endergebnis herausgespuckt hat.«
»Welcher Computer denn?«
»Na, das Hirnchen in meinem Birnchen, das Sie doch vorhin recht schmeichelhaft benotet haben.«
Ich bin sprachlos. Muss erst überlegen: Was habe ich vorhin gesagt? Sie weiß natürlich, sich sofort in diese von mir zugelassene Zeitlücke hineinzuschlängeln. Was nun kommt, ist eine längere Rede, und zwar durchaus mit einem bestimmten Gewicht. Denn ich fühle mich von Satz zu Satz unter einen immer größeren Druck geraten.
»Verfahren Sie mit mir nicht zu leichtfertig. Bilden Sie sich nicht ein, Sie könnten mich abschütteln, wann und wie es Ihnen beliebt«, fängt sie an und lässt ihrer Kehle ein leises Gelächter entsteigen, das mehr nach Groll als nach Heiterkeit klingt. »Denn ich bin nicht, wofür Sie mich zu halten scheinen, Ihrer recht zögerlichen Haltung nach zu urteilen. Dass ich Ihnen gleich eingangs gesagt habe, ich kenne Sie ausreichend gut, ist kein bisschen gelogen. Nein, ich bin, seit ich eine Studentin wurde – das ist gut zehn Jahre her –, den Spuren Ihres Lebens gefolgt. Ich habe die letzten gut fünfhundert Tage und Nächte mit Ihnen gelebt, da mit Entrüstung, hier mit Begeisterung, in Gedanken, mal selig, mal zornig, und in Träumen, meistens in helllichten, zwei-, dreimal auch in düsteren, die dennoch keine Albträume waren. Lassen Sie sich bitte sagen, dass ich meine Diplomarbeit über Ihre journalistisch-politischen Schriften geschrieben habe. Sie werden mich fragen, weshalb ich mich denn mit Ihnen beschäftige. Andere haben mir diese Frage auch gestellt. Meine Antwort darauf lautet in einem Wort: Karma. Denn ich bin schon vor Jahren zu dem Schluss gelangt, dass Sie und ich im Grunde eine und dieselbe Person in sozusagen zwei Ausführungen sind, einmal als Mann und dann als Frau. Gut, könnten Sie mir da kontern, das ließe sich bei jedem beliebig zusammengewürfelten Paar aus der Menschheitsfamilie sagen. Aber ich werde Ihnen anhand von Beispielen beweisen, dass wir als Gespann zusammenpassen, ich zu Ihnen und Sie zu mir, wie keine anderen Zweibeiner zu passen imstande sind …«
Sie spricht und spricht. Auch über recht Persönliches aus meinem Leben, das ihr von Belang zu sein scheint, Dinge, denen ich jedoch keinerlei Bedeutung beimesse. Zumindest es bis heute nicht getan habe. Ich hätte, während sie sprach, ein paar Male dazwischenfahren können, da sie Lücken zuließ. Einmal sogar, das war nach dem Wort Karma, kämpfte sie zwei, drei, vier Pulsschläge lang gegen einen Weinanfall, oder die Tränen waren schon da und liefen über ihre Wangen, als Hörer konnte man es nicht wissen. Nur, ich hatte weder Mut noch Kraft, irgendwelche sinnvollen Worte aus mir herauszubringen, denn ich war selber mitgenommen, ja, mir schmerzte es an der Nasenwurzel, und ich rang nach Atem.
Was kann ich denn Sinnvolles sagen? Am liebsten hätte ich sie weiterreden, meinetwegen noch eine Weile weiterspinnen lassen. Allein jetzt schweigt sie beharrlich und lässt mich damit wissen, sie hat sich ausgesprochen, und nun soll ich drankommen. So frage ich sie, ob sie mir wenigstens ein, zwei Stichworte nennen könne, worum es bei unserer möglichen Begegnung gehen würde.
»Kann ich noch nicht verraten.«
Aber ihre Stimme verrät dabei unverhohlene Wut. Ich muss ihr in Gedanken recht geben: Bin ich denn bekloppt, dass ich nach solchen Worten derartige Fragen stelle? Dennoch will ich mehr wissen über das, was da verhüllt ist. Nur weiß ich nicht, was genau. Also taste ich mich, vom Gedankennebel angezogen, mit den üblichen sanften und nichts aussagenden Worten an sie heran. Ihre Erwartung an unsere mögliche Begegnung, ihre Vorstellung von einer möglichen Zusammenarbeit … Oh, bin ich bekloppt, wahrlich. Zum Geschäftsmann eigne ich mich wohl ganz und gar nicht.
Da rettet sie mich, packt mich sozusagen am Nacken, reißt mich aus dem Nebel heraus und lässt mich ins klare, kalte Wasser der Wirklichkeit plumpsen. Denn sie sagt: »Sie wollen das Ergebnis im Voraus wissen. Kann ich auch genau nennen. Von dieser Reise werden Sie entweder mit dem Milliardenscheck in der Brusttasche oder mit dem nächsten Roman, fertig entworfen, in der Hirnschale zurückkehren.«
Ich bekomme einen Lachanfall. Das ist wohl ein natürlicher Gegenprall des menschlichen Körpers zur Selbstrettung, der sich in Gefahr sieht. Denn ich komme mir ertappt und entblößt vor, sosehr ich beteuern kann, dass berechnendes Reden wie Handeln meiner Überzeugung zuwider ist. Mir ist es peinlich. Wegen dieser Anwandlung, für die mir auch ein anderer Name einfällt: Affigkeit. Ich muss mich da irgendwie herausretten. Also sage ich, immer noch wacklig und wabbelig in der Kehle vom Lachen: »So einfach ist es.«
Sie spricht mir nach, dies aber mit einem Tonfall, der vollen Ernst erkennen lässt, und darüber vielleicht einen Hauch Traurigkeit: »Ja, so einfach ist es.«
Das Telefonat zieht sich noch eine Weile hin. Und da bin ich derjenige, der die Gesprächszügel in der Hand hält, was davon kommt, dass ich den Nachhall der Peinlichkeit immer noch in mir verspüre. Es geht nun lediglich um Belanglosigkeiten, mit der Ausnahme von einer Frage, die ich an sie richte und deren Antwort mich nur noch mehr verlegen macht, weil ich merke, sie gewinnt in meinem Bewusstsein allzu rasch an Raum und Gewicht. Ich frage nach der Versorgung am Ort und die Teilnehmer an möglichen Beratungen. Worauf ich zu hören bekomme: »Sie werden mein himmelhoher Gast und ich werde Ihre irdisch ergebene Dienerin sein, sooft uns gegeben sein wird, zusammenzukommen. Ich werde neben uns als zwei Ausführungen eines und desselben Wesens keinen Fremden dulden, gleich, wer dieser auch sein möge.«
Endlich lassen wir voneinander ab. Zuerst merke ich, dass mein ganzer Körper völlig nass geschwitzt ist. Dann muss ich meinem inneren Menschen, jenem unausstehlich pingeligen und rauen, aber auch untrüglich ehrlichen und wachen Kerl, gegenüber zugeben, wie durcheinander ich im Geist bin. Schon wird mir schwindlig im Schädel von einer Ahnung: Dieses Ferngespräch, eines der mühsamsten, da längsten, aber eines der aufregendsten, da rätselhaftesten, in meinem nicht gerade kurzen und geruhsamen Leben, wird Folgen haben.
Meine Frau, der das auffallend lange Telefonat vom anderen Ende des Grundstücks aus und nun die mit mir geschehene Veränderung unmöglich entgangen sein kann, kommt mir mit kleinen, abtastenden Fragen. Ich füttere sie mit ebenso kleinen, wohldosierten Antworten, die ihre Neugier nicht zu stillen vermögen, sondern, im Gegenteil mitzufüttern und weiterzuschüren scheinen. So wird die unbekannte Kasachin ab Stund und Tag zu einer unsichtbaren Mitbewohnerin des Lebensraums, der bisher uns allein zustand. Denn fast täglich taucht sie in unseren Gesprächen auf, wobei der züngelnde rote Faden ausschließlich in ihrem Mund zu liegen scheint. Und ich kann nicht anders, als dem herüberspringenden Zündfunken mal mit brennbaren Holzspänen, mal mit entflammbaren Ölspritzen entgegenzueilen.
Auch außerhalb der Zwiegespräche sind meine Gedanken fast stündlich mit ihr beschäftigt. Oft fürchte ich, auch die meiner armen Frau sind es. So ungeniert die Ärmste mit ihrer Fragerei mich auch anzugehen und ich ihr darauf ständig geduldig zu antworten weiß, bleiben die einfachsten und wichtigsten Worte unter uns doch unausgesprochen. Diese wären: Ob ich denn hinfahren solle? Der Grund, weshalb wir uns bislang um diese Frage herumdrücken, ist nur uns beiden bekannt – die langen Jahre der Ehe haben uns voreinander so weit geöffnet und miteinander so festgeknetet. Würde ich die Frage an sie stellen, sie würde darauf sofort ein »Nein« zur Antwort geben. Und würde sie von sich aus es mir verbieten wollen, ich würde, ohne mit den Wimpern zu zucken, sagen: »Doch, ich gehe hin.«
Denn unter uns schwelt, still und unauslöschlich, noch etwas fort aus den früheren Zeiten, die zwar verlebt hinter uns liegen, aber deren Spuren, wie eine nie erkaltende, weil gluthaltige Asche, imstande sind, auch nach vorne die verbliebenen Jahre anzusengen, ja, unter Umständen sie sogar in Flammen zu setzen, wie so manches Mal in den früheren Zeiten.
Mitten in einem Gespräch, das mühselig vor sich hinplätschert und ein wenig auch einem Verhör gleicht, frage ich sie, ob sie denn eifersüchtig sei.
»Nein doch, Alter«, sagt sie und schaut mich ein wenig verlegen an. Einen Wimpernschlag später fügt sie hinzu: »Was mich quält, ist die Angst.«
Ach, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Denn ihre Stimme und ihr Blick beweisen mir doppelt, dass das, was ich gerade eben gesehen und gehört, der Wahrheit so entsprechen muss, wie Eis und Schnee zwei andere Zustände des Wassers sind. Und noch etwas – jetzt weiß ich, dass auch ich Angst habe. Bis zu diesem Augenblick habe ich sie nur dumpf in mir gespürt, form- und namenlos, weil ohne den Mut, sie mir einzugestehen. Nun hat sie ihr einen Namen gegeben.
Doch ich bin nicht bereit, diese soeben gewonnene Wahrheit mit ihr zu teilen. So entscheide ich mich wissentlich für einen armseligen, dafür aber mündelsicheren Weg und kehre den unerschrockenen, angeberischen Mann heraus: »Wovor denn, mein Liebes? Ich werde doch in meinem größeren Zuhause sein, in der Sippenwelt, die auf mein Wohlsein zu achten hat, und umgeben dazu noch von den immer wachen zehntausend Schutzgeistern.«
Klar von vornherein, dass eine Frau, lange genug gewaschen vom Wasser des Lebens und rau genug geschliffen vom Salz der Ehe, auf einen derartig dicken Batzen nicht viel entgegnen mag. So geschieht es auch. Ich möchte gern froh sein darüber, denn damit wäre eines der unangenehmen Hindernisse im Alltag, den Denkträge und Sehblinde für grau halten, der in Wirklichkeit aber ständig kunterbunt ist, aus dem Wege geräumt. Doch ich vermag keine Fröhlichkeit in mir zu verspüren. Denn so genau weiß auch ich nicht, wo lang der Weg, der mich heute hierhergeführt, morgen verlaufen wird.
Je näher der Mai heranrückt, umso breiteren Raum nimmt und umso heftiger wälzt sich die Kasachin in mir. Ich versuche, mir ihre Statur vorzustellen. Helles, breites Gesicht? Grüne, schmale Augen? Braunes, dünnes Haar? Gedrungener, fülliger Körper? Diese Vermutung wächst als ein Durchschnitt aus der Quersumme der Kasachinnen, die ich kenne. Sie dürfte all jenen Poeten, die aus patriotisch-internationalistischer Pflicht wenigstens ein Gedicht auf irgendeine Kasachin verfasst haben, wie eine Zumutung vorkommen. Denn die in der mongolischen Poesie verewigte Kasachin ist selbstverständlich immer jung, wohl noch Jungfrau, und darüber hinaus ist sie schwarzäugig, schwarzhaarig, gertenschlank und bildhübsch und auch sonst durch und durch poetisch anmutend – sie singt und tanzt.
In Gedanken rufe ich ihre Worte zurück, treibe sie wieder und wieder durch das Sieb meines Urteilsvermögens, ziehe meine Schlüsse: Sie ist eindringlich … Ist unerschrocken … Ist von sich selbst überzeugt … Ist bestrebt nach persönlicher Nähe … Liebt kräftige Worte und bildhafte Ausdrücke … Hat keine Hemmung vor Über- und Untertreibung … Das sind alles Eigenschaften, die von anderen auch mir zugeschoben werden. Und dann noch: Sie scheint ehrlich zu sein … Scheint sich auf die Sache, die sie macht, voller Hingabe zu stürzen … Das sind übrigens Eigenschaften, die ich von mir selber zu behaupten durchaus bereit wäre.
Soll das alles bedeuten: Was sie von den zwei Ausführungen eines und desselben menschlichen Wesens erzählte, sei kein bloßes Hirngespinst?
Und schließlich: Der Millionär, der ich sein sollte, kann unmöglich der Grund gewesen sein, weshalb sie gerade mich hat anpeilen wollen. Dann doch der »Weise«, von dem sie sprach, im Sinne eines spirituellen Lehrers? Die Begüterten und Bemächtigten, ob der Staatspräsident oder der Parlamentsabgeordnete, ob die Popfürstin oder der Sumo-Yokozuna – ein jeder Leuchtstern am Himmel über der zeitgenössischen mongolischen Gesellschaft soll einen eigenen Schutzgeist halten, wie man es mittlerweile weiß, dank der rotgelbbunten Klatschküche, deren unsichtbare Gebieter und verbissene Betreiber und stillschweigende Verbraucher in einem eben dieselben Günstlinge der Stunde sind.
Inmitten solcher Überlegungen verfange ich mich hin und wieder in Einzelmaschen der Erinnerung, gleite aus und plumpse in einen Hohlraum hinein, der sich alsbald in eine zwickende Falle verwandelt, in der ich am Ende peinlich berührt und kläglich beschämt zurückbleibe, minutenlang dasitze oder liege, atemlos und schwitzend, nicht viel anders als ein tölpelhafter, aber immerhin unschuldiger Jungknabe. Da bereitet mir vor allem der letzte Wortschwall aus ihrer Kehle, der Batzen mit dem himmelhohen Gast, erhebliches Unbehagen. Nun wundere ich mich, warum ich denn alles stillschweigend hingenommen habe, ohne wenigstens eine aufklärende Frage dazu beizusteuern. Und jammere, angewidert von mir selbst, das junge, hexenschlaue Weib habe sich da ins Fäustchen gelacht, belustigt über die Eitelkeit des ollen, doofen Kerls, der ein so übertriebenes Lob einfach hat stehen lassen, o Himmel. Sosehr ich mich in der eigenen Schande suhle und entsetzt über meine Blödheit vor mich hin starre, glaube ich am Ende doch: Das Alterchen in mir, das längst wieder auf das Kind zuschlittert, als das doch ein jeder endet, muss ich vor mir selbst in Schutz nehmen. Ich denke laut und sage leise: Ach was, Mann. Kein Menschenkind vermag in diesem Leben voller Lücken und Tücken alles richtig zu bewerkstelligen. Es ist nun einmal geschehen, und nächstes Mal werden wir einfach besser aufpassen.
Der Aufbruch, der Wunden aufreißt
Ein immer noch winterlich kühler, staubtrockener und steingrauer Mai bricht heran, und an dessen zweitem Tag, einem polternd ungemütlichen Samstag, verlasse ich mein Zuhause in der Würgenähe der auseinanderkrachenden Hauptstadt. Da fühle ich mich unwohl wie ein dreifacher Verräter: vor der besorgten eigenen Frau, vor einer Herde pflegebedürftiger Sämlinge und Setzlinge vom Vorjahr und vor dem werdenden und wachsenden Romankind, gerade im Flegelalter und daher wohl das Hinfälligste von allen Wesen, die meiner bedürfen. Doch trete ich die Reise an, keinen Augenblick daran denkend, sie zu verschieben, geschweige denn darauf zu verzichten. Denn lange genug habe ich tags daran gedacht und nachts davon geträumt, endlich wieder in meinem anderen, wahreren Zuhause anzukommen und dort mich einer anderen, wichtigeren Aufgabe meines befristeten irdischen Lebens zu stellen.
Das ist zunächst unabhängig von dem Anruf, möchte ich dich aufklären, lieber Leser, lichte Leserin. Nein, nein. Die Gründe reichen weiter, tiefer. Der Urgrund wäre, dass wir Menschen vom Schöpfer als sterbliche Wesen erschaffen worden sind. Aber da es niemandem auf Gottes Erde gegeben, sich dagegen aufzulehnen, wage auch ich nicht, ganz so weit zu gehen. Dafür darf ich, ja, muss ich wohl die Fühler meines Geistes und meiner Seele wenigstens bis dorthin ausstrecken, wo die augenblickliche Gestalt des von mir bewohnten Wesens ihren Anfang hat. Vor siebzig Jahren gab der Himmel meinen Eltern Zwillinge, zwei Jungen, nahm sie aber nach nur zehn Tagen Erdenleben wieder zurück. Mein Vater trug die entschlafenen, erkalteten Körperchen im Brustlatz seines Gewandes aus Schaffell zur Steppe des Saryg Höl, des Gelben Sees, hinaus und legte sie nebeneinander in eine lammpansengroße Grube, die er teils mit bloßen Fingern beider Hände, teils mit seinem Dolch aushob, deckte sie mit der sandig steinigen Erde wieder zu und beschwor, während er vor dem Grabhügelchen kniete und dabei sich dreimal verneigte:
Budannyg hün dshordugar, ürennerim
Bujannyg hün dshanyp gelgileger
Am heutigen düsteren Tag uns entgangen, Kinderchen
Möget ihr, bitte, an einem lichten Tag wiederkehren
Tatsächlich, sie kehrten recht bald, das heißt nach kaum zwei Jahren zurück. Doch diesmal in einer Gestalt, und dazu noch, wie die Schamanin Pürwü, damals noch jung und ohne den Beinamen Ulug, die Große, vorauszusagen gewusst, mit den Freuden und Sorgen zweier. Das war ich. Nachdem dieses verwandelte Wesen etwa zehn Jahre lang gediehen, trug der Vater einen weiteren Sohn in die Saryg-Höl-Steppe hinaus. Diesmal handelte es sich um den Ältesten, gerade erst zweiundzwanzig geworden, und so war jener erkaltete Körper schwer und füllte den ganzen Sattelsitz. Derselbe Vater, der drei Söhne vorweggetragen, kam vor dreiunddreißig Jahren selber dorthin. Siebzehn Jahre später folgte ihm seine Frau, die Mutter von den drei Enteilten. Und davor, dazwischen und danach kamen weitere Verwandte in dieselbe Steppe, auf dieselbe Stelle. Ein end- und ruheloser Abgang im Gegenverkehr zu der end- und ruhelosen Ankunft im selben Bett des Flusses Leben und Sterben.
Der Friedhof, der eigentlich unsere ganze Erde ist. Dieser kleine, besondere Fleck, der Steppenfriedhof. Ungepflegt und verwahrlost ist er. In den Augen Fremder muss er wie eine blutende und eiternde Wunde am Leib der Erdmutter, wie ein Dorn verweigerter Liebe und fehlender Achtung zur eigenen Vergangenheit, zu den eigenen Vergangenen aussehen und sich anfühlen. Wie alle Friedhöfe im Nomadenland. Diese Einschätzung kommt wohl daher, dass ich andere Länder gesehen und mich mit der Haltung ihrer Menschen zur eigenen Vergangenheit vertraut gemacht habe. Also habe ich mir Gedanken gemacht darüber, wie wir von anderen ein wenig lernen und einen Schandfleck beseitigen könnten, um der uns ohnehin angedichteten Rohheit wenigstens eine Scharte abzuwetzen. Bis ich mich eines Tages so weit wähnte, diesem eigenen Gebrechen ans Fell zu rücken. Ich beschloss, den vielfach verwundeten, jammergrauen Steppenboden mit den Leibern unserer Vergangenen zu hegen und zu pflegen, zu begrünen und zu bewalden. Was einer der Hauptgründe meines Vorhabens zur Aufforstung des mit einem dreifachen ka belasteten: kalten, kahlen und kargen Landes war – einer Unternehmung, die jeden, der davon hört, sofort nach Unvernunft und Größenwahn anmutet, zugegeben.
Schließlich folgte vor neun Monaten, mich geschwisterseelenallein lassend, der letzte Bruder den Eltern und allen anderen, die in den Steppenboden versunken waren. Noch wenige Wochen davor haben wir beide drei Tage und Nächte zusammen verbracht, über alles Mögliche redend und dabei er wie ich wissend, dies war unser letztes Zusammensein. Damals erzählte ich ihm unter anderem von meinem Vorhaben, die Begrünung und Bewaldung unseres Altai mit der Liegestätte der Eltern und aller, die sie umgeben, zu beginnen. Und was hörte und sah ich da? »Ist das wahr?«, rief er aus, während er eine Gebärde machte, als wollte er sich dem Lager entreißen, und ließ im nächsten Augenblick glitzernd helle Tränen über seine gütigen, von leiblichem Schmerzen und seelischer Spannung gezeichneten Wangen rinnen.
Nach einem derartigen Versprechen – wäre es nicht am einfachsten, gänzlich in die Heimatecke überzusiedeln, für so lange zumindest, bis der abgeschundenen, leichenblassen Steppenerde mit ihrem schier überfrachteten Unterleib eine solche Pflege zuteilgeworden wäre, dass aus ihr nicht mehr die Gebeine Toter hervorbrechen wie platzende Eiterklumpen?
Ja, diese Möglichkeit gibt es, und ich habe sie längst und mehrfach erwogen. Bin dann zu dem Schluss gekommen: Vorerst gibt es für mich keine Nebenaufgaben. Es sind alles Hauptaufgaben, deren Stränge ich in den Händen halte und daran drehe und ziehe. Oder so: Alle sind sie Teile der Aufgabe meines vom Himmel vorbestimmten Lebens. Und bei der Auswertung jener Aufgabe, wenn die Frist abläuft, wird letzten Endes die Quersumme entscheiden.
Dann dieser Anruf. Er ist mir lediglich ein Peitschenhieb gewesen, hat mich vorzeitig angetrieben. So bin ich, der erst Ende Mai auf den Altai zugehen wollte, schon Anfang des Monats auf dem Weg dorthin. Und je länger ich den Zwischenfall mit einer solchen Folge abwäge, desto bedeutsamer erscheint er mir. Auf jeden Fall wird der Himmel dahinter stehen und darüber auch wachen. Eine neue Prüfung, vielleicht? Oder eine Beihilfe? Wie auch immer, ein Rätsel, das ich lösen muss, und dann darf ich entscheiden darüber, wie ich verfahre.
Das Flugzeug ist rappelvoll. Die Kasachin ist nicht mit dabei. Das glaube ich sicher zu wissen. Denn die wenigen Frauen sind entweder zu alt oder zu jung, und überhaupt, aus keinem ihrer Gesichter heraus brennt der Blick einer Geschäftsfrau. Dafür gibt es viele Geschäftsmänner aller Altersstufen, deren kalt flackernde Blicke vom Fieber jener Mischung aus Sorge und Hochmut gezeichnet sind. Ein paar Europäer, ebenso Araber und ein satter, lärmender Schwarm von Chinesen sind darunter.
Auf dem Bezirksflughafen schnappe ich mir ein Taxi und fahre gleich weiter, ohne den Boden der Stadt, in der ich die Jahre meiner frühen Jugend verlebt habe und dem ersten Batzen Weltschmerz begegnet bin, berührt und die Luft darüber geschnuppert zu haben. Denn diesmal erst recht will ich keinem Menschen aus dieser Provinzwelt begegnen, die mir nicht viel anders vorkommt als ein Hybridzwitter, sollte es so etwas überhaupt geben. Gegenüber meiner einstigen Wohnstätte und ihren Bewohnern bin ich zurückhaltend, seit ich gemerkt und daraufhin immer wieder bestätigt bekommen, welcher Geist und welche Seele dort herrschen: ein Weder-noch-Unding – nicht städtisch gepflegt, nicht ländlich unschuldig und dazu längst von allen Lastern der Stadt angesteckt und jeder Tugend des Landes verlustig.
Es ist ein sonniger und windiger Tag, wobei die Sonne eine kosende und schmusende und der Wind ein scheuernder und schrappender ist. Die Höhensteppe erscheint auf den ersten Blick noch gar nichts vom Frühling verraten zu wollen. Aber ein weiterer, bohrender Blick, vor allem mit dem Riechsinn gepaart, entdeckt jede Menge Anzeichen, dass dem berüchtigt harten Winter – dem härtesten seit dreißig Jahren – das Kreuz doch gebrochen ist und der herbeigesehnte Sommer endlich bevorsteht, gleich, wie kurz und launisch er auch ausfallen mag, dass er unterwegs ist selbst zu diesem grauenhaft rauen, dennoch traumhaft anmutigen Winkel auf der Erdkugel. Zu diesem bestärkenden Schluss komme ich, als unser Gehäuse, das sich brüllend und dampfend voranmüht, zum ersten Mal stehen bleibt und der Fahrer daran etwas zu flicken hat. Da verlasse ich es, gehe von dem stinkenden Abwind ein paar Schritte weg und sinke auf die Knie, betört von der Höhenluft. Es ist ein strudelnder und wirbelnder Sturm von Düften, bestehend aus knospendem Wermut, keimenden Fahnenwicken, äugenden und fingernden Feuer- und Salzkräutern und Dutzenden anderer Pflanzen, die aus den Poren der Steppenerde, oft unscheinbar, hervorsprießen.
Der Fahrer ist ein älterer Kasache, ein Mann mit klarem Verstand und feinem Gemüt, wie er mir schon nach einem kurzen Wortwechsel erscheinen will. Wir verbringen die drei Fahrstunden bis zur Kreissiedlung angenehm und nützlich, vertieft in eine ungezwungene, aber ununterbrochene Unterhaltung. Wir tauschen die Neuigkeiten von den Teilwelten, die wir jeweils bewohnen, und hören uns die Meinung des anderen über die heutige Zeit und das Leben an. Dabei stimmen wir in einem überein: Wir leben in einer merkwürdigen Zeit. Aber dann gehen unsere Meinungen auseinander. Er findet sie furchtbar, und darum wohl ist er mit seinen erst vierundsechzig Jahren lebensmüde geworden. So spricht er von sich als einem alten Mann, und meint, er würde bald sterben. Als ich ihm sage, dass die merkwürdige Zeit doch gerade deswegen spannend sei, meint er, ich hätte wohl viel Geld, wenn ich solches zu behaupten wagte.
Ich frage ihn, wieso das mit Geld zu tun habe. Da legt er mir in wenigen Worten sein Leben vor: eine Frau, seit fast dreißig Jahren krank und seit gut zwanzig Jahren im Rollstuhl, acht Kinder, zumeist arbeitslos, verbrauchswütig aber und dabei wählerisch, zwanzig, dreißig Enkelkinder; er selber in Vorzeiten ein ehrlicher Kommunist, darum kein Vermögen angehäuft, dennoch bis auf den heutigen Tag in der Partei geblieben und dies aus Achtung vor der Vergangenheit, auch seiner eigenen.
Als ich ihm von meinem Vorhaben, den Altai wieder aufzuforsten, erzähle, schüttelt er zuerst heftig den Kopf und bemerkt später, entweder sei ich verrückt geworden oder müsse nicht nur mit Geld, sondern auch mit Gaben überschüttet worden sein, über die gewöhnliche Sterbliche nicht verfügten. Und dies sagt er leise, wohl zu sich selbst. Nun nickt er, ebenso leise, vor sich hin. Als er dann noch das mit meinem letzten Bruder und dem Steppenfriedhof erfährt, streckt er mir, hurtig und wortlos, seine Rechte entgegen, begleitet mit einem Blick, in dem ich Achtung, Dankbarkeit, so auch Schmerz und Trauer zu erkennen glaube. Ich fange seine Hand sogleich auf und drücke sie beidhändig fest und lange. Es ist eine wahre Arbeiterhand, knorrig und schwielig, dabei aber auch trocken und warm.
Nun sind wir beim Tod gelandet. Er wünscht sich ein schmerzarmes, schnelles Sterben. Dann ein stilles Begräbnis.
»Ein stilles Begräbnis«, sage ich ihm nach. »Wird das bei den vielen Kindern und Enkelkindern, überhaupt bei einem kasachischen Menschen je möglich sein?«
»Nein.« Das sagt er mit Nachdruck. Und dann fügt er leise hinzu: »Darum dieser unerfüllbare Wunsch, wie alle anderen wesentlichen Wünsche in unserem Leben auch.«
»Warum denn? Warum so ein Wunsch, von dem man von vornherein weiß, er ist unerfüllbar, zu einer so wichtigen Stunde, Mann?«
»Weil die Begräbnisfeier die Hinterbliebenen teuer zu stehen kommt.«
»Ach. Deswegen also. Aber wenn das Parlament morgen ein Gesetz herausgäbe, ab nun übernimmt alle Ausgaben einer jeden Begräbnisfeier für die eigenen Bürger der mongolische Staat?«
»Das wird der Staat, dieser mongolische Staat, ganz bestimmt nicht tun.«
»Aber lass uns doch einmal spinnen. Es kostet uns nichts. Wenn dieser Staat mit dem Hirn eines Spatzen und mit der Seele eines Räubers es irgendwann doch täte?«
»Ich danke Ihnen für die soeben ausgesprochenen, nicht gerade ungefährlichen Worte. Denn was würde geschehen, wenn ich ein Stasispitzel wäre? Zum Glück bin ich es nicht. Aber passen Sie auf: Es wimmelt schon wieder von Spitzeln aller Art. Es ist wirklich ein schafdummer, wolfsgieriger Staat. Ist längst dabei, die Mongolei auszuverkaufen.«
»Genau! Der mongolische Staat hat Geld.«
»Aber nicht für uns, das Volk.«
»Angeblich doch. Er hat doch einem jeden seiner zwei Millionen und siebenhunderttausend Bürger Anteile am Gewinn der demnächst zu erbeutenden Bodenschätze versprochen, oder?«
Der Fahrer winkt ärgerlich ab. Schweigt eine Weile, schaltet um, gibt Gas und spricht endlich: »Ja, das ist ein ganz gemeiner Betrug gewesen, den der Staat am eigenen Volk verübt hat, und eine offene Bestechung, der die berühmt-berüchtigten Massen von zweibeinigem Ungeziefer erlegen sind. Wissen Sie, was ich, grauhaariger Mann mit einem ganzen Jahrsechzig Lebenserfahrung, tat, nachdem der Anführer meiner Partei und meines Staates feierlich bekannt gegeben hat, pro Kopf der Bevölkerung anderthalb Millionen Tugrik vom Erlös der Bodenschätze zuzuteilen? Rief die Sippe zusammen und nahm eine schnelle, aber greif- und tastechte Volkszählung vor – wir waren siebenundsechzig Münder. Dies mal 1,5 Millionen, die Jugend rechnete es auf der Stelle mehrmals aus. Und herausgesprungen kam die schwindelerregende Zahl: Einhundert Millionen und dann auch noch fünfhunderttausend Tugrik sollte ich mit meiner Sippe bekommen, meine Güte, ich war, wir waren mit einem Schlag zu Millionären geworden. Was tat ich Esel daraufhin noch? Ordnete der wahlberechtigten Hälfte, das waren immerhin genau fünfzig Menschen, an: am Wahltag früh aufzustehen, sich feierlich zu bekleiden, möglichst geschlossen zum Wahllokal zu gehen und ihre Stimmen unserer lang vertrauten Mongolischen Revolutionären Volkspartei zu geben. Und dem noch nicht wahlberechtigten Rest, gut zu lernen und sich zu anständigen Bürgern herauszumausern, bereit, dem Staat mit der Treue eines Hundes und mit der Ausdauer eines Pferdes zu dienen.«
»Vielleicht werden die Machthaber ihr Versprechen doch noch einlösen – wenn auch nicht zu unseren Lebzeiten, so doch sobald wir aufgehört haben, auf Vater Staates Rentenkessel zu schielen? Lass es uns doch mal einfach so annehmen.«
»Die werden es nicht tun. Nachdem die da oben es fertiggebracht haben, das kümmerliche Kindergeld, die öffentliche Bestechung von den vorangegangenen Wahlen, gänzlich zu streichen, sich selbst dagegen milliardenschwere Taschengelder zu genehmigen, wären wir hier unten im Volk schon heilfroh, wenn ein Renten- und Leichensteuergesetz ausbleibt.«
»Wenn ein saudi-arabischer Ölmilliardär – vorhin saßen im Flugzeug einige Araber, diese wohlgepolsterten Schüler Allahs, wie sie euch seit Jahr und Tag wöchentlich aufsuchen – wenn also unter ihnen irgendwann einer verspräche, ab nun alle Bestattungsausgaben aller seiner Glaubensgeschwister in dieser kargen Weltecke zu übernehmen – was dann?«
»Die werden den Betrag nicht den Toten, lieber den Lebenden, und zwar jungen Hitzköpfen oder noch eher den Bonzen geben, die ihnen die Volksseele versprechen und auch imstande sind, sie zu vergiften und schließlich auch zu verkaufen.«
»Mann, du bist ja ein echter Spielverderber. Ein ganz zäher. Du hast mich vorhin für verrückt gehalten. Wenn also dieser Verrückte dir verspricht, einfach weil ihm die heutige Bekanntschaft mit dir die Seele wärmt und auch da du vorhast, bald zu sterben, und schließlich weil wir uns nun schon die längste Zeit über deine Bestattung unterhalten, wenn er dir also verspricht, alle Kosten zu übernehmen – was nun?«
Er schaut mich zuerst verdutzt an. Dann erhellt sich sein ernstes, mächtiges Gesicht, das an eine altersgraue Lärche erinnert, und bekommt langsam einen verschmitzten Ausdruck. »O ja. In dem Falle wünschte ich mir natürlich, wie jeder Sippenanführer, ein standesgemäßes Leichenbegängnis unter strömenden Tränen von sieben mal sieben Klageweibern, die ihre Gesichter wund kratzen, ihre Köpfe kahl rupfen und ihre Kehlen heiser schreien, und noch mehr Männer, die mir meine Vorzüge und Verdienste nachrühmen. Dazu Bäche von fließendem, schäumendem Tierblut, Hügel von gekochtem, dampfendem Tierfleisch, kugelrund gesättigte Leichenschmausgäste und zu gutem Schluss eine Grabstätte, geziemend groß und umfriedet von einer weiß bekalkten, reiterhohen Mauer.«
Ich schaue meinen Reisegefährten von der Seite forschend an und versuche zu ergründen, was der nicht gerade schickliche, scherzhafte Ton bedeuten könnte und welches Gewicht dem darin versteckten, ernsten Kern zustehen könnte. Was man im Herzen trägt, das hüpft einem aus dem Mund, folgere ich schließlich und frage: »Und dann?«
»In die Geschichte eingegangen. Verewigt. Und fertig.«
»Keine Wiederkehr?«
»Nein. Ein Moslem, dazu noch ein kommunistischer, wird doch nicht wiedergeboren.«
Das war nicht das, was ich gern gehört hätte. Aber was solls. Nicht nur jeder Religion, auch jedem Menschen steht es schließlich frei, an gewisse Dinge zu glauben oder nicht. Und missionieren ist meine Sache wirklich nicht. So verschlucke ich manche Worte, die mir schon auf die Zunge steigen wollten, und übe mich eine Weile im Schweigen. Dabei hört aber mein auf einmal erwachtes Hirn nicht auf, weitere Gedanken abzusondern. Und diese verlaufen etwa folgendermaßen: Dem Glauben in einem Menschen folgt wohl die entsprechende Tat – wer an die Unlöschbarkeit seines Geistes und die Unsterblichkeit seiner Seele glaubt, der wird wiedergeboren. Wer dagegen an einen abschließenden Tod glaubt, der stirbt in der Tat endgültig und bleibt spurlos weg. Halb bedauernd, halb schadenfroh schaue ich auf den Menschen, der vielleicht tatsächlich recht bald aus dem Leben gehen und dann auf Gottes Erde nie wieder zurückkehren würde. Dabei reizt es mich, ihn an einer anderen wunden Stelle anzupacken. Ich frage ihn: »Du bist ein gestandener Mann, durchaus mit eigenem Urteilsvermögen im Kopf, wie ich sehe. Aber wie kommt es, dass du nach all den Zusammenbrüchen, weltweit wie auch um dich herum, immer noch an der kommunistischen Gesinnung hängst?«
Er antwortet nicht gleich. Hängt beidhändig am Steuerrad. Lenkt schwerfällig den alterswackligen russischen Jeep, ein Vehikel, genauso fragwürdig geworden wie seine Gesinnung. Kämpft angestrengt gegen die Unebenheit der steinigen, staubigen Steppenerde. Bringt uns mühselig vorwärts, hüpft von einem Schlagloch zum nächsten, mit Gepolter und Gequietsche. Dabei ist er mit einem Mal tatsächlich der alte Mann geworden, an dessen Bildnis er anfangs gegen mein Schmunzeln gewerkelt hat. Während ich vergeblich auf seine Antwort warte, erwacht in mir der Zweifel, ob er das, was ich zuletzt gesagt, überhaupt gehört, es als eine Frage verstanden hat. Oder … oder …, drückt mir ein unguter Gedanke auf den Bauch: Hab ich ihn mit meiner Frage etwa zu derb an seiner wunden Stelle angefasst und ihn beleidigt? O möge das nicht der Fall gewesen sein. Das täte mir leid. Denn der kleine Friede, den wir Menschen im Alltag zu bewahren und zu pflegen haben, ist mir, der ich die erste Hälfte meiner bisherigen Lebenszeit mit Fehden und Feindschaften habe verbringen müssen, mittlerweile zu einer wahren Überzeugung geworden.
Verlegen schaue ich geradeaus, den Blick verstrickt in den schwebenden Teppich aus Luftkringeln, die den Himmel füllen und, je höher sie aufsteigen, zu umso feineren Musterungen zusammenfließen. Dabei kommt es mir zwischendurch so vor, als schauten mich aus den einzelnen Kringeln Augen an, und da glaube ich, in den größeren Musterungen Gesichter zu erkennen. Das sind die Vergangenen, denke ich. Vater und Mutter und die Brüder. Und die vielen anderen. Sie sind erschienen, um mich zu empfangen. Sie wissen, dass ich komme. Wissen, dass ich ihnen zu Diensten stehen möchte, ihnen allen nach meinen begrenzten, menschlichen Möglichkeiten dienen werde …
Da aber spricht der Fahrer, was mir zuerst einen kleinen Schreck einjagt. Dann denke ich doch erfreut: Endlich.
»Wieso ich noch immer in der Partei geblieben bin? Und mich weiterhin einen Kommunisten nenne? Das fragen mich alle, die es mit mir gut meinen. Meine arme Frau, seit Hunderten und Tausenden von Tagen und Nächten ans Bett gefesselt, von Allah oder vom Schaitan, ich weiß es nicht, aber von einer Übermacht, hat mich unter strömenden Tränen angefleht, ich solle den Blödsinn endlich sein lassen. Meine Kinder. Die spötteln allerdings nur, da sie es für Alterssturheit halten. Und schließlich, ich selber. Hab mich zahllose Male gefragt, warum ich denn an etwas klebe, das andere doch längst aufgegeben haben, nicht nur einfach aufgegeben, sondern wie einen Stein, mit dem der Hintern abgewischt worden ist, gnadenlos und voller Ekel weggeworfen. Doch die Antwort, die herauskommt, ist immer dieselbe: Man kann alles wechseln, selbst das Obdach, das Bett und das Weib, aber die Gesinnung doch nicht. Man kann sie jedoch verraten. So wie die Bonzen zuerst und daraufhin die Mitläufer es getan haben. Ich komme mir einfach zu schade vor, mich zu einem Verräter abzuwerten, wegen bisschen materieller Vorteile. Wieso muss ich meine Seele verkaufen und mich vor mir selbst zu einem armseligen Speichellecker erniedrigen, wo ich doch weiß, ich kann mich und alle, die meines Schutzes bedürfen, weiterhin auch so von meiner ehrlichen Arbeit ernähren? Dann fühle ich mich Marx, Lenin, Süchbaatar und Abermillionen toter Genossen verpflichtet – andere mögen sie über den Tod hinweg verraten haben, doch ich bringe es nicht fertig, es jenen Verrätern und Betrügern gleichzutun. Trotz aller Schwernisse des Lebens um mich herum spüre ich in mir doch einen gewissen Stolz über mein unbeschädigt erhaltenes Gewissen, mein Ehr- und Schamgefühl. Und es wird wieder und wieder angeschürt vom Ekel angesichts der Niedrigkeiten derer, die sich erst vor Kurzem als die Rötesten in unseren Reihen aufgespielt haben, nun aber zu den Schwärzesten unter den Aasgeiern und den Kotschakalen herabgesunken sind. Schließlich kann und will ich nicht glauben, dass der Kapitalismus mit seinem Wolfsgesicht und seinem Affenhintern, wie er seit zwei Jahrzehnten nun auch unser Land verwüstet, die Endlösung für die menschliche Gesellschaft sein sollte.«
Ist das ein Dickschädel, denke ich, getroffen von dem Gewicht seiner Worte, deren Nachhall mich immer noch anzuwehen scheint. Wie die Kehrseite des Selbstporträts auch aussehen mag, welch ein Charakter! Dieses überwältigende Gefühl macht mich unsicher. Was soll ich von seiner in Scherz gehüllten Antwort auf mein ebenso scherzhaftes, dabei auch reichlich angeberisches Begräbnisangebot halten? Habe ich denn überhaupt den Sinn in seinen Worten richtig erfasst?
So bin ich versucht, schmeichelhafte Worte an ihn zu richten. Nur, er scheint darauf nicht eingehen zu wollen. Denn er sagt, dass wir nun genug über ihn geredet hätten. Nun sei ich dran.
»Nanu«, sage ich, ein wenig überrascht. »Wie soll das gehen?«
Er sagt: »Ich werde die Fragen stellen.«
»Bitte.«
Er fragt, wie alt ich bin.
»Sechsundsechzig.«
Er tut überrascht, schaut für einen guten Pulsschlag auf mich, nickt bedächtig mit dem Kopf und sagt schließlich: »Dann sind Sie auch vom Alter her berechtigt, mich zu duzen.«
Weitere Fragen folgen: Was ich arbeite? Wo und wie ich wohne? Wie viele Kinder und Enkelkinder ich habe? Was meine Frau macht und welcher Nationalität sie angehört? Ob ich ein Auto habe, was das für eines ist und ob ich es selber fahre oder es von einem anderen fahren lasse? Woher ich das Geld habe? Und warum ich es für Dinge ausgeben will, die mich ja eigentlich wenig angehen? Ob es mir der Staat anerkennt? Wie und wo ich bestattet werden möchte? An welchen Gott und ob ich an die Wiedergeburt glaube?
Ich antworte auf alle Fragen treuherzig. Und ich sage hier unter uns, ebenso treuherzig, dass ich, der eigenen Erzählung zuhörend, durchaus geneigt bin, den Kerl, der ich sein soll, erträglich zu finden.
Nachdem der Mann, den ich seit kaum drei Stunden kenne, mir auf diese Weise Löcher in den Bauch gefragt hat, schweigt er eine Weile und bleibt dabei in stiller, aber gespannter Überlegung. Dann stellt er eine weitere Frage, die letzte, denn da kommen wir schon an: Ob ich wüsste, was Klon oder klonen sei. Er habe neulich im Fernsehen einen Bericht über das in England geklonte Schaf Dolly gesehen und dabei auch gehört, dass der unselige Saddam Hussein die Wissenschaftler seines Landes beauftragt hat, abzuklären, ob die Möglichkeit bestehe, sich selbst klonen zu lassen. Seine Erzählung schließt er mit dem Satz ab: »Die Wissenschaftler dieser Welt sollten versuchen, solche wie Sie zu klonen.«
Mir bleibt keine Zeit, dies mit einem freundlichen Gelächter zu quittieren. Wir sind angekommen. Ich sehe durch die Spalten des Holzzauns im Hof zwei Enkelkinder meines Bruders und erkenne im Hintergrund meine Schwägerin, die leicht hinkend ein paar Zicklein vor sich hertreibt. Ich sage dem Gesprächspartner, wo wir sind. Sein Gesicht nimmt einen ernsten Ausdruck an.
Klar, dass der Fahrer mit aussteigt, reingeht, beköstigt wird und sich ausruht, ehe er sein Geld bekommt und zurückfährt – vielleicht findet sich auch jemand, der in die Stadt muss? Das Anwesen meines Bruders ist in jedem Fall auch mein Zuhause, also ist er nach diesen ergiebigen Lebensstunden, in denen zwei altersgraue Männer sich gegenseitig ihre Innenräume umgekrempelt haben, mein Gast. Das wissen wir beide, er kommt mit.
Oh, wie schwer ist der Augenblick, Himmel. Es pikt mir in den Knien, schmerzt in der Nasenwurzel und flimmert vor den Augen, während ich die vertrauten Schwellen betrete und bekannten Wege gehe. Wir sind in der Hütte, und ich nehme an dem niedrigen Tisch oben im Dörr Platz, und der Fahrer setzt sich mir zur rechten Hand, einen Schritt weiter unten, gemäß der nomadischen Empfindung von Rangordnung. Selber kämpfend gegen die Hitze in den Augenhöhlen und den Krampf im Hals, der sich auf das ganze Gesicht auszubreiten droht, nehme ich zur linken Hand, zwei Schritte weiter unten, die Gestalt der Schwägerin verschwommen wahr. Bisher ist es immer so gewesen, dass bei jedem Wiedersehen auf kurz oder lang ich auf sie zuging und sie zuerst begrüßte, woraufhin sie den Gruß erwiderte, indem sie als Dshenggej mich an beiden Backen beroch. Hier und heute aber halte ich Abstand, bleibe sitzen und suche betont bedächtig in meinem Brustlatz nach der Schnupftabakflasche, wartend darauf, dass auch sie sich hinsetzt und ihre Flasche zur Hand nimmt.
Die wohlbekannte Geschichte: Sie sucht danach, wird ihrer aber nicht fündig. Also muss sie durch Zurufen die Enkelkinder fragen, wohin diese denn ihre Flasche mit dem Beutel, der doch heute Morgen noch unter dem Kopfkissen lag, wieder weggetan hätten. So ist es bei meiner Mutter immer gewesen. So auch bei fast allen anderen Tuwafrauen. Das kleine Suchverfahren erleichtert den Druck, erheitert ein klein wenig das Gemüt. Das quecksilbrige Mädelchen Dshymdshak eilt herbei und holt die gesuchte Kostbarkeit mit einem Griff ganz woanders hervor. Und was macht die Großmutter? Anstatt sich bei der flinken Enkelin zu bedanken, will sie ihr eine kleine Mahnrede erteilen: Nicht immer an Sachen rangehen, die sie nichts angehen, und sie dann verlegen! Und weil solches immer wieder vorkomme, habe sie heute früh die Flasche absichtlich unters Kopfkissen gesteckt.
Da plappert die Kleine keck: »Aber Oma. Später habt Ihr sie doch selber in der Hand gehabt und benutzt, als der Onkel Dshapai vorbeikam.«
Jetzt hält die Alte für kurz inne und lässt darauf leise hören: »So? Dann war ich es wieder selber, die es vermasselt hat. Oh, wenn ich nur wüsste, wo mein Kopf steht.«
Endlich kann ich den rechten Arm, gestützt mit der linken Hand unter dem Ellbogen, ausstrecken, ihr so meine Schnupftabakflasche anbieten und dabei meinen Gruß aussprechen. Er ist wohlüberlegt, ist knapp und trocken: »Verbringt Ihr, Dshenggej, ein gutes Frühjahr, dass das Kindervolk samt den Viehherden wohl gedeiht?«
Worauf sie ihre Flasche – es ist die von meinem Bruder, mein Geschenk an ihn vor vielen Jahren – mir entgegenstreckt und ihren Gegengruß ausspricht, während beide Flaschen mit einem leisen Geklirr einander berühren und jede unserer Hände die eigene Flasche dem anderen überlässt und die des anderen auffängt. Ihre Grußworte lauten: »Ja, das tun wir. Und verlebst du selber ein gutes Frühjahr, dass du, samt Frau, Kindern und Kindeskindern gesund und wohl erhalten, all deinen Pflichten nachgehst?«
Ich atme erleichtert auf, dass es uns beiden gelungen ist, die engste Stelle eines unsichtbaren Durchganges passiert zu haben, ohne Tränen vergießen zu müssen. Dabei denke ich, die dunkle, große Gestalt des fremden Mannes neben uns flüchtig wahrnehmend: Wie anders würde so eine Begegnung im ähnlichen Falle bei seinen Leuten ausschauen? Dort ist es üblich, sich in die weit ausgebreiteten Arme des anderen zu werfen, laut zu klagen, um einander auf diese Weise zu noch mehr Tränen anzuregen und die Trauer nach außen sicht- und hörbar zu gestalten. Dagegen heißt es bei uns, sich zusammennehmen und Tränen vermeiden – wie andersartig bei zwei Völkerschaften, die Wand an Wand auf dem gleichen Flecken Erde und unter dem gleichen Hauch Himmel leben.
Nur, wenig später kommt es doch zu Tränen, die zwar spärlich durch die Augenlider sickern, aber einem jeden viel Kraft abverlangen, manche Schmerzen bereiten und bitter genug sind, um die Eingeweide anzuätzen. Das rührt von unserer Sitte her, dass man nach dem knappen Grußwechsel den Hinterbliebenen des Toten die Schnupftabakflasche noch einmal reicht, diesmal den Verlust direkt anspricht, worauf sich die Beileidsbekundung anschließt, welche mit den Worten schließt: Von dem Gegangenen möge seine vom Himmel erteilte Gunst bei Euch zurückbleiben.
Indes fällt mir manches auf. Die Dshenggej, die sich von solchen Dingen wie Feste, Schnaps, Tabak nie etwas gemacht, hat beide Male aus der Flasche je eine zeckengroße Prise von dem ätzend scharfen Pulver auf ihren linken Daumennagel am gekrümmten Zeigefinger herausgeschlagen und das Häuflein mit einem raschen, grunzenden Zug in eines der Nasenlöcher befördert. Soll ich meinen, dass die Trennungsschmerzen von ihrer anderen Hälfte nach viereinhalb Jahrzehnten Ehe so heftig gewesen sind, dass sie beschlossen hat, sie durch den Tabak zu betäuben? Oder sie hat in den letzten neun Monaten so viele Flaschen angeboten bekommen, dass sie, anfangs nur daran riechend, wie alle Nichtschnupfer es tun, sich allmählich daran gewöhnt und schließlich daran Gefallen gefunden hat, dass sie schließlich zu einer Schnupferin geworden ist?
Sie hat mich bei der Erwiderung meines Grußes nicht Dyngmaj, Brüderchen, genannt, so wie sie es früher immer getan hat. Auch hat sie nach meinem Urteil die Sitte verletzt, indem nicht daran gedacht hat, auch mir ihre Flasche noch einmal zu reichen und dabei ihr Beileid mir gegenüber zu bekunden – wenn sie verwitwete Ehefrau ist, dann bin ich der geschwisterseelenallein gebliebene, leibliche Bruder eines Toten. Soll das alles heißen, es ist schon zu einem Riss an dem Band gekommen, das uns beide, Dshenggej und Dyngmaj, verbunden hat, sobald nun der uns Verbindende aus den Augen ist?
Während ich in dieses eigene unerfreuliche Gedankengespinst verstrickt und somit in der Seele doppelt verwundet dasitze, kommt der duftende, dampffrische Milchtee auf den Tisch, und noch während wir dabei sind, unseren Durst damit zu stillen und unsere Ermattung darin zu ersäufen, erscheint auf dem ohnehin vollen Tisch auch das Fleischgericht, was mich ein wenig tröstet, schon wegen des Fahrers, der mir in diesem Augenblick wie ein Bruder vorkommt, mir zugelaufen auf der großen, blauen Straße des Lebens. Ich möchte ihn zumindest ordentlich bewirtet wissen, ehe er sich wieder auf den Heimweg macht.
In diesem Augenblick fällt mir Ueli aus Gränichen ein, der in jenen wunden Tagen meiner Seele mich auf der Bühne nach einer öffentlichen Lesung fest umarmt und mir ein Blatt Papier mit seiner Adresse und der kurzen, handgeschriebenen Notiz in die Hand gedrückt hat: »Gestern habe ich meine Mutter bestattet. Brauchst du einen Bruder, so möchte ich dir dieser eine sein.« Der weiße Mann mit dem wohlgeratenen Körper und dem Aussehen eines Künstlers muss, auf welchem Wege auch immer, erfahren haben, was mir gerade zugestoßen war. Besonders seitdem sichte und lausche ich auf Schritt und Tritt nach Menschen, die mir die sich immer mehr ausweitende, gähnende Bresche im Leben, entstanden durch die vielen Verluste im Laufe der Zeit, wenigstens halbwegs zu verdecken vermögen.
Der Fahrer heißt Keleschek, wir tauschen Anschriften und Telefone aus. Er sagt, ich könne, sobald ich ein Auto brauche, ihn jederzeit anrufen, und er würde kommen. Ich bezahle ihn. Zuerst will ich ihm ein ordentliches Trinkgeld zulegen. Aber dann lasse ich es sein, da ich fürchte, das könnte ihn beleidigen. Dafür entscheide ich mich jetzt für ein Geschenk an seine Frau – ein sonnengelbes Nachthemd aus Seidensamt. Worüber er sich sehr zu freuen scheint, denn ihm entfährt ein leiser Ruf: »Allah. Wer hätte gedacht, dass meine arme Alte so etwas Feines geschenkt bekommt!« Dann sagt er leise: »Ich verspreche, ich werde dafür sorgen, dass das samtseidene Kleid zeitlebens wirklich ihr Besitz bleibt, sosehr die jungen, modesüchtigen Dinger bestimmt versuchen werden, es ihr zu entreißen.« Dabei glänzt in seinem Auge eine kleine Träne. Ich halte sie für etwas sehr Wesentliches und drücke ihm ein weiteres Mal die Hand, fest und lang. Dann geht er. Ich bleibe sitzen, den Blick eine gute Weile auf den Hocker geheftet, auf dem er gesessen und wo ich nun eine weitere gähnende Leere zu sehen glaube, und wovor ich eine leichte Gänsehaut bekomme.
Dann aber rückt die Dshenggej an den Tisch, damit auch an mich näher heran und fordert mich auf, von dem Tee, bevor er ganz erkalte, wenigstens noch eine weitere Schale zu trinken. Und nachdem sie zuerst mir, daraufhin auch sich selbst eingeschenkt hat, schaut sie mir direkt ins Gesicht und sagt, es sei ihr die ganze Zeit so bang gewesen, mir zu begegnen. Nur schon der Gedanke, ich könnte jeden Tag auftauchen und vor ihr stehen, da sie in sich immer ein Schuldgefühl verspürt, nicht vermocht zu haben, mir den Bruder zu erhalten. Dann schlürft sie einen kräftigen Zug aus der Schale. Was ich auch tue. Der Tee ist lau geworden und darum gerade geeignet, ihn bedenkenlos auf den schwelenden Brand weiter unten zu verschütten.
Jetzt sagt sie: »Du bist seit dem letzten Mal sichtlich gealtert, Dyngmaj. Anders kann es ja auch nicht sein. Denn nun bist du von allen einstigen, Jurte und Welt füllenden Geschwistern mutterseelenallein übrig geblieben. Dies dir selber einzugestehen, ist nicht einfach, ich weiß. Aber denk daran, Dyngmaj, was gewesen wäre, wenn der Gegangene du und der Gebliebene dein Bruder gewesen wäre. Er hätte dann schlimmere Schmerzen leiden müssen, als sie dich seit Monaten plagen. Denn so wäre es gegen den gewöhnlichen Verlauf der Dinge gewesen.«