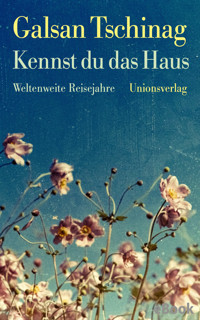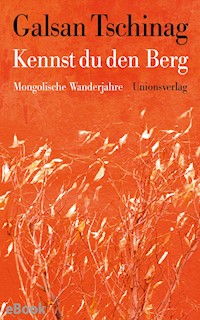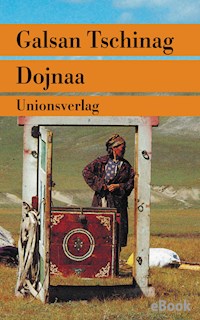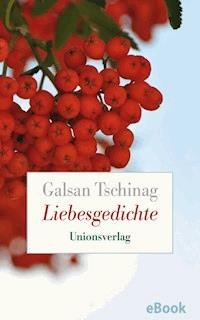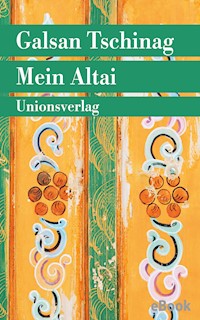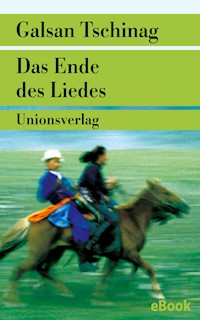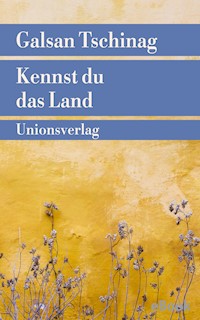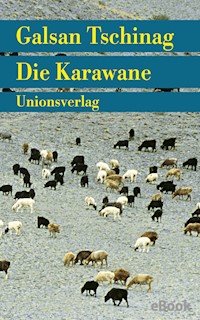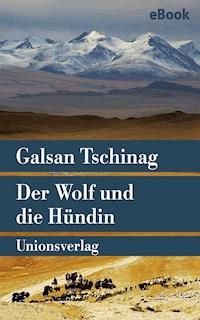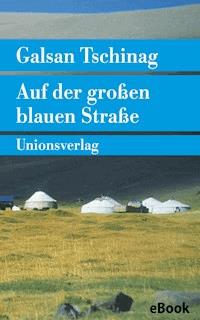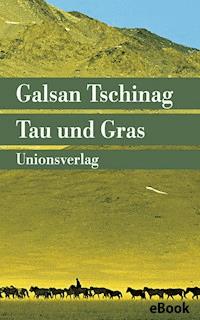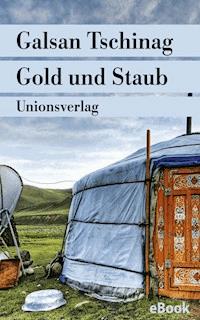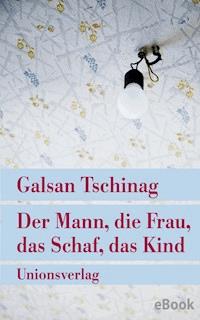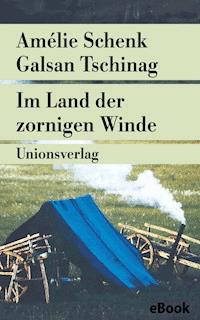
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwei anerkannte Fachleute aus dem Osten und aus dem Westen tun sich zusammen, um über die Welt der Nomaden zu erzählen. Die Ethnologin Amélie Schenk und Galsan Tschinag, das Stammesoberhaupt der Tuwa, berichten in einem Zwiegespräch über Leben, Krankheit, Tod, über das Heranwachsen der Kinder, über das Schamanentum. Sie geben dem Leser Einblick in die Lebensweise und Gedankenwelt der Tuwa und zeichnen ein vielschichtiges Bild der nomadischen Kultur. Eine Liebeserklärung an das Nomadenleben, ein tiefer Blick in die Geheimnisse einer untergehenden Kultur, eine rückhaltlose Bilanz der Wanderungen zwischen Ost und West.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Der tuwinische Erzähler Galsan Tschinag mit dem persönlichsten seiner Bücher. Im Austausch mit der Völkerkundlerin Amélie Schenk ist dieses außergewöhnliche Werk entstanden: eine Liebeserklärung an das Nomadenleben, ein tiefer Blick in die Geheimnisse einer untergehenden Kultur, eine rückhaltlose Bilanz der Wanderungen zwischen Ost und West.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Amélie Schenk ist promovierte Ethnologin. Sie beschäftigt sich insbesondere mit dem Schamanentum verschiedener Naturvölker, lebte bei Indianern Nordamerikas, in Indien und im tibetischen Himalaja. Heute lebt sie vorwiegend in der Mongolei.
Zur Webseite von Amélie Schenk.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag, Amelie Schenk
Im Land der zornigen Winde
Gespräche
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1997 im Verlag Im Waldgut, Frauenfeld.
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Foto Amélie Schenk
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30198-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 23:26h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
IM LAND DER ZORNIGEN WINDE
Alles, was ich zu sagen habeBin der Schwanengesang eines gehenden VolkesStein am Hang des LebensbergesDie Gräser und Wasser in unsIm himmellosen LandHoher Gesang an die GeisterIns Salz gehenWeißes Land der SeeleEin voller Tag, ein ganzes LebenIm HerdenstaubAm unruhigen NomadenherdKnochen, Fleisch und BlutAls meine Mutter das Hakenkreuz abtrennteWie eine Yakblase mit gelber ButterSchau einem Hengst, getrennt von seiner Stute, in die AugenGeboren im Gefäß des SchicksalsWasserauge und FleischherzLand im AbendGrenzwächter der WildnisIm Sturm fremder WindeManches ist ausgesprochenNachredeMehr über dieses Buch
Über Amélie Schenk
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Mongolei
Zum Thema Nomaden
Zum Thema Asien
Zum Thema Heilkunde
Zum Thema Religion
Alles, was ich zu sagen habe
Alles, was ich zu sagen habe, erzähle ich dir. Du bist für mich das Abendland, die nicht-nomadische Welt. Ich weiß, du bist angeschlagen in deinen Grundfesten, irrst umher, bist auf der Suche nach einer neuen Erde, nach einem Halt, den dir bislang keiner hat geben können. Ich weiß auch, du wirst, trotz ständigem Zeitdruck, nun endlich einmal Zeit haben und mir zuhören, schon aus innerer Not heraus. Und unterbrich mich nicht, denn einen Nomaden im Redefluss unterbrechen, heißt ihn bezwingen, ihn eindämmen und letztlich erdrosseln. Und was wäre die Welt ohne ihre Erzähler?
Bin der Schwanengesang eines gehenden Volkes
Ich, der ich für die Welt Galsan Tschinag heiße, genauer: der Galsan des Tschinag, bin in den Tälern und auf den Bergen des Hohen Altai, im äußersten Westen der Mongolei, Irgit Schynykbaj-oglu Dshuruk-uwaa – Fellbaby, Sohn des Reichen Schynyk aus dem Stamme Irgit.
Komme ich nach Europa, überfliege ich jedes Mal sieben Sonnenstunden. Sie sind die Schwelle, die ich überschreiten muss, wenn ich aus der Urgesellschaft, in der mein Volk immer noch lebt, herauskomme in den Auslauf des 20. Jahrhunderts. So schwebe ich eine Zeit lang in den Weiten des Himmelsblau und des Wolken weiß, lasse die Erdenschwere hinter mir. So sitze ich einen Tag lang im Himmel und kann gut nachdenken. Mir ist, ich brauche den langen Flug und das lange Warten, um den Wechsel der Welten überhaupt bewältigen zu können. Ja, Umrüsten muss ich mich jedes Mal, bevor ich meine Füße auf die Gleise einer anderen Welt setze, meine Seele den Pulsschlägen eines anderen Zeitalters angleiche.
Die Leute sind ratlos, gar bestürzt, wenn sie mich sagen hören: Jetzt bin ich fünfzig Jahre alt. Im Grunde aber lebe ich seit 1550 Jahren. Denn in der Tat muss ich jedes Mal, wenn ich die Welten wechsle, so viel Zeit überbrücken.
Und ich glaube, das geschieht auf einen Wink der guten Geister. Denn unmöglich kann ich dies und all das, was mir bisher geglückt ist, im Alleingang erreicht haben. Ich bin ein Mensch, der eigentlich zu gering geschaffen ist: Verfüge über eine ziemlich durchschnittliche Intelligenz, über eine für jegliches Unternehmen ungünstige, eher abweisende als gewinnende äußere Erscheinung, über eine für die Nomadenwelt zu schwache und an vielen Stellen angeschlagene Gesundheit, ja einen schlaffen Leib, bin schwer von Begriff und neige zu Gefräßigkeit und Faulheit.
Die anfänglichen Spuren meines Erdenlebens sind verwischt. Die Zeugen, die darüber etwas hätten aussagen können, sind gegangen. So wird niemand mehr im Stande sein, den Monat und den Tag zu nennen, an dem ich geboren wurde. Es ist wohl in den 40er-Jahren geschehen. Eines aber weiß ich: Bin an einem Sonntag im europäischen Sinn ins Leben getreten. Wie sonst hätte mir der Weg zu so vielen Sonnentagen des Lebens freigelegen?
Und dieses Leben ist von Anfang an ein Märchen gewesen. Mein Vater bekam inmitten eines Lebens, wo andere mit vierzehn heirateten, mit erst siebenunddreißig Jahren meine Mutter zur Frau. Und diese brachte mich auch erst mit siebenunddreißig Jahren auf die Welt, in einer Jurte in den Schwarzen Bergen. Von den vier Kindern, die sie zuletzt gebar, blieb als Einziges ich am Leben. Ich blieb und gedieh selbst dann, als ich einmal in einen Kessel mit siedender Milch stürzte und mir die Haut des ganzen Rumpfes verbrühte.
Vater war so närrisch in mich verliebt, dass er mich jeden Morgen aus dem Bett hob und aus der Jurte hinaus bis zu der Stelle trug, die mir würdig genug erschien, darauf zu pullern. Dieses Spektakel dauerte so lange, bis der alternde Vater unter dem Gewicht des heranwachsenden Sohnes eines Morgens zusammenbrach. Und wenn ich erst an Mutter denke! Sie war bereit, mich so lange zu stillen, bis mir die ersten Milchzähne ausfielen, und gab mir auch später noch ihre Brüste, so oft ich danach verlangte, selbst in einem Alter, in dem ich schon so manches Liebesgedicht verfasst hatte.
Nun, ich wurde verhätschelt, blieb aber doch ein anständiges Wesen: Hatte meine Großmutter, die bereit war, allein für mich zu leben, es aber dann doch nicht verhindern konnte, heimgehen zu müssen. Und hatte ich nicht geschworen und beschlossen, mit ihr zusammen eine eigene Jurte zu bewohnen, eigene Herden zu besitzen und so meinetwegen auch zu einem Baj, einem Fürsten, zu werden? Ich blieb bei diesem Vorsatz. Zwar wurde mir später der Kopf gründlich und mit vielem vollgestopft, so mit einer Ideologie, die allwisserisch meinte, Besitz sei etwas Schlechtes und Wahrheit dürfe man nur dann als solche anerkennen, wenn sie dem Besitzlosen nütze. Und heute? Da bleibe ich erst recht bei meinen alten Ideen. Ein Großteil der Mitmenschen wirft angesichts eines neuen Gottes, der Geld heißt, all seine Heiligtümer über Bord und maskiert sich, als gelehrige Untertanen neuer Herrscher.
Ein Märchen ist es auch gewesen, als vor reichlich drei Jahrzehnten an einem stinkig trüben Herbstmorgen ein Nomadenkind der Tuwa in der preußischen Hauptstadt Berlin ankam und in das sächsische Leipzig weitergeleitet wurde, um dort zu studieren. Nur war das Kind weder der Sprache des Landes noch der Schrift des Kontinents mächtig, allein es war erfüllt vom Willen, alles zu lernen, was zu lernen war. Ein Lomonossow, dessen Biografie es gelesen hatte, war ihm der Leuchtstern: Jener, der Bauernsohn im kalten Norden Russlands, hatte sich inmitten des Winters zu Fuß auf den Weg gemacht, um die Reichsstadt St. Petersburg zu erreichen und dort sich das Wissen anzueignen. Dieses, das Hirtenkind aus dem Mongolischen Altai irgendwo hinter dem Ural, war zur Zeit des warmen Herbstes mit der Eisenbahn gereist. Und das Hirtenkind wähnte sich unter einem günstigeren Stern als jener Bauernjunge. Das musste irgendwie stimmen. Denn dem Nomadenjungen hatte der Staat einen Studienplatz zugesprochen, während dem anderen nicht einmal der eigene Vater den Segen erteilt hatte. Gemeinsam war beiden nicht nur der Lernwille, sondern auch die Tatsache: Jeder der beiden stellte das berühmte unbeschriebene Blatt Papier dar, und jeder war im Besitz eines ausgeruhten Kopfes. Der aus dem russischen Bauerngeschlecht der nordischen Kühle war zwar schriftkundig, aber bei Weitem nicht überbelastet. Wohingegen der Nomadenkopf von Stille und Weiten umweht war. Und zudem, wenn auch schriftunkundig, war er ein offen stehendes, leeres Archiv, aber vor Kurzem geprägt und auf lange Sicht erweckt von nächtelangen und melodietollen Epen und Schamanengesängen.
Und so ging das Märchen weiter. Ich werde es dir erzählen. Und immer, sobald wir Zeit haben, werde ich dich in Stücken damit unterhalten. In diesem Märchen, das mein Leben sein soll, bin ich der Junge gewesen, der von Anfang an gewusst haben muss, eines Tages werde ich doch zum König! So will es das Märchen doch?
Ich glaube an Geister. Dies wohl, weil ich einer bin, der an das Glück gewöhnt, ja mit diesem verwandt ist. So sehr ich mein Leben als eine Fortsetzung des der Väter und deren Väter und der Mütter und deren Mütter betrachte, so darf ich es auch als eine glückliche Verkörperung edler Taten und guter Wünsche eines Volkes begreifen, das die Liebe zur eigenen Erde und die Sehnsüchte nach der unbekannten Ferne in einer Brust durch Zeiten und Welten getragen haben muss.
Und dennoch: Ich bin eine Bestellung der Zeit.
Ich muss der Schwanengesang eines Volkes sein, das nun bald aus der Geschichte gehen wird.
Stein am Hang des Lebensberges
Komm, setz dich zu mir. Schau dir die Hütte meiner Eltern an. Sie steht seit über dreißig Jahren an dieser Stelle, und solange meine Eltern lebten, war das für mich mein Zuhause. Vorher hatten sie eine Jurte. Dann war es so, dass sie alt geworden waren und nicht mehr umherziehen wollten. Da mein älterer Bruder hier Russischlehrer war und im Ort zu leben hatte, blieben sie in seiner Nähe. Dass er, Bruder Gagaa, sich um die beiden kümmern sollte, das war schon vorher, vor vielen Jahren festgelegt, als ich die zehnte Klasse hinter mir hatte. Und als ich dann von Zuhause wegging, gab es eine große Beratung der ganzen Sippe, und die Eltern haben in Gegenwart aller ihrer Kinder gesagt, ich solle ohne Bedenken gehen, wohin es mich treibt, und Gagaa sei derjenige, der sich um die beiden kümmern würde. Er sei ihr und ich sei des Volkes Kind. Ich sollte mich um den großen Stamm kümmern. Wenn einer von uns beiden erkrankt oder stirbt, hat mein Vater gesagt, so brauchst du nicht zu kommen, dein Bruder ist da. So ist es dann auch geschehen, ich kam weder zu Vaters noch zu Mutters Tod. Erst später, als sie schon zu zwei Hügeln geworden waren, kam ich vorbei und hatte mit Erde zu tun, die nach Sonne und Gras und vielem mehr roch.
In dieser Hütte haben die Eltern fast zwanzig Jahre zusammengelebt, mein Vater bis zu seinem Tod im Jahre 1978 und meine Mutter bis zu ihrem Tod im Jahre 1993. Da drüben ist Vaters Bett und hier ist das der Mutter. In verschiedenen Jahren, zu verschiedenen Zeiten bin ich hierher, in diese Hütte zurückgekommen. Die viereckige Hütte hat etwas Rundes für mich, ist wie Vaters Jurte, in der ich irgendwann geboren wurde.
Mein größeres Zuhause ist der Altai. In Ölgij, der Bezirksstadt wo ich immerhin sechs Schuljahre zu verbringen hatte, habe ich mich keine Stunde zu Hause gefühlt. Das ist eine mir fremde Welt. Mit ihr verbindet mich eigentlich nichts. Bin immer froh, wenn ich sie so schnell wie nur möglich verlassen darf. Erst an dem owoo, an dem wir gestern haltgemacht haben, an diesem Eingang zum Hochaltai, da fühle ich mich an der Schwelle ins eigene Land.
Mit Hochaltai meinen wir die fünf großen Flüsse und die Flusstäler und die hohen Berge, das sind dreiunddreißig Schneegipfel. Dann noch sehr, sehr viele schneelose Berge und die Steppen; und dazwischen drei große Seen, die wir alle Meere nennen, Aber wenn ich an das Zuhause im engeren Sinne denke, dann denke ich natürlich an diese Hütte.
Wir sagen nicht Heimat, Wir sagen wörtlich »Fall-Erde« – düschgen dsher und »Wasch-Wasser« – dshungan sug. Damit meinen wir die Erde, auf die man aus dem Mutterleib gefallen ist, und das Wasser, mit dem man gewaschen wurde. Wenn wir eigenes Land sagen, denken wir an die Erde und das Wasser und die Luft darüber, den Himmel. Der Himmel ist unser Vater, die Erde unsere Mutter. Und der Hochaltai ist meine große Jurte, im Gegensatz zu meiner kleinen, elterlichen, Diese ist zeitweilig, während die andere, die große, ewig ist.
All die hochgestochenen Begriffe wie Heimat, Vaterland gibt es auch in unseren Sprachen. Bei den Mongolen heißt es übrigens Mutterland. Heimat ist ein großes Wort. Die Menschen hier in diesen Bergen haben eine gewisse Scheu, so große Wörter in den Mund zu nehmen. Wir nennen all das ganz konkret: Erde, Wasser, Luft, Wind. Und wenn wir an einen Fluss herangehen, nachdem wir lange fort waren, nach ein paar Monaten, gar nach einem oder mehreren Jahren, dann tauchen wir als Erstes die Hand ins Wasser und benetzen damit die Stirn. Gehen wir von hier weg, dann nehmen wir einen kleinen Stein und eine Prise Erde mit. Altaisteine und Altaisand haben mich über die Erdkugel begleitet. Ich habe sie immer bei mir, wo ich auch bin. Denn wenn man auf diese Weise Sichtbares, Greifbares bei sich hat und darunter die Heimat versteht, dann, glaube ich, fiele es einem leichter, die Erde, ja den Planeten als Ganzes überhaupt als Heimat der Menschheit zu begreifen. Meine Heimat ist zwar sehr klein, aber je weiter ich mich von ihr entferne, umso größer wird mein Heimatbegriff. Wenn ich in Ulaanbaatar sitze, dann denke ich an den Hochaltai als meine Heimat, und wenn ich nach Europa fahre, dann denke ich an die Mongolei als meine Heimat, und wenn ich vielleicht nach Amerika fahren würde, dann wäre es sicher Eurasien, und wenn ich als Astronaut im Kosmos umherflöge, dann würde ich mich, das weiß ich, nach der Erde als meiner Heimat sehnen.
Auch in Afrika werde ich einen Teil der Mutter Erde vorfinden, und im Himmel darüber werde ich einen Teil von Vater Himmel sehen. Darum gibt es für mich keine fremde Erde und keine eigene, keinen fremden Himmel und keinen eigenen. Himmel ist immer Vater, Erde ist immer Mutter. Ehrfurcht habe ich vor jedem Fleck Erde und vor jedem Tupfen Himmel.
Hier ist nun einmal der Altai, das ist gerade die Ecke, wo ich geboren wurde. Damit bin ich natürlich besonders verwachsen. Das ist für mich die Erde an sich. Nur um meine eigene Ecke zu lieben, muss ich keine fremde verdammen. Es gibt in dem Sinne keine eigene und keine fremde Ecke, weil ich sehe, die Erde ist einheitlich, ist ein Körper. Und wenn ich jetzt aus Liebe zur Mongolei, sagen wir, die Philippinen hassen oder sie gar zerstören würde, so ist das, wie wenn ich mir aus Liebe zu meiner Hand die Fußzehen abhacken würde. Aber werde ich das tun?
So geht es mir auch mit anderen Menschen. Ich liebe meine Stammesgenossen, meine Sippe, meine Verwandten, aber aus Liebe zu ihnen würde ich nie einen Fremden verachten oder ihm gar Schaden zufügen. Das sind genauso unsere Brüder und Schwestern, nur kenne ich sie im Augenblick nicht so gut. Ich weiß, verschiedene Linien führen zu allen Menschen. Noch weiß ich nicht, welche Fäden von mir zu dir laufen. Aber wenn ich rede, wenn du redest, wenn wir unsere Worte zusammenrücken, unsere Erfahrungen Zusammenlegen und nachforschen, dann werden wir es wissen.
Du sagst manchmal, der Stein ist schön. Steine sind für uns weder schön noch hässlich. Steine sind. Und dieser eine Stein hier, der ist etwas Besonderes wegen der Flechten darauf. Der daneben ist es wegen der Farben. Aber beide sind unnachgiebig, unbestechlich, sind eben das, was nur Steine sein können. So stehen wir auch zu den Bergen. Jeder Berg ist für uns vor allem und einfach Berg. Er ist weder schön noch hässlich. Als Berg ist er immer groß. Und wir sagen ja zu ihm Großvater. Voriges Jahr hatte ich Gäste. Zehn Leute kamen zu mir, und ein Hirte lud uns zu sich ein und schlachtete einen Hammel, denn er wollte uns ein Essen geben. Vorher hatte ich ihm geschildert, was für eine weite Reise die Leute auf sich genommen hatten, um hierher zu kommen. Seine Frage war nun: »Weshalb?« Meine Antwort: »Um die Berge zu beschauen, unsere Berge sind so schön.« Das konnte er nicht verstehen.
Sass lange so da, dachte nach, und sagte dann mehr für sich als zu uns: »Komische Menschen, die kommen, um sich Berge anzuschauen!«
Unser Verhältnis zur Natur ist einfach anders. Ein Berg ist ein Berg, und wenn ich auf diesem Berg sitze, dann bin ich Stein und ruhe. Eine weitere Aufgabe habe ich nicht. Und wenn ich dann über die Steppe gehe, dann bin ich Gras, ich fühle, wie ich wachse oder verdorre, dufte oder raschle. Und wenn ich durch einen Fluss gehe, dann bin ich Wasser, ich fließe. Diesen Gedanken kann ich auf andere Dinge auch übertragen. Mal bin ich Gletscher, mal Baum, mal Luft, immer bin ich Teil der Erde und des Himmels und dessen, was dazwischen ist.
Wir hatten ja angefangen über die Berge, die Flüsse, die Luft zu sprechen. All das zusammen ist der Altai, und wir nehmen ihn zunächst einmal als einen Farbkörper wahr. Dieser ist blau-weiß. Die erste Grundfarbe ist blau: Der Himmel ist blau, und auch die Berge sehen aus der Ferne alle blau aus. Selbst der Schieferstein, aus dem der Altai zur einen Hälfte besteht, leuchtet blau. Dann nimm die vielen Gewässer, alle sind blau. Und dazu das blendende Weiß, das kommt vor allem von den Gletschern; und auch die Wolken, die Jurten, die Schafherden leuchten weiß. Im Sommer kommt noch das Grün dazu. Die Felsen sind meistens rot, können aber häufig auch grün schimmern. Und die Steine haben die verschiedensten Farben. Dies alles zusammen wird von den Tieren belebt. Sind die Schafherden weiß, so sind die Yakherden schwarz-bunt, die Pferdeherden braunbunt und die Kamelherden rot-bunt. Sobald wir auf den Altai hinausschauen, erfassen wir diese Farben sofort, denn wir sind Menschen, die auf Farben sehr schnell ansprechen. Unsere Trachten sind kräftig in den Farben. Wir lieben keine Zwischenfarben, wir tragen Kontrastfarben und sind bestrebt, uns schön anzuziehen. Und schön ist es für uns immer mit vielen Farben. Einfarbigkeit können wir nicht leiden, uns steht der Sinn nach Buntheit. Grau, das in Ostdeutschland so geliebt wurde, das mögen wir nicht. In der DDR waren die meisten, die etwas auf sich hielten, in graue Anzüge gekleidet, graue Mäntel, graue Handschuhe, graue Schuhe. Das war die Farbe der DDR. Daran hat sich später der ganze sozialistische Osten angesteckt. Und so ist es in unseren Städten heute immer noch. Das Parlamentsgebäude in Ulaanbaatar ist ein recht schönes, stabiles Haus. Aber es ist so aschgrau, und. das ist etwas, was wir überhaupt nicht begreifen können. Jede andere Farbe würden wir annehmen, aber Schwarz und Grau bitte nicht. Auch die demokratisch ummaskierte Elite scheint sich für Grau entschieden zu haben, und dies wahrscheinlich bewusst, um sich vom Nomadischen abzusetzen.
Dann empfinden wir unseren Altai als einen Körper von Tönen. Die Flüsse, das sind sehr schnell fließende und vielerorts herabstürzende Höhenflüsse. Da hörst du ein solches Gedonner und Getöse von diesen Wassern. Dann ist da der Wind, den hörst du ständig. Und denk nur an die Tiere. Und doch ist alles in sich ruhend, weit und still, aber eine Totenstille herrscht dennoch nicht. Ständig hörst du die große Natur als eine nie endende Symphonie. Die Berge sind spitz, oft sturzsteil. Die Bergsteppen sind da als Weiden, sind weit und hoch. Vom Sehen, vom Hören nehmen wir ihn wahr, unseren Altai. Dann aber auch vom Geruch her. Der Gletscher hat einen ganz starken, seltsamen Geruch. Es ist Altwassergeruch. Da liegt Schnee von Jahrmillionen. Und wenn der Schnee solange liegen bleibt als Eisschnee und sich diese Gerüche von verschiedenen Jahrhunderten und Jahrtausenden dort gehalten haben, dann empfindest du das dort oben. Kommt hinzu die Würze vom Steppengras, von solch starkduftenden Kräutern wie Wermut, Salbei, kaltem Beifuß, dann riechst du die Urkraft der Berge. Unkraut gibt es für uns nicht. Das sind alles Pflanzen, die die Erde braucht und die auch wir brauchen. Dann riechst du die Wälder, die immer noch da sind, wenn auch kleiner geworden, die Tiere, die alle anders, aber alle so gut riechen, dass wir viele Bezeichnungen dafür haben, niemals aber vom Stinken reden. Für euch stinken sie vielleicht. Aber Stinken kommt von Menschen, Tiere stinken niemals. Der Tuwa ist ein Mensch, der auf den Geruch sehr viel Wert legt und die Welt und den nächsten Menschen durch die Nase wahrnimmt.
Wenn der Tuwa einen Wald in der Ferne sieht, sieht er vor allem den Wald, der seinen Ahnen Schatten gespendet hat. Er sieht darin auch den Wald, der seinen Kindern und Kindeskindern weiterhin Schatten spenden wird. Er freut sich darüber, dass dieser Wald immer noch so dasteht wie schon zu Zeiten der Ahnen. Und er hofft und ist bei dieser Hoffnung froh, dass diese Wälder noch so stehen werden zu Zeiten der Kinder und Kindeskinder. Ein Städter, so kommt es mir vor, sähe in dem Wald vor allem das Holz, er wäre glücklich, wenn er die Bäume schlagen und die Balken herübertragen könnte und schließlich diese Balken geschichtet vor sich sehen würde. Und wie würde er sich freuen, wenn er daraus Bretter machen könnte! Überglücklich aber wäre er erst, wenn er diese Bretter zu Stühlen und Tischen verarbeitet sähe. Und am allerbesten würde er sich fühlen, wenn er von diesem Wald ein Stück abgetrennt und einen Zaun ringsum gezogen hat und wenn er denken dürfte: Das ist nun mein Wald, Wir freuen uns, wenn wir von unserem Wald reden können.
Bei uns gibt es nicht mehr viele Bäume. Wir hatten große Lärchenwälder. Dann kamen, vor sechzig oder siebzig Jahren, die Kasachen, und sie haben die Bäume geschlagen. Heute haben wir ganz, ganz wenig Wald. Eine Statistik aus dem Jahre 1950 besagt, dass ein Prozent unseres Bezirkes bewaldet sei. Inzwischen wird dieser Prozentsatz höchstens noch 0,001 betragen. Wir haben eine eigenwillige Beziehung zu den Bäumen. Denn in jedem von ihnen sehen wir einen Bruder. Wir sprechen von den Bruderbäumen. Ganz besonders wichtig ist für uns die Lärche. Für den Wald sagt man arga, das ist auch die Lärche. Die steht schlechthin für den Baum, für den Wald. Der Tuwa sägt keinen lebenden Baum ab, er darf das Holz nur nehmen, wenn ein Baum tot ist, am Boden liegt. Damals haben wir nur Reisig gesammelt oder umgefallene Bäume fortgeschleppt. Wurde dennoch ein fester Baumstamm gebraucht, hat man sich bei ihm, dem Bruder, entschuldigt, bevor man die Säge an ihn legte. Dies ist eine feierliche Handlung wie beim Schlachten eines Tieres.
Dann kam die Zeit der Kasachen, die Zeit der Kommunisten. Ich war dabei, als wir Schüler der ersten bis vierten Klasse Bäume schlugen. Auf einem roten Tuch waren weiße Papierbuchstaben aufgeklebt, und der kämpferische Satz lautete: »Wir haben keine Furcht vor dir, Natur. Wir werden dir den Reichtum entreißen!« Dann sind wir mit Äxten und mit Sägen ausgerückt und haben angefangen, die jungen Lärchen zu fällen. In diesem großen Flusstal, an der Mündung von den drei Flüssen Haraaty, Homdu und Ak Hem gab es viel Wald, noch vor zwanzig Jahren. Da konnte man nach den Kamelen, nach den Pferden und Yaks tagelang suchen, wenn Tiere verlören gingen. Heute gibt es hier fast keine Bäume mehr, die paar Hundert, oder vielleicht die letzten paar Dutzend Bäume stehen noch, aber selbst diesen letzten alten Lärchen ist unten das Holz bereits abgeschlagen worden. Der Baum steht zwar noch, ist aber schon saftlos, und so sprechen wir von Baumborz. Borz ist ja das Trockenfleisch. Diese toten Bäume kann man, wenn es sein muss, auch fällen. Das sind keine Lebewesen mehr, das ist nur stehendes Holz.
Zu der Espe haben wir eine besondere Beziehung, da sie der Fäulnis entgegensteht. Das haben bereits die Menschen in grauer Vorzeit entdeckt. Wenn man in einen Heuschober nur einen Espenzweig reinsteckt, der nicht einmal länger als zwei Handspannen zu sein braucht, wird das gelagerte Heu nicht verfaulen. Es kann regnen, ringsum nass sein, neblig werden, das Heu wird durch diesen einen Espenzweig frisch bleiben.
Neulich haben Wissenschaftler bei Ausgrabungen von Gräbern der alten Türken Espenholz und Espenzweige gefunden. Die Espe heißt auf tuwinisch terek. Wir sprechen von gök terek. Gök ist eigentlich das Wort für blau, steht aber gelegentlich auch für grün. Wir sagen gök und meinen damit auch das erste Gras. Kurz gesprochen: Gök terek ist die Bezeichnung gewesen für diejenigen, die die Espe irgendwie verehrten. Aus dem Wort gök terek ist im Laufe der Jahrhunderte gök türek geworden. Damit sind die Blauen Türken gemeint, die von den turksprachigen Völkern so verherrlicht werden wie etwa die Großmogulen von den Mongolen. Die Turkologen und Mongolisten streiten sich ja heute darüber, woher gök türek käme. Für mich ist die Sache einfach: die junge Espe, das Espengrün. Schade, dass unter den Wissenschaftlern, die etwas zu sagen haben, kein Tuwa ist. Wenigstens ein Rätsel der Sprachwissenschaft könnte er schnell lösen.
Was aber heißt Altai? Das kommt von ala, bunt, und dag, Berg, Bunte Berge also. Dies aber auf Tuwa. Im Kasachischen und Kirgisischen heißt es Alatau. Der Altai ist eine der längsten Gebirgsketten der Erde überhaupt, durchläuft Territorien von fünf Staaten der Erde, und allein in der Mongolei ist er nahezu 3000 km lang. Allzu verständlich, dass wir unseren Altai als das Höchste verehren. Wir haben ja kein Wort für Gott. Der Spruch, den wir jeden Tag zigmal aussprechen, lautet: Ej baj Aldajym! Oh, mein reicher Altai! Und das sage ich auch, selbst wenn ich viele tausend Kilometer vom Altai entfernt bin, unbewusst immer, wenn ich den Himmel oder das Höchste herbeirufen will. Auch in anderen Gebirgen, die anders, die Hangaj, Hentij heißen, oder in der berühmten ostmongolischen Steppe, vor allem aber in der Verlorenheit am anderen Ende der nomadischen Welt bete ich: Ej baj Aldajym! Damit meint man nicht die Berge, die Felsen, sondern das ganze Universum.
Berge erwecken Ehrfurcht. Sie sind erhaben, streben himmelwärts. Wer auf einem Berg steht, ist dem Himmel näher. Daher heißt es immer: Wenn du frühmorgens aufstehst, dann geh auf die Berge. Das siehst du auch heutzutage noch bei den Nomaden. Sie erheben sich frühmorgens, gehen auf die Berge mit dem Fernglas in der Hand, setzen sich und betrachten mitunter sehr lange, zunächst ohne, dann mit, dann wieder ohne Fernglas die ganze Umgebung. Dies geschieht zunächst aus praktischen Gründen: Wo ist das Pferd? Wo sind die Kühe? Wo sind die Nachbarn? Wer zieht weg, wer kommt in die Gegend? Dann aber gehen die Betrachtungen weiter, in die eigene Tiefe. Das ist jeden Morgen eine Reise in sich selbst. Man bringt Ordnung in seine innere Welt. So kommt man zu der großen Ruhe, die man jeden Tag braucht. Denn erst wer eine ganz bestimmte Zeit auf dem Berg so zugebracht hat, der ist wieder aufgefüllt mit dem notwendigen inneren Frieden. So ist ein jeder Berg ein erster Schritt zum Himmel, zum Himmlischen, zum zeitlos Ewigen.
Viele Orte sind mit Legenden und historischen Begebenheiten verbunden. Auch zu dieser Stelle hier, dem Kamelhals, gibt es eine uralte Legende. Es ist die von Sardakban, dem Tuwa-Weltschöpfer. Sardakban ist ein Riese in Gestalt eines Menschen. Er hat die Welt, den Hochaltai erschaffen. Und als er das Wasser noch hinzufügen wollte, entzog er den Gletschern das Wasser für die großen Seen und hob entlang des dort unten verlaufenden Flusstales einen Graben aus. Und gerade an dieser Stelle hier, wo wir sitzen, machte er Halt und wollte sich ein bisschen ausruhen und schlafen. Vorher aber hat er eine Schaufel mit Sand, die er mitführte, einfach fallen gelassen, daraus ist dieser Berg vor uns, der eigentliche Kamelhals entstanden. Aus einer Schaufel Sand nur! Von dort oben sieht man, dass das alles Sand ist. Und die Stelle, wo er gegraben hat, werden wir unterwegs sehen, dort liegt der Gelbe See. Und während er so schlief, füllte sich diese Stelle mit Wasser, brach aus und durchschlug die Bergfestung und bildete schließlich eine Flussschlinge.
Hörst du das Eis zerspringen? Siehst du, wie die Schollen den Fluss hinuntertreiben? Im Herbst und Frühjahr, da gibt es große Detonationen überall im Hohen Altai, besonders im April, wenn das Eis schmilzt und in großen Brocken abbricht. Im November, wenn die Flüsse zufrieren, dann gibt es auch oft ein Getöse, das kommt vom Zusammenprall sich übereinander schiebender Eisschollen. Die riesigen Eisblöcke, die wir gestern dort oben sahen, sind vom letzten November. Das Flusswasser, dem plötzlich sein Bett zu eng wird, schiebt die tonnenschweren Eisstücke wie Holzspäne übereinander und wirft sie manchmal hoch auf die Uferwiese. Der Volksmund spricht dann vom Röhren des Flussbullen, wenn nachts das Eis kracht. Man meint, ein jedes größere Gewässer berge in sich einen Bullen, der immer dann röhrt, wenn er anfängt, sich mit Eis zu panzern oder sich zurückzieht und das Eis so zum Bersten bringt.
Die Gräser und Wasser in uns
Der Nomade, glaube ich, ist ein großer Erzähler, denn bei uns wird noch alles erzählt. Jeder Tag beginnt mit einer Erzählung in der Jurte. Aber erzählen bedeutet nicht, einfach daraufloszureden, sondern dass man zwischendurch auch Schweigepausen einlegt, die sehr wichtig sind, besonders bei andächtigen Anlässen. Grundsätzlich gilt: Wenn die Nomaden reden, dann sagen sie auch etwas Sinnvolles, und sie reden sowieso nur, wenn sie tatsächlich etwas zu sagen haben. Und dabei gibt es so manche abstrakten Begriffe noch nicht, auch nicht die nichtssagenden Füllwörter. Die Nomadensprachen sind so bilderreich, dass alles, was gesagt wird, von den Zuhörern auch verstanden und aufgenommen wird. Ihr habt eine elegante, nichts sagende Redeweise, könnt stundenlang mit sehr vielen Wörtern plaudern, aber es bleibt nicht viel hängen. Das siehst du auch in der europäischen Poesie. Das ist ja zerhackte Prosa, überhaupt arm an Bildern. Die Poesie der Nomaden ist sehr kräftig, bilderreich und sofort verständlich. Weshalb ich hier auf die Poesie komme, hat folgenden Sinn: In der Jurte lebt die Poesie immer noch. Wenn die alte Mutter frühmorgens aufsteht und ihr Feuer anzünden muss, dann beschwört sie das Feuer in Stabreimversen, und so geht das den ganzen Tag weiter. Wenn sie also ihren Tee gekocht hat und die ersten Tropfen dem Himmel, der Erde, den Bergen und den Geistern opfert und verspritzt, dazu spricht sie das in Versen. Und es endet damit, dass sie sich bei den Geistern bedankt für den Tag in Frieden und dass sie für sich und ihre Kinder eine gute Nacht mit guten Träumen wünscht, ebenso eine Nacht in Frieden für die Herden. Und alles geschieht in Versen. Mit der echten Erzählung und der Poesie sind die Nomaden noch gut in der Übung.
Bei euch haben die Menschen einander so wenig mitzuteilen, und wenn sie etwas sagen, dann sind das nur Bruchstücke. Ich höre den Reden der Leute bei euch aufmerksam zu und muss immer wieder feststellen, dass sie die Sätze nicht beenden. Nicht, dass sie nur schlechte
Erzähler wären, sie sind auch und in erster Linie sehr schlechte Zuhörer geworden. Wenn ich so verschiedene Interviews gebe, dann muss ich für meine Sätze immer kämpfen. Ich will etwas erzählen, ich hebe an, und ich mache das andächtig, mit Zwischenpausen, wie es sich gehört, aber die Journalisten, die mir die Fragen gestellt haben, die laufen mir immer dazwischen, die stolpern dahinein. So muss ich immer sagen: Warten Sie mal, ich bin noch nicht fertig, ich muss erst zu Ende kommen. Mit einem Wort, den Menschen fehlt die Geduld. Und ungeduldig sind sie, weil sie meinen, sie hätten wenig Zeit. Wir dagegen meinen, dass wir unendlich viel Zeit haben, weil wir uns immer sagen, als der Himmel die Zeit erschuf, hat er davon genug geschaffen.
Tuwinisch ist eine freie, großzügige Sprache, kommt mir vor, die keinen Zwängen ausgesetzt ist. Heißt es nicht, dass man uns bei der Erschaffung der Welt vergaß und keine Sprache gab? Da kam der Igel mit dem weisen Rat – alle Sprachen waren ja bereits auf die Völker verteilt –, von jeder nun ein wenig abzuzweigen, so dass die Tuwa doch noch zu einer Sprache kämen. So geschah es. Denn man kann einerseits die einzelnen Wörter wie heilige Wesen pflegen, andererseits kannst du mit jedem Wort jederzeit in jede Richtung hin zielen. Du bist auf Tuwinisch Amel, einer merkt, wir sind uns eng verbunden, sogleich macht dieser aus Galsan oder Dshuruk, was ich immer bin, ein Kamel. Also sind du und ich nun Amel und Kamel. Aber nicht einfach nur das: Die Endung für Mehrzahl geht auf ottar (Gräser) und suglar (Wasser). So also: Amel, Kamel ottar oder Amel, Kamel suglar. Leute, die dieses Gesetz nicht kennen, beginnen dann zu suchen, stellen Theorien auf, schreiben logische Abhandlungen. Was in unseren Augen nur komisch wirkt. Denn sie rätseln: Die Gräser und Wasser in uns …?
Die Nomaden sind friedliche Leute, die versuchen, so weit es geht, miteinander auszukommen. Das laute Reden ist im Allgemeinen nicht beliebt. Wenn man sich Schwiegertöchter aussucht, dann gibt es einige wichtige Kriterien. Wie schaut sie aus? Wie blickt sie auf? Wie bewegt sie sich? Menschen, die friedlich, von oben nach unten still hinblicken, die werden für besser gehalten als solche, die so aufdringlich und forsch hinaufblicken. Also, der Blick ist sehr wichtig. Geschätzt wird auch eine weiche, leise Stimme. Und eine runde, fließende Bewegung. Eine lautredende Frau ist im allgemeinen verpönt, ebenso eine, die sich eckig bewegt. Diese Eigenschaften betreffen Männer genauso. Den Kindern sagt man: Versuch langsam und leise zu reden! Versuch wenig zu reden! Der Mensch kann nie zu wenig reden, heißt es. Die Gefahr, dass man zu viel redet, die bestehe jederzeit. Und das Reden besteht dann meist aus bejahenden Sätzen und Worten. Vom Mund kommt die Zukunft, heißt es. Wer ständig Schlechtes redet, dessen Zukunft geht auch in diese Richtung. Wer eine bejahende, zufriedene Redeweise hat, der darf auch eine Zukunft in diese Richtung erwarten. Kurz: die positive Einstellung zur Sache. Dann gibt es ganz bestimmte Tage, an denen man überhaupt nichts Negatives reden soll. Das sind zum Beispiel die ersten Tage des neuen Jahres, genauer die Tage, solange gefeiert wird. Da soll man Schlechtes überhaupt nicht in den Mund nehmen. Fragen werden bewusst so gestellt, dass darauf nur bejahende, zufriedene Antworten fallen.
Das betrifft dann auch den Tadel. Auch hier zu Lande wird kritisiert. Aber die Kritik sieht ein wenig anders aus als in eurer Kultur. Der Deutsche tut sehr direkt, glaubt sich im Recht, alles kritisieren zu dürfen. So klingt es in unseren Ohren zumindest. Derjenige, der die Kritik ausspricht, scheint da immer recht zu behalten. Diese Art von Kritik verletzt. Für uns seid ihr ein bisschen kritiksüchtig – entschuldige! Bist du mit einem Deutschen unterwegs, musst du dir bewusst sein, dass er dich sich immer unterwerfen will. Sein Wille ist oberstes Gebot. Er scheint erst dann Ruhe zu finden, wenn er andere kritisiert und so am Ende geknickt hat und dann über alle selber hinausragt. Das fällt dem Deutschen selber wahrscheinlich gar nicht auf. Aber es ist in der Tat so, und weil wir uns in solchen Dingen sehr empfindlich zeigen, spüren wir das genau, wenn wir ein belehrendes Wort hören. Auch uns gefällt vieles nicht. Aber wir greifen nicht gleich nach einem Stein. Und wenn wir ihn auch in der Hand halten, dann versuchen wir eine Weile abzuwarten, ehe wir ihn nach jemandem werfen. Schweigen, sein Gegenüber darauf aufmerksam machen, ist eine wirksame Kritik.
Wir versuchen auch, die Direktheit, die einen Zusammenstoß herbeirufen könnte, weitgehend zu vermeiden. Wenn meine eigenen Kinder mir gegenüber etwas falsch machen, rede ich von einer Familie, in der die Kinder artig und gut sind. Ich sage: Die Schenks haben ja prächtige Kinder, die haben so eine wohl wollende Art, die sind so nett zueinander und hilfsbereit zu anderen Menschen. Mensch, der Junge hat mir geholfen, der hat mit mir so lieb gesprochen, und in dem Kerl steckt so viel Wärme. So ungefähr. Dann wird mein Sohn, den meine unausgesprochene Kritik betrifft, dem diese Eigenschaften fehlen, der wird verstehen, woher der Wind weht. Damit hat zwischen uns kein Zusammenstoß stattgefunden.
Angenommen, es gibt einen Todesfall. Niemals wird direkt gesagt: Dein Mann ist gestorben! So darf man mit einem Menschen nicht verfahren. Da fängt man sehr weit an, man philosophiert über das Werden und Sterben. Das ist meistens die Aufgabe eines älteren Menschen. Die Welt ist ständig im Fluss, der Mensch ist im Kommen und Gehen, es ist eine Welt des Werdens und Sterbens, und wo an einem Tag ein Mensch stirbt, da kommen zwei neue Menschen an, wo es Tod gibt, gibt es Geburt, und umgekehrt ist der Tod unvermeidlich, wo geboren wird. Es ist das große Gesetz der Natur. Das muss man kennen. Und vom großen Wind des Werdens und Sterbens wird, früher oder später, ein jeder getroffen. So die Einleitung. Nun, meine Liebe, musst du zeigen, dass du eine kluge Frau bist, denn es gibt im Leben eines jeden Menschen Momente, wo man sich tapfer verhalten, Weisheit zeigen muss, und wo man sich zusammennehmen, die Zähne zusammenbeißen und die Hände zu Fäusten ballen muss. Nun, liebes Mädchen, ich werde dir etwas Schweres mitteilen müssen … Längst bist du aufmerksam geworden, längst bist du auf das Schwerste gefasst. Nun darf er die Mitteilung anbringen.
»Wasser kostbar, Holz kostbar, Worte kostbar …«, so fängt ein Gedicht von mir an. Kostbares Wasser wird bei uns mit der Träne verglichen, Tränen sind immer etwas Wesentliches, das findest du überall bei den Nomaden. Worte sind kostbar, sie werden nicht vergeudet. Worte verweisen nicht auf etwas Dahinterstehendes, Worte wirken unmittelbar, haben Wirkkraft, Zauberkraft, werden durchaus materiell verstanden wie Schleudersteine, wie Brennholz.
Die Menschen haben ein inniges Verhältnis zur Sprache, wie überhaupt zu allen Dingen. Sie haben sich noch nicht davon entfernt. Und es gibt in dem Sinne kein hässliches Wort. Jedes Wort ist gut genug, wo es hinpasst. Dazu gehören auch solche Wörter, wie man sie im Deutschen nur sehr schwer benutzen würde. Die Scham, der Penis, der Arsch, der Hintern, ficken, stinken, all diese Wörter. Scham heißt göd. Und wenn man eine Frau etwas aufziehen will, dann kann man sagen: Du gök göd, du Blaumöse! Die Möse wird immer als blau empfunden. Der Arsch dagegen immer als schwarz: hara gyda. Das sagt man auch im übertragenen Sinne zu einem Menschen, der eine Kette von Unglücksfällen hinter sich herzieht. Dann sagt man: hara gydalyg, der hat einen schwarzen Arsch, oder er ist ein schwarzärschiger Mensch. Oder wenn es nichts Gutes mehr für eine Familie gegeben hat, seit dieses eine Kind geboren wurde, dann nennt man es schwarzärschig. Dagegen setzt man das weißärschige: ak gydalyg. Das heißt: Seit der Geburt dieses Kindes geht es uns gut. Gyda ist das neutrale Wort für Arsch, wenn ich hyjma sage, dann empfindet keiner etwas Schlechtes, man hört so etwas wie Arschlein, Ärschel, und ich kann es noch liebevoller sagen: hyypy. Wenn ich hyypy sage, so denke ich als Tuwa an einen zarten kleinen Arsch, also an den von einem Kleinkind. Das muss der Pöter sein, von dem deine Großmutter immer so liebevoll gesprochen hat.
Noch etwas Interessantes. Die tuwinische Bezeichnung für Chinese, Chinesin oder China ist gydad. Vergleiche mal! Man sagt gydang hys! oder gydang! oder hys! jeweils ein Wort weglassend. Und das heißt wörtlich: Kneife deinen Arsch zusammen! Also: Sei dir deiner Grenzen bewusst! Sei nicht so frech! Reiß dich zusammen! Halts Maul! Stille! Aber das klingt gar nicht so grob. Ich kann auch von mir sagen: Ach, ich habe Angst, dazu will ich mich nicht äußern. Da sage ich: gydam gysajm! – Da will ich meinen Arsch zusammenkneifen!
Siger ist ficken. Jeng sik! heißt: Ficke deine Mutter! Das kann man in der Aufregung sagen, wenn sich zwei Menschen streiten. Oder man kann es ganz einfach liebevoll sagen: Jesin sigimer! Der seine Mutter ficken möge! Das sagt man zu einem Kind, das sehr aufgeweckt ist und das etwas Unerwartetes bringt. Das kommt nicht ärgerlich heraus, besonders bei kleinen Kindern. Im Gegenteil, es kommt als Ausdruck der Anerkennung, denn man ist erfreut, erstaunt.
Noch etwas mit Arsch. Gydam dyngnasyn! sagt man. Wörtlich: Mein Arsch möge es hören! Das gebraucht man, wenn einer etwas sehr Freches sagt und man keine Lust hat, sich so etwas anzuhören. Ich will mir so etwas nicht anhören müssen, aber mein Arsch vielleicht. So in dem Sinne, Nun eine andere Wendung: Hyjma dshydyg deesch gesip dshashar arga dshok. Wörtlich: Den Arsch kann man nicht wegschneiden, auch wenn er stinkt. Dies sagt man, wenn ein Kind, ein Verwandter missraten ist. Oder wenn irgendeine eigene Sache sehr misslich geraten oder einem einfach unangenehm ist. Dagegen kannst du nichts tun, es ist nun einmal so, das musst du einfach so hinnehmen.
Dann gibt es noch etwas, das dich verwundern wird. Es kann nämlich geschehen, dass einer vor Schreck hässliche Sachen ausruft, die Beherrschung verliert. Das siehst du bei Nomadenvölkern sehr oft, ganz gleich, ob das nun Kasachen, Mongolen oder Tuwa sind. Das ist eine Krankheit, die heißt bei uns belingneer und bei den Mongolen uulgamtsch. Pürwü, die große Schamanin, litt darunter. Sie war sehr schreckhaft, selbst wenn sie schamante. Bekam sie einen Schreck, rief sie hässliche Sachen aus: Ok gödek! Oh, Möschen! Hoppla! oder Ok godak! Oh, Penis! Hoppla! Es gibt Menschen, die bestimmte Sachen nicht ertragen können. Ein jüngerer Bruder der Schamanin, Bigir hieß er – der starb früh, mit siebenunddreißig Jahren –, war bekannt dafür, dass er belingneer hatte. Und dessen jüngerer Bruder Dagwa, der erst vor wenigen Jahren gestorben ist, der war auch dafür bekannt. Diese Menschen kannst du auf sehr einfache Weise dazu bringen, dass sie Sachen nachmachen. Wenn du dich über sie lustig machen willst, machst du einfach irgendeine ruckartige Bewegung. Sie erschrecken und machen nach, was du ihnen vorführst. Ich habe mit alten Männern und Frauen experimentiert. Habe Twist getanzt, und sie haben mitgetwistet. Du kannst Fremdsprachen mit ihnen betreiben. Schwere deutsche Wörter und Sätze sagen, und sobald du dazu eine ruckartige Bewegung ausführst, sie damit aufschreckst, machen sie alles mit. Du kannst rennen, hüpfen, springen. So einen alten, kranken, hinkenden Menschen kannst du derart auf Trab halten. Er wird nichts dagegen tun können und am Ende nur zusammenbrechen. Das ist eine Krankheit, die mit den Hirnfunktionen Zusammenhängen muss. Viele Völker haben ja Krankheiten, die andere gar nicht kennen. Dazu dann noch eine weitere Krankheit: hej, Luft, die ihr gar nicht habt. Wenn wir eine Zeit lang, drei, vier Tage lang keine warme Brühe zu uns nehmen, dann bekommen wir hej. Der Bauch bläht sich auf, und dann bekommen wir am Ende sogar überall Schwellungen. Die Finger quellen auf, und das Gesicht wird schließlich aufgedunsen. Wenn wir dann endlich eine Suppe bekommen – das ist meistens Hammelbrühe – müssen wir rülpsen. Hej tritt sofort auf, sobald die Hammelbrühe fehlt.
Schimpfwörter kennen wir natürlich auch, aber es sind andere, die ihr gar nicht benutzen würdet. Obwohl, in meines Vaters Jurte wurde nicht geschimpft. Wenn wir als kleine Kinder ein ganz harmloses Schimpfwort gebraucht hatten, da mussten wir uns eine ganze Geschichte anhören. Da wussten wir, das geht nicht.
Nur: Du olle Ziege! Du dumme Kuh! das kennen wir nicht. Dafür mola, das heißt Totengrab. Dieses Schimpfwort sagt man zu Kasachen, wenn man sagen will, es ist ein schlechter Mensch, ein toter Kerl. Auf Tiere schimpft man auch. Da nennt man Tierkrankheiten. Dschoksaga ist eine Hirnkrankheit bei Schafen. Das Hirn bekommt eine Wasserblase, und die muss herausoperiert werden. Wenn also jemand so unwillig ist und nicht mehr hört, was man ihm sagt, dann sagt man: Hör doch auf, du dschoksaga, Hirnkranker. Schimpfwörter gibt es natürlich, aber solche, die sich auf Tiernamen beziehen, die gibt es in all den Sprachen nicht. Was es gibt, ist Hund. Aber dies kann auch liebevoll gemeint sein. Zu Kleinkindern sagt man: Mein Hündchen. Was macht euer Hundejüngchen? So fragt man liebevoll nach dem Nachwuchs. Der ist ein Hund, kann man auch sagen. Und das bedeutet, er ist ein ganz listiger Kerl. Aber so, dass man zu einem Mann Kamel sagt, oder Gaul, oder zu einer Frau Kuh oder Ziege, das gibt es in der Stammeskultur nicht, wo die Menschen von und mit diesen Tieren leben. Das Kuriose ist, du kannst es so oder so sagen. Du kannst es auch sehr liebevoll sagen. Wenn ich es sehr eng, vertraut mit dir meine, dann kann ich zu dir sagen: Du, meine Dirne, komm! Du, mein Nüttchen, gib mir dein Guschel! Damit meine ich nicht die Dirne, die Nutte, die in deiner Sprache zu Hause ist.
Alle Nomadenvölker verwenden Umschreibungen. Wichtige, höherstehende, für heilig gehaltene Dinge nennt man nicht beim Namen. In meinem Roman ›Der blaue Himmel‹ geht es um den Namen des Himmels, deeri ist dafür der große, schwere Name. Den darf man nicht nennen. Nur in einem sehr kritischen Zustand darf man das schwere Wort aussprechen, dann ist es aber schon eine Herbeibeschwörung. Auch bei den Geistern, die der Schamane ruft, ist es so: dshiwesi gelir. Das ist, wörtlich übersetzt: Ihre oder seine Sachen kommen. Dshiweler ist das umschreibende Wort für die Geister. Der Wolf wird bei uns auch nicht genannt. Wir sagen zu ihm: Großvater, eshej. Und jeder versteht, was damit gemeint ist. Kein Mensch sagt bör, Wolf. Weil er gefährlich ist. Das Erhabene und das Gefährliche werden nicht direkt genannt. Große Berge auch nicht, man sagt haarakan. Flüsse genauso wenig. Homdu heißt unser großer Fluss. Kein Mensch sagt Homdu. Mutter sagen wir, oder die große oder die mütterliche Schwester.
Als die ersten Europäer zu den nordamerikanischen Indianern kamen, stellte man fest, dass sie keinen Gott kennen. Die haben nicht darüber gesprochen. Die hatten keinen Namen dafür. Und dann hat man gesagt: Nun, das sind Heiden, die kennen keinen Gott, deswegen kann man sie ruhig umbringen, sie sind ja die Gottlosen. Erst später fand man heraus, sie haben das Höchste nicht benannt, einfach weil es ihnen zu heilig war. Ein Christ nimmt aber seinen Gott ständig in den Mund. Ja, er kann mordend Gott sagen, mein Gott! Aber es ist dann ihr Gott, der solches erträgt. Das ist typisch für den Abendländer, er redet dauernd über eine Sache, die er damit auch fortwährend befleckt. Und mit dem Schwert in der Hand verbreitet er so seinen Glauben.
Im himmellosen Land
Weißt du, manchmal kommt es mir vor, ich denke inmitten Europas anders. Ich versuche zu denken, dann aber ist es, als wenn meine Längen irgendwie gestört sind und ich komme nicht bis zum Ende. Da muss ich zurück in die Steppe kommen, mich auf die Erde setzen, am besten auf der Erde liegen, den Himmel über mir sehen und diese große Ruhe um mich herum, diese vielen Schwingungen auf mich wirken lassen, und wenn ich dann nochmal versuche zu überlegen, komme ich vielleicht an ein Ende.
Ich bin überhaupt sehr widersprüchlich. Das merke ich jeden Tag an mir selber. Gut, dass ich mir dessen bewusst bin. In meiner Haut stecken mehrere Menschen. Und so unterschiedliche. Ich bin der Dichter. Nehme verschiedene Rollen an, und aus jeder Rolle heraus erzeuge ich mich jedes Mal als einen ganz anderen Menschen. Das merke ich. Meine besondere Gabe ist, dass ich mich selber wie ein Außenstehender ganz schonungslos betrachten kann. Diesmal hatte ich in Deutschland einundzwanzig Lesungen, in der Schweiz fünf, und jedes Mal habe ich mich selber beobachtet. Bin jedes Mal anders gewesen, kein Abend hat dem anderen geglichen, obwohl ich im Grunde immer nur über das eine redete. Wahrscheinlich bin ich ein launischer Mensch, der abhängig ist von dem Tag, von der Stunde, von dem Publikum, von dem Raum, der mich gerade umgibt.