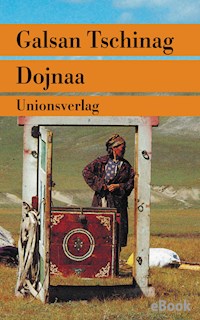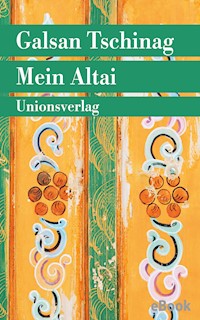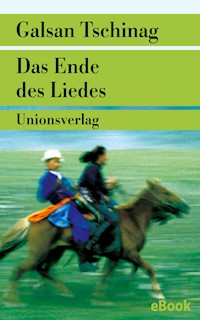8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Galsan Tschinag, Stammesoberhaupt tuwinischer Nomaden, erfüllt sich 1995 einen Traum: Über zweitausend Kilometer führt er einen Teil seines in den Sechzigerjahren zwangsumgesiedelten Volkes zurück, zu den Weideflächen und Jagdgebieten im Hohen Altai. Ganze Generationen ziehen in einer biblisch anmutenden Karawane mit schwer beladenen Kamelen über schroffe Berge und durch karge Steppen nach Westen, um die ursprüngliche Lebensweise als Nomaden wieder aufzunehmen. In Geschichten und Tagebuchnotizen berichtet Galsan Tschinag von der Verwirklichung seines Traums mit ungewissem Ausgang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Über zweitausend Kilometer führt Galsan Tschinag 1995 einen Teil seines in den Sechzigerjahren zwangsumgesiedelten Volkes zurück, zu den Weideflächen und Jagdgebieten im Hohen Altai: eine biblisch anmutenden Karawane. In Geschichten und Tagebuchnotizen berichtet Tschinag von der Verwirklichung seines Traums mit ungewissem Ausgang.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag
Die Karawane
Reisebericht
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Erstausgabe erschien 1997 im A1 Verlag, München.
© by Galsan Tschinag 1997
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Amélie Schenk
Umschlaggestaltung: Heinz Unternährer
ISBN 978-3-293-30349-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 23:12h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE KARAWANE
PrologDie Geschichte beginnt mit VerspätungDie VorgeschichteDer Alltag schreibt GeschichteNachtrag zur VorgeschichteDie Geschichte fließtDie Gegengeschichte nimmt ihren AnfangFließe und wachse GeschichteDie Geschichte sickert durch Sand und KälteDie Geschichte eines TugrikmillionärsDie Geschichte eines HabenichtsTagebuchnotizen3. Mai 19957. Mai8. Mai9. Mai10. Mai11. Mai13. Mai15. Mai16. Mai17. Mai18. Mai20. Mai21. Mai22. Mai23. Mai24. Mai25. Mai26. Mai27. Mai28. Mai29. Mai30. Mai31. Mai1. Juni2. Juni3. Juni5. Juni7. Juni8. Juni9. Juni10. Juni11. Juni12. Juni13. Juni14. Juni15. Juni16. Juni17. Juni19. Juni20. Juni21. Juni22. Juni23. Juni24. Juni25. Juni26. Juni27. Juni28. Juni29. Juni30. Juni1. Juli2. Juli3. Juli4. Juli5. Juli6. Juli7. Juli8. Juli9. Juli10. Juli11. JuliEpilogWorterklärungenÜber die TuwinerMehr über dieses Buch
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Nomaden
Zum Thema Asien
Prolog
Ich will Geschichte machen. Die Menschen halten mich für verrückt, zunächst fast alle, zum Schluss nur noch wenige. Ich weiß, was ich tue, und kein Gerede ist imstande, mich von dem Weg abzubringen, der vor mir liegt und wie vom Schicksal vorgezeichnet scheint. Am Morgen des Tages, an dem ich die Heimatecke verließ, bekam ich von den Eltern meine Aufgabe im Leben zugewiesen. »Gakaj ist unser Kind«, sagte Vater mit Blick auf den um drei Jahre älteren Bruder, der neben mir saß und friedlich kaute, »und so wird er sich auch um uns kümmern. Dich aber«, und er schaute mir fest in die Augen, »entlassen wir, auf dass du weiterkommst, mehr lernst und auch mehr auf dich nimmst als er und jedes andere der Geschwister. Denn du bist des Volkes Kind, und so ist dir der Altai die Jurte, und der Stamm Vater und Mutter.«
»Seit Generationen, zumindest so weit unser kurzes Gedächtnis zurückreicht, sind deine Vorfahren die Stützen des Volkes an den fünf Flüssen gewesen«, meldete sich Mutter, die links neben Vater einen halben Hintern weiter zum Herd saß, »und es hat seinen Kopf mit dem vorausschauenden Auge und der Entscheidungen fällenden Zunge immer in eurer Sippe gesehen.« Darauf hatte ich nichts zu erwidern. In unserer Sprache brauchen Worte Stille, um anzukommen. Mit der Zeit waren sie erst einmal an mich gerichtet, und ich war achtzehn Jahre alt.
Die Geschichte beginnt mit Verspätung
Am ersten Tag des noch winterlich kalten mongolischen Frühjahres verlässt ein Lastwagen die Hauptstadt in südlicher Himmelsrichtung. Den lackneuen Viertonner fährt ein junger Bursche, der durch seinen dünnen Hals und die abstehenden Ohren noch wie ein Kind wirkt, der aber mit dem Schicksal behaftet ist, das älteste von vier Geschwistern zu sein, und so frühzeitig von der Kindheit hat Abschied nehmen müssen.
Neben ihm sitzt sein Vater, der erst am Morgen zu ihm gesagt hatte, ab Stunde seien sie zueinander nicht mehr Vater und Sohn, sondern Häuptling und Fahrer, und dies solange, bis sie wieder zu Hause angekommen seien. Er, der Häuptling, sitzt unbequem, denn seine ausgestreckten Beine liegen auf zwei prallen Säcken, die das geräumige Fahrerhaus mit der schönen lederbezogenen Sitzbank zu einem Lagerraum verunstaltet haben.
Im Ladekasten, unter einem Verdeck, hocken neun junge Männer. Ein jeder von ihnen ist mit einem Jagdgewehr ausgerüstet, denn sie haben in der Tat etwas zu verteidigen. Die beiden Säcke im Fahrerhaus, jeder so schwer wie ein ausgewachsenes Schaf, enthalten Bargeld.
Ihr Ziel ist die Wüste Gobi. Dort wollen sie Kamele kaufen, und diese dann gut dreiunddreißig Örtöön weit in den Norden treiben, wo sie spätestens zur Mitte des Frühjahres angekommen sein müssen.
Auf dem Gesicht des Fahrers bemerkt der Häuptling dessen Aufregung. Auch er selbst ist aufgeregt, doch er ist es zunächst aus einem anderen Grund. Ursprünglich wollten sie nämlich um acht Uhr abfahren, was schon vor einem Monat festgelegt worden war, jetzt hatten sie jedoch bereits vier Stunden Verspätung, weil sie auf ein Schriftstück warten mussten, dessen Text vom Häuptling verfasst war, der aber auf einen offiziellen Kopfbogen umgeschrieben und mit dem entsprechenden Stempel versehen erst einen Sinn machte.
Das Schriftstück, das Schwierigkeiten ausräumen sollte, die auf künftigen Wegen auftauchen konnten, war das Ergebnis eines langen, schwierigen Streitgesprächs zwischen zwei Männern.
Beide waren Häuptlinge. Der eine der eines Staates und der andere der eines Stammes. Also steckte jeder in einer Rolle, und beide schossen als Zielscheibe auf einen Vertrag, der aus grauen Vorzeiten stammte, und, da er noch nicht außer Kraft gesetzt war, rechtskräftig sein musste. Dieser Vertrag verpflichtete den Ersteren, während er den Letzteren berechtigte. Und so war es nur allzu verständlich, dass die beiden Männer durch ihn in einen Streit gezogen wurden.
Der Stammeshäuptling, der in der kleineren Rolle weniger zu verlieren hatte, gebärdete sich von Anfang an unbändiger, und der Staatshäuptling sah sich irgendwann gezwungen, ihn zu besänftigen, indem er ihm recht gab und meinte, dass man eigentlich etwas tun müsse für die Menschen, die seinerzeit Aufopferungsvolles und Gemeinnütziges geleistet hätten.
Das aber stimmte den anderen noch kämpferischer. Alles sei beim Namen genannt, nicht irgendjemand solle etwas unternehmen, sondern der Staat, und nicht irgendetwas solle dieser tun, sondern einen jeden solle man dorthin zurückbringen, wo er vorher gelebt hatte. Und dies müsse auf Kosten des Staates geschehen wie damals auch, als es darum ging, ein Volk, das Jahrtausende in sich geschlossen und an einem Ort gelebt hatte, wie einen enthäuteten Körper auseinanderzunehmen und in alle möglichen Töpfe zu werfen!
»Ich verstehe«, entgegnete der in der größeren Rolle friedfertig und fügte dem nach einer Pause hinzu: »Aber was soll ich tun, wenn die Regierung kein Geld hat!« Seine Stimme verriet Müdigkeit.
Der andere musste darauf gewartet haben, denn er nickte dazu verständnisvoll und sagte leise, wie nebenbei: »Dann werde eben ich die Mittel dazu aufbringen.« Und er sah sogleich, dass er gehört worden war. Er hatte gewusst, dass er gehört und verstanden werden würde, wie neuerdings immer bei jedem, wenn dort, wo kein Geld vorhanden war, welches ins Spiel kam.
Die Augen des Staatshäuptlings, die soeben kaum noch zu glimmen schienen hinter den schweren, fast rechteckigen Lidern, schauten nun unter den dichten, buschigen Augenbrauen rund und mit fast jugendlichem Glanz herüber. Vorsichtig fragte er: »Du willst das Geld aufbringen?«
Der Stammeshäuptling bejahte die Frage, sichtlich stolz, wurde darauf jedoch ungehalten: »Nun werden Sie fragen, weshalb ich die Last auf meine Schultern nehmen will, die eigentlich die Regierung zu tragen hat. Nicht aus Verrücktheit, die mir viele nachsagen, auch nicht aus lauter Patriotismus, den mir einer vielleicht andichten könnte! Nein, ich nenne Ihnen den wahren Grund, und der ist einfach: Das Volk, von dem ich abstamme, stirbt vor meinen Augen aus, und keine Regierung schert sich darum. Ich will der Geschichte, die an uns vorbeizuströmen und uns als toten, namenlosen Schwemmkörper liegen zu lassen gedenkt, in die Zügel greifen!«
Der in der größeren Rolle mahnte: »Die Politik braucht nicht unbedingt eine schöne, umso mehr aber eine klare Sprache!«
Der Kleinere gab schnell und gerne nach: »Ich werde mein verstreutes Volk sammeln und es mit einer Karawane ohne Beispiel in der Geschichte in die angestammte Heimat zurückführen!«
»Karawane sagst du? Kamele also brauchst du?«
»Ihr Wohlwollen brauche ich!« Dann gab es Tee, und der Rollenunterschied verschwand.
Das alles war vor einem halben Jahr gewesen. Wenig später tauchte der zu jener Stunde vereinbarte Text im Vorzimmer des Staatsoberhauptes auf, und dieser, bereits mit dem Inhalt vertraut, ordnete nur noch an, dass alles auf das gewünschte Blatt umgeschrieben und mit dem Stempelabdruck versehen an den zurückgeschickt werden solle, von dem es gekommen war.
Doch der Weg der Bürokratie erwies sich wieder einmal als lang, länger jedenfalls als Zeit und Geduld gewöhnlicher Sterblicher. Weder Bitten noch Druck halfen, sosehr auch derjenige, der das Schriftstück benötigte, den Lauf der Dinge zu beeinflussen versuchte. Zu seinem Pech war der Mann, der die Suppe miteingebrockt hatte, für längere Zeit verreist, und der Häuptling sah sich fassungslos einem Apparat gegenüber, der schon eine Ordnung zugrunde gerichtet hatte und nun dabei war, die nächste in den Bankrott zu treiben.
Der letzte Tag vor dem beschlossenen Aufbruch verstrich, und die Kameltreiber standen bereit. Das Schriftstück aber war immer noch nicht eingetroffen. So griff der Stammeshäuptling in der Nacht aus Verzweiflung zum letzten Mittel und erklärte dem, der den Haupthebel der morschen Bürokratie bediente, den Krieg, den Telefonkrieg.
Am anderen Ende des Drahtes meldete sich ein keuchender Mann, der sich bald als jähzornig entpuppte. Für den Angreifer sollte dies wichtig werden, denn deshalb durfte er auf einen Sieg hoffen, und so geschah es am Ende auch. Nach dem vierten Anruf innerhalb einer Stunde merkte der Krieger, dass sein Opfer zusammenbrach, indem es ihn im Namen des Himmels bat, sich bis zum nächsten Tag zu gedulden, Punkt zehn Uhr werde er das verflixte Schriftstück in Händen halten.
Also ließ er von ihm ab und wusste trotzdem nicht, ob er einem eingefleischten Bürokraten restlos trauen konnte. Dieser Zweifel war es wohl auch, der ihn noch nach Mitternacht dazu trieb, einen Brief an den anderen Häuptling zu schreiben, in dem sich alles niederschlagen musste, was zuvor gegenüber dem Staatsangestellten mündlich gesagt worden war: Totale Unfähigkeit wurde dem Staatsapparat vorgeworfen, und da dies so sei, verkündete der kleine Häuptling nun feierlich, dass er sich von Stund an weigere, die Gesetze des längst unfähigen und von Anfang an unredlichen Staates zu respektieren und aus eben diesem Grunde sich jedes Mittel erlaube, um das Ziel zu erreichen, das den Sinn seines Lebens ausmachte.
Während er solches niederschrieb, kam er sich wie ein Nachfahre der edlen Gesetzlosen vor, die als Beschützer des benachteiligten, niedrigen Volkes gegen die Herrschenden ankämpften und gerade deshalb in die mündlichen Überlieferungen des Nomadentums eingegangen waren. Und der Mensch, der in diesem Augenblick die auf ihn zugestürzte Rolle des Häuptlings materiell zu spüren glaubte, war von einem süßlich-schweren Gefühl erfüllt. Dann schaute er auf den zugeklebten Brief, erleichtert und bestätigt in der Freiheit, die er sich soeben zugeschrieben hatte. Bestechen, betrügen, bestehlen – so, wie andere es längst tun, dachte er mit kindisch sanftem Lächeln auf den Lippen, als er später endlich im Bett lag und in die Finsternis starrte. Doch erreichen, ging der Gedanke weiter, was ich mir einmal vorgenommen, um jeden Preis erreichen will ich es und die Geschichte, die nie gerecht, nie wahr geblieben, immer nachträglich verschnitten und verformt worden war, nun in die Hand nehmen wie einen Klumpen Lehm, ihn durch die Finger pressen und ihr Form und Namen geben, und wenn es sein muss, sie dabei auch biegen und brechen.
Der Brief blieb unabgeschickt, denn der Mann, der im Namen des Himmels geschworen hatte, vermochte zwar nicht den genannten Termin einzuhalten, sein Versprechen aber mit einer zumindest für ihn unbedeutenden Verspätung doch einzulösen. Und der kämpferische kleine Häuptling verzieh dem Bürokraten und dem Staat alles, als er das verdammte Schriftstück auf dem erwünschten Bogen mit dem notwendigen Stempel in der Hand hielt.
Endlich glaubte er wieder daran, dass er ein Sonntagskind war, geboren zur Stunde des Sonnenaufgangs und vorbestimmt, so manche Wünsche äußern zu dürfen, die dann auch in Erfüllung gingen. Nun saß er auf Geld, führte Menschen, war beschützt und in einer Rolle, die ihm gefiel, er als der geschichtemachende Häuptling des ältesten Stammes der Nomadenwelt.
Nun bewegte er sich auf sein Ziel zu, und Kilometer um Kilometer verkürzte sich der Weg, der über Steppen, Wüsten und Berge führen, aber an der samtenen Schwelle zum gletscherbunten und himmelhohen Altai sein Ende finden würde.
Minute um Minute bröckelte die Zeit ab, die aus Tagen, Wochen und Monaten besteht, doch irgendwann auch zu Ende gehen würde. Dem Abenteuer, das noch keiner gewagt hatte, war die Tür jetzt aufgestoßen. Der Berg hatte sich bewegt, die Geschichte hatte begonnen.
Die Vorgeschichte
Wieder einmal hatte der Gelbe Sedip einen roten Kopf. »Ich möchte noch Folgendes sagen!«, brüllte er nun schon zum dritten Mal, während er seinen Blick über die zusammengepferchten Menschen im Raum gleiten ließ und ihn wie eine stechende und schneidende Schere auf die drei Männer warf, die vorne an einem Tisch mit dem Gesicht zu den Versammelten saßen, ein jeder auf einem hohen Stuhl.
»Du hast genug geredet, und wir haben dich verstanden. Du erdreistest dich, dem Beschluss der Bezirksleitung zu widersprechen!«, unterbrach ihn der Versammlungsleiter, der mittlere der drei, ein wohlbeleibter Mann um die Vierzig. Auch er hatte einen roten Kopf, der im Unterschied zu dem von Sedip fleischig und rund war, riesig wirkte und zwischen dem dünnen schwarzen Deckel aus langen, nach hinten gekämmten Haaren und dem ebenso runden Oberkörper ohne Halsansatz festgeklemmt schien.
Der Mann sprach gequetscht und gequält, was in Verbindung mit seiner Statur noch mehr Gewicht bekam. Der Tisch mit der dunkelroten Decke war für alle drei zu kurz, und da keiner von ihnen ganz daneben sitzen mochte, mussten sie sich zusammendrängen.
»Hör mir zu, Batyj, du großer, fetter Mensch mit dem Hirn eines Spatzen und dem Herzen eines Hasen!« Wildentschlossen fuchtelte dabei der Redner mit der Hand, als wolle er damit auf seinen Widersacher einhacken. »Ich bin nicht jemand, der sich von einem wie dir vorschreiben lässt, was er zu sagen hat und was nicht, geschweige denn, sich das Wort verbieten lässt. Nein, Genosse Noch-Darga, du wirst dich, hoffe ich, noch daran erinnern, dass ich meine Jugend der Sache der Revolution verschrieben habe als einer der allerersten fünf Kommunisten auf tuwinischem Boden, ich, Sedip, mit dem feuerroten Parteibuch, das ich zur Herzseite getragen habe!«
Wieder ist es der Wohlbeleibte mit dem glühenden Vollmondgesicht, der ihn unterbricht und höhnisch erwidert: »Das Parteibuch, das dir dann entzogen wurde! Dir würde ich raten, die Vergangenheit lieber nicht zu bemühen, da du sonst deine Schande hier noch einmal auftischen müsstest, denn keiner hat vergessen, was gewesen ist, und eine andere aufgeputzte Geschichte wird man dir hier nicht abnehmen, du Möchtegernkommunist und winziger dummer Blindgänger einer großen Stunde! Ist es so gewesen oder nicht? Ich frage dich vor dem Volk, du Gelber Sedip, Sohn des Schyrysch!«
Gelächter bricht aus. Die Menschen, die seit Stunden dicht gedrängt auf hölzernem Boden sitzen müssen, kommen in Bewegung, ein allgemeines Gemurmel entsteht. Der kahlrasierte, hagere Kopf des Redners glüht.
Da springt aus der unruhigen Menge Gasybaj, Sedips jüngerer Bruder, auf: »Noch ein beleidigendes Wort, du Sohn der Schwarzen Baashaj, und ich werde dir den Schädel spalten, damit du es weißt! Ich habe deine tote Mutter genannt, weil du zuerst unseren toten Vater genannt hast! Du siehst, wir haben einen Vater, nach dem wir genannt werden, wen aber hast du, Buschkind und Arschlecker?!«
Der Wohlbeleibte muss aufspringen und mit der Faust auf den Tisch schlagen. Dann brüllt er: »Ruhe, Ruhe!« Sofort tritt Stille ein. Ein jeder fällt in die Haltung mit eingezogenem Kopf und gesenktem Blick zurück. Nur die beiden Schyrysch-Söhne stehen aufrecht wie die letzten Lärchen in einer Wüste von Baumstümpfen.
»Sie haben, Genosse Gasybaj, von einer Beleidigung gesprochen«, fährt der Versammlungsleiter nun etwas gefasster fort, da er zufrieden ist über die so schnell wieder hergestellte Ordnung, »von einer Beleidigung, die es nicht hätte geben dürfen, einverstanden, aber ich frage, wer hat hier wen beleidigt?« Nach einer kleinen Pause, die gewollt ist, geht es mit aller Wucht weiter: »Sie, Genosse Gasybaj, haben nicht nur mich, sondern in meiner Person auch die Staatsmacht beleidigt, denn das, was Ihnen soeben über die Lippen gerutscht ist, passt genau zu dem Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch der Mongolischen Volksrepublik! Ist Ihnen dies bewusst?«
»Das mag sein«, pflichtet Gasybaj sichtlich eingeschüchtert bei, »doch zu dem unerfreulichen Wortwechsel ist es nur gekommen, weil Sie, Genosse Darga, dem Volk die Redefreiheit verweigern wollten, die ihm laut revolutionärem Gesetz zusteht, oder?« Damit wendet er sich ans Publikum, das ihn umgibt wie eine breite, schwere Flanke gegen die drei Männer, die sich hinter dem Tisch verbarrikadiert haben.
»Jawohl!«, tönt es vielstimmig aus der auf dem Boden hockenden Menschenmenge, aus der jetzt einzelne Stimmen zu vernehmen sind.
»Warum hört man nicht auf uns?« »Wir meinen, wir sind das Volk … das die Revolution gemacht hat, und dem nun der Staat gehört!«
Unsicherheit fährt in den Genossen Versammlungsleiter, der nun mit versöhnender Stimme eingreift: »Als ehrlicher Parteigenosse verhalte ich mich zur eigenen Tat kritisch und verspreche hier vor dem Volk: Solches wird nicht wieder vorkommen!«
Alsbald geht er jedoch wieder in die Offensive, sein Körper nimmt Haltung an, und die Stimme wird härter: »Das soll natürlich nicht heißen, dass ich stumm und untätig bleiben kann, wenn sich einer Worte herausnimmt, die die Prinzipien des Sozialismus in Zweifel ziehen. Ich fühle mich in meiner Funktion als Vorsteher eines Kreises und einer landwirtschaftlichen Vereinigung voll und ganz verantwortlich für alles, was hier geschieht, und werde als entscheidender Kopf und ausführende Hand der Partei und des Staates jedem Versuch, fehlerhafte Einschätzungen in Sachen der Leninschen Nationalitätenpolitik einzuschmuggeln, eine gnadenlose Abfuhr erteilen!«
Damit lässt er für einen kurzen Moment den Blick über die geduckten Köpfe der Versammelten schweifen und scheint zufrieden zu sein. Er setzt sich, und Gasybaj folgt seinem Beispiel. Der Gelbe Sedip aber bleibt weiterhin stehen.
»Über zweitausend Menschen leben hier im Kreis Zengelchairchan, und keiner ist gefragt worden, was er davon hält, nein, nicht einmal Sie, Genosse Kreisvorsteher, der Sie sich soeben für alles, was hier geschieht, für verantwortlich ausgaben, nicht einmal Sie sind gefragt worden!«, setzt der Redner, der sich inzwischen wieder in der Gewalt zu haben scheint, von Neuem an. »Und wieso geschieht es, dass eines Morgens, gleich Heuschrecken, Schwärme von Kasachen zu Fuß und zu Pferd auftauchen?«, will er in ruhigem Ton fortfahren, wird jedoch vom Versammlungsleiter unsanft unterbrochen: »Was reden Sie von Kasachen und von Heuschrecken, Genosse? Ich warne Sie!«
Sedip stockt, fährt zusammen, und seine tief liegenden grünen Augen sprühen zwei Strahlenbündel nach vorn, wo sie die drei Männer treffen. Die beiden Schatten, die den Wohlbeleibten in ihrer Mitte eingezwängt halten, scheinen seit Langem erstarrt. Jetzt bewegen sie sich erstmals, und Sedip legt los: »Von Kasachen rede ich deswegen, weil sie es waren, und nicht Tuwiner, nicht Chinesen, weder amerikanische Imperialisten noch japanische Militaristen! Und von Heuschrecken, weil ein jeder hier die schwarze Plage zur Genüge kennt, wenn fliegende Insektenschwärme das Land inmitten des grünen Sommers wieder und wieder heimsuchen und es innerhalb weniger Tage kahl fressen. Ja, als die Fremden kamen, sich niederließen und sagten, von Stund an würden Erde, Luft, Wasser, das Gebüsch und selbst unsere windschiefen Scheunen ihnen gehören, da musste ich, ein Mann mit sechzig Jahren und einer Menge Lebenserfahrung auf dem Buckel, an jene Plage denken!«
»Du hättest ja von Ortsfremden oder einfach von Menschen reden können!«
»Menschen? Hinter dem Präsidiumstisch sitzen drei Menschen, wie klingt das? Vielleicht ein Mann, eine Frau und ein Kind? Nein, ein Tuwiner und zwei Kasachen, möglicherweise Nachkommen von jenen Räubern, die deine Großmutter vergewaltigt und deinen Großvater erschlagen haben. Wenn sie selbst auch nicht ganz so schlimm waren, so sind sie doch bestimmt bis heute deine und meine Dargas! Nein, Sohn der Schwarzen Baashaj! So, wie sie dich in diesem Augenblick zwischen sich einzwängen, so werden sie dich auch künftig haben wollen! Ob du ihnen dienst oder nicht dienst, ihr Dank dir gegenüber wird heißen: Wir werden dich um alles bringen!«
Das Präsidium schreibt dreifach mit. Niemand unterbricht den Redner. Erst jetzt, nachdem sich dieser gesetzt hat, sichtlich bewegt, dass er sich hat aussprechen können, und auch im Publikum ein lebhaftes Gemurmel und Getuschel aufkommt, erhebt sich der Kreisvorsteher, wuchtig und wichtig. Er zögert noch, den Mund aufzutun, und lässt vorerst den Blick ruhig über die Gesichter gleiten, als müsse er jede Bewegung, jedes Zeichen auf diesen erhitzten, erschöpften, aber nun mit einem Mal belebten und bewegten Gesichtern in sich aufnehmen. Dann redet er, tut dies bedächtig, scheint jedes Wort vorher hinter den Zähnen abzuwägen und zurechtzulutschen, bevor er es loslässt, behutsam zwar, aber mit leichter Schärfe.
»Das Bild, das Sie da hingemalt haben, Genosse Sedip, sieht überhaupt nicht nach Lebenserfahrung aus, sondern stinkt nach schmutzigem Nationalismus und politischer Blindheit! Hiermit entziehe ich Ihnen endgültig das Wort und teile Ihnen außerdem offiziell mit, dass ich diesen Fall zur Klärung vor die Kontrollorgane bringen werde!«
Diese Worte vernichten. Die Versammelten, deren Köpfe nach und nach wieder in die Höhe gegangen sind, ducken sich erneut, und Sedip, der jähzornige Mensch, der nun eigentlich erst recht in Weißglut kommen müsste, stockt, zögert, hält den Kopf schief, überlegt und fängt darauf verzweifelt zu stammeln an: »Aber Darga, mein Darga, ich meine, ich meinte es nicht so, bitte glauben Sie mir, ich schwöre es bei meinen toten Eltern!«
Seine hohe, krächzende Stimme zittert, geht in Winseln über, und mit einem Mal beginnt der alte dürre Mann zu schluchzen wie ein Kind, dem eine bittere Kränkung widerfährt. Man könnte meinen, die Stille lebt, denn mit einem Mal nehmen die Sinne Dinge wahr, die ihnen bisher verschlossen waren. Diese seltsame Stille, ein Vorhang im Hintergrund, im Vordergrund aber Sedips Geheul, das nicht aus ihm, sondern aus einem unsichtbaren und ohnmächtigen Tier herauszukommen scheint, das gegen die schwere, glühende und stinkende Stille ankämpft, um in sie einzudringen und sie zu brechen.
Vergeblich erwartet man vom Versammlungsleiter, er möge seine Macht ausspielen, in die Geschehnisse eingreifen und den schluchzenden und röchelnden Erdenwurm anschreien, ja, auch vernichten, wenigstens aber endlich erlösen und so der Pein, die sengend und erstickend in der Luft liegt und jeden berührt, ein Ende bereiten. Doch der Darga, dieser Hengst der Menschenherde, sitzt still und schweigt. Er muss verwirrt sein, beschämt vielleicht, aber ganz bestimmt auch die verheerenden Folgen seiner eigenen Macht genießend.