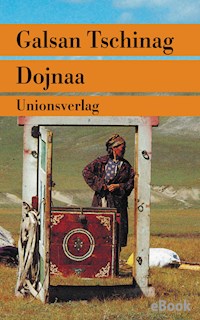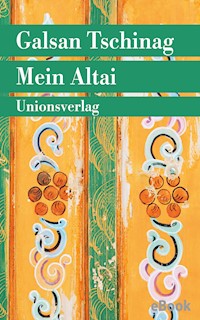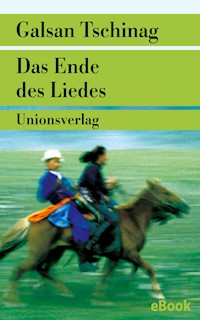11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Galsan Tschinag erzählt mit großem Einfühlungsvermögen die Geschichte eines Jungen, er schildert das Leben der Nomaden in der Steppe der Mongolei, den Überlebenskampf der Familie, das Zerbrechen der alten Strukturen und Traditionen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Galsan Tschinag
Der blaue Himmel
Roman
Suhrkamp
Meiner Großmutter – der wärmenden Sonne am Anfang meines Lebens
Der Traum
Möglich, diese Geschichte hat ihren Anfang in einem Traum genommen. War es eine Vorbereitung auf das, was einmal eintreten würde, eine Warnung vielleicht? Denn der Traum war böse, böse – ein Alptraum.
Es hieß, von bösen Träumen dürfte man keinem Menschen erzählen, dafür ins Leere sprechen und hinterher dreimal ausspucken. Auch von guten hieß es ähnlich. Man durfte sie keinem verraten, sondern man sollte sie für sich behalten. Waren es also solche Träume, die weder böse noch gut waren, von denen man erfuhr?
Der Tag in der Jurte begann gewöhnlich damit, daß von den Träumen berichtet wurde, die man in der Nacht geträumt hatte, und dies löste oft Freude oder auch Sorge aus, wie man den Zuhörern ansehen konnte – seltsam!
Aber diese Regel kannte ich noch nicht, als ich den Traum hatte. So erzählte ich ihn weiter, und zwar noch brüh- oder in diesem Falle besser tränenwarm. Denn ich hatte geweint und war geweckt worden. Es war meine Mutter, die mich weckte. Sie war beim Morgenmelken gewesen und in die Jurte gekommen, um den vollen Melkeimer zu entleeren. So war ihre Hand, die mich streichelte, naß und kühl und roch nach roher Milch.
Immer noch schluchzend erzählte ich ihr von dem, was ich soeben geträumt hatte. Allein sie behauptete, nachdem sie meinen Bericht angehört hatte, das sei ein guter Traum. Ich argwöhnte, sie habe mir nicht gut zugehört, denn sie war damit beschäftigt gewesen, die Milch durch ein Büschel Yakschwanzhaar in den großen Aluminiumkrug durchzuseihen, während ich erzählte. »Nein!« sagte ich heftig und machte Anstalt, wieder zu schluchzen, doch meine Mutter blieb bei ihrer Behauptung. Mehr noch: Sie sprach von einer verkehrten Deutung des Traumes, von Gold, Silber, Seide, von Festen und Süßigkeiten. Ich begriff nichts.
Doch dieses behielt ich: Keinem erzählen, ins Leere sprechen und dann dreimal ausspucken!
Das hat sie verraten, nachdem sie sich vor der Türschwelle noch einmal umgedreht hatte. »Aber dies nur bei einem wirklich bösen Traum!« hat sie warnend gesagt.
Natürlich war es ein böser Traum. Also mußte ich tun, was getan werden mußte. Aber ich hatte doch einer, Mutter, davon schon erzählt?! Was nun?
Ich überlegte, während ich unter dem alten, wattierten Lawschak hervorkroch, der einmal Vater gehört haben mußte und nun meine Schlafdecke war. Und ich überlegte immer noch, als ich mich auf den Weg in den neuen Tag machte.
Es empfing mich ein hellichter Sommermorgen, es roch nach Tau, Sonne und Viehharn; lärmend verließ gerade die Schafherde die Hürde, die Lämmer blieben an den Höne und bildeten einen viereckigen weißen Fleck. Die Frauen und Mädchen waren an der Dshele dabei, die Yakkühe zu melken: Von allen Seiten trommelten Milchspritzer in die Melkeimer aus tönendem Espenholz, sie hörten sich so unterschiedlich an, von hellem Zischen bis zum dunklen Glucksen, als ob aus einem Erdauge Wasser hervorsprudelte.
Unser Hund Arsylang lag neben dem Dunghaufen und schlief. Er schnaufte friedlich. Die Sonne strömte auf sein dunkles Fell mit den glitzernden Daunen, zersprang in Strahlen, die sogleich wieder abprallten und von Daunenspitze zu Daunenspitze glitten. Die Rippen hoben und senkten sich kaum merklich. Die Glieder lagen leicht gekrümmt, gesammelt und wirkten gelenk- und schwerelos. Ich sah, in dem Körper wohnte Ruhe, und alles war, wie es gewesen ist: gut. Doch der Traum?!
Ich ging zu Mutter, die unter einer Kuh hockte und so flink und heftig molk, daß sich ihre Schultern wiegten, als ob sie zitterten. Sie hielt das halbe Gesicht in das dichte, buschige Bauchhaar der Kuh vergraben und dazu noch das sichtbare Auge geschlossen.
Ich näherte meinen Mund ihrem freien Ohr und flüsterte: »Mutter!« Das Auge öffnete sich.
»Was ist, wenn man vorher doch jemandem davon erzählt hat?«
Mutter erriet nicht sofort, was ich meinte. Sie mußte überlegen. Dann sagte sie bestimmt: »Keinem darf man davon erzählen, keinem!«
Ich erschrak und entfernte mich. Ich überlegte und beschloß, doch noch in die Steppe zu rennen und dort den Traum loszuwerden. Denn es kam mir irgendwie besser vor, so zu tun, als die Sache beim Verkehrten zu belassen.
Ich ging ein ganzes Stück weit weg vom Ail. Dann stellte ich mich mit dem Gesicht zum Auslauf des Flußtales und sprach, jedes Wort so deutlich, wie ich es nur konnte:
MIR TRÄUMTE, MEIN ARSYLANG IST AN DEKPIREK ERKRANKT. ER KANN NICHT LAUFEN, NICHT STEHEN. TAUMELT, FÄLLT UM. AUS SEINEM MUND QUILLT SCHAUM HERVOR. SEINE GLIEDER SIND STEIF, SEINE HAARE STEHEN ZU BERGE, ER STIRBT! TÜI-TÜI-TÜI!
Um diese Zeit rannten die Hunde mit einem lärmenden Gebell davon. Sie jagten einem eiligen Reiter nach, der in einiger Entfernung am Ail vorbeizog. Der Reiter fiel aus dem Galopp und darauf auch aus dem Trab, als er die nahenden Hunde bemerkte. Nun ritt er im Schritt und verhielt sich still. Die Hunde erreichten ihn, umliefen ihn und bellten ihn an. Doch bald beruhigten sie sich, ließen schließlich von dem friedlichen Reiter ab und machten kehrt. Ich trieb mich herum unter der Morgensonne, die schräg stand und lange, dünne Schatten warf. Ich spielte mit meinem Schatten, versuchte ihn einzuholen, aber es wollte und wollte mir nicht gelingen. So schnell ich auch davonfederte, er hüpfte mit und entkam mir. Die Hunde kehrten zurück. Sie gingen träge mit hoch über dem Kreuz geringelten Schwänzen, gähnten und leckten sich mit langen, heraushängenden rosa Zungen die Mäuler ab.
Aber nicht Arsylang! Er ringelte den Schwanz nie, hob ihn soweit auch nicht, er trug ihn schräg nach unten, und die Schwanzspitze krümmte sich nur leicht nach außen. Dazu standen ihm die Ohren, die spitz waren wie bei einem Fohlen, aufrecht und dicht nebeneinander, sie glichen einer Schere. Auch jetzt ging er leicht im Paßgang und den Hals vorgereckt, in der gefaßten Haltung eines Raubtieres.
Arsylang war ein Findlingshund. Vater brachte ihn noch im Welpenalter von weither mit. Als der Welpe zu uns kam, hatte ich schon meine ersten Zähne im Munde. Aber das Hundejunge wuchs schnell und galt nun längst als erwachsen, während ich immer noch ein Kind geblieben bin.
Niemand, der zu uns kam, übersah Arsylang, jeder bedachte ihn wenigstens mit der allgemeinen Bemerkung: »Oi, das ist ein gefährlicher Hund!« Die Antwort darauf lautete, gleich, wer es war, der den Besuch vom Sattel empfing oder ihn wieder in den Sattel hob: »Der sieht nur so aus!«
In der Tat war Arsylang nicht gefährlich, er hat noch keinen gebissen. Doch die Menschen hörten nicht auf, sich vor ihm zu fürchten. Meistens aber war es ein längeres Gespräch, das sich um den Hund drehte.
Manche spielten auf seinen Namen an. Der eine sagte, das wäre bald ein wirklicher Löwe. Vater erwiderte darauf, daß der Löwe nicht zum Sehen, sondern zum Hören da wäre. Der andere meinte, wir hätten den Hund nicht Arsylang – Löwe –, sondern Börü – Wolf – nennen sollen. Vaters Antwort darauf lautete: »Das hieße dann den Wolf täglich zehn, zwanzigmal beim Namen nennen und so ihn herbeirufen – wer würde das tun?«
Ich bekam Lust, Arsylang rennen zu sehen. So rief ich in einem Atemzug: »Arsylang! Arsylang! Arsylang!« Darauf: »Tuh-tuh-tuuh!« Und selber rannte ich zurück. Hier und da erscholl Gebell, und mit einem Mal preschten die Hunde herbei. Ich beobachtete Arsylang beim Rennen: Er hatte sich ausgestreckt und an die Erde geschmiegt; der Schwanz lag ihm längs gerade. So jagte er an den Hunden vorbei, die früher losgerannt waren und vor ihm gelegen hatten, und nahm nun die Führung. Ich rannte wieder ein Stück weiter und hockte mich vor einen Bau nieder, in den leicht ein Murmeltier oder sogar ein Fuchs hineingeschlüpft sein könnte. Arsylang kam an, landete gleich mit der Schnauze im Bau und wollte sich schnurstracks hineinzwängen, dabei winselte er dumpf und kratzte sich mit allen vier Pfoten in die Erde; in Klumpen flogen Erde und Gras hoch, die von dem Nachttau noch feucht waren. Dann kam die trockne Schicht Erde, die sich zu Staub stieb und zu einer kleinen Wolke wuchs. Ich rief Arsylang beim Namen, und er hörte auf, sich weiter abzurackern. Aber die Aufregung wollte ihn lange nicht verlassen: Er winselte weiter, und seine Haare standen zu Berge.
Ich erschrak.
Großmutter kam. Sie kam in kleinen Trippelschritten auf mich zu. Ich wollte nicht, daß sie sich meinetwegen so weit vom Ail wegschleppte. So rief ich »tschuh!«, gab mir dabei einen Klaps auf das Gesäß und galoppierte ihr entgegen.
Die Hunde rannten mir hinterher, bald holte mich Arsylang ein, blieb aber neben mir. Die anderen Hunde blieben hinter uns, keiner überholte.
Großmutter blieb stehen. Sie hatte den kurzen Birkenholzstock beidhändig am oberen Ende gefaßt und stützte sich dabei, als wir bei ihr ankamen.
»Was war das? Ein Wolf etwa?« fragte sie weich-leise, mit jenem kleinen Lächeln inmitten der Lippen, das nur selten erlosch. »Ein Wolf nicht«, sagte ich unsicher. »Ein Fuchs vielleicht oder auch nur ein Murmeltier.« Ich spürte eine kleine Kränkung dafür, daß mir Großmutter so eine Frage gestellt hatte, auf die ich lügen mußte.
»Wo bist du gewesen, Großmutter?« fragte ich mißmutig, und dies teils, um die Scham abzuwehren, die noch nicht da war, aber kommen mußte, und teils als Gegengewicht dazu, um die Kränkung aufrechtzuerhalten und so erstmalig ein Geheimnis vor ihr besser aufbewahren zu können.
»Ich mußte mich erleichtern«, sagte Großmutter gehorsam.
»Aber so lange und so weit weg?«
»Ich ging hinter den Hügel. Die Beine werden eben alt.«
Großmutter seufzte, wurde jedoch gleich darauf wieder heiter, sie deutete auf ihre Beine: »Ich habe zu den beiden soeben gesagt, seid nicht so faul, sonst geh ich mit euch noch die Schafherde hüten!«
Ich wollte nicht auf den Witz eingehen, da er mir ungelegen erschien. Ich wollte etwas anderes klären: »Aber Großmutter! Warum mußt du hinter den Hügel gehen? Andere hocken sich doch auch gleich in die Steppe!«
»Nein, Kindchen. Das bin ich eben nicht gewöhnt: Ich hocke hier, und die Leute blicken herüber – nein!«
Plötzlich überkam mich ein heftiges Gefühl zu ihr. Es war halb Mitleid und halb Achtung. Darauf schlug es in Liebe um. Es war wie ein Schmerz, ja es schmerzte. Die Augenränder liefen mir heiß an. »Großmutter!« sagte ich und faßte ihre Hand. Sie blickte mich so mild und so alleswissend an, daß ich mit Mühe aus mir herausbrachte: »Komm, Großmutter, wir gehen nach Hause!«
Großmutter
Großmutter war eine Menschenseide. Das hat Vater gesagt. Und das, was er sagte, mußte stimmen, immer. Und sie ist mir vom Himmel geschickt worden. Das hat mir Mutter verraten. Zwar stimmte manches nicht, was sie sagte, aber dort, wo der Himmel mit im Spiel war, durfte man nicht lügen. Das hat Mutter selber gesagt, und sogar Großmutter hat da zugehört.
Zuerst aber soll sie eine Fremde für uns gewesen sein. Sie hatte einen Mann, einen Sohn, eine Jurte und eine stattliche Herde. Später wurde der Mann von flüchtenden Russen erschossen und der Sohn von plündernden Kasachen erschlagen. Beides geschah kurz hintereinander.
Alleingeblieben suchte sie die Nähe ihrer jüngeren Schwester Hööshek auf. Diese war ebenso verwitwet und war meines Wissens die einzige Frau in der ganzen Ecke, der es gelungen war, den Titel Baj zu erwerben. Sie hatte einen Sohn, der, obwohl schon längst volljährig, ein schwächliches, menschenscheues Geschöpf blieb, und dieser Umstand hat wohl ihren Wert als Familienoberhaupt und ihren Willen noch gesteigert, sich im Leben zu behaupten.
Großmutter erzählte wenig von ihrer Schwester, und dieses wenige hatte nur Gutes zum Inhalt. Böses erzählte sie auch von anderen, ihr fremden Menschen nicht. So war sie eben.
Aber es wurde dennoch eine Menge von Hööshek und dem erzählt, was diese aus Großmutters Jurte und Herde gemacht hatte. Es kam von selbst zusammen. Es war der Volksmund.
Höösheks hielten sich von den Leuten ständig abseits, und dennoch gab es die Geschichte, die Krümel um Krümel zusammengetragen worden war und ein ungefähres Bild von dem Leben abgeben konnte, das Großmutter bei ihrer Schwester gehabt hatte. Auch Hööshek ist inzwischen längst tot. Es heißt in allen Sprachen und bei allen Völkern, daß man von einem Toten nichts Schlechtes sagen sollte. Warum nur? Ist das Totsein ein Luxus, den nur Auserlesene genießen dürfen? Oder eine Strafe, die nur Ausgestoßene büßen müssen? Es ist etwas, womit ein jeder bezahlen muß dafür, daß er dagewesen ist, womit beglichen werden muß das Wunder, das mit jeder Geburt gelingt. So denn wollen wir auf den Spuren des Gewesenen und im Lichtschein der Wahrheit bleiben!
Großmutters Jurte und Herde wanderten Stück für Stück in den Besitz der Hööshek. Die guten Filzdecken sollten besser die Jurte der Schwester mitbedecken, als sinnlos herumliegen und verkommen. Dem war vorausgegangen, daß Hööshek sagte: Wozu zwei Jurten aufstellen, wenn in der einen auch genug Platz für alle wäre!
Also mußte Großmutter ihre eigene Jurte als einen Haufen in einigen Bündeln liegenlassen und in die der Schwester einziehen. Als man das erste Bündel aus dem Haufen herausholte, es auspackte und die Decke nahm, hieß es: Zeitweilig, bis neuer Filz gewälzt und daraus neue Decken genäht wären. Aber neuer Filz wurde und wurde nicht gemacht, dafür wurden weitere Decken genommen.
Indes hörten auch die weniger guten Filzstücke auf, zwecklos in Bündeln herumzuliegen. Sie wurden zu Satteldecken für Reit- und Lasttiere verwendet. Zunächst wurden sie als Ganzes genommen, als Notbehelf, für einmal nur; nach einer bestimmten Zeit aber wurden sie schon zerschnitten und zurechtgenäht. Gleiches geschah mit dem Holzgerüst. Die Dachstreben waren zuerst dran, sie dienten eine nach der anderen einem anderen Zweck. Und es dauerte nicht lange, man wurde so frei, so großzügig, eine davon in Stücke zu hacken und daraus Pflöcke zu hauen. Und Pflöcke wurden gebraucht!
Dann waren es einige der Scherengitter, der Jurtenwände, die in die Jurte der Schwester kamen und dort solche ablösten, die ausgebessert werden müßten.
Ähnlich mit dem Vieh. Die laufenden Ausgaben wurden gern mit den Lämmern und den Zicklein, aber auch schon mit den ausgewachsenen Schafen und Ziegen aus der Herde der Großmutter bestritten. Die wären kleiner im Wuchs oder sonstwie nicht so gut wie die aus der eigenen Herde. Besser, wenn die besseren Stücke in der Herde zurückblieben, denn Großmutter würde ja alles ersetzt bekommen. Aber kein Lamm bekam sie ersetzt, nichts!
Eines Tages sah man ein: Es war sinnlos, den Haufen, der einmal eine Jurte erhalten hat, auf Umzügen weiter mitzuschleppen. Also löste man ihn auf, nahm, was noch einen Wert hatte, und verfeuerte, was gar keinen hatte. So wurde Großmutter zu einem obdachlosen Menschen. Und sie wäre wahrscheinlich auch zu einem besitzlosen Menschen geworden, wenn sie weiter bei der Schwester geblieben wäre. Aber zum Glück kam es anders!
Großmutter pflegte den Kopf leicht gesenkt und ein wenig schief zu halten. Das möchte ich schon hier untergebracht haben, obwohl ich noch eine Weile an der Vorgeschichte weitererzählen muß, die ich erst später als erwachsener Mensch zusammengebracht habe.
Großmutter hieß im Volke Dongur Hootschun, dies bedeutete Greisin mit dem kahlgeschorenen Kopf. Der Name ist wörtlich zu verstehen. Sie war die erstere von insgesamt zwei Frauen mit einem kahlgeschorenen Kopf, die ich bei Tuwinerinnen sah.
Übrigens wurde die andere Frau, die ein halbes Menschenalter später den Altai bewohnt hat, ebenso Dongur Hootschun genannt. Und der Spitzname hat, wie sooft, längst die Stelle des richtigen Namens eingenommen. Wie sie vorher hieß, solange sie lange schwarze Haare gehabt hatte, die sie zu zwei Zöpfen flocht, wird ein ewiges Geheimnis bleiben. Ich nannte sie mir Dongor Enem – meine Großmutter mit dem kahlgeschorenen Kopf. Manche Kinder versuchten, mir gleich zu reden, wurden aber auf der Stelle von mir zurechtgewiesen: »Wieso Enem? Ist sie etwa deine Großmutter?!«
Damals lebten die Kinder auf dem Altai friedfertig miteinander; die Filme mit den Schlägereien und den Schießereien waren noch nicht da, und auch der Geist, der Emanzipation predigte und Streit meinte, war dort noch nicht heimisch geworden. So lautete die Antwort des Kindes, das ich soeben zurechtgewiesen hatte, in der Regel: »Gut doch. Dann eben: Eneng – deine Großmutter!«
Die Eltern und auch die Erwachsenen im Ail sprachen vor Großmutters Namen den meinen, und dies mit der die Zugehörigkeit, oder noch besser den Besitz, anzeigenden Endung. Und das gefiel mir!
Denn in der Tat war sie meine Großmutter. Und das kam so: Großmutter hat sich, seitdem sie bei ihrer Schwester lebte, um die Kleinarbeit in der Jurte und in der Hürde gekümmert, zu mehr reichten ihre Kräfte nicht, denn sie war längst über siebzig. Sie sah selten jemanden, noch seltener ging, was in ihrem Alter nur noch heißen konnte: ritt sie irgendwohin. Das kam bei ihr nur vor, wenn sie sich die Kopfhaare nicht kahlscheren, sondern abrasieren lassen wollte, denn dieses letztere Handwerk wurde ausschließlich von Männern beherrscht.
So ergab sich, daß die Großmutter wieder einmal auf Suche nach jemandem ausritt, der ihr die Haare vom Kopf rasieren würde. Dabei kam sie bei unserem Ail vorbei, bei unserer Jurte. Das ist hier so leicht erzählt, in Wirklichkeit war das eine böse Geschichte mit einem doch guten Ausgang. Denn Großmutters Reitpferd war vor Hunden ausgerissen, flüchtete an vier, fünf Ails vorbei. Die Hunde – es waren ihrer zuerst drei – blieben dem Pferde und der Reiterin auf den Fersen, immer neue kamen hinzu, und am Ende war es ein ganzes Rudel von einem guten Dutzend. Unser Vetter Molum, der dort zufällig vorbeiritt, rettete sie: Er jagte dem flüchtenden Pferd nach, holte es ein und erwischte es schließlich am Zügel.
Allzu verständlich nur, daß einem solcher Art angekommenen Besuch ein herzlicher Empfang bereitet wurde. Die immer noch schnaufende und zitternde alte Frau saß auf der guten Filzmatte, die sonst eingerollt hinter dem Kleiderstapel stand und nur dann herausgeholt wurde, wenn ein ehrwürdiger oder seltener Besuch kam. Sie wurde von den Erwachsenen begrüßt und bemitleidet und von den Kindern beäugt und bestaunt. Diese letzteren waren in einer Horde herbeigaloppiert, noch bevor man den Besuch vom Sattel herunterholen konnte, und die ersteren waren eine nach der anderen erschienen, die eine mit dem Baby an der Brust, die andere mit dem Fell, das sie gerade gerbte, und die dritte mit dem Kleidungsstück, an dem sie nähte, in der Hand, und ein jeder wiederholte sinngemäß das, was schon gesagt und gefragt worden war. Und auch Großmutter antwortete auf die Fragen und wohlwollenden Tadel, die ihr galten, fast mit denselben Worten, Tadel, weil Großmutter so leichtfertig gewesen sei, sich auf ein Pferd einzulassen, das nicht zahm war.
Großmutters Pferd war eine Stute, die einmal ein dunkelgraues Fell gehabt hatte, nun aber fast weiß aussah, denn sie war im Altern. Die Stute war alles andere als wild, aber sie war einmal von Wölfen angefallen und arg zugerichtet worden. Seitdem war sie hundescheu, aber Großmutters einziges Reittier. Sie fohlte zwar jedes Jahr, aber die spätwinterlichen Schneestürme, die Wölfe und die Hööshek brachten es fertig, daß sie allein und einzig blieb.
Auf dem Herd kam der beste Tee zustande. Der beste Tee, das war, wenn in den Teesud nicht nur Milch und Salz, sondern auch ein sehr fetter Mehlbrei hinzukamen. Und dieser Tee war das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit, denn eine jede der Frauen, die sich zwischen Tür und Herd breit hinbequemt hatten, machte sich nebenher auf irgendeine Weise nützlich. Der Geruch des brennenden Fettes und Mehls steigerte die Neugierde im Kindervolk immer mehr, die von dem Wunsch kam, endlich zu erfahren, wer der Mensch mit dem Kopf eines Mannes und mit der Stimme einer Frau war. Sie durften dabei nicht wie die Erwachsenen in die Jurte eintreten, auch durften sie nicht in der Tür stehenbleiben, also gingen sie hin und her, an der Tür vorbei und schickten schnell forschende Blicke in die Jurte. Dabei litten sie fast.
Als der Besuch die Schwelle der Jurte betrat, streckte ihm ein Baby laut lallend die Arme entgegen. Aber das war noch nichts Besonderes; damals wurde ein jedes Kind, sobald es sich von selbst fortbewegen und bis es unterscheiden konnte zwischen Gefahr und Nichtgefahr, an einen Strick angekettet, dessen eines Ende am Kopfende des elterlichen Bettes festgebunden war. Dies beschützte das Kind zwar vor vielen Gefahren, in die es sich sonst hätte stürzen können, aber es bedeutete für den, um dessen Wohl es ging, auch eine ungemeine Langeweile, denn ein so angebundenes Kind ähnelte sehr einem angepflockten Tierjungen: Es durstete nach einem Gesellen, gleich wer es war. So flatterte und tschilpte das Kleinkind dem Hereintretenden entgegen, und so war der erste Mensch, der mich begrüßte, Großmutter. Sie, die zunächst nur die Alte mit dem kahlgeschorenen Kopf war, erwiderte meinen Gruß auf ihre Art: nickte mir zu, liebkoste mich aus der Entfernung, segnete mich mit einem langen Leben, und dieses letzte kleidete sie in folgende Worte: »Nimm meinen weißen Kopf, meine gelben Zähne, die mir noch geblieben sind, und die Jahre darauf!« Dann mußte sie mich einstweilen aus dem Blick lassen, da sie mit den Erwachsenen Grüße wechseln und die ihr zu diesen angebotenen Schnupftabakflaschen in die Hand nehmen und daran riechen mußte – sie schnupfte nicht.
Ich aber ließ von ihr nicht ab, fuchtelte, den Blick auf sie geheftet, mit den Händen und lärmte weiter. Und das dauerte so lange, bis man auf mich aufmerksam wurde und beschloß, mich vom Strick zu befreien. Und kaum war ich frei geworden, begab ich mich auf allen vieren schnurstracks zu ihr und fing mit einem freudigen Aufschrei ihre Hände auf, die sie mir entgegengestreckt hielt. Sie half mir auf die Beine, führte mich zu sich, beroch mir zuerst die Hände, dann den Haarschopf und wünschte mir erneut ein langes Leben – diesmal sprach sie mit dem Altai und bat ihn: »Ej baj Aldajm! Nimm dieses Hundejüngchen auf Deinen Schoß, damit es von unten her beschützt ist, nimm das Hundejüngchen in deine Achselhöhle, damit es von oben her beschützt ist, und so gib ihm ein langes Leben mit einem langwährenden Glück!« Darauf setzte sie mich auf ihren eigenen Schoß und hielt mich. Und somit war sie für mich und für unsere Verwandtschaft keine Alte mit dem kahlgeschorenen Kopf mehr, sondern meine Großmutter mit dem kahlgeschorenen Kopf.
Großmutter blieb den Tag im Ail und übernachtete. Während sie von Jurte zu Jurte ging, um den für sie gekochten Tee zu trinken, klebte ich auf ihrem Rücken, und sie war es, die mir von dem Höötbeng oder Scharbing in den Schüsseln in den Jurten ein Stück abbrach und mir auf die Hände gab, was bisher Mutter getan hatte. Und das dauerte so lange, bis ich vom Schlaf übermannt wurde.
Am nächsten Morgen war Großmutters graue Stute zeitig gesattelt, allein, sie konnte erst gegen Mittag aufbrechen, da ich von ihrem Schoß nicht abstieg und zu kreischen begann, sobald man mich dort wegnehmen wollte. Sie mußte so lange warten, bis ich wieder einschlief. Vetter Molum brachte sie zurück, wegen der Hunde und auch wegen der Schwester; er nahm ein paar Worte von Vater und Mutter mit, die er, in Höösheks Jurte angekommen, für Großmutter einzulegen hatte.
Großmutter kam im Frühjahr wieder. Der Winter lag davor, und die lange Zeit hörte man damals sowenig voneinander, oft auch nichts. In dem Jahr haben die Eltern bis zuletzt nicht erfahren können, ob Höösheks in Baschgy Dag einen verlustarmen Winter gehabt hätten und ob Großmutter über den Winter gekommen sei.
Dann kam sie! Es war noch die magere Zeit inmitten der Stürme und des Umzuges, unsere Jurte war in Hara Hoowu gerade erst angekommen. Höösheks waren von den Bergen auf die Steppe heruntergewandert, hatten einen Zwischenaufenthalt in Saryg Höl. Großmutter hatte den Hööshek-Sohn, ihren Neffen, auf seine jungen, scharfen Augen und auf sein Fernglas hin gelobt und ihn gebeten, nach Hara Dag, jenseits des Ak Hem, Ausschau zu halten. Sedip, so hieß der Neffe, sagte eines Morgens, der Ail mache sich auf den Weg. Darauf berichtete er der Großmutter in kleinen Zeitabständen, wo sich die Schafherde und die Yakherde mit den beladenen Ochsen gerade bewegten: »Am Heritsche über Doora Hara, an Üd Ödek, in Gysyl Schat, am Ak Hem.«
»Paß auf nun gut, Jüngelchen«, sagte Großmutter, »gleich werden wir wissen, wo man hin will!« Wenig später wurde ihr berichtet, daß die Herden den Ak Hem passierten in Richtung oberhalb des Gysyl Ushuk. Großmutter wußte Bescheid, wo unsere Jurte demnächst zu finden war.
Am nächsten Morgen ritt sie aus, um sich, wie sie zu ihrer Schwester sagte, die Haare herunterrasieren zu lassen und den Kopf endlich aufzufrischen. Sie fand unsere Jurte dort, wo sie sie vermutet hatte. Mutter schimpfte mit ihr, als sie hörte, Großmutter sei allein und mit Mühe über den Homdu, den großen gefährlichen Fluß, gekommen, da das Eis schon löcherig und brüchig geworden war und sie stellenweise das tiefe Flußwasser gesehen habe. Natürlich freute sich auch Mutter darüber, daß Großmutter gekommen war. Mit mir, der ich inzwischen größer geworden war und laufen konnte, geschah dasselbe wie vorher: Mit einem Aufschrei hastete ich ihr entgegen, kletterte auf ihren Schoß und wollte nicht wieder herunter. Ich blieb dort bis zum Abend, blieb lange wach. Nachdem ich endlich eingeschlafen war, hätte mich Großmutter die Nacht über bei sich behalten können, übergab mich aber Mutter. Großmutters Haare waren stark gewachsen. Sie hatte sie in der ganzen Zwischenzeit unberührt gelassen. So hatte sie den Anlaß, zu uns zu kommen, ständig bereit.
Die Stürme dauerten nicht nur an, sie nahmen von Tag zu Tag noch zu, aber auch die Sonne, ihre Gegenkraft, wuchs unaufhaltsam, so daß der Zusammenstoß zweier Naturkräfte auf die eine Hälfte der Dinge zerstörend wirkte; der Eispanzer über den Flüssen wurde von Stunde zu Stunde morscher, zerbröckelte und zerfloß.
Vater, der mir die Großmutter entführt hatte, während ich schlief, brachte sie am Nachmittag wieder zurück. Mir war, als ob in mir von der Freude, die mich beim Anblick der Großmutter erfüllte, eine Welle oder ein Lichthauch geblieben wäre, der sich so tief und so hell entzündete, daß er sich über die Zeit hinweg als eine lichte Spur gehalten hat. Der Fluß war inzwischen unpassierbar geworden, die nächtliche Kühle war nicht mehr imstande gewesen, die auseinanderfallenden Teile des Eises für Stunden wieder zusammenzuschweißen. Die wasserdurchtränkte Eismasse glich erweichtem Lehm und sank an jeder Stelle ein, sobald sie unter den Pferdehuf kam. Vater blieb nichts übrig, als von den Kasachen, die sich schon damals dort festgemacht hatten, jemanden ans Ufer heranzurufen und ihn zu bitten, Hööshek an Saryg Höl zu benachrichtigen.
Großmutter blieb bis zum Frühsommer bei uns. Sie war eine große Hilfe im Haushalt. Vor allem, weil sie mich beaufsichtigte. Aber es war mehr als nur das: Sie erzog mich. Nur muß sie das selbst nicht gewußt haben; keiner in der Jurte konnte damals wissen, daß er ein Kind erzog, und keinem Kinde wurde bewußt, daß es erzogen wurde. Und dieses Wort fehlte auch in unserer Sprache.
Großmutter fühlte sich bei uns wohl. In ihre Mutterseele, die schon seit langem verwaist war, hat sich mit einem Mal ein kindliches Wesen eingedrängt, und es erfüllte und erhellte sie nun.