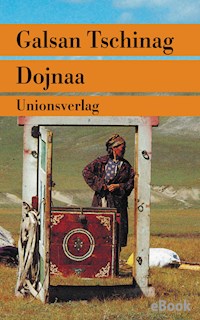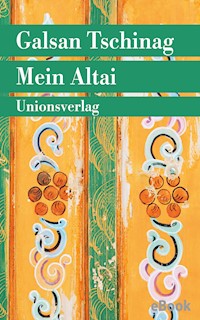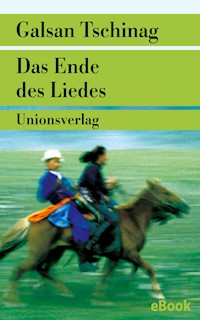
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die dreizehnjährige Dombuk versucht mit all ihrer Willenskraft eine Stute, die ihr Fohlen verloren hat, dazu zu bringen, ein verwaistes Fohlen anzunehmen. Nicht nur ihr Wissen über die Tiere hilft ihr dabei, sondern auch Lieder, mit denen sie die Stute beschwört. Aber ist sie selbst nicht genauso allein wie das Fohlen? Seit dem Tod der Mutter ist der Vater oft tagelang unterwegs. Dombuk muss sich allein um die drei jüngeren Geschwister kümmern. Doch eines Tages stellt Gulundscha, die Jugendliebe ihres Vaters Schuumur, ihre Jurte ganz in der Nähe auf. Der flieht zwar vor seiner Jugendliebe und will seine Jurte so schnell wie möglich abbrechen. Aber Dombuk hat genug von der Einsamkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch
Alle, mit denen Schuumur spricht, meinen, dass es unklug sei, nach dem Tod seiner Frau mit den vier Kindern allein zu bleiben. Er jedoch flieht vor seiner Jugendliebe Gulundschaa und will seine Jurte so schnell wie möglich abbrechen. Aber seine dreizehnjährige Tochter, die zu früh erwachsen werden musste, hat genug von der Einsamkeit.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag
Das Ende des Liedes
Erzählung
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die Erstausgabe erschien 1993 im A1-Verlag, München.
© by Galsan Tschinag 1993
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Michel Zumbrunn
Umschlaggestaltung: Heinz Unternährer
ISBN 978-3-293-30346-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 22:42h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DAS ENDE DES LIEDES
Gib deine weiße, weiße MilchSchuumur war seit Stunden unterwegs, ihn drängte es …Dombuk war kaum ein halbes Jahr alt …Der Baj saß in einer Fleischrunde mit Männern …Gulundshaa bangte und fieberte um diese Zeit …Gulundshaa hatte lange im Warten gelebt, hatte auf …Churaj, churaj, churaj … Das war nur halb …Der Frühsommer war vorüber. Er hatte sein Werk …Was ist aus den Menschen unserer Erzählung geworden …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Asien
Zum Thema Liebe
Zum Thema Tier
Gib deine weiße, weiße Milch, Mutter!
Lösch den roten, roten Brand aus,
Den Durstbrand, der brennt auf der Zunge,
Auf der Zunge deines armen Kindes,
Guruj-guruj-guruj!
Die Stimme des Mädchens klang hell, einsam und aufwühlend. Doch die Mutter, die blaugraue Stute, blieb in der Haltung, in der sie nun schon den zweiten Tag stand: mit gesenktem Kopf und geschlossenen Augen; ihre Unterlippe berührte fast das tote Fohlen, das erstarrt dalag, dessen Beine sich vom Boden abhoben und gleich Aststummeln eines toten Baumes gen Himmel zielten. Das andere, das lebendige Fohlen schien entmutigt, wagte nicht mehr, sich dem Euter der fremden Mutter zu nähern. Es stand widerstrebend und leise zitternd dort, wo man es festhielt: unter dem Bauch der Blaugrauen, und schielte abwechselnd bald auf die Zitzen und bald auf die behuften Füße vor sich, welche, wären sie nicht gefesselt gewesen, es längst hätten zertrümmern und zerfetzen können. In langen Abständen gingen die Augen der Stute auf, es kamen Tränen, und ein durchsichtiger, heller Ring über jedem der Augäpfel schwoll an, lief zu einem Tropfen zusammen und fiel dann glitzernd auf das Fohlen herab. Doch die Tränen waren nicht das Ergebnis des Gesanges. Das Ziel der menschlichen Bemühungen war die Herstellung einer Brücke zwischen den Tränen, die seit zwei Tagen und Nächten flossen, und dem Gesang, der seit den Morgenstunden klang. Es war inzwischen später Nachmittag geworden, und der Gesang ging und floss an den Tränen vorbei, er verschwendete sich sinnlos wie jene auch. Die Stute blieb unerschütterlich. Sie war unbeeinflussbar. Der Panzer, hinter dem sie ihre Tierseele versteckt hatte, war nicht zu durchdringen, und so war die Seele, auf die der Gesang zielte, unerreichbar. Noch mehr: Die Strophen, die das Mädchen aus dem Stegreif erfand und in Melodie verwandelt auf die Stute hinsang, vermochten nicht nur den Panzer nicht zu durchbrechen, sie schienen auch darauf haften zu bleiben, als eine Art Schutzschicht zu erhärten und so der Sache eher zu schaden als zu helfen. Denn mit der Stute ging eine Veränderung vor sich: War sie am Anfang, als sie das Maul des fremden Fohlens an ihrem Euter spürte, wiehernd davongesprungen und hatte nach ihm ausgeschlagen und darauf jedes Mal, wenn sie seinen Atemhauch witterte, gezittert wie vor einer großen Gefahr, so stand sie nun still und teilnahmslos da, schien betäubt und erstarrt.
Gib deine weiße, weiße Milch, Mutter!
Erhelle damit die schwarze, schwarze Nacht,
Die Seelennacht, die brütet über dem Leben,
Über dem Leben deines armen Kindleins,
Guruj-guruj-guruj!
Die Stute blieb taub, ihr Körper war erstarrt, ihre Seele erkaltet, sie war uneinnehmbar, ein Fels. Und da es so war, so schien dem Mädchen, waren auch Himmel und Erde erstarrt, selbst der Wald, der grünte, selbst der Fluss, der floss, selbst der Wind, der blies, selbst diese harrten stumm und reglos. Ihr Gesang war machtlos. In Wirklichkeit war die Natur, das große Leben ringsum, unberührt von den Leiden einer Tiermutter, vom Schicksal eines Tierkindes und von den vergeblichen Mühen eines Menschen, wir wissen das.
Am Himmel war ein mächtiges Spiel im Gange: Wolken waren zurückgekehrt und mit ihnen Vögel, und beide, aus zwei Himmelsrichtungen gekommen, schienen noch keine Ruhe zu finden, die Bewegung, die Wanderlust und -sucht, die sie hergetrieben hatte, schien noch unverbraucht. Die Grauenten, die die kleinsten und beweglichsten waren in der bunten Schar, erschienen unter dem sich verdichtenden und brodelnden Wolkenmeer, je nachdem, ob das Licht oder der Schatten sie trafen, bald glitzernd hell, bald schwindend dunkel, und so strahlte ihr Flug spielerische Heiterkeit auf den Fleck Erde aus, auf dem sie zum Leben erweckt und zu dem sie nun zurückgekehrt waren. Auch die anderen Vogelarten, Rot- und Graugänse, Rostenten und Schwäne, die Möwen und Kraniche schwebten zwischen Licht und Schatten, und dieses ihr Treiben mutete von unten, von der Erde aus gesehen, sehr wie ein Spiel an. Das konnte die in Bewegung, in Farben gesetzte Freude des Wiedersehens zwischen zwei verschiedenen Formen des Daseins ein und desselben Urstoffes sein. Der Fluss stürzte noch in der Wucht der Geburt, des Ursprungs, tosend und krachend in das Tal hinab, schlug flatternden, lodernden Schaum an Geröllsteine, an Felsklippen, an die uralten Lärchen mit den kahlen, blaudunklen Wipfeln, die wie zum Trotz mitten im Fluss gewachsen waren und nun unerschütterlich fest standen. Die Wälder klebten wie Flecken an den sonnengeschützten Nordhängen der Berge und grünten, sie grünten in kaum wahrnehmbare blaue Schleier gehüllt und rauschten, also lebten sie, also bestanden sie die Herausforderung der Zeit weiterhin, also setzten sie ihr Dasein fort.
Zwischen Fluss und Wald, am steinigen Berghang auf dem Steilufer, stand eine einsame Jurte, und wenige Schritte vor ihr, am Rand der Hürde, spielte sich das ab, was eingangs geschildert wurde. Es war der Kampf zwischen einem Menschen und einem Tier um das Schicksal eines weiteren Tieres, zunächst. Einem Fohlen war die Mutter und einer Stute das Kind verendet, und nun arbeitete man, um die Verwaisten aneinander zu gewöhnen, um dem Tierkind das Leben zu retten und der Tiermutter die Leiden zu lindern. Und hier sei auch ein erstes Licht auf die Jurte, ihre Bewohner und ihr Schicksal vorausgeschickt: Es war eine sechswandige, das heißt, eine große, stattliche, wohlgeformte und recht helle Jurte. Nur schien ihr etwas, irgendetwas zu fehlen, doch dies, dieses gewisse Etwas herauszufinden und zu benennen, war auf den ersten Blick nicht möglich. Die Jurte gehörte einem Mann namens Schuumur und seinen vier Kindern; die Frau und Mutter war ihnen vor einem Jahr gestorben. Das Mädchen, das mit der Stute kämpfte, hieß Dombuk und war das älteste Kind unter den Geschwistern, sie galt als 14-jährig, die neun Monate im Mutterleib und das erst vor Kurzem angebrochene Mondkalenderjahr hinzugerechnet.
Gib deine weiße, weiße Milch, Mutter!
Lindere damit das bittere, bittere Leid,
Das Schreckensleid, das schreit aus der Kehle,
Aus der Kehle eines armen Waisenkindes,
Guruj-guruj-guruj!
Selbst die Felsen des Erik-Arga gaben als Echo eine Antwort. Nur die Stute blieb taub. Die Zitzen an ihrem prallen Euter hingen leer und kalt herab. Die Stute war tot, wie tot. Der Gesang brach ab. Dombuk sagte: »Schluss!« Das war mehr gezischt als gesprochen. Darauf blickte sie hinauf in den Himmel, fasste sich mit beiden Händen am Hinterkopf, dort, wo unter einem verblichenen Kopftuch ein Paar bläulich schwarzer Zöpfe hervorsprangen. Dabei kniff sie die Augen zu zwei dunklen Strichen zusammen und benetzte die Lippen mit ihrer schmalen hellen Zunge. Sie kämpfte gegen die Schmerzen, die vom Zusammenspiel zweier Gewalten, Hass und Mitleid, kamen: Hass auf diese harte Mutter, auf alles Harte und Mitleid mit dem Waisenfohlen, mit allen Waisenwesen. »Schluss!«, sprach sie wieder, das klang inbrünstig wie ein Gebet. Dabei riss sie die Augen weit auf und fletschte die Zähne. Die Augen, die angefangen hatten, die angeborene Schwärze zu verlieren und einen rötlich braunen Schimmer anzunehmen, wie immer bei schwarzhaarigen tuwinischen Mädchen mit der einsetzenden Umstellung des Körpers auf das Frauendasein, wirkten wieder schwarz, schwarz und unnatürlich groß. Schluss: das bedeutete vorläufig eine Niederlage. Aber gerade darum musste das eine folgenschwere Entscheidung für die Stute sein, die beschlossen haben mochte, in der großen Trauer zu verharren.
»Dongur und Tasaj!«, rief Dombuk in einem fast großmütterlich-herrischen, jedoch wieder kindlich überstürzten Ton. Auf den Ruf hin kamen zwei Jungen, etwa acht und fünf Jahre alt, aus der Jurte hinausgestürzt, rechts und links unter der herabhängenden Filztür, beide gleichzeitig. Die Kinder kamen gerannt wie in freudiger Erwartung. Angekommen, wechselten sie Blicke, unterdrückten aufkommendes Keuchen, wurden leise und klein. Oft ist es das Schicksal einer älteren Schwester, die Mutterstelle im Leben einzunehmen. Sie sieht dann in der Erfüllung der Pflichten und im Genießen der Rechte einer Mutter die vorläufige Krönung der Ziele ihres Lebens. So war es auch bei Dombuk. Und so war es nur allzu natürlich, dass sie das Benehmen ihrer jüngeren Brüder inquisitorisch genau verfolgt hatte. Doch tat sie nun so, als wäre daran nichts auszusetzen gewesen, obwohl sie missbilligend festgestellt hatte, dass sich die Brüder gleichzeitig durch die Tür hindurchgezwängt hatten, wo es sich doch gehörte, die Schwelle in Ruhe und in Reihenfolge zu überschreiten. Dongur vor allem, der Ältere, der für den Jüngeren ein Vorbild hätte sein müssen, hatte die falsche, die rechte Türseite benutzt, und das hätte sehr gut für eine ordentliche Kopfwäsche gereicht.
»Gefällt wird das Aas!«, sprach sie zu den Brüdern im Ton einer Richterin und dann zu der Stute gewandt: »Erst verfrisst du deine eigene Brut, nun willst du auch den Nachkömmling einer anderen, besseren Mutter zugrunde richten, du alte Nutte!«
Während sie dies sprach, kam sie in Schwung, glühte vor Zorn und legte los: »Das bildest du dir vielleicht ein, aber ich werde es dir zeigen, du Wolfsfraß! Gebunden werden dir alle viere, dass dir die mürben Knochen krachen! Eher lass ich dich verrecken, als dass du auch das andere Fohlen verschlingst, du Unglückselige! Wir haben unsere eigene Mutter begraben in der kalten, schwarzen Erde, den Würmern zum Fraß. Wir werden kein Erbarmen, kein Mitleid mit dir kennen, du wirst es sehen, Wolfsgeschiss!« Sie schrie, von Wort zu Wort immer lauter, bis sie in Tränen erstickte.
Die Brüder blickten blass, erschrocken auf die ältere Schwester. Und auf ihr Hindeuten machten sie sich an die Stute heran. Sie waren flink und ausdauernd wie heranwachsende Jungwölfe. So legten sie die Stute bald in Fesseln und warfen sie mit einem Ruck auf die Erde. Sie glich einem Baum, der vorher lange geschwankt hatte, und fiel wie leblos. Sie leistete keinerlei Widerstand, während man ihr die Vorder- und Hinterbeine zusammenzog und umschnürte. Es schien ihr gleichgültig, was man mit ihr tat, sie lag wie betäubt, wie tot da. Allein ihre Augen zielten hellwach auf das tote Fohlen. Sie schienen es noch im Tode zu bewachen, und Liebe und Angst gingen von ihnen aus. Im Blick dieser Augen war ein solch tiefer Ausdruck, der nur das Ergebnis einer großen noch vorhandenen Kraft sein konnte.
Die Geschwister schnürten der Stute die Beine so fest zusammen wie bei einem Tier zum Beschlagen oder zum Schlachten. Diejenige, die die Beine gewaltsam zusammenzog und mit dem zähen Yaklederstrick umschnürte, war Dombuk. Dabei ähnelte sie mehr einem Mann als einer Frau. Der gelbköpfige Dongur, der ältere der beiden Brüder, half der Schwester mit der Gehorsamkeit eines Hundes und mit der Schnelligkeit eines Wiesels; ihm fehlte nur noch die Kraft eines Bären, die er wohl so gern gehabt hätte. Tasaj, der andere, der schwarzköpfige Junge, zerrte an dem Strick, der um den Kopf der Stute gehalftert war, er tat es, obwohl die Stute still dalag. Darauf holte man das lebendige Fohlen her, warf es um und schleppte es rückwärts dicht an die Hinterseite der Stute heran. So lagen sie, Fohlen und Stute, Schwanz an Schwanz.
Nun geschah etwas, was einen Eingriff in die Gesetze der Natur durch den Menschen darstellte: Tasaj zerrte den Schwanz der Stute hoch, Dongur hockte vorgebeugt auf den Knien, unter jeden Arm ein Paar Beine des Fohlens geklemmt und stemmte sich mit dem Körpergewicht gegen dessen Bauch, Dombuk wickelte sich den Schwanz um Zeige- und Mittelfinger der linken Hand und stopfte sie in die Scheide der Stute. Das geschah gewaltsam und geschickt zugleich, nach jedem Fingerbreit, der in der Scheide verschwand, rutschte die Hand zurück, fasste den Schwanz von Neuem und schob nach; alle drei Kinder arbeiteten verbissen, sie keuchten und stöhnten. Auch die Stute stöhnte, sie stöhnte und zuckte zusammen, doch diese kleinen Zuckungen, die durch ihren Leib gingen, waren nicht imstande, die Kinder bei ihrem Unternehmen zu stören. Also lag sie da, zuckte zusammen und stöhnte, aber auch jetzt hörten ihre Augen nicht auf, auf das eigene, auf das tote Fohlen zu sehen, ihr Blick blieb klar und warm. Der Schwanz des Fohlens steckte nun bis zum Ansatz in der Scheide der Stute. Die Jungen blickten erwartungsvoll auf die Schwester, und diese richtete sich auf, schaute auf die liegende Stute herab und sang:
Gib deine weiße, weiße Milch, Mutter!
Sieh hier, es ist aus deinem heißen Leib,
Fleisch von deinem Fleisch, Blut von deinem Blut,
Es ist deines, vergiss das nimmer,
Guruj-guruj-guruj!
Das war ein aufgeregtes, ein zerhacktes und schweres Singen. Dombuk wartete nicht erst auf eine mögliche Reaktion der Stute, sie ordnete kurz an: »Weiter!« Und dieses Weiter bestand darin, dass das Fohlen dicht an der Scheide der Stute nach allen Seiten vorbeigezogen und so daran gerieben wurde. Das hatte den Sinn, das Jungtier den Geruch des Muttertieres annehmen zu lassen. Ausgiebig benässt, durfte das Fohlen aufstehen. Die Jungen führten es in eine für die Stute unsichtbare Richtung und von dort aus auf einem Umweg hinter die Jurte. Dort pflockten sie es an. Zurückgekehrt, trugen die Jungen das tote Fohlen fort, sie brachten es ebenfalls hinter die Jurte, nur taten sie es nun anders, sie schleppten es auf dem geraden Weg fort, sie taten es ohne Eile, auffällig. Dort hinter der Jurte, ein Stück weiter weg, wurde das Fohlen später enthäutet, und das Fell wurde, samt dem Schwanz, noch nass dem lebendigen Fohlen übergestülpt und festgeschnürt. Das alles geschah auf Geheiß der Schwester. Die Stute, die still, die wie tot dagelegen, aber den Blick auf ihr totes Fohlen geheftet, es bewacht, es selbst im Tode und noch danach bewacht hatte, schlug Alarm aus allen Leibeskräften, die ihr noch geblieben waren, mit allem, was ihr zur Verfügung stand. Das begann, als die Jungen das tote Fohlen an den Beinen fassten: Ein Zucken durchfuhr ihren Leib, der Kopf flog hoch und schlug gleich wieder auf die Erde, ein klägliches Gewieher erscholl; das wiederholte und wiederholte sich, bis es ihr einmal gelang, sich auf die zusammengebundenen Füße zu stellen. So blieb sie eine kleine Weile stehen, mit zitterndem Leib, blutendem Maul und brennenden, hüpfenden Augen. Sie hätte es vielleicht länger ausgehalten, wenn sie nicht noch mehr gewollt, wenn sie nur daran gedacht hätte, das Gleichgewicht zu finden und es zu halten. Doch sie wollte mehr, wollte ihrem fortgeschleppten Fohlen nacheilen, so versuchte sie einen Sprung und fiel. Es gelang ihr nicht wieder, in die günstige Lage zu kommen, die ihr schon einmal geglückt war. Doch wurde sie nicht müde, den hoffnungslosen Versuch, auf die Beine zu kommen, wieder und wieder von Neuem zu unternehmen. Sie kämpfte, dass ihre Gelenke knirschten, die Knochen krachten und die Sehnen und Muskeln, sich in Hunderten von Kugeln verziehend, unter der Haut hüpften; der Kopf flog hoch und fiel dann gegen die Erde, ein Gewieher folgte, es war ein verzweifelter, vielleicht auch Hilfe suchender Schrei. Doch alles, alles war umsonst. Der Yaklederstrick, der, wie es sich gehörte, im Frost ausgelegen hatte, in Wolfsfett eingeweicht und unter sanftem, gleichmäßigem Schlag eines Birkenwurzelstocks nur langsam geschmeidig geworden sein musste, gab nicht nach. Die Füße der Stute indes bluteten, das Fell hatte sich an dem zähen, unüberwindbaren Lassostrick wund gerieben: Dieser Fessel war der Wille einer Mutter, dem Schicksal auf jeden Fall, um jeden Preis zu trotzen, nicht gewachsen.
Dombuk beobachtete das Geschehen. Sie fühlte sich in der Rolle einer Richterin. Befriedigung und Mitleid erfüllte sie. Schließlich besiegte das Mitleid die Befriedigung in der schmalen Mädchenbrust, und die Brüder wurden herbeibefohlen. Die Stute sollte aus ihren Fesseln befreit werden. Nur war es Schwerstarbeit, die von einem Großtier in äußerster Not festgezurrten Knoten zu lösen. Kinderhände waren außerstande es zu tun. Ein Erwachsener, der Vater, sollte herkommen. Aber wo war er, wo blieb der Vater?
Schuumur war seit Stunden unterwegs, ihn drängte es längst nach Hause. Aber er wollte nicht ohne Lasttiere zurückkehren. Deshalb hatte er noch am Morgen zu seinen Kindern gesagt, dass sie weiterhin an der Stelle bleiben, wohl dort übersommern würden. Er hatte es zornig gesagt, hatte es auf die ungehaltene Frage Dombuks, wie lange man noch so einsam dahinleben würde, weit weg von Jurten und Leuten, hingeschleudert. Während er dieses sagte, hatte er das Gewehr geschultert und sich auf den Sattel geschwungen. Dann aber war er, unterwegs zu den Murmeltieren der drei Chörleet, auf einen Reiter gestoßen, der das Flusstal hinaufwanderte. Und von diesem hatte er erfahren, dass die Frau Gulundshaa mit ihrer Jurte unterwegs nach Erik-Arga war. Der Reiter hatte es wie nebenbei erzählt, hatte dabei am hinteren Bauchriemen seines Sattels hantiert, aber einen Seitenblick auf ihn geworfen, mit einem angedeuteten Grinsen. Und dieser Blick, dieses Grinsen hatte einer Frage geglichen: Nun, freust du dich?
Die Nachricht war für Schuumur ein Blitzschlag aus heiterem Himmel. Wort- und atemlos entfernte er sich. Erst nach einigen Lassostricklängen kam er zu sich. Der erste Gedanke, der sich in seinem Kopf zu einem Sinn formte, war: Weg von hier! Die Vorstellung verfestigte sich: Davonziehen! Entkommen! So schnell wie nur möglich! Aber woher so schnell die Lasttiere nehmen, drei Kamele, besser noch vier, oder zur Not sechs Ochsen oder auch Pferde, oder?! Und wenn Ochsen oder Pferde, wer sollte sie beladen? Bald bog er vom Weg rechts ab in Richtung auf die beiden Doshangty. Der Weg führte weiter nach Charaaty, in das Flusstal hinter dem Bergrücken, wo die Landesmitte lag. Landesmitte, das war immer die Stelle, wo sich die meisten Ails niedergelassen hatten. Schuumur hatte beschlossen, dort Verwandte und Bekannte um Lasttiere zu bitten.
Er war in jenem Teil des Altai geboren, welcher später erst von Kasachen und Urianchais, dann von Kasachen, Russen und Chinesen und schließlich vorwiegend nur noch von Chinesen besiedelt wurde. Er war der Älteste der drei Söhne des Gonsat aus dem Stamm Chara-Chöjük, war gut gebaut und hatte eine kurze Kindheit. Noch mit Milchzähnen im Mund überließ er die Schafherde, die er zu hüten hatte, den jüngeren Brüdern und machte die Jagd zu seinem Hauptgewerbe. Er war elf Jahre alt, als er ein Murmeltier mit einem Faustschlag auf die Schnauze erschlug. Das Tier war auf der Flucht vor seinem Vater, war von jenem lahm und wundgeschlagen und hatte in seiner Not Schutz vor diesem gesucht: Es war auf ihn zugekrochen und unter seinen Lawschaksaum geschlüpft. Vielleicht hatte dem Tier der Instinkt gesagt, dass von einem Kinderwesen Schutz zu erwarten wäre. Dieses aber fasste es mit der Linken am Genick und schlug es mit der Rechten auf die Schnauze. Das Menschenkind hatte auf den Handteller einen Stein von der Größe einer Kamelkugel gelegt, bevor es die Hand zur Faust ballte und hatte dann gut gezielt. Der Schlag traf tödlich. Der Vater, der das gesehen hatte, sagte kein Wort. Auch er selbst verlor kein Wort darüber, weder dort noch später zu Hause. In dem Jahr bekam er seine erste Büchse, eine Schyity, wie sie im Volk genannt wurde, und gleichzeitig bekam er ein Pferd als sein Eigen. Gonsat hatte die Büchse bei einem russischen Händler gegen fünf ausgewachsene Yaks erworben, und das Pferd, ein dreijähriger Fuchshengst, aus dem Teil der eigenen Herde, der auf keinen Fall zum Verkauf oder Tausch bestimmt war. Schuumurs Freude war groß, es war mit Abstand die größte, die er je empfunden, je empfinden sollte, aber auch da sprach er kein Wort, blieb düster und verschlossen. Er war sechzehn Jahre alt, als er heiraten musste. Die Frau, die man ihm ins Bett brachte, hieß Dshajnaasch, war kaum fünfzehn und hatte einen gelben, sonnengelben Kopf. Er hätte sich gern geweigert, sie ins Bett zu nehmen, doch tat er es nicht, wohl weil er wusste, dass es keinen Sinn hatte. Er konnte sich an sie lange nicht gewöhnen, wollte ihr aber auch nicht fernbleiben, denn sie war ihm nun einmal gegeben. Sie war ihm auch nicht gleichgültig, nachts vor allem, da sah er ihren gelben Kopf mit den grünlichen, runden Eulenaugen nicht. Dafür fühlte er ihren straffen, heißen, leise zitternden Körper und war zuweilen froh. Und eines Nachts glaubte er eine kleine beginnende Wölbung inmitten des schlanken Mädchenkörpers, über dem unteren Bauch erfühlt zu haben. Die Wölbung blieb, wuchs; er wusste lange nicht, ob er darüber froh sein sollte oder traurig. Das Kind, ein Mädchen, kam. Er war es, der es empfing im Leben. Das glitschige, blutige Ding in den Händen, war er einen Augenblick lang wie gelähmt vor Schreck und Ekel. Aber da stieß es einen Schrei aus und begann zu zappeln. Das musste in ihm ein bisher unbekanntes Gefühl ausgelöst haben, denn Schreck und Ekel waren wie weggeblasen. Dafür glaubte er in den Adern Feuer anstatt Blut zu spüren. Mit der Liebe eines Vaters kam er dem neuen Erdenbürger entgegen. Das fiel ihm wie jedem anderen aus dem Hirtenstamm nicht schwer: Man hatte schon oft einem gebärenden Schaf oder einer gebärenden Yakkuh beigestanden, so manche Lämmer und Kälber ins Leben geholt, den Schleim vom Maul heruntergewischt und die Nabelschnur durchgerissen. Ob Schaf, ob Mensch, das Leben war in seinem großen Gerüst einem Gesetz unterworfen.
Es war eine in sich widersprüchliche, oft gestörte Vaterliebe bei dem Minderjährigen, wie es in späteren Zeiten geheißen hatte. Die erste Störung kam, als Schuumur der Haarfarbe seines Erstlingskindes gewahr wurde. Sie war hell. Eine Gelbköpfige, stellte er mit Unmut fest, und diese Feststellung rief in ihm Bitterkeit und Enttäuschung hervor. Zwar verging dies dann, denn er begriff, das Kind konnte nichts für seine Haut- und Haarfarbe, keiner konnte etwas dafür. Aber der Gedanke, nicht sein Blut sei in dem Kind bestimmend, auch die künftigen Kinder würden von der Mutter geprägt sein, kehrte immer und immer wieder zurück, wie ein unstillbarer Schmerz.
Schuumur ritt die schmale, steile Schlucht des Oberen Doshangty im Trab hinauf, er trieb das Pferd arg an. Der Schimmelwallach fiel immer wieder aus dem Trab, schnaufte lautstark. Er war ein Nachkomme der grauen Stute, auf der Dshajnaasch zu ihm gekommen war. Die dreijährige Stute war nebst Reitgeschirr und den Satteltaschen mit den Kleidern ihre Mitgift gewesen. Damals hatte das Tier ein fast schwarzes Fell, nur hier und da schimmerten einzelne Haare hindurch, die davon kündeten, dass es sich mit der Zeit aufhellen und eines Tages ganz weiß aussehen würde. Sie gab viele Fohlen, das letzte war der Schimmel, auf dem Schuumur nun ritt. Als sie alt wurde, wurde sie für ein ganzes Jahr ihrem Willen und den Winden des Himmels überlassen. In dem einen Jahr der Freiheit erholte sie sich gut und setzte bei ihrem Alter noch genug Fett an. Und in dem Zustand wurde sie geschlachtet. Das geschah auf Wunsch von Dshajnaasch. Anfangs hatte Schuumur die Stute verschmäht, wie ihre Besitzerin auch. »Warum hat der Alte seiner Tochter nicht wenigstens einen Wallach mitgegeben?«, hatte er mit einem grimmigen Blick auf die junge Stute mit dem dünnen Schwanz und den schlanken Gliedern gedacht und hatte dabei Hass auf seinen Schwiegervater empfunden. Bald jedoch ritt er mit ihr auf die Jagd. Das geschah aus lauter Bosheit. »Wirst sehen, dass du fehl am Platz bist, Stütlein«, sagte er mit Grinsen zu ihr, als er davonritt. Tatsächlich war sie noch nicht zahmgeritten, war noch ungelenk im Gehorchen. Aber die kleinen Unebenheiten waren schnell beseitigt, die Stute zeigte sich von den guten Seiten eines Reittieres, war flink, stark und ausdauernd. Und sie war eine durchaus gutwillige Natur. Schuumur brauchte eine Reise, um all die guten Eigenschaften der Stute erkennen zu können. Jahre sollten dagegen vergehen, bis er von denen seiner Frau Kenntnis nehmen konnte.