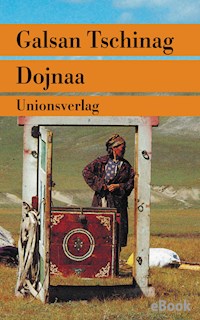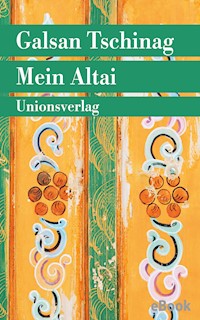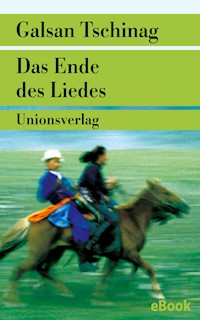11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit der Ankunft des jungen Studenten Galsan Tschinag in Leipzig beginnen diese Lebenserinnerungen. In der Nomadenjurte aufgewachsen, ist ihm hier alles fremd und neu: das Essen mit Messer und Gabel, das Wasserklosett, der Umgangston der Menschen und der Himmel über der grauen Stadt. Aber mit unbändigem Wissensdrang stürzt er sich auf alles, was er hier lernen kann, gewinnt Freunde unter Studenten, Professoren und Schriftstellern und wird bald zu einem Meister der deutschen Sprache. Inmitten der reichen europäischen Kultur und Geschichte fühlt er sich zunächst klein und unbedeutend. Erst als er eine deutsche Forscherin durch seine Heimat führt, wird ihm klar: Auch sein eigenes Land, seine Sprache und seine Leute haben der Welt einzigartige Erkenntnisse zu schenken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über dieses Buch
In der Nomadenjurte aufgewachsen, ist dem jungen Studenten Galsan Tschinag in Leipzig alles fremd: das Essen mit Messer und Gabel, der Umgangston der Menschen und der Himmel über der grauen Stadt. Aber mit unbändigem Wissensdrang stürzt er sich auf alles, was er hier lernen kann.
Lebhafte Szenen eines weltumspannenden Lebenswegs.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag
Kennst du das Land
Leipziger Lehrjahre
Die Lebensromane (1)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Erstausgabe
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Mona Eendra (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-30995-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 17.05.2024, 22:47h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KENNST DU DAS LAND
1 – Gelernt habe ich dieses Land aus der Ferne …2 – Nach dem schweren Anfang im Schoß der Mutter …3 – Demnächst werde ich vollwertiger Germanistikstudent der größten Universität …4 – In den Sommerferien verzichte ich auf die umständliche …5 – Mittlerweile ist der Sommer verrauscht. Dshuppi und ich …6 – Nun, wie heißt es bei den Nomaden …7 – Ende Juni schon brechen wir mit der Bahn …8 – Ja, hier stehen wir und überlegen fieberhaft …9 – Am 13. Juli 1968 ist es so weit …WorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Deutschland
1
Gelernt habe ich dieses Land aus der Ferne als German. Aber die Menschen, die es bewohnen, nennen es Deutschland. Auch unser Name für die Stadt stimmt wohl nicht ganz: Hatte ich eine kleine Ewigkeit auf ratternden, qualmenden und schaukelnden Eisenbahnschienen lang gedacht, ich sei unterwegs nach Leepzik, angekommen bin ich nun nach einer Woche in Leipzig.
Ansonsten scheint alles zu stimmen: Es ist ein gewaltiges Land, das mehr aus Beton, Eisen, Glas und Dampf zusammengesetzt ist als aus Gestein, Holz, Wasser und Luft. So auch die Stadt. Sie besteht aus hünenhaften Häusern, die gleich jenen gruselig-geheimnisvollen Felsen in unseren Heldenepen, Wand an Wand neben- und gegeneinanderstehen und verwegen emporklettern und mit den Spitzen und Kanten ihrer Dächer den Himmel bedenkenlos zerstechen und zerschneiden, während weit unten im schummrigen Schatten klammschmale, sturztiefe Schluchten sich kreuz und quer auftun und nach Luft und Licht zu keuchen und zu japsen scheinen. Und der Himmel darüber wirkt merkwürdig niedrig und gefleckt und gedämpft – vielleicht ist er schon so sehr angegriffen, aufgebrochen und ausgeräumt worden, dass ihm jegliche Erhabenheit abgekommen ist. Ja, das geistreiche, machtvolle Volk, im Unterschied zu unserem befreit aus jeglichen Fesseln des dummen Aberglaubens und der dumpfen Genügsamkeit, hat es vermocht, sogar den Himmel und die Erde in seine Untertanen zu verwandeln. Ja, der Traum des tollkühnen Teils der Menschheit, die Allmacht der Natur zu brechen und darüber zu herrschen, ist in diesem Erdteil wahr geworden.
Wohl auch deswegen hört sich die hiesige Sprache schneidend scharf an und wirkt hämmernd bestimmt. Welch ein Unterschied zu der unseren, die selbst unter den Bruder- und Schwestermundarten aus denselben Wurzeln durch ihre Weichheit so auffällt, dass manche aus Ecken gegenüber daran allerlei auszusetzen versuchen, indem sie darin bald Mark ohne Knochen, bald Lippen ohne Zähne zu wittern meinen. Nun muss ich, der ich diese markweiche, lippenzarte Sippensprache mit der Milch meiner Mutter getrunken, mich in meinem endgültig erwachsenen neunzehnten Lebensherbst mit dieser wildfremden, zur Wachheit rüttelnden und zur Strenge zwingenden Weltsprache herumbalgen.
Die Menschen kommen mir anfangs wegen ihres merkwürdig verteilten – überm Kopf so schütter und über anderen Körperlandschaften umso üppiger! – zieselgelben, mausbraunen, fuchsroten oder anders vielfarbigen Haares, ihrer langen, rabenspitzen Nasen, ihrer zu fülligen oder dann zu schlaksigen Gestalt recht unansehnlich vor. Doch sie belasten meine Augen mit jedem Tag weniger. Und mittlerweile glaube ich, so manche Vorzüge in dieser Menschenrasse zu sehen, freilich noch ohne zu ahnen, dass dies zu einem Teil bei Fremden aufgeschnappte billige Phrasen sind, die ich selbst recht bald durchschauen werde: die deutsche Pünktlichkeit, Genauigkeit, Sauberkeit … Hinzu kommt etwas, das mir selbst ins Auge springt und im Hirn pocht: der Unterschied im Körperbau zwischen mir und den Einheimischen. Der Schöpfer muss sie, einen nach dem anderen, in die Länge gezogen haben, ehe er sie entließ, während er mich aus seiner hohlen Hand nicht herausgelassen und immer wieder darauf geklopft hat, wohl einen Taaten-Knollen im Sinne. Und das Ergebnis: Sie sind lang und schmal, und ich bin kurz und knubbelig geraten.
Ich bin noch recht weit entfernt von der Bibel, dem Garten Eden und dem gifthaltigen Phänomen Erkenntnis, das schon damals Adam und Eva aus dem Paradies vertreiben konnte. Doch diese kleine Erkenntnis wirkt auf mich. Ich beginne, mich mit den anderen zu vergleichen, und finde jene im Vorteil und mich im Nachteil. Denn an mir entdecke ich so vieles auszusetzen. Und das macht mich unglücklich. Ja, am liebsten würde ich sofort in eine solche rötlich helle Haut schlüpfen!
Nun ereilen mich weitere Auskünfte, die ich natürlich für Wissen halte und daher stolz bin, dass auch ich sie weiß: wer Sachse ist und wer Preuße. Und wie und was sie alle seien. Auch dieses Klischee nimmt mein Hirn auf. Wäre nicht gerade Mutter Leipzig es gewesen, die sich meiner angenommen und mich mit Nahrung und Wissen säugt, und wäre der Nummer-eins-Mensch des Staates, zu dem nun auch ich gehöre, der Genosse Walter Ulbricht, nicht hier geboren worden, dann wäre ich liebend gern als Preuße wiedergeboren worden. Denn die meisten Tugenden, die man den Preußen zuspricht, gelten auch bei uns Steppennomaden als erstrebenswert. Nun aber gebe ich mich damit zufrieden, Sachse zu werden – ohne aber Sächsisch zu reden, denn die Lehrer, die auf Hochdeutsch pochen, gestatten uns so etwas nicht. Ich, der klein- und rundwüchsige Möchtegernsachse, werde viele Jahre später einen Begriff erfinden, der meinem Wunschbild genau entspräche: verpreußter Sachse.
Doch vorerst bin ich noch der Welpe, zwar nicht mehr blind wie ganz am Anfang, aber doch emsig vor mich hin schnüffelnd, um mich in meiner neuen Welt zurechtzufinden, und dabei getrieben von dem flammenden Wunsch Lernen, lernen und nochmals lernen!, wie der große Lehrer Lenin es Abermillionen von Schülern ans Herz gelegt hat.
Den ersten Leipziger Monat meines Lebens verbringe ich in der Lumumbastraße 3, Zimmer 103. Da widerfährt mir das erste erschütternde Erlebnis, das ich meinem Tagebuch anvertraue: Ich bringe es, nach anfänglich heftigem Zögern, doch fertig, in das schöne, strahlend weiße Porzellangefäß meine Notdurft zu verrichten. Das nächste buchenswerte Ereignis geschieht in der Studentenmensa. Ich schließe Bekanntschaft mit dem vierteiligen Besteck aus einem Messer, einer Gabel, einem großen und einem kleinen Löffel. Eigentlich kenne ich das aus dem Schulinternat zu Hause, aber das Messer hier hat keinerlei Ähnlichkeit mit den Messern bei uns, es ist unglaublich stumpf.
Zuerst beobachte ich, wie die Leute damit umgehen. Da arbeiten beide Hände zusammen, und zwar so: Die Gabel in der Linken spießt, während das Messer in der Rechten schneidet. Dann probiere ich es selbst. Und scheitere. Doch das vermag mich nicht zu entmutigen, nein, im Gegenteil: Es stachelt meine Neugierde nur noch an. So fange ich an, damit in meinem Studentenzimmer zu üben. Mithilfe meiner verlängerten Finger nähere ich mich der Kunst, eine Scheibe Brot mit einem Klecks Butter zu schmieren, es in mundgerechte Stücke zu trennen und jedes davon zwischen die Lippen sicher hineinzuschieben. Nur merke ich selbst dabei, wie an jeder meiner Bewegungen die Unbeholfenheit haftet.
Doch, wie ich später zu lesen bekomme, Übung macht schließlich selbst aus mir einen Meister. Sodass ich viele Jahre später auf einem internationalen Integrationskongress einen Spruch aus mir herauszuspucken wage: Sollte die Übernahme von gewissen Gepflogenheiten eines fremden Landes die Integration ausmachen, dann wäre ich bereit, vor laufender Kamera mit Gabel und Messer Nüsse zu knacken! Was eine gewiss bissige, doch ziemlich unsinnige Aussage war. Wenn einer mit Gabel, Messer und einer Muskatnuss gekommen wäre und mich vor eine laufende Kamera gebeten hätte, ich hätte mich sicher blamiert.
Beharrlich bleibe ich der fremdländischen Esskultur auf den Spuren, sodass sich bei mir im Laufe der Jahre manches anhäuft. Zum Beispiel glaube ich zu wissen, wo das richtige, kultivierte Essen anfängt: Mit dem Platznehmen am Tisch. Ich darf mich weder zu dicht an den Tisch noch zu weit weg davon setzen. Der Tischrand soll genau zur Mitte meiner Schenkel reichen. Dann bin ich in der Lage, bei Notwendigkeit jederzeit in die Höhe zu schnellen, ohne vorher meinen Stuhl zurückschieben zu müssen. Bevor ich anfange zu essen, habe ich eine kerzengerade Haltung anzunehmen und zwei bis drei Sekunden lang meinen Blick über den Tisch und durch den Raum schweifen zu lassen. Sollte ich dabei bekannte Gesichter entdecken, habe ich ihnen zuzunicken, begleitet von einem nur angedeuteten Lächeln. Jedes Besteckteil darf ich nur am Griff anfassen. Den Esslöffel nur bis zu zwei Dritteln füllen und einzig mit der Spitze, nie und nimmer aber seitlich zum Mund führen. Dabei den linken Arm so halten, als wenn darunter ein dünnes Büchlein geklemmt wäre, das nicht herunterrutschen darf. Arbeite ich dann mit Messer und Gabel, habe ich in Gedanken unter jede Achselhöhle ein Buch geklemmt. Die Gabel in der Linken habe ich fünfundvierzig Grad schräg zu halten, und das Messer in der Rechten soll mit gleicher Schräge leicht über die Gabel gleiten. So schneidet es am leichtesten. Wenn eine dünne Scheibe von dem dicken Stück abgetrennt ist, muss ich sie mit der Gabel vorsichtshalber noch einmal richtig aufspießen und dann erst zum Mund führen. Ob es dann der Löffel ist oder die Gabel, was die Ladung zu mir bringen will, es verharrt zunächst vierzig Zentimeter entfernt von meinem Mund. Die goldene Regel lautet dann: Mund und Gabel oder Löffel bewegen sich zeitgleich aufeinander zu und treffen sich in der Wegemitte! Die nächste goldene Regel. Ist die Gabel oder der Löffel am Ziel angekommen, lautet die Aufgabe des Mundes: die Ladung bedacht und geräuschlos aufnehmen, sogleich die Lippen schließen, dann kauen und dabei jedes Geräusch vermeiden! Eine weitere goldene Regel: Während des Essens nicht dauernd auf den Teller blicken. Das könnte von anderen als ein Zeichen des Minderwertigkeitsgefühls gedeutet werden. Darum gilt es, während des Kauens, was natürlich wieder in kerzengerader Haltung geschieht, den Blick ernst und selbstbewusst durch den Raum schweifen lassen. Und sollte er dabei einem anderen Blick begegnen, dann nicht vergessen, was eingangs gesagt worden ist: wieder lächeln!
Auf diese Weise besteckt, das heißt, mit einem vollständigen Besteck bestückt, fühle ich mich, inmitten meiner Spinnereien, sicher wie eine geballte Faust: Die vier Besteckteile gleichen meinen dicht bei dicht nebeneinanderliegenden vier Fingern, und ich selbst bin mit meiner tadellos geraden Körperhaltung am Tisch ein herausgestreckter, vorgezeigter Daumen.
Viele weitere, nun an meinem Geist rüttelnde Erlebnisse widerfahren mir einige Hundert Schritte weiter, im Sprachinstitut. Hier lerne ich die große Welt im Kleinen kennen: Junge Menschen aus sechzig Staaten der Welt füllen, beleben und beseelen das schlichte, aber solide, sichtbar neue Gebäude, genannt Herder-Institut. Der Weg zum Eingang führt an einem Standbild aus hellgrauem Gestein vorbei. Darauf ist ein schlanker junger Mann mit kurzen, krausen Haaren und etwas wulstigen Lippen abgebildet: Patrice Emery Lumumba, Führer des nationalen Befreiungskampfes im Kongo und bestialisch ermordet von belgischen Kolonisatoren.
Doch noch bevor ich diese heroisch-tragische Geschichte erfahre, kann ich längst erkennen, aus welcher Weltecke der steinerne Held da oben auf dem Sockel herstammt. Denn in der Mensa sehe ich solche Menschen. Nur, jene sind viel schwärzer, ja, richtig ruß- und rabenschwarz. Ich muss gestehen, die erste Begegnung mit einem Afrikaner erweist sich für mich als ein zutiefst aufregendes Erlebnis – sofort bekomme ich heftiges Herzklopfen. Und das Gefühl darauf: Mitleid mit dem merkwürdigen Wildfremden, an dem mein Blick einerseits stolpert und andererseits klebt. Viele Jahre später werde ich das Geständnis eines Afrikaners lesen, wie es ihm zumute gewesen, als er zum ersten Mal einen Chinesen sah. Ebenso Mitleid, genährt vom Gedanken: Ach, wie hässlich das arme Wesen! Ohne mein eigenes Erlebnis damals am späten Nachmittag des 29. August 1962 in der Lumumbastraße 3 zu Leipzig würde ich jenen Erzähler nicht verstehen können.
Nun betrete ich endlich den nach außen recht schlicht wirkenden Raum, der aber als ein heiliger Altar des Wissens für immer in meine Erinnerung eingehen wird. Denn hier beginnt mein Deutschunterricht. Und er beginnt bei null. Mit dem Abc des lateinisch-deutschen Alphabets. Mit der Aussprache eines jeden Buchstaben. Schon das b bereitet meinen nomadisch schlappen Lippen Schwierigkeiten. Dass Deutsch eine kraftvolle Sprache ist, merke ich bei der angespannten Aussprache des sonst so einfachen Lautes. Das e hören meine Ohren als ein Zwitterwesen. Als halb e, halb i. Und f – das ist die reinste Katastrophe! Keine der drei nomadischen Sprachen, die ich spreche, kennt den Laut. Das Russische, das ich wenigstens halbwegs zu beherrschen glaube, kennt ihn zwar, aber keiner von unseren zahlreichen Fremdsprachenlehrern hat es fertiggebracht, uns die Aussprache dieses unlenksamsten Lautes beizubringen. All die sechs Jahre, wie wir uns mit Russisch abplackten, hatten wir keinen richtigen Russischlehrer, diese Stunde wurde immer von jemandem, der gerade frei war, betreut. Und wie es mir jetzt einfällt, beherrschten jene Aushilfslehrer selbst die Aussprache des berüchtigten Lautes nicht so richtig. Hätten sie sonst mit uns Schülern, um die Laute f und p zu unterscheiden, nach den verpönten, aber sicheren Hilfswörtern paaprik oder piiner greifen müssen? Das taten nämlich die Menschen aus dem gemeinen Volk: Sagten sie p wie paaprik (Fabrik), dann meinten sie f, sagten sie dagegen p wie piiner (Pionier), dann meinten sie p.
Also stecke ich mit dem unaussprechlichen Laut f fest, der bei mir immer zu einem p wurde. Was den Lehrer sehr nervt, mich gar tief bedrückt, die kunterbunte Gruppe aus fast zwei Dutzend Personen aber hoch zu amüsieren, ja, heftig zu erfreuen und zu ermutigen scheint. Denn ein jeder von ihnen bekommt eine gute Gelegenheit, sich mit diesem Dummköpfchen zu vergleichen und sich für so viel klüger zu halten. Aber auch ich profitiere unbemerkt von diesem eigenen Versagen ganz am Anfang einer langen Lebensphase, was ich freilich erst später erkenne. Denn viele bekommen Mitgefühl mit mir – nach dem Muster: Jedes Dorf hat seinen Depp –, und dem Deppen ist das Wohlwollen der Gemeinschaft sicher. Vielleicht darum, vielleicht aber auch aus einem anderen Grund, spüre ich schon gegen Ende des ersten Unterrichtstages die Wärme, die von den meisten auf mich zuweht.
Doch schweren Herzens muss ich gestehen, dass vonseiten zweier die soeben gefühlte Wärme nicht nur fehlt, sondern auch harsche, zum Teil verächtliche Bemerkungen mich treffen. Und das alles in unserer Landessprache. Ja, von den neun mit mir zusammen Hergereisten wurden ein Junge und ein Mädchen in die gleiche Gruppe eingeteilt. Nun müssen sich die beiden meinetwegen vor Vertretern so vieler Nationen der Welt schämen. Was ich vollkommen einsehe und was die Trauer in mir noch schwerer lasten lässt.
Der gute Lehrer scheint eines nicht zu verstehen: Aus dem gleichen Land herstammend, können die beiden das f tadellos richtig aussprechen, während es damit bei mir gar nicht klappen will. Ich aber weiß den Grund: Alle außer mir wurden von sowjetischen Lehrkräften in eigenen Kindergärten und Schulen erzogen und verständigen sich untereinander auf Russisch. Was bei mir nicht der Fall ist.
Dann aber gibt es vier Laute, die ich besser aussprechen kann als meine beiden Landsleute: ö, ü, h und ng. Wieder weiß ich, weshalb es so ist: Die beiden ersten gibt es im Westmongolischen, das ich als Kind habe lernen müssen. Und die letzten beiden gehören zu den häufig vorkommenden Grundlauten meiner Muttersprache Dwadl. Im modernen Hochmongolisch und auch im Russisch fehlen sie. Der Lehrer, dem diese Feinheiten der Dinge unbekannt sind, macht wieder ein verwirrtes Gesicht. In mir aber erwacht ein Hoffnungsschimmer: Schau mal da, selbst die Elite von sowjetisch erzogenen Sprösslingen mit der ganzen Staatsmacht hinter ihren Rücken zeigt gewisse Schwächen! Hinzu kommt, dass viele andere aus der Gruppe, darunter drei auffallend schöne, reife Männer, alle drei schon imstande, sich mit dem Lehrer ziemlich flott zu verständigen, dennoch bei der Aussprache des Lautes ng ziemlich stolpern. Zuerst denke ich, sie kämen aus dem gleichen Land. Aber mit der Zeit werde ich den einen als Chilenen, den anderen als Syrer und den Dritten als Iraner unterscheiden lernen. An dem Tage und zu der Stunde ist mein so arg geplagtes und immer noch verwirrtes Hirn einer anderen wichtigeren Erkenntnis auf der Spur: Also muss es, wenn ich mit dem Laut f nicht fertigwerde, nicht ganz an meiner nomadischen Blödheit liegen!
Nach diesem aufregenden allerersten Sprachunterricht, der ganze sechs Stunden gedauert hat, schwirrt die Gruppe laut und fröhlich aus dem Institut und eilt auf die Mensa zu. Da hört man die verschiedensten Sprachlaute. Dazwischen hin und wieder welche auch, die ich als deutsche vermute. Ich habe niemanden neben mir, mit dem ich einige Worte oder wenigstens Laute tauschen könnte. Da werde ich von zwei, drei groß gewachsenen, langgliedrigen Männern überholt, und einer von ihnen legt mir dabei die Hand auf meine Schulter und sagt lachend: »Hallo, Mongolei! Gut …«, und noch etwas, das meinen Ohren entgleitet. Dann deutet er auf sich selbst und sagt: »Iran!« Das ist einer von den drei schönen, reifen Männern. Ich freue mich so sehr über diese Geste und Mitteilung und denke beschwingt: Also ist er aus dem Iran! Da lässt mich der liebe Mensch mit seinen weiten Schritten schon zurück und stürmt weiter. Es ist mir, als wenn er meinen soeben gedachten Gedanken zu weiteren voranträgt – durch meinen Kopf blitzt schon der nächste Gedanke: »Iran ist doch die neuzeitige Bezeichnung für Persien …« Kaum geht mir dieser große ruhmreiche Name durch den Kopf, tropfen weitere Berühmtheiten aus der Geschichte, einer nach dem anderen: Ulug Bek … Omar Hayyam … Rumi … Wie gut, dass die Geschichte neben der Literatur mein Lieblingsfach war! Und wie seltsam, dass Ulug Bek eine Bezeichnung in meiner Muttersprache ist und großer Fürst bedeutet!
Das Mittagessen nach diesen hochtrabenden Gedanken wird wieder einmal zu einer Qual für mich, weil die beiden Landsleute sich zu mir setzen. Da weiß ich gleich, dass ich es, o Himmel, nicht einfach haben werde. Denn schon beim Frühstück habe ich von dem Jungen, der mit mir ein Zimmer teilt und dessen Vater ein hohes Regierungsamt bekleidet, so manche abschätzige Bemerkungen und demütigende Zurechtweisungen einstecken müssen: Ich würde durch meine Kulturlosigkeit den guten Ruf unseres Vaterlandes besudeln. Der wahre Grund ist aber: Ich bin um vier Uhr wach geworden und habe die Bettlampe angemacht, um aus meinem einzigen Buch, dem Wörterbuch, das mir am Vortag in Berlin ein Botschaftsmensch geschenkt hat, wenigstens ein paar Ausdrücke zu lernen. Bald daraufhin dröhnte die befehlerische Stimme, das Licht sofort auszumachen, da es ihn beim Schlaf störe. Ich bin dem Befehl nur halbwegs gefolgt, indem ich das Licht ausmachte, solange ich das Angelesene leise im Mund wiederholte, bis ich glaubte, es auswendig gelernt zu haben. Daraufhin aber machte ich das Licht wieder an, um mir das Nächste schnell anzulesen und sogleich wieder auf den Schalter zu drücken.
Und nun: Ich gehe sehr überlegt an die Suppe und gebe mir Mühe, alles richtig zu machen. Dennoch muss ich mir sehr bald die genervte Zurechtweisung anhören, ich soll doch gefälligst aufhören zu schlürfen und zu schmatzen. Und dann passiert bei dem Hauptgericht mit einer Scheibe Fleisch und ein paar kugelrunden Kartoffeln das große Unglück. Denn ein Tadel nach dem anderen trifft mich aus nächster Nähe so pausenlos, dass mir irgendwann jede Beherrschung entgleitet, die Gabel über den Teller ausrutscht und alles, was auf ihm ist, über Tisch und Boden verstreut wird. Was dann geschehen ist, weiß ich nicht mehr. Erst draußen komme ich zu mir. Da renne ich schon auf das Haus zu, ins Rettung verheißende Zimmer mit dem Bett, das meinen kleinen Heimatersatz bildet. Ich werfe mich aufs Bett, stecke den Kopf unter die Decke und lasse den Tränen, die seit einer quälend langen Weile mir im Hals gesessen und zum Schluss arg schmerzhaft gegen den ganzen Schädel gedrückt haben, endlich freien Lauf.
Es dauert eine Zeit, bis ich mich ausgeweint habe. Ich spüre, dass keine Tränen mehr aus meinen Augen fließen und mich nur noch ein Schluchzer dann und wann schüttelt, und fühle schon eine gewisse Erleichterung in mir. Da merke ich, mein Kopf kann wieder denken. Der Gedanke, der mir dazu die Gewissheit gibt, lautet: Was tun?
Hier fällt mir ein, dass zwei große russische Denker diese Frage zum Titel eines Buches machten: Tschernischewskij und Lenin. Ja, was tun? Langsam, im Schleichtempo fange ich an, meine Erlebnisse am heutigen Tag wieder ins Gedächtnis zurückzurufen: Das nächtliche Erwachen … das Anknipsen der kleinen Bettlampe … das Herumblättern im Wörterbuch … der herrische Befehl … das Abknipsen … Wiederanknipsen … Wiederabknipsen des Lichts … Das wiederholte rasche Spähen ins Buch und die Dunkelpausen zum Auswendiglernen der erhaschten Ausdrücke dazwischen … Das Frühstück mit den Brotscheiben, Butter und Marmelade … Das Besteck, das man unbedingt benützen musste … Die hämischen Bemerkungen und befehlenden Zurechtweisungen von nebenan … Der erste Unterricht mit dem lieben Lehrer und den zahlreichen Kommilitonen ringsum … Das große, druckfrische Lehrbuch, das jeder bekam … Die Seite mit dem Alphabet mit den vielen unbekannten Buchstaben … Der verfluchte Laut f mit der schweren, schwersten Aussprache … Die anderen Laute, die für einen nicht so schwer sind, aber für andere doch, die bis dahin so sicher wirkten … Der Heimweg im so fröhlich lauten, verwirrend unterschiedlichen Stimmengewirr … Der schöne, langgliedrige Iraner mit der freundlichen Stimme und dem lieben Händedruck … Das herrlich duftende Mittagessen … Der schöne, freie Tisch … Die plötzliche, wie betäubende Gegenwart des Landsmannes …
Hier stockt der Fluss meines Gedächtnisses, denn das Herz fängt wieder an, heftig zu pochen. Aber ich stemme mich dagegen an, indem ich die Fäuste balle, die Zähne zusammenbeiße und mir selbst anbefehle: Halt! Du bist ein erwachsener Mann! Schau den Fährnissen und Quernissen des Lebens ins Auge und tu alles, dass du durchkommest, was und wie es auf dich auch zukäme! Und siehe da, es scheint tatsächlich zu helfen – mein Herz schlägt wieder ruhiger.
Da merke ich auch, wie klar mein Verstand wird. Der gestockte Fluss fließt wieder. Nun aber müssen meine Augen über den Tellerrand gegangen sein. Ja, jetzt sehe ich nichts mehr von unserem Tisch, meinem Teller und dem Gift spuckenden Nörgler. Sehe dafür den großen Raum mit den vielen Tischen und Menschen. Erkenne Schwarze, Braune, Weiße und solche wie wir, Asiaten, die ich demnächst als Vietnamesen und Nepalesen voneinander unterscheiden lerne. Da mache ich eine wichtige Entdeckung: Einige von ihnen halten die Gabel in der rechten Hand und fördern damit das Essen in den Mund, wie die Internatskinder bei uns es schon immer gemacht haben. Und ich sehe keinen Einzigen, der sich dem Zwang mit Messer und Gabel unterstellt und dabei so unglücklich ausschaut wie ich! Ach, wie dumm, dass ich mich von einem, der mit mir möglicherweise noch ganz anderes vorhat, unter Druck setzen ließ! Nun schwöre ich bei Vater Himmel und bei mir selbst, einem seiner Söhne, und schon deswegen bestimmt nicht so gering, wie jener meinen mochte: Nie wieder werde ich mich zu dem Affenspiel zwingen lassen!
Der Gedanke verleiht mir Festigkeit. Schwungvoll raffe ich mich auf. Zu meiner Erleichterung ist der Mitbewohner noch immer nicht da. Ich befreie meinen Oberkörper, nehme mein Handtuch, um mir im Waschraum am Ende des Korridors das verweinte Gesicht zu waschen. Dort angekommen, drehe ich den Kaltwasserhahn auf und lasse den zischenden, hellen Strahl laufen, wie ich es anderen abgeschaut habe, stecke meinen Kopf darunter und bleibe so lange, bis mir das Hirn zu schmerzen anfängt. Dann, das triefend nasse Haar mit dem Handtuch einigermaßen abgetupft und eine wohlige Frische durch den ganzen Körper spürend, gehe ich zurück.
Der Mitbewohner ist da. Und empfängt mich sofort mit einer abschätzigen Bemerkung: »So wirkst du nicht nur schweinisch unkultiviert, sondern auch noch glattweg verrückt!«
Merkwürdig, anstatt wie bisher vor Unsicherheit zittrig zu werden, bleibe ich diesmal völlig ruhig und sage, ebenso ruhig und leise, aber vollkommen deutlich: »Was ist nun schon wieder?«
Da mein Gesicht dabei nicht nur ihm zugewandt, sondern mein Blick stramm mit dem seinen verstrickt war, vermag ich genau zu sehen, wie sehr meine Frage ihn trifft: Die schmalen Augen weiten sich rasch, und dort, wo der schwere Unterkiefer endet, zuckt es – ein dicker Klacks Überraschung also!
Beim nächsten Wimpernschlag aber scheint er sich wieder zu fassen. Denn die Augen ziehen sich zu zwei Schlitzen zusammen, und dabei zittern die Nüstern der flachen, breiten Nase bedrohlich. Erst nach einer reichlichen Pause kommt durch die zum Strich gezogenen, blattdünnen Lippen, schwer gepresst und schrill gezischt, ein schto-o-sh-ty-maltschischek! heraus: Wa-a-s, du, Büblein?
Ich habe nicht vor, ihn zur Weißglut zu treiben. Nehme mir aber Zeit, um wohlüberlegt an die Sache heranzugehen. So beschließe ich, meinen Blick weiterhin an den seinen zu heften. Und rücke schließlich, immer noch leise und betont sachlich, mit der Sprache heraus: »Darf ich endlich wissen, woher du das Recht nimmst, einfach so über mich herzufallen?«
»Die Sorge um den guten Ruf unseres mongolischen Heimatlandes gibt mir das Recht, dich wasserköpfigen, kulturlosen Lümmel zurechtzuweisen, und wenn es sein muss, auch zurechtzuklopfen!«
»Woher willst du wissen, dass ich wasserköpfig bin?«
»Man hat doch heute gesehen, was für ein Schafshirn in deinem Schädel steckt! Solltest du es vergessen haben, wie schändlich du den Ruf der mongolischen Nation besudelt hast, dann sag doch einfach Fisch!«
»Pisch!«
»Hahaha! Da haben wir es – Pisch! Willst du nicht zugeben, dass du einfach zum Kotzen dumm bist?«
»Gut, ich gebe zu, mit dem Laut klappt es bei mir nicht, noch nicht. Aber ich hoffe doch, dass ich es bei einiger Übung irgendwie schaffen werde.«
»Nein, du wirst es nie! Das weiß ich!«
»Sag das nicht. Du kennst mich nicht. Übrigens, ich könnte dich mit einigen Wörtern auch in Schwierigkeiten bringen, du!«
»Du mich in Schwierigkeiten bringen? Unmöglich!«
»Sag doch dann: Ich möchte üben!«
»Denkst du wirklich, ich lasse mich von so einem wie dir prüfen? Dafür bist du mir einfach zu gering, du Hirtenpack!«
»Also hast du Angst, dich zu blamieren – du Hasenherz!«
»Ich warne dich, Pöbel, mich zu reizen! Ich lernte boxen und könnte dir die Schnauze platt hauen!«
»Armseliger Angeber! Aus Angst, dich zu blamieren, versuchst dich herauszureden! Ich kann einen Laut nicht aussprechen. Und du ganze viere! Sag doch: möchte! Sag: Übung … lange … heute …!«
»… mjochte … jiubung-g … lang-ge … choite …«
Ich fange an zu lachen: »Soso. Während ich wegen eines Stolpersteines aufpassen muss, hast du, Ärmster, mit vieren zu tun!«
»Halts Maul! Woher willst du denn wissen, dass ich alles falsch ausspreche?«
»Der Lehrer hat es doch auch gemerkt, und darum hat er es mit dir eine ganze Weile geübt. Bislang aber umsonst, wie man hört!«
»Pass nur auf, Kleiner! Ich warne dich. Das kann Folgen haben. Mich haben sowjetische Lehrer sechs Jahre lang in Deutsch unterrichtet, und ich habe immer gute Zensuren gehabt!«
»Aber der deutsche Lehrer hat heute deine Aussprache bemängelt. Willst du es ihm, dem Muttersprachler, etwa nicht glauben?«
»Nein! Denn was ist ein Deutscher gegen eine ganze Mannschaft von sowjetischen Lehrern? Und erst gegenüber der großen Armee sowjetischer Pädagogen!«
Ich werde hellhörig. Jeder in unserem Land weiß allzu gut, mit welch bösen Folgen er rechnen muss, wenn irgendjemand selbst der harmlosesten Bemerkung eine politische Mütze aufsetzt. Darum will ich in dieser Richtung nicht weiter eindringen. Doch wage ich, einmal die Eisschale des stummen leidvollen Duldens aufgebrochen, die mir zur Last gelegte Kulturlosigkeit von selbst anzugehen, um mir Klarheit zu verschaffen. So fange ich an: »Die Sünde, die ich gegen den guten Ruf unseres Heimatlandes begangen habe, ist nicht die Unfähigkeit meiner Lippen, im Unterricht jenen einen Laut auszusprechen, sondern die meiner Hände, beim Essen mit Messer und Gabel zu verfahren. Ich weiß es. Und ebenso weiß ich mittlerweile, wie es zu dem peinlichen Ausrutscher gekommen ist – da trifft die Hauptschuld dich!«
»Die Hauptschuld? Mich?«
»Du hast mich gehetzt. Schlimmer, als manche Stümper von Jägern ein Tierwesen hetzen. Muss wohl froh sein, dass ich mich nicht noch übergeben habe. Oder noch schlimmer, dass ich mit Messer und Gabel oder mit meinen Krallen und Zähnen auf dich losgegangen bin. So wie das arme gehetzte Tier – es besprüht den Peiniger zuerst mit dem Inhalt seines Darmes und seiner Blase, und zum Schluss springt es ihm an die Gurgel.«
»Willst du mir etwa Angst machen?«
»Wie könnte ich, Sohn eines Wandernomaden aus der Jurte, dir, Sohn eines mächtigen Chefs aus der Hauptstadt und Bewohner eines Palastes aus Stein und Glas, Angst machen – das geht einfach nicht. Dennoch. Ich bitte dich, Freund, mich nicht weiter grundlos zu quälen. Wir leben lange nicht mehr im Feudalismus, wo einer den anderen unterdrückt. Der Sozialismus, der auch mir mitgehört, hat auf seine Fahne geschrieben: Alle Menschen sind gleichberechtigt.«
Ein Geschrei, begleitet von einem knallenden Aufstampfen, unterbricht meine Worte: »Schweig, Lümmel! Denkst du, ich lasse mich von dir vollquatschen? Und dann auch noch: Freund! Derlei Erniedrigung will ich aus deinem Stinkmund nicht hören!«
Merkwürdig, wirklich merkwürdig, dass ich weiterhin ruhig bleibe. Ich sage in einem echt freundlichen, gerade weil er mir das Wort Freund verbieten will, aber auch unmissverständlich bestimmten Ton: »Gut, dann will ich es kurz und bündig machen. Lass mich ab heute Abend mein Stück Brot essen, so wie ich damit zurechtkomme! Sonst verspreche ich dir, du wirst mich von einer ganz anderen Seite kennenlernen!«
»So! Wieder eine Drohung?«
»Nimm es, wie du willst. Übrigens, der Umgang mit dem Messer macht mir nichts aus. Ich habe von Kindesbeinen an gelernt, mit Messern umzugehen, mit richtigen Messern, mit ellenlangen Dolchen, scharf zum Haarespalten. Jeder bei uns trägt in einer Holzscheide sein eigenes Messer – o ja, wir Bergsteppennomaden können mit Messern besser umgehen als die Kaukasier!« Das ist möglicherweise ein wenig übertrieben.
Ein Schlag trifft mich mitten ins Gesicht. Ich taumle. Stürze hin. Bleibe liegen. Blute aus beiden Nasenlöchern …
Das alles stelle ich nachträglich anhand langer Überlegungen wieder her. Möglich, dass noch etwas dazwischen war. Doch im Großen und Ganzen dürfte es so gewesen sein. Was ich tatsächlich wahrnahm, ist dies: Der Schläger, der Menschenschlachter, rüttelt derb an mir, zerrt meinen Oberkörper in die Höhe und zischelt mit gepresster, keuchender Stimme immer wieder: »Verstell dich nicht! Steh sofort auf! Aufgestanden, sag ich dir, aufgestanden! Hörst du?« Eine Zeit lang noch im Unbestimmten, was mit mir gerade passiert, spüre und höre ich nur dieses Ruckeln und Zischeln. Dann dämmert es mir langsam, und ich stürze in eine tiefe Fassungslosigkeit. Diese entlässt mich später an weitere Stufen des Gefühls: Hass, Wut, Angst, Scham, Enttäuschung. Ja, die Enttäuschung! Und sie gilt mir selbst: Oh, was für ein Schwächling bin ich, habe mich von einem Angeber niederschlagen lassen und liege nun schändlich in einer Lache aus eigenem Blut und hechle und röchle wie ein armseliger, sterbender Köter! Der Schmerz, der, einem doppelschneidigen Messer gleich, in meiner Seelenlandschaft wütet, erfährt auch dann kaum Linderung, als meine Augen wahrnehmen, was da geschieht, und mein Verstand anfängt abzuwägen, warum das geschieht, und bald zu dem Schluss gelangt, dass mein Schinder arg von Panik erfasst ist: Ein ganzer Haufen Klopapier, blutbeschmiert und zerknüllt, liegt bereits auf dem Fußboden. Der Unmensch reißt von einer Restrolle immer noch ellenlange Stücke ab, zerknüllt sie und wischt mir damit Gesicht und Hals und bald Brust und Bauch ab. Dabei ist seine ganze rechte Hand blutverschmiert, wie die Pfote eines leichenfressenden Hundes, während seine Linke mich am Nacken packt und zerrt.
Da zuckt mir ein Gedanke durch den Schädel: Wie kommt denn das Klopapier her? Ist er in seiner Panik vor dem rinnenden Blut bis zum Ende des Korridors gerannt und hat dort aus einer Toilette die ganze Papierrolle gestohlen?
Hustend und prustend raffe ich mich schließlich hoch und taumele an dem Mistkerl vorbei auf die Tür zu. Sie ist abgeschlossen. »Mach auf, Feigling!«, schreie ich heiser. Mitten auf dem befleckten und verschmierten Fußboden steht er, umringt von zerknüllten, rotbunten Papierfetzen. Sein Gesicht wirkt leichenblass, nimmt aber sogleich wieder den selbstgefälligen Ausdruck an – er grinst. Seine Stimme klingt voller Hohn und Schadenfreude: »Ich habe dich gewarnt, du Lümmel vom Land. Vor mir, einem Hauptstädter mit ganz anderen Kenntnissen und Fähigkeiten, hast du dich immer schön bescheiden und gehorsam zu benehmen! Das war nur ein kleines Vorspiel. Nächstes Mal werde ich so zuschlagen, dass du nicht wieder aufstehst, verstanden?«
»Einer, der so spricht, endet früher oder später im Knast. Pass also auf, Unglücklicher!« Ich glaube aber, er wird zu Gewalttaten weiterhin bereit sein. Darum muss ich mir unbedingt etwas einfallen lassen. Meine Nase hat aufgehört zu bluten. Ich habe mich fast beruhigt. Nur, denke ich, so wie ich jetzt aussehe, mit Blutspuren am halben Körper, kann ich nicht bleiben. Außerdem spüre ich Blasendruck. Also muss ich unbedingt raus. Aber der Gewalttäter will es nicht. Der hat einfach Angst, aufgedeckt zu werden. Dafür habe ich sogar Verständnis. So fangen wir an zu verhandeln.
Ich unterbreite ihm zwei Vorschläge. Entweder er geht mit meinem Handtuch, die blutigen Papierfetzen hineingewickelt. Damit hat er die Spuren seines Verbrechens halbwegs beseitigt und das fremde Blut von seinen Händen entfernt. Das Tuch kann er mir klitschnass zurückbringen, auf dass ich mich hier säubere, ehe ich das Versteck verlasse. Oder ich werde hier drinnen das Handtuch nass pinkeln, damit mich und ihn und den Fußboden abwischen, schließlich die Papierfetzen, darin eingewickelt, mitnehmen, um sie ins Klo zu stecken und zum guten Ende das Tuch wieder sauber zu waschen.
Er überlegt eine Weile und geht auf den ersten Vorschlag ein, schließt das Zimmer aber ab und kommt recht schnell wieder zurück, mit dem nassen Handtuch. Mit dem wische ich zuerst mich, dann den Fußboden ab, und zum Schluss spüle ich es im Waschraum gründlich durch. Da mir die Nase und Lippen dick geschwollen sind, verzichte ich auf das Abendbrot und bleibe im Zimmer. Ihm scheint das recht zu sein, aber er äußert sich dazu nicht. Spricht aber, bevor er geht und mich wieder einschließt, die gewichtigen Worte: »Sollte irgendwann jemand von dem heutigen Vorfall erfahren, dann werde ich meinen Vater einschalten, und er braucht nur die Botschaft anzurufen, um dich zu deiner Schafherde zurückzuschnipsen, verstanden?«
Ich sage nichts dazu. Glaube aber sofort an die Möglichkeit. Diese Nacht schlafe ich schlecht. Erst jetzt begreife ich meine Erniedrigung in ihrem vollen Ausmaß. Da komme ich mir so himmelschreiend minderwertig vor: schwach, feige und untertänig.
Mit der Zeit jedoch werde ich über mein Verhalten an diesem Tag anders urteilen und mir sogar Vernunft und Weitsicht zubilligen. Denn hätte ich mich, mit meinem schwachen Körper und meiner ungeschützten sozialen Stellung, vom Idealismus eines aufbrausenden Jugendlichen führen lassen und meine menschliche Würde um jeden Preis verteidigen wollen, hätte ich nur Öl ins Feuer geschüttet. Dann wäre die Sache ganz bestimmt viel schlimmer ausgegangen. Vielleicht hätte er mich sogar erschlagen. Selbst bei einem milderen Ausgang der Schlägerei, wie sie zwischen Mongolen tagtäglich passiert, wäre von vornherein klar gewesen, dass ich den größeren Verlust erleiden würde. Ach, wie dankbar bin ich da dem guten Geist, der mich, den Hitzkopf, in der Stunde jener harten Prüfung vom Wahn eines unangebrachten Mutes und unzeitgemäßen Stolzes bewahrt hat!
Doch bin ich noch um viele Zeithügel, manche Zeitberge entfernt von dieser weisen, rettenden Erkenntnis. Noch stecke ich im Sumpf des Leides fest und stöhne. Kämpfe gegen Tränen und Rotz wegen Scham und Schande. Ja, ich komme mir unerträglich vor, ein Nichts, mit dem man rücksichtsloser verfährt als mit einem streunenden Hund! Dabei plagt mich nicht nur seelisches Leid, sondern auch körperliches. Meine Lippen müssen innen aufgeplatzt sein, ich spüre im Mund widerlich süßlichen Blutgeschmack und brennende Schmerzen. Alles an meinem Kopf kommt mir wie erschüttert und entwurzelt vor. Mit einem Mal wird mir speiübel.
Da will ich, wie immer in solchen Fällen, den großen himmlischen Vater und seine mächtige Dienerin, meine liebe Muttertante Pürwü, herbeirufen. Und was muss ich da hören? Eine armselig winselnde Stimme und ein halb gewispertes und halb gepiepstes Fürwü … Ich halte inne. Dann will ich den mir so vertrauten Namen wieder aussprechen. Und wieder kommt ein Fürwü hervor. Mein Herz steht still, vor Erstaunen, vor Überraschung – denn es blitzt durch meinen Kopf: Das ist doch der Laut, gegen den sich meine Zunge und meine Lippen so hartnäckig widersträubt haben! Sogleich fallen mir die Wörter ein, die der Lehrer mir immer wieder vorgesprochen hat und die ich ihm nachsprechen musste: Fisch … fischen … Fischer … Fritz … Nun scheinen sie alle sich mir zu ergeben! Daraufhin begreife ich auch, woher solches kommt: Meine Lippen sind so dick angeschwollen, dass sie sich nicht mehr schließen lassen – die Lippen offen halten, so einfach ist es!
Das ist doch eine helle, ja, lodernd helle Erkenntnis mitten in dieser düstersten, schwersten, bittersten Nacht in all den Jahren meines Erdendaseins überhaupt. Ach, wie sehr erleichtert sie mir nun das so schwer niedergedrückte Gemüt mit einem Ruck, o Himmel! Und in diesem Augenblick der sich erhebenden Erkenntnis keimt in der Tiefe meines Bewusstseins eine Einsicht, die recht bald, einer Pflanze gleich, Wurzeln schlagen und mit der Zeit zu einem der vielschichtigen Böden unter den Rädern meines Lebensfahrzeuges sich ausbreiten und verfestigen wird. Denn da ist mir, als fühlte ich in mir eine hauchleise Haftung für den Mitbewohner.
Der nächste Tag … Die Schmerzen im Mundraum spüre ich immer noch, doch was macht das schon: Ich komme mir wie neu eingerichtet vor, um nicht zu sagen: neugeboren. Ich bin endgültig entschlossen, meine plumpe nomadische Hülle abzulegen und in eine feine städtische hineinzuschlüpfen, mich zu verändern, zu veredeln, mir Zugang zu verschaffen zu Dingen, die andere längst besitzen, die mir aber bislang gefehlt haben, sodass ich möglichst bald mit möglichst allem bestückt dastehe, in der Lage, von allen Mitmenschen als ein Gleichwertiger anerkannt zu werden, und, wenn einer es nicht tun wollte, mich ihm gegenüber furchtlos zu behaupten. Und meinen Willen durchzusetzen.
Mir ist, als tue ich an diesem Tag den ersten Schritt auf meinem Weg nach oben. Der Unterricht fängt wieder mit phonetischen Übungen an. Der Lehrer nimmt mich als Ersten dran. Und ich spreche ihm wacker nach: Fisch … fischen … Fischer … Fritz … Noch bevor der Lehrer eine Bemerkung dazu machen kann, bricht ein kleiner Beifallssturm aus, begleitet von einem vielstimmigen Bravoruf der Kommilitonen. Das unverkennbare Wohlwollen aus ihren glänzenden Augen und die Überraschung auf ihren Gesichtern bemerke ich schnell. Und erkläre es mir später so: Am Vortag, sozusagen gleich bei dem Startschuss des Massenrennens, haben sie gemeint, ich würde es gar schwer haben, und haben mich dabei bedauert und gleichzeitig mit mir unbewusst sympathisiert, wie wir Menschen es mit Benachteiligten und Unterlegenen in der Regel immer tun. Und nun, einen Tag später, erleben sie meinen kleinen Erfolg und sind überrascht und aufrecht erfreut.
Nicht teilen kann diese allgemeine Freude selbstverständlich mein Landsmann und Zimmergenosse. Sein betont sowjetisch-städtisches, edel-bleiches Gesicht mit der Igelfrisur wirkt wie tödlich erschrocken, regungs- und leblos. Was meiner Seele zunächst eine betäubend süße Befriedigung verschafft – ich gebe es zu. Dann aber tut er mir auch ein winziges bisschen leid. Noch weiß ich nicht, woher dieses Gefühl kommt. Aber später werde ich in die Lage kommen, dem einen Namen zu geben.
Unser Landsmädchen, seine Klassenkameradin, schenkt mir heute einen kindlich bestürzten, weiblich kecken Blick, sogar begleitet von einer städtisch kontrollierten Begeisterung. Vollkommen anders als am Vortag. Denn da hat sie überhaupt kein Auge für mich gehabt und hat wie eine weibliche Kopie ihres Klassenkameraden gewirkt: wolkenhoch und eisig kühl. Nun fängt ihr Bild an, in mir dorthin zu wandern, wo ich meinen lichten Altar und warmen Herd in einem habe: herzwärts. Was zur Folge hat, dass ich in den nächsten Stunden und Tagen beginnen werde, mich in ihre Richtung zu bewegen, jede noch so kleine Gelegenheit erhaschend, auf Suche nach so etwas wie einer scheuen, kleinen Freundschaft mit dem erhabenen Wesen. Nur wird daraus natürlich nichts werden. Denn eines Tages werde ich begreifen müssen, was wir sind: eines Staates Bürger zwar, aber zweier Welten Bewohner! Und so werde ich meine mehr nomadisch harmlosen als männlich missdeutbaren Annäherungsversuche zu ihr aufgeben.
Dieser Tag bringt mir einen weiteren Gewinn. Einer der Kommilitonen erweist sich als ein Türke aus Zypern, und wir zwei können uns halbwegs verständigen, sooft ich tuwinische oder kasachische Ausdrücke aus mir heraushole und er mir wohl mit seinem Türkisch entgegenkommt. Er ist fünfundzwanzig Jahre alt, Sohn eines Arztes und heißt Oktay, was ich mühelos verstehe, weil der Name auch bei uns zu Hause ist: Pfeilschneller Pferdejährling.
Irgendwie mache ich Oktay verständlich, dass ich groß und stark werden und darum boxen lernen will. Ich frage ihn, wo ich das lernen könnte, sehe jedoch, er ist von meinem Vorhaben nicht gerade begeistert. Boxen sei nicht gut, sagt er. Aber, so verstehe ich ihn daraufhin, ich könne auch auf andere Art und Weise groß und stark werden – durch Sport. Ja, antworte ich, Sport ist gut! Aber wo? Und wie?
Er nimmt mich in die Stadt mit. Wir betreten ein Sportwarengeschäft. Er zeigt mir dies und das, führt mir manches davon vor und macht verständlich, all das würde mir helfen, groß und stark zu werden. Zum guten Schluss kaufe ich einen Expander und zwei Hanteln.
Womit ein Grenzstein meines neuen Lebens gesetzt ist. Und ich mich vom Begriff Freizeit so gut wie für immer verabschiedet habe. In dem Augenblick, als ich mit meinen Einkäufen im Studentenwohnheim ankomme, mein Zimmer betrete, es auspacke und zuerst den spöttischen Blick, daraufhin die ebenso spöttischen Bemerkungen des Mitbewohners auszuhalten habe, weiß ich es noch nicht.
»Hej, das ist nichts für Leute von deiner Sorte! Und es braucht dazu speziell eingerichtete Räumlichkeiten!« So fängt er an. Ich erwidre nichts darauf. Er wartet eine kleine Weile, fährt aber dann fort: »Du bildest dir einfach zu viel ein, Kleiner, dein Schafshirn hat dir wohl vorgeblökt, du wirst gleich sportlich, weil du dir solche Dinger anschaffst! Wüsstest du nur, wie du mit diesen wirkst! Ich sage es dir: Glattweg lächerlich! Genauso, wie du dir einbildest, die deutsche Sprache erlernen zu können! Mir ist sie ganze sechs Jahre lang beigebracht worden, und daher weiß ich, wie störrisch ihre Grammatik und wie unermesslich ihr Wortschatz ist. An einer sowjetischen Spezialschule unter Anleitung von hochgebildeten sowjetischen Lehrkräften sind wir neun zum Weiterlernen der Sprache im Mutterland endlich zugelassen worden. Das alles ist nichts für solche wie dich. Geh lieber zurück zu deinen Schafen und Yaks und sei froh, dass ihr Steppler im Unterschied zu euren Tieren wenigstens so etwas wie eine eigene Sprache habt! Und tu es, bevor du den guten Ruf unseres Mutterlandes besudelst oder selbst zu Schaden kommst, zum Beispiel durch mich!«
Ich will weiterschweigen. Sehe aber, auch das ist ihm nicht recht. Denn jetzt schreit er mich an. »Hej, du zweibeiniges Yakvieh! Ich rede mit dir. Du … du … du bist wie ein Kopf ohne Ohren«, stottert er wutentbrannt und stößt mir mit seinem gespreizten Finger derb gegen den Schädel. Hastig überlege ich, was der wahre Grund seines Wutanfalls sein könnte. Mein Erfolg mit dem schwierigen Laut, fällt mir ein. Und die unmissverständlich bekundete Gefühlsneigung der Kommilitonen zu mir! Da tut er mir im Grunde leid: Ein unglückliches Geschöpf, das sich gegen eine Gemeinschaft stellt. Und ein von der eigenen Angst Getriebener. Denn er ahnt wohl schon, ich würde nicht schlechter lernen als er. So kann er mich in seiner Nähe nicht ertragen. Daher will er mich entmutigen, mir Angst machen. Es ist sein letzter verzweifelter Versuch, mich dazu zu zwingen, dass ich das Feld freiwillig räume.
Ich tue, als ahnte ich nichts von seiner Absicht. Denn würde ich ihn es wissen lassen, würde sich seine Wut noch steigern. Aber ich will auf keinen Fall wieder geschlagen werden. So spiele ich lieber den Dummen, für den er mich hält.
Also sage ich betont friedlich – aber auch nicht ganz ohne: »Mein türkischer Freund Oktay, der selbst ein namhafter Sportler, und zwar ein Karatemeister, ist, hat mir diese Geräte empfohlen.«
Ich merke, die Erwähnung des Türken macht ihn sofort hellhörig. Doch er will es lieber unbemerkt lassen und äfft mich nach: »Mein türkischer Freund … Gib doch nicht so maßlos an! In welcher Sprache willst du dich mit ihm verständigt haben?«
Da aber sage ich unerschrocken: »Auf Türkisch eben! Meine Muttersprache Dwadl ist doch eine Mundart des Alttürkischen, wie auch das Kasachisch, sozusagen meine Vatersprache. Auch im Kirgisischen, einer weiteren Mundart des Türkischen, bin ich einigermaßen bewandert, sodass ich Tschingis Aitmatows Bücher meistens in der Originalsprache lese …« Ich hätte noch weiter erzählt, werde jedoch unterbrochen. »Hör auf!«, schreit er mich an. »Bildest du dir ein, ich würde deine Märchen glauben?« Sicher habe ich gegen Ende etwas zu dick aufgetragen. Dennoch war es die reinste Wahrheit, dass meine Muttersprache und meine Zweitsprache beide aus denselben Wurzeln wie das Türkische hervorgingen und ich daher mit jeder der anderen Geschwistersprachen recht leicht klarkomme. Selbst mit dem Kirgisischen war es nicht ganz gelogen. Vielmehr, es muss dahinter eine hellseherische Ader gepocht haben. Denn siebenunddreißig Jahre später, 1999, werde ich in Brüssel in der kirgisischen Botschaft den großen Schriftsteller, der dort als Botschafter seines Landes saß, treffen und mit ihm einen ganzen Sonntag lang ein unvergesslich intensives Gespräch führen. Da wird jeder in seiner eigenen Mundart reden, und das Kasachisch wird griffbereit dazwischen als eine Krücke daliegen, sooft wir bei einem fehlenden Wort zu hinken anfangen. Und wenn auch das nicht hilft, werden wir zum Russisch greifen, das zu jener Zeit als eine mächtige Brücke die Menschen im Osten untereinander verband.
Noch ist die Zeit nicht so reif, noch bin ich ein Grünschnabel, in die Ecke gedrängt von meinem Mitbewohner, der mich für minderwertig hält.
Doch er geht gar nicht darauf ein und redet von was ganz anderem: »Dir fehlt einfach die Kultur! Also einfach Hände weg von gewissen Dingen, sie sind für andere, bessere. Ein Hochschulstudium in Deutschland ist für dich einfach zu hoch gegriffen!«
Am liebsten würde ich darauf nichts erwidern. Doch wage ich nicht, ihn durch mein Schweigen wieder zu erzürnen. So sage ich gedämpft: »Ich werde mich anstrengen, um mich zu bessern …« Was übrigens meine ehrliche Absicht ist. Durchaus so materiell gemeint, wie die Heilung eines Kranken auf schamanische Art vorstellbar ist: das Untaugliche zuerst anpacken und abstechen, dann zerlegen und ausmerzen und zum Schluss wieder formen, neu beseelen und wiederbeleben. Doch der Himmel behüte mich, an diesem Ort den leisesten Hauch von irgendetwas Verdächtigem zu wagen, geschweige denn das verfemte Schamanische anzutasten.
Doch ach! Je sanfter ich mich vor ihm benehme, desto mächtiger gebärdet er sich mir gegenüber. Der Grund: Er hat meine Angst gespürt und will nun wohl nur eines – will sie in mir weiterschüren. Denn jetzt steigt seine befehlerische Stimme in fast schreiende Höhe: »Nichts wird dir helfen, das sage ich dir! Dir fehlt jede Grundlage für ein Hochschulstudium in Deutschland. Keine Kultur! Kein Russisch! Kein lateinisches Alphabet! Keine Vorkenntnisse in Deutsch! Du wirst schändlich scheitern und uns alle blamieren! Das hat doch Tschimka schon bei dem Vorstellungsgespräch in der Botschaft vorausgesagt. Das haben gestern bei der Eilberatung der Revsomol-Gruppe auch die anderen bestätigt. Und haben mich beauftragt, im Namen des Kollektivs einen Antrag an die Institutsleitung zu stellen, dich von der ohnehin aussichtslosen Bürde zu befreien und zu entlassen, damit du wieder nach Hause fahren darfst. Du hast hier nichts verloren, hast eine kostenlose Spazierfahrt nach Deutschland und zurück gemacht. Sei also froh!«
Ich werde hellwach. Oho, denke ich, so weit haben sie es schon gebracht! Mein Herz klopft heftig, und Gedankenschwärme jagen durch meinen Kopf. Ja, eines der Mädchen, das mit mir nie ein Wort gewechselt hat und dessen Namen ich auch nicht kannte, aber später als Revsomol-Tschimgee kennen werde, feuert am Tage der Ankunft in Berlin gleich bei dem ersten Vorstellungsgespräch in der mongolischen Botschaft in Gegenwart von mehreren Botschaftsangehörigen tatsächlich eine vernichtende Wortgarbe aus ihrem kleinen Mund mit den niedlich aufgewölbten Lippen auf mich los: »Wir, die wir alle Russisch besser als unsere Muttersprache sprechen, schon ganze sechs Jahre Deutsch als Fremdsprache gelernt haben und in kultivierten Familien der Hauptstadt aufgewachsen sind, werden gut lernen und den Ruhm unseres Heimatlandes hochhalten. Aber der da!«, damit zielt sie mit ihrem Zeigefinger auf mich, der ich ganz am Ende des langen Tisches sitze. »Von dem hört man, er spreche kein Russisch, kenne nicht das lateinische Alphabet, geschweige denn Vorkenntnisse in Deutsch. Und schlimmer noch: Er hat nicht mal gelernt, sich das Gesicht richtig zu waschen! Wir in der Gruppe haben uns gefragt: Wer von unseren zuständigen Genossen ist so unbesonnen gewesen, einen solchen Tollpatsch in ein Kulturland wie die DDR zum Hochschulstudium zu schicken? Und wir meinten, je eher man diesen Ungebildeten und Unkultivierten zurückschickt, desto besser wäre es!«