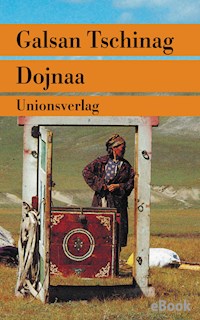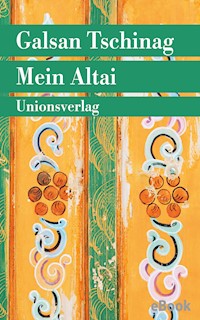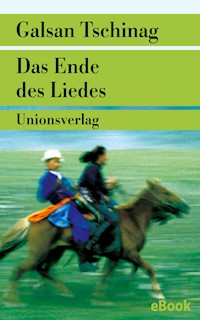22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die ungeschminkten Reportagen des jungen Journalisten Galsan Tschinag erregen Aufsehen. Als internationaler Korrespondent erlebt er die Umwälzungen in Kambodscha, berichtet aus Moskau, Kasachstan, Deutschland. Als sich in der Sowjetunion die Perestroika ankündigt, bietet sich ihm eine einzigartige Chance: Er wird zum ersten Redakteur einer Zeitschrift, die in der Mongolei das bisher Unsagbare an die Öffentlichkeit bringen soll. Immer wieder stürzt Galsan Tschinag aus vermeintlichen Sicherheiten und findet sich auf neuen Wegen wieder, die ihn rund um die Welt führen: zu seiner Leserschaft, zu neuen Freundschaften und Einsichten und zu seiner Bestimmung als Schriftsteller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Die Reportagen des jungen Journalisten Galsan Tschinag erregen Aufsehen. Doch als er die Prinzipien der Perestroika ernst nimmt und bisher Unsagbares an den Tag bringt, muss er neue Wege gehen, die ihn rund um die Welt führen: zu seiner Leserschaft, zu neuen Freundschaften und Einsichten und zu seiner Bestimmung als Schriftsteller.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag
Kennst du das Haus
Weltenweite Reisejahre
Die Lebensromane (3)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dritter Band im Zyklus der autobiografischen Romane:
Kennst du das Land; Kennst du den Berg; Kennst du das Haus.
© by Unionsverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Annie Spratt (Unsplash)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31183-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.08.2023, 18:02h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
KENNST DU DAS HAUS
1 – Meine Arbeitsstelle in der Redaktion, die mich berechtigt …2 – Jene drei Wochen in Südostasien, so darf ich …3 – Das so düster begonnene Jahr 1980 belohnt mich …4 – Nach diesem bleibenden, einschneidenden Erlebnis beginnt bei mir …5 – Nur wenige Tage nach jener inneren Erschütterung höre …6 – Ich komme nicht dazu, nach einer neuen Arbeitsstelle …7 – Schreibe ich weiterhin für Zeitungen und Zeitschriften Artikel …8 – Was nun geschieht, droht zuerst mich und später …9 – Der Gang der Jahre scheint sich um mich …10 – Wie habe ich mich gefreut, als 2009 mein …11 – Im Zentrum der lauten Weltmetropole Wien habe ich …EpilogWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Revolution
1
Meine Arbeitsstelle in der Redaktion, die mich berechtigt, Monat um Monat ein Gehalt zu beziehen, lautet »internationaler politischer Beobachter«. Da heißt es mit einem Mal: Nach Kampuchea! Der Staat, der nicht mehr Königreich, sondern wie eben mein Land auch eine Volksrepublik sein soll.
An Nang. Großer Bruder Nang. Er nimmt uns am Flughafen Po Chen Tong in Empfang. Er ist ein wirklich großer Mann, sowohl im Wuchs als auch im Amt, das er bekleidet. Weil er mich um einen halben Kopf überragt, zudem über auffallend lange Arme und einen ebenso auffallend schlanken, ja, fast skeletthaft dürren Körper verfügt, wirkt er in alle Höhen und Längen gestreckt.
Und dann erst seine Funktion: Mitglied des Zentralkomitees der Nationalen Front zur Rettung Kampucheas und Vorsitzender der Landesgewerkschaften! Beide Titel sind mir wohlbekannt, darum werde ich sprachlos. Von solchen Amtsinhabern weiß ich einiges aus der großen Weltmacht Sowjetunion, dem fernen Teil Germaniens und meiner Mongolei. Meine Güte, so ein Gewerkschaftsboss verfügt über etliche Stellvertreter, Sekretäre, Abteilungs- und Sektionsleiter, Dolmetscher, Referenten, Redenschreiber und viele andere, die ihm rund um die Uhr zu Diensten stehen. So einer pflegt, abgeschirmt durch ein Lobbyzimmer, in einem protzigen Büro mit holzbekleideten Wänden und blickdichten Vorhängen geschützten Fenstern zu thronen. Wohl möglich, dass ein dermaßen Abgehobener und Verwöhnter sich selbst als das Gemälde eines Heiligen in einem Edelholzrahmen sieht. Jeder Berichterstatter aus dem Ausland fühlte sich geschmeichelt, wenn er am Schluss seines Aufenthalts von dem so privilegierten Boss auch nur zu einem kurzen Höflichkeitsgespräch empfangen würde.
Aber hier ist der Amtsinhaber höchstpersönlich zum Flughafen gekommen, um mich, einen einfachen Journalisten aus der politisch wohl bedeutsamen, aber wirtschaftlich extrem leichtgewichtigen Mongolei, abzuholen. Ich muss es erst einmal verdauen!
Wir werden gebeten, in ein weißes Auto einzusteigen. Es ist eine sowjetische Produktion, ein Wolga neuen Typus. Unter den nicht wenigen Fahrzeugen, die ringsum stehen, ist unseres das ansehnlichste, sodass ich darin das tadellose Funktionieren der sozialistischen Hierarchie erkenne. Zweierlei aber weicht von der mir bekannten Praxis ab. Erstens steckt der Fahrer des Dienstwagens in einer Armeeuniform und trägt eine Pistole am Gürtel. Zweitens steigt der Chef vorne ein, obwohl sich sonst alle mit Recht auf einen Dienstwagen rechts hinten zu platzieren pflegen. Als er eine eindrückliche Schießwaffe aus dem Handschuhfach holt und auf seinen Schoß legt, glaube ich, die Erklärung dafür gefunden zu haben. Im Ernstfall würde er augenblicklich nach ihr greifen und sich in den Kampf stürzen.
Eher als gedacht, hat sich für mich, den Fremden, die Gelegenheit ergeben, in das Innenleben dieses Landes, das bislang außerhalb meines geistigen Horizonts lag, einzutauchen. Nach nur wenigen Minuten Fahrt treffen wir auf einen Zug von Menschen, den ich auf einige Hundert, vielleicht auch einige Tausend Menschen schätze. Sie wirken aus der Entfernung tiefschwarz und fast erstarrt. Dann aber, nachdem wir uns ihnen genähert haben, bemerke ich doch kleine, träge Bewegungen. Schließlich holen wir den Menschenzug ein und schleichen uns behutsam an ihm vorbei. Ich vermag die einzelnen Gestalten zu erkennen und hefte auf das eine oder andere Gesicht den Blick. In diese Mienen scheinen alle Schattierungen menschlichen Leids hineingemeißelt zu stehen: Elend, Entbehrung, Erschöpfung, Trauer, Verbitterung, Trostlosigkeit.
An der Spitze des Zuges hält der Wagen und wir steigen aus. Was ich zuerst wahrnehme, ist ein Meer aus Augen. Und ein Gedröhn von Schritten. Ich empfinde ein peinliches Unbehagen – nicht allein vor dem, was ich sehe, sondern vor allem wegen meines eigenen Aussehens. Meine gepflegte Erscheinung – schneeweißes Hemd und wolkengraue Hose und ein Gesicht ohne Schweiß und Staub, inmitten dieses Haufens Elend.
Viele meiner Berufskollegen hätten da anders verfahren, ich weiß. Aber ich bringe es nicht fertig, auf diese Menschen im schutzlosen, nackten Elend mit dem Objektiv des Fotoapparats zu zielen. Schon den Blick auf sie zu richten kostet mich schwerste Überwindung, so wie sie dastehen, in ihren verdreckten und zerfetzten Lumpen, mit ihren ausgemergelten und erschöpften Gestalten, wunden, blutenden Lippen und redenden Blicken. Der Kontrast kommt mir unerträglich scharf vor: Diese menschlichen Wesen, von schwerem Schwarz gedrückt und peinigendem Griff des Elends gezeichnet, und ich vor ihnen in strahlendem Hell wie im Eitelglanz von Glück und der Unbeschwertheit ungestörten Lebens.
Still und stumm, wage ich nicht einmal, auf die Menschen direkt um mich herum zu blicken. Stehe, die Augendeckel gesenkt, und gewahre alles nur gedämpft. Aber alle meine Sinne sind wach, ich spitze die Ohren. Vor allem lasse ich die Hände arbeiten – sie schreiben. Denn unterdessen hat der Chef ein Gespräch mit den Menschen angefangen. So schüchtern die Leute am Anfang auch gewirkt haben, jetzt rücken sie mit der Sprache heraus, eine richtige Aussprache ist im Gange.
Lien, meine vietnamesische Dolmetscherin, übersetzt fleißig, und ich versuche, es möglichst verlustfrei in meinem Notizbuch festzuhalten. In meinem Hirn beginnt es zu dämmern, warum es zu dieser Volkswanderung gekommen ist und wohin der Leidenszug führt.
Pol Pot und Ieng Sari, die Führer der Roten Khmer, hatten den Maoismus auf ihre Fahne geschrieben und allseitigen Beistand Pekings genossen. 1975 gelangten sie in Kambodscha zur politischen Macht und stürzten sich sogleich in ein gruseliges Abenteuer: Alles Bürgerliche sollte ein für alle Male ausgerottet werden. Mit einer unverhohlenen Gewaltherrschaft begannen sie, alles Städtische und Zivilisatorische zu zerschlagen. Würfelten die gesamte Bevölkerung durcheinander, vertrieben sie aus Städten und Siedlungen und verschleppten sie in möglichst weit abgelegene, unwegsame Gegenden. So sollte das ganze Land auf Landwirtschaft umgestellt werden, damit dann, getreu der Lehre des Großen Lenkers, ein Urkommunismus aufblühe, eine konfliktfreie Gemeinschaft von lauter Gleichen, in der es nichts mehr gab, worüber zu streiten wäre. Ein Volk ohne städtischen Luxus, ohne Elektrizität, ohne Maschinen, ohne Schulen, ohne Geld – ohne alles.
Jahre zuvor war mir eine kleine Broschüre in rotem Einband in die Hände gekommen und ich hatte darin auch ein paar Seiten gelesen. Ich erfuhr damals, dass diese Sammlung ausgewählter Zitate aus Werken des schwindelerregend mächtigen Vorsitzenden millionenfach gedruckt und nicht etwa nur kostenlos, sondern unter Zwang im eigenen Land verbreitet wurde. Es gab jedoch auch Versuche, die Broschüre in die Außenwelt einzuschleusen. Die Kreise der Mächtigen meines Landes nannte sie die Rote Mao-Bibel und verbannten sie in die Giftschränke.
Ich fand sie damals gut lesbar, hier und da merkwürdig oder fragwürdig, einige köstliche Passagen sind mir in Erinnerung geblieben: Greift der Gegner an, ziehen wir uns zurück, und sobald er das auch tut, greifen wir ihn an. Oder: Welches Glück, arm zu sein, so hat man nichts zu verlieren. Alles in allem schien es mir mehr belustigend und unterhaltend als ernst gemeint.
Daher hätte ich damals das Büchlein, das gut in die Brusttasche eines jeden Arbeitskittels passte, gerne zu Ende gelesen. Zu meinem Bedauern durfte ich es jedoch nicht mitnehmen, denn es gehörte nun einmal zum Giftschrank einer hohen Behörde und stand unter Aufsicht noch höher gestellter Sicherheitsorgane.
Mit keiner Fussel meines Gehirnes dachte ich damals daran, dass ich eines Tages zum Zeugen von Folgen jener verwirrenden Lehre werden würde. Hier, auf Kampucheas Erde, am 26. Juni 1979, starrt mich das Leid, ausgebrochen infolge jener wahnwitzigen Lehre, aus nächster Nähe erbarmungslos an.
Mittlerweile habe ich erfahren, dass vor zehn Tagen die Nationale Front angefangen hat, unter den Umherirrenden Lebensmittel zu verteilen.
»Wisst ihr davon was?«
»Ja, wir haben zweimal etwas bekommen. Aber es ist schon längst verbraucht!«
»Unsere Genossen tun ihr Bestes. Geduldet euch bitte etwas. Spätestens morgen kommt die nächste Hilfe. Ich verspreche es euch.«
»Können wir schon in die Hauptstadt?«
»Die Zugänge sind immer noch gesperrt. Aber man arbeitet daran, die Stadt wieder bewohnbar zu machen. Vorerst werden nur Schwerkranke, medizinisches Personal und Handwerker eingelassen.«
Da sagt mir Dolmetscherin Lien, der Chef habe mich den Leuten vorgestellt und uns vorgeschlagen, miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ich stehe dem Meer von Augen gegenüber und vernehme ein leises, aber mächtig anschwellendes Gemurmel. Ich weiß, es gibt kein Zurück mehr. Der Möchtegernjünger des Rasenden Reporters Egon Erwin Kisch, der Anhänger von Ilja Ehrenburg und seiner Dauerfabrik von Kampfgeschossen gegen den Faschismus, der erklärte Schüler des Meisters in Reisebeschreibungen Lodongiin Tüdew – jetzt muss er dem Augenblick in die Iris schauen und Bericht erstatten, jede Regung in der eigenen Brust kurzhalten und jedes Schwächegefühl niederzwingen. Er muss seinem Dienstauftrag gerecht werden!
Also trete ich an den Menschen, der mir am nächsten steht, heran und spreche ihn an: »Warum und wann haben Sie sich auf den Weg gemacht? Wissen Sie, wie weit Sie noch zu gehen haben?«
Es ist eine ältere Frau, und sie fährt arg zusammen. Der Blick aus ihren tief liegenden, schwer entzündeten Augen ist zuerst scharf und stumpft dann schnell ab. Lien sagt etwas auf Vietnamesisch zu ihr, worauf die Alte hilflos den Kopf schüttelt. Der Chef, der längst dabei ist, mit anderen Menschen zu reden, unterbricht sein Gespräch und wendet sich zu uns. Der Träger von den vielen hohen Titeln muss mir auch noch als Dolmetscher meiner Dolmetscherin dienen. Es gibt keinen anderen Weg zur Verständigung.
Ich höre zu, wie meine Fragen, doppelt gebogen, endlich zu der armen Frau gelangen. Die Worte aus ihrem Mund kommen auf dem gleichen umständlichen Weg zurück:
»Früher haben wir in unserem Dorf Pen Potam am anderen Ende des Landes gelebt. Viele Tage und auch Nächte haben uns die Bewaffneten in neue Gebiete getrieben, als wären wir eine Viehherde. Nach drei Jahren, nachdem die Treiber geflüchtet waren, entschlossen wir uns, aus der Hölle dort nach eigenem Zuhause, in unser Paradies, zurückzukehren. Heute sind wir den dreiundfünfzigsten Tag unterwegs. Wie lange es noch andauern wird, bis wir zu Hause ankommen, wissen wir nicht. Aber wir werden es irgendwie schaffen, wir müssen. Andernfalls hätte es ja keinen Sinn gehabt, dass wir die Hölle überlebt haben!«
Hang But heißt die Frau. Ich stelle ihr keine weiteren Fragen, frage auch nicht nach ihrem Alter. Ihr Gesicht sieht uralt aus, obwohl ihre Stimme jung klingt. Alle hier wirken ausgemergelt und uralt. Selbst die Kinder sind ausgezehrte Gestalten mit abgehärmten Mienen und klagenden Blicken.
Ich wende mich an eines von ihnen. Das Mädchen heißt Mi Ma, stammt aus einem Dorf namens Pas Sat und ist dreizehn Jahre alt. Doch nichts ist kindlich an ihr, den Worten aus ihrer altersrau klingenden Kehle fehlt jegliche Gemütsregung. Als zusätzliche Absonderlichkeit bleiben ihre tieftraurigen Augen trocken, während nicht nur wir, die soeben Dazugekommenen, sondern auch manche der abgehärteten Mitziehenden vergebens gegen die Tränen kämpfen wegen ihres Albtraums, von dem sie erzählt. Vor drei Jahren ist sie als zehnjähriges Kind vom elterlichen Hof geflüchtet, an jeder Hand eine ihrer beiden jüngeren Schwestern.
»Im Gebüsch hinter unserem Gemüsefeld haben wir Kinder gespielt. Da hörte ich von unserer Hütte her brüllende Männerstimmen. Zwei uniformierte Fremde zerrten jemanden, der sich wohl dagegen wehrte, aus der Hütte. Einige Schritte von der Hütte entfernt blieben sie stehen. Der eine mit der Pistole zerrte den Kopf des Mannes in die Höhe. Da erkannte ich unseren Vater. Und in demselben Augenblick sah ich das Messer des anderen aufblitzen und über Vaters Kehle fahren und daraufhin einen dicken, roten Strahl nach vorn schießen. Dann stürzte unsere Mutter sich mit einem Knüppel von hinten auf den mit dem Messer und versetzte ihm einen Hieb auf den Kopf, der andere richtete die Pistole auf sie. Ein Schuss krachte. Mutter stockte, krümmte sich, richtete sich kurz auf, sah mich. Ich hörte zum letzten Mal ihre Stimme: ›Mi Ma! Nimm die anderen beiden mit, geht weg!‹«
Mi Ma und ihre Schwestern gerieten in die Menschenmenge, die nun von Bewaffneten unter Schüssen und Schlägen weggetrieben wurde. Es grenzte an ein Wunder, dass die drei Kinder die Vertreibung, den Marsch und dann die rund tausend Tage und Nächte in der Hölle überstanden, ohne zu verhungern und ohne einander zu verlieren. Und nun sogar wieder auf dem Heimweg sind, voller Hoffnung, den Flecken Erde wieder zu betreten, dessen Gestalt, Farbe und Geruch all die tausend Tage und Nächte lang nicht von ihnen gewichen war. Um dort ihr grausam unterbrochenes Leben, wie auch immer es ihnen möglich sein würde, fortzusetzen.
Ich habe nicht die Kraft, die Interviews mit diesen Menschen, die die Hölle überlebt haben, weiterzuführen und noch mehr Grausamkeiten zu hören. Wozu noch in ihren ohnehin blutenden, wohl nie wieder heilbaren Wunden herumstochern?
Der Mekong mit seinem undurchsichtig grünen Wasser, seiner weit ausholenden Breite und seinen sich wälzenden Springfluten, da hell und dunkel, hier hoch und tief, liegt vor uns, ein gewaltiger Strom. Unsere Uferseite ist ameisenschwarz mit Menschen besät, während das gegenüberliegende Ufer noch leer, wie wartend und sinnend daliegt. Die Brücke zur Hauptstadt ist für die Flüchtlingszüge noch gesperrt. Unsere Gruppe wird als einzige durchgelassen. Der Fahrer hat auf meine Bitte hin in der Brückenmitte gehalten, wir sind ausgestiegen. Von der Brücke aus können wir das Leben und Treiben am Ufer beobachten: Die Neuankömmlinge befreien sich zuerst von ihrem Gepäck, treten daraufhin mit vorsichtigen, kleinen Schrittchen an den Fluss heran, sinken in die Knie und verneigen sich vor dem Fluss. Strecken sich dann nach vorne und schöpfen mit der hohlen rechten Hand Wasser und tröpfeln es sich auf den Scheitel.
Wie bei uns.
Dann stehen sie auf, treten ins Wasser, tauchen die Hand hinein, ziehen sie zurück und führen sie zum Mund. Nun schaufeln sie sich winzige Wassermengen beidhändig gegen das Gesicht und fahren mit den nassen Händen um die Halsgegend.
Auch wie bei uns.
Schließlich entledigen sie sich des oberen Kleidungsstücks, mehr ein Umhang als ein Hemd, legen es auf die Fluten, drücken es hinein und warten eine kleine Weile. Zurück am Ufer, schütteln sie das nasse Stück Stoff ein paarmal recht sanft und breiten es auf dem Kiesboden aus, um es, sobald es nicht mehr triefnass ist, wieder um den Körper zu legen.
Das ist anders als bei uns.
Viele sitzen, die Füße im Wasser, regungslos die Zeit vorüberziehen lassend und wohl auch kräftesammelnd und sinnend. Weiter hinten, in gehörigem Abstand zum Fluss, sind mehrere kleine Rauchsäulen zu erkennen. Um jede solcher Stellen herum hocken Gruppen von Menschen.
Anderntags, an einem anderen Ort, werde ich auf eine Menschengruppe stoßen, die um ein solches Notfeldküchenfeuer herum versammelt ist. In einem außen wie innen gleichermaßen verrußten und dazu auch noch sehr verbeulten Kessel köchelt eine dünne Reissuppe mit ein paar Scheiben Gemüse. Das gute Dutzend Menschen wartet mucksmäuschenstill und bewundernswert geduldig, ein jeder seine Essschale in der Hand und alle ihren Blick auf den Dampf aus dem Kessel gerichtet.
Auf der Weiterfahrt erfahren wir vom Chef einige Eckdaten: Von der Sieben-Millionen-Bevölkerung des Landes habe das Pol-Pot-Regime während seiner dreijährigen Herrschaft an die drei Millionen vernichtet. Gleich nach der Befreiung durch die Widerstandsbewegung mithilfe der vietnamesischen Armee hätten sich groben Schätzungen nach zwei Millionen der Überlebenden auf den Weg nach ihren früheren Wohnorten begeben. Etwa die Hälfte sei immer noch unterwegs. Sie zu versorgen, sie vor dem Hungertod zu bewahren, unabhängig davon, wo sie sich befinden, sei im Augenblick eine der wichtigsten Aufgaben der Nationalen Front.
Früher habe Phnom Penh über zwei Millionen Seelen beherbergt. Am Abend des ersten Tages der Verwüstung durch die Schergen seien davon nur an die vierzigtausend Menschen zurückgeblieben. Alle anderen hatten die Roten Khmer aus der Stadt geprügelt. Mit denen, die zögerten, dem Befehl zu folgen, hätten sie kurzen Prozess gemacht – erschossen, erstochen, erschlagen, erdrosselt.
Eine knapp viertausendköpfige Mannschaft bemühe sich jetzt rund um die Uhr, der Stadt wieder Leben einzuhauchen und das Allernötigste einzurichten: Strom, Wasser, Reis, Medikamente, ärztliche Versorgung. Denn die Mehrheit der Überlebenden sei durch die gezielten Grausamkeiten und die Unterernährung ausgelaugt und am Ende ihrer Kräfte. Viele würden während der langen Fußmärsche von ihren Nächsten mitgeschleppt oder sogar getragen. Mindestens zweihunderttausend Menschen würden hinter den Absperrungen um die Stadt herum warten. Man könne sie beim besten Willen nicht sofort hereinlassen. Bevor die Wasserversorgung und Kanalisation wieder in Gang gebracht sei, befürchte man den Ausbruch einer Epidemie.
Die ersten Häuser tauchen auf. Sie schimmern als blinde Flecken durch die bedrohlich ausgewucherten Pflanzen, niedrige, meistens zwei- oder dreistöckige, weiß gekalkte Bauten. Das Merkwürdige ist, dass hier weder Autos fahren noch Fußgänger die Straßen kreuzen. Wir bewegen uns, wie stumm gleitend, auf leeren Straßen voran. Mir kommt eine Filmszene in den Sinn, die mir vor vielen Jahren Grusel eingejagt hat. Darin träumt einer, dass seine Stadt mit einem Mal von allen Lebewesen verlassen ist. Der Träumer irrt durch menschenleere, stumm gähnende Straßen und kommt an einem Gebäude vorbei, an dessen Wand eine große Uhr hängt. Ihr fehlen aber alle Zeiger. Dass der Film Wilde Erdbeeren geheißen hat, weiß ich noch, auch, dass es eine schwedische Produktion war. Und war der Name des Regisseurs oder Hauptdarstellers nicht irgendetwas mit »Berg«?
Mit solchen Erinnerungsfetzen im Kopf und demselben Gruselgefühl im Herzen rollen wir über die geisterhaft leeren Straßen der einstigen Millionenmetropole Phnom Penh, die noch vor gut tausend Tagen und Nächten um diese Tageszeit mächtig gelärmt und gebrodelt haben dürfte. Hatte man sie nicht sogar überschwänglich Asiens Paris genannt?
Und da heißt es: angekommen. Was für eine Überraschung – die Limousine hält auf einem tadellos glatten Asphaltbogen vor einem massiven Gebäude mit einer ganzen Reihe von Marmorsäulen. Das Royal Hotel, erklärt man mir. Hier seien die Herrscher und Vornehmen ein und aus gegangen, die höchsten Gäste aus aller Welt abgestiegen. So auch Pol Pot und seine Kumpane. Der Angriff, der sie vom Machtteppich wegfegte, musste sie arg überrascht haben, denn sonst hätten sie auch dieses Glanzstück, ohne mit den Wimpern zu zucken, in einen Trümmerhaufen verwandelt. Das Gebäude aber ist heil geblieben, darin residieren nun die neuen Machthaber der Volksrepublik Kampuchea. Und ich darf als ihr Gast hier unterkommen wie ein König. Ehrfürchtig bestaune ich das mir zugeteilte Zimmer. Alles ist sauber, edel und prächtig. Das matt glänzende Mobiliar, auch das Gestell des massiven Bettes muss aus einem ganz besonderen Holz in sorgfältiger, erfahrener Handarbeit geschnitzt worden sein. Allein die weißleinenen Bezüge der bauschigen Schlafdecke und des Kopfkissens wirken merklich ermattet und schmälern die Erhabenheit des Raumes ein wenig.
Als ich das Bad betrete, verschlägt es mir fast den Atem. Ein solch vornehmes Gelass mit wohlgemaserten Marmorwänden und steinern ernstem Fußboden in traummattem Glanz habe ich in der Hotellandschaft Eurasiens noch nie betreten dürfen. Geschweige denn, um dort meinen verborgenen menschlichen Bedürfnissen nachzukommen. Da trifft mein forschender Blick auf ein deckelloses, ovales Becken mit einem schmalen Röhrchen und zwei kleinen Drehrädchen hinten, direkt neben dem zwar kühle Vornehmheit ausstrahlenden, aber in diesem gehobenen Zimmer vertrauten Klo unter zugeklapptem Deckel. Bis ich begreife, wozu es gut sein soll, vergeht eine volle Minute. Und dieser Zeitbruchteil reicht aus, um in mir das alte, verfluchte, nomadische Minderwertigkeitsgefühl wieder zu erwecken.
Ach, denke ich verunsichert, ich bin noch immer jener blinde Welpe angesichts der großen kultivierten und zivilisierten Welt geblieben! Ich muss mir ein unliebsames, ja vernichtendes Eingeständnis machen: Alle diese Annehmlichkeiten der großen Welt, an denen ich mich als Mitnutznießer so gern beteilige – sie machen mir ein schlechtes Gewissen gegenüber dem eigenen weltunerfahrenen Volk. Ist mein Stolz darauf nicht bloß Selbstbetrug und Eitelkeit?
Von diesem quälenden und erniedrigenden Zweifel lenkt mich ein Geräusch an der Tür ab. Eine junge Frau. Sie hat nicht geklopft, wie anderswo in der Hotellandschaft dieser Welt üblich, verbeugt sich aber, die Hände vor der Brust zusammengelegt, und sagt etwas, dem Klang nach vielleicht auf Vietnamesisch. Mit der Rechten deutet sie auf die Badewanne hin. Da erst sehe ich das trübgrünliche Wasser, nicht viel mehr als eine Handspanne über dem Boden der tiefen Wanne. Jetzt spreizt sie die fünf Finger ihrer einen Hand, zeigt anschließend auf ihre Armbanduhr und sagt noch etwas. Ich glaube, so viel mitbekommen zu haben: Mit dieser Wassermenge musst du bis fünf Uhr zurechtkommen, dann wird nachgefüllt!
Da spüre ich in mir die vorherige Begeisterung erlöschen. Der Glücksaufschwung in meinen Adern ist geplatzt wie eine Seifenblase. Prompt erwacht in mir jenes Gegenmittel zur Unterwürfigkeit, mein Trotz. Mich durchzuckt der Gedanke: Wie lächerlich, umringt von all dem nichtigen, überflüssigen Zeug, Lockmittel des Luxus nur, mit entblößtem Arsch in hauchdünner Nachbarschaft zu dem Elend zu sitzen und deine so arg befristete, so wertvolle Lebenszeit zu vergeuden, o Mann! Schau, dass du schleunigst aus dieser Hölle wegkommst! Was hast du hier verloren, in dieser feuchtheißen Weltecke, wo auf der einen Seite Genuss, Rausch und Wollust aus allen Winkeln schreit, auf der anderen Seite die Tollwütigen Mord und Zerstörung predigen – und dazwischen schweigt eine hilflose, schafdumme, eselsgehorsame Menschenherde!
Wobei ich zugeben muss: Mein kaum verhüllter Nomadenstolz, aus dem Überlebenswillen geboren, ist ein recht schlüpfriger Boden. Denn der Nomade ist keineswegs nur mit diesen und anderen edlen Wesenszügen, sondern auch behaftet mit jenen und anderen fragwürdigen, die uns zu dem machen, was wir alle einmal sind: ein Mensch. So kann ich, als Steppennomade, schnell den Boden unter den Füßen verlieren und über jede Grenze hinausschießen. Ganz wie jeder andere seiner Art auch, in den unzähligen Schubladen des Riesenkastens Leben. Jenes harte Urteil, soeben meiner Hirnrinde entwichen angesichts des für mich bisher rätselhaften Afterbeckens und der Badewanne mit der trübgrünen Lache, scheint mir nachträglich wieder einmal unüberlegt, gemein und undankbar gegenüber dem Land und seinem Volk, über das eine unvorstellbare Not hereingebrochen ist. Nun möchte ich nachträglich doch hoffen, dass mit diesem Ausbruch ein Stein zertrümmert wurde, der viele tausend Tage und Nächte lang in bedrohlicher Nähe meines Herzens hing und es bedrückt hat.
Der Speiseraum ist klein und wirkt darum gemütlich. Nur das Servieren der Gerichte an die Gäste geschieht auffällig ungeschickt. Der Chef, der jede Bewegung der weiß beschürzten, nicht sehr jungen Kellnerin mit sichtbarer Sorge verfolgt, entschuldigt sich dafür schon zum Anfang: Alle hier, wie überall in den staatlichen Einrichtungen, seien Neulinge und ohne Erfahrung bei ihrer Tätigkeit. Die Gerichte aber schmecken ausgezeichnet. Zumindest hat der Koch große Erfahrung. Da fällt mir der rege Betrieb in der gemeinsamen Küche des Studentenwohnheims ein – dort pflegten besonders die Ostasiaten unermüdlich lange zu kochen und wurden deswegen auch von den europäischen Mitbewohnern regelrecht bewundert.
Meiner Gewohnheit, vor und nach jeder Mahlzeit mir Hände und Mundraum mit Feuerwasser zu reinigen, komme ich in dieser heimgesuchten Weltecke erst recht nach. Der Chef nickt verständnisvoll: Ja, auf Menschen aus kühlen nördlichen Breiten müssten die Tropen mit ihren vielen Mikroorganismen natürlich sehr belastend wirken. Was kann da schneller und gründlicher helfen als das spülende und brennende Feuerwasser!
Dies erlaubt mir, ihn zu fragen, ob ich ihm ein Glas anbieten dürfe.
Sogleich blüht ein sanftes Lächeln auf dem sehnig hageren Gesicht auf. Ich möchte aber nicht, dass der hohe Vertreter eines uns verbündeten Staates die Gabe des mongolischen Steppenbodens aus einem Billigbehältnis wie meiner Flasche kostet. Der Gläserschrank an der Wand glänzt gar verführerisch. Also stehe ich auf, trete an den Schrank heran und suche mir einen langstieligen Kelch aus dem Arsenal. Er ist aus klarem Bergkristall, schnittig geschliffen mit messerscharfen Kanten und am Rand erst noch goldgelb besprüht.
Ich fülle das Glas bis zum goldgelben Strich und bringe es meinem Gegenüber, streng nach der Regel des nomadischen Knigge: es beidhändig umfassend, mit feierlich-stiller Miene und leicht gesenktem Blick. Mein Gegenüber schafft die gleiche Haltung beinah auf Anhieb. Weswegen ich denke, dass er vielleicht schon diplomatisch tätig gewesen ist.
Monate später werde ich in der sowjetischen Prawda tatsächlich seinen Namen als Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter der Volksrepublik Kampuchea wiederfinden. Da werde ich mich freudig-verlegen an jenen Augenblick meiner Nebenrolle als kleiner politischer Clown erinnern.
Der Chef, An Nang, führt das Glas langsam zum Mund, setzt es bedächtig an die Lippen und trinkt den Inhalt wie tröpfchenweise und macht dann erst mal halt. Er scheint das Eingenommene zu begutachten, mit geschlossenen Lippen und eingekehrtem Blick. Schließlich spricht er sein Urteil aus: »Oh, der ist sehr gut. Ermuntert, brennt aber nicht. Und gleitet von selbst ölig sanft hinein!« Lächelnd leert er das Glas. Aber nicht wie unsereins, die wir in solchen Fällen die ganze Menge mit einem Ruck hinunterkippen und die Unsitte dann auch noch als partisanenhaft ausgeben, also ins Heldenhafte rücken. Mit geschlossenen Augen lässt er das Feuerwasser genießerisch still in sich hineinrinnen, sodass ich tatsächlich an Öl denken muss, das wie von selbst hineingleitet.
Nach diesem gekonnt ausgeführten, feierlich anmutenden Akt gehen seine schönen und ausdrucksstarken Augen wieder auf. Nur, da wirken sie durch die glitzernden Ringe ringsum irgendwie erschütternd. Die bläulich geränderten Ringe um die mächtigen Augen sind mir schon im ersten Augenblick unserer Begegnung aufgefallen, ich habe gedacht: Auch dieser Mensch hat zu wenig geschlafen! Dann muss ich mich wohl daran gewöhnt und nicht mehr darauf geachtet haben. Nun aber bin ich abermals darauf gestoßen und frage mich, wovon und warum die Haut dort dauernd glitzert. Und diesmal fällt es mir ein: Tränen. Tränen, entweder ein Rest vom letzten Ausbruch oder einen nächsten ankündend. Oder beides.
Jedenfalls rückt mir der Gedankenblitz diesen Menschen, von dem ich bis vor wenigen Stunden noch nichts wusste, ganz nahe und brüderlich ans Herz. Prompt stehe ich auf, hole aus dem Schrank ein gleiches Glas, schenke in beide ein, strecke meines mit der Rechten meinem Gegenüber hin. Ohne eine Silbe schauen wir uns an. Lassen unsere Blicke reden. Stoßen dann mit einem klangvollen Klirren an. Mit einem Ruck kippe ich den ganzen Glasinhalt in mich hinein. Mit einer Verzögerung von wenigen Sekunden folgt er meinem Beispiel. Worauf wir uns für eine, zwei, drei Sekunden erneut anschauen. Unsere Blicke reden miteinander. Und sie sind imstande, das Wesentliche auszusprechen und die kürzeste und passendste Formulierung zu treffen!
Hunderte, vielleicht Tausende im Grunde nichtssagende Ansprachen habe ich dolmetschen müssen, in Festsälen und Konferenzzimmern, in Empfangssälen und Verhandlungsräumen. Daher wohl graust es mir, wenn ich hin und wieder selbst darum gebeten werde, ein Schnapsglas zu heben und einen Trinkspruch anzubringen. Ja, es graust mir jedes Mal, wenn ich den tausendmal angeknabberten, zum Brei zerkauten Spruch der Funktionäre Eurasiens von der ewigen, unverbrüchlichen Freundschaft abermals anhören, geschweige denn dolmetschen muss. Wie zeitsparend, schmerzarm und sinnvoll ist es da, die Blicke reden zu lassen, die direkt vom Seelenspiegel her strahlen!
Ich bitte An Nang, etwas von seinem Privatleben zu erzählen. Sehr merkwürdig, dass er da zögert und dann bedauerlich knapp bleibt.
Sein Geburtsdorf liege etwa hundert Kilometer entfernt von Phnom Penh. Er habe es 1947 verlassen und sei nie wieder dort gewesen. Als Grund dafür nennt er sein unstetiges Leben, ständig unter Gefahr und im Dienstzwang zu kämpfen, rund um die Uhr beladen mit Eilaufträgen. Zuerst gegen die Franzosen, dann gegen die Amerikaner, daraufhin gegen die Lon Nols und schließlich gegen die Pol Pots.
Dennoch kann ich nicht glauben, dass er in zweiunddreißig Jahren seine Heimatecke, seine eigenen Eltern kein einziges Mal hat wiedersehen können. Vielleicht wollte er nicht? Mein eigener bergsteppen-nomadischer, durch die Jahre der Trennung hervorgebrachter Hang zu meinen Eltern und meiner Heimatecke hat mich gewiss zu diesen Gedanken geführt, dessen unsichtbare Spitze sich gegen den heldenhaften Patrioten und unermüdlichen Kämpfer richtet. Ich frage, ob er denn in all den Jahren mit ihnen wenigstens briefliche Verbindung gehabt hätte?
Seine Antwort fällt kränkend kurz und kühl aus: Nein, seine Eltern seien Analphabeten.
Was mich wurmt und weiterbohren lässt: Ob er denn wisse, was aus seinen Eltern geworden sei. Die Antwort darauf ist nicht nur ebenso kurz, sondern sogar vernichtend abschlägig: Sie seien sicherlich längst gestorben. Ich schließe: Wir stammen tatsächlich aus zwei äußerst unterschiedlichen Menschenschlägen!
Als wenn der gute Mann meine Gedanken erraten hätte, spricht er einen Kanonensatz aus, der mich aufhorchen lässt: Seit er seinen Bauernspaten gegen ein Soldatengewehr tauschte, hätten so viele atemberaubende Ereignisse Kambodscha erschüttert, dass ihm, ohne je selbst darüber nachzudenken, jeder Gedanke an das Heimatdorf und die Eltern verschwunden sei. Mit der Bändigung solcher persönlichen Gefühle habe er tagein, tagaus gekämpft, und darüber waren die Jahre, ja, das halbe Leben verflossen. Was jammertraurig sei. Der einzige Trost wäre, wenn der lang ersehnte Sieg über die ärgste Knechtschaft endlich errungen sei. Und dennoch plage ihn das eigene schlechte Gewissen. Das müsse er gestehen. Da versuche man, sich mit einer blank geputzten Ausflucht darüber hinwegzutrösten, dass man sein klitzekleines Dörfchen Kong Pungin zurückgestellt, es nun aber samt Tausenden anderen Dörfern in sich einschließe und anstatt zu den Eltern zu einer riesigen Volksfamilie gehöre. Ja, der immer noch Millionen zählende Volkskörper, der die blutigen Gemetzel überlebt habe, ersetze einem all die lieben Wesen, denen man Dank schulde, erfülle einen mit Kraft, erhelle einem den Geist und erwärme auch die Seele.
Nach diesem kraftvollen Geständnis wirkt das tief dunkelbraune Gesicht des Mannes noch entschlossener. Und da erst werde ich auf einen rötlich glänzenden, fast handbreitenlangen Narbenstrich aufmerksam, der sich von seiner rechten Stirn rechts oben bis an die linke Augenbraue zieht. Unter heftigem Herzklopfen frage ich mich, wie oft er wohl am Tod vorbeigeschlittert war.
Ich halte mich bewusst zurück mit weiteren Fragen. Möchte dem guten Mann wenigstens eine kleine Rast und Atempause gönnen. Da reicht er mir eine etwas zerknitterte, aber nicht wirklich alte Fotografie herüber. Ein Dutzend Männer sind darauf zu sehen, in zwei Reihen, die vorderen sitzend und die hinteren stehend. Ihn erkenne ich in der Mitte der Sitzenden. Die Männer scheinen alles Leute aus der Oberetage der Gesellschaft und alle in bester Stimmung zu sein. Und auch er sieht wesentlich jünger und stattlicher aus.
»Das war vor sechs Jahren«, sagt er leise und traurig. »Rechts von mir ist Ieng Sari und neben ihm Pol Pot.«
Die Aussage trifft mich wie ein Schlag. Doch der Berichterstatter in mir meldet sich, wartet hellwach darauf, was als Nächstes kommt.
»Damals waren wir alle im Parteivorstand und noch guter Dinge, denn keiner ahnte, was demnächst in unseren Reihen über das Land hereinbrechen würde. Mit Ieng Sari war ich besonders verbunden, denn wir wohnten beide drei Jahre lang in einem engen Zimmer zusammen und teilten alles miteinander. Später, als unser Sieg über das Lon-Nol-Regime schon in Aussicht stand, versprach er mir das Amt des Generalbürgermeisters von Phnom Penh. Es hätte auch so geschehen können, denn er stand auf der Leiter der Macht eine Stufe höher als ich. Und über ihm, ebenso eine Stufe höher, nur Pol Pot.«
An Nang zögert. Ein müdes Lächeln erscheint in seinen Mundwinkeln und verschwindet sogleich wieder. »Dann geschah, woran keiner gedacht, aber seit Monaten so mancher gewartet hatte, mit einer solchen Wucht, die keiner für möglich gehalten hätte. Ich ging mit meinen Gleichgesinnten in den Dschungel. Von Neuem begann das Partisanenleben, und diesmal richtete sich meine Waffe gegen die vormaligen Genossen. Ich hätte wirklich ein schlechtes Gewissen bekommen können, wenn jene nicht so sehr abgekommen wären von ihrem anfänglichen Ziel und keinen Vernichtungskrieg gegen das eigene Volk angefangen hätten. Wären uns die vietnamesischen Genossen nicht zu Hilfe gekommen, wir allein hätten es nicht geschafft, die Peiniger des eigenen Volkes von ihrem blutrünstigen Höllenspiel abzubringen.« Er verstummt, hat sich fürs Erste ausgesprochen.
Wir gehen nach draußen, tauchen wieder in das schwüle, tropische Dämmerlicht ein und setzen unsere Fahrt fort. Sie führt durch geisterhaft leere Straßen, vorbei an etlichen Ruinen. Von einem mächtigen Gebäude, welchem das Dach samt einem Stück der Wände weggesprengt worden ist, heißt es, das sei einmal die Staatsbank gewesen. Ich bitte zu halten, um von diesem markanten Beweis der dumm-brutalen Gewalt ein Foto zu schießen. Als ich aussteige, sehe und fühle ich unter den Sohlen eine weiche, raschelnde Schicht, als stünde ich auf einem von Blättern bedeckten Waldboden. Um mich herum sehe ich lauter gleichmäßig geschnittene, bläulich bemusterte Papierfetzen, die ich schließlich als Geldscheine erkenne. Sie starren vor Dreck und sind so stark verwittert, dass auf der Oberseite das Bedruckte nur schemenhaft zu erkennen ist. Getrieben von journalistischer Pflicht, nehme ich vorsichtig ein paar Exemplare. Die Scheine müssen in unversehrtem Zustand recht schön gewesen sein, die Schrift mit ihren runden Schnörkeln wirkt ornamenthaft und freundlich fürs Auge.
Wir fahren durch einen verwüsteten Stadtteil und halten vor dem prächtigen Tor einer auffällig fest gemauerten Umzäunung, die ein verblüffend schmuckes, geheimnisvoll anmutendes Haus umschließt. Inmitten dieser Zerstörung sticht es wie eine Märcheninsel heraus.
»Was ist denn das?«, frage ich und höre vom Chef vorerst nur die knappe Antwort: »Ein Wohnhaus.«
Dann schlägt er mit geballter Faust gegen das Tor aus gediegenem Metall, so kräftig, dass ein dumpfer Knall durch die Gegend hallt. Seitlich an einer unvermuteten Stelle geht eine schmale Tür auf, und sichtbar wird ein Uniformierter, sehr jung und forsch, wie erwartet mit einer Pistole am Gürtel. Der Chef zeigt jenes Papier, das uns Stunden zuvor schon an der Brücke Durchlass gewährt hat, und wir werden hereingelassen. Wie friedlich es da drinnen aussieht! Die Anlage erinnert an einen der Höfe Europas. Selbst die Schatten spendende, bei Regen vor Nässe schützende Gartenlaube und die Sitzbänke fehlen nicht. Rasen und Beete allerdings sind verwildert von mächtig wuchernden Kräutern, Gräsern und Blumen. Der Pflanzenschmuck wird schnell zur Plage in dieser tropischen Welt.
Der Wächter eilt uns voran zur Tür des Hauses. Da geht sie mit einem Mal auf, und es erscheint ein weiterer Uniformierter, nun aber mit einem Maschinengewehr vor der Brust. Diesmal ein deutlich älterer Mann, der sogleich schwungvoll Haltung annimmt, aber etwas tapsig salutiert. Offensichtlich hat er den Besucher erkannt.
Dann betreten wir das Haus. Obwohl es von außen nicht ganz so mächtig ausgesehen hat, ist der Raum, der sich nun vor uns auftut, riesig, wie ein Saal für öffentliche Zwecke. Ich staune, wer hat denn in diesem Land so machtprotzend und verschwenderisch gewohnt? Da kommt vom Chef schon die Auskunft: Ieng Sari und seiner Familie soll es gehört haben. Unglaublich! In diesem Schloss soll der Mann gewohnt haben, der immer noch die blutige rechte Hand des Oberzerstörers und -mörders Pol Pot ist? Worauf aus mir die verblüffte Frage herausgeschossen kommt: »Derselbe, mit welchem Ihr drei Jahre lang in einem Zimmer gewohnt habt?«
Er nickt nur, eher traurig und sanft, aber auch wie jede weitere Frage von vornherein abweisend.
Die zahlreichen Räume des zweistöckigen Hauses stehen gähnend leer, als habe die Familie all ihre Habseligkeiten rechtzeitig weggebracht oder andere hätten sie ausgeräumt. Daher wage ich nicht, über den Geschmack des berühmt-berüchtigten Mörders zu mutmaßen. Doch eines steht fest: Die ganze Einrichtung des Hauses ist überaus modern und westlich. Der laut verkündete Hass auf alles Städtische und Westliche galt nicht, sobald es um den eigenen Luxus ging. Dieser schreiende Widerspruch bei vielen selbst ernannten Weltverbesserern war mir längst wohlbekannt. Es fing an bei den Mitarbeitern unserer Botschaft in Germanien. Sie warnten uns Studenten davor, unser knappes Stipendiengeld für westliche Sachen auszugeben, während sie selbst und ihre Familien fast ausschließlich in Westklamotten umherstolzierten, West-Filterzigaretten rauchten und Westbier aus der Dose tranken. Und der Obergenosse, der Herr Botschafter, wurde in einer schwarz glänzenden Mercedes-Limousine von Empfang zu Empfang kutschierte.
Beim Wandern durch die so luxuriös angelegten Räume der schmucken Villa glaube ich, auf die Antwort zu kommen, weshalb der Spitzenzerstörer nicht seiner eigenen und zum allgemeinen Kriegsbrauch gewordenen Gewohnheit folgte und seine Wohnstätte zerstörte, sondern sie in heilem Zustand den Heranstürmenden überlassen hat. Im Augenblick der Flucht musste er davon überzeugt gewesen sein, wieder zurückzukehren! Und die starke Bewachung des leeren Hauses ist wohl Beweis genug für die Realität der neuen Führer und ihre vernünftige Haltung. Hat mein Land nicht die traurige Erfahrung gemacht, dass nach der Volksrevolution 1921, die den Besitzlosen die Staatsmacht zur Hand gab, so vieles sinnlos vernichtet wurde? Die sieben-, achthundert buddhistischen Klöster, die ausgeplündert, oft noch zerstört und angezündet wurden, sind nur ein Bruchteil der Schäden, die im Anschluss die erschöpfte Staatskasse zusätzlich belasteten. Geschehenes kann man nicht rückgängig machen. Damit pflegen wir uns zu trösten, dass jener Wandel uns jedenfalls mehr gegeben habe als genommen. Ich greife nach dem oft gehörten, milden Urteil über jene Ereignisse, die nun weit hinter uns liegen: Wer solches anrichtete, war bar jeglicher Bildung und Aufklärung, aber erfüllt von angestautem Hass ganzer Generationen auf die Ausbeuter. Und nun erwacht und entfesselt von den Fanfaren der Revolution. So versuche ich, Verständnis für die Irrnisse und Wirrnisse jener Zeiten aufzubringen.
Und umso bewundernswerter finde ich nun die Tatsache, dass die Wohnstätte eines Massenmörders, dessen Lebensweise für Millionen dem reinsten Hohn gleichkommt, in heilem Zustand erhalten geblieben und sogar unter staatliche Bewachung gestellt ist.
Wir fahren weiter zu einem echten Schloss – zum Schloss des Prinzen Norodom Sihanouk. Das sieht viel schlimmer aus: teils zerstört, überall die klaffenden Wunden der Gebäude vom Ansturm der Roten Khmer. Teils gänzlich versunken in wildwuchernden Stauden. Ein grünes Ungeheuer, das mich mit lähmendem Gruselgefühl erfüllt.
Doch dann glaube ich, wie aus Trotz und zum Trost, helle Lichtstrahlen und kühle Lufthauche in mir zu spüren. Ach, ich kenne das. Da ich mich von der Schwüle und Zerstörung ringsum eingeschlossen gefühlt habe, ist mir meine Bergsteppenheimat zur Hilfe herbeigeeilt. Ja, jedes Mal, wenn ich weit draußen, auf fremden Gründen, unter fremden Himmeln in Bedrängnis komme, richte ich meine Gedanken, gleich den Zügeln meines Pferdes und dem Lenkrad meines Fahrzeugs, auf die Heimat, und kurz darauf kommt mir eine rettende Eingebung. So gesehen, sind der Altai und die Mongolei und deren einzigartige Natur mit dem ebenso einzigartigen Himmel darüber das Mantra aus Bild und Klang, an welchem sich mein Wesen putzt, wetzt und läutert. Möge es mir mein Heimatland bitte, bitte verzeihen, sollte ich mich dann und wann über dessen kahle, karge Erde und den kalten, herben Himmel zu undankbaren Gedanken oder Worten hinreißen lassen! Die süßen wie herben Erfahrungen in der Fremde zeigen einem jeden Menschenkind den Wert seiner Heimat. Angesichts dieser aus sich heraus explodierenden, alles um sich herum betäubenden und verschlingenden tropfgrünen Tropennatur will mir die ungestörte Weite und Leere unserer Höhensteppe nicht nur schön vorkommen, sondern auch gleichbedeutend mit wahrem Reichtum, imstande, tiefsten Seelenfrieden zu erschaffen.
Dieser Gedanke, den ich Tage später, wieder zu Hause, recht unsinnig finde und wieder verwerfe, wird jedoch Jahrzehnte später in meinem Schädel merkwürdigerweise doch wieder und wieder aufblitzen. Er erinnert mich jedes Mal an diesen, mittlerweile weit zurückliegenden Spätnachmittag des 26. Juni 1979 im gruselig verwilderten Schlosshof von Phnom Penh. Und dabei werde ich mich an ganz anderen Orten der Erdkugel befinden, Tausende von Kilometern entfernt, mich aber wieder von Übermenge bedrängt fühlen, ganz gleich, ob es sich um Pflanzen, Gewässer, Städte, Technik oder Menschen handelt. Oder Obdach, Klamotten, Futter, Habseligkeiten. Oder auch die Hilfsmittel, die sie sich zur Gestaltung ihrer irdischen Frist zugelegt haben, wie Bücher, Spiele und sonstiger Zeitvertreib. Sobald solche Dinge, die auch mir als gut und hilfreich einleuchten, zu Übermengen ausufern, beginnen sie mich zu quälen, werden zu Ballast, der mein Leben sinnlos beschwert.
Doch wieder zurück in den schaurig zerfallenen Thronsaal des Königs. Der Thron steht in einer Höhe von vielleicht anderthalb Metern, zu erreichen auf einer geraden, langen Treppe mit zahlreichen Stufen. Thron wie auch Treppe – alles scheint aus Holz zu sein. In der Ecke gegenüber türmt sich eine etwa kniehohe Schutthalde. Sie erinnert mich an eine aufgebrochene Beule aus Stein und Schlamm vom Dauerfrostboden des Altai. Hier aber scheint der ganze Schamott aus lauter Kistchen und Kästchen, Schatullen, Bändern, Orden, Medaillen und Ähnlichem zu bestehen. Für uns Menschen gewiss von hohem Wert, für die Natur jedoch nichts als Müll, und zwar ein wirklich sehr schwer vergänglicher. Wurde hier vielleicht eine königliche Schatzkiste aufgesprengt? Dass dabei der Thron heil geblieben und das feierlich geräumige Gemach nicht noch schlimmer verunstaltet worden ist, will wohl nach dem, was ich bisher gesehen und gehört, einem kleinen Wunder gleichen.
Da durchzuckt mich der Gedanke, mich einmal auf den königlichen Thron zu setzen. Erschrocken blicke ich unwillkürlich zu An Nang, dem Hausherrn. Und entdecke auf dessen sonst eher kämpferisch ernstem als verspielt heiterem Gesicht nun ein unverkennbar ermunterndes Lächeln und sogar Schalk im Blick.
Mein eigenes ziemlich unberechenbares Wesen ist mir bis zum Überdruss bekannt. Doch eine so abartige Idee, mich auf den Thron eines fremden Königs zu setzen, ist mir noch nie durch den Schädel geblitzt. Nun aber schwirrt es drinnen: Ja, warum auch nicht! Immerhin brachte ich es doch fertig, mich im Haus des Menschengottes und Dichterfürsten Goethe nicht nur wie einer seiner Vertrautesten lange und frei aufzuhalten, sondern mich einmal sogar auf sein Sterbebett zu legen! Mich auf den Thron eines der letzten echten Könige auf Erden zu setzen – diese Verrücktheit würde mir gewiss auf Lebenszeit in Erinnerung bleiben!
So schaue ich, wohl mit dem wild lodernden Blick eines Verrückten, auf den Hausherrn und sage kurz und gut hörbar: »Ja doch, wenn ich darf!« Der Bevollmächtigte und obendrein jetzt Gutgelaunte streckt beide Arme mit nach oben gewendeten Handflächen zu den Stufen aus und nickt mir mit einem verschwörerischen Augenzwinkern zu.
Als ich an die Treppe herantrete, spüre ich den verspielten Übermut jäh von mir abfallen. So mache ich zuerst einen kleinen Halt, besonnen und bedacht. Dann fange ich an, die sachten Stufen feierlich-gemächlich, eine nach der anderen hochzuschreiten. Mit einem Mal ersterben alle Stimmen und Geräusche im Raum, ich werde begleitet von Mucksmäuschenstille. Jetzt fallen mir die ebenso sachten Stufen an der Treppe des Hauses am Frauenplan zu Weimar ein. Mit einem Schlag begreife ich, dass deren sonderbare Beschaffenheit nicht nur mit Goethes kurzen Beinen zu tun hat, sondern vor allem auch für jeden Gast, der ins Haus kommt, wohl eine Aufforderung war, sich zu kleinen Schritten zu bändigen und seine Gedanken zu sammeln und bündeln.
Mit dieser für mich epochalen Erkenntnis komme ich am oberen Ende der Treppe an und bleibe stehen. Der Thron vor mir ist ein eher spartanisch als schwelgerisch gepolsterter Sitz mit Rücken- und Armlehne, sehr kunstvoll geschnitzt vermutlich aus den besten aller Edelhölzer. Ich setze mich dann hinein und versuche zu erspüren, wie es sich anfühlt, will meinen Blick endlich heben und merke, ich muss ihn aber eher senken. Versuche nun zu schauen, das Wie erwägend: hinaus, hinunter, herunter, herab … Ja, wie schaut der König wohl auf seine Untertanen da vorne, da unten? Während ich grübele, merke ich, dass die da unten Stehenden verstummt sind und merkwürdig klein und niedrig wirken. Und gewahre jetzt auch deren auf mich gerichtete Blicke und sogar den einen oder anderen offenen Mund. Es ist, als wenn die Untergebenen in Totenstille harrten, ganz Ohr, auf jedes Sterbenswörtchen aus dem Mund Seiner Majestät lauschten. Unter so einer Menge darf auch einer mit dabei sein, der mit aufgesperrtem Maul heraufglotzt –
O Himmel, ein Schreck reißt mich aus dem Fetzen Tagtraum heraus! Also stehe ich sogleich auf und verneige mich. Schuldbewusst? Demütig? Beschämt? Verängstigt? Keines dieser Wörter vermag auszudrücken, was ich soeben erfühlt habe.
Aber das Volk ist gütig – wie überall, anfangs zumindest. Die Leute, eine Handvoll Unbekannter, haben meine Afferei da oben nicht nur geduldet, sondern sie spenden mir sogar einen kurzen, schwachen Applaus. Ich bin gerührt von ihrer Güte. Oder haben sie bemerkt, was in mir gerade vorging?
Ich steige sehr langsam die Treppe herab. Es ist mir, als müsste ich meinen schweren Körper, der mir betäubt und fremd vorkommt, mühselig herunterschleppen. Unten angekommen, zieht es mich hinaus, ins Freie, ins Schutz bietende Gehäuse des Autos. Weg, weg, wegkommen von hier, denke ich wieder und wieder, als wäre dies ein Mantra, von dem ich eine helfende Wirkung erwarte. Doch ich muss einsehen, dass ich so schnell nicht von dem Erlebten wegkommen werde. Weshalb bin ich denn so nachdenklich geworden, als ich auf dem Thron saß? Ich nehme mich in die eigene Gewalt und begebe mich auf Suche nach der Antwort. Sie führt mich nun durch ein Gedankengestrick. Erstmalig habe ich begriffen, was für ein armes Wesen doch ein König letzten Endes ist. Besonders dann, wenn sein Reich untergeht. Nicht anders als ein Meeresschiff oder ein Hirtenhund unter der Last seiner Jahre, weil er nicht mehr imstande ist, dem Umzug zu folgen. Dann muss der König mit seinem bisschen nackten Leben davonflüchten und auf Almosen von Fremden angewiesen sein. Und seinen Thron muss er stehen lassen und weiß nicht, wer von den Strolchen dieser Welt ihn demnächst besteigen und entweihen wird.
Im Auto werde ich von An Nang gefragt, ob es mir denn auf dem Königsthron nicht gefallen hätte. Ich gebe eine ausweichende Antwort. Der wahre Kern der Sache, so scheint mir, steckt darin, dass dieser Thron nicht jedem zusteht, weil dazu nur ganz wenige geeignet sind. Und solche wie ich gehören mit Bestimmtheit nicht dazu.
Der nächste Tag ist der Besichtigung von Betrieben gewidmet, die sich darangemacht haben, die Produktion wiederaufzunehmen. Hier geht es um die schmerzhafte, schwierige Geburt der neuen Volksrepublik Kampuchea. Ich sehe den stockenden Beginn der Arbeit, tausche mit den Belegschaften, die noch Unsicherheit in ihren Gesichtern, Händen und Körpern zeigen, einige wenige Worte. Mir ist feierlich zumute, dass hier ein neuer Staat in den Windeln liegt und ich zu den Schreibern seiner Geschichte gehöre. Immer wieder höre ich diesen formelhaften Satz: Wir fangen bei null an. Die Ausgangslage sieht tatsächlich beängstigend düster aus – die Pol-Pot-Bande hat alles zerschlagen und zerstört.
Die Textilfabrik Tul Go stellt wieder grobfaserige Stoffe her, die sich ziemlich rau anfühlen, doch recht stabil im Gebrauch sein dürften. Goldgelb, hellblau und rosafarben. Pol Pot hat nur die schwarze Farbe erlaubt. Auf etliche Hunderte schätze ich die Belegschaft. Doch die wenigsten stehen an den Webmaschinen. Viele tragen Gewehre und stehen um das Gebäude auf Wache. Die Mörder und Zerstörer sollen noch aktiv sein und immer wieder auftauchen. Andere sind immer noch mit dem Aufräumen der Trümmer beschäftigt, während wieder andere kaputte Maschinenteile zusammenzuflicken versuchen. Die tägliche Produktionsmenge ist angesichts der Bedürfnisse des Landes ein Tropfen auf glühheißem Boden.
Tep Tuon, der junge Fabrikleiter, ist mit einer Pistole bewaffnet und begnadet mit einer überzeugenden Miene und Stimme. Sein Ziel: Die Produktion so zu steigern, dass jeder Bewohner des Landes im Lauf des ersten halben Jahres mit einer Hose und gegen Ende des zweiten Jahres mit den allernötigsten Kleidungsstücken versorgt sei.
Der »Ingenieur« Lou Ngi belohnt mich, im Unterschied zu vielen anderen, mit einem so festen Händedruck und einem so offenen Lächeln, dass es mir unvereinbar mit der augenblicklichen Lage in diesem Land vorkommt. Sogleich höre ich die Erklärung seiner Fröhlichkeit: Ich sei der erste ausländische Mensch, dem er in den letzten vier Jahren leibhaft habe begegnen dürfen. Wenig später erfahre ich, dass er selber vor Jahren auch einmal im Ausland gewesen sei, für ganze drei Monate in Albanien, zu Zwecken einer Lehre. Er habe nie studiert, trotzdem arbeite er nun auf dem Posten eines Ingenieurs, weil die Studierten alle umgekommen seien. Weil er früher mit Ingenieuren gearbeitet hatte, auf ihre Anweisungen hin dies und jenes habe ausführen dürfen, müsse er sich jetzt selbstständig um all die technischen Fragen kümmern. Womit über unserem Gespräch längst wieder der Ernst der Stunde schwebt. Nachdenklich und mit einer veränderten, leisen Stimme erzählt Lou Ngi: Diese Fabrik sei innerhalb von vier Jahren zweimal zerstört worden und werde nun das zweite Mal wieder zusammengeflickt. Zuerst hätten die Roten Khmer bei ihrem wilden Ansturm alles in den Fabrikhallen kaputt geschlagen und die Arbeiter brutaler als eine Viehherde davongetrieben. Wenige Tage später hätten sie die Arbeitslager nach diesen Arbeitern durchsucht und die Überlebenden zurückgetrieben und beauftragt, die kaputten Teile zusammenzuflicken und darauf das einzig erlaubte pechschwarze Tuch herzustellen. Die Arbeiter, die von da an in einem nach Geschlechtern getrennten Lager unter strenger Aufsicht steckten, mussten von der Morgendämmerung bis zum letzten Schimmer des Tageslichts arbeiten. Im vierten Jahr dann, als der Feuersturm nahte, der diesem Albtraum ein Ende bereiten sollte, hätten die Aufpasser unter Waffendrohung der Belegschaft befohlen, alles, was sie schon einmal zusammengeflickt hatten, wieder zu zerstören, damit es nicht dem Gegner in die Hände fiele. So sei man wieder dabei, alles zusammenzuflicken.
Zum Schluss sagt er: »Es ist zum Lachen, mehr aber zum Weinen, nicht wahr?« Während er diese Worte ausspricht, verzieht er sein frühzeitig gealtertes, müdes Gesicht so merkwürdig, als würde er etwas sehr Bitteres ausspucken.
Da fällt mir die beherzte Selbstbefreiung der Häftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald zum Ende des letzten großen Kriegs ein. Hätten die Entrechteten auch hier in jenem schicksalhaften Augenblick den Verstand und Mut aufgebracht, den bewaffneten, aber zahlenmäßig unterlegenen Mördern an die Gurgel zu springen, wären nicht viele Menschenleben gerettet und viele spätere Mühseligkeiten erspart worden? Könnte die Bitternis in Gesicht und Stimme des Mannes, der die Geschichte Buchenwalds kaum kennen dürfte, dennoch diese verpasste Gelegenheit gemeint haben?
Doch gut, jene düsteren Zeitabschnitte, drüben wie auch hier, liegen hoffentlich ein für alle Mal überwunden zurück. Sowohl der Fabrikleiter als auch der Ingenieur sprechen zuversichtlich von der Zukunft und umreißen die Aufgaben ihrer Belegschaft genau, daher vermute ich, sie werden es schaffen. Und so auch all die anderen Kollektive, die ich besichtigte: Kraftwerk, Wasserversorgung, Bäckerei, Autoreparaturwerkstatt und Schuhfabrik. In den allernächsten Tagen sollen auch die Fabriken zur Gummiverarbeitung, für nicht alkoholische Getränke sowie die Bierbrauerei die Produktion aufnehmen.
Zurück im Hotel, erfahre ich von einem Empfang. Was mich zuerst erschreckt und erschüttert. Sogleich schießt mir der Gedanke durch den Kopf: Bei dieser Versorgungslage einen Empfang zu organisieren – sind denn die Leute noch bei Trost?