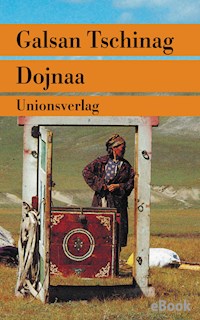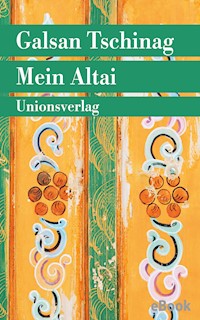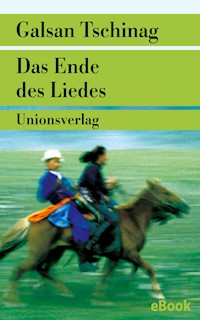10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Galsan Tschinag, deutschsprachiger Schriftsteller aus der Mongolei und preisgekrönter Bestsellerautor, erzählt in seinem neuen Roman eine Liebesgeschichte voller Leidenschaft. "Das andere Dasein" meint die Chance, auch nach einem großen Verlust noch einmal das Glück zu erleben. Moskau im Spätfrühling des Jahres 1977: Der junge Burjate Minganbajir begegnet der ungarischen Studentin Anni und verliebt sich unsterblich. Sie erleben wunderbare Tage, dann muß sie nach Budapest zurückkehren. Sein einziger Brief kommt zurück mit dem Vermerk: »Kein Empfänger. Bitte an diese Adresse nicht wieder schreiben!«. Die Zeit vergeht, Minganbajir heiratet, gründet eine Familie und verdient seinen Lebensunterhalt als Dolmetscher. Die verlorene Liebe aber bleibt immer in seinem Herzen. Jahre später lernt er erneut eine Anni kennen. Sie ist die Chefin einer ungarischen Zirkustruppe, die er als Dolmetscher in die mongolische Steppe begleitet. Er fühlt sich auf geheimnisvolle Weise zu dieser Frau hingezogen, mit ihr verbunden, obgleich sie seine Anni nicht sein kann, denn sie ist wesentlich älter. Bei einem Ausflug in die winterliche Steppe kommen sich die beiden näher. Kann es sein, daß sie die Mutter der einstigen Geliebten ist? Und kann es sein, daß die Liebe die Generationen überschreitet?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Moskau im Spätfrühling des Jahres 1977: Der junge Burjate Minganbajir begegnet der ungarischen Studentin Anni und verliebt sich unsterblich. Sie erleben wunderbare Tage, dann muß sie nach Budapest zurückkehren. Sein einziger Brief kommt zurück mit dem Vermerk: »Kein Empfänger. Bitte an diese Adresse nicht wieder schreiben!«.
Die Zeit vergeht, Minganbajir heiratet, gründet eine Familie und verdient seinen Lebensunterhalt als Dolmetscher. Die verlorene Liebe aber bleibt immer in seinem Herzen.
Jahre später lernt er erneut eine Anni kennen. Sie ist die Chefin einer ungarischen Zirkustruppe, die er als Dolmetscher in die mongolische Steppe begleitet. Er fühlt sich auf geheimnisvolle Weise zu dieser Frau hingezogen, mit ihr verbunden, obgleich sie seine Anni nicht sein kann, denn sie ist wesentlich älter. Bei einem Ausflug in die winterliche Steppe kommen sich die beiden näher. Kann es sein, daß sie die Mutter der einstigen Geliebten ist? Und kann es sein, daß die Liebe die Generationen überschreitet?
Galsan Tschinag (Irgit Schynykbai-oglu Dshurukuwaa) wurde 1943 in der Westmongolei geboren. Er ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. In den sechziger Jahren studierte er in Leipzig Germanistik; seitdem schreibt er in deutscher Sprache.
1995 führte Tschinag die Tuwa-Nomaden in einer beispiellosen Aktion über 2000 km in ihre Heimat im Altai-Gebirge zurück. Galsan Tschinag lebt als freier Schriftsteller in Ulan Bator, in Europa und mit seinem Stamm in der westmongolischen Steppe.
Galsan Tschinag
Das andere Dasein
Roman
Insel Verlag
eBook Insel Verlag Berlin 2011
© Insel Verlag Berlin 2011
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlagfotos: James Morgan / Getty Images
Umschlaggestaltung: bürosüd, München
eISBN 978-3-458-74900-4
www.insel-verlag.de
Begleitbrief an den Verleger
My dear Brother – or – mein dheurer Brodh-Herr!
In the world language English
– oder –
in der Geistersprache Deutsch?
Du hast richtig geraten – das Manuskript ist beendet. Und so bin ich endlich einmal wieder guter Laune. Auch wirst du gleich verstanden haben, hoffe ich doch, was ich mit meinem bisschen Englisch bezweckte: Ich wollte dir ein Lächeln auf die Lippen locken, meinend, du wirst, wie jeder erfolgreiche Verleger, deinen Geist weiterhin schwer anstrengen, und dies hinter einem unnahbar und undurchdringlich ernsten Gesicht, wie der Durchschnittsmensch im heutigen Westeuropa. Das Lächeln, das ich, deinen angespannten Geist mit meinem armseligen Englisch düngend, aus deinen Lippen ernten will, darf ruhig ein mitleidiges sein, denn ich weiß doch, dass ihr Mitgewinner des Kalten Krieges jenseits des Eisernen Vorhangs die Weltsprache wirklich besser beherrscht, unvergleichbar besser als wir Mitverlierer auf der anderen Seite. Warum das so sei, darüber habe ich in den letzten Jahren immer wieder nachgedacht und herausgefunden: Diese Sprache, eigentlich aus lauter Schnipseln zusammengesetzt und daher recht ungelenk, verglichen mit vielen anderen aus einer Wurzel herausgeschossenen und einer Quellader hervorgesprudelten Sprachen, habt ihr mit der Muttermilch als Vitamin, als Magomin, eingesogen, an nichts oder höchstens an den zuckersüßen, kunterbunten Inhalt der Pakete aus Amerika oder an eure von Gott gewollte Wohlstandszukunft denkend, während wir sie alle erst in längst erwachsenen bis schon alternden Jahren als bittersüße Pille zum Überleben von den Siegern oder ihren Lakaien heruntergereicht bekamen und mit Widerwillen herunterschlucken mussten, nicht sehr daran glaubend, ob sie wirklich Not abwendet.
Und was mich betrifft, habe ich mein dürftiges Schrift-Englisch mir selber beigebracht. Wie ich mir eigentlich das allerallerallermeiste von dem, was in meinem Hirn eingespeichert liegt und ich Wissen nenne, mir im Selbststudium angeeignet habe. Bin also durch und durch ein Dilettant. Übrigens, ich wollte neulich ein anderes Wort dafür haben und erfragte meinen läppischen Topdiener Laptop danach. Und was bekam ich angeboten? Von Banause über Stümper bis Dummkopf, schamlos bewertende, ausnahmslos alles abtuende, abschätzige Ausdrücke. Sosehr ich wusste, dass dahinter die selbstgefällige Fachweltzunft steckte, drohte ich, einen Groll auf die deutsche Sprache zu empfinden, die ich ja sonst abgöttisch verehre und beinah erotisch liebe.
Von solchen, die sich selber nicht nur das Wissen beibringen, sondern auch das Geschick schmieden, wird im Folgenden die Rede sein – darum die Erläuterung. Dass diese Hirtennomaden aus der unwirtlichen mongolischen Wüstensteppe, meine Helden mit ihrer wurzelhaften Ausdauer und ihrem triebhaften Selbstvertrauen, alles andere sind als träge und stumpf oder gar mongoloid, dürfte jeder unvoreingenommene Leser erkennen. Doch das nur am Rand. Mein Anliegen, weshalb ich dem Manuskript einen Begleitbrief beistecke, ist ein anderes. Es betrifft ein weites Feld, die Kunst schlechthin, in welche die Literatur voll eingeschlossen ist.
Ja, die Kunst, diese heitere Göttin, hat das Leben der Menschheit nicht nur beschönt und bereichert, verfeinert und veredelt, sondern auch, wenn wir es so wollen, ihm einen solchen Sinn und ein solches Gewicht verliehen, weswegen es uns letztendlich so heilig-wichtig erscheint. Daher auch habe ich sie schon in sehr jungen Jahren zu meiner Religion gewählt, um ihr fortan zu dienen. Und ich habe ihr gedient, diene ihr noch und werde ihr immer dienen, solange es mir vergönnt sein wird, auf dieser wunderbar lichten Welt verweilen zu dürfen.
Bei all dieser Ehrfurcht habe ich in mir irgendwann einen leisen Zweifel gespürt, der die Kunst betraf. Ist es denn überhaupt Kunst, wenn ein Schamane stirbt und irgendwer von seinen Kindern irgendeins der von jenem zurückgelassenen Utensilien aufgreift und irgendwelche Stabreime dreht, sie in irgendeine Weise kleidet und damit vor das Volk tritt? Sorgen eines Anfängers in einer Sippengesellschaft. Später hat sich jener Zweifel gewandelt: Ist es, wenn nichts darin stimmt und es so stümperhaft erschaffen ist, immer noch Kunst, weil es einem guten Zweck dienen soll? Sorgen eines Geächteten in einem totalitären Staat. Heute bin ich, dem Himmel sei Dank, ein freier Weltenkünstler. Aber es gibt immer noch Sorgen, die mich bedrücken. Der Zweifel, den ich zu Anfang meines Lebens in mir leise gespürt habe, scheint mit mir zusammen gewachsen zu sein, hat sich vergrößert und verhärtet.
Ich möchte es dem christlichen Propheten gleichtun, der verkündet hat: GOTT IST ANDERS! Möchte aufschreien: »Kunst ist doch anders!« Denn ich, den Lawinen, die uns von allen Seiten tagtäglich rund um die Uhr überfluten, mit ausgeliefert, spüre mit allen meinen Sinnen, dass die Kunst, die ich meinte, tödlich gefährdet ist. Es gibt zu viel an Leichen, Scherben, Schmutz. Das Verbrecherische daran ist, dass sich die Göttin, die unser himmlisch-irdisches Haus und unser Dasein darin einst so beschönt und bereichert, verfeinert und veredelt hat, seit geraumer Weile daran werkt und harkt, es zu beschmutzen und zu besudeln, ja, zu verseuchen und zu zerstören. Es scheint mitunter in der heutigen Zeit zur Berufung der Kunst geworden zu sein, die Wirklichkeit zu verleumden und das Leben zu entheiligen, wo und wann und wie es nur geht.
Die Göttin Kunst kann selber nichts dafür, dass sie zu einer Hexe verunstaltet worden ist, ich weiß. Die Menschen sind es gewesen, die, grob im Gewebe, verfallen dem Gelüst und schielend nach Vorteil, sie dazu verstümmelt haben. Ja, die wollüstigen, habsüchtigen und gewalttätigen Menschen haben die Kunst in eine Handelsware verwandelt und teuflische Kanäle erfunden, ihr nachzuschleichen, sie abzuklatschen und als Massenbedarfsramsch jedem vor die Füße zu schmeißen.
Glück ist zwar das sehnlichste Ziel eines jeden, ist aber so in seiner gegebenen lupenreinen Gestalt schwer zu vermarkten. So mit Güte, so mit Leben, so auch mit Frieden. Leicht vermarktbar sind dagegen immer ihre Gegenteile: Pech, Bosheit, Tod, Krieg. Hierin scheint mir der Grund zu liegen, weshalb die Künstler in der heutigen Zeit des Triumphs des vielfachen G: Geknatter und Geschnatter, Gekeife und Gejaule, Gemetzel und Gemengsel den Gierschürenden und Gewalterzeugenden den Gefallen tun, indem sie vor deren gottgleichem Geld auf die Knie fallen und daraufhin den gespenstergleichen Genüssen selber verfallen.
Falls du noch fernsiehst oder ins Kino gehst, wirst du wissen, was ich meine. Diese Medien sind längst zu Schauplätzen von Gewalt und Grausamkeit, Krieg und Katastrophe geworden, wobei die alltäglichen Familien- und Betriebskriege mit ihren Folgen, den Katastrophen auf den unsichtbaren Innenlandschaften des Menschen, mitgemeint sind. Die Zeitungen sorgen dafür, dass möglichst schon das Frühstück in jeder Familienküche mit den Horrormeldungen gewürzt ist. Und welche hässlichen Unterstellungen, Verleumdungen und Klatschgeschichten die meisten der übrigen Flächen füllen! Und die Bücher, unser Gebiet – wie grau und gruselig da das Leben dargestellt wird, wie viel Gift und Galle, Blut und Tränen, wie viel Grausamkeiten und Gemeinheiten! Hin und wieder kommt es mir so vor, als wären die Medien, die Kunst als Ganzes eingeschlossen, heutzutage die eigentlichen Lehrstoffe und Übungsfelder für künftige Gewalt und Niedrigkeit. Denn sie stecken die Sinne der Leser, Zuschauer und Zuhörer, kurz: der Verbraucher, an. Doch ist damit noch nicht alles getan. Auch die Nichtleser, Nichtzuhörer, Nichtzuschauer sind mitgefährdet, mitverseucht. Denn der ganze Raum des Universums ist mitverpestet. Es entstehen morphologische Felder, nach Rupert Sheldrake. Viele der Quantenphysiker, Genforscher und Psychologen werden mir recht geben, ganz zu schweigen von Philosophen, Pädagogen und Schamanen.
Diese neuzeitige Katastrophenkultur und -kunst und die neuzeitige katastrophale Art und Weise, das Erbe aus vergangenen Jahrhunderten und -tausenden zu interpretieren, haben einen entsprechenden Geschmack bei den Menschen erzielt und sind dabei, ihn noch zu einer regelrechten Sucht nach Gewalt, Zerstörung und Mord zu vergröbern und zu verschlimmern.
Kein Wunder, dass Happyend längst zu einem abschätzigen Begriff beim Beurteilen eines Kunstwerks geworden ist. Aber, Himmel, unser Planet Erde ist trotz der Salzmeere und Sandwüsten, der Hitze und Kälte doch ein ganz wohnliches Zuhause und wir ertragen unser Leben darauf trotz aller Fährnisse und Kümmernisse doch ganz gut. Die Welt ist trotz der vielmaligen Voraussagen der Schwarzseher bis auf den heutigen Tag noch nicht untergegangen, auch ist der Kernkrieg der geltungssüchtigen Großmächte noch nicht ausgebrochen. Und wenn das kein Happyend-Ereignis ist! Ja, das Leben ist schöner und die Menschen leben glücklicher, als die profitorientierten Meinungereien dieser Welt in breitester Front es uns glauben machen wollen.
Wenn du, edler Freund und lieber Bruder, mir das alles abzunehmen bereit bist, dann wirst du dich dem nachfolgenden Manuskript gegenüber auch nicht abgeneigt zeigen, nehme ich an. Denn es ist die Geschichte einer Liebe, die bei ihrer ersten Blüte einen vernichtenden Schlag erlebt und verheerende Folgen auf beiden Seiten hat, aber dann in Gestalt eines Zufalls oder eines Geschenks vom Himmel, jenem spiellustigen und gutmütigen Wesen, eine Gelegenheit angeboten bekommt, sie aufgreift, es zu einer zweiten Blüte bringt, der ein Neubeginn und diesem ein Happyend-Schluss logischerweise folgen.
Und zum Schluss. Solltest du wissen wollen, wie ich als Autor zu meinem Werk stehe, so sage ich, ohne zu erröten, dass ich es in der Nähe der Eroica des großen Tondichters und mächtigen Tonschamanen Ludwig van Beethoven verortet glaube. Bei dieser pausbackigen Selbstgefälligkeit geziemt es mir wohl dennoch, eins zu gestehen: Ich bin hier nicht der Schöpfer gewesen – darum benutzte ich oben ein anderes Wort. Die Vorlage gibt es im Leben, in meiner greifbaren Nähe. Ich habe die Geschichte einfach niedergeschrieben, bin also lediglich ihr Schriftführer gewesen.
Habe ich mit diesem Geständnis wieder an das Misstrauen in manchem wachen Geist gerührt? Habe ich mich des Naturalismus verdächtig gemacht? Dazu meine Meinung: Lieber entscheide ich mich für den prallbackigen, voll pulsierenden Naturalismus als für das hohlwangige Gespinst eines Hirns, umstrickt von verkalkenden Leitungen!
Gedankt sei
Lutbajir,
Dem Auserwählten vom Himmel,
Ein solches Geschick
Ertragen zu müssen,
Erleben zu dürfen.
Und gewidmet sei
Die sanfte Frucht meiner heißen Bemühungen
Dem treu und trotzig und mächtig Liebenden –
So auch seiner unsterblichen Geliebten.
Vorspruch
Im Folgenden wird wieder einmal von der Liebe erzählt werden. Es wird die sanftmütige, behutsame Beschreibung der Wonnen und Schmerzen zweier Menschen des anderen wegen sein, zuerst auf gewohnten Wegen des Lichts zustande gekommen und später auf ebenso gewohnten Stegen des Schattens gestolpert, zum Schluss jedoch, dem Verlauf aller Dinge trotzend, sich fangend und fortgesetzt. So ist es eine schwere, mehr noch, eine merkwürdige: bemitleidens- wie auch bewundernswerte Liebe.
Die Geschichte wird auf so manchen Widerstand stoßen. Das weiß ich, noch bevor ich sie der Öffentlichkeit vorgelegt habe. Doch ich muss sie unbedingt niederschreiben, auch auf die Gefahr hin, mein guter Wille und meine heißen Bemühungen werden mir auf dem verschlungenen, dornenbesäten Pfad meines Lebens, ohnehin beschwerlich genug, weitere Steine bescheren. Denn die Liebe ist nicht nur gewesen, sie dauert mit ihrer irrewirren Feuersbrunst noch an. Und das ist das Allerwesentlichste an der Sache. Und dies, weil ich meine, die Dichtung ist mündig genug, um die Widerspiegelung des wenigstens schon einmal Geschehenen im Leben zu sein. Und die Leser möchten sich wieder von den Verstrickungen einer Kunst, die mord- und zerstörungssüchtig und letzten Endes von sich aus sterbenskrank wie auch von außen her überwindungswürdig geworden ist, zu befreien und endlich wieder zu erkennen: Die lichte Welt, in der wir alle leben, ist sanfter beseelt, klarer begeistet und einfacher bestellt, als die Gespenster aus den Büchern, auf den Bühnen und über den Bildschirmen, alles dem Oberteufel Geld unterstellt und miteinander verwandt, wie die Krallen einer Fangpfote, uns einreden wollen.
Es war Ende Januar. Die Erdkugel schien in ihrer Abgeschiedenheit inmitten der kosmischen Fülle noch einsamer, trostloser und zerbrechlicher geworden zu sein. Denn das Leben, das sich in ihren Falten und Spalten eingenistet hat, wurde unaufhaltsam fragwürdiger: Fische und Vögel, Goldmäuse und Silberfüchse, Widder und Pinguine, weit und unabhängig voneinander beheimatet, fingen an, schwärme- und herden- und rudelweise einzugehen; die Bäume neigten dazu, ihre gewohnte Stärke, und die Gräser ihre gewohnte Länge zu verfehlen – beiden war neuerdings gemeinsam, dass ihre Wurzeln immer mickriger gerieten und brüchiger ausfielen, und der Mensch, dieses rundschädlige, stelzbeinige Wesen, war unermüdlich damit beschäftigt, die bereits angehäuften, himmelstarrenden und erderdrückenden Waffenberge jeden Tag um weitere Hügel zu vermehren, um seine Artgenossen, das hieß im Endergebnis sich selber, auszurotten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!