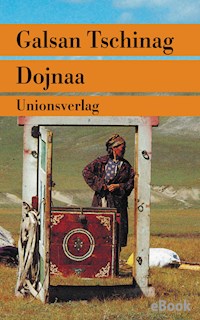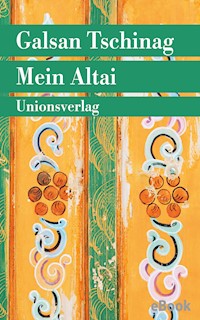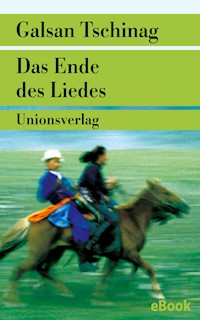12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann, eine Frau, ein Schaf – eine Begegnung, nicht auf dem Land, sondern im Hausflur eines großstädtischen Hochhauses. Die junge, gut aussehende Frau hat in einem Fernsehquiz ein Schaf gewonnen, doch was soll sie in ihrem schäbigen Wohnblock damit anfangen? Das Schaf ist am falschen Ort, aber sind es nicht vielleicht auch der Mann und die Frau? Er ist ein alter, gestrandeter Nomade und vertraut im Umgang mit Tieren. Sie ist jung und hilflos, nicht nur gegenüber dem Schaf. Die Angehörigen ihres ehemaligen Liebhabers, eines mächtigen Oligarchen, stellen ihr nach. Beide haben ihre Erfahrungen gemacht in der neuen Metropole, die postkommunistische Blüten treibt. Gier, Neid, Gewalt, alles was Menschen sich antun können, haben sie erfahren, und nun werden sie einander Zuhörer und Fürsorger. Sind sie Vater und Tochter, Mutter und Sohn? Liebende?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 618
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein Mann, eine Frau, ein Schaf – eine Begegnung, nicht auf dem Land, sondern im Hausflur eines großstädtischen Hochhauses. Die junge, gut aussehende Frau hat in einem Fernsehquiz ein Schaf gewonnen, doch was soll sie in ihrem schäbigen Wohnblock damit anfangen? Das Schaf ist am falschen Ort, aber sind es nicht vielleicht auch der Mann und die Frau?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Galsan Tschinag, geboren 1943 in der Westmongolei, ist Stammesoberhaupt der turksprachigen Tuwa. Er studierte Germanistik in Leipzig und schreibt viele seiner Werke auf Deutsch. Er lebt in Ulaanbaatar und verbringt die restlichen Monate abwechselnd als Nomade in seiner Sippe und auf Lesereisen.
Zur Webseite von Galsan Tschinag.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Galsan Tschinag
Der Mann, die Frau, das Schaf, das Kind
Roman
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: benicce
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30849-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 22:26h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DER MANN, DIE FRAU, DAS SCHAF, DAS KIND
Die Geschichte des Kindes, das sich mit dem Himmel gezankt hatJeglichem Ding eine lichte Haut abgeschält und allen Finsternissen getrotztWorterklärungenMehr über dieses Buch
Über Galsan Tschinag
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Galsan Tschinag
Zum Thema Asien
Zum Thema Liebe
Zur vorgerückten Stunde eines schwülen Mittsommertages betritt ein Mann in ebenso vorgerücktem Alter und gedämpftem Zustand den schummrig-schmutzigen Flur eines Hochhauses mitten in einem brodelnden, lärmenden Wohngebiet. Von der ruppig zuklappenden Tür im Rücken hineingeschubst, von der plötzlich eingetretenen Stille um sich herum verblüfft und von der schweißig beißenden, stickig moderigen Raumluft angewidert, bleibt er einen Pulsschlag lang stehen, wie eingeschüchtert, und blinzelt vor sich hin. Sogleich sichtet er in der Ecke mit dem Fahrstuhl zwei Gestalten, deren eine er für einen schmalen, stehenden Menschen und die andere für einen breiten, hockenden Hund hält. Doch da erschallt das unverwechselbare, lebhafte Blöken aus einer unverkennbar gequälten Schafskehle.
Unter weiteren Pulsschlägen schleicht sich der Mann an den beiden Gestalten vorbei, gelangt an eine Wohnungstür, öffnet sie und entschwindet dahinter. Das alles dauert wirklich nicht sehr lange, doch es scheint alle Anwesenden zu belasten, denn sie schauen währenddessen angespannt aneinander vorbei und halten sogar den Atem an; selbst die glänzenden, gelben Augen des Schafs, das auf beiden Vorderfüßen hockt, da sein Hinterteil bis zum Widerrist in einem Sack steckt, glotzen ins Leere, während der ganze sonstige Körper Stille bewahrt, sodass ihm in der Tat etwas von einem gut abgerichteten Hund anhaftet.
Überlassen wir das Schaf einstweilen seinem tierischen Schicksal und wenden uns den Menschen zu. Diese haben sich doch echt menschlich verhalten, was heißen will, sie haben einander versteckt beobachtet und dabei schon manches Urteil übereinander gefällt. Ja, aus dem Augenwinkel, unter angehaltenem Atem lassen sich die Dinge oft schneller und genauer erforschen und erkennen als mit vollem Blick.
Die Frau hat dem Mann das Alter und die Müdigkeit angesehen. Aber nicht etwa richtend, auch nicht bedauernd, sondern vielmehr mitfühlend und vor allem auf sich selbst bezogen: Auch ich werde eines Tages alt sein; und was die Erschöpfung betrifft, wer ist schon nicht erschöpft, der aus der Mühle der Großstadt, dieser täglich wahnsinniger wirkenden Hölle, endlich aussteigen und unter das ihm zustehende Dach flüchten darf? Wobei ich in diesem Augenblick schlimmer dran bin als jeder andere, weil ich ja gar nicht weiß, wann ich heute die Schwelle zu meinen eigenen vier Wänden überhaupt betreten werde!
Da beneidete sie den unbekannten Mann mit dem schütteren, grauen Haar und dem zerfurchten schwitzigen Gesicht, das alle Erschöpfung der Welt auszustrahlen schien. Es war ein aufrichtiges und heftig empfundenes, dabei sogar liebenswertes Gefühl. Denn sie wusste, gleich würde er sich der lästigen, an der Haut haftenden Kleidung entledigen, mit kühlem Wasser die ermatteten, klebrigen Hände und das brennende Gesicht waschen und möglicherweise sogar mit dem ganzen Leib kindsnackt unter zischendem, belebendem Duschstrahl stehen.
Dieser Gedanke an die Dusche schoss ihr wohl durch den Kopf, da ihr sein Hemdkragen einfiel – der, zumindest nach außen, blitzsauber strahlte. Jedem Mann, der ihr begegnete, prüfend auf den Kragen zu schauen war eine ihrer Gewohnheiten, und so wusste sie, dass in dem Land nur wenige Männer ihrer Prüfung standhielten. Dieser betagte, erschöpfte Mensch, ausgerechnet, und dazu der strahlend saubere Kragen, ja, das war eine überraschende Ausnahme. Hinzu kam: Das Hemd, das er trug, war zwar kein modernes, aber ein himmelblaues – himmelblau war ihre Lieblingsfarbe!
Der Gedanke ging wie im Flug weiter: Wenn einer in dem Alter so sauber gekleidet war, musste er in Vorzeiten etwas Besonderes dargestellt haben. Nur, fragte sie sich, wieso war sie ihm denn in den zwei Jahren, die sie in dem Haus wohnte, noch nie begegnet? Er könnte ja erst in letzter Zeit zugezogen sein – ja, so etwas gab es hin und wieder.
Unterdessen hat der Mann sich nur annähernd nach der Spielleitung verhalten, welche die Frau vor der Tür für ihn ausgedacht. Er hat sich seiner verschwitzten Kleidung zwar tatsächlich entledigt, aber nicht geduscht, sich auch ganz anders vom eigenen Schweiß und fremder Schlacke gesäubert, als die Fantasie der Unbekannten ihm hat vorschreiben wollen: Er hat seinen ganzen Körper mit einem Lappen eingeseift und sorgfältig abgerieben, wie er es sich vor Jahren angewöhnt. So wurde Wasser gespart, Wasser, das Geld kostete, Geld, das man auf Schritt und Tritt benötigte, um der lauernden Armut zu entkommen, in die sich tagtäglich unzählige Menschen gedankenlos stürzten.
Nun war er wieder angezogen und fühlte sich erfrischt und in der Lage, den nächsten Schritt seines geregelten Lebens zu tun: das Zubereiten des Abendmahls. Doch er ertappte sich dabei, vor dieser so einfachen Tätigkeit zu zögern, und er ahnte den Grund dafür: Es musste mit den beiden Wesen zu tun haben, die er vorhin draußen gesehen, an denen er sich, nicht anders als ein Schuldbeladener, mucksmäuschenstill vorbeigeschlichen hat und die immer noch da waren, wo sie gewesen. Denn das Geblöke des Schafs dröhnte durch die hellhörige Tür hindurch, wieder und wieder, in immer kürzeren Zeitabständen, und es schien mit jedem weiteren Mal tiefer in sein Gehör einzudringen.
Vielleicht weil vom anderen Ende jener unsichtbaren, soeben gezogenen Leitung hirnwarme, seelenhelle Gedanken zu ihm herüberströmten, hat er unaufhörlich an die beiden denken müssen. Schon während er die Wohnung betrat, sein Mitbringsel ablegte und sich seines Öffentlichkeitspanzers entledigte, dann, während er seine alte, zähe Hülle säuberte und erfrischte, und schließlich, während er sich wieder anzog. Er hat die Frau aus dem peinlich nahen Winkel seines geziemend niedergeschlagenen Blickes wiedererkannt, so wie man die Mehrheit der Bewohner im Haus von Gestalt und Gesicht her zu erkennen pflegt. Dabei hat er, ohne sagen zu können, wie sie hieß noch wo sie genau wohnte, schon manches über sie gewusst: Seit wann sie zur Hausgemeinschaft gehörte und welcher Bevölkerungsschicht sie zuzuordnen wäre, wer alles sie begleitete und aus welchem Fahrzeug sie ausstieg, wenn sie hin und wieder recht spät auftauchte. Auch konnte er sich gut daran erinnern, dass sie einmal unverkennbare Spuren äußerer Gewalt auf ihrer noch jungen, auffallend dünnen und hellen Gesichtshaut aufwies.
Nun ging er, ohne es selber zu merken, den Gedanken an das Schaf nach. Das Schaf war wohl dem Körperumfang und den Hörnern nach ein Hammel, und zwar einer von mindestens drei Jahren, und die Atemwolke hat nach jenen berauschend würzigen Lauchstängeln der südlichen Wüstensteppe geduftet. Seine Besitzerin musste ihn wohl geschenkt bekommen haben, denn man mochte ihr unmöglich zutrauen, dass sie solch einen Prachtkerl aus einer wimmelnden Menge verängstigter Schafe auf dem Tierbasar selber ausgesucht, eingefangen und schließlich auch niedergezwungen haben könnte. Dafür war sie eine zu feine, zu zerbrechliche Person, deren ganze Erscheinung an ein hauchdünnes, schneeweißes Porzellanstück denken ließ, das eher zum Glasschrank in der guten Stube angeberischer Städter gehörte und als Alltagsgeschirr ganz und gar ungeeignet war.
Zum ersten Mal hat er sie vor gut zwei Jahren gesehen, als sie mit ihrer eher spärlichen, jedoch auffallend feinen Wohnungseinrichtung in das Haus einzog. An dem Tag und zu der Stunde hat er mit zwei, drei Alten auf einer Bank unweit vom Hauseingang gesessen, wie so oft abends vor dem Untergang der Spätfrühlingssonne. Da hat es kleine Bemerkungen über die noch wildfremden, aber künftigen Mitbewohner gegeben: an und für sich harmlose, aber im Flüsterton gehaltene Worte schüchterner Alter angesichts des lauten Auftretens junger, machtstrotzender Menschen. Zu jenem Gefühl der Unterlegenheit muss die gepflegte Erscheinung der Noch-Fremden und das glanzvolle Aussehen ihrer Habseligkeiten geführt haben.
Damals kam die blütenzarte, zerbrechliche Frau in Begleitung eines Mannes, der einem Bild aus einer Modezeitschrift glich. Es war ein richtiger Herr in jeder Hinsicht. Er strahlte, wohin er trat und sogar nur schaute, gnadenlose, eiskalte Vornehmheit und überzogene mongolische Urmännlichkeit aus. Später tauchten andere Männer auf. Wie viele genau, war schwer zu sagen. Vielleicht drei oder vier oder noch mehr sogar. Denn es dürfte ja gut sein, dass man nicht jeden zu Gesicht bekommen hat.
Aber eine Sache fiel ihm, dem Außenstehenden, jedes Mal auf: Der Neue, der kam, schien immer weniger von der aufgesetzten und angestrengten Männlichkeit aufzuweisen. Es war auch möglich, dass man sich an die zeitgemäßen Erscheinungen um sich herum einfach gewöhnte. Bei all dem Auftauchen von männlichen Gestalten und Gesichtern schien die Frau zu jedem Neuen den gleichen Abstand und das gleiche Schweigen wie zu seinem Vorgänger zu bewahren. Man sah sie nie Hand in Hand mit jemandem gehen, auch hörte man sie zu keinem je ein Wort sprechen. Schweigend trat sie morgens aus dem Fahrstuhl, schritt, Kopf und Blick gerade, auf den Ausgang zu, und der Begleiter folgte ihr zuerst und eilte alsbald an ihr vorbei, um ihr die Tür aufzumachen. Und sie schritt in den Tag hinaus. Abends dasselbe Bild, nun in umgekehrter Richtung: Die Dame kam tadellos artig und durchschritt die geöffnete Tür, zuerst des Hauses und dann des Fahrstuhls. Gewiss kam es manchmal vor, dass man auf den Fahrstuhl warten musste. Da schaute sie, kerzengerade und einem Standbild gleich, vor sich hin, scheinbar, ohne sich um das Getue und Gerede der Leute ringsum zu kümmern.
Diese sonderbare Haltung, die sie für andere wohl unnahbar machte, beschäftigte seine Gedanken immer wieder, was mit seiner eigenen Schrulle zu tun hat, welche wiederum von unsichtbaren Wunden herrührte. Er war wohl daher schnell bereit, ihre Eigenart zu billigen, indem er sich sagte, sie wäre eben ein höheres und edleres Wesen als die niederträchtigen Menschen, die vom Klatsch lebten wie Geier von Aas. Wobei er zugestehen musste, die junge, vornehme Frau habe bestimmt viele Feinde. Doch hörte er einmal, wieder auf der wackligen Bank vor dem Haus, eine alte Frau sagen, dass jene es goldrichtig machte, indem sie die Männer – diese dämlichen, geilen Gockel – um sich herum trippeln und trappeln ließe, ohne sie dabei auch nur mit dem kleinen Finger anzurühren! Wie dankbar war er dieser Klatschtante, obwohl er von ihrem zahn- und zaumlosen Mund als Mann mitgepeitscht worden war! Die junge, auffallend Erhabene aus einem der oberen Stockwerke des Hochhauses beschäftigte also die Gedanken mancher Mitbewohner, darunter die eines alten, unscheinbaren Junggesellen hinter der blechernen Tür neben dem Fahrstuhl im dreckigen, lärmigen Erdgeschoss!
So ertappte sich der Mann jedes Mal in hellster Aufregung, wenn er ihr begegnete. Eine Aufwallung tief in ihm, die er niederzuhalten und in eine dicke Wolke der Gleichgültigkeit einzuhüllen versuchte. Und nun heute – die Erhabene bar jeder Begleitung und mit einer so lästigen Bürde, die ein so edles Wesen wie sie glattweg erniedrigte! Die harngelben Augen einer gepeinigten Kreatur, die sie und ihn samt dem schmutzig-stickigen Raum im Spätnachmittagslicht wie bettelnd anglotzten, waren ihm schier unerträglich. Wie sterbenspeinlich muss es erst für sie gewesen sein, o Himmel, dachte er voll Schauder und kam sich schuldbeladen vor.
Wobei er wusste, dass solches Nachgrübeln die Vorkommnisse meist näher rückte, als man sie sonst erlebte. Doch er fand es gut so und hatte in der Hinsicht seine festgebackene Meinung: Den Bewohnern und Geschehnissen dieser Welt ständig gepanzert begegnen und das, was an der Außenfläche des Panzers hängen geblieben, erst durch den Verstand seihen, um möglicherweise auf einen Hauch Geist und eine Spur Honig zu kommen; dann den Fund emsig in den Innenraum tragen und sorgfältig aufbewahren, als Dauernahrung für die Seele, auf dass sie sich, wann nötig, daran labte! Das war der Hauptertrag, den er sich auf den kunterbunten Feldern dieser Welt in den langen Jahren seines wechselvollen Lebens abgeerntet hat.
Es wurde an die Tür geklopft, leise und zaghaft, doch er hörte es trotz seiner alterstauben Ohren mehr als deutlich. Er wusste, es musste, es konnte nur sie sein. Er eilte zur Tür und öffnete sie, ohne zu fragen. Sie war es auch. Nur, welch wunderlicher Anblick bot sich ihm dar! Im Blick derer, die vor ihm stand, wiederum las er, dass er selbst um keinen Deut besser aussah. Es erkannten wohl beide, was es sie kostete, das Eis der Fremdheit zu brechen, um erst einmal in die Atemnähe des anderen zu gelangen. Durch dieses Bild der Bestürzung im Gegenüberstehenden fühlte man sich selbst entblößt, was beiden unerträglich komisch und albern vorkam. Und so brachen sie im gleichen Augenblick in Gelächter aus. Vielleicht war es auch eher ein Gebrüll, ein gruseliges Geschrei, der Kehle unwillkürlich entfahren, mit einem Nebengeräusch, dem die Nähe schlotternder Tränen anzuhören war.
Der peinliche Aufzug dauerte zum Glück nur ein paar Herzschläge. Dann kamen sie mit einem Mal zur Ruhe. Wie wunderlich, wie wunderbar, da war von der eisigen Fremdheit, die vorhin auf ihnen gelastet und sie gelähmt hatte, kein Hauch mehr zu spüren. So standen sie jetzt mit ernsten, aber gelösten, offenen Mienen: ein älterer Mensch und ein jüngerer – ein Mann und eine Frau – einander gegenüber und führten ein Gespräch, wie es unter allen Menschen an allen Enden der Welt zu allen Zeiten und Anlässen geführt wurde.
Sie brauchte Rat, brauchte Hilfe. Er wusste Rat und war bereit zu helfen. So viel erst einmal. Über die Einzelheiten könnte später geredet werden.
Sie schafften das Tier in seine Wohnung. Es war schwer und schweißnass obendrein, zu zweit schleppten sie es mit Mühe bis an die Tür, über die Schwelle und ließen es im finsteren Flur stehen. Dann ging sie. Und er blieb zurück. Nun war er nicht mehr allein. Das fettpralle, wesenhafte Tier war Mitatmender der Luft seiner vier Wände. Dass es sich um ein männliches Schaf handelte, stand mittlerweile fest. Auch in der Einschätzung des Tieralters hatte er sich nicht geirrt: Drei Ringe zeichneten sich um die gebogenen, stämmigen Hörner ab.
Bedeutete das für den Junggesellen mit dem verwitterten Aussehen einen Trost? Vielleicht. Aber der hatte auch seinen Preis: Das Tier strömte einen durchdringenden Geruch nach Urin, Schweiß und Kot aus, der die ganze Wohnung mit den zellenartigen Räumlichkeiten schnell füllte und nun die ohnehin dicke Luft in einen beißenden und ätzenden Dunst verwandelte. Gut, das war für die Nase und die Lunge eines Menschen, der ursprünglich vom Land kam, nichts Besonderes. Fragwürdiger erschien mit der Zeit etwas anderes: das Geblöke, das jetzt im engen Raum und in der Nähe der Blechtür noch bedrohlicher dröhnte. Dabei schien es, als ob sich die Geduld des Tierwesens bald erschöpfte – jeder weitere Stoß aus der Schafskehle glich immer weniger dem natürlichen Mitteilungslaut eines Lebewesens, sondern immer mehr dem Notgeschrei eines Sterbenden. Die Atemnähe des Gepeinigten zu spüren und sein verzweifeltes Gebrüll zu hören war höllisch anstrengend. Doch ein Gedanke vermochte den Mann mit der augenblicklichen kläglichen Lage um ihn herum zu versöhnen: Es galt, was auch geschähe, das Übel zu ertragen, da er es einem anderen Menschenkind abgenommen … Also gab es doch einen Trost!
Die Zeit verging langsam, doch es verging ein ganzer Zeitenberg. Die Besitzerin des lästigen Taviul blieb aus, obwohl sie gesagt hatte, sie würde so bald wie möglich zurückkommen und ihn abholen. Der Besitzer der Wohnung, im Augenblick vor allem Hüter eines fremden Besitzes, konnte sich nicht einmal an seine längst fällige Aufgabe, die Zubereitung des Abendmahls, machen. Stattdessen ging er Grübeleien über jene nach, auf deren Rückkehr er wartete.
Die Erhabene … So hatte er sie bislang in Gedanken genannt. Würde er es weiterhin tun, nachdem sie vorhin mit ihm zusammen an dem klitschnassen, nach allen Ausscheidungen stinkenden Hammel gezerrt, dabei hörbar gestöhnt und davor ihn, den armen Kerl aus dem namenlosen Volk und dem vor Schmutz starrenden, nach Muff stinkenden Erdgeschoss, um Rat und Hilfe gebeten hatte? Ja doch, nun erst recht! Seine Begründung dazu lautete: Sie hat sich in einem notwendigen Augenblick dazu durchgerungen, den Dünkel ihres Stands als jüngere Bewohnerin der oberen Stockwerke des Lebens zu überwinden und hinabzusteigen zum Untergeschoss, wo Namenlose mit ihrer selbstlosen Dienstbereitschaft warteten.
Den wenigen Worten nach, die sie gesprochen, konnte sie nicht in ihre Wohnung. Vielleicht hatte sie ihren Schlüssel verloren? Oder das Schloss streikte? Oder der Mann, der sie zurzeit begleitete – Der Grübler brach den Gedanken ab, denn ihm fiel sein Alter ein, in welchem jede Mutmaßung über andere Menschen untersagt sein musste.
Je weiter der Tag auf die Nacht zuging, umso bedrohlicher wurden die Laute, die das Tier von sich gab, und umso mehr verdüsterten sich die Gedanken des Menschen. Wie würden die Nachbarn dies aufnehmen? Bestimmt fänden sie es nicht lustig! Was, wenn gleich an die Wand, an die Tür gepocht wird? Solches war immer wieder vorgekommen und hatte so manches Mal mit Prügelei und sogar mit Polizei geendet! Jetzt schien das menschliche Hirn Funken zu sprühen, wovon der ganze Körper heiß anlief, und er glaubte zu wissen, was zu tun war.
Der Mensch eilte in die Küche, nahm ein Messer nach dem anderen in die Hand und prüfte es auf seine Schärfe hin, indem er mit der Fingerkuppe leicht gegen die Schneide fuhr. Er entschied sich für eins und rieb dessen Spitze noch ein paar Mal an einem Wetzstein hin und her. Dann schritt er mit der blanken Waffe in der Hand auf den Hammel zu, der immer noch hündisch dahockte, regungslos an seinem ganzen gewaltigen Leib, auch an dem behörnten Kopf, wobei sich allein die großen, vollen Augen so heftig verdrehten und goldene Strahlenbündel in alle Richtungen auszuschütten schienen.
Man wird dich von dort, wo du auch immer zu Hause gewesen sein magst, nicht herübergeschleppt haben, um dich etwa weiterleben und wachsen zu lassen, mein vierbeiniges Brüderchen, lauteten die Gedanken des Menschen mit dem entschlossenen Ausdruck auf seinem runzligen Gesicht und dem gleißenden Dolch in der Faust. So will ich dich erlösen von deinem Leiden, sprach er weiter mit seinem Blick, während er dem Tier mit der freien Hand sanft übers Gesicht fuhr.
Dabei verspürte er, welch ein glühheißes Leben durch das dicht behaarte Fell hindurch strahlte. Welch gebündelte Restkräfte könnten aus dem gepeinigten Tierkörper noch losbrechen gegen den, der sich erdreistete, in ihn einzudringen und sein Leben auszulöschen? Da meldete sich im menschlichen Hirn die Vorsicht. Er schaute auf die immer noch aufgerichtete Tiergestalt und auf die eigenen menschlichen Hände am Ende der holzdürren Altmännerarme und kam sich kräftemäßig so nichtig gegen den ausgewachsenen, vor Fett quellenden und vor Muskeln strotzenden Hammel vor. Weitere Überlegungen mahnten zu noch mehr Vorsicht.
Wann hatte er denn das letzte Mal ein Tier geschlachtet? Vor gut zwanzig Jahren vielleicht. Ach, wie jung und stark musste er da gewesen sein! Und das damals war ein mickriger Schafsjährling gewesen, mit Sicherheit kein ausgewachsener Hammel! Nun war es schier unmöglich, die beiden Vorderfüße des Hammels in seiner dürftigen linken Faust zusammenhalten und dabei das rechte Bein mit dem krachenden Knie, dem geschrumpften Schenkel und der schlaffen Wade über die Hinterbeine des Opfers schwingen und sie niederdrücken zu wollen, während sich die rechte Hand mit dem Messer nach der Kuhle am Vorsatz des Brustbeins hintastet.
Aber der Hammel musste geschlachtet werden, damit sein sinnlos andauerndes Leiden beendet und auch die menschliche Gemeinschaft ringsum von dieser widersinnigen Plage befreit war! Doch wie sollte man dem armen Tier nur den Tod beibringen? Ihm die Kehle durchschneiden, wie die Kasachen es tun? Da fiel dem Mann etwas ein: Wie mancher mit einem Großvieh verfährt – ihm vorher einen Betäubungsschlag versetzen. Zwar würde sich jedermann über ihn lustig machen, der davon erführe, aber hier war nun einmal niemand.
Gedacht, getan. Unter dem eher sanften als barschen Fall eines armdicken Hammers zwischen die Hörner zuckte das Opfer für einen kurzen Augenblick zusammen und sank dann mit verdrehten Augen stumm und langsam nieder. Alles Weitere führte der Mensch schnell und gewissenhaft aus, treu den Griffen des nomadischen Handwerks, das sich seit alters her bewährt und darum auch erhalten und längst die Gültigkeit eines Gesetzes erlangt hatte.
Erst als das Wesen, dessen durchdringende Stimme in seinen Ohren immer noch nachklang, endgültig tot war und nun reglos dalag, kam dessen Schlächter, nein, dessen Erlöser wohl zu sich. Denn er stand, schnaubend und zittrig, vor seinem Opfer wie jeder, der soeben ein fremdes Leben ausgelöscht hat, und schaute erschüttert darauf hinunter. Er nahm es als strahlend hell, sanft hügelig und tief friedlich wahr, woraus er einen kleinen Trost für sich zu erhaschen wusste und woran sich eine rührselige Verschnaufpause anschließen konnte.
Dann stürzte sich der Mensch schwungvoll in die Arbeit, die jetzt erst richtig anfing und Muskeln anstrengte und Schweiß austrieb, jedoch nicht weiter schlimm war. Denn dieses Handwerk hatte er in jungen Jahren erlernt, weshalb ihm alle erforderlichen Griffe traumwandlerisch sicher von den Fingern gingen. Er arbeitete langsam und gewissenhaft, bedacht auf Genauigkeit und Sauberkeit, und in seinem Hirn kreisten die Gedanken.
Einer davon: Bei jeder ausgeführten Arbeit wird später selten danach gefragt, wie lange sie gedauert, öfter aber, wer sie verrichtet hat. Das hatte er einmal von seinem Vater gehört. Wie viele Jahre mochten seitdem verflossen sein? So viele, dass man sich bei der Zahl leicht wie ein Lügner oder wie ein Toter schon vorkommen konnte. Weshalb aber die Worte immer noch in seinen Ohren geblieben sind? Weil sie die Wahrheit getroffen haben!
Ein anderer: Was wäre, wenn in diesem Augenblick die Besitzerin des Hammels wieder auftauchte? Es wäre gewiss eine Überraschung für sie, aber was für eine – eine böse oder eine freudige? Was, wenn die wildfremde vornehme Dame seine Entscheidung eigenmächtig und unverschämt fände? Das wäre zwar unschön, aber er würde ihr erklären, warum er es getan. Wäre die Arbeit sauber und sachgemäß ausgeführt, würde dies vielleicht seine Schuld mildern. Wohl aus diesem Grund wünschte er sich jetzt, die Besitzerin käme nicht, solange er nicht fertig war!
Ein weiterer: Merkwürdig, warum das Kleinvieh ohne jegliche Betäubung bei klarem Bewusstsein geschlachtet wird. Es müssen doch höllische Schmerzen sein, die das arme Tierwesen zu erleiden hat, wenn ihm der Bauch aufgeschnitten, die menschliche Faust in seinen Innenleib gerammt und der Lebensfaden, der entlang des Rückens, einem Bach gleich klopft, durchgerissen wird! Warum wollen die Menschen, die mittlerweile selber bei jeder Kleinigkeit zu Betäubungsmitteln greifen, den sie ernährenden Wesen nicht wenigstens die Vortodesqual lindern? Ist es menschliche Dummheit oder falscher Stolz, der sie davon abhält?
Das Abziehen ging schwer vor sich, zäher als bei allen Schafen, die ihm in der Vergangenheit unter die Faust gekommen waren, sollte seine Erinnerung stimmen. Oder lag das schon wieder am Alter? Oder an den Umständen? Ja, jeder Abdecker brauchte einen Gehilfen, der ihm den Tierkörper aufrecht hielt. Unser Mann wusste sich zu helfen, indem er die beiden Vorderfüße mit einem Strick zusammenband und dessen Ende an der Türklinke befestigte. Nachdem der Körper endlich enthäutet war, galt es, ihn auszuweiden. Da hätte es richtig schwer werden können, wäre das Tier direkt von der Weide gekommen, mit prallvollem Bauch, der frisch abgerupften Grasmenge im Pansen. Aber es hatte den langen Leidensweg gehen müssen und alles, was es zu sich genommen, schon zu einem Brei verdaut. Das meiste davon hatte den Körper längst verlassen. So waren der Pansen, die drei Mägen und die weiteren Gedärme fast leer. Dank des Wassers aus dem Hahn, das alles, was wegzukommen hatte, ins Unsichtbare mitnahm, war es sogar einfach, die Innereien sauber zu spülen. Also gab es doch manches, was die Mühsal verringerte, sosehr diese ganze Notschlachterei in einer Stadtwohnung den Gepflogenheiten der neuzeitigen Lebensweise widersprechen mochte.
Der Rumpf wurde bis auf Keulen und Flanken, Hals- und Rückenwirbel und der Kopf in Schädel- und Kieferteil gelöst. Man hätte diese Brocken weiter zerlegen, die Glied- und Wirbelmassen in einzelne Knochenteile zertrennen können, damit die Dame und ihr Begleiter es einfacher hätten, bei der Lagerung wie beim Kochen. Aber er ließ es sein, aus Vorsicht, es könnte falsch ausgelegt werden, in welche Richtung auch immer.
Jetzt durfte die Besitzerin schon kommen. Aber sie kam nicht. Er überlegte, was noch zu erledigen wäre: Der Fleischhaufen auf der ausgebreiteten nassen Haut könnte umplatziert werden, um das Fell zusammenzuklappen, ehe es an den freien Rändern zu vertrocknen anfinge! Er holte Bretter und Schüsseln herbei und schichtete die Fleischbrocken um. Dann schabte er die Fettreste von der Haut wie früher und dachte an das Salz, das daraufgestreut werden müsste. Nach kurzem Überlegen ließ er es jedoch sein. Erstens war das Fell riesengroß, und es würde bestimmt viel Salz gebraucht, und Salz war teuer. Und zweitens: Was würden die Eigentümer des Fells und alles Übrigen denken!
Das Fell wurde also lediglich zu einem sauberen, rundlichen Ballen zusammengelegt. Mochte die Besitzerin nun endlich erscheinen! Doch trotz der fortgeschrittenen Zeit blieb sie weiter aus. Da fiel dem Wartenden eine weitere Erledigung ein: Das Blut, das zu einer glänzenden Masse geronnen in einem Topf stand, rühren, verdünnen, veredeln und in Gefäße gießen! Er stürzte sich auf diese Tätigkeit, bei der nicht nur Wille und Erfahrung, sondern auch Fingerfertigkeit und Denkfähigkeit gefragt waren. Die geronnene Masse war, verglichen mit der Größe des Spenders, gering, aber es war verdicktes, wertvolles Blut, das eine gehörige Menge Flüssigkeit und einige Zusätze brauchte, um zur Grundlage so mancher Leckereien verarbeitet zu werden. So schüttete der Mensch Wasser hinein, mengte dem fein gehackte Zwiebeln und zerriebenen Knoblauch bei und streute Mehl, Salz und Pfeffer darauf. Dann rührte, quetschte und schüttelte er das Gemisch, schaute wieder und wieder prüfend darauf und schnupperte schließlich daran.
Nun goss er es in den Magen und den Zwölffingerdarm, wissend, so entstanden die einfachsten, aber auch leckersten Blutwürste. Was viel Zeit und Anstrengung kostete. Denn in die schlabberigen Mündungen der glitschigen Gedärme die schleimige Flüssigkeit zu gießen war für nur zwei Hände etwas fast Unmögliches. Aber zu guter Letzt schaffte er auch das. Und wie stolz er auf dies gute Ergebnis seiner Anstrengung war!
Doch die Besitzerin, die – aus welchem Grund auch immer – irgendwo in dieser kopf- wie fußlosen Stadtwelt zur Mitternachtsstunde, einer läufigen Hündin gleich, herumstreunen musste, kam und kam nicht, Himmel und Erde! Er war blindwütend auf diese Frau, die ihm einerseits wildfremd war, andererseits aber auch nicht, da er sie schon seit Langem für ein erhabenes, übermenschliches Wesen gehalten und dann, vor wenigen Stunden erst, mit ihr auf dem gleichen Boden gestanden hatte, Mensch zu Mensch. Deshalb hatte er sich dieser blutig schweißigen Plackerei ergeben, ohne zu wissen, ob sie ihm Anerkennung oder Schererei bescherte!
Mit einem Mal spürte er einen solchen Hunger im Magen, dass er schmerzte und seinen ganzen Leib mit einem lähmenden Schwächegefühl erfüllte. Was tun?
Er hätte sich ein Stück von den Blutwürsten ins Wasser tun, es kochen und damit seinen Heißhunger stillen können. Doch an so etwas wollte er nicht einmal denken. Denn das wäre ein Sichvergehen an fremdem Eigentum. So musste er sich mit einer dicken Scheibe Graubrot, ebenso dick bestrichen mit einem blassen Butterersatz, begnügen. Er verschlang das Notfutter hastig, mit andauernder Wut in der Kehle und auch woanders, vielleicht immer noch auf die fremde Frau. Oder auf den altersblöden Kerl, der er war und der möglicherweise den Eindruck von einem tadellos Edlen erwecken mochte, wenn die nun mit Ungeduld Erwartete demnächst doch noch erschiene. Dieser ketzerische Gedanke gegen sich selbst ließ den Druck in ihm schwinden und erheiterte ihn beinah. So lächelte er. Nur, es war, zugegeben, ein müdes, trauriges Lächeln.
Die Besitzerin blieb weiterhin aus. Also beschloss er nach wiederholtem Gähnen, ins Bett zu gehen. Und tat es auch, zögernd und immer noch horchend auf jedes Geräusch im Raum. Im Bett merkte er, wie geschafft er war. Im Kreuz, in den Knien und Arm- und Handgelenken – überall war Schmerz. Es dauerte lange, bis er endlich einschlief. Dabei mochte ein Teil seines Bewusstseins wachen, falls sich das ungeduldig erwartete Klopfen an der Tür doch noch ergäbe. Der Schlaf hatte sein Opfer fest im Griff und lag steinschwer auf ihm. Beim Erwachen konnte er sich an keinen Traum erinnern.
Da fand sich der Mensch in hellem Tageslicht wieder, und gleich fielen ihm das Schaf und seine Besitzerin ein. Erst nach einem gewissen Zögern öffneten sich seine Sinne für die durchdringende tierische Stimme, das stumme Zusammensinken des Hammels, dessen hügeligen, friedlichen Leib, dann die glänzenden Eingeweide, die unter der Schneide des Messers aufquollen und im nächsten Augenblick auseinanderflossen, und schließlich der Riesenhaufen aus nichts anderem als Fleisch, Fleisch und nochmals Fleisch. Nun kam es ihm unwirklich vor – vielleicht war das alles geträumt? Hastig fuhr er aus dem Bett und trat aus dem Zimmer. Die ganze Küche und die halbe Diele starrten von rohem, aufeinandergehäuftem Fleisch. Erschüttert und angewidert schaute er darauf. Es war also doch kein Traum!
Während er sich von der Nacht sauber und wach rieb, beschloss er, gut zu frühstücken. Allen Fährnissen und Quernissen, die er in seiner knochigen Brust mit dem hämmernden Herzen spürte, zum Trotz. In flackernder Verbindung mit der Frau, die ihn mit so einer Last hat sitzen lassen und selber dann verschwunden war und deretwegen dieser lächerliche Alte, der er war, sich am Ende aus lauter Verzweiflung offensichtlich zu einer Tat hatte überwinden müssen, die in den Augen der heutigen Menschen bestimmt eine Straftat darstellte! Schließlich bereitete er sich tatsächlich ein fürstliches Mahl nach seinem Verständnis zu und versuchte, es in aller Ruhe und Behaglichkeit zu genießen.
Doch mit jedem Bissen, den seine wenigen Zahnstummel taten, schienen seine Sinne immer deutlicher zu spüren, wie das tote, rote Fleisch ihn von hinten und von der Seite anstarrte, als beschuldigte es ihn, dass es, aus einem herrlich lebendigen Tierkörper herausgeschnitten, nun da herumlag, werdender Müll, längst auf dem Weg zur Verwesung. Somit tauchte in einer hinteren Nische seines Hirns und leise eine Frage auf, die mit weiteren Bissen immer hörbarer zu werden schien, bis sie mit einem Mal die Stirnhöhe erreichte und anfing, laut zu pochen: Was soll mit dem vielen Fleisch geschehen, wenn die Frau weiterhin ausbleibt? Das war nun bei der Hochsommerhitze und in der stickigen Wohnung eine wichtige Frage. Ihm mit der nomadischen Erziehung tat es jedes Mal in der Seele weh, wenn eine Kleinigkeit in der Küche nicht mehr genießbar wurde und daher weggeworfen werden musste. Nun ein ganzer Hammel, großer Himmel! Und wenn dieser, so gewaltig an sich und dazu so mühselig zurechtgemacht, auch nur den kleinsten Schaden auf dem Weg zur menschlichen Nahrung nähme, wäre das nicht nur eine Dummheit, nein, es wäre glattweg ein Verbrechen!
Somit machte er sich daran, zumindest die Stücke, die schnell schlecht werden konnten, in den Kühlschrank zu stauen, wobei er sich in Gedanken schalt, es nicht schon in der Nacht getan zu haben. Und er ertappte sich bei dem Gedanken, fremdes Gut in einen so verborgenen Teil seines Haushalts wie in den Kühlschrank zu stecken, wäre wie der Anfang eines Diebstahls. Nun war das Allerempfindlichste dort, der Kühlschrank damit aber schon so gut wie voll.
Nachdem dies Notwendigste getan, nahm der Gedanke weiteren Lauf: Was, wenn sie gar nicht mehr zurückkäme? Das ließ den Mann erstarren: Das geht doch nicht, sie muss doch zu ihrem Eigentum zurückkommen! Doch sogleich fiel die Frage in einer genaueren, doppelten und dreifachen Fassung: Was, wenn ihr etwas zugestoßen ist? Ein Mensch kann doch plötzlich krank werden oder sogar sterben!
Das war zu viel! Eine Bewegung lief durch seinen ganzen Körper, als hätte in ihm etwas geknackt, und mit einem Mal kam ihm der vorherige Gedanke an das verderbende Fleisch nichtig und unverzeihlich töricht vor. Denn jetzt war ihm klar, dass der guten Frau, dem lieben Kind, ganz bestimmt etwas zugestoßen sein musste. Kein menschliches Wesen dürfte und könnte doch sonst so schändlich untreu sein Wort brechen und so sträflich grausam mit einem Mitmenschen umspringen, nein, selbst in der heutigen wirren Zeit nicht! Und das innerhalb eines Hauses, auch wenn dieses einander entfremdende, auseinanderdriftende Splitter einer gesprengten Welt beherbergen mochte!
Zwar hatte der Wert des Fleischs im Hirn des Mannes einen jähen Sturz erlitten, aber das vermochte dessen allzu wirkliche Gegenwart um ihn herum nicht zu vermindern. Im Gegenteil, nun schienen die Augen samt anderer Sinne dauernd an den sperrig-störrischen Häufungen zu kleben, als hätte das Unglück, das längst passiert sein musste, den Unwert des sündbehafteten Zeugs gesteigert. Am liebsten sollte man alles gleich aus dem Auge schaffen oder selber wegflüchten, um nicht fortwährend von dem grausigen Kram angestarrt zu werden. Was aber dann, wenn das Menschenkind doch noch käme?
Mit jeder Viertel-, halben und vollen Stunde, die verging, quälte er sich sinnlos weiter, und es verfestigte sich seine Einbildung, ihr sei etwas zugestoßen. Unbarmherzig fühlte er sich dem Ticken der Wanduhr ausgeliefert und in seine kleine Wohnungswelt eingeschlossen, die mit nichts anderem vollgestopft war als mit rotem Fleisch und nach nichts anderem roch und stank.
So verging der halbe Tag. Dann aber raschelte und klopfte es an der Tür! O wie hatte man darauf gelauscht und sich solches herbeigewünscht! Nun geschah es, endlich! Da war wieder ein leises, zaghaftes Klopfen. Man vernahm es sofort – nicht mit dem Ohr, sondern mit dem Herzen, denn dieses blieb einem für einen Lidschlag still stehen, hüpfte dann bis zum Hals und schien ganz herausspringen zu wollen. Man eilte hin und öffnete die Tür, wieder, ohne zu fragen. Und fuhr vor Schreck zurück.
Sie betrat die Schwelle zögerlich, machte einen schüchternen Schritt ins Wohnungsinnere und schloss die Tür leise hinter sich. Ihr Kopf war über das linke Auge mit einem breiten, weißen Band verbunden. Stummheit breitete sich im Raum aus – Stille war es nicht – und dauerte zwei, drei, vier Pulsschläge vielleicht. Dann ein gleichzeitiger und beiderseitiger Gefühlsausbruch, genauso heftig und diesmal echter als echt. Nun waren es Tränen, die aufschossen, bei ihr aus unverhoffter Freude, bei ihm aus Schreck und Mitgefühl zunächst. Dann ebenso aus Freude, ja, vor allem aus Freude, darüber, dass sie trotz des Schadens, den man ihr ansah, am Leben geblieben war und es geschafft hatte, wieder über die Schwelle zu treten, hinter der sie so lange und so sehr erwartet worden war!
Zuerst war er es, der aufhörte zu weinen. Sie aber ließ ihren Tränen Zeit, ließ sie ungehindert und ausgiebig strömen, stellvertretend für die Worte, die sie sonst hätte aussprechen müssen. Denn seitdem sie ihn mit dem Hammel zurückgelassen hatte, hatte sie keinerlei innere Ruhe mehr gehabt. Sie hat ja gewusst, wie es dem betagten Menschen in der Wohnung mit dem lärmenden Hammel gehen würde, und hat sich beeilt. Und als ihr das Missgeschick passierte und sie wusste, so schnell würde sie nicht zurückkehren können, war sie sich wie eine Betrügerin, ja eine Verbrecherin, wie eine Tier- und Menschenschänderin vorgekommen. Dabei hat sie während der vielen Stunden die klagende Stimme des gepeinigten Tierwesens im Ohr und die Mühen des dem ausgelieferten Menschen auf ihrem Gewissen gehabt. Zum Schluss hat sie von dem wildfremden Mann, den sie in so eine missliche Lage gebracht hat, erwartet, er würde sie anschreien oder sogar ohrfeigen. Was ihr auch recht gewesen wäre. Aber was erwartete sie stattdessen?
Der Hausherr, der sich gefasst hat, stützt sie, die nicht aufhören kann zu weinen, mit der Handfläche sanft am Ellbogen und führt sie in die Küche. Sie geht willig mit und nimmt Platz, ohne erst aufgefordert zu werden. Schnell greift er nach einer Schale, füllt sie mit dampfheißem Milchtee aus der Kanne auf dem Herd und reicht sie ihr beidhändig. Wie gut, denkt er dabei, dass frischer Tee gekocht ist! Das hat man in der Hoffnung getan, sich vielleicht für eine Weile von den unerträglichen Gedanken ablenken zu lassen. Nun aber meint man, sie ist gerade zum Tee erschienen – ein sehr gutes Omen! Und sie, die die Gabe mit Dankesgeste entgegennimmt, schlürft gleich den ersten Pflichtschluck. Dann stellt sie die Schale auf den Tisch und weint weiter, ungehemmt, und dabei rollen ihr die Tränen in perlengleichen Kügelchen über die Wange.
Der Hausherr schweigt und hält sich, während er seinen Tee laut und bedächtig schlürft, an die Worte: Frag Weinende nicht! Dabei denkt er: Tränen kommen auch aus dem verbundenen Auge, also darf es nicht allzu sehr beschädigt sein! Was seine Seele mit einer gewissen Freude anhaucht. Auch findet er es eigentlich wunderbar, dass sie in diesem Augenblick, zwar weinend, aber quicklebendig neben ihm sitzt, in seinen vier Wänden, und seine vom Geruch eines gepeinigten Tiers und dessen rohen Fleischs betäubte Nase erfüllt und belebt mit ihrem jugendlich-weiblichen, lieblich frischen Duft.
Irgendwann sagt sie, noch schluchzend, aber mit der befreiten Stimme Ausgeweinter: »Verzeiht mir, lieber Mann, alles … Zuerst die Tränen … Ich war einfach so erleichtert beim Anblick des Fells und des Fleischs … Ihr seid ein weiser, lieber Mensch und habt die richtige Entscheidung getroffen … Ich finde einfach keine Worte, die ausdrückten, wie dankbar ich Euch bin …«
Da eilt er ihr entgegen: »Ach, Kind. Wenn du wüsstest, welche Last du mir mit diesen Worten abnimmst! Denn ich war mir nicht sicher, ob ich richtig gehandelt habe. Nicht die Güte, nicht die Weisheit war es, ich musste es einfach tun, wegen der zimperlichen Nachbarn und des armen Tierwesens und nicht zuletzt wegen meiner eigenen Ruhe. Nun aber bin auch ich erleichtert!«
Mit dieser ersten ungeschminkten Entladung von Gefühlen von zwei Seiten wurde der Weg eröffnet zum dauerhaften Austausch von Freuden und Kümmernissen zweier Hoffender und Wartender. Weitere Aussagen entfalteten sich Wort um Wort zu einer offenherzigen Unterhaltung, die in Richtung späterer Bekenntnisse und Eingeständnisse zielte und dabei beiden schon so manchen Druck von der gequälten Seele nahm.
Bald wusste man, wen man vor sich hatte. Er hieß Nüüdül und sie Dsajaa. Er fand ihren Namen gut, wegen der Kürze. Sie äußerte sich zu seinem ähnlich erfreut, aber ausführlich und leidenschaftlich, was dem Zuhörenden erst einmal Kopfzerbrechen bereitete, aber ihren Wert in seinem Bewusstsein noch mehr steigerte: »Ach, wie schön! Weder ein tibetisch-buddhistischer Zungenbrecher noch einer von den chinesisch-kommunistischen Seelenschrubbern, sondern eine urige Benennung, leise im Laut, gewichtig im Gehalt und hervorgegangen aus einer nomadisch-mongolischen Bewandtnis – Ihr seid während eines Umzugs geboren worden, nicht wahr?«
»Wohl ja, wenn einer so heißt.«
»Doch nicht jedes Menschenkind, das während eines Umzugs das Licht der Welt erblickt, ist mit dem Glück gesegnet, diesen Namen zu bekommen und ihn ein Leben lang zu tragen. Stammt es von Eltern ab, die sich für den safrangelben Glauben ereifern, könnte es ja schnell mit einem Zungenbrecher wie Dshugderdemtschikragtschaa beladen werden. Oder bei Leuten, deren erklärter Glaube der Unglaube ist, zugesetzt mit den verherrlichten Götzen Gewalt, Besitz und Fortschritt, könnte so ein Sprössling einen stechend oder schneidend rauen Namen mit dem chinesischen Gang, Stahl, aufgebrummt bekommen!«
Diese Worte, gegriffen aus einer gewissen Höhe, verunsicherten ihn für einen Augenblick. Er versuchte, dies mit ihrer Bildung und Stellung in Verbindung zu bringen, und fragte sie nach ihrer Arbeit.
Ihre Antwort darauf fiel kurz und einfach aus: »Sekretärin.«
Und er fragte nicht weiter nach.
Nüüdül, der Mensch mit Lebenserfahrung, hatte es fast richtig erraten: Der Hammel war der Hauptpreis von einer Spielerei im Fernsehen gewesen. Sie hatte sich daran beteiligt und angeblich alle Fragen richtig beantwortet. Dem Fahrer vom Fernsehen, der sie nach der Sendung mit ihrem Gewinn heimzufahren hatte, fiel anscheinend nicht ein, der fettpralle Hammel könnte für die schmächtige Frau zu schwer sein, denn er ging gleich weg, nachdem er die sprudellebendige Last bis an die Tür der Fahrstuhlkabine geschleppt hatte. So fuhr sie, den Hammel zurücklassend, schnell hinauf, um Hilfe zu holen, aber niemand öffnete ihr die Wohnungstür, sosehr sie klingelte und pochte; und ihren eigenen Schlüssel fand sie in der Handtasche auch nicht! Das war zwar merkwürdig, doch nicht bedenklich. So begab sie sich zurück nach unten und wartete dort mit dem Hammel auf die Rückkehr ihres Mitbewohners, da sie annahm, er hätte sich nur kurz aus dem Haus begeben.
Später, nachdem sie den Hammel in der fremden Wohnung gelassen hatte, fuhr sie wieder hinauf, drückte ihr Ohr ans Schlüsselloch und lauschte, da ihr mittlerweile alles irgendwie verdächtig vorkam. Und bald vermochte sie deutliche Geräusche und sogar menschliche Stimmen wahrzunehmen. Nun fing sie an, minutenlang zu klingeln und an die Tür zu pochen. Doch nichts half. Da nannte sie den Mitbewohner beim Namen und rief, sie würde gleich die Polizei herbeiholen. Worauf plötzlich die Tür aufging, hinter welcher Dunkelheit gähnte. Sie trat ein und tastete nach dem Lichtschalter. In diesem Augenblick spürte sie einen Schlag im Gesicht, und eine grelle Flamme nahm ihr die Sinne. Die große, stille Finsternis schien sie zu verschlucken.
Wie lange sie weg war, konnte sie nicht erinnern. Als sie zu sich kam, lag sie in ihrem Bett, halb ausgezogen, mit einem brummenden Schädel und einem zuckenden, brennenden Auge; neben ihr lag jemand, wohl auf dem Rücken und mit ausgebreiteten Armen, denn dieser schnarchte donnernd laut, und ein süßlich herber Fuselwind wehte sie von der Seite her an. Ihr wurde speiübel. So wälzte sie sich vom Bett, tastete sich ins Badezimmer und übergab sich über dem Toilettenbecken. Dann sah sie sich im Spiegel an und erschrak. Eins ihrer Augen war geschwollen, und die Gesichtshälfte sah tiefrot und entstellt aus. Eine Weile vermochte sie nur stoßweise zu atmen. Da fiel ihr der Hammel ein, und dabei entfuhr ihrer Brust ein lang gezogenes Winseln. Sie horchte, dann trat sie an die Wohnungstür, um hinauszulauschen. Doch die war abgeschlossen, und kein Schlüssel hing daran.
Sie überlegte. Ins Schlafzimmer wollte sie nicht wieder. Sie wollte sich im Nebenzimmer auf die Liege setzen und darüber nachdenken, was zu tun wäre. Aber als sie die Tür aufstieß und das Licht anschaltete, schrak sie zusammen und schaltete es gleich wieder aus. Denn dort lagen Menschen. Später, erneut im Bad, am Rand der Badewanne, versuchte sie, sich an das zu erinnern, was sie dort erblickt hatte. Es waren drei Personen, zwei Frauen und ein Mann. Und sie sahen nicht aus wie normale, schlafende Menschen. Sie lagen quer und längs herum und erinnerten an eine Gewaltszene aus einem Film. Und nach Verwüstung hatte das ganze Zimmer ausgeschaut. Jetzt fielen ihr noch der von Alkohol und Tabakrauch geschwängerte widerliche Geruch der Raumluft ein und das voll tönende, vielstimmige Geschnarche.
Sie tastete sich in die Küche und setzte sich dort in die Polsterecke. Dabei vermied sie es, Licht anzumachen, da sie ahnte, was sie auch dort anstarren würde: ein weiteres grausiges Bild der Verunstaltung. In immer neuen Schüben flossen ihr die Tränen, die seit ihrem Blick mit dem fürchterlichen Gesicht in den Spiegel aus ihr geströmt waren. So saß und flennte sie eine ganze Stunde oder länger, kehrte aber dann doch in ihr Bett im Schlafzimmer zurück. Sie musste, da ihr der Kopf so entsetzlich schmerzte, dass sie fürchtete, von Neuem in Ohnmacht zu fallen. Aber sie wollte es auch, wollte wieder neben dem Unmenschen liegen, sich unter seinem Schnarchen quälen und von seinem Gestank weiterhin anekeln lassen – so wollte sie sich strafen für die vielen Dummheiten, die sie in ihrem bisherigen Leben begangen hatte. Vor allem wegen ihrer letzten, so offensichtlichen Dummheit, auf die klebrig süßen Worte und die ruppige Männlichkeit eines solchen Rohlings abermals hereinzufallen, nach allem, was sie von solchen Typen hatte erfahren müssen. Ja, sie war durchaus gewillt, sich für ihre Einfalt und Lüsternheit mit härtester Bestrafung zu quälen!
Gedacht, geschehen. Was sie dann auszuhalten hatte, war schlimm. Doch es hätte ihre Seele noch rauer treffen können, hätte in ihr nicht der Wille zu einer selbst auferlegten Strafe gepocht. So lag sie stundenlang wach und täuschte Schlaf vor. Irgendwann erhob sich der Mitbewohner und verschwand im Bad. Später waren auch Geräusche und Gepolter von anderen zu vernehmen. Dann waren sie offenbar alle in der Küche versammelt und lärmten lange dort. Vielleicht tranken sie wieder Schnaps, wie alle Säufer es Morgen für Morgen gegen den Katzenjammer tun. Schließlich schwappte der Lärm in den Flur hinüber, die Tür wurde aufgeschlossen und die Fremden hinausgelassen. Darauf krachte das Türschloss wieder zu, sogar das Herausziehen des Schlüssels war zu hören.
Der Mitbewohner betrat eine ganze Weile später das Schlafzimmer. Sie hielt auch das gesunde Auge geschlossen und verharrte still. Er blieb am Bett stehen und fragte leise, ob sie noch schliefe. Sie witterte den stechenden Alkoholdunst und antwortete nicht sogleich. Nach etlichen Pulsschlägen sagte sie leise: »Mir droht der Schädel zu platzen, ruf mir den Notarzt.«
»Es tut mir leid, bitte, verzeih und versteh es richtig, ich war wohl in der Nacht besinnungslos betrunken, da wir zwei Geburtstage auf einen Schlag gefeiert haben«, sagte er.
Sie ging nicht darauf ein und fuhr leise, aber bestimmt fort: »Ich sterbe wohl. Wenn ich sterbe, gibt es jemanden, der mich gesehen und gehört hat, als ich dich in der Nacht an der Tür beim Namen rief. Es wäre wohl das Beste für dich, wenn du jetzt wenigstens den Notdienst benachrichtigen würdest!«
Er hörte schweigend zu und ging aus dem Zimmer. Kurz darauf hörte sie ihn mit jemandem telefonieren. Es schien endlos zu dauern, bis es an der Tür läutete, vielleicht waren aber auch nur ein paar Minuten vergangen. Denn der Arzt oder der, der den Arzt spielte, war aus demselben Haus, wie sie aus den nebenan gewechselten Worten verstand.
Der junge Mensch in kurzen Hosen, einem grell beschrifteten Sporthemd und mit einer kleinen Metallkiste in der Hand rief verwundert am Bett: »Hei, es sieht ja richtig schlimm aus! Was ist denn passiert?«
Sie antwortete leise: »Bin letzte Nacht überfallen worden.«
Der Mensch kniff die Augen zusammen und wollte sie wohl weiter ausfragen, schien sich aber dann zu besinnen. So schwieg er und legte ihr stattdessen seine Hand auf die Stirn und die Schläfe, schüttelte den Kopf, schwieg jedoch weiterhin. Dann fing er an, sie zu verarzten, indem er die Schmerzstelle mit einer angenehm kühlen, wohlriechenden Flüssigkeit wieder und wieder bestrich und anschließend einen Verband darüberlegte. Nun sagte er, an den Mitbewohner gewandt, der stumm zugeschaut hatte: »Sie hat eine Gehirnerschütterung und hohes Fieber. Du kommst gleich mit. Ich habe zu Hause eine echt amerikanische Kühlhaube, die bekommst du leihweise bis morgen und setzt sie ihr gleich auf!«
Dann verließ er den Raum, und jener ging mit. Die Tür fiel zu. Kein Schlüsselgeräusch war zu hören. Mit pochendem Herzen erhob sie sich, zog sich schnell an und eilte zur Tür, die tatsächlich nicht abgeschlossen war! Sie nahm die Treppe und ging so schnell, wie ihr schmerzender Kopf es erlaubte. Dabei betete sie, dass jener ihr nicht entgegenkäme! Und überlegte, was sie tun sollte, wenn doch: Kämpfen! Sich mit Händen und Füßen, mit Fingern und Knien, Krallen und Zähnen zur Wehr setzen! Sie würde es können und müssen! Denn vor nicht allzu langer Zeit hatte sie einen Lehrgang zur Selbstverteidigung mit anderen jungen Frauen abgeschlossen. So wusste sie wenigstens theoretisch, wie sie sich gegen einen männlichen Gewalttäter, von Natur aus größer gebaut und stärker ausgerüstet, durchzusetzen habe: Ihm mit zwei gerade gestreckten, gespreizten Fingern in die Augen stechen! Mit einem Knie ihm von unten her zwischen die Beine fahren! Ihn mit der Handkante an der Kehle oder der Schlagader unterhalb der Schläfe erwischen! Sich ihm an der Gurgel, der Nase oder am Ohr festbeißen! Seine beiden Augenbrauen gleichzeitig zerkratzen, dass strömendes Blut die Augenlichter trübte! Und wenn das alles nicht hilft und man doch überwältigt wird, dann: Schreien! Brüllen! Tun, dass man gehört wird!
O ja, sie war entschlossen wie nie in ihrem bisherigen Leben, sich kämpfend durchzusetzen gegen die brutale Macht eines unwürdigen Mannes! Denn sie war in ihrer weiblichen Liebe, in ihrer menschlichen Würde erniedrigt und beschädigt worden, und so war sie nun die sprichwörtliche verwundete Tigerin! So würde sie auch, wenn das zweibeinige Raubtier ihr in diesem Augenblick begegnete, all ihr Kopfwissen und all ihre Muskelkraft zu einem Ganzen zusammenrufen, auf dass es zu einer durchbohrenden Spitze gefeilt, zu einer aufreißenden Schneide gewetzt, mit dem Salz ihrer Tränen, der Galle ihrer Verbitterung und dem Gift ihres Hasses getränkt, gegen jenes Biest eingesetzt würde! Doch dazu kam es nicht. Sie vermochte ungestört das Erdgeschoss zu erreichen, an die Tür heranzutreten und anzuklopfen.
Nüüdül kauerte mit geducktem Kopf, gesenktem Blick und musste die zittrigen Lippen angestrengt gegeneinanderpressen, da es ihm die Kehle zuschnürte, in der Nasenwurzel schmerzte und an den Augenrändern kribbelte. Dabei wusste er, dass er als Hausherr auf den ungeschminkt offenen, empörend schaurigen Bericht Dsajaas, dieses leidgeprüften Wesens, etwas sagen und ihr als gereifter Mensch mit Lebenserfahrung einen Rat geben sollte. So fand er nach einer Weile endlich die Kraft, es zu tun.
»Das Wichtigste ist, mein Kind, du bist mit dem Leben davongekommen. Und jetzt werden wir gemeinsam überlegen, was zu tun ist«, sprach er.
Damit war vielleicht nicht viel gesagt, aber es half. Ihr, die nicht wusste, was nun geschehen würde, nachdem sie ihre gewagte Beichte der längst geschehenen, schwerwiegenden Versäumnisse abgelegt hatte für eine erhoffte, nachträgliche Vergebung. Ihm, der nicht erst zu überlegen brauchte, ob er einem Menschenkind in Not beistehen wollte, der aber nicht wusste, wie weit er mit diesem Beistand gehen und wie nah er dabei an jenes Menschenkind treten dürfte. Auch halfen die recht allgemeinen Worte dem Zwiegespräch, das gerade hätte lossprudeln sollen, aber mit einem Mal ins Stocken geraten war.
»Ja, es ist wahr«, sagte Dsajaa nachdenklich, »ich darf froh sein, dass ich mit dem Leben davongekommen bin. Nun hätte ich eine Bitte an Euch: Würdet Ihr mich bitte noch ein paar Stunden in Eurer Wohnung beherbergen? Erst bei Einbruch der Dunkelheit werde ich mich aus dem Haus stehlen.«
Nüüdül hob den Kopf und blickte sie scharf an. Sein sonst gutmütiger Blick aus den schafbraunen Augen war eine Frage: Wohin denn?
»Vielleicht fahre ich zu einer Freundin, die im Vorort wohnt«, sagte sie kleinlaut.
Er duckte sich mit dem ganzen Oberkörper, als hätte ihn ein Schlag getroffen. Dann schüttelte er leise den Kopf und sprach: »Nein. Du bleibst hier. In dieser Wohnung. Bis der Kerl aus der deinigen rausgeschmissen und ihm jeder Weg zu unserem Haus durchkreuzt ist.«
Das war nicht sonderlich laut gesprochen. Aber die Stimme klang fest, jeder Satz zog eine Atempause nach sich, jedes Wort fiel mit fester Betonung, was sie wissen ließ, es duldete keinen Widerspruch. Und noch ehe sie zu Wort kommen konnte, fuhr er fort. Und diesmal war es eine Frage: »Die Wohnung gehört doch dir?«
»Ja«, antwortete sie leise.
»Na, siehst du? Aus den eigenen vier Wänden flüchten, das geht nicht!«
Sie wollte ihm entgegnen, sie würde auf alles verzichten, könnte sie sich dafür nur von dem fiesen Kerl trennen. Doch nachdem sie die fast leisen, aber so bestimmt klingenden Worte dieses ausgereiften Menschen gehört hatte, schwieg sie lieber und wartete, was noch käme. Und es kam bald.
»Ich kenne einen Polizeioberst, den ich für einen der letzten echten Menschen in diesem Land halte und dessen Grundstück unweit der Stadt ich seit vielen Jahren verwalte. Ich werde zu ihm gehen und ihn um Rat fragen.«
Er machte sich tatsächlich auf den Weg – und kam bald wieder zurück. Sie erfuhr, dass der Oberst nicht da war, aber durch den Assistenten benachrichtigt würde, dass sein Gärtner dringend Hilfe brauche.
Bei seiner Rückkehr sieht Nüüdül Unglaubliches: Dsajaa, die er für ein erhabenes Wesen gehalten und seit wenigen Stunden als Notleidende bei sich beherbergt hat, ist daran, die Schlachthaufen auseinanderzunehmen, das Fleisch zu schnetzeln und eine erste Menge davon in dem größten Topf, der da ist, im eigenen Saft zu kochen.
»Was machst du, Kind?«, ruft er halb erschrocken, halb begeistert.
»Nachdem ich gesehen habe, dass der ohnehin kleine Kühlschrank schon voll ist, habe ich gedacht, man kann das viele Fleisch nur als Schuuz retten«, antwortet sie sachlich.
»Also bist du doch ein Nomadenkind vom Land?«
»Ja. Bis vor zehn Jahren habe ich in der südlichen Gobi Schafe gehütet und Ziegen gemolken.«
Da schaut er sie sprachlos, mit funkensprühendem Blick an und gesellt sich zu ihr, und so werken sie zu zweit. Was ihm ein unnennbares Wohlbehagen bereitet! In dieser Hochstimmung legt er die Knochenstücke, deren Fleisch schon heruntergeschnitten ist, in einen weiteren Topf, füllt ihn halb mit kaltem Wasser, stellt ihn auf den Herd und spricht: »Das wird eine kräftige Brühe geben!«
Da sagt sie: »Gebt doch den vielen Knochen eins der Schulterblätter mit den vier hohen Rippen bei!«
Er stockt kurz, sagt aber nichts und tut, wie ihm geheißen. Dabei glaubt er zu ahnen, wozu, doch er unterdrückt das Gefühl, indem er sich im Stillen einen törichten Alten schilt: An die Möglichkeit, das viele Rohfleisch zu Schuuz zu verarbeiten, hatte er mit seiner gegerbten Haut und seinem ergrauten Haar nicht gedacht, sie trotz ihrer Jugend und der zehn Jahre in der Stadt aber schon.
Stunden später ist die schweißtreibende, beflügelnde Arbeit getan. Die Haufen rohen, roten Fleisches, die die enge Wohnung halbwegs gefüllt und deren ohnehin schwüle Luft verpestet haben, sind verschwunden und haben sich verwandelt in eine geordnete Menge abgetrennter Knochenstücke und eine gebändigte Fülle duftender Fertignahrung, so weit zusammengeschrumpft, dass sie in zwei schafmagengroße Behälter hineinpasst. Da ist auch die Brühe längst fertig und scheint ungeduldig darauf zu warten, dass man sie endlich kostet und rühmt, wie sie es wohl verdient.
Nun ist der Augenblick gekommen, und er erweist sich als hoch feierlich und ein wenig knifflig, für ihn wie auch für sie. Denn er meint, sie sei es, die ihn verköstigt, da das Fleisch ihr gehört, während sie denkt, er sei es, der sie bewirtet, da es seine Wohnung ist. Freilich merkt sie, dass bereits eine unverzeihliche Entgleisung passiert ist, mit dem Schulterblatt und den vier hohen Rippen, weil durch ihre bestimmende Art der Eindruck erweckt worden sein müsste: Sie sei die Person, die über das Fleisch zu entscheiden habe! Dabei hat sie in Gedanken den ganzen Hammel längst dem Menschen überlassen, den sie damit überfallen und dessen Ruhe sie dadurch folgenschwer gestört hat. Und es ist lediglich ihr Wunsch gewesen, dem lieben, weisen Menschen die Ehre zu erweisen, indem gerade die beiden Stücke, die in der nomadischen Küche seit alters her etwas Erhabenes darstellen, nun ihm vorgesetzt werden!
Wie gut, dass das ungeschriebene Gesetz über das Vorrecht des Alters immer noch wirkt! Denn in Hinblick darauf, wer zu sitzen und wer zu arbeiten hat, gibt es keine Fragen, wenn es darum geht, das fertig Gekochte aus der Brühe zu fischen, in eine flache Schüssel zu legen und zur Essecke zu tragen. Sie tut das alles. Und er hockt, gefasst, als komme er einer Pflicht nach, am kniehohen Tisch, schaut ihr andächtig zu und begleitet sie bei jeder ihrer Bewegungen mit einem halb entzückten, halb bestürzten Blick.
Als die beiden einander gegenübersitzen, getrennt durch den schmalen Tisch und verbunden durch die Dampfwolke, redet Dsajaa. Sie klärt ihn über ihre Entscheidung wie auch über ihre Entgleisung auf.
Nüüdül hört ihr aufmerksam zu, erhebt aber sogleich Widerspruch: »Früher, in meiner Heimatecke, habe ich einen mittellosen Witwer gekannt, der viele Jahre lang Tag um Tag mit nichts anderem beschäftigt war, als Tiere für die Kreisgaststätte zu schlachten. Der Lohn für sein blutigtes Handwerk bestand aus dem, was über den Rumpf und die Haut des jeweils Gefällten hinaus abfiel. Das waren das Blut, die Eingeweide, der Kopf und die vier Spitzbeine. Diese galten in unserer satten, übermütigen Ära damals als Abfall, da ihre Bearbeitung zu Nahrung mühevoll war, also durfte er das alles behalten. Und davon ernährte er sich und seine Kinder. Wenn du also darauf bestehst, Kind, will ich dem Beispiel jenes Mannes folgen. Das gute Fleisch aber nimmst du zu dir, sobald du wieder in deine Wohnung darfst.«
Die Stimme wirkt weder überlaut noch überstürzt, trotzdem so bestimmt und gewichtig im Klang, als duldete sie keinen Widerspruch. Doch wagt sie diesmal, sich ihm zu widersetzen, indem sie sich genauso sanft, aber mit einer unverkennbaren Entschiedenheit zu Wort meldet: »Das Fleisch wird hierbleiben. Ich werde kommen und es mit Euch teilen. So habe ich einen Grund, Euch immer wieder zu besuchen. Und auf diese Weise auch die kleinen Freuden und Kümmernisse des Tages und der Stunde mit Euch zu teilen. Nun aber fangen wir endlich an. Das Schulterblatt, begleitet von den vier hohen Rippen, ist für Euch. Bitte, greift zu!«
Nach solchen Worten immer noch den Besserwissenden herauskehren zu wollen? Nein, so ein Dummkopf ist Nüüdül nicht. Sogleich greift er nach dem Messer, das, sauber gewaschen und blank gewetzt, längst dagelegen, und macht sich an die Schüssel heran. Seine freie linke Hand berührt das Schulterblatt zuerst sanft, eh sie es der Schüssel entnimmt. Darauf fährt das Messer in der Rechten bedächtig am Rand des viereckigen Brockens entlang und schneidet eine dünne Fettscheibe herunter, die in die Schüssel fällt. Dieser folgt eine zweite. Die dritte schließlich, nun noch dünner und fast gänzlich aus Fleisch, wird aufgefangen von drei Fingern und in sachter Bewegung endlich in den Mund geschoben.
Dsajaa schaut dem wie gebannt zu und versucht sich zu erinnern, ob die ehrwürdigen Männer mit den versilberten Haaren und gezeichneten Gesichtern bei ihr zu Hause auch so mit dem Hammelschulterblatt verfuhren. Es fällt ihr nicht ein, doch glaubt sie, den dahintersteckenden Sinn zu erahnen. Die Scheiben, heruntergeschnitten und unberührt gelassen, dürften für die Geister gedacht sein, vielleicht für den des Herdes, der sich in dieser neuzeitlichen Stadtwohnung als ungeeignet erweist für die herkömmliche Art der Bewirtung durch Verbrennung.
Während Nüüdül der ihm erwiesenen Ehre nachkommt, indem sein Mund den ersten Bissen mit der umständlichen Gründlichkeit bejahrter Menschen kaut, arbeitet seine Hand an dem Brocken weiter. So wird eine weitere, diesmal etwas dickere Scheibe abgetrennt, die zwischen Daumen und Messerklinge kleben bleibt und dann sanft in die Kuhle der Handfläche gleitet. Schließlich wird sie, begleitet mit einer feierlichen Gebärde, vom Hausherrn an den Gast gereicht. Und sie empfängt die Gabe beidhändig und erfreut.