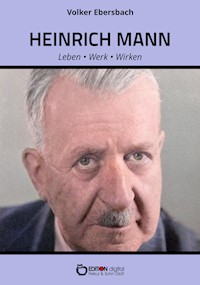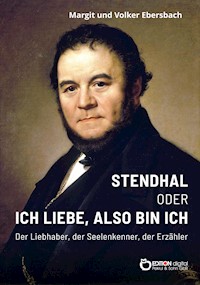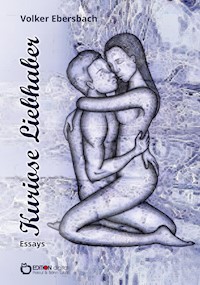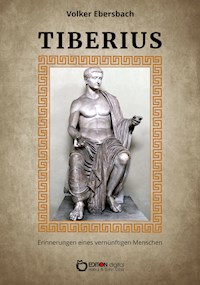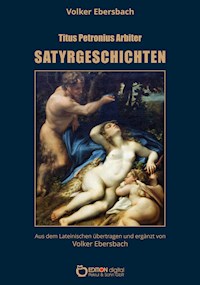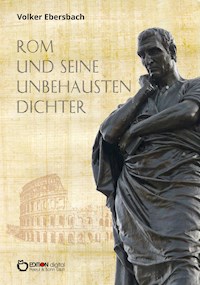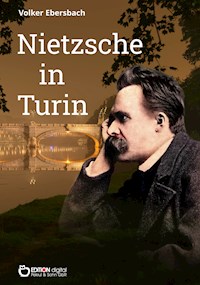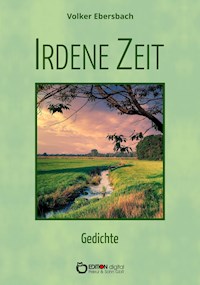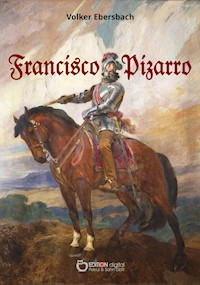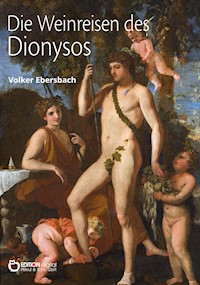10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Bücher von Volker Eberbach liest man immer mit Gewinn, man kommt aus der Lektüre informierter und wissender, ja fast schon gelehrter heraus als man hineingegangen ist. Das gilt auch für diese weltgeschichtlichen Begegnungen, über die der Autor in einem ebenso aufschlussreichen wie seine damit verbundenen Intensionen erhellenden Vorwort schreibt: „Zu den aufregendsten Momenten der Weltgeschichte gehören die, in denen zwei bedeutende Männer einander begegnen. Begegnungen brachten oft einiges zustande, nicht immer Gutes. Sie waren einmalig, oder sie wiederholten sich. Man ging voller Hochachtung auseinander oder im Zorn. Aus mancher Begegnung erwuchs ein schweres Zerwürfnis. Oft enthielt die Begegnung ein großes Versprechen; selten wurde es eingelöst. Oft bahnte sie eine besondere Chance an; meist wurde sie vertan. Die Beteiligten repräsentierten verschiedene Religionen oder unterschiedliche Staatsformen, einander entgegengesetzte Machtansprüche oder Kulturkreise, die lange voneinander nichts gewusst hatten, scheinbar verwandte Auffassungen von Kunst und gegensätzliche Ziele des Forschens. Am faszinierendsten wirken auf uns Heutige solche Begegnungen und Zerwürfnisse, in denen Geist und Macht aufeinandertrafen, Kontrahenten, wie Heinrich Mann sie in seinen Essays herausstellte“, wie der Heinrich-Mann-Biograf notiert. Greifen wir eine dieser Begegnungen der Weltgeschichte heraus, die von Friedrich dem Großen und Voltaire, dessen Biografie über weite Strecken die eines Flüchtlings ist, wie der Autor beweist: Verwandte Irrtümer können Freundschaften stiften. Klären sie sich nur einem der beiden Freunde auf, so kommt es zu tiefer Entzweiung. Aber löst man sich je voneinander ganz? Es ist das Jahr 1766. Das Zerwürfnis zwischen Voltaire und dem König von Preußen liegt dreizehn Jahre zurück. Seit acht Jahren lebt der früh gealterte, geistig jedoch immer wieder sich verjüngende Dichter und Philosoph auf seinem Gut Ferney nahe der Schweizer Grenze, auf dem Sprung, vor französischen Behörden zu den Calvinisten von Genf zu fliehen, deren Toleranz allerdings für einen ständigen Aufenthalt in ihren Mauern auch nicht weit genug geht. Auf einmal liegt der Gedanke nahe, sich nochmals nordostwärts auf die Reise zu machen, zu Friedrich II. nach Potsdam. Warum will der Hofnarr noch mal zu seinem König? Und was hatte eigentlich zu dem Zerwürfnis zwischen diesen beiden Aufklärern geführt? Es war ein doppelter Irrtum, wie Ebersbach aufklärt. Lesen Sie selbst. Es lohnt sich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Begegnungen der Weltgeschichte
ISBN 978-3-96521-727-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Ein Teil der Essays erschien 1994 bei Edition Leipzig .
Für Schneewittchen
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Der Essayist, der dem Gelehrten als eine Art Windbeutel gilt,
der seine Wesenheit aus dem bestreitet,
was für die gelehrte Produktion nur Abfall ist,
gilt auf der anderen Seite den Dichtern meist nur als Kompromiss,
als eine Brechung ihres strahlenden Wesens
im Dunste der gemeinen Rationalität.
Eines ist so beschränkt wie das andere.
Die Artikulation des Gefühls durch den Verstand,
die Wegwendung des Verstandes von den belanglosen Wissensaufgaben
zu den Aufgaben des Gefühls, das ist das Ziel des Essayisten.
Robert Musil (über Franz Blei)
Vorbemerkungen
WELTGESCHICHTE – welch ein großes, regalefüllendes Wort! Und hier soll ein einziger Band davon handeln? Dies ist nur in Ausschnitten möglich, die einzelne Persönlichkeiten herausgreifen. Aber lässt es sich rechtfertigen, dass Einzelne so weit in den Vordergrund treten?
Was in der Weltgeschichte geschieht, mag wohl das Zusammenspiel Vieler sein. Aber NICHTS geschieht, wenn nicht wenigstens EINER es tut, und NICHTS unterbleibt, wenn nicht wenigstens EINER es unterlässt.
Zu den aufregendsten Momenten der Weltgeschichte gehören die, in denen zwei bedeutende Männer einander begegnen. Begegnungen brachten oft einiges zustande, nicht immer Gutes. Sie waren einmalig, oder sie wiederholten sich. Man ging voller Hochachtung auseinander oder im Zorn. Aus mancher Begegnung erwuchs ein schweres Zerwürfnis. Oft enthielt die Begegnung ein großes Versprechen; selten wurde es eingelöst. Oft bahnte sie eine besondere Chance an; meist wurde sie vertan. Die Beteiligten repräsentierten verschiedene Religionen oder unterschiedliche Staatsformen, einander entgegengesetzte Machtansprüche oder Kulturkreise, die lange voneinander nichts gewusst hatten, scheinbar verwandte Auffassungen von Kunst und gegensätzliche Ziele des Forschens. Am faszinierendsten wirken auf uns Heutige solche Begegnungen und Zerwürfnisse, in denen Geist und Macht aufeinandertrafen, Kontrahenten, wie Heinrich Mann sie in seinen Essays herausstellte. Selbst wenn sich die Wege zweier Geistiger kreuzten, versuchte sich oft genug einer des anderen zu bemächtigen. Auch ihre Sympathien, Missverständnisse und Zerwürfnisse sind Abbilder der Kräfte, die in der Weltgeschichte wirken.
Die welthistorischen Begegnungen, von denen hier erzählt wird, sind unterschiedlich belegt. Ihre Überlieferung reicht vom Legendenhaften über die Geschichtsschreibung bis zu Tagebuchnotizen, Briefen, Protokollen und Erinnerungen. Aber ganz gleich, wie genau Einzelheiten wiederhergestellt werden können, die Pläne, Erwartungen, Ränke oder Illusionen der Gestalten, die da einander wirklich begegnet sind – immer machen sie Beispielhaftes spürbar, immer lässt sich ihre Gegenwart heraufbeschwören, immer gibt es Indizien, die sie uns vergegenwärtigen, und seien sie so schwach wie der Atem einer lautlos eingetretenen Person.
Diese Auswahl versucht, die Zeitepochen zu berühren, die mit wesentlichen Ereignissen die Welt von heute mitgeprägt haben, und über die Umrisse Europas, das nur Europäern als Mittelpunkt der Weltgeschichte erscheint, auf andere Kontinente hinauszugreifen. Der Welt von heute hat nun einmal Europa seinen Stempel aufgedrückt. Wie mit den außereuropäischen Regionen verhält es sich auch mit den Frauen. Die Auswahl der Gestalten, von denen die Rede ist, erweckt den Anschein, als habe die Weltgeschichte weitaus mehr bedeutende Männer aufzuweisen als Frauen. Die Männer selbst haben dafür gesorgt, wie Europa für die Europäisierung der Welt, und es wäre eine Verzerrung des Bildes, das uns die Weltgeschichte nun einmal liefert, wollte man daran durch einen hergeholten Ausgleich etwas ändern.
Wenn gleich zu Beginn ein Mann, kaum dass er einer schönen, verführerischen Frau begegnet, vor ihr geradezu zurückprallt, scheint die berüchtigte Gretchenfrage über den beiden zu schweben, wie sie es denn mit der Religion hielten. Es ist eine Zeit, in der sich der Gegensatz zweier Epochen und ihrer jeweiligen Gesellschaft in religiösen Bildern besonders ausdrückt, und diese Bilder haben bis auf den heutigen Tag wie lebhafte Träume das Handeln vieler Menschen bestimmt. Zu beweisen, dass es Gott nicht gibt, ist zu jeder Zeit ebenso schwierig gewesen, wie zu beweisen, dass es ihn gibt.
Welche Staatsform, welche Regierungsweise die beste sei, ist eine Frage, die schon sehr früh die Weltgeschichte bewegte. Wir zögern heute nicht zu antworten: Natürlich eine Demokratie! Die attische Demokratie, die sich die Athener verordneten, als sie die Machtpolitik des Adels satt hatten, erforderte, als es galt, sie nach außen und innen zu verteidigen, ihrerseits Machtpolitik. Solche Machtkämpfe schicken manchmal, weil in den Verteilungskämpfen Ehrgeiz, Egoismus, Habgier und Dünkel die Oberhand gewinnen und in Rivalitäten das Eigeninteresse höher veranschlagt wird als das Gemeinwohl, ehrliche, verdienstvolle Leute in die Wüste oder gar zum Feind, wie es Themistokles widerfuhr.
Philosophen hielten es immer wieder für möglich, dass wissende Leute den Mächtigen raten, wie sie ihre Macht besser, sagen wir, gerechter ausüben sollten. Sie meinten, die Wissenden hätten nicht nur ein Recht, ihr Wissen auszubreiten, sondern sogar die Pflicht dazu. Ist Wissen bei Mächtigen nicht besser aufgehoben als bei Ohnmächtigen? Die ersteren können etwas tun, und wenn sie in Bedrängnis kommen, hören sie zu. In der Weltgeschichte ist das selten vorgekommen. Nicht einmal Alexander hat seinen Lehrer Aristoteles ausreden lassen. Woran mochte das liegen? Zum Scheitern eines Mächtigen reizt es Wissende, im Nachhinein zu sagen: Siehst du! Hättest du auf uns gehört! Das alles haben wir dir vorausgesagt, und alle stünden jetzt besser da, hättest du unsere Lehre beherzigt.
Aber vielleicht stimmt an einer Lehre etwas nicht, wenn es dem, der sie verwirklichen könnte, nicht gelingt, sie zu beherzigen. Oder ist der rechte Gebrauch der Macht gar nicht lehrbar? Regeln Geld und Immobilien das Zusammenleben so unterschiedlicher Wesen, wie es die Menschen nun einmal sind, nicht viel besser? Die römische Adelsrepublik ist damit groß geworden: Nur wer reich ist, kann geben, nur wer etwas besitzt, kann eine Wirtschaft voranbringen. Einer Demokratie bekommt das allerdings nicht gut. Wo allein der Besitzende gibt und den, der weniger oder nichts besitzt, zum Nehmen verurteilt, schleicht sich unter die Nehmenden eine gewisse Bestechlichkeit, und der Satz aus Schillers Demetrius-Fragment fängt an sich zu bestätigen: dass die Mehrheit nur der Unsinn sei, weil der Bettler für Brot und Stiefel seine Stimme verkaufen müsse. Wahlen missraten so zu einem einzigen gesellschaftlichen Korruptionsskandal, nicht anders als in der Diktatur. Unter den Reichen greift bald dasselbe traumatische Sicherheitsbedürfnis um sich wie in autoritären Oberschichten. Platons Warnung, dass ein Bewacher das, was er bewacht, auch stehlen könne, erhält eine das ganze Staatswesen umfassende Dimension. Es ist die Stunde des politischen Banditentums, der Militärdiktatur.
Die römischen Kaiser, jeweils die vermögendsten Leute ihrer Zeit, haben das ihrem Imperium vorgeführt, und schon Tiberius, dem Nachfolger des Augustus, und der schönen Agrippina schlugen dabei die edelsten Vorsätze ins Gegenteil um.
Dass die Mächtigen und die Geistigen Bündnisse schließen, um einander zu helfen und zu korrigieren, erschien angesichts so fataler Entwicklungen immer wieder den letzteren als Chance. Gerade sie haben ja ein Interesse daran, sich in den Schutz eines Mächtigen zu begeben und dessen Tatkraft auf die Durchsetzung wenn nicht des Guten, so wenigstens des Besseren zu lenken. Aber solche Bündnisse währen nie länger als die Zwecke des Mächtigen. In Bedrängnis fragt ein Machthaber wie Theoderich nicht mehr nach den Wahrheiten eines Boethius. Beim geringsten Verdacht lässt er den Mann des Geistes fallen. Umgekehrt geht es selten – es sei denn, dass die Geistigen Priester werden und in das Gewand des Geistlichen schlüpfen.
Unter Berufung auf eine göttliche Autorität teilen sie sich dann die Macht mit den Mächtigen. Der Kaiser beschützt den Papst, und der Papst beaufsichtigt den Kaiser: Wenn der Handel aufgeht, bedeutet das zweifellos einen Fortschritt in der Moral des Herrschens. Aber wer lässt sich gern von dem beaufsichtigen, den er beschützt? Da haben wir wieder Platon! Und wenn der Geistige im Gewand des Geistlichen selbst zum Teilhaber weltlicher Macht geworden ist, sehen dann seine Mahnungen nicht den Drohungen eines Rivalen zum Verwechseln ähnlich? Zumal keine Seite den eigenen Maßstäben standhält, ihrem vereinbarten Auftrag treu bleibt. Der Wunsch nach Unabhängigkeit scheint jeder Seite unerfüllbar ohne die Forderung nach Vorrang. Dann heißt es doch wieder: Wessen Legitimation ist die höhere? Wer darf wen ernennen? Wer wen züchtigen? Und nur das drohende Chaos zwingt Todfeinde wie Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII. zu zähneknirschenden Kompromissen, die einen Konflikt nicht lösen, sondern verschleppen.
Manch einer kam aus seinem Dilemma, indem er einfach seinen Horizont erweiterte. Reisen bildet nicht nur, es hilft auch, sich selbst besser kennenzulernen. Diese Chance haben die Europäer, scheint es, wenig genutzt. Ehe sie sich anschickten, den Rest der Welt unter sich aufzuteilen, gingen sie in die Schule asiatischer Eroberer. Marco Polo und andere Händler traten auf Jahre in die Dienste der Mongolenherrscher, ohne sich an der Unterdrückung und Ausplünderung unterjochter Kulturvölker zu stoßen. Noch betrieben sie ihre Geschäfte als Forschungsreisende. Schon bahnte sich aber ein neues Zeitalter an, in dem Europäer den Rest der Welt entdeckten, ihrem Handel erschlossen und bald selbst als Eroberer kamen, ohne sich um die Kulturen zu kümmern, die sie auf ihrem Siegeszug zerstörten. Das war die Stunde, in der Franzisco Pizarro vor dem Inka Atahualpa stand.
So lernten die Reisenden zwar kaum sich selbst besser kennen, aber sie zeigten späteren Generationen die Wege zu anderen Menschen. Die Entdecker wollten einen sanftmütigen Glauben verbreiten und andere Weltteile zivilisieren, wurden aber Barbaren. Das zeigt, wie es Menschen immer wieder ergeht: dass ihre Entscheidungen ganz andere Folgen haben, als sie beabsichtigen. Hinter dem Mönch Martin Luther erhoben sich auf dem Reichstag zu Worms die Schatten der salischen Kaiser. Aber er sprach auch vor den leiblichen Nachfahren der Fürsten, die gegen sie rebelliert hatten. Luthers Standhaftigkeit vor Karl V. vermittelte den deutschen Fürsten, ob sie nun protestantisch wurden oder katholisch blieben, auch, dass es inzwischen leichter denn je möglich war, dem Kaisertum die Stirn zu bieten und eigene partikularistische Interessen vor die des Reiches zu stellen. Ein Mann des Geistes ermisst selten, welche Handhabe er Mächtigen gibt für geistfernes, geistloses Handeln. Sein streitbarer Geist muss nicht selten herhalten für blutigen Streit um andere Dinge.
Aber sein Wort bleibt immer ein Wagnis. Er darf nie die eigene Natur mit der eines Mächtigen verwechseln. Ein Zerwürfnis wie das zwischen Voltaire und Friedrich II. zeigt es: Wo der Philosoph sich im König, der König sich im Philosophen täuscht, liegen verwandte Irrtümer vor. Die Hoffnung der Aufklärer, ein Geist, dem Macht zufällt, und eine Macht, die sich mit Geist ausstattet, könnten bessernd auf den Gang der Welt wirken, verkehrt sich, sobald der Fall wirklich eintritt, ins Gegenteil. Warum? Gerade der Kopf, der die Macht hat, ist im Fall eines Konflikts weniger frei als der Ohnmächtige, der sich in ihren Glanz begibt. Rücksichten auf die Macht beschädigen also nicht nur die Freiheit des Geistigen, sondern auch den Geist des Mächtigen. So werden Macht und Geist einander nie ebenbürtig.
Aber einmal in der Weltgeschichte, schien es manchem, einmal verstanden sie einander in Harmonie. War es nicht eine klassische Begegnung, die zwischen Goethe und seinem Kaiser? Es kam nie zu einem Zerwürfnis. Und Napoleon sagte den Satz, der für alle Zeitalter der Weltgeschichte zutrifft: DIE POLITIK IST DAS SCHICKSAL!
Goethes Einvernehmen mit Napoleon hatte allerdings einen doppelten Boden. Der Dichter wurde keineswegs als gleichrangig behandelt. Dem Kaiser unterlief, wenn er über Dichtung sprach und aus ihr das Mahnende, das Tragische, verbannen wollte, jener im Grunde nur banale Satz, mit dem er, ahnungslos wie eine tragische Gestalt, sein eigenes Urteil fällte.
Auch unter Männern des Geistes werden Machtkämpfe ausgetragen. Nietzsche erlebte Wagner als den Älteren, Erfahreneren, an Lebensglück und Ruhm uneinholbar Überlegenen. Und die wertvollste Beute, über die zwei Männer sich entzweien können, ist das Weib. Nietzsche liebte Cosima! Die vermeintlich wertvollste Beute. Dahinter glühte der Wunsch des Jüngeren, des unscheinbaren Philologen, des verkannten Philosophen mit künstlerischem Anspruch, nicht nur als Theoretiker und Propagandist benutzt, sondern auch als Künstler ernstgenommen zu werden. Er war sich des künftigen Ruhmes bei weitem nicht so sicher, wie er es in ‚Ecce homo‘ mehr sich selbst als anderen zurief. Er neidete dem Opernfürsten, der höhere Gedankenwanderungen kaum nachvollzog, im Grunde nicht die Frau, sondern, wider besseres Wissen über den Wert des eigenen Werkes, den Glanz des raschen Erfolges beim Publikum.
Der rasche Erfolg beim Publikum! Ein anderer Wortlaut für die Formel vom „Willen zur Macht“, die Nietzsche so umstritten gemacht hat. Aber hatte er damit nicht Recht? Ging es nicht schon in seinem Zeitalter um die Weltherrschaft? Es ging um die Aufteilung der Welt, solange sie für keinen ganz zu haben war. Nur Afrika galt es noch aufzuteilen. David Livingstone und Henry Morton Stanley gehörten auch zu den Männern, deren Taten andere Folgen hatten, als sie beabsichtigten. Die beiden ergänzten einander auf fatale Weise: Der Forscher, der die weißen Flecke ausfüllen, der Missionar, der das Christentum verbreiten wollte, und ein Sensationsreporter, der nach Publikumserfolg jagte, Vorbote einer totalen Gegenwelt der Medien, für Funk, Film und Fernsehen nur zu früh geboren, arbeiteten dem Kolonisator vor, der die Landkarten ebenso brauchte wie den sanftmütigen Glauben und die Schicksalsergebenheit der Eingeborenen.
Es war fatal, und fatal ist nicht tragisch. Tragisch ist es, wenn jemand das, was er vermeiden wollte, gerade herbeiführt, und gerade mit den Mitteln, die es verhindern sollten. Das Scherbengericht über Themistokles, von dem wir eingangs sprachen, sollte Athen vor der Tyrannis bewahren. Aber es eröffnete die Tragödie der attischen Demokratie. Die modernen Demokratien hingegen, scheint es, sind nicht so zerbrechlich. Die Idee der parlamentarischen Demokratie hat in den drei großen Kriegen des 20. Jahrhunderts, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und im Kalten Krieg, triumphiert und setzt sich weltweit durch. Zweifelhaft bleibt aber, ob die Demokratie bei Supermächten besser aufgehoben ist als bei Stadtstaaten. Das Einvernehmen in den Begegnungen Roosevelts mit Stalin verriet die Ähnlichkeit der Bahnen, in denen an den Spitzen von Supermächten gedacht wird: Der wie selbstverständlich vorausgesetzte Vorrang in einer Region verbindet sich mit dem Anspruch, man vertrete mit den eigenen Interessen auch die der Vasallen und Klienten. Solange ein dritter Anwärter auf die Weltherrschaft, der gemeinsame Feind Deutschland, noch nicht kapituliert hatte, schien der Erdball genug Platz für zwei Supermächte zu bieten. Erst der Kalte Krieg sollte zeigen, dass es zum Wesen einer Supermacht gehört, keine andere neben sich zu dulden. Mag die eine Supermacht nun untergegangen sein – wir können die andere deshalb doch nicht als Sieger sehen.
Das Modell GEIST UND MACHT darf man nicht zu oft bemühen. Alles lässt sich damit nicht erklären, zu vieles lässt es offen. Nicht nur Roosevelt wurde von einem gewissen Charme des kleinen schnurrbärtigen Generalissimus geblendet. Heinrich Mann selbst hat sich in seinem kalifornischen Exil von diesem Modell in die Irre führen lassen. Als alter, geistig ausgereifter Mann, der die Welt gesehen hatte und nun sein ZEITALTER besichtigte, wollte er in dem Banditen Stalin unbedingt einen Intellektuellen erblicken, den Intellektuellen an der Spitze eines Staates, von dem Platon geträumt hatte. Haben nicht alle drei MACHT mit GEWALT verwechselt? Vielleicht ist MACHT etwas, womit die meisten Menschen einverstanden wären, ohne ihre Würde zu verlieren, ohne sich zu unterwerfen, etwas, das sich eben dadurch selbst legitimiert. Dient nicht GEWALT immer nur einer Vortäuschung von Macht? Ist nicht GEWALT das materialisierte Dilemma der Legitimation, in das sich Herrschende seit eh und je begeben? Schön wäre es, wenn der GEIST eine MACHT würde. Auch wenn immer irgendeine GEWALT versuchen wird, dies zu verhindern – soll sie darum das letzte WORT haben? Wer verfügt denn über das WORT, wenn nicht der GEIST?
Gott oder Götter?Joseph und Potiphars Weib
Die Geschichte der Menschheit wurzelt in Mythen. Herrscher und Helden, Götter und ihre Erdenkinder wachsen im Traumgarten des Mythos noch am selben Holz. Eine Geschichtsbetrachtung, die alles Mythische als erfunden abtäte, schnitte sich selbst von einem Teil ihrer Quellen ab. Mythologie wie Religionsgeschichte sind Bestandteile einer Kulturgeschichte, ohne die das Faktische nur schwer zu erklären, ohne die auch das Verbürgte nie ganz glaubwürdig wäre. Die Überlieferungen der ältesten Kulturvölker tragen über lange Zeitabschnitte mythische Gewänder. Ohne Zeugnisse aus Zeiten, in denen der HOMO SAPIENS Traum und Wirklichkeit weniger streng unterschied als heute, wüssten wir nichts von den Anfängen seiner Selbstverständigung als Individuum.
Wenn also am Anfang einer langen Reihe historischer Begegnungen zwei Menschen stehen, deren Namen uns nur durch mythisches Schriftgut bekannt sind, darf die Frage nach ihrer geschichtlichen Existenz zurücktreten. Denn es sind zwei Welten, zwei Kulturkreise, zwei Weltbilder, die jeweils einander verstehen oder verkennen, wenn sich zwei Individuen ergänzen oder entzweien.
1. Die Götter der Sesshaften
Die geistige Welt des Altertums wird von Götterscharen beherrscht. Wir kennen die olympische Götterfamilie der Griechen und Römer am besten, weil sie als letzte den monotheistischen Religionen erlag und seit der Renaissance den Europäern immer wieder in Erinnerung gebracht wurde. Doch den knapp zwei christlichen Jahrtausenden stehen mehr als dreitausend Jahre der Vielgötterei gegenüber. Zeus und Hera, Aphrodite und Apollon, die wir als starre Figuren aus Marmor oder Bronze sehen, sind späte Ausprägungen vielfach zusammengesetzter, allmählich verschmolzener Wesen, deren gemeinsames Merkmal die Unsterblichkeit war.
Wer vielen Göttern huldigt, ist duldsam gegen die Götter seiner Nachbarn und Gäste, seiner Gefangenen und Sklaven, nur nicht gegen die unbesiegter Feinde. Der Polytheismus ist im Allgemeinen tolerant. Die religiöse Weitherzigkeit der Antike ging so weit, dass in Rom, als ihm fast der gesamte bekannte „Erdkreis“ zu Füßen lag, „dem unbekannten Gott“ ein Altar geweiht wurde, damit kein Unsterblicher sich übergangen fühlte und etwa Unglück über die Stadt der Städte brächte. Die Neugier auf andere Götter hatte allerdings ein Ende, als Anhänger monotheistischer Glaubenslehren mit ihrem alleinigen Gott zum politischen Problem wurden. Sowohl Juden als auch Christen zogen im kaiserlichen Rom Verfolgungen auf sich, weil sie sich weigerten, einem verstorbenen und „vergöttlichten“ Kaiser göttliche Ehren zu erweisen. Der Polytheismus, hervorgegangen aus der Dämonisierung von Naturerscheinungen, offenbarte im Stadium des Verfalls seinen Zusammenhang mit der Staatsräson. Bei aller Duldsamkeit entsprach die Rangordnung der Götter der Ungleichheit unter den Menschen. Wo die Machtfrage unter den Sterblichen strittig wurde, hatten auch die Unsterblichen stets Machtkämpfe auszutragen. Kam es zu Abwehrkriegen und Eroberungszügen, kämpften die Götter mit um ihren Rang im Glaubensgefüge der Sieger und um die Vorrechte ihrer Priester. Im Frieden galt der freie Mensch als Sklave der Götter und als den Göttern verantwortlicher Gebieter von Sklaven. Die Freiesten der Freien, die Adligen, hielten sich für Nachfahren der Helden, die Götter mit Sterblichen gezeugt hatten. Aus dem ursprünglichen Erschauern der Menschen vor übermächtigen Naturgewalten war ein Instrument zur Legitimation der Macht geworden.
In den Schlachten um Troja, wie Homers „Ilias“ sie schildert, kämpften auch olympische Götter gegeneinander. In früheren Schichten des Mythos mögen europäische mit vorderasiatischen Gottheiten gerungen haben. Aber die Unsterblichen bei Homer sind bereits Mischwesen aus den Götterfamilien dorischer Einwanderer und denen der Einheimischen, die mit Vorderasien verschwägert waren. Manche Mythen der Griechen vollziehen selbst noch die asiatische Abkunft ihrer Gestalten nach. Dionysos, Sohn des Zeus, wuchs im kleinasiatischen Nysa auf; Kadmos, der Vater seiner Mutter, war ein phönikischer Königssohn, Abkomme einer ranghohen semitischen Gottheit. Europa selbst verdankt seinen Namen der Schwester des Kadmos, die Zeus in Gestalt eines Stiers entführte.
Die ersten anthropomorphen Götterfamilien waren in Vorderasien und Ägypten beheimatet. Das alte Sumer glaubte um 3000 v. Chr. an eine Versammlung der Stadtgötter von Ur, Uruk und Lagasch. Aus Innerarabien eindringende Nomaden brachten neue Gottheiten mit. Das Reich von Akkad, das die sumerischen Städte nach ihrer Eroberung durch Sargon I. (um 2414–2358 v. Chr.) vereinte, kannte mehr als dreieinhalbtausend Götter. Josephs mythischer Ahnherr Abraham, der Stammvater des Volkes Israel, verließ diesen Schmelztiegel von Menschen und Götzen, um in der Einsamkeit der Wüste seinem einzigen Gott zu begegnen. Die Stufenpyramiden Mesopotamiens, „Zikkurats“, künstliche Tempelberge, auf denen gottgleiche oder von einem Gott abstammende priesterliche Herrscher wie auf einer Burg residierten, zeugen von der Theokratie dieser ältesten Kulturen. Der Himmelsgott An zeugte mit der Erdgöttin Ki den Windgott Enlil und Ninlil, die Herrin der Stürme. Enki verwaltete die Feuchtigkeit der Erde, aber auch Weisheit, Kunst und Magie. Die himmlische Inanna nahm sich der Macht des Lichtes und der Liebe an. Utu verkörperte sich in der Sonne, Nanna im Mond. Dumuzi, ein göttlicher Rinderhirt, verging alljährlich unter der Sommerhitze und ließ sich von Inanna aus der Unterwelt zurückholen. Die Ähnlichkeiten mit dem altgriechischen Götterapparat gehen bis zu einem schweigenden Fährmann und einem Fluss ohne Wiederkehr. Der Jagd- und Kriegsgott Ninurta hingegen geistert als Nimrod durch die ältesten jüdischen Schriften, und im Schwarm der Dämonen galt Lilith nach einer aus der Bibel getilgten Episode als Adams erste Frau, schön wie eine Liebesgöttin, aber boshaft und zänkisch.
Bei den Babyloniern wurde Anu aus An, Ellil aus Enlil, und als Ea übernahm Enki die Macht über alle Gewässer. Stärker trat der Sonnengott Schamasch hervor, von den Hammurabi (1793–1750 v. Chr.) die Gesetzestafel empfing. In Ischtar lebte die sumerische Inanna fort. Die Großmacht Babylon verwies auch den Krieg in die Zuständigkeit der Fruchtbarkeitsgöttin, und das berühmte Tor ihres Namens eröffnete die martialisch geschmückte Prozessionsstraße aus farbig glasierten Ziegeln. Marduk, Babels Stadtgott, stieg auf zum Weltenschöpfer, der Tiamat, die chaotische Urmacht des Wassers, gespalten und aus den Hälften Himmel und Erde geschaffen hatte. Ihn machte das kriegerische Assyrien, als es das Erbe Babylons antrat, zum Stadtgott von Assur. Die ersten Sterndeuter und Eingeweidebeschauer, die ersten Propheten des Altertums bezogen ihre Geheimnisse aus diesen Kulten und ihren Riten.
In den Göttern Ägyptens, mit denen Potiphar und sein Weib aufwuchsen, lebten noch die Tiergestalten totemistischer Naturreligiosität fort, in ihren Vermischungen, Entsprechungen und Gleichsetzungen aber erreichten sie hohe Stufen einer für Außenstehende kaum nachvollziehbaren Abstraktion. Atum, der mächtigste Gott des Alten Reiches, erschien bald als Sonnengott Re, der mit seinem Schiff über den Himmel fuhr. Im Mittleren Reich rückte Amun, der „Erstentstandene“, an seine Stelle. Der Pharao, zu Zeiten des legendären Urkönigs Menes (um 2900 v. Chr.) noch als Verkörperung des höchsten Gottes gefeiert, galt nun als Sohn der Sonne. Amuns Rivale Ptah, als „Herz“ und „Zunge“ der Welt, als Weltgeist und Verkünder der Weisheit verehrt, diente der Priesterkaste als Bürge ihrer Unabhängigkeit. Der Mondgott Thot, Schreiber der Götter, behütete in Gestalt eines Pavians Schrift und Schriftkundige. Maat verkörperte Wahrheit und Ordnung, war Inbegriff aller Ethik. Chnum, der widderköpfige Herr der Nilquellen, und der Nilgott Hapi hatten den Jahresrhythmus der fruchtbringenden Überschwemmungen in den Händen. Den Wechsel der Jahreszeiten vollzog das Paar Isis und Osiris. Immer wieder wurde Osiris von seinem Bruder Seth zerstückelt und von Isis zu neuem Leben erweckt: Brudermord und Auferstehung als mythisches Modell. Lenkend mischte sich in die Schlachten der falkenköpfige Month. Oft war das Tierhafte nur eine bevorzugte Gestalt: Amun liebte es, als Stier zu erscheinen, Hathor, die Himmelsherrin, als Kuh. Mut nahm die Erscheinung eines Geiers an, Sachmet die einer Löwin, Bastet die einer Katze. Wepwawet schlüpfte in einen Hund, Thoeris in ein Nilpferd. Ein Schakal verkörperte den Totengott Anubis.
Priesterkollegien, durch Erleuchtungen befugt, brachten von Zeit zu Zeit Ordnung in die Genealogien und Zuständigkeiten, schufen die Göttertafeln der Achtheit, der Neunheit. Der doppelgeschlechtige Atum begattete sich selbst und gebar die Luftgottheit Schu und die Wassergottheit Tefnut. Die Geschwister zeugten die Erdgottheit Geb und die Himmelsgottheit Nut, deren Geschwisterehe wiederum Osiris, Isis, Seth und Nephtys entstammten. Ihr Abbild war die Geschwisterehe des Pharao.
Der Tod beherrschte die Glaubenswelt der alten Ägypter. Sie führten Totenbücher und dachten sich das Totenreich jenseits der Wüste, wo die Sonne unterging. In der Frühzeit ließ man den Pharao nicht allein dorthin aufbrechen; ein Großteil seiner Gefolgsleute musste mit ihm sterben. Wer starb, vollzog die Metamorphose des Osiris. Auch in den Religionen Vorderasiens stand neben der Legitimation der Macht die Bewältigung des Sterbenmüssens: Gilgamesch, Held und König, Erbauer von Uruk, macht sich in dem berühmten sumerisch-akkadischen Keilschriftepos auf die Suche nach der Unsterblichkeit, da er den Tod seines Freundes Enkidu nicht verwindet.
Die Götterscharen des Altertums wurden von Sesshaften verehrt, die ihren Wohnsitz jeweils als Mittelpunkt der Welt betrachteten. In Ägypten gebot der höchste Gott eines Reiches über andere Götter wie der Pharao über seine Provinzstatthalter. Der Polytheismus war Staaten bildend. Wo in der Rangordnung der Götter eine monotheistische Tendenz zum Vorschein kam, verschärfte sich jeweils die Despotie, verabsolutierte sich der Staat. Der Pharao Amenophis IV, genannt Echnaton (1375–1358 v. Chr.), Gatte der durch ihr Porträt berühmt gewordenen Nofretete, erhob Atun, der als Sonnenscheibe den Sonnengott Re verkörperte, zum Staatsgott. Doch dem Versuch, damit alle anderen Gottheiten auszuschalten, widersetzten sich die Priester, und der staatspolitisch vordergründige Kult verschwand fast spurlos.
Woher also kam die Religion des Einen Gottes, der keine anderen Götter duldet, weder neben noch unter sich?
2. Gott als Heimat
Das Volk, das sich mit seinem Abscheu gegen Vielgötterei in der Alten Welt schon einen Namen gemacht hatte, die Juden, das Volk Israel, ist aus wandernden semitischen Stämmen hervorgegangen, die das karge, versteppte, von Wüsten durchzogene Gebiet zwischen dem Nil und dem Zweistromland als Kamelnomaden oder Kleinviehzüchter nutzten und vorübergehend Weiderechte im Machtbereich der mesopotamischen Stadtstaaten und der Pharaonen erwarben. Ihren Namen haben sie von Sem, der in der Arche seines Vaters Noah die allen Mythen des Altertums bekannte Sintflut überlebte. Von seinem Bruder Ham stammen die weiter im Süden wohnenden Völker ab, von Japhet die Völker des Nordens und Westens, jenseits des Meeres.
Für die Nachkommen Sems muss die Anbetung eines alleinigen Gottes, vor dem alle anderen Gottheiten sich in tönerne Götzen oder böse Dämonen verwandelten, ein Gefühl der Geborgenheit, ja des Auserwähltseins bedeutet haben, das ihnen im harten Kampf gegen eine unwirtliche Natur und feindselige Völker überleben half. Aus einer Familie wurde ein Volk, und der Gott dieser Familie, als Stimme, als Traum, als brennender Dornbusch, als Unbekannter, mit dem man eine Nacht lang vergebens ringt, der Gott der Begünstigung wie der Prüfung, bot den Umherwandernden, die hier abgewiesen, da vertrieben oder versklavt wurden, Schutz und Vergeltung. Ihr zielloses Heimweh erhielt in ihm eine Heimat, eine übersinnliche zwar, aber damit auch eine so unfehlbare wie unvergängliche. Die Sesshaftigkeit, die Zivilisation der Städte mag Bequemlichkeit und leichteren Gewinn geboten haben. Aber sie nötigte zum Dienst fremder Götzen, zur Botmäßigkeit unter Despoten, die einen nicht heimisch werden ließ, die gerade andersgläubige Minderheiten heimatlos machte.
In den Weiten der Steppe überwältigte die mystische Kraft einer Gotteserscheinung jeden fremden Lokaldämon und stiftete eine eigene Kultstätte, zu der man wiederkehrte, denn man hatte damit Weiderechte erworben. Man zog wieder fort, Gott blieb und zog zugleich mit, weil er überall war. Gott war die einzige Heimat, und die Heimat war der einzige Gott. Die monotheistische Glaubenswelt ist eine Frucht des Nomadenlebens.
Ob das biblische „Ur in Chaldäa“, aus dem Tharah mit Abraham und seinen anderen Kindern und Schwiegerkindern fortzog, das sumerische Ur meint oder eine andere, schon babylonische Stadt des Zweistromlandes, sei dahingestellt. Die Sesshaftigkeit unter Fremden und ihren Götzen brachte tausend Gefahren. In Ägypten begehrte der Pharao Abrahams Weib. Sodom und Gomorrha, wo sich Lot, ein Enkel Tharahs, festsetzen wollte, gingen wegen ihrer Sündhaftigkeit im Feuerregen unter. Die semitischen Hirten und ihre Herden, Abraham, sein Sohn Isaak und sein Enkel Jakob hielten sich fern von den Machtzentren des frühesten Altertums. Ihr Weideland ermöglichte auch Ackerbau, aber es war nicht fett genug, um die Besitzlust eines Eroberers zu wecken. Es war das Land zwischen dem Meer und dem Jordan, zwischen Wüste und Libanongebirge, das Land Kanaan, das spätere Palästina. In der Absonderung, fern von jedem Staat und seinen Staatsgötzen, blieb ihre Besonderheit unangetastet. In der Gegend von Hebron, Sichern und Dothan lebte man in Anspruchslosigkeit, die noch keine Armut war, frei und seinem Gott, also sich selbst, unangefochten treu: „Jakob aber wohnte im Lande, in dem sein Vater ein Fremdling gewesen war, im Lande Kanaan“ (I. Mose 37.1). Jakob nannte sich auch Israel: „Gott kämpft“. Seine zwölf Söhne gaben den zwölf Stämmen des Volkes Israel ihre Namen.
3. Gunst, Neid und Treue
Die Geschichte des Monotheismus kennt aber auch früh schon eine Gefahr, die der Glaube an einen einzigen Gott mit sich bringt, und die Gefahr geht gerade von der Gunst aus, die dieser Gott seinem Auserwählten erweist, indem er mit ihm einen Bund schließt. Von seiner Lieblingsfrau Rahel hatte Jakob einen Lieblingssohn: Joseph. „Joseph war siebzehn Jahre alt und war ein Hirte bei den Schafen mit seinen Brüdern … Israel (Jakob) aber hatte Joseph lieber als alle seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war, und machte ihm einen bunten Rock“ (I. Mose 37. 2 f.).
Diese Auszeichnung steigt dem Jungen zu Kopf. Sie weckt in ihm das Gefühl, auch Gottes Liebling zu sein. Die Vorstellung eines einzigen Gottes, von dem Wohl und Wehe abhängt, kann Sünde und Verworfenheit, aber auch narzisstischen Selbstkult und Dünkel nach sich ziehen. Wem die Gunst irgendeines Gottes unter vielen Göttern zuteil wird, der ist ein Günstling unter vielen Begünstigten. Der Liebling des Einen Gottes kommt in Versuchung, sich über seine Brüder zu erheben. So sehen auch Josephs Träume aus: Die Garben des Feldes umringen ihn und verneigen sich vor ihm. Sonne, Mond und Sterne unterziehen sich demselben Zeremoniell. Und Joseph ist arglos genug, seine Träume auszuplaudern. Die Brüder, schon durch sein schöneres Gewand gereizt, werden ihm „feind“, und wenn sie ihn „Träumer“ nennen, liefern sie gleich die Deutung mit: Er betrachte seinen bunten Rock wohl als Prinzengewand und erwarte von seiner Familie, dass sie ihn wie einen König verehre. Ein härterer Vorwurf kann nicht erhoben werden unter Leuten, die Könige, Städte und Götzen verabscheuen. Der Dünkel des Träumers ist Abfall von Gott. Der Rückfall in den Götzenkult, die Versuchung, die das Volk Israel noch weit in die Königszeit begleitet, liegt gerade für den Begünstigten nicht weit. Und dem monotheistischen Gewissen sind Götzendienst und Selbstvergottung zwei Seiten derselben Medaille.
Der eifersüchtige Gott hat ebenso eifersüchtige Anhänger: Bis zu Mordplänen treibt der Neid die Brüder. Auch in ihrem Blut brennt Kains Erbe. Doch Joseph hat, anders als Abel, Fürsprecher. Ruben und Juda verwenden sich für sein Leben. Man wirft den Gimpel nur in eine Grube und verkauft ihn für zwanzig Silberlinge an vorüberziehende Kamelnomaden, an Ismaeliter, Medianiter, Vorfahren der Araber. Den Vater, der seine Liebe so ungleich verteilt hat, strafen die Brüder, indem sie ihm das mit dem Blut eines Bocks getränkte Prachtgewand schicken: Ein Wolf habe den Lieblingssohn gefressen. „Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Tuch um seine Lenden und trug Leid um seinen Sohn lange Zeit“ (I. Mose 37.34).
Die Schuld der Brüder heißt Neid. Doch auch der geckenhafte Missbrauch göttlicher Gunst war Schuld. Joseph trägt sie ab als Rechtloser, als Ware fremder Kameltreiber. Als der Untersten einer gerät der junge Mann nach Ägypten, das schon sein Großvater Abraham wenig gastlich fand, in eine üppige Zivilisation, in eine Despotie voller Versuchungen, sich Wohlleben durch Götzendienerei zu erkaufen.
An Belegen für die Anwesenheit von Semiten und namentlich Israeliten in Ägypten mangelt es nicht. Schon Ende des dritten Jahrtausends baute der Pharao Amenemhet I. östlich vom Nildelta eine Mauer, um semitische Viehzüchter fernzuhalten, die neue Weidegründe suchten. In der sogenannten Amarna-Zeit am Ende der XVIII. Dynastie, unter Amenophis III., Amenophis IV. und Nofretete, als dem Reich mit dem Sonnenkult ein Pseudomonotheismus verordnet wurde, verdichten sich die Zeugnisse. Zu Beginn der XIX. Dynastie sind semitische Bautrupps bezeugt. Sie waren mit der Errichtung der Vorratsstädte Ra’amses und Pithon beschäftigt. Ramses II. (1304–1238 v. Chr.), dessen neue Residenz daraus versorgt wurde, sah man deshalb allgemein als „Pharao der Bedrückung“ an. Auf der Stele des Ramses-Nachfolgers Merenptah (1238–1219 v. Chr.), der als „Pharao des Auszugs“ galt, erschien erstmalig der Name „Israel“.
Die biblischen Texte widersprechen einander. Einmal geben sie für Israels Aufenthalt in Ägypten vierhundertdreißig Jahre an, ein andermal lediglich vier Generationen. Offen muss auch bleiben, ob es zwangsrekrutierte Fremdarbeiter waren, die unzufrieden davonliefen, oder ob der Pharao tatsächlich ein ganzes Volk gefangen hielt und schließlich sein Versprechen, es zu entlassen, doch noch brach. Sicher scheint, dass sich der Aufstieg des Mannes im Land der Pharaonen, von dem die Joseph-Geschichte im Ersten Buch Mose berichtet, zwischen der Amarna-Zeit und der Epoche Ramses’ II. vollzogen hat.
Das Reich, in das Joseph als Sklave kommt, schaut auf anderthalb Jahrtausende zurück. Zwei „Zwischenzeiten“ hat es schon überdauert, einen zerstörerischen Aufstand seiner unteren Volksschichten und die halbbarbarische Fremdherrschaft der asiatischen „Hyksos“. Gänzlich fremd ist es ihm nicht, denn in Kanaan, dem Landstrich seiner Herkunft, berührt sich ägyptischer Einfluss mit dem Anspruch der Hethiter, die von Kleinasien her vordringen, bis die Schlacht von Kadesch (um 1295 v. Chr.), von beiden Seiten als Sieg verbucht, zumindest klare Vereinbarungen erzielt.
Der Gott der Väter steht dem Gefangenen bei: „Und der HERR war mit Joseph, so dass er ein Mann wurde, dem alles glückte“ (I. Mose 39.2). Auf dem Weg des privilegierten Sklaven im Haus des reichen und mächtigen Potiphar erwartet den begabten Gottesliebling allerdings eine neue Falle: Er wird Knecht zweier Herren. Potiphar, heißt es, „setzte ihn über sein Haus; und alles, was er hatte, tat er unter seine Hände. Und von der Zeit an, … segnete der HERR des Ägypters Haus um Josephs willen, und es war lauter Segen des HERRN in allem, was er hatte, zu Hause und auf dem Felde“ (I. Mose 39.4 f).
Was nun geschieht, beleuchtet die tief voneinander geschiedenen religiösen und kulturellen Hintergründe der beiden Beteiligten. Joseph hat die Klippen einer komplizierten Dialektik zwischen einem Herrn und seinem HERRN zu meistern. Richtschnur ist ihm die Rangfolge seines Gehorsams: „Und Joseph war schön von Gestalt und hübsch von Angesicht. Und es begab sich, dass seines Herrn Frau ihre Augen auf Joseph warf und sprach: Lege dich zu mir!“ (I. Mose 39.6 f). Potiphars Weib wartete gewiss nicht nur mit Befehlen auf, sondern auch mit prächtiger Garderobe, kostbarem Schmuck, hochentwickelter Kosmetik und der Kunst, ihren feingliedrigen Körper reizend zu bewegen. Sie muss schön gewesen sein. Ob sie auch all die subtilen Empfindungen des erwachenden, unterdrückten und doch unwiderstehlichen Liebesverlangens durchlebte, die Thomas Mann in der Mitte seiner Romantrilogie „Joseph und seine Brüder“ schildert, bleibt offen. Sie hätte vielleicht Maat oder irgendeine ethische Instanz in ihrer Götterwelt fürchten müssen, aber gewiss bei einer anderen Gottheit sogleich ihre Zuflucht gefunden. Und die lüstern schmachtende Herrin besaß eine Befehlsgewalt, mit der sie die Satzung ihres eigenen Herrn und Gatten auf eigenwillige Weise allzu wörtlich auslegen konnte: Wenn unter Josephs Hände alles gegeben war, was Potiphar gehörte, durfte er dann nicht auch über Potiphars Weib verfugen?
Joseph widersteht. Seine Weigerung, nicht weniger entschieden als die des Narziss gegenüber Echo, lässt sich nicht allein aus seiner Keuschheit erklären. Die Liebessophistik seiner Gebieterin ist ihm nicht unverständlich; er macht sie nur nicht mit. Einem Missbrauch der Befugnisse, die ihm sein Herr Potiphar erteilte, verschließt er sich aus Gehorsam gegenüber dem HERRN, dem einzigen Gott, der allein der rechte Gehorsam ist: „… alles, was er hat, das hat er unter meine Hände getan; er ist in diesem Haus nicht größer als ich, und er hat mir nichts vorenthalten außer dir, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen?“ (I. Mose 39.8 f.).
Sünde ist ein Vergehen gegen den Willen des Einen Gottes, ein monotheistischer Begriff. Potiphars Weib, mit vielen Göttern aufgewachsen, kennt den Frevel, die Schande, die ein Ehebruch bedeutet – wenn er entdeckt wird. Die Sünde, die Gott sieht, für die einen kein anderer Gott in Schutz nimmt, bleibt ihr fremd. Sie hofft davonzukommen, wenn alles geheim bleibt und einer ihrer Götzen durch ein Opfer gewonnen wird. In Joseph und Potiphars Weib begegnen sich nicht nur Mann und Frau, nicht nur Untergebener und Herrin, sondern auch zwei unterschiedliche, einander moralisch ausschließende Götterwelten in der denkbar heikelsten Situation: der Versuchung zum Ehebruch. Die Verführerin, die vielen Göttern huldigt, sieht, vielleicht noch mit einem Rest matriarchalischen Instinktes, zumindest eine Chance, sich gegenüber einer göttlichen moralischen Instanz herauszureden. Der Widerstehende, der nur dem EINEN, dem patriarchalischen Gott gehorcht, setzt die Treue zu seinem irdischen Herrn der zu seinem göttlichen HERRN gleich. Die Vielgötterei macht nicht nur tolerant, sie macht auch lax. Der Polytheismus relativiert die Moral, der Monotheismus hingegen verabsolutiert sie.
Joseph hat eine Prüfung bestanden. Die Verschmähte sieht das anders. Die Begierde trübt ihren Gerechtigkeitssinn, sie ist auf Rache aus und greift zur Verleumdung. Sie wiederholt ihr Angebot, und da sich Joseph abermals weigert, hält sie sein Gewand fest und ruft: „Seht, er hat uns den hebräischen Mann hergebracht, dass er seinen Mutwillen mit uns treibe. Er kam zu mir herein und wollte sich zu mir legen“ (I. Mose 39.14). Der Vorwurf trifft mit dem Knecht zugleich den Herrn. Joseph wird, als habe er Potiphars Weib vergewaltigen wollen, ins Gefängnis geworfen. Wieder ist er der Untersten einer, sitzt im Elend, in der „Grube“.
Doch auch die unverdiente Strafe wird zur Bewährungsprobe: „Da nahm ihn sein Herr und legte ihn ins Gefängnis … Aber der HERR war mit ihm … so dass er alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab“ (I. Mose 39.20 ff). Josephs jugendlicher Narzissmus, ein Abfall von Gott, wird mit Sklaverei bestraft. Seine Gottestreue, die ihm die Ungnade irdischer Herren einträgt, belohnt der HERR durch neuen Erfolg: Der Gefangene legt dem Pharao Träume aus, die kein Wahrsager zu deuten weiß. In seiner Jugend wurden ihm lebhaftes Träumen und selbstgefällige Traumdeuterei zum Verhängnis. Nun springt er hinauf in den Rang eines Wesirs, nur weil er in sieben mageren Kühen, die sieben fette fressen, in sieben dürren Ähren, die sieben dicke verschlingen, sieben magere Jahre erkennt, die sieben fetten Jahren folgen werden. Mehr denn je kann der Gottesliebling beweisen, was in ihm steckt. Während der sieben fetten Jahre, in denen die Nilüberschwemmung die Felder fruchtbar macht, sorgt er vor für die sieben mageren, in denen sie ausbleibt. Er kann endlich seine Familie an die „Fleischtöpfe Ägyptens“ rufen, den leidgekrümmten Vater trösten, der ihn für tot hielt, und den Brüdern Böses mit Gutem vergelten.
Mit der Bedrückung des Volkes Israel in Ägypten und seinem Auszug unter Moses, dessen Name ägyptisch ist, begann ein neues Kapitel seiner Geschichte. Das Volk, das nur seinen Gott Jahwe als König über sich haben wollte, wurde doch in Kanaan, dem „gelobten Land“, sesshaft. Den Text der auf dem Berg Sinai vom HERRN empfangenen Gebote bewahrte die transportable Bundeslade auf. Sie bedeutete den Wandernden soviel wie den Sesshaften der Tempel. Doch bedroht durch die Philister und andere Nachbarn, entwickelten sie eine Staaten bildende Kraft. Sie führte nach Jerusalem, zur Salbung Sauls durch Samuel, den letzten der „Richter“, zum Königtum Davids und Salomos, die als Stellvertreter Jahwes gelten (I. Samuel 8 ff. und 16 ff), zum Bau eines Tempels für den Einen Gott, gegen den sich die alttestamentlichen „Richter“ immer verwahrt haben wie gegen einen Abfall von geheiligten Grundsätzen.
Die Blütezeiten des jüdischen Staates im Altertum fielen mit Schwächephasen der Großmächte Ägypten, Babylon, Assyrien zusammen. Umringt von Vielgötterei, hatten es seine Priester schwer, ihren Einen Gott zu bewahren. Unter den Gottheiten der Nachbarn und alteingesessener Kanaaniter blieb der große Baal, zu dessen Kult Menschenopfer und die rituelle Prostitution der „Tempelhuren“ gehörten, eine ständige Herausforderung. Schon in hellenistischer Zeit verbreitete sich das „Volk des Buches“ über die Städte rund um das Mittelmeer. Nach der Zerstörung Jerusalems durch den römischen Kaiser Titus (70 n. Chr.) begann die Zeit der Diaspora, in der Jahwe wieder die einzige Heimat bedeutete.
Literaturhinweise
Beltz, W., Die Schiffe der Götter. Ägyptische Mythologie, Berlin 1987
Beltz, W., Gott und die Götter. Biblische Mythologie, Berlin und Weimar 1988
Bonnet, H., Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte, Berlin 1952
Herrmann, S., Geschichte Israels in alttestamentlicher Zeit, Berlin 1983
Ions, V., Ägyptische Mythologie, Wiesbaden 1970
Lexikon der Ägyptologie, Wiesbaden, seit 1972
Lurker, M., Götter und Symbole der alten Ägypter, Bern; München; Wien 1974
Morenz, S., Ägyptische Religion, Stuttgart 1960
Morenz, S., Gott und Mensch im alten Ägypten, Heidelberg 1965
Moscati, S., Die Kulturen des alten Orients, München 1962
Otto, E., Ägypten. Der Weg des Pharaonenreiches, Stuttgart 1968
Roeder, G., Mythen und Legenden um ägyptische Gottheiten und Pharaonen, Zürich 1960
Schmökel, H., Das Land Sumer, Stuttgart 1955
Die Bibel-Zitate folgen dem Alten Testament mit Erklärungen, Berlin und Altenburg 1983
Exil beim Feind. Themistokles und Artaxerxes I
Ein Reisewagen, mit Zeltplanen verhängt, durchquert die westlichen Provinzen des Perserreiches, das heutige Kleinasien. Wer nach dem verborgenen Fahrgast fragt, bekommt zur Antwort, ein schönes griechisches Mädchen aus Ionien werde einem Höfling des Großkönigs zugeführt. Doch bei der Ankunft entsteigt dem Gefährt ein ergrauter Mann, der sich weigert, seinen Namen zu nennen. Er sei Grieche, sagt er, und habe mit Artaxerxes Dinge zu besprechen, die für seine Herrschaft von größter Bedeutung wären. Der hohe Beamte, dem dieser Fremdling aus dem feindlichen Volk mit soviel Selbstbewusstsein entgegentritt, gibt ihm verwundert zu bedenken, am persischen Königshof habe man sich nicht respektlos aufzuführen wie in Athen, sondern dem Herrscher, einem Abbild der Gottheit, zu Füßen zu fallen. Der Ankömmling versichert, dies beabsichtige er zu tun. Er wolle die Macht des Großkönigs stärken und der Zahl derer, die ihn als den Beschützer der Welt anbeten, noch viele hinzufügen. Es sei selbstverständlich, dass er die Sitte des Landes wahre. Der Beamte zeigt sich beeindruckt und geneigt, den Fremden, der des Persischen mächtig ist, zu melden. Dazu müsse er jedoch seinen Namen wissen. „Niemand soll eher als der König meinen Namen erfahren“, lautet die Antwort.
Es muss ein besonderer Name gewesen sein, mit gutem oder schlechtem Klang, ein Name, den sowohl im Riesenreich der Perser als auch in den griechischen Städten jeder kannte. Wir wissen nicht, ob Themistokles in dem von Dareios I. erbauten Königspalast der Achaimeniden-Dynastie zu Susa oder in der Hundertsäulenhalle der Sommerresidenz zu Persepolis dem Großkönig Artaxerxes I., dem Sohn des Xerxes, gegenübertrat. Auch das Jahr steht nicht genau fest. Denn der athenische Flüchtling hatte eine lange Irrfahrt hinter sich und einen Zwischenaufenthalt bei Admetos, dem König der Molosser. Aber die Audienz war ein bedeutsames Nachspiel des Zusammenpralls zwischen Griechen und Persern. Der Mann, der seinen Landsleuten das persische Joch ersparte, musste zuletzt sich selbst darunter beugen, um vor ihnen sein Leben zu retten. Themistokles, der entschiedene Demokrat, der leidenschaftliche Gegner der Aristokraten, der Schrecken der asiatischen Monarchie, wurde am Ende seiner Laufbahn ein Satrapengünstling. Wie kam es zu dieser paradoxen Begegnung?
1. Perserreich und Polis
Artaxerxes I. war der Nachfahre namhafter Großkönige aus dem Herrscherhaus der Achaimeniden. An der Spitze einer indoarischen Adelsschicht, die über den Kaukasus eingewandert war und seit einem halben Jahrtausend über das iranischer Hochland herrschte, hatte es nach und nach auch die altersschwachen Staatsgebilde des Alten Orient unterworfen. Kyros II. hatte sich Mitte des 6. Jahrhunderts v. Chr. der legendären Schätze des lydischen Königs Kroisos (Krösus) bemächtigt, das zusammenbrechende Babylonien besetzt und das Perserreich bis nach Indien ausgeweitet. Zwischen Aralsee und Kaspischem Meer war er im Reiterkampf gegen die Skythen gefallen. 525 v. Chr. eroberte sein Sohn Kambyses Ägypten.
Unter Dareios I. (521–486 v. Chr.) stießen die Perser ins westliche Kleinasien vor und unterjochten die Ionier, griechische Kolonisten an der Küste der Ägäis, die, sooft sie sich gegen die Fremdherrschaft erhoben, auf Hilfe aus dem Mutterland hofften. Xerxes I. (485–465 v. Chr.) wagte den Vorstoß nach Europa.
Persien verfügte über alles, was den despotischen Machthaber eines Riesenreiches dazu ermutigen konnte. In seinem Heer dienten neben anderen botmäßigen Völkerschaften längst schon griechische Söldner. Gute Straßen knüpften ein dichtes Netz von Garnisonen; ein schneller Kurierdienst brachte in kurzer Zeit erdrückende Marschsäulen auf die Beine. Persische Schiffe kreuzten unangefochten im östlichen Mittelmeer. Ein straff organisierter Beamtenapparat, der die aramäische Schrift übernommen hatte, setzte die verwaltungstechnischen Erfahrungen Babylons, Assyriens und Ägyptens fort.
Aber das zusammengeraubte, durch blutige Willkür botmäßig gehaltene Machtgebilde zeigte innerhalb weniger Generationen bereits Risse: Kambyses hatte, um einen Rivalen loszuwerden, seinen Bruder Bardija umgebracht. Artaxerxes I. (465-425 v. Chr.) verdankte seine Herrschaft einer Palastrevolte, in der sein Vater Xerxes, durch seine Niederlage gegen die Griechen geschwächt, und sein älterer Bruder gedungenen Mördern zum Opfer fielen. Die dynastischen Streitigkeiten ermutigten Ionier, Ägypter und Babylonier, sich zu erheben, riefen skythische Horden an die Nordgrenzen.
Innere Kämpfe entzündeten sich auch an der Staatsreligion der Achaimeniden, dem Parsismus oder Zoroastrismus. Ihr Stifter Zarathustra (599/98 bis 522/21 v. Chr.), der vermutlich aus dem östlichen Reichsteil kam, verkündete nach seiner ersten Offenbarung (um 569 v. Chr.) in seinen Verspredigten einen schroffen Dualismus. Der Kult seines Gottes Auramazda (Ahura-Mazda) verwarf die Vielgötterei, ohne selbst absolut monotheistisch zu sein. Sein Name – er begegnet auch als „Zoroaster“, erscheint in Mozarts „Zauberflöte“ als „Sarastro“ und steht als Ur- und Gegenbild hinter Nietzsches im übrigen frei erfundener Denkergestalt – durfte nicht mehr genannt werden, nachdem der Magier Gaumata seine Lehre in den Augen des Adels zur Aufwiegelung des Volkes gegen die bestehenden Eigentumsverhältnisse missbraucht hatte (522 v. Chr.). Die Autokratie der Großkönige verlangte nach namenlosen Priesterscharen, die nicht das Volk über Gut und Böse aufklärten, sondern den Untertanen Gehorsam als gut und abirrende Fragen als böse hinstellten.
Mit Dareios I. und Xerxes I. zog auch der zoroastrische Staatsgott gegen die Götzendienerei der Griechen zu Felde, die, gleichfalls indoeuropäische Einwanderer, ihre archaiischen und dorischen Götter mit denen der Pelasger verschmolzen hatten und weder nach einem einheitlichen Reich strebten, noch einen einigenden Staatsgott brauchten. Ihr Staaten bildendes Streben beschränkte sich auf die jeweilige Stadt und das sie nährende Umland. Sie kolonisierten die Inseln der Ägäis, die kleinasiatische Westküste, Sizilien und Unteritalien und hielten nur zusammen, wenn es die Feindseligkeiten andrängender Barbaren erforderten. Als Barbaren galten ihnen alle Nichtgriechen, gleich, auf welcher Kulturstufe sie standen, also auch die Perser. Die Athener entwickelten zuerst jenen Sinn für die Rechte des Individuums, aus dem die Demokratie hervorging, und schauten deshalb mit Verachtung auf die monarchischen Staatsgebilde anderer Völker herab. Als Individualisten waren die Hellenen aber auch untereinander zerstritten und wechselten oft so eigennützige wie verhängnisvolle Zweckbündnisse. Unter diesen Poleis ragten bald Athen und Sparta als die stärksten und einflussreichsten heraus. Dieser Vorrang machte sie aber auch zu erbitterten und verschlagenen Rivalen.
Eine Legende behauptet, Artaxerxes I. habe den bösen Geist Ahriman (Angra Mainyu) beschworen, er möge den Griechen den Verstand rauben und sie die Besten aus dem Land jagen lassen. Sein finsteres Gebet wurde erhört. Nach der Seeschlacht bei Salamis brach ein Streit aus, wer der tapferste Feldherr gewesen sei, und die heiligen Stimmsteine ergaben, dass jeder sich selbst an die Spitze und Themistokles an die zweite Stelle gesetzt hatte.
2. Halb aus dem Volk
Die griechische Porträtplastik zeigt nur wenige Charakterköpfe und duldet kaum einen Vergleich mit der Lebensnähe römischer Porträtbüsten, deren Ähnlichkeit auf die Benutzung von Gipsmasken zurückgeführt wird, während griechische Bildhauer sich meist, soweit sie nicht gänzlich idealisierten, mit einer allgemeinen Annäherung an die Züge des Dargestellten begnügten. Eine der wenigen Ausnahmen ist der breite, bäurische Schädel mit dem energisch wachen Blick engstehender Augen, der sich von Themistokles erhalten hat. Aus diesem Porträt spricht heute noch der „Feuergeist“, den ihm die Überlieferung nachsagt. Sie bezeichnet ihn als „Halbbürger“, schwankt aber, ob er den Makel, nur zur Hälfte aus athenischem Geblüt zu stammen, dem Vater Neokles verdanke oder der Mutter, die teils als Zugereiste aus Halikarnassos in Kleinasien bezeichnet, teils dem attischen Adelsgeschlecht der Lykomiden zugeordnet wird.
Der Zwiespalt, wie auch immer begründet, die eingeschränkte Zugehörigkeit im Kreis der athenischen Jugend, mag frühzeitig den Ehrgeiz und den Scharfsinn des Heranwachsenden geschult haben. Er musste mehr bieten als andere, um als gleichwertig behandelt zu werden. Ein Lehrer namens Mnesiphilos gab ihm Unterricht, kein bedeutender Kopf, und im Urteil über die Bildungserfolge des Zöglings zeigt sich bereits die Spaltung zwischen Verehrung und Verachtung. Die einen dichteten ihm den berühmten Sophisten Anaxagoras als Ziehvater hinzu, der allerdings dem Alter nach eher sein Sohn hätte sein können, andere wollten, dass der „Halbbürger“ auch ungebildet und amusisch geblieben sei.
Bald reizte seinen Ehrgeiz die Politik. Keine Warnung half. „Sein Vater“, weiß Plutarch aus älterer Quelle, „habe ihn, um ihn von dem Gedanken an die Politik abzubringen, an den Strand geführt, dort habe er ihm die alten verfallenen Trieren gezeigt, um die sich niemand mehr kümmerte, und ihm bedeutet, so mache es das Volk mit den Staatsmännern, wenn sie dienstuntauglich geworden wären.“
3. Der Demokrat und die Tyrannis
Auch die Feindschaft zwischen Themistokles und seinem aristokratischen Widersacher Aristeides soll in die Jugendjahre zurückreichen: Angeblich bemühten sich beide um die Liebe des schönen Jünglings Stesilos von Keos. Fortan sah der Adelsdünkel in dem verhassten Demokraten, dem bedenkenlosen politischen Neuerer nichts als einen beleidigten Ehrgeizling, den eigenen Vertreter aber als einen Mann ruhiger Überlegenheit.
Am erstaunlichsten an Themistokles ist, dass er es gerade in äußerer Bedrohung, die eher ein autoritäres Regieren begünstigt, vermochte, die Demokratisierung Athens voranzutreiben. Der Begriff „demokratia“ wurde erst zur Zeit des Perikles gebräuchlich. Er geht auf das Wort „demos“ zurück, das im Griechischen das Volk, eine Volksversammlung, aber, mit ablehnendem Ton, auch den Pöbel bezeichnen konnte. Als Themistokles den Schauplatz betrat, blickte der Stadtstaat Athen auf ein Jahrhundert wechselvoller demokratischer Bestrebungen zurück. Das Gebrechen der Adelsherrschaft war die Oligarchie, die eine zügellose Bereicherung weniger auf Kosten des Gemeinwesens ermöglichte. Doch hinter demokratischen Staatsmännern stand ein Schreckgespenst, das sich von den Zwängen im Kampf gegen die Oligarchie nährte: die privilegierte Herrschaft eines Einzelnen, die ebenso volksferne Tyrannis. Peisistratos, geboren um 600 v. Chr., aus dem Geschlecht des legendären Gesetzgebers Solon stammend, schützte sich gegen die Anschläge Vermögender mit einer Leibwache und ließ die Akropolis besetzen. Für diesen Anschlag auf die Rechte freigeborener Athener wurde er von Megakles und Lykurgos vertrieben. Die Verwundung aus dem Hinterhalt, mit der er seinen aufwendigen, die Freiheit anderer Bürger bedrohenden Selbstschutz rechtfertigte, hatte er sich angeblich selbst beigebracht. Doch die beiden Tyrannenfeinde entzweiten sich, und Peisistratos wurde zurückgerufen. Gegen seine Söhne Hipparchos und Hippias, die 528/27 v. Chr. wie in einer Monarchie die Nachfolge antraten, verschworen sich die beiden berühmten, durch eine klassische Figurengruppe verewigten Tyrannenmörder Harmodios und Aristogeiton. Kleisthenos, Sohn des Megakles und selbst Adliger, hatte unter der Tyrannis der Peisistratiden in der Verbannung leben müssen. Nach seiner Rückkehr 510 v. Chr. brachte er durch Verwaltungsreformen Athen auf dem Weg in die attische Demokratie zügig voran und schuf eine Institution gegen ihren Missbrauch: Er gilt als Urheber des Ostrakismos, des Scherbengerichts.
Um 524 v. Chr. geboren, lernte Themistokles als Heranwachsender die Tyrannis des Hippias, die Adelsherrschaft des Isagoras und die Reformen des Kleisthenes kennen. Nach seiner ersten Wahl zum Archon 493/92 v. Chr. mischte sich, sooft er Vorzüge und Gefahren der Demokratie gegeneinander abgewogen hatte, eine außenpolitische und strategische Aufgabe ein: die Abwehr der Perser. 494 v. Chr. hatten die Schergen des Großkönigs einen Aufstand der ionischen Städte grausam niedergeschlagen und ein Fanal für die Nähe der Bedrohung gesetzt. Die Tragödie des Dichters Phrynichos, frühes Vorbild und Gegenstück für die „Perser“ des Aischylos, musste gleich zu Beginn seines Archontats abgesetzt werden, weil sie panikartige Tumulte auslöste. Eine Entscheidungsschlacht um Sein oder Nichtsein der griechischen Poleis stand am Horizont. Athen und Sparta ließen ihre Streitigkeiten fallen. Doch Thessalien hoffte auf Schonung, indem es sich den Persern als nördliches Durchmarschgebiet öffnete.
Damit wurde der günstigste Schauplatz für die Verteidigung strittig. Die adligen Gegner des Themistokles, Miltiades, Aristeides und Kimon, hielten am Vorrang eines starken Landheeres fest. Sie hofften so die Grundbesitzer gegen die persische Heereswalze am besten zu schützen. Der Sieg bei Marathon 490 v. Chr. schien ihnen recht zu geben. Die Athener schwankten: Aristeides hatte bei Marathon strategisches Geschick bewiesen, Miltiades erlag den Wunden, die er sich bei der Belagerung von Paros zugezogen hatte. Sein Sohn Kimon hatte ebenfalls ersten Ruhm erworben. Aber die Verbindungen zur Aristokratie Spartas, die ihnen nachgesagt wurden, gingen über ein Zweckbündnis gegen die Perser hinaus. Ihre Familien hatten dem Tyrannen Peisistratos und seinen Söhnen gedient. Wer Bedenken äußerte, nicht nur von den Persern, sondern auch von diesen Kreisen ginge Gefahr für die Freiheit aus, fand in Athen offene Ohren.
Themistokles ließ den Hafen Piräus befestigen. Bei der Siegesmeldung von Marathon stimmte er nicht in den allgemeinen Jubel ein. Er verbrachte die Tage nachdenklich, die Nächte schlaflos. Er wusste, dass die Perser, eine Landmacht, ein noch mächtigeres Landheer mobilisieren würden, dem Hellas nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Zugleich sah er, dass die amphibische Natur des Unternehmens, das Übersetzen von Asien nach Europa, einer überlegenen Seemacht die Chance bot, jedem Landheer den Sieg wieder abzujagen.
Sein Vorschlag, eine starke Kriegsflotte zu bauen, stieß auf den Widerstand der Aristokratie und Spartas. Beide Gegner hatten leicht durchschaubare Gründe: Sparta sah Athen nicht gern zu einer überlegenen Seemacht heranwachsen und vertraute darauf, dass es den Peloponnes auf dem schmalen Isthmus von Korinth auch zu Lande würde verteidigen können. Die attische Aristokratie lehnte es ab, ihre Ländereien auch nur vorübergehend den Persern preiszugeben. Doch Themistokles konnte sich auf die Mehrheit der Stadtbevölkerung stützen, deren Selbstbewusstsein durch die Politik des Kleisthenes gestärkt war. 487/86 v. Chr. demokratisierten Reformen, die als geistiges Werk des Themistokles gelten, die Verfassung weiter. Wer nicht an Landbesitz und reichen Stadthäusern hing, also nicht viel zu verlieren hatte, wenn die Perser in die Falle gingen, unterstützte Themistokles. Städtern leuchtete sein Weitblick ein, während thessalische Grundbesitzer ein Beispiel dafür boten, dass der Landadel das Volk unters persische Joch lieferte, sobald er damit seine Habe sichern konnte. Der einfache Bürger, im Alltag ohnehin dem Sklavenlos näher, entwickelte Opferbereitschaft und Heldenmut, wenn sein höchstes Gut, die Freiheit, auf dem Spiel stand. Der Grundherr würde den Tribut, den er dem Perser zu zahlen hätte, den Untergebenen mit persischen Waffen zusätzlich abpressen. Der Händler aber bangte um den freien Transport seiner Waren, der Handwerker um den Absatz seiner Erzeugnisse.
483/82 v. Chr. brachte Themistokles, zum zweiten Mal Archon von Athen, ein Gesetz ein, das die Erträge der staatlichen Silberbergwerke von Laureion, die seit Peisistratos an die Bürger verteilt worden waren, dem Bau einer Kriegsflotte zuführte. Aristeides, unbelehrbarer Wortführer des Adels und unentwegter Demagoge, verfiel dem Scherbengericht, wurde „ostrakisiert“: Auf den Tonscherben, denen die Bürger in einer jährlichen Umfrage den Namen des Mannes anvertrauen mussten, an dem sie ein Streben nach der Tyrannis bemerkten, erschien erdrückend oft sein Name. Die Athener schickten den einflussreichsten Gegner des Themistokles in die Verbannung. Es lässt sich ahnen, dass die Aristokratie dies nicht hinnahm, sondern ihm fortan dasselbe Los wünschte. Doch der Begegnung des Themistokles mit Artaxerxes I. ging noch ein militärisches Treffen voraus.
4. Salamis
Es war höchste Zeit für die Vorbereitung eines Seekrieges. Das Orakel von Delphi machte die Athener noch einmal wankelmütig. Nur eine Mauer aus Holz, hatte die Pythia geweissagt, werde sie schützen. Der Adel verwies auf die Dornenhecke am Abhang der Akropolis. Doch ein Gleichnis für die Flotte lag näher. Der viel beschäftigte Stratege musste auch als Zeichendeuter seinen Scharfsinn bemühen: Kaum hatte er die Insel Salamis dazu ausersehen, die evakuierten Athener aufzunehmen, und die Meerenge zu Attika zum Schlachtort bestimmt, verlautete aus Delphi, das „göttliche Salamis“ werde die Kinder der Weiber morden. Themistokles beteuerte, es könnten nur persische Kinder persischer Weiber gemeint sein, sonst hätte die Pythia von einem „grausamen Salamis“ gesprochen.
Wie erwartet, wirft Anfang 480 v. Chr. Großkönig Xerxes sein Heer abermals über den Hellespont. Die Jahreszeit ist rau, sturmgepeitschte Wogen behindern die Schiffe wie ein böses Omen. Wütend glaubt der Despot die Naturgewalten zu züchtigen, indem er mit Eisenketten aufs Wasser schlagen lässt. Zu Lande verläuft alles nach seinen Wünschen. Unaufhaltsam stoßen die Perser mit Fußvolk und Reiterei vor, Marathon wiederholt sich nicht. Die Schlacht bei den Thermopylen, in der Spartas König Leonidas fällt, geht durch Verrat und ein Umgehungsmanöver des Feindes für die Griechen verloren. Jenseits des Passes liegen den Persern die blühendsten Landstriche offen. Doch ihre Preisgabe, auch die Athens, ist für diesen schlimmsten Fall nur der Köder für die Falle des Themistokles.
In der Meerenge bei Salamis, die Buchten, Inseln, Vorgebirge und Untiefen für Fremde zu einem nautischen Irrgarten machen, erwartet Themistokles, Stratege der Flotte, den Großkönig. Xerxes ist nicht ganz ahnungslos. Den Griechen, die persische Gesandte töten ließen, hat er nicht Gleiches mit Gleichem vergolten, sondern Gefangene mit Schonung behandelt, um die Absichten des Feindes zu erfahren. Er ist nur verblendet. Um sich im Glanz seines Hofstaates und unter dem Jubel seiner Speichellecker die Seeschlacht anzuschauen, deren Ausgang er zu kennen glaubt, hat er auf einer Anhöhe seinen Prunksessel aufstellen lassen. Was er sieht, ist der Untergang der persischen Flotte. Sein Entsetzen verdoppelt sich, denn von ihr ist sein Landheer abhängig, ohne sie sind alle europäischen Eroberungen wertlos. Die plumpen persischen Transporter, mehr für die Verschiffung von Truppen und Beute geeignet als für einen Seekrieg, haben, obwohl in der Überzahl, keine Chance gegen die kleinen, wendigen Trieren, die am Bug mit einer gnadenlosen Waffe ausgestattet sind, dem Rammsporn. Der Wind in den Segeln und die Muskelkraft der Sklaven, die sich in drei Etagen nach den Paukenschlägen des Rudermeisters rhythmisch in die Riemen legen, setzen der persischen Flotte nicht weniger zu als geschleuderte Feuerbrände und die Schwerthiebe beim Entern.
Die Niederlage der Perser ist so vernichtend, wie sie Themistokles wollte. Auch das abziehende Landheer wird bei Plataiai empfindlich geschwächt. Bei Mykale an der ionischen Küste schlägt die Seemacht der Athener noch einmal zu. Die griechischen Kolonien fallen vom Großkönig ab. Athen ist Herrin der Ägäis und Schutzmacht der kleinasiatischen Pflanzstaaten.
5. Feinde im Rücken
Das Schicksal des Themistokles, vom Ende her betrachtet, zeigt exemplarisch, wie die attische Polis-Demokratie von drei Seiten bedroht wurde: von Sparta, den Persern und den Aristokraten. Sparta verfolgte mit Unmut, wie die Athener ihre wehrhaften Mauern wiederaufrichteten. Pausanias, als König Nachfolger des Leonidas, Sieger von Plataiai, ließ sich mit einem Denkmal als alleiniger Triumphator des Krieges gegen die Perser feiern, doch die Inschrift wurde getilgt und durch die Namen aller beteiligten Städte ersetzt. Dem Attischen Seebund, den sie nun gegen die Perser schlossen, blieb Sparta fern, weil es die Führung Athens nicht dulden wollte.
Aristeides und Kimon waren nach dem Sieg von Salamis nach Athen zurückgekehrt. Sofort drängten sie wieder in die Politik. Sie erwarben sich Verdienste bei militärischen Unternehmungen des Seehundes, standen aber heimlich im Einvernehmen mit Sparta. Wo sie es konnten, schmälerten sie die Erfolge des Themistokles. Auf dem Lande schürten sie die Unzufriedenheit der Bauern, die auf ihren Feldern schwere Verwüstungen hatten hinnehmen müssen. Die Demagogie der Reichen versäumte keine Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wie hässlich der Liebling des Volkes war, und verdächtigten seinen Charakter: Seine Erfolge nannten sie Früchte der Ruhmsucht, seinen Wohlstand erklärten sie mit der Habgier eines Emporkömmlings.
Themistokles ertrug dies mit Gleichmut, Humor und Selbstironie. Sein Scharfsinn hatte das Verhalten seiner Gegner vorausgesehen. Die Behauptung, er sei der mächtigste Mann Athens, die, noch unausgesprochen, mit dem Scherbengericht drohte, rückte der treu sorgende Familienvater witzig zurecht: Der Mächtigste sei vielmehr sein Sohn, denn der beherrsche seine Mutter, diese aber ihn, Themistokles. Aber die keinen Spaß verstanden, sahen darin nur ein neues Eingeständnis, dass seine Autorität bereits an den Institutionen vorbeiwirkte. Die persönliche Macht, die ihm erst die Mehrheit der Athener, dann der Erfolg seiner Strategie und nun der Einfluss Athens im Attischen Seebund eingebracht hatten, ließ sich mit einigem Geschick, er mochte sich drehen, wie er wollte, in den Verdacht des Missbrauchs bringen. Das Gespenst der Tyrannis wurde durch die Gassen geschickt.
6. Das Scherbengericht
Plutarch, der Biograf des Themistokles, nannte den Ostrakismos „ein Mittel, die Leute abzukühlen, die ihre Lust daran finden, große, verdiente Männer zu stürzen“. Nach einem Jahrzehnt hatten die Halbwahrheiten, Entstellungen, Verleumdungen ihre Wirkung getan. Bei dem Scherbengericht des Jahres 470 v. Chr. war auf mehr als der Hälfte der Tonscherben, mit denen die Bürger von Athen die Gefahr der Tyrannis zu bannen hofften, der Name Themistokles zu lesen. Das Verbannungsurteil, das die Gegner seines Plans zur Rettung der Demokratie ausgeschaltet hatte, ereilte nun ihn selbst.
Doch Kimon gibt sich damit nicht zufrieden. In Argos erreicht Themistokles die Nachricht, dass er wegen Hochverrats zum Tode verurteilt ist. Es soll heimliche Verhandlungen des Pausanias mit den Persern gegeben haben, und er soll ihr Mitwisser gewesen sein. Plutarch und Thukydides räumen ein, dass der gekrönte Verräter aus Sparta den Athener wirklich eingeweiht habe, aber erst, als dieser über keine Macht mehr verfügte, mit einem Geheimpakt an seinen undankbaren Mitbürgern Rache zu üben. Eine gezielt lancierte Indiskretion also?
Pausanias wird für sein Vergehen im Athenatempel von Sparta eingemauert. Für Themistokles beginnt die Irrfahrt eines Verfemten. Auslieferungsgesuche jagen ihn von einem Ort Griechenlands zum anderen, durch die Inselwelt der Ägäis, nach Unteritalien, bis es ihn nach Kleinasien verschlägt. Vermutlich begleitet ihn seine Familie, denn seiner jüngsten Tochter gibt er den provokanten Namen Asia. Dem Weg nach Osten haftet eine Schmach an, denn auch der Tyrann Hippias ist nach seinem Sturz zum Großkönig geflohen. Doch ein Traumgesicht soll ihm gesagt haben, das einzig sichere Exil sei beim Feind zu finden, bei den Barbaren. Vielleicht lenkt auch die Herkunft der Mutter seinen Sinn. Und der Trotz, nun zu tun, wofür man ihn fälschlich verurteilt hat, wäre ihm zuzutrauen. Der Adel von Athen konspiriert unausgesetzt mit Sparta. Warum soll er sich der Todesdrohung nicht entziehen, indem er bei einem anderen Feind Zuflucht sucht? Die Zerstrittenheit der griechischen Poleis setzt den Treuegefühlen ihrer Bürger Grenzen. So wird sie sturmreif für andere, ähnlich den Persern straff organisierte Mächte, die Makedonier und schließlich die Römer, die in ihrer Geschichte einen verwandten Fall kennen: Coriolan.
Für die Untertanen des Großkönigs allerdings, vom Geringsten bis zum Ranghöchsten, ist unbedingte Treue die selbstverständlichste aller Pflichten. So verlangt es die tributäre Produktionsweise aller asiatischen Reiche. Es fällt schwer zu begreifen, wie aus dem griechischen „Feuergeist“, der, nach Thukydides, „ganz deutlich die Macht der Natur bewies“, aus dem Demokraten und Menschenkenner der Handlanger eines persischen Satrapen wird. Aber die Audienz bei Artaxerxes I. hat Erfolg. Der Monarch genießt das Desaster der zerbrechlichen, von Dünkel, Egoismus, Habgier und Neid zerrütteten Polis in der Unterwerfung des Mannes, der an der Spitze einer feindlichen Macht und einer freiheitlichen Staatsform seinem Vater Xerxes eine vernichtende Niederlage beigebracht hat. Der Verbannte findet nun Zeit, nachzudenken über den Undank seiner Mitbürger, die in der Politik ahnungslos nachvollziehen, was ihre tragischen Helden auf der Bühne erleiden: Die Athener führen genau das herbei, was sie vermeiden wollen, und genau mit den Schritten, die es verhindern sollen. Das Scherbengericht, einberufen, um Tyrannen zu entlarven, ebnet Tyrannen den Weg, indem es Verfechter einer Demokratie verstößt. Die Begegnung des Themistokles mit Artaxerxes I. eröffnet die Tragödie der attischen Demokratie.
Themistokles erhält die Städte Lampsakos und Magnesia am Fluss Maiandros zur persönlichen Verfügung, um nach Gutdünken aus ihnen seine Einkünfte zu pressen. Es sind griechische Kolonien im nordwestlichen Kleinasien, die sich weder während des ionischen Aufstandes noch nach dem Sieg der Athener aus dem persischen Joch hatten lösen können. Anzunehmen ist aber, dass der Grieche die großzügigen Empfehlungen, die den Despoten nichts kosten, nicht wörtlich nimmt. 459 v. Chr. stirbt er alt und krank in Magnesia. Eine Überlieferung behauptet, er habe Gift genommen, um sich der Pflicht eines Waffengangs gegen anrückende athenische Truppen zu entziehen.
Kimon genoss seinen Triumph nicht lange. Eine Zeit lang verhalf ihm das Erbe dessen, den er gestürzt hatte, zu politischen und militärischen Erfolgen im Attischen Seebund. Doch in Athen erstarkte mit dem Aufstieg des Ephialtes, der das reformerische Werk des Themistokles fortsetzte und in die Hände des Perikles legte, die Demokratie. Übereifrig und ungerufen kam Kimon den Spartanern gegen einen Aufstand der Heloten zu Hilfe. Die Athener sahen darin einen Verstoß gegen ihre Interessen und schickten ihn 461 v. Chr. durch ein Scherbengericht in die Verbannung. Nach seiner Rückkehr zu politischer Bedeutungslosigkeit verurteilt, fand er bei der Belagerung von Kition 450 v. Chr. den Tod.
Auch das Perserreich der Achaimeniden hatte den Gipfel seiner Macht überschritten. Der „Kallias-Frieden“ von 448 schrieb den Verlust der ionischen Städte fest. Aufstände, vor allem in Ägypten, zermürbten es an den Rändern, dynastische Ränke schüttelten seinen Thron. Artaxerxes II. gelang es durch die Kollaboration der Spartaner, noch einmal Athen zu erobern. Die finstere Herrschaft der „dreißig Tyrannen“ vernichtete die attische Demokratie, die unter Perikles zu ihrer Blüte gelangt war, und bereitete der makedonischen Monarchie den Boden. Alexander der Große eroberte das Riesenreich des Großkönigs Dareios III. schließlich mit makedonischen und griechischen Truppen. Innerer Zwist und äußere Feinde hatten ihr Zerstörungswerk an der attischen Demokratie vollendet. Doch auch das Riesenreich, das Alexander auf den Fundamenten Persiens errichtete, bestand nicht lange.
Literaturhinweise
Herodot, Das Geschichtswerk
Plutarch, Parallel-Biografien: Themistokles
Thukydides, Der Peloponnesische Krieg
Bengtson, H., Griechische Geschichte, München 1969
Bengtson, H., Griechische Staatsmänner des 5. und 4. Jahrhunderts, München 1983
Papastauru, J., Themistokles. Die Geschichte eines Titanen und seiner Zeit, Darmstadt 1978
Schachermeyr, E, Die frühe Klassik der Griechen, Berlin; Köln; Mainz 1966
Zu Artaxerxes und Xerxes:
RE, d. i. Paulys Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaften, IX A, 2096 ff. (W. Hinz)
Das Unlehrbare: Aristoteles und Alexander der Große
Die Philosophie ist eine Griechin. Ihren Namen fand sie erst mit dem Bewusstsein ihrer selbst. Aus Mythos und Mystik auftauchend, widmete sie sich in ihrer Frühzeit vielen Gegenständen, die sich allmählich als gesonderte Wissensgebiete abtrennten. Noch für Pythagoras gehörten im 6. Jahrhundert v. Chr. Mathematik, Physik, Astronomie, Musik dazu, war Philosophie im Grunde die Gesamtheit dessen, was man dann die Wissenschaften nennen sollte. Heraklit machte erstmals den Philosophen als „Freund des Wissens“ oder „der Weisheit“ namhaft. Wissen und Weisheit galten noch als dasselbe.
Platon gab in seinem Dialog „Phaidros“ zu bedenken, Wissen käme eigentlich nur der Gottheit zu, und des Menschen Teil sei, nach Wissen zu streben. Dieses Streben bezeichnete er als Weisheit, und Menschen, die diesem Streben vor allem anderen nachgingen, nannte er „Philosophen“. Philosophen wollen, so Platon in seinem Dialog über den Staat, mit dem Unwandelbaren in Berührung kommen; Tugend und Wahrhaftigkeit sind dafür die Grundvoraussetzung. Die Namensgebung verengt den Begriff der Philosophie auf Erkenntnistheorie, Logik und Ethik. Damit wird sie Grundlage für die Staatslehren der Antike. Doch die Philosophen blieben weiter auch Naturwissenschaftler. Aristoteles sah in der Philosophie etwas Grundlegendes, das alle durch Menschen erschlossenen Wissensgebiete von einem überschauenden Gesichtspunkt ordnen könnte.
Nicht von ungefähr entwickelte die Philosophie gerade im Stadium ihrer Selbstfindung Staatslehren. Welche Art des Regierens, welche Verteilung der Macht, welche Staatsform für das Zusammenleben der Menschen am günstigsten sei, wodurch sich Macht am glaubwürdigsten legitimiere, worauf sich das Recht auf die Macht überhaupt gründe, wurde erst interessant, als die Herrschaft des von Göttern abstammenden Adels nicht mehr fraglos hingenommen wurde, als es nicht mehr selbstverständlich war, dass Sterbliche dem König, einem Nachfahren von Halbgöttern, bedingungslos zu gehorchen hatten, als der Machtfrage keine mythischen und mystischen Welterklärungen mehr zuvorkamen.