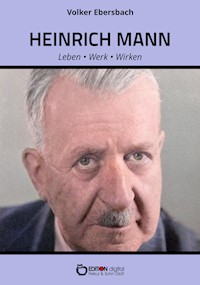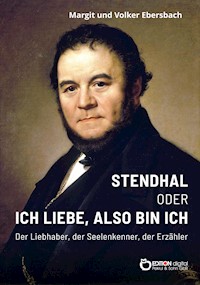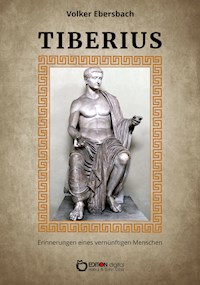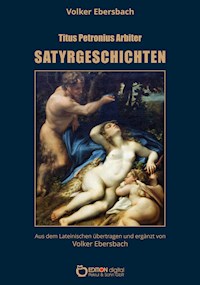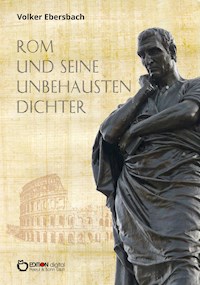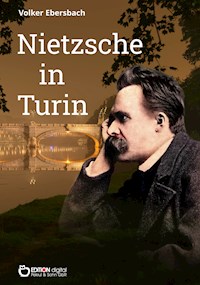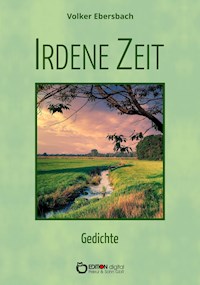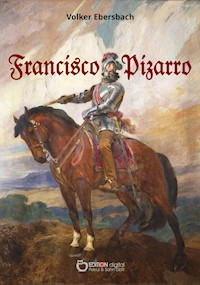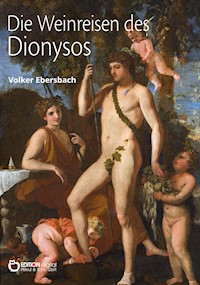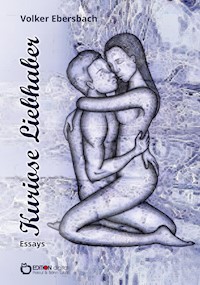
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ist doch mal eine hübsch formulierte Überschrift, die uns da Volker Ebersbach in einem seiner zehn Essays über „Kuriose Liebhaber“ präsentiert : Ein Stratege heiratet. Aber nein, es geht keineswegs um Boris Johnson, den britischen Politclown, Brexit-Durchpeitscher und british prime minister, sondern um einen Mann namens Perikles – der von vor oder um 490 vor Christus bis September 429 vor Christus lebte, ein führender griechischer Staatsmann, ein glänzender Rhetoriker sowie ein Stratege der Demokratie und ein Mann, der sich durchaus für die Liebe und die Lust interessierte und den damit verbundenen Wonnen mit Frauen verschiedener gesellschaftlicher Stellungen keineswegs abgeneigt war: „DIE WONNE DES STRATEGEN“. Und gleich mit den ersten Sätzen seines Versuchs über Perikles kommt Ebersbach auf das Geheimnis zu sprechen, weshalb die yellow press so erfolgreich war und ist: Gerüchte über das Privatleben „großer Männer“ kennen alle Zeiten. Was ein beliebiger Mensch tut und lässt, findet vielleicht das Interesse seiner Nachbarn oder anderer, die ihn kennen. Ein Mann, den alle kennen, muss es hinnehmen, dass sich jeder Gedanken über ihn macht. Er mag seine privaten Vorlieben, Freuden und Ärgernisse der Öffentlichkeit, so gut er kann, verbergen. Alle wollen jedoch mehr über ihn wissen, als bekannt wird, und jeder schließt von sich auf andere. Die Vorzüge des „großen Mannes“ langweilen mit ihrer Selbstverständlichkeit. Mit dem einen oder anderen kleinen Fehler, mit all den Schwächen und Lastern, die man selbst hat, lebt es sich besser, wenn auch ein Bedeutenderer nicht frei von ihnen ist. So trennt sich allmählich, zumal unter einem allgemeinen und scheinbar unumstößlichen Konsens der Gesellschaft über die moralischen Werte, von der Gestalt des berühmten Mannes ein Doppelgänger und beginnt in den neugierigen Köpfen der Leute ein Eigenleben, auf das sein ahnungsloses Original kaum noch einen Einfluss hat, dafür aber die tausendstimmige Menge umso mehr. Neben Perikles befasst sich Ebersbach, von dessen Büchern man immer schlauer aufsteht als man sich hingesetzt (oder bei diesem Thema eher auch hingelegt hat) mit den Lebens- und Liebesabenteuern von Kaiser Caligula, Dante Alighieri, Papst Alexander VI. und Zar Peter dem Großen (DER UNWIDERSTEHLICHE GERUCH DER MÄGDE), Stendhal und Novalis sowie König Edward VIII. von Großbritannien und Nordirland und nicht zuletzt mit John F. Kennedy und – Marilyn Monroe. Sie erinnern sich? „HAPPY BIRTHDAY MISTER PRESIDENT!”
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Kuriose Liebhaber
Essays
ISBN 978-3-96521-659-4 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
1. DIE WONNE DES STRATEGEN: Perikles
Gerüchte über das Privatleben „großer Männer“ kennen alle Zeiten. Was ein beliebiger Mensch tut und lässt, findet vielleicht das Interesse seiner Nachbarn oder anderer, die ihn kennen. Ein Mann, den alle kennen, muss es hinnehmen, dass sich jeder Gedanken über ihn macht. Er mag seine privaten Vorlieben, Freuden und Ärgernisse der Öffentlichkeit, so gut er kann, verbergen. Alle wollen jedoch mehr über ihn wissen, als bekannt wird, und jeder schließt von sich auf andere. Die Vorzüge des „großen Mannes“ langweilen mit ihrer Selbstverständlichkeit. Mit dem einen oder anderen kleinen Fehler, mit all den Schwächen und Lastern, die man selbst hat, lebt es sich besser, wenn auch ein Bedeutenderer nicht frei von ihnen ist. So trennt sich allmählich, zumal unter einem allgemeinen und scheinbar unumstößlichen Konsens der Gesellschaft über die moralischen Werte, von der Gestalt des berühmten Mannes ein Doppelgänger und beginnt in den neugierigen Köpfen der Leute ein Eigenleben, auf das sein ahnungsloses Original kaum noch einen Einfluss hat, dafür aber die tausendstimmige Menge umso mehr.
Der Ruhm des Perikles ist in Jahrtausenden kaum verblasst. Perikles galt schon in der griechisch-römischen Antike als einer der begabtesten Staatenlenker. Und er war kein König, kein Tyrann, sondern er war „strategos“, ein gewähltes Staatsoberhaupt mit zivilen und militärischen Vollmachten. Bis in unsere Zeit sieht man in ihm den so genialen wie entschlossenen Vollender der attischen Demokratie. Allerdings wäre es ein Kurzschluss, sowohl ein historischer als auch ein politologischer, sähe man in Griechenland die „Wiege der Demokratie“ oder das „Mutterland der Demokratie“ und in der alten Stadtrepublik Athen ein Muster für die Demokratie, von der heute gesprochen wird. Die attische Polis-Demokratie war nicht so „demokratisch“, wie man es heute gern verstehen möchte. Sie war, wendet man moderne Begriffe an, frauenfeindlich, oligarchisch, nationalistisch, ja rassistisch. Denn weder die rechtlosen Sklaven, die sich die Athener hielten, durften bei Wahlen abstimmen noch die Frauen noch die „Metöken“, Gastbürger, die nicht in Athen geboren waren: Zugewanderte. Die Mehrheit hatte also kein Stimmrecht. So war sie eine Ethnokratie. Die „Isonomia“ eines kleinen Stadtstaates hob die Vorrechte des Adels auf und war das Zugeständnis gleicher Rechte an freigeborene Bürger. Als „Demokratie“ ließe sie sich, obwohl das „Herrschaft des Volkes“ bedeutete, nicht einfach auf einen modernen Flächenstaat übertragen. Sie war nur die Herrschaft einer Minderheit, in der annähernd demokratische Regeln galten, über eine Mehrheit nahezu rechtloser Einwohner Athens.
Perikles war aristokratischer Herkunft. Das machte es ihm nicht leicht, sich das Vertrauen der Athener zu erhalten. Aus der Aristokratie, die das Staatswesen nicht aus den Händen lassen wollten, erwuchsen ihm erbitterte Gegner. Sie verzichteten auf keinen demagogischen Winkelzug, um das Volk gegen ihn einzunehmen. Dazu gehörte es, sich scheinheilig darüber zu entrüsten, dass Maßnahmen, mit denen er seine demokratischen Reformen gegen ihren Widerstand durchsetzte, nicht immer demokratischen Kriterien entsprachen. Wie auch seinem Vorgänger Themistokles, der mit unpopulären Mitteln Athen gegen den Ansturm der persischen Heere zu verteidigen hatte, schaute auch ihm das Gespenst der „Tyrannis“ über die Schulter. Es hatte Könige gegeben, die durch ihre gnadenlose Gewaltherrschaft in den Ruf von Tyrannen gekommen waren. Nun sorgten die Verfechter der alten Adelsherrschaft und des Königtums durch Quertreibereien dafür, dass einem gewählten Staatsoberhaupt ähnliche Vorwürfe gemacht werden konnten. Den wahlberechtigten Athenern, die sich die Polis-Demokratie erhalten wollten, machte solche Propaganda wenig Eindruck. So richteten die Konservativen ihre Blicke auf das Verhältnis des Perikles zur Welt der Frauen, um den Ruf des Gefeierten ins Wanken zu bringen. Was die unbefangene Meinung vieler einfacher Bürger auch im eignen Interesse lieber diskret behandelte, weil sie es menschlich und darum verständlich gefunden hätte, ließ sich durch Mutmaßungen, Gerüchte und Verleumdungen zum Gegenstand eines moralisierenden Argwohns manipulieren, dem nur ein Unfehlbarer entkommen wäre. Durch Zweifel an seiner Person und ihrer sittlichen Integrität versuchten die Feinde des Perikles Verdacht gegen den Volksliebling zu wecken und zu nähren und ihn in Verruf zu bringen. Und weil dieses schäbige Spiel aus Geschwätz und Naserümpfen von den Zielen seiner Gegner abzulenken vermochte, war es schon halb gewonnen.
Die Griechin
Von der archaischen Zeit bis in die Blütejahre der attischen Polis hatten die Griechinnen zumeist ein bedrückendes Los. Bereits in vorgeschichtlicher, also mythischer Zeit war das Matriarchat zu Ende gegangen. Es hat keine schriftlichen Zeugnisse und nur karge Spuren in der Kultur hinterlassen. Wir kennen das Matriarchat nur aus der antimatriarchalischen Propaganda des frühen Patriarchats. Denn matriarchalische Gesellschaften bringen keine Gesellschaftstheorien hervor. Die Sage vom untreuen Jason und der verlassenen Medea, die ihre Kinder tötete, warnt vor der blutrünstigen, zerstörerischen Unvernunft, vor der Barbarei, in die ein „Weib“ zurückfallen kann, sobald der Ehegatte seine monogamische Treuepflicht – sie ist der Preis des Patriarchats – nicht mehr einhält. Die patriarchalische Zivilisation – soweit es sie überhaupt gibt – ist vor allem ein Produkt einer Dominanz des Mannes infolge seiner biologischen Freizeit. Die Einehe ist ein nur durch Gesetze über das Eigentum geschützter Kompromiss zwischen dem Matriarchat und Patriarchat. Als es notwendig wurde, Güter zu verteilen, verwandelte sich die Polygamie zur Monogamie. Eva ist das biblische Symbol der Monogamie, Lilith das Fragezeichen dahinter. Sie wollte in der in die Bibel nicht aufgenommenen jüdischen Variante der Überlieferung den Mann Adam beherrschen und fuhr in ihrer Wut darüber, dass es ihr nicht gelang, in die Lüfte auf und verbündete sich mit bösen Geistern. Solange die Frauen herrschten, nahmen sie sich Männer nach Belieben. Telemachos, gefragt, ob er der Sohn des Odysseus sei, sagt, seine Mutter behaupte es, er wisse es nicht selber, und niemand wisse genau, wer sein „Erzeuger“ sei (Homer, Odyssee I, 215 ff.). Wo Männer die Macht haben, leben manche Männer mit zwei oder mehreren Frauen. Sie nehmen „Nebenfrauen“ oder halten sich Geliebte. Bei gelockerten Sitten gibt es auch Frauen, die nicht nur mit einem Mann allein leben wollen. Das vollkommene Matriarchat war die Polyandrie, und das vollkommene Patriarchat ist die in manchen Kulturen erlaubte Polygynie.
Vom erstarkten Patriarchat war die Frau in Attika, dem Land, das Athen umgab, wie in anderen Teilen Griechenland ähnlich hart betroffen wie die Orientalin. Sie stand rechtlich auf einer so niedrigen Stufe, dass nach ihr nur noch die Sklavin kam. Nur in den ionischen Städten auf den ägäischen Inseln und an der Westküste Kleinasiens genossen die Frauen etwas mehr Achtung. Selbst in Sparta billigte ein sprichwörtlich altväterisch paternalistisches Gemeinwesen Frauen mehr Rechte zu als unter der Akropolis. In ihrer familienrechtlichen Stellung übertraf nur die freigeborene Römerin jede Griechin. Nach den attischen Gesetzen war ein Mädchen das Mündel des Vaters, und die Frau wurde bei ihrer Heirat zu einem Mündel ihres Gatten. Im Obergeschoss des elterlichen Hauses lehrte die Mutter die Heranwachsende das Weben und Sticken und andere häusliche Arbeiten. Das Erdgeschoss blieb der Männergesellschaft vorbehalten. Lesen und Schreiben gehörte nicht zu den weiblichen Bildungszielen. Geduldet wurde nur Musisches wie Malen und Singen, solange es nicht die Zucht gefährdete. Das Tanzen und die Fingerfertigkeit auf einem Musikinstrument galten schon als heikel, weil sie bei der Unterhaltung der Männer die Sitten aufweichen konnten. Wo sich Männer trafen, hatten Frauen keinen Zutritt. Von den olympischen Spielen blieben sie ausgeschlossen.
In der Götterwelt der Griechen fand die rechtliche Lage der Frauen keine genaue Entsprechung. Hera thronte noch als Gemahlin in der aus archaischer Zeit überkommenen olympischen Götterfamilie beinahe gleichberechtigt neben Zeus, dem „Göttervater“. Mit ihrer unbarmherzigen Eifersucht verfolgte sie alle ihre Nebenbuhlerinnen. Einige höhere göttliche Instanzen blieben noch weiblich besetzt: Nemesis behütete das Recht, und die Rache lag in den Händen der Erinyen. Über allen Göttern waltete die weibliche Macht der Moiren, durch deren Finger die Fäden aller Schicksale liefen. Auch Eris, die Göttin der Zwietracht, war eine Frau. All das weist darauf hin, wie wenig gefestigt das Patriarchat noch war. In der minoischen Kultur auf Kreta und in Mykene, dem nordöstlichen Teil der Peloponnes, stand die Frau nur wenig unter dem Mann. Eine so strenge Einschränkung auf alles Häusliche kam der Dressur für die Dienerin des Mannes nahe und erzeugte bei Frauen, die mehr konnten, als ihre Rolle verlangte, und die über einen weiteren Horizont verfügten, Ausbruchsgelüste. Xanthippe, die Ehefrau des Sokrates, soll ihrem Gemahl Abwaschwasser über den Kopf geschüttet haben. Sokrates sagte einmal zu Xanthippe, die zänkisch wurde: „Du musst lernen, dass du mit einem Philosophen lebst.“ Die legendäre Frau antwortete ihm aber: „Und du musst lernen, ein Philosoph zu sein!“ Aus ihr wurde das sprichwörtliche Symbol einer sich hinter Boshaftigkeit verschanzenden Ehegattin. Ohne eine hinreichende Anzahl wirklicher Beispiele wäre diese Legende wohl niemals entstanden. Einer anderen Legende zufolge unterhielt die Dichterin Sappho auf der Insel Lesbos einen nahezu feministischen, alle Männer abweisenden Kreis von Freundinnen. Der Begriff der „lesbischen Liebe“ ging aus dem Verdacht gegen das erotische Verhalten dieser Damen hervor. Die Amazonen, ein mythisches Reitervolk aus dem Osten, das, angeführt von der Königin Penthesilea, einer Tochter des Kriegsgottes Ares, spät in den trojanischen Krieg gegen die Griechen eingriff, schienen das Vorurteil, Frauen wären keine Kämpferinnen, entkräften zu wollen. Die Legende, sie hätten sich eine ihrer Brüste entfernt, unterstellte ihnen vielleicht einen Hass gegen die Reize ihrer Weiblichkeit. Dass der Held Achilles sich, nachdem er die Königin tödlich getroffen hatte, beim Abnehmen ihres Helmes in Penthesilea verliebte, gehört zu dem religiösen Sinn der Griechen für das Tragische, das die patriarchalischen Verhältnisse herbeiführen konnten. Die Männerwelt hatte zwar im „Krieg der Geschlechter“ die Macht an sich gerissen und genoss sie auch in vollen Zügen; doch in der geheimnisvollen Welt reizender Frauen, die sie heiß begehrten, aber nicht verstanden, argwöhnten sie dunkel drohende Gefahren. Phaidra, die zweite Gemahlin des Theseus, des mythischen Königs von Athen, verliebte sich heftig in ihren Stiefsohn Hippolytos, und eine andere tragische Geschichte nahm ihren Lauf. Die Sage von Ödipus, der ahnungslos seinen Vater erschlug und danach zum blutschänderischen Beischläfer seiner Mutter wurde, warnte das Unterbewusstsein der Griechen vor dem tabuisierten Matriarchat, dessen Makel darin bestand, dass es unter den Nachkommen polygamer Liebesbeziehungen den Inzest nicht auszuschließen vermochte. Auf die wild schwärmenden Mainaden und Bacchantinnen, das weibliche Gefolge des dem Rausch freundlichen Weingottes Dionysos, der die Sitten lockerte, beriefen sich die orgiastischen Feste, zu denen nur Frauen Zutritt hatten. Agaue, die Mutter des Pentheus, der mit seiner königlichen Macht den Kult des Dionysos unterbinden wollte, befand sich in solch einem Schwarm und beteiligte sich an der blutrünstigen Ermordung ihres eigenen Sohnes. Die Gemahlin des kretischen Königs Minos entbrannte in sodomitischer Liebe zu einem Stier. Pasiphae gebar den Minotauros, ein grauenhaftes Ungeheuer, das jährlich Menschenopfer von Athen verlangte und schließlich, nicht ohne den Beistand der Ariadne, von Theseus in seinem Labyrinth getötet wurde. Dionysos erbarmte sich über die Verlassene, nachdem der siegestrunkene Held sie auf der Insel Naxos vergessen hatte. Durch alle Jahrhunderte der Antike, auch bei den Römern noch, blieben die ausschweifenden Proteste der Frauen gegen ihre Rechtsunfähigkeit im Alltag lebendig. Der tragische Mythos von Orpheus ist, unverfälscht, nicht nur eine Allegorie monogamischer Gattentreue: Die geliebte Frau wird ihm durch einen Schlangenbiss von der Seite gerissen, er darf ihr in die Unterwelt folgen und sie ins Leben zurückführen und muss sie ein zweites Mal und nun unwiederbringlich verlieren, weil die Geliebte ihn herzzerreißend anfleht, doch endlich das zu tun, was seine Liebe bewiese, doch wegen einer schicksalhaften Bedingung alles vereiteln würde: sich zu ihr umwenden und ihr in die Augen schauen. Nach diesem Verlust musiziert Orpheus so, dass die gesamte Natur mit ihm trauert, und weil er nun keine andere Frau mehr lieben kann und sich der Fortpflanzung verweigert, wird er von den wütenden Mainaden des Fruchtbarkeitsgottes Dionysos zerrissen. Die Griechen, als Philosophen und Dichter die Anwälte des Maßes, des Maßhaltens und der Mäßigkeit, waren dies in einem ständigen Kampf gegen eine tief in ihrem Wesen verwurzelte Maßlosigkeit geworden.
Die Männerwelt warnte vor den unkontrollierten Trieben der Weiber, tat aber ihren eigenen Trieben nur wenig Zwang an. Der Vorrang des Mannes erlaubte im Alltag nach einem allgemeinen Konsens auch außereheliche Abenteuer mit Sklavinnen, Lustknaben, schönen Jünglingen oder Prostituierten. Die Frau hatte sich züchtig zu halten und durfte bei Fehltritten mit keinerlei Nachsicht rechnen. Sie musste aber alles dulden, was sich der Gatte herausnahm. Der Geschichtsschreiber Thukydides legte dem Perikles in den Mund: „Wenn von einer Frau, sei es im Guten, sei es im Bösen, unter Männern möglichst wenig gesprochen wird, so ist das für sie ein großer Ruhm.“ Dieser Satz drückt das aus, was alle Griechen dachten. Es gab aber sittliche Hintertüren. Kluge Griechinnen versuchten ihre auf das Haus des Mannes festgelegte Rolle zu umgehen. Andere verstanden sich mit List und Trotz zu zügeln und damit zu öffentlichem Ansehen zu gelangen. Auch nach dem Ende des Matriarchats blieben Frauen rätselhafte, den Männern unverständliche Wesen.
Hetären
Der Kult der Liebesgöttin, bei den Griechen Aphrodite, erlaubte seinen Priesterinnen als eine heilige Handlung das, wofür die profane Dirne nur schlechte Münze und Verachtung bekamen: Nach hochgeachteten Vorbildern in den Kulten Ägyptens und des alten Orient übernahmen es Hierodulen, den Beischlaf mit zahlenden Männern im heiligen Raum eines Tempels zu vollziehen. So füllten sie die Schatzkammern der Kultstätte und verdienten auch ihren Unterhalt. Diese Tempelprostitution brachte es gelegentlich zu patriotischen Ehren: Wie der spätantike Schriftsteller Athenaios überliefert, erflehten in Korinth über tausend Opferdienerinnen der Aphrodite mit ihrer Hingabe erfolgreich die Rettung ihrer Stadt vor den Truppen der Perser. Aphrodite, die göttliche Ehebrecherin, war eigentlich – aber die Unsterblichen alterten ja nicht – eine Tante des Zeus, im Schaum des Meeres aus dem letzten Samenspritzer des Urgottes Uranos geboren, nachdem die Erdgöttin Gaia ihn während ihres Beilagers mit einer Sichel entmannt hatte. Aphrodite, die mit Hephaistos verheiratet war, dem Waffenschmied der Götter, machte ihren unansehnlichen, hinkenden Gatten auch noch zum Ehetrottel: Er fing sie während ihres Beilagers mit dem Kriegsgott Ares mit einem Netz und führte die beiden so den versammelten Olympiern vor. Die aber, statt ihm mit einer Bestrafung des ehebrecherischen Paares Genugtuung zu verschaffen, brachen in das sprichwörtliche homerische Gelächter aus.
Die selbstbewusste Göttin der Liebe behütete auch die vielschichtige Sonderrolle der Hetäre, die es nur bei den Griechen gab. Sie war Männern eine „Gefährtin“, ohne als eine gewöhnliche Dirne zu gelten. Nicht nur in gepflegter Schönheit ihres Gesichts und in wohlgebildeter Anmut ihrer Gestalt, mit ihrer Stimme, mit der Grazie ihrer Bewegung im Tanz in vornehmen, von auserlesenen Parfüms duftenden Gewändern entfaltete sie ihre weiblichen Reize, sondern auch mit musischen Fertigkeiten und geistiger Bildung. Gesang und Tanz, ausdrucksvoller Vortrag und unterhaltsame Dichtung zeichneten sie aus. All das vermisste der Grieche bei einer treuen Ehefrau, die ihm ein schlichtes, bescheidenes Hausmütterchen zu sein hatte. Der Umgang mit schönen Hetären schadete dem Ansehen eines Mannes, blieb er diskret genug, kaum. Das Kultivierte erhob ihre Liebesdienste zu einem sublimen Gewerbe lediger Frauen, das sittlich kaum noch Anstoß erregte. Wurde es einträglich, konnte die Hetäre sogar reich und wählerisch werden. In manchen Fällen kam es auch zu engeren und längeren eheähnlichen Verbindungen. Die Bezahlung verlor das Anrüchige für jeden, der bedachte, dass der griechische Mann seine Braut beim Brautvater ja auch nur unter Bedingungen erwarb, die einem Kauf nahekamen. Von einer Hure oder einer Hetäre unterschied sich die fast rechtlose Ehefrau durch ihre gesetzlich festgelegte Rolle bei der Güterverteilung und bei der Erzeugung und der Erziehung von legitimem Nachwuchs. Bei Athenaios heißt es dazu: „Hetären halten wir uns zum Vergnügen und Konkubinen für die Befriedigung des täglichen Bedürfnisses, ehrbare Frauen heiraten wir, um ebenbürtige Kinder zu zeugen und unser Hab und Gut treu bewahren zu lassen.“
Der Stratege heiratet
Liebesheiraten waren selten, wo ein Vater seinem Sohn die Frau aussuchte. Für eine Braut war es schicklich, noch nicht zwanzig zu sein. Ein junger Mann dachte ans Heiraten meist erst gegen Ende seines dritten Lebensjahrzehnts und war bis dahin auf ehelichen Verkehr nicht angewiesen. Auch das Paar, als dessen Sohn Perikles im Jahr 494 v. Chr. geboren wurde, erfüllte einen derartigen Ehevertrag. Xanthippos, der Vater, muss Differenzen mit dem Strategen Themistokles gehabt haben, denn er verfiel vier Jahre vor der Seeschlacht bei Salamis, die 480 v. Chr. Griechenland von den Heerscharen der Perser befreite, einem Scherbengericht: Ein „Ostrakismós“ wurde im 5. Jahrhundert v. Chr. über eine politisch verdächtige Person so verhängt: In einer Volksversammlung schrieb jeder Teilnehmer den Namen dessen, den er verdächtigte, die „Tyrannis“, die Alleinherrschaft, anzustreben, auf einen Tonscherben. Der Verurteilte musste dann, ohne dass er sein Eigentum und seine bürgerlichen Ehrenrechte verlor, für zehn Jahre in die Verbannung gehen. Doch nur fünf Jahre später, in der Schlacht bei Mykale 479 v. Chr., wirkte der Vater des Perikles an dem Seesieg mit, der die Flotte der Perser auch von den griechischen Städten an der ionischen Küste Kleinasiens vertrieb. Agariste, die Mutter des Perikles, war eine Nichte des starken Reformers Kleisthenes, der gegen Ende des 6. Jahrhunderts v. Chr. die Demokratisierung Athens vorbereitet hatte. Sie gehörte wie ihr mächtiger Oheim zu der uralten Familie der Alkmeoniden, einem der angesehensten attischen Adelsgeschlechter, das seinen Stamm auf Nestor zurückführte, den sprichwörtlich weisen Berater der Griechen im Krieg gegen Troja, und war unter dem Tyrannen Peisistratos nahezu geschlossen emigriert.
Weder über das Jahr, in dem Perikles verheiratet wurde, noch über die Herkunft der Braut ist noch etwas bekannt. Sie kann nicht blutjung gewesen sein, denn sie hatte bereits einen Sohn von Hipponikos, von dem man weiß, dass nach seinem Vater Kallias später der berühmte Friedensschluss des Jahres 449 v. Chr. mit Persien benannt wurde. Diese Familie galt als sehr reich. So hat Geld auch bei der Hochzeit des Perikles eine Rolle gespielt. Die Laufbahn eines demokratischen Politikers hatte Perikles vermutlich, als sein Vater die Mitgift aushandelte und das Hochzeitsmahl bestellte, schon begonnen, und die Freunde, die das Paar am Abend im Fackelschein zum Haus des Bräutigams begleiteten, dachten gewiss aufgeklärt über den Hochzeitshymnus, den sie sangen, und die Götter, die sie darin beschworen. Reife und Bildung hatten den vornehmen jungen Mann und seinen Kreis längst von den religiösen Traditionen entfernt. Außer dem Sophisten Damon, der ihm Musikunterricht erteilte, waren der Naturphilosoph Zenon von Elea und der damals schon weit berühmtere Anaxagoras von Klazomenai seine Lehrer gewesen. Die Sophisten galten als philosophische Alles- und Besserwisser, die mit argumentativen Winkelzügen Recht zu behalten versuchten. Anaxagoras, der ihnen von seinen Gegnern verleumderisch zugerechnet wurde, betrieb eine realitätsnahe Naturphilosophie, die sich um den Vorwurf der Gottlosigkeit nicht kümmerte. Er setzte sich in seiner Lehre von den Himmelskörpern über religiöse Vorurteile hinweg, lehrte, dass die Sonne nicht der Gott Helios sei, sondern eine glühende Steinmasse, und sagte am Beginn des Krieges, der das Zeitalter des Perikles beenden sollte, auf Grund von Berechnungen eine Sonnenfinsternis voraus. Hegel rühmte Anaxagoras, bei ihm fange ein Licht aufzugehen an, und der Verstand werde als Prinzip anerkannt. Der junge, inzwischen hochgebildete und ehrgeizige Ehemann nimmt sich für sein Eheleben und für die Gründung einer Familie nicht viel Zeit. Das Gefühl, durch seine Abkunft und seine Erziehung ein hervorragender Mensch zu sein, steckt ihm Ziele.
Aufstieg
Als 472 v. Chr. die Tragödie „Die Perser“ von Aischylos aufgeführt wurde, trat der junge Perikles als „Chorege“ auf. In diesem Ehrenamt hatte er die Mitglieder des Chors, der das Geschehen kommentierte, anzuwerben, einzukleiden, zu speisen und die Miete für den Raum aufzubringen, in dem die Gesänge eingeübt wurden. Bei der Aufführung in einem dramatischen Wettkampf war die Ehre des Sieges sein einziger Lohn. Perikles mag dabei an die Verdienste des Themistokles als Staatsmann um den Sieg der Griechen über die Angreifer nachgedacht haben. Sein rationalistisch geschulter Geist muss erkannt haben, dass das demokratische Prinzip, die „Isonomie“, für Athen segensreich war und der Stadt zu der notwendigen Überlegenheit über das mächtige, aber despotisch starre Perserreich verholfen hatte. Er schließt sich dem Ephialtes an, der das Reformwerk des auf Druck der Aristokratie verbannten Themistokles fortsetzt. Währenddessen eilt Kimon, der führende Kopf der Aristokraten, der wankenden Königsmacht der Spartaner gegen einen Aufstand der gleich Zwangsarbeitern unterworfenen Heloten zu Hilfe. In seiner Abwesenheit gehen weitere Befugnisse an die Volksversammlung über, und dem Areopag, der Versammlung der Aristokraten, wird das Recht genommen, gegen Beschlüsse der Volksversammlung zu intervenieren. Kaum zurückgekehrt, setzt Kimon alles daran, die Reformbestrebungen des Ephialtes wieder zu durchkreuzen. Das bietet dem Perikles eine Gelegenheit, als Politiker der Demokratie von sich reden zu machen. Er tritt auf und erhebt Anklage: Kimon wolle in Athen die Macht an sich reißen. Ein Scherbengericht schickt den Vertreter der Reichen und Vornehmen in die Verbannung. Der Adel, schon lange bitter gereizt durch peinliche Korruptionsprozesse, schlägt umgehend zurück: Ephialtes fällt 461 v. Chr. gedungenen Mördern zum Opfer.
Perikles ist durch sein Auftreten der Mann geworden, der an seine Stelle rückt. Er gilt fortan als der einflussreichste Mann in Athen. Seine Ehefrau bekommt ihn kaum noch zu Gesicht. Unablässig schicken ihn wichtige Unternehmungen in die Ferne, gegen einige abtrünnige Verbündete, gegen die spartanische Schiffswerft Gytheion, von der für Athen eine Bedrohung ausgeht, gegen die Perser im östlichen Mittelmeer und Expeditionen nach Ägypten. Der Aufschwung des Handels und die Kolonisierung der Halbinsel Chersones im Norden der Ägäis und der Küsten Unteritaliens heben sein Ansehen so weit, dass ihn die stimmberechtigten Athener fünfzehnmal hintereinander zum Strategen wählen: Ein Amt, das der Gewählte in der Regel nur ein Jahr lang hätte bekleiden dürfen, wird durch seine Popularität zu seiner Regierungsepoche. Das Amt des „Strategos“ war ursprünglich ein militärischer Oberbefehl. Nach den Perserkriegen und in der zunehmenden Spannung zwischen dem demokratischen Athen und dem aristokratischen Sparta gewinnt es in der überragenden Person des Perikles die Bedeutung der Staatsführung und stellt die zivile Spitze der neun Archonten in den Schatten. In den argwöhnischen Augen seiner Gegner kommt so viel Macht einer Tyrannis bedenklich nahe. Nicht nur Aristokraten, auch viele der „Isonomie“ wohlgeneigte einfache Athener fürchten, da entwickele sich eine – modern ausgedrückt – Militärdiktatur.
Der milde und gerechte Liebling des Volkes zeigt sich dem Volk selten. Alle seine Porträtbüsten und Statuen tragen einen Helm, um, wie Gerüchte behaupten, einen Makel, eine meerzwiebelartige Verformung seines Kopfes zu verbergen. Er bewahrt die Würde und die Unnahbarkeit seiner adligen Herkunft. Man sagt ihm den Dünkel philosophischer Bildung nach und unterstellt ihm die Furcht vor einem Scherbengericht. In seinem Herzen sei er, heißt es, gar kein Demokrat, sondern er trachte nur nach persönlichem Ruhm und strebe nach immer mehr Macht. Indem er auch einfachsten Bürgern die höchsten Ämter zugänglich mache, besteche er das Volk, mit dessen Hilfe er den eignen Vorteil und nicht den Athens suche. Greise, die sich noch an die Schreckensherrschaft erinnern, entdecken in seinem Auftreten, seinem Blick und im sonoren Klang seiner Stimme Ähnlichkeiten mit dem Tyrannen Peisistratos. Seine Redegewalt kommt in den Verdacht der Demagogie, und wer ihn einen „Olympier“ nennt, eine Gepflogenheit, die schnell um sich greift, lässt offen, ob er ihn wie einen Gott bewundert oder ihm die Willkür eines Gottes zutraut.
Das aufgeklärte Denken, das den Strategen zu einem erfolgreichen Pragmatiker und den Politiker zu einem von der Mehrheit begünstigten Demokraten macht, entfernt sein Privatleben immer weiter vom Hergebrachten. Als Vierziger lässt sich Perikles von seiner Ehefrau scheiden. Nach der Sitte der Väter hat sein Vater sie ihm ausgesucht. Zwei Söhne gebar sie ihm, Xanthippos und Paralos. Inzwischen liebt er eine schöne, junge und gebildete Frau, die in Athen von vielen bewundert wird. Plutarch berichtet über die längst zerbrochene Ehe: „Da sie aber auf die Dauer nicht miteinander leben konnten, gab er sie mit ihrer Einwilligung einem anderen zur Frau und nahm nun selbst Aspasia.“
Eine Hetäre?
War Aspasia eine Hetäre? Es läge nahe, dass adlige Saubermänner nach all dem, was sie als Verstöße gegen das politische Herkommen werteten, auch über das Privatleben des Perikles die Nasen rümpften. Bedenkt man die in allen Belangen benachteiligte Rolle, die einer Griechin zugedacht war, wenn sie an den überkommenen Sitten festhalten wollte, lassen gerade die vielgerühmten Vorzüge Aspasias kaum einen anderen Schluss zu.
Einen schillernden Eindruck vermitteln die überlieferten Zeugnisse, Anekdoten, die schon Herodot erwähnte, und wie sie, mehr als fünfhundert Jahre später, Athenaios und Lukian erzählten. Was ein gewisser Herondas, über den fast nichts bekannt ist, in seinen schon ziemlich schlüpfrigen Dialogen zur Sprache bringt, passt eher zu den gewöhnlichen Dirnen. Ob die Geliebten der römischen Liebesdichter Catull („Lesbia“), Tibull („Delia“ und „Nemesis“), Properz („Cynthia“), Gallus („Lycoris“) und Ovid („Corinna“) auch den Gaben der Rhodopis, Thais, Myrtale oder Lais entsprachen, lässt sich aus ihren elegischen Versen nicht erschließen. So untergeordnet die Rolle der Frauen im Alltag blieb – in der Kunst war es üblich, ihre erotischen Reize zu feiern. Bildhauer gestalteten, wenn sie dem Marmor mit ihrem Meißel Göttinnen entlockten, die berückende Schönheit der weiblichen Körper, und als Modell war ihnen eine Hetäre nicht unwillkommen. Dem Praxiteles stand im 4. Jh. v. Chr. die Hetäre Phryne für die Aphrodite von Knidos Modell. Vielleicht diente sie auch dem Maler Apelles, der zur Zeit Alexanders der Großen malte, für die dem Meer entsteigende Liebesgöttin Aphrodite anadyomene als Vorbild. Wie überhaupt von der antiken Malerei ist von diesem seit Jahrtausenden gerühmten Meister fast nichts erhalten. Von anderen Hetären unterschied sich Phryne bald durch ihre Zurückhaltung, denn sie wurde reich. Sie war eine Schönheit, die ohne Schminke auskam, trug hochgeschlossene Gewänder und mied die öffentlichen Bäder. Umso überraschender war die Sensation, als sie bei einem großen Mysterienfest in Eleusis den Fruchtbarkeitsgöttinnen Demeter und Persephone mit einer feierlichen Entblößung huldigte. Mit derselben Geste spornte sie vor Gericht ihren Verteidiger Hypereides zu einer rhetorischen Glanzleistung an, so dass der Richter sie in einer Mischung aus religiöser Scheu und Mitgefühl freisprach. Phryne galt auch als die Urheberin geistreicher Sprüche, wie sie bald nach der „klassischen“ Zeit der griechischen Literatur und Philosophie beliebt wurden. Doch die Wette, den Philosophen Xenokrates zu verführen, verlor sie.
„Lais“ war als Hetärenname sehr weit verbreitet und bedeutete so viel wie „überall bekannt“. Lais von Korinth erwarb sich den Ruf, wählerisch und teuer wie Phryne zu sein. Dem anspruchslosen Philosophen Diogenes, dem nichts gehörte als seine Tonne, gewährte sie ihre Gunst aber kostenlos. Ihre Schlagfertigkeit bewahrte sie nicht davor, hinters Licht geführt zu werden, sobald sie es bei einer Männerbekanntschaft darauf angelegt hatte, in den Hafen der Ehe zu gelangen. Sie endete als eine alte Trinkerin. Eine jüngere Lais maßte sich an, dem Redner Demosthenes zehntausend Drachmen abzufordern. Sie wurde von eifersüchtigen Weibern erschlagen. Die schöne und kluge Plangon von Milet bewies eine überraschende Ehrfurcht vor dem Ehestand: Ihr lockerer Liebhaber brachte es fertig, ihr die kostbare Halskette seiner Braut zu schenken. Als sie erfuhr, dass die Hintergangene das hinnahm, ging sie zu ihr und gab ihr den Schmuck zurück. Die beiden Frauen sollen Freundinnen geworden sein und sich die Liebe des jungen Mannes geteilt haben.
Aus der ionischen Hafenstadt Milet kam auch Aspasia. Ihr Vorbild soll die Ionierin Thargelia gewesen sein. Deren Name war einem frühsommerlichen Fest mit Opfern für die Fruchtbarkeit der Getreidefelder entlehnt, bei dem die ersten Körner als Samensegen gekocht wurden. Diese Thargelia folgte dem Grundsatz, nur einflussreiche Männer zu erhören. So hatte sie die Stadtoberhäupter dazu gebracht, sich dem persischen Großkönig zu unterwerfen. Aspasia wurde um 469 v. Chr., ein Vierteljahrhundert nach der Besetzung Milets durch die Perser, geboren. Wann und wie sie nach Athen gelangte, ist nicht sicher. Ein Landsmann namens Hippodamos soll die junge Zugewanderte mit Perikles bekannt gemacht haben. Eine bildungsbeflissene, künstlerisch begabte Frau sah in einem Leben als Hetäre die einzige Möglichkeit, sich zu emanzipieren.
Hätte sie wie die Milesierin Plangon zartfühlend Rücksicht auf die Ehefrau nehmen wollen – der geschiedene Perikles brauchte darauf keinen Wert mehr zu legen. Er war für sie sofort entflammt. Trotz der Fülle seiner Verpflichtungen soll der Stratege zweimal am Tag zu ihr gekommen sein, um Zärtlichkeiten mit ihr zu tauschen. Doch wenn Perikles und Aspasia ihr Verhältnis als Ehe betrachten wollten, machten sie die Rechnung ohne die strengen Athener. Die Ionierin hatte kein athenisches Bürgerrecht; nicht nur als Frau, auch ethnisch war sie eine rechtlose Fremde. Perikles hatte 451 v. Chr. mit einem verschärften Bürgerrechtsgesetz dem Adel politische Zugeständnisse gemacht und damit seiner legalen Verbindung mit der Geliebten selbst das Wasser abgegraben, und der Sohn, der aus ihren Umarmungen hervorging, der jüngere Perikles, blieb jenem „Bastardgesetz“ zufolge wie seine Mutter vom attischen Bürgerrecht ausgeschlossen. Erst einige Jahre später, als er die beiden ehelichen Söhne durch Krieg und Pest verloren hatte, gelang es dem Strategen, mit einem Volksbeschluss durchzusetzen, dass sein Sohn mit Aspasia in Athen als Vollbürger anerkannt wurde.
Zweifelhafter Humor
Das eheähnliche, aber als eine Ehe nicht anerkannte Zusammenleben des Perikles und der Aspasia, ihr den schönen Künsten, der Dichtung, der Philosophie und der Gelehrsamkeit offenes Haus, die liebevolle Hochachtung, die der Stratege einer Hetäre entgegenbrachte, empfanden angesehene Männer, die ihre angestammten Privilegien hüteten, als dreiste Herausforderung. Hätte er sich, wie allgemein üblich, mit einer Sklavin oder einer Dirne vergnügt, niemandem wäre eingefallen, daran Anstoß zu nehmen.
Die Nachrede, Aspasia wäre nur eine „gewöhnliche“ Hetäre gewesen, geht auf die Komödie „Demoi“ („Die Gemeinden“) des um eine Generation jüngeren Dichters Eupolis zurück, von dessen Stücken allerdings nur wenige Fragmente erhalten sind. Hermippos, der mehrfache Sieger im Bühnenwettstreit, verunglimpfte Aspasias ganz unbefangenes und zuweilen freizügiges Auftreten so anzüglich und platt, dass auch seine Verse keinen Bestand hatten. Von seinen rund vierzig Stücken sind nur noch elf dem Titel nach oder in Verssplittern erhalten. Ein gewisser Kratinos richtete seine Bosheit im Gewand der Satire gegen Aspasia als eine „geile Buhlerin mit schamlosen Augen“. Im Theaterleben Athens muss sich schon damals gezeigt haben, wie humorlos eine „Satire“ wird, die nur bissig moralisiert.
Aus dem Hintergrund wühlten die Feinde der Demokratie, die Areopagiten, gegen den beim Volk so beliebten Politiker Perikles. Anhänger der Oligarchie weniger Reicher kauften sich mittelmäßige Komödiendichter, die, wenn sie witzig zu werden versuchten, ihren Humor an den Nagel hängten. Doch sie bereiteten einer konservativen Opposition den Boden, und bald wurde es ernst. 432 v. Chr. kam es zu einer Anklage gegen Aspasia wegen Kuppelei. Nicht genug, dass man sie als käufliche Hetäre abgestempelt hatte, sie sollte in ihrem Haus andere Hetären beherbergt und für Geld an Männer vermittelt haben. Es waren vielleicht Freundinnen, die sich wie sie mit ihrer vorgeschriebenen Frauenrolle nicht begnügten. Die Scheu vor der einer patriarchalischen Ehe, ein wenig Bildung und Kunstsinn reichten schon aus, um eine Frau in Verruf zu bringen.
Das legendäre Zeitalter des Perikles war also bei weitem nicht so licht und klar, wie es das marmorne Ebenmaß der Akropolis erscheinen lässt. Nach der Zerstörung durch die Perser war sie schöner als zuvor wieder aufgebaut worden, und noch heute bewundern wir ihre Ruinen. Dem Geist der Vernunft, der mit der Philosophie aufblühte, stellte sich wie zu allen Zeiten ein rückwärtsgewandter Obskurantismus entgegen. Die Anklage, die gegen Aspasia erhoben wurde, verband er mit einem schwerer wiegenden Vorwurf: dem der Asebie, der Gottlosigkeit. Hinter den lahmen Witzen der Komödiendichter steckte ein Priester, der Orakeldeuter Diopheites, der schon seit langem gegen die Lehrmeinungen in den Schriften der aufgeklärten Philosophen Protagoras und Anaxagoras, des Lehrers des Perikles, über die Bahnen der Himmelskörper donnerte. Weniger störten ihn Verse in den flachen Komödien des Hermippos, die augenzwinkernd die altehrwürdigen Mythen der Götter parodierten. Die Gottlosigkeit und ein Mangel an Sittlichkeit hingen in den Augen der Hüter einer alten Ordnung eng zusammen. Immer treten Anhänger einer überlebten Herrschaftsform als Moralprediger auf.
In dem anberaumten Prozess verteidigte Perikles selbst die Angeklagte. Er wusste, dass sich die Angriffe letztlich gegen ihn richteten. Die Komödiendichter, die sich in den Dienst des Adels nehmen ließen, wollten an seiner Art, die Demokratie zu schützen, schon autoritäre Züge entdeckt haben. Es war keine Huldigung, wenn sie seine Redegewalt mit Blitz und Donner verglichen, und der politische Olympier wurde nicht mehr bewundert, sondern der Anmaßung bezichtigt. Entsprechend gehässig wirkte es, wenn Aspasia neben ihm als „Hera“ figurierte, was aber angesichts der Verdächtigungen auch als Blasphemie ausgelegt werden konnte. Wenig Komik lag in der Niedertracht, die Aspasia mit Omphale oder mit Deianeira verglich: Die eine hatte Herakles, den Helden aller Helden, wie einen Sklaven behandelt, die andere in zänkischer Eifersucht mit dem Hemd des Nessos seinen Tod herbeigeführt. Mitunter lässt sich beobachten, dass sich eine berechtigte Sorge um die Demokratie und die Argumente ihrer Feinde vermischen. Auch der Geschichtsschreiber Thukydides, dem eine aristokratische Skepsis gegen den Strategen nicht fremd war, urteilt später, die straffe Herrschaft des Perikles sei „nur dem Namen nach noch eine Demokratie gewesen, in Wahrheit aber die Herrschaft eines einzelnen Mannes.“
Als „Gerichtsvormund“ seiner Geliebten sprach Perikles also auch in eigener Sache. Kein modernes Gericht ließe das zu. Das Herz dieses prominenten Liebhabers nahm es in Kauf, dass er den Verdächtigungen gegen Aspasia auch Zweifel an seiner demokratischen Regierungsweise hinzufügte. Sarkastisch griff er den Olympier-Vorwurf gegen ihn auf. Er konnte darauf verweisen, dass Fremde in Athen unter dem Schutz des Zeus standen. Das enthielt mehr Witz als die schlappen Komödien. Doch während seiner Verteidigungsrede soll er auch Tränen vergossen haben, als ginge es um das eigene Leben. Die Überlieferung schweigt davon, wie dieser Auftritt wirkte. Es lässt sich schwer entscheiden, wovon sich das Gericht mehr beeinflussen ließ, von den Gefühlsaufwallungen, der Autorität oder den Argumenten: Es erkannte, obgleich der Verteidiger befangen war, auf Freispruch.
Damit schliff es aber für die Neider eine neue Waffe der Verleumdung gegen einen verdienstvollen Mann. Dass der Liebhaber seine politische Autorität für die Rettung seiner Geliebten in die Waagschale geworfen hatte, blieb nicht ohne weitreichende Folgen. Wie Perikles sich nun auch verhielt – Bescheidenheit legten seine Feinde ihm als Heuchelei und Hochmut aus, Stolz aber als Ehrsucht. Wenn er sich nicht als Atheist, sondern aus seiner unbeirrbaren Frömmigkeit heraus gegen den Aberglauben wandte, verschrie man ihn als gottlos. Zu seinen unverfrorenen Verleumdern gehörte gewisser Stesimbrotos von Thasos, ein Grammatiker, der die Werke des Homer kommentierte, den Dichter aber im Sinne des Wahrsagers Diopheites interpretierte und auch Vorträge über „heilige Handlungen“ hielt. Dieser Scharlatan verbreitete, Perikles habe seine eigene Schwiegertochter verführt. Athen hatte seine Heimat, die Insel Thasos, in seine Abhängigkeit gebracht. Vermutlich verzieh der Obskurant dem Strategen nicht, dass er Athen nach und nach zu einer Vorherrschaft in der Ägäis verholfen hatte.
Doch ein Charisma, das von Perikles ausging, erhielt ihm die Volksgunst. Gegner wie den hartnäckigen Politiker Thukydides, einen Verwandten des Aristokraten Kimon und nicht mit dem Geschichtsschreiber zu verwechseln, schickten Scherbengerichte in die Verbannung. Nun versuchten die Feinde, den Unangreifbaren zu treffen, indem sie seinen Freunden schadeten. Auch der Bildhauer Phidias sollte, so ein Gerücht, sich als Kuppler betätigt haben. Sooft der Schöpfer der Zeus-Statue von Olympia und der die Akropolis schmückenden Statue der Athena in sein Haus einlud, ruhten die Augen und Hände der beiden Freunde angeblich mehr auf den Aktmodellen als auf den Kunstwerken. Wer den Charme der Nacktheit griechischer Skulpturen aus der perikleischen Zeit sieht, ihre in sich ruhende „klassische“ Grazie, möchte kaum glauben, dass eine von kleinlichen Interessen angeheizte Hetzjagd im Alltag der Öffentlichkeit ihr Entstehen begleitete. Der Anwurf, Phidias hätte während seiner Arbeit etwas von dem Gold für das Standbild der Athene unterschlagen, war leicht zu entkräften: Die goldenen Teile ließen sich wieder abnehmen und nachwiegen. Doch das Gerede kam nicht zur Ruhe: Auf dem Schild der Göttin hätte der Künstler ungebührlich sich selbst mit Perikles verherrlicht. Das Kunstwerk ist nicht mehr erhalten, so dass wir nicht nachprüfen können, worauf sich das Urteil gegen ihn stützte, das ihn in die Verbannung trieb oder, nach einer anderen Überlieferung, in den Selbstmord durch Gift.
Keine Ruhe vor Anklagen fand auch der Philosoph Anaxagoras, ein Lehrer des Perikles. Er ging um 430 v. Chr. nach Lampsakos ins Exil. Protagoras, der Denker, der den Menschen das Maß aller Dinge nannte, war als ein Kenner der Gesetze ein unschätzbarer Rechtsberater des Strategen. Er reizte die Frömmler nicht etwa mit den gottlosen Parolen des Atheismus, sondern mit der lauteren Feststellung seines wissenschaftlichen Denkens: Über die Götter könne er nichts sagen, denn die Dunkelheit der Sache und die Kürze des Lebens versage dem Menschen ein Wissen darüber. Auch er wurde aus Athen vertrieben und ertrank wahrscheinlich bei einem Schiffbruch auf seiner Überfahrt nach Sizilien.
Demokratie als Wettstreit?
Perikles förderte die Panathenäen. Ein Fackellauf und eine Götterprozession eröffneten diesen nicht nur sportlichen, sondern auch musischen Wettstreit. Sie wurden ähnlich wie die olympischen Spiele, aber nur in lokalem, nicht in panhellenischem Ausmaß, alle vier Jahre im Sommer gefeiert. Die aristokratischen Areopagiten, die Perikles ein Streben nach der Alleinherrschaft unterstellten, sahen einen Makel darin, dass der Tyrann Peisistratos sie ins Leben gerufen hatte. Doch ein Fest erhält seine Seele nicht von dem, der es stiftet, sondern von denen, die es feiern. Eine Ähnlichkeit der Demokratie mit einem Wettstreit liegt auf der Hand: Sie mag sich in einzelnen Personen durch deren Begabung, Klugheit und Geschick verwirklichen und in ihnen auch starke Verteidiger finden. Gedeihen kann sie aber nur aus sich selbst, durch ihre Verwurzelung im Volk. Auf ihre Verwandtschaft mit dem „Agon“, dem griechischen Geist des fairen Wettstreits, wird oft hingewiesen. Die Griechen standen beispielhaft für das agonale Verlangen der menschlichen Natur, besser als andere und womöglich der Beste zu sein. Perikles hätte wohl schwerlich ohne kluge Ermutigungen und Bestätigungen durch Aspasia, die geliebte Frau, den vernünftigen und friedfertigen Wettstreit freier Bürger um die besten politischen Lösungen immer wieder gewonnen.
Über die Zahlung von Tagegeldern für Volksvertreter und Geschworene wollte es Perikles jedem Freien ermöglichen, sich an der Verwaltung seines Stadtstaates und an der Gerichtsbarkeit zu beteiligen. Ausgegrenzt blieben allerdings nicht nur wie in der ganzen Antike die Sklaven, sondern auch Frauen und Zugewanderte. Auch Kornspenden und Zuschüsse für Theatervorstellungen ermunterten die Bürger dazu, unabhängig von ihrem Einkommen einen Teil ihrer Zeit den öffentlichen Belangen zu widmen. Das zog aus der Landbevölkerung viele in die Stadt. Um die sozialen Spannungen, hervorgerufen durch Erwerbslose, zu schlichten, ließ Perikles auf den Inseln der Ägäis, an ihren Küsten, an den Schwarzmeerküsten und in Unteritalien neue Siedlungen gründen, die von Athen und seinen Verbündeten abhingen. Athen verfügte bald über ein Netz von Pflanzstädten, die ihm Rohstoffe erschlossen und seinen Markt erweiterten.
Den wachsenden Wohlstand bezeugen die Bauten der perikleischen Zeit, mit denen man bis heute den Begriff des klassischen Athen verbindet. 480 v. Chr. hatten die Perser bei ihrer Invasion die archaische Akropolis geplündert und zerstört. 447 v. Chr. wurde der neue Parthenon, Wahrzeichen der Stadt, fertiggestellt. Innerhalb eines Jahrzehnts kamen die Propyläen, das sogenannte Theseion und das Odeon hinzu. Doch auch diese sakralen Zwecke dieser Bauten brachten die Areopagiten, die ihnen jede Ehrfurcht vor den Göttern absprachen, nicht zur Ruhe. Nun sagten böse Zungen, Athen werde herausgeputzt wie ein altes Weib. Der Seitenhieb gegen Aspasia war nicht zu überhören.
In seinem Haus hatte Perikles oft so anregende wie entspannende Gespräche mit Freunden geführt, mit dem Bildhauer Phidias, mit den Architekten der Akropolis Iktinos und Kallikrates, mit den Philosophen Anaxagoras und Protagoras. Auch Herodot, der Geschichtsschreiber, der erfolgreiche Tragödiendichter Sophokles und dessen jüngerer Kollege Euripides waren seine Gäste gewesen. Aspasia blieb in diesen geselligen Kreisen gewiss nicht der dienstbare Schatten wie andere griechische Hausfrauen. Was man dann den Glanz des perikleischen Zeitalters rühmte, war auch dem unverwechselbaren Reiz zu verdanken, der von Aspasias Schönheit, ihrer Bildung und ihrem Geschmack ausging.
Krieg, Pest, Gram
Der Frieden Athens war in den Jahrzehnten nach dem Sieg über die Perser keineswegs gesichert. Perikles ließ die aufblühende Stadt befestigen und die Straße, die sie mit dem Hafen Piräus verband, durch lange Mauern schützen. Die persische Bedrohung hatte den Zwist mit Sparta, der anderen mächtigen, jedoch von Königen regierten Stadt und ihren Verbündeten auf der Halbinsel Peloponnes, nur vorübergehend beigelegt, und der Plan eines großen panhellenischen Kongresses scheiterte am Widerstand der aristokratischen Polis. Der attische Seebund, in dem Athen mehreren kleineren griechischen Stadtstaaten einen Schutz garantierte, diente auch der eigenen Sicherheit. Perikles hütete sich, mit den anderen mittelmeerischen Großmächten Ägypten und Karthago Händel zu suchen, und verzichtete 445 v. Chr. feierlich auf alle Eroberungen. Dennoch erhoben sich unzufriedene Verbündete wie Samos und Megara gegen Athen und warfen der Schutzmacht ein Streben nach Hegemonie vor. Sparta bewertete die fortifikatorischen Maßnahmen des Perikles als Herausforderung und verlangte das Schleifen der Mauern. Der Stratege sah also Gründe genug, bei aller Besonnenheit seinen Helm nur selten abzunehmen.
Boten ihm die Feinde im eigenen Gemeinwesen nicht auch immer wieder Anlässe? Die Areopagiten ließen es sich nicht entgehen, Aspasia als Kriegsfurie zu beschimpfen, die ihrem Buhlen einen Feldzug nach dem anderen einflüsterte. So etwas passte zu allen ihren Einwänden gegen die Einführung von Frauenrechten doch bestens. Samos hatte im Streit um den Marktflecken Priene seinen Krieg gegen Aspasias Vaterstadt Milet nicht beendet; also war die Geliebte des Strategen die „Anstifterin“ einer athenischen Strafaktion. Athens Embargo gegen Waren aus Megara auf attischen Märkten, das „Megarische Psephisma“, wurde 432 v. Chr. durch einen Volksbeschluss verhängt und dennoch dem Einfluss einer Hetäre auf den demokratischen Politiker Perikles zugeschrieben. Eine Zeit lang hatten die heimlich mit Sparta konspirierenden Aristokraten Perikles in seiner persönlichen Ehre zu treffen versucht. Nun benutzten sie üble Nachrede gegen Aspasia für ein Attentat auf die Glaubwürdigkeit der Demokratie.
Die nicht auszuräumende Rivalität zwischen den beiden mächtigen griechischen Stadtstaaten trieb solche Konflikte auf einen Bruderkrieg zwischen Athen und Sparta zu. Jede Verzögerung schien die Chancen Athens darin zu verschlechtern. Ging Perikles mit der Demokratie fahrlässig um? Er strebte gewiss nicht die Alleinherrschaft an. Aber was als Verpflichtungen einer Schutzmacht im attischen Seebund angesehen wurde, lief auf eine Hegemonie Athens unter den „Poleis“, den griechischen Stadtstaaten, hinaus. In der auf antike Weise, mit antiken Einschränkungen „demokratischen“ Machtvollkommenheit glaubte der „Stratege“ Perikles einen Krieg mit dem von Königen beherrschten Rivalen Sparta, riskieren zu müssen, den „Peloponnesischen Krieg“. Wechselseitig wurden Städte zerstört, ihre männlichen Einwohner massakriert und Frauen und Kinder in die Sklaverei verkauft, Getreidefelder verwüstet und Olivenhaine abgeholzt. Dass er einunddreißig Jahre dauern würde, konnte an seinem Beginn kaum jemand ahnen. Perikles benutzte seine Macht nicht dazu, seinen Ausbruch zu verhindern. Das konnte ihm eine Flucht aus den unbewältigten innenpolitischen Auseinandersetzungen gedeutet werden. Wenn es so war – es rettete ihn nicht. Athen wurde schon während der ersten Kriegsjahre von der Pest heimgesucht, einer der furchtbarsten des Altertums. Am Ende der zerrütteten römischen Adelsrepublik schilderte sie der Dichter Lukrez in seinem Lehrgedicht „Über die Natur der Dinge“ (VI. 1139 ff.). Die Sonnenfinsternis, die Anaxagoras auf Grund seiner genauen Berechnungen der Umlaufbahnen des Mondes um die Erde und der Erde um sie Sonne als natürliches Himmelsereignis vorausgesagt hatte, half Obskuranten, die Stimmung des abergläubischen Volkes auf ihre Seite zu bringen. 430 v. Chr. wurde Perikles abgesetzt.
Auch seine Familie fand keinen Frieden. Xanthippos, der ältere Sohn aus erster Ehe, heiratete eine „prachtliebende“ Frau, auf die wohl das zutraf, was Aspasia nur nachgesagt wurde. Er lebte auf großem Fuß, nannte seinen sparsamen Vater einen Geizhals, lieh sich auf den guten Namen des Strategen Geld, das er nicht zurückzahlte, bis es zum Prozess kam. Statt sich zu besinnen, fügte er der Schande, die auch seinen Vater traf, noch Spott und üble Nachrede hinzu: Dass die boshafte Verleumdung des Stesimbrotos, Perikles habe die eigene Schwiegertochter verführt, zuerst von ihm ausgestreut wurde, ist nicht auszuschließen. Xanthippos starb an der Pest, wenig später Paralos, sein jüngerer Bruder.
In der Bedrängnis durch Krieg und Epidemie suchte das Volk doch wieder Halt bei Perikles: Die Wiederwahl zum Strategen 429 v. Chr. richtete den gramgebeugten Mann noch einmal auf. Die Volksversammlung tat nun Abbitte und bestätigte die Aufhebung des „Bastardgesetzes“, so dass Perikles seinen gleichnamigen Sohn von Aspasia als seinen Erben einsetzen konnte. Der jüngere Perikles brachte es während des Peloponnesischen Krieges ebenfalls bis zum Amt des Strategen. Im Jahr 406 v. Chr. gehörte er in der größten Seeschlacht, die sich Griechen in ihren selbstmörderischen Bruderkriegen je lieferten, bei den Argenusen nahe der Insel Lesbos, zu den siegreichen Befehlshabern. Doch auf ihrer Rückfahrt geriet die Flotte der Athener in einen verheerenden Sturm, der die Hälfte ihrer Schiffe in den Grund bohrte. Eine Anklage befand, der eingeschlagene Kurs sei unnötig waghalsig und deshalb diese Katastrophe vermeidbar gewesen. Die Härte des Gesetzes wollte anstelle einer Ehrung für den Sieger die Hinrichtung. Eine späte Rache der Feinde seines Vaters?
Perikles selbst war 429 v. Chr., im Jahr seiner Wiederwahl, an der Pest gestorben. Aspasia verheiratete sich noch einmal mit einem gemeinsamen Freund, dem Viehhändler Lysikles, war aber bald darauf wieder Witwe. Der mit ihr gleichaltrige Philosoph Sokrates (470–399 v. Chr.) soll noch ihre Nähe gesucht und in Gesprächen mit ihr seine Redekunst geschult haben. Athenaios teilt ein Gedicht in Hexametern aus Aspasias Hand mit. Es rät dem Philosophen, um ihn über seine Hässlichkeit hinwegzutrösten, mit seinem Wunsch, den Menschen zu gefallen, auf die „Gaben der mächtigen Muse“ zu vertrauen.
Literaturhinweise:
Herodot, Das Geschichtswerk
Thukydides, Der Peloponnesische Krieg
Plutarch, Parallel-Biografien: Perikles
Athenaios, Das Gelehrtenmahl
Beloch, J., Die attische Polis seit Perikles, o. O. 1884
Bengtson, H.: Griechische Geschichte, München 1969
Ehrenberg, V., Sophokles und Perikles, München 1956
Forrest, W. G., Wege zur hellenischen Demokratie, München 1966
Meier, Ch., Athen. Ein Neubeginn der Weltgeschichte, Berlin 1993
Miltner, F., in: Paulys Real-Encyclopädie der klassischen Altertumswissenschaften (RE), XIX, 779 u. 784 ff.
Prestel, G., Die antidemokratische Strömung im Athen des 5. Jahrhunderts, o. O. 1939
Schachermayr, F., Perikles, Stuttgart, Berlin, Köln 1970
Schachermayr, F., Die frühe Klassik der Griechen, Berlin, Köln, Mainz 1966
Schmidt, A., Perikles und sein Zeitalter, 1877–79
Willrich, H., Perikles, Göttingen 1936
2. DER REIZ DES VERBOTENEN: Kaiser Caligula
Sobald Gespräche über Erotik und Sexualität den Inzest streifen, fällt auf, dass er in allen Kulturen der Weltgeschichte ein Problem war. In manchen Stammesgemeinschaften, die bis ins 20. Jahrhundert als „Naturvölker“ bezeichnet wurden, war Geschlechtsverkehr zwischen Blutsverwandten nicht verboten. Oft handelte es sich um Inselbewohner, denen auch der Kannibalismus nichts Anstößiges war. In manchen frühen Hochkulturen wurde die Geschwisterehe zum Privileg der höchsten Herrscher. So selbstverständlich uns das Inzestverbot erscheint, so umstritten ist seine Herkunft. Eine Tabuisierung hat nüchternes Nachdenken darüber lange gehemmt. Der Inzest gilt in unserer zivilisierten Welt als ein ebensolches Unding wie der Kannibalismus, was nicht ausschließt, dass er immer wieder vorkommt.
Die ältesten Mythen allerdings bewahren in allen Kulturkreisen eine Erinnerung daran, dass der Inzest einmal eine natürliche Tatsache gewesen sein muss. Wie hätten die ersten Menschen, die Nachkommen von Adam und Eva, sich anders fortpflanzen können? Die Genesis der Thora und des Alten Testaments unterstellt stillschweigend, dass ihre Kinder und Kindeskinder zwangsläufig über Generationen inzestuös verkehrt haben. Mit welcher Götterfamilie man es auch zu tun bekommt, keine war groß genug, dass ihre Genealogie ohne inzestuöse Verbindungen ausgekommen wäre. Den nomadisierenden Urhorden ließ das eingeschränkte Angebot an Partnern einfach keine Wahl. Und wenn im Matriarchat zwar immer die Mutter, aber selten der Vater eines Kindes feststand, konnte es nicht ausbleiben, dass Geschwister und Halbgeschwister sich paarten. Da gab es kein Verbot. Also war es nicht unsittlich. In der Religionsgemeinschaft der Mormonen in Utah führte eine ähnliche Zwangslage dazu, dass bis 1892 nicht nur die Polygamie, sondern auch die Ehe zwischen nahen Blutsverwandten geduldet wurde.
Mythische Inzeste dienten in frühgeschichtlicher Zeit manchen Adelskasten dazu, ihren inzestuösen Ehen eine Aura der Heiligkeit zu verleihen. Für eine kleine und erlesene Gruppe der Gesellschaft galt als Norm, was später verboten war. Bei den Pharaonen im alten Ägypten und in der Dynastie der Sassaniden im alten Iran war es üblich, dass an der Spitze der Adelspyramide nur Geschwister oder Halbgeschwister ihre einzig legitimen Nachfolger zeugten. Noch in hellenistischer Zeit, als an den Ufern des Nil die griechische Kultur die altägyptische überlagerte, herrschte das geschwisterliche Ehepaar Ptolemaios II. Philadelphos und Arsinoe II., und auch in dem altpersischen Herrschergeschlecht der Achämeniden schlossen Herrscher Geschwisterehen. Waren nicht Zeus und Hera und andere olympische Götterpaare eigentlich Geschwister? Im alten Peru kapselte sich der Herrscherclan der Inkas vom „Hatun-Runa“, dem „großen Haufen“ des Volkes, ab, indem er die sonst allgemein verbotene Inzestehe als seine Norm pflegte. Wie Sonne und Mond Geschwister waren, so zeugte der Inka, der Sohn des Sonnengottes Inti, seinen legitimen Nachfolger mit seiner Schwester, der Coya.
Im dynastischen Inzest verschafft sich ein extremer Adelspurismus Geltung. Nur das eigene Blut ist würdig, die Herrscherreihe fortzusetzen. Gleichsam im genealogischen Rückwärtsgang beruft sich die Herrscherkaste auf eine Abkunft von Göttern und versucht durch eine Art heiliger Zuchtwahl von gottgleichem Geblüt zu bleiben. In der Gregorius-Legende bewahrt selbst das christliche Mittelalter einen Rest davon: Die Über-Sünde einer unwissentlich geschlossenen Geschwisterehe zieht eine Über-Buße des blutschänderisch gezeugten Sohnes nach sich, deren Weihe ihn zum Papst, einer Art Über-Menschen der Christenheit, prädestiniert.
Mit Versuchen, die geheimnisvolle Herkunft des heute so selbstverständlichen, in seiner wechselvollen Geschichte jedoch rätselhaften Inzestverbotes zu klären, sind in den zurückliegenden zwei Jahrhunderten verschiedene Theorien einander gegenübergetreten. Einhelligkeit gibt es bis heute nicht. Schützt sich die Gesellschaft mit dem Inzestverbot vor „Inzucht“ und vor den Erbschäden einer durch sie bedingten Degenereszenz? Gab es vor allem soziale Beweggründe? Oder hemmt eine natürliche „Inzestscheu“, eine warnende „Stimme des Blutes“, wie bis heute vielfach noch angenommen wird, ein geschlechtliches Begehren zwischen Geschwistern? Wo aber bleibt diese Stimme, wenn wie in jenem Fall des Gregorius die Geschwister oder im Fall der Jokaste und des Ödipus Mutter und Sohn früh getrennt werden und einander bei der Wiederbegegnung einander nicht kennen und das Verbotene nur aus Versehen geschieht? Macht die Vertrautheit von Kindesbeinen an erotisch kalt, oder kann sie wie in anderen Inzestgeschichten gerade eine besondere Liebe hervorrufen? Hat die Psychoanalyse Recht, wenn sie behauptet, nicht der Abscheu vor dem Inzest sei das Problem, sondern ein heimliches Streben danach? Schürt gerade das Verbot einen erotischen Reiz? Ist das Inzestverbot, wie Claude Lévi-Strauss erörtert, eine soziale Institution, gleichbedeutend mit dem Übergang der Natur zur Kultur?