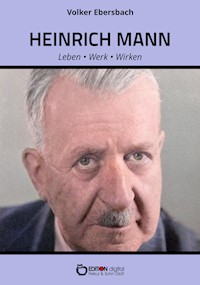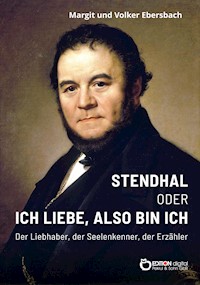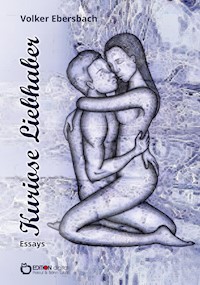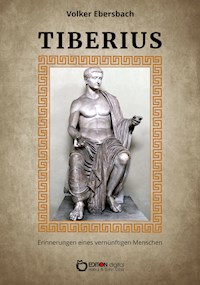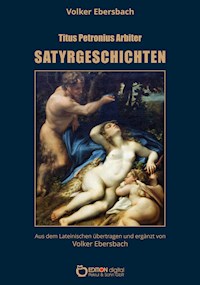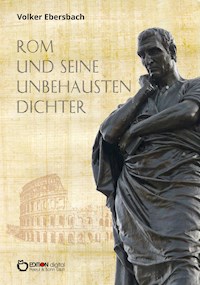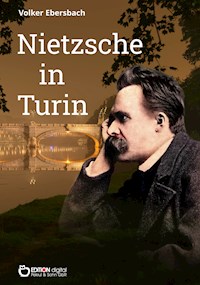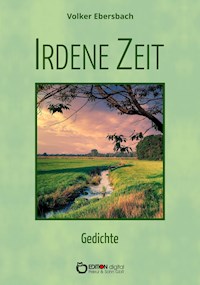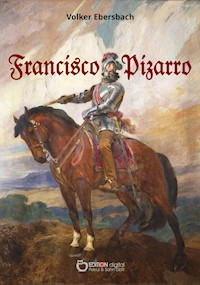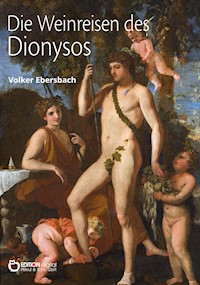10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was weiß man über Bernburg? Bernburg an der Saale. Lohnt sich das überhaupt? Es ist ein dickes Buch über die kleine Residenz, die erste und älteste unter den Residenzen der anhaltinischen Fürstentümer, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts Herzogtümer wurden. Und geschrieben hat es ein gebürtiger Bernburger, der in seiner Vorbetrachtung einen hübschen Vergleich zieht: Spielerisch könnte man Bernburg als ein kleineres, ärmlicheres, schlecht weggekommenes Geschwisterchen neben Weimar stellen. Nicht nur, dass auch Weimar einmal von einem Askanier regiert wurde: Die Grafen von Orlamünde, die im 13. und 14. Jahrhundert, bis sie 1375 ausstarben, die Herrschaft über Weimar innehatten, waren Verwandte Albrechts des Bären gewesen wie übrigens auch Uta von Ballenstedt, die Gemahlin des Landgrafen Ekkehard von Thüringen, an dessen Seite sie unter den Statuen der Stifter im Westchor des Naumburger Doms steht. Lohnt es trotzdem, sich mit Bernburg zu befassen? Mit Bernburg an der Saale. Nach der Lektüre dieses dicken Bernburg-Buches, das sich nach Auskunft seines Verfassers an interessierte Leser wendet, nicht an Wissenschaftler, die sich in den Quellen selbst auskennen, darf man diese Frage mit Ja beantworten. Denn der Leser erfährt sehr viel über die Stadt und ihr Schloss und über die dort bis 1863 herrschenden Anhaltinischen Fürsten der Linie Anhalt-Bernburg – von da an wurde die Saale-Residenz von Dessau aus regiert. Und der Leser erfährt viel über Persönlichkeiten, die in verschiedener Weise mit eben jenem Bernburg zu tun haben. Dazu gehören der Minnesänger Heinrich I., Fürst von Anhalt, ein Enkel Albrechts des Bären, Till Eulenspiegel, der auch in Bernburg seine tollen Späße getrieben haben soll, der Offizier und Dichter Ewald von Kleist, der einen Teil seiner Werke in Bernburg schrieb, natürlich auch Goethe, der mit Herzog Alexius Friedrich Christian von Bernburg im Briefwechsel stand, um seine Werke schützen zu lassen, die beiden Durchreisenden Novalis und Eichendorf, der Maler und Schriftsteller Wilhelm von Kügelgen sowie Kaiser Napoleon, der dort 1813 seine Pferde gewechselt hat und Bismarck, der dort fast einmal Erster Minister geworden wäre, und – kleiner Zeitsprung – DDR-Stararchitekt Hermann Henselmann, der dort seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Es ist ein dickes und schönes Lesebuch über Bernburg, das man vielleicht am besten in kleinen Abschnitten genießen sollte. Es lohnt sich jedenfalls. Bernburg an der Saale wie dieses Lesebuch über Bernburg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 660
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Die kleine Residenz
Ein Lesebuch über Bernburg
ISBN 978-3-96521-740-9 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 2005 in der Kulturstiftung Bernburg, veröffentlicht mit Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt, des Landkreises Bernburg und der Sparkasse Elbe-Saale.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Vorbemerkung
Dieses Lesebuch wendet sich an interessierte Leser, nicht an Wissenschaftler, die sich in den Quellen selbst auskennen. Es verzichtet daher auf einen wissenschaftlichen Apparat. Leser, die sich über die hier vorgelegten Texte hinaus zu den einzelnen Themen kundig machen und über die historischen Hintergründe und Zusammenhänge der ausgewählten Abschnitte vergewissern wollen, seien auf die angefügte Literaturauswahl verwiesen.
Vorbetrachtung: Eine kleine deutsche Residenz
Über die deutsche Kleinstaaterei ist in den zurückliegenden zweihundert Jahren viel geklagt worden. Die politische Zersplitterung des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation brachte es mit sich, dass über ganz Deutschland verstreut große und kleine ehemalige Residenzstädte heranwuchsen. Die kleineren Residenzen haben manche Ähnlichkeit miteinander. Vor- und Nachteilen ihrer geografischen Lage und ihrer Verkehrsverbindungen, aber auch manchem Zufall verdanken sie es, dass sie meist erst im 18. und 19. Jahrhundert zu unterschiedlicher Bedeutung gelangten.
Spielerisch könnte man Bernburg als ein kleineres, ärmlicheres, schlecht weggekommenes Geschwisterchen neben Weimar stellen. Nicht nur, dass auch Weimar einmal von einem Askanier regiert wurde: Die Grafen von Orlamünde, die im 13. und 14. Jahrhundert, bis sie 1375 ausstarben, die Herrschaft über Weimar innehatten, waren Verwandte Albrechts des Bären gewesen wie übrigens auch Uta von Ballenstedt, die Gemahlin des Landgrafen Ekkehard von Thüringen, an dessen Seite sie unter den Statuen der Stifter im Westchor des Naumburger Doms steht.
Johannes Werner, Herausgeber von Werken und Briefen Wilhelm von Kügelgens und Wilhelmine Barduas, nannte im Geleitwort seines Buches „Die Schwestern Bardua“ Ballenstedt eine „kleine Residenz“. Dieselbe Bezeichnung trifft auf Bernburg zu. Weimar hatte kaum mehr Einwohner als Bernburg und lebte auch nicht eben üppig, als die früh verwitwete Mutter des Herzogs Carl August zuerst Wieland und dann Goethe in ihre kleine Residenz rief, der dann Herder und Schiller holte, an deren Fersen sich wieder andere Literaten hefteten, bis es kaum noch einen deutschen Schriftsteller gab, der nie in Weimar gewesen war. Man stelle sich einmal spielerisch vor: Fürst Friedrich Albrecht von Anhalt-Bernburg, 1735 geboren, wäre im richtigen Alter gewesen, um Anna Amalia von Braunschweig-Wolfenbüttel, geboren 1739, zu heiraten, die Nichte Friedrichs des II. von Preußen, die das Vorbild des Weimarer „Musenhofes“ aus Wolfenbüttel schon mitbrachte und damit zu verwirklichen begann, dass sie den Dichter Christoph Martin Wieland als Erzieher ihrer Söhne nach Weimar zog, der dann Goethe - … Wir brauchen nicht weiter zu spekulieren: Friedrich Albrecht war noch nicht Herzog, sondern nur Fürst und wäre für die Wolfenbütteler Prinzessin keine gute Partie gewesen. Zum Herzog wurde erst sein Sohn und Nachfolger Alexius Friedrich Christian 1806 durch Kaiser Franz II. in Wien erhoben. Das kostete Anhalt-Bernburg ein gutes Stück Geld. Aber Alexius war der letzte Fürst des im selben Jahr sich auflösenden Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation, der vom Kaiser in Wien zum Herzog erhoben wurde. Die Fürsten von Anhalt-Köthen und Anhalt-Dessau wurden dann Herzöge von Napoleons Gnaden.
Eine Verbindung zwischen den beiden kleinen Kleinstaaten Anhalt-Bernburg und Sachsen-Weimar kam aber doch zustande: Die Malerin Caroline Bardua (1781-1864), in Ballenstedt geboren und durch ihren Vater, den Kammerdiener Johann Adam Bardua (1740-1818), dem Hof sehr nahe aufgewachsen, lebte vom September 1805 bis zum Mai 1807 in Weimar und entwickelte das „mannichfaltige Talent“, das Goethe ihr bescheinigte, an der vom Dichter gegründeten Zeichenakademie bei dessen Freund und Kunstberater, dem aus der Schweiz stammenden „Kunscht-Meyer“, weiter, bevor sie in Dresden bei Gerhard von Kügelgen (1772-1820), dem Vater des anhalt-bernburgischen Hofmalers Wilhelm von Kügelgen (1802-1867), Unterricht nahm und dann in Berlin ihre Karriere forsetzte. Caroline Bardua porträtierte Goethe in ihrer Weimarer Zeit zweimal, gewann die Silbermedaille der Zeichenakademie und wurde der Herzoginmutter Anna Amalia vorgestellt. Johanna Schopenhauer schrieb am 7. November 1806 an ihren Sohn, den späteren Philosophen Arthur Schopenhauer, Mademoiselle Bardua sei ein Wunder an Talent: sie wird in kurzem die erste Malerin in Deutschland sein; dazu spielt sie das Klavier und singt in großer Vollkommenheit“ (zitiert nach: Charlotte Marlo Werner, Goethes Herzogin Anna Amalia, Düsseldorf 1996, S. 312).
Die zahlreichen Ähnlichkeiten kleiner deutscher Residenzen bringen es mit sich, dass sie alle irgendwie in einer erfundenen kleinen Residenz wiedererkennbar sind: Thomas Mann zeichnet in den ersten Kapiteln seines 1909 erschienen zweiten Romans „Königliche Hoheit“, der nicht so berühmt werden sollte wie sein Erstling, die „Buddenbrooks“, das Bild einer kleinen deutschen Residenz um 1900, das sich aus Gemeinsamkeiten solcher Städte zusammensetzt. In Bernburg ist der große Romancier niemals gewesen; er kannte die Stadt wahrscheinlich nicht einmal dem Namen nach. Und doch lassen sich in der für „Königliche Hoheit“ erdachten Residenzstadt Grimmburg und der dazugehörigen Sommerresidenz Hollerbrunn frappante Parallelen zu Bernburg und Ballenstedt erkennen:
Die Grimmburg beherrschte von einem buschigen Hügel das malerische Städtchen des gleichen Namens, das seine grauen Schrägdächer in dem vorüberfließenden Stromarm spiegelte und von der Hauptstadt in halbstündiger Fahrt mit einer unrentablen Lokalbahn zu erreichen war. Auf manchen alten Stichen, etwa dem von Puttrich, wird Schloss Bernburg auch als „Die Bernburg“ bezeichnet. Von Dessau, ab 1863 Hauptstadt des vereinigten Herzogtums Anhalt und danach auch Hauptstadt des gleichnamigen Freistaates, benötigt man mit dem kaum rentablen Regionalzug auch heute noch bei günstiger Verbindung etwa eine halbe Stunde.
Weiter heißt es bei Thomas Mann: Sie stand dort oben, die Burg, in grauen Tagen vom Markgrafen Klaus Grimmbart, dem Ahnherrn des Fürstengeschlechts, trotzig erbaut, mehrmals seither verjüngt und instandgesetzt, mit den Bequemlichkeiten der wechselnden Zeiten versehen, stets wohnlich gehalten und als Stammsitz des Herrscherhauses, als Wiege der Dynastenfamilie auf eine besondere Weise geehrt.
Die Wiege des anhaltischen Fürstenhauses war freilich Ballenstedt und nicht Bernburg, und dass ein Erbprinz noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts, in wilhelminischer Zeit wie im Roman „Königliche Hoheit“ im „Stammschloss“ geboren werden musste, traf auf Bernburg nicht mehr zu, seit mit dem Tod des letzten Herzogs Alexander Carl 1863 die Linie Anhalt-Bernburg ausgestorben war und die alte Saaleresidenz von Dessau aus regiert wurde. Doch Markgraf war auch Albrecht der Bär, der Urahne des Bernburger Fürstenhauses, gewesen.
Während die Bernburger Askanier nach der Verlegung der Residenz durch den Fürsten Friedrich Albrecht 1765 vor allem im Sommer lieber in Ballenstedt wohnten, halten es bei Thomas Mann die Grimmburger mit ihrem Hollerbrunn gerade umgekehrt: Übrigens war das Stammschloss ein Zufluchtsort, so würdig und friedevoll. Als Sommersitz mochte man ihm, der Kühle seiner Gemächer, des schattigen Reizes seiner Umgebung wegen, sogar vor dem steiflieblichen Hollerbrunn den Vorzug geben.
Als Aufstieg vom Städtchen beschreibt Thomas Mann eine ein wenig grausam gepflasterte Gasse zwischen ärmlichen Heimstätten und einer geborstenen Mauerbrüstung. Die Namen der Gässchen am Bernburger Schlossberg, die dazu passen würden, fallen Ortskundigen sofort ein.
Die Ähnlichkeiten mit der alten Bernburger Bergstadt gehen weiter:
Das Schloss bildete zusammen mit der Hofkirche einen grauen, unregelmäßigen und unübersichtlichen Komplex mit Türmen, Galerien und Torwegen, halb Festung, halb Prunkgebäude. Verschiedene Zeitalter hatten an seiner Ausgestaltung gearbeitet, und große Partien waren baufällig, verwildert, schadhaft, zum Bröckeln geneigt. Es fiel steil ab zum westlichen, tiefer gelegenen Stadtteil, zugänglich von dort auf brüchigen, von rostigen Eisenstangen zusammengehaltenen Stufen.
Das Innere der Burg schildert Thomas Mann als einer umfassenden Auffrischung und Verschönerung unterzogen durch einen gewissen Johann Albrecht III. Dem entspräche in der Bernburger Burg vielleicht die Umgestaltung zu einem Renaissance-Schloss durch die Fürsten Wolfgang, Joachim Ernst und Christian I., gewiss auch die klassizistische Ausgestaltung mehrerer Räume im Langhaus durch Herzog Alexius. Mit einem Kostenaufwand war der offenbar historistische Umbau vorgenommen worden, der viel Gerede hervorgerufen hatte. Die Einrichtung der Wohngemächer war in einem zugleich ritterlichen und behaglichen Stil ergänzt und erneuert, die Wappenfliesen des „Gerichtssaales“ waren genau nach dem Muster der alten wiederhergestellt worden. Die Vergoldung der verschmitzten, in vielfachen Spielarten wechselnden Kreuzbogengewölbe zeigte sich glänzend aufgemuntert, alle Gemächer waren mit Parkett ausgestattet … Es fehlte an nichts.
Im Bernburger Schloss allerdings fehlte es schon ab 1765 an manchem, ab 1863 jedoch an vielem. Eine Restauration, wie sie Schloss Ballenstedt als Witwensitz der 1902 im einundneunzigsten Lebensjahr verstorbenen Herzogin Friedrike teilweise erfuhr, wäre auch Schloss Bernburg gut bekommen. Als der Christiansbau 1894 völlig ausbrannte, ging seine kostbare Inneneinrichtung unwiederbringlich verloren.
Da Herzog Alexander Carl infolge einer Geisteskrankheit nicht regieren konnte, war 1855 nach zähem Ringen mit Dessau die Regentschaft seiner Gemahlin Friedrike zuerkannt worden. Ihr Versuch, den jungen preußischen Politiker Otto von Bismarck als Ersten Minister zu gewinnen, misslang. So kam 1851 Bismarcks Freund Max von Schaetzell in die kleine Residenz. Die Höflinge, mit denen sich die Herzogin Friedrike umgab, mag man sich so vorstellen, wie sie im Roman „Königliche Hoheit“ beschrieben werden. Die historisierende Atmosphäre der Räumlichkeiten lässt sich leicht vom Rathaus an der Blumenuhr auf das Schloss übertragen:
Die Minister, der Generaladjutant, der Hofprediger und die Hofchargen, neun oder zehn Herren, warteten in den Repräsentationsräumen des Hoch-Erdgeschosses. Sie wanderten durch den Großen und den Kleinen Bankettsaal, wo zwischen den Lindemannschen Gemälden Arrangements von Fahnen und Waffen hingen; sie lehnten an den schaftartigen Pfeilern, die sich über ihnen zu bunten Gewölben entfalteten; sie standen vor den deckenhohen und schmalen Fenstern und blickten durch die in Blei gefassten Scheiben hinab über Fluss und Städtchen; sie saßen auf Steinbänken, die um die Wände liefen. (…) Der heitere Tag machte den Tressenbesatz der Uniformen, die Ordenssterne auf den wattierten Brustwölbungen, die breiten Goldstreifen auf den Beinkleidern der Würdenträger erglitzern.
Dieser Glanz gilt der Geburt des Erbprinzen, für die es in Bernburg keine Entsprechung mehr gab. Dem Schlossalltag in „Königliche Hoheit“ jedoch war der in Bernburg gewiss vergleichbar:
Verblichenheit und Zerschlissenheit herrschte bis in die Räume hinein, die unmittelbar der Repräsentation und der hohen Familie zum Aufenthalt dienten, zu schweigen von den vielen unbewohnten und unbenutzten, die in den ältesten Gegenden des vielfältigen Gebäudes lagen und in denen es nichts als Erblindung und Fliegenschmutz gab. Seit einiger Zeit war dem Publikum der Zutritt versagt – eine Maßnahme, die offenbar in Hinsicht auf den anstößigen Zustand des Schlosses getroffen war. Aber Leute, die Einblick hatten, Lieferanten und Personal, gaben an, dass aus mehr als einem stolzen und steifen Möbelstück das Seegras hervorguckte.
Mit einer ähnlich abgeschabten Pracht war es nach dem Ersten Weltkrieg im Bernburger Schloss ganz zu Ende. In der ersten deutschen Republik gehörte Bernburg nun zum Freistaat Anhalt mit dem Regierungssitz in Dessau. Die Presse meldete am 24. März 1919: Vom Schlosse. Die Räume, die für die herzogliche Familie reserviert waren, sind geräumt, die teilweise recht kostbare Einrichtung hat u. a. den Erlös von 5000 Mark gebracht. Die Räumlichkeiten werden an zwei Amtsgerichtsräte zu Wohnzwecken vermietet werden.“ Repräsentative Räume waren schon unter der Monarchie für die Gerichtsbarkeit genutzt worden.
Das Land um die kleine Residenz schildert Thomas Mann in „Königliche Hoheit“ als ein schönes, stilles, unhastiges Land. Die Wipfel seiner Wälder rauschten verträumt; seine Äcker dehnten und breiteten sich, treu bestellt; sein Gewerbewesen war unentwickelt bis zur Dürftigkeit.
So mancher mitteldeutsche Kleinstaat mag diesem Bild entsprochen haben. Wer aber das folgende liest, fragt sich, ob der Romanautor das Ländchen Anhalt-Bernburg wirklich nicht gekannt hat:
Es besaß Ziegeleien, es besaß ein wenig Salz- und Silberbergbau – das war fast alles. Man konnte allenfalls noch von einer Fremdenindustrie reden, aber sie schwunghaft zu nennen, wäre kühn gewesen. Die alkalischen Heilquellen, die (…) dem Boden entsprangen und den Mittelpunkt freundlicher Badeanlagen bildeten, machten die Residenz zum Kurort.
Das Sol- und Moorbad Bernburg, das sich 1902 das ansehnliche Kurhaus im Jugendstil zulegte, bezog „Deutschlands stärkste Sole“ von den Deutschen Solvaywerken, die sie im Schacht Plömnitz förderten. Doch weder der Residenz Grimmburg noch dem „Kurort“ Bernburg ist es je gelungen, ihr Wasser in der Welt zu Ehren zu bringen.
Die finanzielle Lage solch einer kleinen Residenz, wie sie in „Königliche Hoheit“ geschildert wird, fordert Vergleiche mit Bernburg geradezu heraus: Ein Herr von Knobelsdorff kann sich bissige Anmerkungen über die Romantik seines Fürsten, wie sie an deutschen Höfen bis 1918 verbreitet war, nicht verkneifen. Sie ist ein Luxus, ein kostspieliger! Exzellenz, (…) bedenken Sie, dass zuletzt der ganze Missstand fürstlicher Wirtschaft in diesem romantischen Luxus seinen Grund hat. Das Übel erblickt er darin, dass die Fürsten eigentlich nur Grundherren sind und ihre Einkünfte aus landwirtschaftlichen Erträgnissen kommen, nicht anders als die der Bauern. Sie haben sich bis zum heutigen Tage noch nicht entschließen können, Industrielle und Finanzleute zu werden. Sie lassen sich mit bedauerlicher Hartnäckigkeit von gewissen obsoleten und ideologischen Grundbegriffen leiten, wie zum Beispiel den Begriffen der Treue und Würde. Das vereitele vorteilhafte Veräußerungen. Hypothekarische Verpfändungen, Kreditbeschaffung zum Zwecke wirtschaftlicher Verbesserungen scheint ihnen unzulässig. Die Administration ist in der freien Ausnutzung geschäftlicher Konjunkturen streng gehindert – durch Würde. (…) Wer so sehr wie diese Menschenart auf gute Haltung sieht, kann und will mit der Freizügigkeit und ungehemmten Initiative minder eigensinniger und ideell verpflichteter Geschäftsleute natürlich nicht Schritt halten.
So machte denn bis 1880 das Kapital auch um Bernburg einen Bogen. Die Eisenbahnstrecke Magdeburg–Leipzig wurde 1840 fertiggestellt und lief, da Bernburg zögerte, über Köthen. Der Eisenbahnanschluss kam für Bernburg erst 1846. Er blieb bis heute eine Nebenstrecke. Die Linie Berlin–Sangerhausen machte 1878 das benachbarte Güsten zu einem weiteren Eisenbahnknotenpunkt, auf dem die Bernburger umzusteigen hatten.
Woher sollte das Geld kommen?
Da ist ein Hoftheater, die Galerie, die Bibliothek zu unterstützen, heißt es in „Königliche Hoheit“ weiter. Da sind hundert Ruhegehälter zu zahlen, – auch ohne Rechtspflicht, aus Treue und Würde. Und auch davon ist die Rede, dass der Monarch bei der letzten Überschwemmung eingesprungen ist. Kein Wunder, dass im Landtage der kleinen Residenz alljährlich von wenig günstigen finanziellen Ergebnissen gesprochen wurde, weil die Lokalbahnen sich nicht rentierten und die Eisenbahnen nichts abwarfen, – betrübende, aber unabänderliche und eingewurzelte Tatsachen, die der Verkehrsminister in lichtvollen, aber immer wiederkehrenden Ausführungen mit den friedlichen kommerziellen und gewerblichen Verhältnissen des Landes sowie mit der Unzulänglichkeit der heimischen Kohlenlager erklärte. Krittler fügten dem etwas von mangelhaft organisierter Verwaltung der staatlichen Verkehrsanstalten hinzu. Aber Widerspruchsgeist und Verneinungen waren nicht stark im Landtage; eine schwerfällige und treuherzige Loyalität war unter den Volksvertretern die vorherrschende Stimmung.
Auch Anhalt-Bernburg hatte seine Erfahrungen mit der Unzulänglichkeit der heimischen Kohlenlager. Wo jetzt die Wiendorfer Teiche, der Schachtsee, auch Kartoffelsee genannt, und der Thyls – ehemals Thyls Schacht – bei Neugattersleben zum Baden einladen, wurde im 19. Jahrhundert in kleinem Umfang Braunkohle gefördert.
Welche Bernburgerin, welcher Bernburger versteht nun seine Stadt, die jahrhundertelang eine kleine Residenz war, immer noch nicht? Aber auch seine Vorfahren mag mancher in Thomas Manns Roman charakterisiert finden, Bewohner des Harzwaldes und seines Vorlandes mit den Auenwäldern an Saale, Bode und Wipper:
Das Volk liebte seinen Wald. Es war ein blonder und gedrungener Typ mit blauen grübelnden Augen und breiten, ein wenig zu hoch sitzenden Backenknochen, ein Menschenschlag, sinnig und bieder, gesund und rückständig. Es hing am Wald seines Landes mit den Kräften seines Gemütes. (…) Die Armen lasen ihr Brennholz im Walde, er schenkte es ihnen, sie hatten es frei. Sie gingen gebückt, sie sammelten allerlei Beeren und Pilze zwischen seinen Stämmen und hatten ein wenig Verdienst davon.
Von den Flussauen der Saale blieben nur inselhafte Reste übrig, und selbst die Wälder des Harzes sind heute mehr denn je gefährdet. Auch das gehört zum Umland der kleinen Residenz, die Thomas Mann in „Königliche Hoheit“ schildert:
Dennoch hatte man sich am Walde versündigt, gefrevelt daran seit Jahren und Menschenaltern. Der Forstbehörde gebrach es an der politischen Einsicht, dass der Wald als ein unveräußerliches Gemeingut erhalten und bewahrt werden musste, wenn er nicht nur den gegenwärtigen, sondern auch den kommenden Geschlechtern Nutzen gewähren sollte, und dass es sich rächen musste, wenn man ihn, uneingedenk der Zukunft, zugunsten der Gegenwart maßlos kurzsichtig ausbeutete.
(Die Zitate wurden der zwölfbändigen Thomas-Mann-Ausgabe des Aufbau-Verlages, Berlin und Weimar 1965, Band 1, S. 420 ff., entnommen.)
Dass bei der Erfindung des Stadtnamens Kaisersaschern an der Saale, nicht weit von Halle, in seinem Altersroman „Doktor Faustus“ neben Kaiserslautern das Bernburg benachbarte Aschersleben eine Rolle gespielt hat, räumte Thomas Mann selbst ein. Eine Gewisse Ähnlichkeit Bernburgs mit diesem Kaisersaschern stellte schon der Architekt Hermann Henselmann in seinen Erinnerungen fest (Hermann Henselmann, Drei Reisen nach Berlin, Berlin 1981, S. 8). Der fiktive Erzähler des „Doktor Faustus“ ist ein gewisser Serenus Zeitblom. Sein zurückhaltend bewunderndes Verhältnis zu der genialen Romangestalt Adrian Leverkühn, in seiner Erinnerung ein geschwinder Kopf, ähnelt dem des nachmaligen Bernburger Gymnasialdirektors Carl Hachtmann zu Friedrich Nietzsche, seinem Mitschüler am Naumburger Domgymnasium und Kommilitonen an der Universität Bonn. Zeitblom ordnet sich selbst bescheiden in die mäßige Höhe eines halbgelehrten Mittelstandes ein und nimmt auch teil an der spürsinnigen Aufgeschlossenheit jüdischer Kreise. Der Apothekerssohn, zur kleinen katholischen Gemeinde gehörig, wie sie auch in Bernburg ihre Tradition hat, akademisch gebildet, ein ins zwanzigste Jahrhundert versprengter Humanist, dem alles Dämonische abgeht, erinnert sich an Kaisersaschern, als sähe er die Türme der Marien- und der Nikolaikirche, die Breite Straße, wie sie einmal war, zumal die Nummer 103, oder die alte „Freiheit“, die Saaleufer zwischen Schleuse und Marktbrücke, den Hasenturm, den Kugelweg, den alten Karlsplatz:
Es ist über diese Stadt (…) zu sagen, dass sie atmosphärisch wie schon in ihrem äußeren Bilde etwas stark Mittelalterliches bewahrt hatte. Die alten Kirchen, die treulich konservierten Bürgerhäuser und Speicher, Bauten mit offen sichtbarem Holzgebälk und überhängenden Stockwerken, Rundtürme mit Spitzdächern in einer Mauer, baumbestandene Plätze, mit Katzenköpfen gepflastert.
Diese Stadt hat wie andere ihrer Art auch Originale und Sonderlinge, und in gewissen volkshochschulartigen Vorträgen, zu denen nur etwa ein halbes Dutzend Zuhörer kommen, zergliedert Wendell Kretzschmar, eine musikwissenschaftliche Lokalgröße, im Saale der Gesellschaft für Gemeinnützige Thätigkeit Beethovens Klaviersonate op.lll.
Das Dämonische des Mittelalters sieht Zeitblom auf jene unheimliche Art sich wieder beleben, wie es auch in Bernburg um das Jahr 1933 geschah:
Aber in der Luft war etwas hängengeblieben von der Verfassung des Menschengemütes in den letzten Jahrzehnten des fünfzehnten Jahrhunderts, Hysterie des ausgehenden Mittelalters, etwas von latenter seelischer Epidemie: Sonderbar zu sagen von einer verständig-nüchternen modernen Stadt (aber sie war nicht modern, sie war alt, und das Alter ist Vergangenheit als Gegenwart, eine von Gegenwart nur überlagerte Vergangenheit) – möge es gewagt klingen, aber man konnte sich denken, dass plötzlich eine Kinderzug-Bewegung, ein Sankt-Veits-Tanz, das visionär-kommunistische Predigen irgendeines „Hänselein“ mit Scheiterhaufen der Weltlichkeit, Kreuzwunder-Erscheinungen und mystischem Herumziehen des Volkes hier ausbräche. Natürlich geschah es nicht – wie hätte es geschehen sollen? Die Polizei hätte es nicht zugelassen, im Einverständnis mit der Zeit und ihrer Ordnung. Und doch! Wozu nicht alles hat in unseren Tagen die Polizei stillgehalten – wiederum im Einverständnis mit der Zeit, die nachgerade dergleichen sehr wohl wieder zulässt.
Zeitblom, inzwischen im bayrischen Freising lebend, fürchtet dann im Zweiten Weltkrieg – auch dieser Zwiespalt ist so zeit- wie ortstypisch – einen deutschen Sieg mehr als eine Niederlage, sehnt diese Niederlage, wenn auch mit Gewissensqualen, herbei und bangt um seine ferne Heimatstadt an der unteren Saale:
Aber die Türme erheben sich ja immer noch am selben Platz, und ich wüsste nicht, dass bis jetzt ihr architektonisches Bild durch die Unbilden des Luftkrieges irgendwelchen Schaden genommen hätte, was um seiner historischen Reize willen auch im höchsten Grade bedauerlich wäre.
(Die Zitate wurden der zwölfbändigen Thomas-Mann-Ausgabe des Aufbau-Verlages, Berlin und Weimar 1965, Band 6, S. 50 ff., entnommen.)
Bernburg blieb denn auch von Bomben weitgehend verschont, und auch das tragische Schicksal Halberstadts, das noch am 8. April 1945 zerstört wurde, weil es sich den amerikanischen Truppen nicht ergab, blieb der Saalestadt erspart.
Doch zurück zu Bernburgs Herkunft aus der vielbeklagten deutschen Kleinstaaterei! Johann Peter Eckermann, Goethes Sekretär, verzeichnet in seinen „Gesprächen mit Goethe“ unter dem 23. Oktober 1828 die bekannten Worte, die der Hoffnung des Dichters auf ein geeintes Deutschland Ausdruck verleihen:
Mir ist nicht bange, (…) dass Deutschland nicht eins werde; unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das ihrige tun. Vor allem aber sei es eins in Liebe untereinander, und immer sei es eins gegen den „auswärtigen Feind“. Es sei eins, dass der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reiche gleichen Wert habe; eins, dass mein Reisekoffer durch alle sechsunddreißig Staaten ungeöffnet passieren könne. Es sei eins, dass der städtische Reisepass eines weimarischen Bürgers von dem Grenzbeamten eines großen Nachbarstaates nicht für unzulänglich gehalten werde, als der Pass eines Ausländers. Es sei von Inland und Ausland unter deutschen Staaten überall keine Rede mehr. Deutschland sei ferner eins in Maß und Gewicht, in Handel und Wandel, und hundert ähnlichen Dingen, die ich nicht alle nennen kann und mag.
Goethe vermag aber auch in der Zersplitterung Deutschlands Vorteile zu erkennen, die bis heute die deutsche Kulturlandschaft prägen und für Bernburgs Entwicklung in mancher Hinsicht zutreffen. Das Carl-Maria-von-Weber-Theater, dieses klassizistische Juwel, hätte sich eine so kleine Stadt nie leisten können, wäre sie nicht die Residenz eines deutschen Kleinstaates gewesen. Goethe fährt fort:
Wenn man aber denkt, die Einheit Deutschlands bestehe darin, dass das sehr große Reich eine einzige große Residenz habe und dass diese eine große Residenz wie zum Wohl der Entwicklung einzelner großer Talente, so auch zum Wohl der großen Masse des Volkes gereiche, so ist man im Irrtum. (…) Wodurch ist Deutschland groß als durch eine bewundernswürdige Volkskultur, die alle Teile des Reiches gleichmäßig durchdrungen hat? Sind es aber nicht die einzelnen Fürstensitze, von denen sie ausgeht und welche ihre Träger und Pfleger sind? Gesetzt, wir hätten in Deutschland seit Jahrhunderten nur die beiden Residenzstädte Berlin und Wien, oder gar nur eine, da möchte ich doch sehen, wie es um die deutsche Kultur stände, ja auch um einen überall verbreiteten Wohlstand, der mit der Kultur Hand in Hand geht. Deutschland hat über zwanzig im ganzen Reiche verteilte Universitäten und über hundert ebenso verbreitete öffentliche Bibliotheken, an Kunstsammlungen und Sammlungen von Gegenständen aller Naturreiche gleichfalls eine große Zahl; denn jeder Fürst hat dafür gesorgt, dergleichen Schönes und Gutes in seine Nähe heranzuziehen. Gymnasien und Schulen für Technik und Industrie sind im Überfluss da, ja es ist kaum ein deutsches Dorf, das nicht eine Schule hätte. Wie steht es aber um diesen letzten Punkt in Frankreich? Und wiederum die Menge deutscher Theater, deren Zahl über siebzig hinausgeht, und die doch auch als Träger und Beförderer höherer Volksbildung keineswegs zu verachten. Der Sinn für Musik und Gesang und ihre Ausübung ist in keinem Lande verbreitet wie in Deutschland, und das ist auch etwas!
Nun denken Sie aber an Städte wie Dresden, München, Stuttgart, Kassel, Braunschweig, Hannover und ähnliche; denken Sie an die großen Lebenselemente, die diese Städte in sich selber tragen; denken Sie an die Wirkungen, die von ihnen auf die benachbarten Provinzen ausgehen: und fragen Sie sich, ob das alles sein würde, wenn sie nicht seit langen Zeiten die Sitze von Fürsten gewesen.
Frankfurt, Bremen, Hamburg, Lübeck sind groß und glänzend, ihre Wirkungen auf den Wohlstand von Deutschland gar nicht zu berechnen: würden sie aber wohl bleiben was sie sind, wenn sie ihre Souveränität verlieren und irgendeinem großen deutschen Reich als Provinzialstädte einverleibt werden sollten? Ich habe Ursache, daran zu zweifeln.
(Zitiert nach: Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe 1823– 1832, Berlin 1962, S. 434 ff.)
Was die Einheit gegen den auswärtigen Feind betrifft, so hat sich hier, vielleicht durch Eckermanns Vermittlung, ein wenig von dem Zeitgeist eingeschlichen, der nach den Befreiungskriegen von 1813 das deutsche Nationalgefühl beeinflusste. Denn eigentlich kennt man Johann Wolfgang von Goethe als einen Freund Frankreichs und als einen Bewunderer Napoleons. Goethe war in seinem politischen Denken Europäer und als Stifter des Begriffes Weltliteratur bereits ein Weltbürger. Aber als Freund und Minister des Herzogs und späteren Großherzogs Carl August von Sachsen-Weimar-Eisenach schaute der greise Dichter auf Jahrzehnte der Erfahrung mit der deutschen Kleinstaaterei zurück. So konnte er sich dieses differenzierte Urteil bilden, das zugleich auch alle die Vorteile erkennt, die viele kleine Residenzen einer großen Hauptstadt gegenüber haben. Im föderalistischen Prinzip der heutigen Bundesrepublik Deutschland wirken diese Vorteile weiter.
Einleitung: Früheste Zeugnisse
Aus: Franz Stieler, Wann tritt Bernburg in das Licht der Geschichte? Bernburg 1961
Der Bernburger Regionalhistoriker Franz Stieler überraschte 1960 die Einwohner der Stadt Bernburg ebenso wie die damaligen „Stadtväter“ durch die Mitteilung, Bernburg habe 1961 sein tausendjähriges Bestehen zu feiern. Denn die Stadt hatte 1938 gerade erst ihr achthundertjähriges Bestehen begangen. Die Differenz war durch eine unterschiedliche wissenschaftliche Bewertung zweier Urkunden entstanden.
Leopold Friedrich Franz Stieler wurde am 8. November 1893 in Leopoldshall geboren, hart an der Grenze Anhalts, und sein Vorname erinnert an den musenfreundlichen „Vater Franz“, den Herzog von Anhalt-Dessau (1740–1817). Nach seiner Schulzeit absolvierte er das Anhaltische Landesseminar Köthen. Er wurde Lehrer, lehrte kurze Zeit in Jeßnitz, Dessau und Meinsdorf bei Roßlau und wirkte 1914–1923 als Lehrer, Kantor und Ortsvorsteher in Großwirschleben, Kreis Bernburg. 1923–1935 war er Lehrer im benachbarten Plötzkau. In Kunstgeschichte, Englisch, Französisch und Latein bildete er sich ständig weiter, an der Universität Halle, 1940 auch an der Universität Leipzig. 1935–1945 lehrte er an der Mittelschule in Jeßnitz/Anhalt. 1945–1958 unterrichtete er an verschiedenen Schulen Bernburgs. Bis 1966 war er auch Dozent an der Bernburger Volkshochschule und gewann auf Exkursionen und durch Vorträge das Interesse zahlreicher Zuhörerinnen und Zuhörer für die anhaltische Regionalgeschichte und Baugeschichte und auch für literarische, kunstgeschichtliche und philosophische Themen. 1966 verzog er nach Rellingen bei Hamburg, wo er sich bis ins hohe Alter, allmählich erblindend, regionalgeschichtlichen Forschungen auch über die neue Wohngegend widmete. Fast fünfundneunzigjährig starb er am 19. September 1988.
Franz Stieler verfasste zahlreiche heimatgeschichtliche Aufsätze für Zeitschriften, für die Beilage „Der Bär“ zum „Anhalter Kurier“ und für andere Tageszeitungen, auch einige Reiseberichte, Stimmungsbilder in literarischer Prosa und Gedichte. Als Broschüren veröffentlichte er u.a. „’Gallassische Ruin’ – Bernburgs ärgste Notzeit im Dreißigjährigen Kriege“ (Bernburg 1931) – eine Darstellung der Ereignisse des Herbstes 1644 in Bernburg –, „Revolution in Anhalt Bernburg“ (Bernburg 1948), „Die Leuchte des Bernburger Schlosses“ (Bernburg 1953), „Die Entstehung des Renaissanceschlosses Bernburg“ (Bernburg 1954), „Das untere Saalegebiet“ (Bernburg 1954) und „Wann tritt Bernburg in das Licht der Geschichte?“ (Bernburg 1961). Die folgenden Ausschnitte vermitteln außer den Sachinformationen zugleich eine Kostprobe davon, wie Franz Stieler seine gründliche wissenschaftliche Arbeit mit einem meisterhaften Stil zu verbinden wusste (S. 5 ff., 46 ff., 73 ff. und 94 ff).
Zur Geschichte der Forschung (S. 5–10)
Waldau auf den westlichen Randhöhen des Saaletales ist Bernburgs ältester Stadtteil, dessen Geschichte im Jahre 806 beginnt. Damals sandte Karl der Große seinen Sohn, den König Karl, mit einem Heere an die östliche Grenze seines Reiches. Wenn auch die Unternehmungen des Kaisers an Saale und Elbe nicht über Grenzsicherungen hinausgingen, so waren diese Züge doch zielbewusst und hart.
Zu Waldau (Waladala) hielt Karl der Jüngere seine Heerschau. Dann schickte er einige Abteilungen (scaras), die als Rückendeckung wahrscheinlich sorbische Grenzstämme beschäftigen und zurückhalten sollten, über die Elbe. Er selbst überschritt die Saale, zog durch Guerenafeldo und wandte sich gegen den „übermütigen König Milito“, der über die Sorben jenes Gebietes herrschte und in den Kämpfen erschlagen wurde. Nach diesem Erfolg marschierte Karls Heer nordwärts, erreichte die Elbe, verwüstete die angrenzenden slawischen Gaue und zerstörte eine Anzahl sorbischer Befestigungen. (2)
Bei einem Angriff Karls des Jüngeren auf Böhmen, den drei Kampfgruppen aus Bayern aus dem Maintal und vom Nordthüringgau her vorwärtstrugen, war schon 805 das sächsische Heer mit slawischen Hilfstruppen über Werinofelda und Demelcion (Dalaminzien zwischen Elbe und nördlicher Mulde, Meißen und Döbeln) in das Land jenseits des Erzgebirges bis zur Eger vorgestoßen. (3) Werinofelda hat seinen Namen möglicherweise nach dem germanischen Stamm der Weriner oder Warnen erhalten. Es wird in den verschiedenen Handschriften auch Guerenaveldo, Huerenaeldo, Hwerenaveldo, Guerchaveldo, Hwerenofelda, Werinfelda und Hwernofelda genannt (4) und hat Auseinandersetzungen über die erste Erwähnung Bernburgs hervorgerufen. Für solche historischen Funde und Untersuchungen war die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts als die Zeit der aufblühenden heimatlichen Geschichtsforschung, die sich auf die großartigen Ergebnisse der modernen wissenschaftlichen Methoden und die Publikationen in den „Monumenta Germaniae historica“ sowie andere neuzeitliche Urkundensammlungen stützen konnte, außerordentlich günstig. Bereits 1865 hielt Otto von Heinemann in seinem damaligen Wirkungsort Bernburg einen Vortrag, in dem er darauf hinwies, dass Waladala mit Waldau bei Bernburg gleichzusetzen ist. (5) Heinemann, der später Oberbibliothekar in Wolfenbüttel war und den bekannten Kodex Diplomaticus Anhaltinus herausgegeben hat, machte auch dem Landesarchivar Ferdinand Siebigk für seine anhaltische Heimatkunde entsprechende Angaben. Durch Friedrich Knoke und spätere Forscher wurde diese Auffassung Heinemanns erhärtet. (6)
Friedrich Knoke war es auch, der in seiner „Anhaltischen Geschichte“ 1893 die Auffassung vertrat, dass Werinofelda eine frühe Namensform für Bernburg wäre. (7) Gegen die Beweisführung Knokes wandte sich sofort Dr. Karl Schultze in Rieder. (8) Bei Werinofelda handele es sich um keinen Ort, sondern um eine Landschaft, ähnliche Gedanken äußerte 1912 Wilhelm Müller in seiner Dissertation über die Entstehung der anhaltischen Städte. (9)
Diese Meinung wird bis zur jüngsten Zeit vertreten, wobei man das Werinofeld als eine Landschaft betrachtet, die südlich der Elbe etwa von der Saale bis über die Mulde reichte, also große Teile des ehemaligen Ländchens Anhalt umfasst. (10)
So kommt dem Jahr 806 für die Bernburger Geschichte dennoch eine gewisse Bedeutung zu. Wenn damals die Franken bei Waldau lagerten, dann blickten sie hinunter auf die Saale, die in weitem Westbogen einen Talgrund umschloss, durch den der Weg zu den östlichen Höhen führte. Wo die gegenüberliegenden Hochflächen den Weg in die Weite des Ostens wiesen, lag Werinofelda.
Der weitverbreiteten und altüberlieferten, aber unbewiesenen Auffassung, dass Bernburg eine sehr alte Stadt sei und bereits im 10. Jahrhundert bestanden habe, kam Professor Paul Höfer im Jahre 1907 mit einer verblüffenden Feststellung entgegen. (11) Er setzte die „civitas Brandanburg“ der Urkunde Ottos I. vom 29. Juli 961 unserem Bernburg gleich und begründete die Behauptung damit, dass der Ortsname mit dem Worte „brennen“ Zusammenhänge, Brandenburg die hochdeutsche und Bernburg die niederdeutsche Form sei. „Da auch die Reihenfolge der aufgezählten rechtssaalischen Burgen durchaus auf Bernburg hinweist, so wird man gar nicht anders können, als anzunehmen, dass hier in der Urkunde von 961 Bernburg zum ersten Mal genannt worden ist.“
Diese Idee nahm im Jahre 1921 Professor Walter Möllenberg wieder auf, indem er sie erweiterte und dafür eintrat, dass Bernburg an der Saale und Brandenburg an der Havel ihre Namen nach einem slawischen Brennabor erhalten hätten. (12)
Unterdessen setzte sich jedoch eine andere Auffassung durch, die von dem Gedanken ausging, dass Burg und Stadt Bernburg verhältnismäßig junge Gründungen seien. Der verdienstvolle Professor Dr. Emil Weyhe, dessen anhaltische „Landeskunde“ noch heute von keinem Heimatforscher entbehrt werden kann, sagt eindeutig: „1138 tritt das Schloss ’Berneborch’ in die Geschichte“. (13)
Die Autorität Weyhes beeinflusste zweifellos auch eine Reihe anderer Forscher. Hermann Wäschke äußert sich zwar in der „Geschichte Anhalts“ zum Alter Bernburgs nicht, verzeichnet jedoch als erste Nachricht über die Saalestadt die Tatsache, dass Bernburg 1138 verbrannt wurde. Es kann nicht bestritten werden, dass auch er mit diesem Jahre den Beginn der Bernburger Geschichte sieht. (14)
Zu 1138 meldet der Annalista Saxo: „Castrum quod Berneburch dicitur, igne crematum est propter tirannidem, quam inde marchionissa Eilica exercebat.“ („Die Burg, die Berneburch genannt wird, ist wegen der Tyrannei, welche die Markgräfin Eilika von dort ausübte, niedergebrannt worden.“) (15)
Die Magdeburger Schöppenchronik sagte das auf Niederdeutsch so: „Des jares was die grevinne Elica to Berneborch sere unbescheiden in dem lande, dar umme wart Berneborch vorbrant.“ (16) Welcher Art die Tyrannei der Markgräfin Eilika war, können wir nicht mehr feststellen, wohl aber, dass der Bericht von ihren Gegnern kam. In dem Kampfe zwischen Hohenstaufen und Welfen standen die Askanier auf Seiten der Hohenstaufen. Der Erzbischof von Magdeburg jedoch, ein Parteigänger der Welfen, berannte und zerstörte Burg Bernburg wie auch 1139 die benachbarte Burg Plötzkau, die damals noch Sitz der Plötzkauer Grafen war.
In der Folgezeit gewann die Auffassung von der Entstehung Bernburgs um 1100 immer mehr an Boden, wobei die Stellung Möllenbergs nur als Querschlag betrachtet wurde, der ernstere Beachtung nicht verdiente. Für 1138 als das Jahr der ersten Erwähnung Bernburgs traten besonders Hans Peper (17) und Hermann Siebert ein. Alle Gründe, die für das Jahr 1138 geltend gemacht werden konnten, fasste H. Siebert zusammen, erweiterte sie und ordnete sie zu einem beachtenswerten Beweise. (18)
Den breitesten Raum nahm in Sieberts Abhandlung die Widerlegung aller Möglichkeiten ein, die für das Jahr 961 sprachen. Ernstliche Gründe für seine Annahme, dass Bernburg erst nach 1100 entstanden sei, vermochte er außer der Zitierung des Jahres 1138 kaum anzuführen. Daher verlegte er sich darauf, den Beweis zu führen, dass Bernburg im Jahre 961 als Burg oder als andere Siedlung nicht vorhanden gewesen sein konnte.
Immerhin lässt sich daraus erkennen, wie stark gerade in dem Hauptvertreter der These 1138 das Bewusstsein war, dass die Jahreszahl 961 für das geschichtliche Denken geradezu eine Aufforderung zur Vertiefung in dieses Problem bedeutete.
Unterdessen war eine Feststellung gemacht worden, die den Vertretern der Anschauung, Bernburg sei erst im 12. Jahrhundert entstanden, sehr zustatten kam. Professor Hermann Größler in Eisleben wollte im Jahre 1906 als das Brandenburg der Urkunde 961 einen „Brinzenberg“ festgestellt haben, der südöstlich Könnern bei Dalena und Domnitz gelegen haben sollte. (19) Dieser Brinzenberg wurde dann durch Schultze-Gallera als „Brinzenburg“ in die historische Literatur eingeführt, die These mit so viel Sicherheit vertreten, dass die Brinzenburg bis heute sich in der gesamten einschlägigen geschichtlichen Darstellung gehalten hat und von den Verfechtern einer späteren Gründung Bernburgs als Hauptpunkt ihrer Beweisführung verwendet werden konnte. (20)
Dr. Sieberts Abhandlung „Wann entstand Bernburg?“ enthält folgende Leitgedanken: (21)
Das Brandenburg des Jahres 961 ist das wüste Brentin südöstlich Könnern zwischen Dalena, Domnitz und Dornitz, also die „Wüstung Brinzenburg“. Ein etwaiger Burgbezirk Bernburg um 979 „könnte nur rechts der Saale gelegen haben“. (20a) „Das rechtssaalische Gebiet bei Bernburg gehörte aber 961 zum Gau Serimunt und nicht zum Gau Nudzizi.“ Für einen Burgbezirk Bernburg war damals rechts des Flusses auch kein Raum. „Die Gegend, die dafür in Betracht kommen würde, gehörte zum Burgwardbezirk Grimschleben.“ Um 1100 war dieses Gebiet eingeklemmt zwischen Nienburger und Gernroder Lehenstücken, die der Erbauer von Burg und Altstadt Bernburg hauptsächlich aus Gernröder Klosterbesitz erwarb. Die Burg wurde ebenso wie die Altstadt erst kurz vor 1138 erbaut. Bei Bernburg rechts der Saale bestand keine Zehntberechtigung des Domstifts Magdeburg. „Hätte im Jahre 961 das Moritzstift zu Magdeburg, der Vorgänger des Erzstiftes, den Zehnten in der Bernburger Gegend (die Identität Brandenburgs der Urkunde von 961 mit Bernburg vorausgesetzt) erlangt, so würde das Erzstift doch wohl diesen Vorteil benutzt haben, um in diesen Gegenden das Aufkommen der Fürstenmacht zu verhindern und die hiesige Landschaft ebenso mit der Zeit zu Magdeburger Besitz zu machen wie die Bezirke Werttin, Löbejün, Rothenburg, Laublingen und Trebnitz. Am wenigsten aber darf dann erwartet werden, dass Schloss Bernburg mit der Altstadt, der Neustadt und der Ansiedlung vor dem Berge jemals ein Allodium des fürstlichen Hauses Anhalt werden konnte, als welches es sich in der Tat zur Zeit des Fürsten Bernhard VI. erweist. Wenn schon ein Besitz der anhaltischen Fürsten, so wäre es dann ein solcher nur gewesen in der Form eines erzbischöflich-magdeburgischen Lehens oder allenfalls als Reichslehen. Meines Erachtens fällt auch für die Beurteilung der Gründungszeit der Bernburg sehr ins Gewicht, dass weder zur Zeit der Ottonen noch der salischen Kaiser, also bis nach 1100, ein Ort oder eine Feste Bernburg in urkundlichen, registrativen oder annalistischen Zeugnissen erwähnt wird, während viele Orte der nächsten Umgebung, manche sogar öfter, angeführt werden“. (22)
Anmerkungen:
(1) Chron. Moiss. ad a. 806 (M G SS II S. 258). (= Chronicon Moissiacense)
(2) Vielleicht vertrat Milito slawische Einigungsbestrebungen.
(3) Chron Moiss. ad a. 805 ( M G SS II S. 258); auch die Annalen Einhards berichten über diese Züge.
(4) M G SS I 307 ff. u. II 256 ff.
(5) Mitt. (Mitteilungen des Vereins für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde) III S. 482. An dieser Stelle spricht Friedrich Knoke über die ersten Erwähnungen Waldaus durch U. Stechele und Otto v. Heinemann.
(6) Siebigk (Ferdinand Siebigk, Das Herzogtum Anhalt, Dessau 1867) S. 577. Hinweis auf diese Angabe wieder bei Knoke, Mitt. III S.483. Waladala ist trotz einiger gegensätzlicher Äußerungen (Förstemann-Jellinghaus, Altdeutsches Namenbuch II 2, Bonn 1916) unser Bernburger Waldau. Für Waldau an der Saale bei Bernburg entscheiden sich auch Gustav Reischel (Die Wüstungen der Provinz Sachsen und des Freistaates Anhalt. Mit besonderer Berücksichtigung der Kreise Bitterfeld und Delitzsch. Sachsen und Anhalt. Magdeburg 1926, Band 2, S. 226) und W. Möllenberg (Aus der Frühzeit der Geschichte Magdeburgs. Geschichtsblätter für Stadt und Land Magdeburg. 55. Jahrgang 1920). Auch Max Bathe äußert sich überzeugend zu diesem Problem (Bathe S. 17 siehe Anm. 10).
(7) Fr. Knoke, Anhaltische Geschichte (1. Band, Dessau 1893) S. 70–74.
(8) Karl Schulze, Ist der Ort Guerenafeldo an der Stelle der heutigen Altstadt Bernburg zu suchen? Mitt. VI S. 546 ff.
(9) Wilhelm Müller, Anhaltische Städte (Die Entstehung der anhaltischen Städte, Inaugural-Dissertation, Köthen 1912). Anmerkung 52, S. 89/92. – Müller stellt zwar auch das Jahr 1138 als den Zeitpunkt der ersten Erwähnung Bernburgs fest, verlegt aber die Entstehung besonders der Burg, wegen des Auftretens von Sattelhöfen auch die Anfänge der Stadt, in eine wesentlich frühere Zeit.
(10) (M.) Bathe (Die Sicherung der Reichsgrenze an der Mittelelbe durch Karl den Großen. Sachsen und Anhalt. Jahrbuch der Landesgeschichtlichen Forschungsstelle für die Provinz Sachsen und für Anhalt. Band XVI. Magdeburg 1940), S. 4, 27 auf 2 Karten, dazu Text von S. 32/34.
(11) (Paul) Höfer (Die Frankenherrschaft in den Harzlandschaften. Zeitschrift des Harzvereins für Geschichte und Altertumskunde. Wernigerode. 40. Jahrgang 1907. 1. Heft), S. 157. Professor Paul Höfer war vor 1900 in Bernburg tätig, später in Wernigerode und Blankenburg; er hat auch auf dem Gebiete der vorgeschichtlichen Forschung verdienstvoll gearbeitet. Paul Grimm (Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg. Handbuch frühgeschichtlicher Wall- und Wehranlagen, Teil I, Akademie-Verlag Berlin 1958, S.36) spricht über Höfers Arbeit folgendes Urteil aus: „Im Anschluss an die Forschungen K. Rübels und C. Schuchhardts schuf P. Höfer 1907 eine großzügige Übersicht dieser Zeit in seiner Arbeit 'Die Franken in den Harzlandschaften’. Leider blieb in der Folgezeit die archäologische Beweisführung, die seinen zunächst stark theoretischen Überlegungen hätte folgen müssen, aus.“
(12) (W.) Möllenberg (Urkundenbuch des Erzstifts Magdeburg I. Magdeburg 1937), S. 1 ff.
(13) (Emil) Weyhe (Landeskunde des Herzogtums Anhalt. 2 Bände. Dessau 1907) II, S. 217.
(14) Jedenfalls äußert er sich in keinem Teil seiner „Geschichte Anhalts“ über das Alter Bernburgs. Doch nimmt er gegenüber den verschiedenen Auffassungen eine vorsichtige Stellung ein (H. Wäschke, Geschichte Anhalts. 3 Teile. Köthen 1912 und 1913. I S. 21). Eine geschlossene Auseinandersetzung mit den Anfängen des Landes Anhalt fehlt bei ihm.
(15) M G SS VI 776. – M G SS XIV 186. Der Annalista Saxo befindet sich in der Bibliotheque nationale zu Paris. – Obgleich W. Müller (S. 92, Anmerkung 52) über Bernburgs Alter zu keinem abschließenden Urteil gelangt, setzt er ebenfalls den Beginn der Bernburger Geschichte auf das Jahr 1138.
(16) Wäschke, Geschichte Anhalts I, S. 115.
(17) (H.) Peper, Gründung Bernburgs (Die Gründung der Stadt Bernburg und ihre Entwicklung bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Anhaltische Geschichtsblätter. Doppelheft 6/7 1930–1931. Dessau 1931, S. 50–67), S. 50 ff. – H. Peper, Geschichte der Stadt Bernburg, Bernburg 1938, S. 22/26, S. 38/39.
(18) (Hermann) Siebert, Wann entstand Bernburg? (Anhaltische Geschichtsblätter. Dessau 1925) S. 49 ff.
(19) Hermann Größler, Die Einteilung des Landes zwischen unterer Saale und Mulde in Gaue und Archidiakonate. (Mit einer Karte.) Mitteilungen des Vereins für Erdkunde zu Halle. 1905, S. 26.
(20) (Siegmar) Schultze-Gallera, Wanderungen (durch den Saalekreis, Halle 1920) III, S. 117 ff. – „Brinzenburg“ fehlt in keinem ernstzunehmenden wissenschaftlichen Werke.
(20a) Das Jahr bezieht sich auf die Schenkung des Kastellbezirks Grimschleben an Kloster Nienburg.
(21) Siebert, S. 49–59.
(22) Siebert, S. 53.
Geschichtliche Äußerungen über das hohe Alter Bernburgs (S. 46-49)
Dass Bernburg ursprünglich Allod war, vergaßen die Amtsstellen des Ländchens nicht. So äußerte sich 1563 der Verfasser eines Besitz- und Einkommenverzeichnisses: „Das Amt Bernburg soll ehemals erblich gewesen sein, dass es auch die Frauchen haben erhalten können. Itzund ist es männlich Lehngut. Aber gleichwohl, da kein männlich Erbe zu gewarten, habens die Herren zu verkaufen potiusque absit.“ (1)
Geschichtlichen Äußerungen über das hohe Alter Bernburgs kommt insofern eine bemerkenswerte Beweiskraft zu, als sie die Linie der Beweisführung nicht stören, sondern unterstützen.
Dass Bernburg sehr alt sei, ja, zu den ältesten Teilen des Ländchens Anhalt gehöre, war bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts allezeit eine selbstverständliche Auffassung.
Wie historische Auseinandersetzungen für den Nachgeborenen stets ein ertragreiches Feld der verschiedensten Erkenntnisse darstellen, so sind auch die Erbstreitigkeiten des 15. Jahrhunderts zwischen den Fürsten von Anhalt und Hedwig, Witwe des letzten Bernburgers der alten Linie, für Bernburgs Geschichte sehr aufschlussreich. In einem Briefe, der den Bernburger Wirren gewidmet ist, nennen die Fürsten das Schloss Bernburg „Unser unsers alten herkommenden Stammes der Fürsten zu Anhalt Herz und Enthalt“. (2) Diese Äußerung kam von allen Vertretern des Landes Anhalt.
Als im Jahre 1641 das Bernburger Salbuch aufgestellt worden war, bemerkte Präsident Heinrich von Börstel in seinen „Erinnerungen und Bedenken wegen des aufgerichteten Salbuches“: „So wird dieses Buch des fürstlichen Amts Bernburg Salbuch titulieret. Es erstrecket sich aber des fürstlichen Hauses Bernburg und der dazu gehörigen Herrschaft Würde und Dignität viel weiter, als dass man es nur ein Ambt nennen sollte, welcher Namb so wenig bei den Rechtslehrern als in den alten Verträgen in dergleichen Fall gebrauchet wird. Wollte derowegen unmaßgeblich dafür halten, dass der Titul derogestalt einzurichten:
Das uralten fürstlich anhaldischen Haupt-, Stamb- und Residenzhaus Bernburg und der dazugehörigen Herrschaft Salbuch.
Denn das fürstliche Haus oder Schloss Bernburg ist das Caput, das dazugehörige Territorium und Herrschaft ist das Corpus, das Ambt aber ist nur Species einer auf gewisse Maß anbefohlener Jurisdiction und Ambtierung, so von der fürstlichen Herrschaft delegieret wird“. (3)
In den folgenden Ausführungen hebt Börstel nochmals hervor, dass Bernburg „ein Haupt- und Stammhaus der Fürsten zu Anhalt sei“.
Bei Streitigkeiten zwischen Bernburg und dem Erzstift Magdeburg wegen des Zinkenbusches bei Kustrena und wegen Lösewitz heißt es im Jahre 1650: „Es hat das fürstlich Haus und Ambt Bernburgk sein gewisses, von vielen hundert Jahren abgemessenes und erhaltenes Territorium und Gebiete bis jenseits dem Dorfe Kustrena“, ein Gebiet, das seit undenklichen Zeiten „zum uralten fürstlichen Haus und Ambt Bernburgk“ gehört. (4)
Im Jahre 1644, also mitten in den schlimmsten Nöten des Dreißigjährigen Krieges, kam es zu inneranhaltischen Streitigkeiten wegen der „Wegtreibung des Nienburger Schlossviehes und der Bürgerherde vom Anger am Altenburger Busch“. Solche Triftsteitigkeiten waren Legion, und diese kleinen Kämpfe endeten auch nicht während des fürchterlichen Völkerkrieges. In scharfer Weise äußerte sich dazu die Bernburger Regierung: „Item worumb man die Erblande zur uralten Herrschaft Bernburg geringer halten wollte als einem Prälatenkloster, welches nach dem Pragerischen Frieden dörfte eingezogen und privieret werden.“ (5)
Johann Christoph Beckmann beginnt seine Beschreibung der Stadt Bernburg mit folgenden Worten: „Die Stadt und Schloss Bernburg ist eine von den ältesten Wohnsitzen des fürstlichen Hauses Anhalt.“
„In besonderer Betrachtung der obgemelten Anteile des Fürstentums Anhalt machen wir einen Anfang von dem fürstlichen Bernburgischen Anteile als dem ältesten Sitz der hochlöblichen Vorfahren des hochfürstlichen Hauses Anhalt und in welchem die meisten Begebenheiten, so von den alten Historicis angemerket worden, sich zugetragen haben.“ (6)
Ähnliches weiß Beckmann von dem Schloss Bernburg zu berichten: „Das vornehmste aber nicht nur von dieser Seite, sondern von ganz Bernburg ist das fürstliche Schloss, eines von den ältesten und zugleich wegen der vielen Begebenheiten dieser Orten das berühmteste in dem ganzen Fürstentum Anhalt.“ (7)
Kein älterer Historiker, in welchem Teile Anhalts er auch lebte, dachte daran, Gleiches von den anderen Hauptstädten Anhalts zu bemerken. Niemals wurde die Auffassung, dass Bernburg das älteste Stück des anhaltischen Landes sei, von irgendeiner Seite bestritten. Bernburg stand in der öffentlichen Meinung außerhalb aller Lehensbeziehungen und wurde in jedem Falle als der Kern des Landes angesehen.
Anmerkung
(1) (Reinhold) Specht (Das anhaltische Land- und Amtsregister des 16. Jahrhunderts) II (Magdeburg 1938) Amt Bernburg Seite 3. In der von Specht zitierten Form lautet die Stelle: „Das ampt Bernburgk soll ehemals erblich gewesen, das es auch die frewchen haben heben können, itzund ist es menlich lengut, aber gleichwoll, do kein menlich erbe zu gewarten, habens die hern zu vorkeufen, potiusque absit.“ (=was besser unterbliebe)
(2) (Johann Christoph) Beckmann (Historie ds Fürstenthums Anhalt. 3 Bände, Zerbst 1710) III (1716), S. 123.
(3) LAO (Landesarchiv Oranienbaum) Abt. Bbg. C la Nr. 5f 1642.
(4) LAO Abt. Bbg. D 5 Nr. lb.
(5) LAO Abt. Bbg. C 10b Nr. 4.
(6) Beckmann III S. 114.
(7) Beckmann III S. 123.
Die Urkunde vom 29. Juli 961 (S. 70–75)
In seinem Bestreben, das Moritzkloster zu Magdeburg mit Gütern und Einnahmen zu bedenken und ihm damit als Zentrum des erstehenden Erzbistums Magdeburg ein beachtenswertes Gewicht zu verleihen, stattete Otto I. die Domkirche reichlich mit Zehnteinnahmen aus. Infolge seiner Schenkung bildete sich zwischen Magdeburg und Halle längs der Saale und Elbe eine Zehntlinie des Domstiftes.
Zu den wichtigsten Diplomen dieser Zeit gehört die Schenkungsurkunde vom 29. Juli 961, die zu Ohrdruf in Thüringen ausgestellt worden ist. (2) Noch im Jahre 1658 war das Original vorhanden. Wie viele andere Diplome ging es verloren, als nicht mehr das aufmerksame Auge derjenigen Personen auf ihm ruhte, für welche es die Grundlage einer wichtigen Einnahme bildete.
(…)
Wertvolle Quellen für den Text der Urkunde sind zwei Abschriften im Landeshauptarchiv Magdeburg, die, aus dem 11. und 15. Jahrhundert stammend, sich in den Copiaren la und 6 finden.
(…)
Die Unterschrift des Diploms ist von Otto I. eigenhändig „vollzogen“ worden.
Die Urkunde lautet in deutscher Übersetzung:
„Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit.
Otto, König durch die Gunst göttlicher Gnade.
Kund sei allen unseren Getreuen, den jetzigen und natürlich auch den zukünftigen, dass wir zum Heil unserer Seele und zur Verringerung unserer Sünden und selbstverständlich auch zum Heil unserer Gattin und ebenso unserer Nachkommen und besonders auch zur Festigkeit unseres Reiches an das Kloster der Heiligen Moritz und Innozenz in dem Orte, der Magadaburg heißt und wo die heiligen Märtyrer leiblich ruhen, geschenkt und übergeben haben in den folgend benannten Gauen und Orten:
(…)
Nudcici, in dem die Burg Vitin und der Burgbezirk namens Liubuhun und Zputinesburg, der Burgbezirk Loponoh und Trebonizi und der Burgbezirk, der Brandanburg heißt, sich befinden,
den gesamten Zehnt in vorgenannten Gauen und Burgbezirken von allen Erträgen und Nutzungen, von denen die Christen den Zehnt offensichtlich geben und den die anderen gleichfalls zahlen müssen, wenn sie durch Gottes Gnade Christen geworden sind.
(…)
Und damit die Rechtsgültigkeit dieser unserer Schenkung, wie wir schon vorher gesagt haben, durch die kommenden Zeiten fest und unverrückbar fortdauere, haben wir daraufhin befohlen, diese gegenwärtige Anordnung niederzuschreiben und durch den Abdruck unseres Siegelringes zu bestätigen, was wir eigenhändig bekräftigt haben.
Zeichen und Siegel des Herrn Otto (M), des unbesiegbaren Königs. Liutulf, der Kanzler, hat es an Stelle des Erzkaplans Bruno geprüft und unterschrieben (Si.).
Gegeben am 29. Juli 961 der Fleischwerdung des Herrn, in der Indiktion IV, nämlich dem 26. Jahre der Regierung des erhabenen Königs Otto; gegeben zu Ordorp; im Namen Christi gesegnet Amen.“ (7)
Anmerkung
(1) (E. O.) Kuujo (Das Zehntwesen in der Erzdiözese Hamburg-Bremen bis zu seiner Privatisierung. Helsinki 1949) S. 14: „Bei der Schaffung der wirtschaftlichen Grundlage für die junge Kirche hat die Zehntabgabe allem Anschein nach von Anfang an einen hervorragenden Platz eingenommen.“ – LHA Mg. (Landeshauptarchiv Magdeburg) Cop. 6 f.,7f., 9.
(2) Ordorp = Ohrdruf.
(7) Für die Hilfe bei der Übersetzung dieser Urkunde danke ich Frau Johanna Wege und besonders Herrn Oberstudiendirektor i. R. O. Kersten, welcher der Urkundenübersetzung die Fassung gegeben hat, die dem Druck zugrunde liegt.
Zusammenfassung und Ergebnis (S. 94 ff.)
Im Jahre 1907 wurde zum ersten Mal darauf hingewiesen, dass eine Urkunde Kaiser Ottos I. für Bernburg außerordentliche Bedeutung gewinnen könne. Otto schenkte am 29. Juli 961 zu Ohrdruf dem Moritzkloster Magdeburg, aus dem nach des Kaisers Willen das Erzbistum Magdeburg hervorging, den Zehnt der Christen u. a. in einem Landstreifen längs des rechten Saaleufers von Giebichenstein bis in die Gegend des heutigen Bernburg. Paul Höfer nahm als die „civitas Brandanburg“, die nach den Angaben dieser Urkunde im Gau Nudzizi lag, unsere Saalestadt an.
Nach dem Stand der Gauforschung um 1920 schien die heimatliche Wissenschaft zu der Annahme berechtigt, dass der Saale-Fuhne-Winkel nicht zum Gau Nudzizi, sondern zum Gau Serimunt zu zählen sei.
(…)
Im Blick auf die jüngsten Ergebnisse der Gauforschung besteht kein Anlass, das Gebiet der Fuhne von Burg Pfuhle bis zur Mündung des Flüsschens in die Saale dem Gau Nudzizi abzusprechen.
*
Nach der Urkunde vom 29. Juli 961 ist ein „Brandenburg-Berneburg“ nur anzunehmen, wenn es rechts der Saale lag.
Für eine frühzeitige Besiedlung des heutigen Bernburger Schloss- und Stadtgeländes waren alle natürlichen und geschichtlichen Vorbedingungen gegeben. Östlich und westlich der Saale in näherer und weiterer Umgebung Bernburgs bestanden keine ernstlichen Hinderungen für Verkehr und wirtschaftliche Ausdehnung. Der Ort lag mitten in einem Gebiet, das zwischen Harzvorbergen sowie Fuhne im Süden und dem Urstromtal der Elbe im Norden eine kräftige westöstliche Bewegung zuließ, ja, verlangte. Bernburgs Weg in die Welt, schon zur Zeit Karls des Großen benutzt, war die Straße von Magdeburg über Waldau und dem gegenüberliegenden Ort nach Halle und anderen Städten des Südostens. Eine zweite wichtige Straße führte vom Harz zwischen Bode und Wipper über Bernburg und Latdorf an Borgesdorf vorüber zur Mulde und trug im späten Mittelalter den Namen „Bernburger Heerstraße“. Wie sehr die Saaleenge bei Bernburg zum Übergang über den Fluss benutzt worden ist, beweisen nicht nur die geschichtlichen Berichte, sondern auch die Situation der Stadt. Kennzeichnend für das Muster einer Stadtanlage, die einen wichtigen Flussübergang vermittelte, führt ein Straßenzug als städtebauliches Rückgrat Bernburgs von Nordwesten nach Südosten.
Möglicherweise ist der Übergang über die Saale im zehnten Jahrhundert dadurch erleichtert worden, dass außer dem breiten Hauptlauf der Röße auch Nebenarme des Flusses unter dem Schloss und im Bezirk der heutigen Talstadt die Stromtiefe minderten.
(…)
Bernburgs ursprüngliche Feldflur, zu der auch die bedeutendsten Ackerbreiten des Burggutes gehörten, umfasste annähernd 4 qkm „vor dem Berge Berneburg“ und die Talaue der Alt- und Neustadt von rund 1 qkm.
Ihre anfängliche Situation verwies die Burg mit Vorburg und Burgbezirk auf das rechte Saaleufer. Burg und Ort Bernburg wurden im 10. Jahrhundert durch den damaligen Hauptarm unserer Saale, die Röße, von den westlichen Saaleauen und den Höhen getrennt. Links der Röße – wie der Saale überhaupt – bestand keine Bernburger Feldmark. Unmittelbar an den Fluss schlossen sich die Gemarkungen von Waldau, Gnetzendorf und Zernitz an, von denen Zernitz und Gnetzendorf heute wüst sind. Die Bernburger Flur lag ja rechts der Saale „vor dem Berge“. Dementsprechend befand sich Bernburg ganz in der Diözese Magdeburg und bestätigte durch seine Zugehörigkeit zur Sedes (Erzpriesterstuhl) Brachstedt, die zwischen Fuhne und Saale nach Norden bis zur Fuhnemündung vorstieß, seine Eingliederung in den Gau Nudzizi.
Von hoher Bedeutung war stets die strategische Position des Platzes, auf dem Burg Bernburg stand. Gegen ein Vorhandensein der Burg bereits im 9. und 10. Jahrhundert erhebt die archäologische Forschung keine Einwände. Es gibt bedeutsame Auffassungen, welche die Burg vermissen und, falls sie nicht durch urkundliche Nachrichten bewiesen werden kann, aus anderen Gründen trotzdem als im 10. Jahrhundert als bestehend ansehen.
Für die Zeit, in der auf dem Giebichenstein, zu Wettin und Rothenburg, zu Plötzkau, Nienburg und Kalbe Höhenburgen vorhanden waren, müsste es ja auch sehr verwunderlich anmuten, wenn die Stelle bei Bernburg, die sich zur Anlage einer Burg geradezu anbot, nicht benutzt worden wäre. Der wuchtige Westbogen des Flusses unter dem „Berge“ verlieh der Feste besondere Kraft.
(…)
Wann die Saale ihren Hauptlauf geändert hat, ließ sich bisher nicht feststellen.
(…)
Unzweifelhaft lassen die Erwerbungen des Erzstiftes Magdeburg im Raume um Bernburg, die mit der Gründung des Moritzklosters begannen, das Bestreben erkennen, auch dieses Gebiet einflussmäßig zu durchdringen und ganz an sich zu bringen. Wenn jene Absicht nicht verwirklicht werden konnte, so lag das allein daran, dass dem Druck Magdeburgs nicht nur ein entschiedener Wille der Herren von Bernburg, sondern auch überlegene Eigentums- und Hoheitsrechte entgegenstanden, wie sie durch das Bernburger Allod gegeben waren. Es war mit Ballenstedt als ursprüngliches Eigentum der Askanier Ausgangspunkt und Zentrum aller Macht des Ländchens Anhalt.
(…) Im Laufe des Mittelalters ergriff die Landwirtschaft von Burg und Stadt Bernburg dieses Allod in seinem vollen Umfange, ging aber über die Grenzen des altüberkommenen Herrschaftsbereiches nicht hinaus.
(…)
*
In der geschichtlichen Forschung ist der Name eines Ortes für gewöhnlich das ausschlaggebende Erkennungsmittel. Wenn der Name von heute in Übereinstimmung gebracht werden kann mit der Form einer Erwähnung, die 1000 Jahre zurückliegt, dann sind die beiden Siedlungen identisch. Voraussetzungen für die Anerkennung der Gleichheit bestehen darin, dass auf Grund der urkundlichen Erwähnung die Orte an derselben Stelle gesucht und gefunden werden können, dass nicht doppeltes Auftreten des Namens Unsicherheit hervorruft oder abweichende Ortsbestimmungen in verschiedenen Diplomen die Gleichsetzung ausschließen. Es ist im Gegenteil notwendig, dass andere sachliche und sprachliche Gründe sowie urkundliche Angaben sie geradezu fordern.
Wie stützen schriftliche Unterlagen die bisherigen Untersuchungen?
Ottos I. Urkunde vom 29. Juli 961, welche die Gaue und Burgbezirke einer Zehntschenkung an das Magdeburger Moritzkloster aufzählte, nannte in ihrer überzeugenden Süd-Nordrichtung als letzten Ort „Brandenburg“ im Gau Nudzizi. Für die Gleichsetzung der „civitas Brandanburg“ mit dem „Berneburg“ des Mittelalters und dem heutigen Bernburg ist das Copiar 6 (Erzstift Magdeburg) im Landesarchiv Magdeburg von ausschlaggebender Bedeutung. Dieses Copiar aus dem 15. Jahrhundert mit seinen sorgfältigen Abschriften ist durch inhaltbestimmende Überschriften der Kopien, durch Randglossen und ein Inhaltsverzeichnis des 17. Jahrhunderts bemerkenswert. Die Glossen zu Urkundenabschriften, die sich auf Diplome des 10. Jahrhunderts beziehen, erweisen in allen Fällen genaueste Kenntnis der genannten Ortschaften, Irrtümer erscheinen ausgeschlossen.
Als Teil der Randglosse „decima“ zur Abschrift des Diploms vom 29. Juli 961 tritt „Brandenburg“ als „Berneburg“ auf. Im Inhaltsverzeichnis wird, wie wenn es sich von selbst versteht, „Brandenburg“ als „Berneburg“ registriert. Diese Identifizierung wie die sprachliche Untersuchung der beiden Namen Brandenburg und Berneburg ergeben, dass seit dem 10. Jahrhundert „Brandenburg“ an der Havel und „Bernburg“ an der Saale als Wortform aufgefasst werden, die mit dem Verb „brennen“ zusammmenhängen. Mit starkem Recht kann, wenn keiner der anderen möglichen Entwicklungsgänge angenommen wird, „Brandenburg“ als die hochdeutsche, „Berneburg“ als die niederdeutsche Form gelten.
Als Analogiebeispiel von eindringlicher Überzeugungskraft mag die Entwicklung der „Born“-Orte dienen. Die niederdeutsche „Bornform“, die sicherlich im Volksmunde stets gebräuchlich war, setzte sich nach jahrhundertelangen Schwankungen zwischen „Brunnen“ und „Born“ schließlich auch im Schriftdeutschen durch und wurde (Bornstedt, Borne) zum unabänderlichen Ortsnamen. Eine entsprechende sprachliche Entwicklung lässt sich für „Brandenburg-Berneburg“ festlegen. Während Bernburg an der Saale, das bis zum 16. Jahrhundert fast nur als „Berneburg“ auftritt, im 10. Jahrhundert „Brandenburg“ genannt wird, so erscheint Brandenburg an der Havel im Kodex Londiniensis des bekannten Geschichtsschreibers Widukind von Corvey als „Berneburg“.
I. TEIL: FRÜHE STIMMEN
Das Tanzwunder in Kölbigk und andere Sagen
In Kölbigk nahe Ilberstedt geschah, so wird erzählt, ein Wunder, das die Machtfülle der mittelalterlichen Kirche veranschaulicht. In der Christnacht des Jahres 1021 sollen einige Bauersleute, darunter auch drei Frauen und eine Jungfrau, des Kirchendieners Schwester, statt in die Kirche St. Magnus zu gehen, zu tanzen und zu springen angefangen haben. Alles Bitten und alle Mahnungen des Pfarrers, doch in die Kirche zu kommen, damit er die Messe lesen könne, seien nutzlos gewesen, sodass der Priester sie verfluchte. Der Fluch, sie möchten ein ganzes Jahr lang so singen und springen, erfüllte sich. Erst die Bischöfe von Köln und Hildesheim, heißt es, ranghöhere Geistliche also, hätten nach Jahresfrist diesen Fluch gnädig abwenden können; die Tänzer seien vor dem Altar niedergekniet, um zu beten, und dann in einen dreitägigen Schlaf gesunken. Vier von ihnen sollen gestorben sein, die Überlebenden aber ein ständiges Zittern behalten haben, und die Gruben, die ihre tanzenden Füße gestampft hätten, wurden noch lange gezeigt.
Johann Christoph Beckmann erzählt die Sage in seiner „Historie des Fürstentums Anhalt“, Zerbst 1710, S. 465, nach einem lateinischen und einem deutschen Text, die zu seiner Zeit beide noch auf Tafeln an der Wand der Kirche zu Kölbigk zu lesen gewesen wären, verfasst von einem Ecbertus oder Otpertus, folgendermaßen:
Nach Christi Geburt im Jahr 1021. bei des Kaiser Heinrichs Zeiten / im anderen Jahr seines Regiments / hat sich begeben diß Miracul, dass sich hie in dieser Kirchen / die geweihet ist worden in den Ehren Gottes und S. Magnus, etliche Bauers-Leute zusammengethan / auf das Fest der Heil. Christ-Nacht / und allda gesungen und gesprungen auf dem Kirch-Hofe zu Kolbig / dermassen / dass der Priester sein Ampt nicht vor ihnen hat verbringen können / hat sie aber höchlichen vermahnet umb Gottes Willen / von solch Fürnehmen abzustehen / iedoch hat alles nicht seyn wollen / der Bauern aber seind gewesen Fünfzehn / zwo Frauen und eine Jungfrau / ist gewesen des Kirchners Schwester. Als nun des Priesters Vermahnen an ihnen nichts verfährt / hat er gesaget / ey nun gebe GOtt und S. Magnus, dass ihr ein gantz Jahr also singen und tantzen müsst. Also hat obgedachter Kirchner seine Schwester vom Tantze wollen reissen bei einem Arm / hat ihm der Arm erschröcklicher Weise von ihrem Leibe gefolget / so haben sie darnach ein gantz Jahr all umbgetantzet / und biss unter die Gürtel Kulen in die Erden getantzet / und ihre Kleider seind nicht veraltet / ihre Schuhe nicht zerrissen / ihr Haar und Bart unversehret blieben / auch weder Regen noch Schnee auf sie gefallen. Als das Jahr verschliessen / seind kommen hieher gen Cölbig die heiligen zweene Bischoffe / der von Cölln und Hildesheim / mit andern andächtigen Vätern / und haben GOtt mit Ernst angerufen und gebehten / dass GOtt der Allmächtige diß Miracul von diesen geplagten armen Menschen wollt gnädig abwenden. Also hat GOtt durch dieser heiligen Väter Gebeht entledigt von solcher Strafe und erschrecklichen Plage / darnach nach ihrer Entledigung seind sie kommen vor den Hohen Altar / haben nieder gekniet / und alle entschlafen Drey Tage und Drey Nächte / und seind ihrer 4. von ihnen gestorben / die andern sind aufgestanden / und GOtt den Allmächtigen gepreiset / und Dancksagung gethan / dem sei Lob / Preiß und Ehre in Ewigkeit / Amen.
In diesem Vorfall ist unschwer ein frühes Zeugnis für den im mittelalterlichen Europa und besonders in Deutschland überall bezeugten Veitstanz zu erkennen, ein heidnisches Relikt, durch das Menschen in eine epidemische Tanzwut versetzt werden konnten (vgl. Richard und Hermann Siebert, Anhalter Sagenbuch, Bernburg 1927, S. 112 ff.). Für Thomas Mann gehört er in seinem Roman „Doktor Faustus“ zur Geschichte der erfundenen Stadt Kaisersaschern. Der Priester, der die Tänzer verflucht hatte, hieß angeblich Ruprecht. Auf ihn geht die Mär zurück, die den Weihnachtsmann auch „Knecht Ruprecht“ nennt. Er wurde zu einer Gestalt, mit der man Kindern drohen, mit der man sie aber auch durch Lockungen brav machen konnte. Da Kölbigk und Ilberstedt nicht weit von Bernburg liegen, wurde Knecht Ruprecht in entfernteren Gegenden bald auch als der „Bernburger Heele Christ“ angesehen, als der er jetzt noch in Bernburg zur Adventszeit gefeiert wird. Über Köthen, Dessau und Wittenberg gelangte er als „Bernburger Heele Christ, der de kleenen Kinder frisst“, der auch ausnehmend dumm oder sogar allwissend sein sollte, nach Sachsen. Als Robert Schumann das bekannte Klavierstück „Knecht Ruprecht“ schuf, war die Gestalt in weiten Teilen Deutschlands so bekannt, dass man nicht mehr fragte, woher er kam.
Hermann Siebert wies in seiner Schrift „Das Tanzwunder zu Kölbigk und der Bernburger Heil’ge Christ“ (Bernburg 1902) erstmalig darauf hin. Im schon erwähnten „Anhalter Sagenbuch“ von Richard und Hermann Siebert, das 1926 in erster und 1927 bereits in zweiter Auflage bei Alfred König in Bernburg erschien und in einem Reprint der Anhaltischen Verlagsgesellschaft Dessau (1999) wieder zugänglich ist, knüpfen sich daran zwei weitere Sagen (S. 113 ff.):
Der Kölbigker Heele Christ oder Kölbigker Spukegeist
In den Dörfern der Umgegend von Kölbigk, wie in Ilberstedt und Giersleben, erzählte man früher, besonders in der Weihnachtszeit, viel vom Kölbigker Heele Christ (auch der Kölbigker Spukegeist genannt). Zwischen Kölbigk und Bullenstedt liegt eine Wiese mit Namen: „die Nachthute“. Hier treibt alljährlich am Weihnachtsabend der Kölbigker Heele Christ sein Wesen. Es ist ein tanzlustiger Geist aus dem alten Kloster Kölbigk, der hier seiner Lust frönt und die Vorübergehenden zum Tanz auffordert. Wer sich weigert zu tanzen, den nimmt er mit sich in den Turm von Kölbigk und von dort in den unterirdischen Gang, der nach der Warte bei Neugattersleben führt. Die aber nicht gutwillig folgen, ertränkt er in der Wipper an einer breiten und tiefen Stelle, welche man den Sauwinkel nennt.
Auf der Nachthute soll das Kölbigker Spukeding auch mit andern Geistern Zusammenkünfte haben, besonders mit der Bläsjungfer, einer ehemaligen sündhaften Nonne. Auch soll es Leute, die lustig und singend an Kölbigk vorbeikamen, im dortigen Teiche ertränkt haben. Furchtsame vermeiden daher abends den Weg von Kölbigk nach Bullenstedt.
Dieser böse Geist, der auch die Kinder, welche ihr Weihnachtsgebet nicht sprechen können, umbringt, zeigt sich aber auch von der menschenfreundlichen Seite, indem er für artige Kinder auf dem Turme zu Kölbigk die Weihnachtsgeschenke bereithält und dort die Wunschzettel entgegennimmt.
Der Bernburger Heele Christ
Der Bernburger Heele Christ oder Knecht Ruprecht von Bernburg ist eine vermummte Figur der Advents- und Weihnachtszeit, welche noch vor 20 und 30 Jahren in den mittleren Teilen der Provinz Sachsen, im Herzogtum Anhalt und im Nordwesten des Königreichs Sachsen dem Volke wohl vertraut war und zum Teil noch jetzt ist. In der Verkleidung eines alten Mannes mit großem Bart, angetan mit einem langen Pelz oder dunkeln Mantel, seltener in ein weißes Laken gehüllt, mitunter auch mit Erbsstroh umwickelt und ausgerüstet mit Sack, Rutenbündel und Knotenstock, spielte sie oder spielt sie noch jetzt die Rolle des Nikolaus, des Knecht Ruprecht oder des Weihnachtsmannes.
Einige Redensarten, die im Volke umlaufen, kennzeichnen ihr Wesen und deuten zugleich darauf hin, dass wir es mit einer in ihrem Verbreitungsbezirk früher allgemein bekannten Gestalt zu tun haben. Mit dem Spruche: „Der Bernburger Heele Christ, der de kleenen Kinder frisst“ führt sich der Knecht Ruprecht ein in den Ortschaften des Köthener und Dessauer Landes bis nach Wittenberg und Kemberg hin. In der Wurzener Gegend bei Leipzig, auch in Querfurt, dann wieder in Sandersleben und bei Staßfurt gebraucht man das Wort: „Der geht wie der Bernburger Heele Christ“, wenn jemand, besonders ein alter, graubärtiger Mann, gebückt einhergeht, einen langen Mantel trägt oder in anderer Weise auffällig gekleidet oder auch vermummt ist. Ebenfalls in der Umgegend von Wurzen, aber auch in Nienburg a. d. S. sagt man, wenn man ausdrücken will, dass die Weihnachtsbescherung kärglich ausgefallen ist: „Es kommt nur der Bernburger Heele Christ!“ oder: „Es ist nur der Bernburger Heele Christ gekommen!“ und deutet damit an, dass der Knecht Ruprecht sich mehr von der strafenden als der belohnenden Seite zeigen wird oder gezeigt hat. Eine andere Redewendung, die in den Dörfern zwischen Bernburg und Köthen und auch in letztgenannter Stadt viel gebraucht wird, lautet: „Der ist allwissend –“ oder: „Der weiß alles, wie der Bernburger Heele Christ!“ und wird scherzend auf sogenannte superkluge Leute angewendet. Dass der Knecht Ruprecht alles, was geschieht, gute und böse Taten, weiß, um danach gerecht Belohnung und Strafe austeilen zu können, muss man billiger Weise von ihm erwarten, und die Kinder meinen auch, dass „ihm der liebe Gott alles sagt“. Umso mehr wird es uns verwundern, wenn er andrerseits wieder als dumm hingestellt wird. „Dumm wie der Bernburger Heele Christ“ sagt man in Oberröblingen a. d. Helme, aber auch vielfach in Anhalt und weiterer Umgegend. Diese Bezeichnung wird wohl auf das schwerfällige, polternde Auftreten des Knecht Ruprecht zurückzuführen sein. Ein derartiges Verhalten bringt leicht in den Ruf der Dummheit.