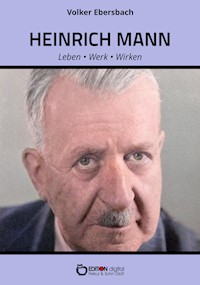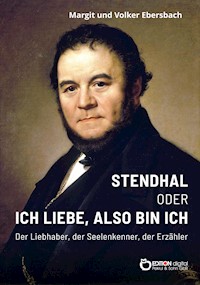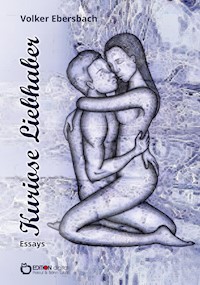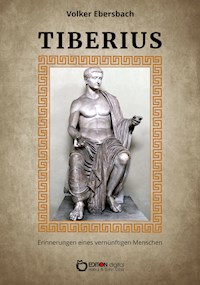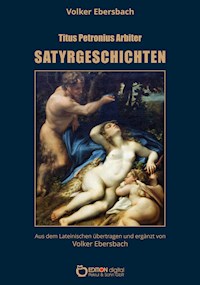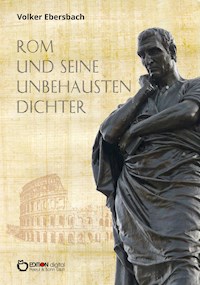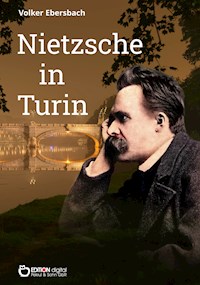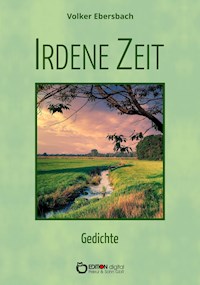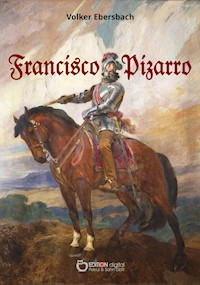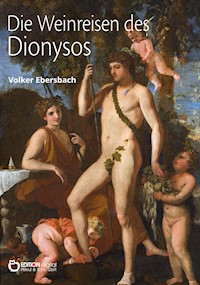12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das ist ein Verhör. Befragt wird der gelehrte Ritter Rodeger von Serimunt, der gerade aus dem Morgenland nach Teutschland zurückgekehrt ist und dort die Landgräfin Elisabeth von Thüringen sucht. Und schon diese Absicht bringt ihn während des ersten Verhörs in Schwierigkeiten: Lange muss er in der Bischofsburg zu Bamberg warten. Der Bischof befindet sich nicht in seiner Residenz. Ein Mönch befragt Rodeger. – Ihr nennt Euch Magister Rodeger von Serimunt? Geboren zu Palermo? – Verzeiht: Zu Messina. – Und habt die Landgräfin von Thüringen gesucht? Und wusstet nicht einmal, dass sie zum Herrn eingegangen ist? – Herr! Ich lebte Jahre lang als Gefangener bei den Sarazenen. – Lernt man dort so frech und gotteslästerlich zu lügen? Nun, die Ketzerei lernt man dort sicherlich. Ein Kreuzfahrer wollt Ihr gewesen sein? Wisset: Wir befinden uns im Ketzerkreuzzug, mitten im Heiligen Römischen Reich! Ihr habt im Reich wohl einen Gewährsmann, der Euch kennt? Rodeger sucht in seinen Erinnerungen nach einem Menschenantlitz, dem er jetzt trauen könnte. Er sucht lange. Dann sagt er klar: – Ja! Herr Heinrich von Askanien, der Fürst von Anhalt. Man lässt ihn weiter warten. – Verfügt Euch auf die Burg Pottenstein über der Püttlach. Reitet aber vorsichtig. Der Kaiser war lange nicht im Land, und Raubgesindel schweift umher. Ihr wünscht einen Begleitschutz? Nein, Herr, das sähe ja aus, als wollten wir einen Ritter gefangen setzen. Habt Ihr denn keinen Knappen? – Dafür bin ich zu arm. Sie schicken ihn allein weiter. Doch schon bald sieht sich der Ritter wie ein Bandit gefangengesetzt und mit dem Vorwurf konfrontiert, Schulden gemacht zu haben. Der Weg stieg an. Der Wald blieb zurück. Aus der Rodung wuchsen Mauern. Die Burg hieß Pottenstein. Das hatte er einem Wortwechsel der Schergen entnommen. Er war ohnehin auf dem Weg hierher gewesen. Warum also diese Gewalt? – Du bist jetzt hier gefänglich eingezogen, sagte der Burgvogt schon im Tor. – Ich wäre als freier Mann selbst gekommen, wie mir in Bamberg befohlen wurde. – Wer sollte das einem wie dir glauben? Auf Pottenstein residiert der Bischof von Bamberg. Der Vernehmer, an den der Bischof nun das Wort weitergibt, feixt wie über einen ertappten Sünder: – Warum trübt sich deine Stimme? Davon war ja noch keine Rede. Aber nun gebt Ihr selbst uns einen Anhaltspunkt. Der Beichtvater der Landgräfin, Herr Konrad von Marburg, hat es in einem Schriftstück festgehalten: Ihr, Herr Rodeger von Serimunt, hättet sie zur Unzucht bewegen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1555
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Wildnis des Herzens
oder
Die Reisen des gelehrten Ritters Rodeger von Serimunt, eines Gesprächsfreundes der Heiligen Elisabeth von Thüringen
ISBN 978-3-96521-730-0 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
PRAEAMBULUM: Gottesminne
Es war einmal ein Ritter, in dem ein Gelehrter steckte. Wenn auch weder dem Ritter noch dem Gelehrten in seinem Leben je etwas glückte, bestand er doch viele Aventüren. Er hatte große Dinge erlebt, beglückende und arge, und war mehrmals dem Tod nur knapp entronnen.
Der Ritter muss gut beritten sein und reiten, reiten, gefährlich reiten und die Welt erkunden. Das Herz pocht in der Brust, die Hufe pochen auf den Weg. Im Vorfrühling des Jahres 1235 erreicht er, von Osten, aus der weiten, dunstigen pannonischen Ebene, aus dem Reich der Ungarn kommend, an den Ufern der Donau das Heilige Römische Reich, das SACRUM IMPERIUM ROMANUM, das teutsche Land. Es ist nicht seine Heimat. Dennoch hat er das Gefühl, er fände nach Hause. Ist es eine Todesahnung? Die Menschenwelt ist ihm so fremd geworden, dass er dem Sterben bisweilen so froh wie einer Heimkehr entgegensieht. Ein Alter hat er schon, das wenige Menschen in seiner Zeit erreichen. Nicht viele Kranke hat er heilen können. Aber sich selbst ist er der beste Arzt gewesen. Auf die Heilkunst und die Philosophie versteht er sich weit besser als auf das Ritterhandwerk. Und Frau Aventüre reitet wie eine Fee unfassbar immer vor ihm her. Inzwischen gehorcht eine arabische Rappenstute namens Muntane seinem Griff in die Zügel, seinen Schenkeln und seinen Sporen. Ihre Hufe greifen scharf aus. Er hat in den Pferdesätteln weit größere Entfernungen zurückgelegt als seine Vorväter auf Schiffskielen. Einmal, das weiß er, kommt jedoch der Tag, an dem der Ritter ausgeritten hat. Warum bin ich so lange ziellos in der Welt umhergeirrt? fragt er sich. Ist es meine Vaterlosigkeit? Ich wollte nicht mit denen gehen, die mich betrogen hatten, und ich geriet nur anderen Betrügern in die Hände. Wie ein Zugvogel kehrt dieser Ritter, Herr Rodeger von Serimunt, zurück in den kalten, dunklen Norden. Nirgends hat er den Stein gefunden, in dem blinkend ein Schwert gesteckt hätte, das allein von seiner Hand herausgezogen worden wäre. Sein Schwert heißt Springfeuer und nicht Excalibur. Er ist kein König, kein König Artus. Die Welt läuft ohne Gerechtigkeit weiter. Unterwegs hat er sich von Kaufleuten dafür bezahlen lassen, dass er sie auf Handelsstraßen ein Stück begleitete und ihnen die Waren vor Raubgesindel und Wegelagerern beschützte, von manch einem dankbar mit dem Heiligen Christophorus verglichen, von anderen mit Sankt Georg. So ist er den Gegenden, die er erreichen wollte, immer näher gekommen.
In den frühlingsgrünen Wäldern erkennt er die Vogelstimmen wieder, die ihn vor Zeiten an den Liebreiz schöner Frauen erinnert haben. Wahrhaftig! ruft er eines um das andere Mal in seinem Herzen sich selber zu: Wahrhaftig, homo viator! Wir sind Pilger auf dieser Welt, nur Pilger. An keinem Ort ist unseres Bleibens. Und erst im Sterben gelangen wir an unser Ziel. Aber noch stirbt er nicht, so leicht stirbt es sich nicht, das Sterben ist ein hohes Gut, das man nicht einfach am Wegrand findet. Er braucht vor dem letzten Ziel noch ein vorletztes. Sein inneres Auge hat ihm oft die Burg Kerlouan vorgeführt und die Gesichter der drei Damen, die vielleicht seine Cousinen waren. Er würde wohl nicht einmal ihre Asche finden, und von der Burg nichts als aschfarbene Ruinen. Hätte jemand die Burg wieder aufgebaut, ihm wären es Fremde. Der lachende Specht aber macht, dass er ein Frauenlachen hört. Es ist Elisabeth, die über seine Späße lacht oder ihn für irgendein ungeschicktes Wörtlein verspottet. Was wir wirklich lieben, geht uns nie verloren.
Die Wasser der Flüsse, die von beiden Seiten her der Donau zuströmen, wälzen, von der Schneeschmelze in den Bergen geschwollen, ihre Fluten eilig dahin. Es ist ein Rauschen, ein Gurgeln und Tosen, und wenn der Reiter verharrt und lauscht, glaubt er den Widerhall davon in seiner Brust zu hören. Da treten ihm Tränen in die Augen. An einer Böschung seines Weges sieht er die bizarre Wirrnis der ineinander gewachsenen Wipfel zweier uralter Apfelbäume und ruft halblaut: – Das sind wir, wir beide! Und er spürte wieder die Wildnis seines Herzens.
In einer Burg bei Passau schmeckten die Speisen fade. Verwundert schaute man ihn an, als er sagte, er käme aus dem Morgenland, sei den Mongolen Ögödeis und Hülägüs entflohen, die man hier Tataren oder Tartaren nenne, weil man glaube, sie kämen aus der Unterwelt, dem Tartarus. Er sei ein treuer Gefolgsmann des Landgrafen Ludwig von Thüringen gewesen und wolle dessen Witwe Elisabeth besuchen. Niemand sprach mehr mit ihm ein Wort, auch nicht am anderen Morgen. Der Burgherr sagte, als er ihm einen guten Weg wünschte, nur: – Wenn Ihr die Landgräfin Elisabeth sucht, so reitet nach Bamberg.
– Warum? Ist sie dort zu finden?
Das Ja des Burgherrn klang so, als schenkte er selbst ihm keinen Glauben.
An einem Ende eines Burgberges werden die Mauern einer neuen Domkirche aufgeführt. Rodeger traut seinen Augen nicht: Die älteren Teile des Baues haben die runden Fensterbogen, die er kennt. Aber nun setzen die Steinmetze den schmalen, hohen Fensterrahmen oben spitz zulaufende Bögen auf, wie er sie, allerdings breiter und flacher, im Morgenland gesehen hat, wie sie aber auch entstehen, sobald man zwei runde Bögen halb ineinander schiebt. In anderen Kirchen, die schon fertig sind, findet er, kniet er darin nieder, um still zu beten, die gleichen Fensterformen, und auch die neuen Gewölbe alter Kirchenschiffe und Burghallen laufen spitz zu auf diese Weise.
Die teutschen Wälder sind für ihn voller Erinnerungen. Rodeger fühlt sich in ihnen heimisch, obgleich er nie bei ihnen zu Hause war. Er kommt nicht zum ersten Mal aus der Fremde zu den Teutschen; er kommt aus einer den Teutschen sehr fernen Fremde. Die Gesichter erscheinen ihm gespenstisch, jedes wie ausgebaut zu einer Festung. Die Sonne strahlt schwächer, obschon das Frühjahr voranschreitet. Sein Pferd wiehert auf einmal freudig, wälzt sich im frischen Rasen und schlägt die bläulich kühle, hell und gelb durchsonnte Luft mit seinen Hufen.
In Bamberg geht er durch ein Büchergewölbe. In seiner Geldkatze weiß er mehr als einen goldenen AUGUSTALIS, eingetauscht gegen einen Tatarendolch. Es ist die neue Münze, die auf der einen Seite Kaiser Friedrichs Profil als römischen Cäsar und auf der anderen den staufisch-teutschen Adler zeigt. Sie ist so schwer, hart und gediegen wie einer der alten BYZANTINER. Lange hat er keinen mehr gesehen. Lange hat er auch kein abendländisches Buch gelesen. Er findet den EREC des Hartmann von Aue, zu teuer gewiss, er braucht den Händler gar nicht nach dem Preis zu fragen. Sein Geld wird er zusammenhalten müssen. Stattdessen erkundigt er sich, ob man wisse, wie es Hartmann, dem gelehrten Ritter, denn gehe und wo er lebe. Gestorben sei er, schon lange, erfährt er. Jeder Gebildete wisse es, wird er blicklos kurz belehrt. Da könnte es nur Misstrauen wecken, wenn er sagen würde, was ihm auf der Zunge liegt: Er habe den Dichter gut gekannt. Auf einem besonders hohen Stapel liegt, kunstlos gebunden, ohne Sorgfalt hingeschrieben, erschwinglich, der ROSENROMAN eines französischen Dichters. Rodegers Neugier bleibt gedämpft. Wer könnte ihm über Rosen noch etwas Unerhörtes sagen? Schon wird seine Aufmerksamkeit abgelenkt: Auf einem anderen, höheren Tisch liegt, kostbar gebunden und verziert und sichtlich unerschwinglich eine Neuheit: DE ARTE VENANDI CUM AVIBUS, ein Buch über die Jagd mit Falken, reich und zierlich bebildert mit kräftig farbenfroher Malerei. Der Verfasser ist kein geringerer als der staufische Kaiser Friedrich, der Zweite seines Namens. Rodeger weiß seit dem Hoftag in Hagenau, dass Friedrich gelegentlich daran arbeitete. In einer Bibliothek des Morgenlandes hat er in einem arabischen Buch über die Jagd mit Falken gelesen. Er blättert, liest hier und da und findet seinen Verdacht bestätigt: Der Verfasser hat so manche Seite davon ausgeschrieben. Er mag ein großer Herrscher sein, als Verfasser dieses Buches hat er geklaut: Es ist zusammengeklaut, sagen Rodegers Lippen tonlos, so wie der Ritter Bertran von Capua in Salerno meine Papiere geklaut hat.
Nachdenklich wartet er bei einem Kleiderhändler, der auch Schmuck feilhält, bis die beiden Bürgerfrauen das gefunden haben, was sie suchen. Ein Bürger wartet in gemessenem Abstand. Die eine betrachtet einen goldenen Fingerring, die andere hebt einen seidenen Schleier in die Höhe, greift nach der mit Perlen besetzten Haarspange, die ihr der Händler entgegenhält, und Rodeger glaubt, er dürfe seinen Ohren nicht mehr trauen, die jetzt hören, diese Raritäten hätten einen ganz besonderen Wert, die Landgräfin von Thüringen sei die Besitzerin gewesen, Elisabeth, Gemahlin Ludwigs, der von seinem Kreuzzug nicht heimkehrte. Sie hätte diese und andere Kostbarkeiten zu Geld gemacht, um in ihrem Spital die Kranken und die Armen zu ernähren.
Da vermag er nicht mehr mit edlem Anstand zu warten. Er mischt sich ein: – So ist sie immer noch am Werk in ihren Wirsinghäusern zu Eisenach? Ich danke Gott, dass er mich hergeführt hat, denn sie ist es, die ich suche, um sie zu besuchen.
– Ihr könnt sie weder suchen noch besuchen, Herr, denn sie ist tot. Seit Jahren schon, und sie starb nicht in Eisenach, sondern in Marburg an dem Flüsschen Lahn.
Eine der vielen ganz verschiedenen Möglichkeiten, die man sich ausdenkt, wird laut genannt, und man glaubt, dies und nichts anderes habe man vorausgesehen.
– So jung? entfährt es Rodeger. So lange, denkt er, war ich gefangen?
Sie schauen ihn schweigend und neugierig an und flüstern einander etwas zu. Alles, erinnert er sich grämlich, was sie mir gegeben hat, hat sie mir auch genommen. Der HERR? Die Herrin hat’s gegeben, die Herrin hat’s genommen.
– Ihr kanntet sie? verwundert sich die eine Frau. Die andere fragt: – Wie war sie denn, Herr Ritter? Habt Ihr der Dame nahegestanden?
– Ich zog mit Landgraf Ludwig. Aber wir mussten, wie Ihr wisst, ohne unseren geliebten Herrn ins Heilige Land fahren.
Da fangen sie an, ihm Wundergeschichten zu erzählen, die über Frau Elisabeth im Umlauf sind, über die Heilung von Kranken und die Fürsorge für Aussätzige, über die Speisung Verhungernder und ihre Gastlichkeit für Bettler, Alte und Ausgestoßene. Sie fassen es nicht, dass er ihr Hinscheiden zum ersten Mal vernimmt, auch wie sich ihre Brotwecken auf wundersame Weise in Rosen verwandelt hätten, weil der raue Herr Heinrich Raspe ihr in den Korb hatte schauen wollen und ihr das Brot für die Armen ja weggenommen hätte. Da sie nicht aufhören, weiß er: Für alles, was er im Morgenland erlebte, hätte hier niemand Ohren. Zuletzt wird ihm versichert, es dauere nicht mehr lange, dann werde die selige Landgräfin eine Heilige sein.
Brot für die Hungrigen, denkt Rodeger nicht ohne Geistesrührung, und Rosen für die Satten – wie sinnreich! Das Volk braucht Heilige, die Herren machen sie.
So eilt die Kunde, dass ein thüringischer Ritter wieder im Land sei und Frau Elisabeth von Thüringen besuchen wollte, dem Ritter Rodeger von Serimunt voraus.
Ich war sterbensmüde, flüstert Rodeger auf der Gasse in seinen Bart. Und sie, sie geht! Sie war ihm manchmal unvergleichlich irdisch, ja sinnlich vorgekommen, aber eben durchaus nicht festzuhalten. Sie war so voller Geben und konnte sich zugleich unerbittlich verflüchtigen. Er wäre jetzt gern gegangen, ihr nach, will aber, wenn es Gott will, noch eine Weile bleiben. Sobald er wieder allein ist, wird ihm, als wäre sie um ihn. Als wolle sie sich für immer von ihm verabschieden. Als wolle sie für immer bei ihm bleiben. Als frage sie ihn, ob er dieses oder jenes wünsche.
– HERR lehre mich den Sinn des Widersinns!
Ihm sträuben sich die Haare, sooft er daran denkt, dass sie gestorben ist, dass er an eine Tote denkt. Ihm wird im Sattel taumelig. Er hatte sie verklärt. Nun kommt es ihm so vor, als hätte er ihr den Tod gewünscht, weil er sie nicht sinnlich, nicht irdisch hatte haben können. Seit er sie liebt, ohne sie zu haben, ohne sie zu lassen, ahnte er, dass er nur in dem Gedanken, dass sie tot sei, Ruhe fände. Nun ist es ein Wissen. Die Toten umgeben uns noch eine Zeit. Bald kommen sie seltener, bald nicht mehr. Dann bleiben sie uns fern, als wären sie woanders angekommen.
Es ist ihm immer am liebsten gewesen, wenn er auf sich selber angewiesen war, sich selber helfen und selbst zusehen musste, wie er weiter durchkam. Eine Stimme mahnt ihn, jetzt einfach umzukehren, andere Weltgegenden aufzusuchen, anderwärts seine Aventüre zu finden. Weil aber sein Herz im Spiel ist, fasst er Vertrauen zu den Menschen, die Elisabeth angeblich gekannt haben, obwohl sie für ihn Fremde sind und manchmal ein Gesicht ziehen, als hätten sie nichts Nettes mit ihm vor. Und was für eine düstere Frömmigkeit muss er unter diesen Teutschen finden, wiederfinden. Was die Frömmigkeit anging, war die Ungarin Erzsébet ganz eine Teutsche geworden!
Lange muss er in der Bischofsburg zu Bamberg warten. Der Bischof befindet sich nicht in seiner Residenz. Ein Mönch unbestimmten Ranges befragt Rodeger.
– Ihr nennt Euch Magister Rodeger von Serimunt? Geboren zu Palermo?
– Verzeiht: Zu Messina.
– Und habt die Landgräfin von Thüringen gesucht? Und wusstet nicht einmal, dass sie zum Herrn eingegangen ist?
– Herr! Ich lebte Jahre lang als Gefangener bei den Sarazenen.
– Lernt man dort so frech und gotteslästerlich zu lügen? Nun, die Ketzerei lernt man dort sicherlich. Ein Kreuzfahrer wollt Ihr gewesen sein? Wisset: Wir befinden uns im Ketzerkreuzzug, mitten im Heiligen Römischen Reich! Ihr habt im Reich wohl einen Gewährsmann, der Euch kennt?
Rodeger sucht in seinen Erinnerungen nach einem Menschenantlitz, dem er jetzt trauen könnte. Er sucht lange. Dann sagt er klar: – Ja! Herr Heinrich von Askanien, der Fürst von Anhalt.
Man lässt ihn weiter warten.
– Verfügt Euch auf die Burg Pottenstein über der Püttlach. Reitet aber vorsichtig. Der Kaiser war lange nicht im Land, und Raubgesindel schweift umher. Ihr wünscht einen Begleitschutz? Nein, Herr, das sähe ja aus, als wollten wir einen Ritter gefangen setzen. Habt Ihr denn keinen Knappen?
– Dafür bin ich zu arm.
Auf einmal ist ihm wieder klar, was schon Elisabeth an ihm erkannt hat: Sie alle, Bertran und Federico, Herr Ludwig und Herr Konrad von Marburg, – sie fühlten sich von ihm erkannt, durchschaut und missbilligt, noch ehe er den Mund auftat. Etwas Entlarvendes geht schon von seiner wortkargen Ruhe aus, von seiner Miene, seinem Lächeln, das die Betroffenen boshaft ein Grinsen nennen, als schwankten sie, ob er vielleicht der sei, dem an der Tafel des Gral der freigelassene dreizehnte Platz gebührte: Ist dieser Dreizehnte der Ritter Galahad, den die Heldenepen besingen und dem Herr Hartmann von Aue als dem Gottesritter huldigte, oder ist er, wie die Pfaffen hämisch dagegenhalten, der Verräter Judas?
Er fand den Lauf der Püttlach und folgte ihm. Schroffe Felsen wiesen ihm den Weg. Jenseits des Flusses tauchen Reiter auf und halten Ausschau. Sie sehen ihn und kehren um. Wenn die eine Furt finden oder gar kennen, sagt er sich, dauert es keine Stunde, und sie sind hier. Umkehren macht ihn jetzt verdächtig. Besser ist, er begegnet ihnen. Sie tun wie Banditen und fangen mit der üblichen Behauptung an, er solle endlich seine Schulden bezahlen.
– Ich habe bei niemandem Schulden, entgegnet Rodeger.
– Das ist uns gleich. Wir werden nur von deinem Gläubiger geschickt, und zu ihm bringen wir dich jetzt.
Er wusste nicht, weshalb die Reisigen ihn festgenommen hatten, und sie sagten ihm auch nicht, wohin sie ihn schleppten. Da war er wieder überrumpelt worden. Warum hatten sie es immer so leicht mit ihm? – HERR, machs glimpflich! betete er.
Der Weg stieg an. Der Wald blieb zurück. Aus der Rodung wuchsen Mauern. Die Burg hieß Pottenstein. Das hatte er einem Wortwechsel der Schergen entnommen. Er war ohnehin auf dem Weg hierher gewesen. Warum also diese Gewalt?
– Du bist jetzt hier gefänglich eingezogen, sagte der Burgvogt schon im Tor.
– Ich wäre als freier Mann selbst gekommen, wie mir in Bamberg befohlen wurde.
– Wer sollte das einem wie dir glauben?
Einen Tag und eine Nacht hörte er in einer engen Kammer, deren Fenster nur ein schmaler, mit dünnem Ziegenleder bespannter Spalt war, draußen, unten, Rufe und Hufe. Ketten klirrten, Seile knirschten auf den Rollen der Zugbrücke, und Hornklänge entfernten sich. Dann wurde er geholt und einem kostbar gekleideten, ihn freundlich anblickenden Prälaten vorgeführt.
– Äußere dich! Bist du der, der du zu sein vorgibst? Welches Erbe beanspruchst du?
– Und ich bin zwar arm, aber ich erhebe keine Ansprüche auf irgendein Erbe, und ich habe keine Schulden. Ich bin zwar wie ein Ritter dahergekommen, aber ich war nie ein guter Ritter. Auf so viele andere Künste verstehe ich mich besser, dass ich in all den Jahren ein reicher Mann hätte werden müssen. Gott hat es nicht gewollt.
Der Bischof von Bamberg, Herr Ekbert von Andechs-Meranien, ein Oheim der Frühverstorbenen, residiert auf Pottenstein. Er möchte von Wundern hören, die Frau Elisabeth vollbracht habe. Hier an diesem Ort, der durch ihre Anwesenheit gesegnet worden sei, habe sie auch Wunder gewirkt. Aber sie seien leider ihre letzten, nicht die ersten gewesen. Er sucht nach Zeugen, die Wunder gesehen haben und ihre Aussagen beeiden. Erzbischof Siegfried von Mainz habe den päpstlichen Auftrag, diese Aussagen zu sammeln, zu prüfen und dem Heiligen Vater in Rom, Papst Gregor, zum Zweck der Heiligsprechung vorzulegen. Dieser Papst, der Neunte seines Namens, habe unlängst auch schon drei Mönche, Franziskus von Assisi, Antonius von Padua und Dominikus de Guzmán, heiliggesprochen.
– Wer ermächtigt ihn dazu? fragt Rodeger.
– Weißt du das nicht? Deine Frage klingt ketzerisch. Er hat dazu einen göttlichen Auftrag, den Auftrag zu binden und zu lösen wie der Heilige Petrus. Wir Priester alle haben diesen Auftrag, je nach Rang und Würden. Du müsstest das doch als ein Christ des Abendlandes wissen. Mir scheint, du warst zu lange im Morgenland.
Seine Stimme hat den Klang eines scheppernden Kessels.
– Seinen Auftrag von Gott hat jeder. Aber ist einer unter uns, der sich mit einem Auftrag von Gott über andere erheben darf? Vor Gott sind alle gleich.
– Das sind ja wirklich Ketzereien. Ich will sie nicht gehört haben. Wir üben uns in viel Geduld mit dir. Von dem, was du mir sagst, hängt ab, ob ich dich für den nehme, als den du dich ausgibst: Rodeger von Serimunt, magister disciplinae spiritualis der Landgräfin Elisabeth von Thüringen, ihr geistlicher Gesprächsfreund also. Erinnere dich! Sie hat selbst lange auf diesem Schemel hier gesessen, nachdem ihre Tante, die fromme Nonne Mechthild von Kitzingen, sie hat zu mir bringen lassen. Auf diesem Schemel ist sie klug geworden.
Nun ist es klar: Er mag sich selbst noch so hartnäckig für Galahad halten, für den Gottesritter, der er gern geworden wäre. Sie sehen in ihm Judas, den Verräter.
Der Bischof hat drei Dominikanermönche als Zeugen und einen Schreiber für die Vernehmung rufen lassen. Wie Elstern stehen sie in ihrem schwarzweißen Habit an den Pulten. Rodeger hört im inneren Ohr Kelabanes mütterlich warnende Stimme, dunkel wie ihre Mohrinnenhaut: – Du wirst deine Zunge essen müssen, El Freng!
Er hat sehr viel über Elisabeth zu erzählen. Doch nichts davon wollen sie hören. Wunder soll er bezeugen. Es ist wie ein Verhör, und da er zaudert, wird es ein Verhör. Warum nur sind sie so darauf versessen, Wunder bezeugen zu lassen, Wunder zu verkünden, zu beglaubigen, Wunder womöglich auch zu tun? Wozu Wunder? Ist denn der Glaube, den ich niemals verloren habe, nicht selbst Wunder genug? Sagte zu seinen Jüngern nicht Jesus selbst, er tue Wunder nur für die Kleingläubigen, und selig seien die, die nicht sehen und doch glauben? Nun sitze ich so gefangen, dass mich nur ein Wunder herausholen könnte.
– HERR, bewahre mich davor, dass ich dich um ein Wunder bitte!
Die Tote, belehrt ihn Herr Ekbert, wieder freundlicher, habe noch geweint und geschwitzt, und Wohlgerüche seien von Ihrem Leichnam ausgegangen, als man sie begrub und als man sie in die Kirche umbettete und krönte. Ein wunderwirkendes, heilkräftiges Öl sei unten aus dem Bleisarg ausgetreten. Nur wenige Tropfen hätten Augenkranken, Fallsüchtigen, Gelähmten Heilung gebracht.
– Warum bebt deine Brust?
Rodeger beugt sich über das Pergament und hält sich seine Berylle aus Bagdad wie eine Schere vor die Nase. Herr Ekbert wirft einen verwunderten, misstrauischen Blick auf diese Augen aus geschliffenen Steinen. Er kennt den Text auswendig und spricht ihn seinem erstaunten Leser vor: – Ein Mann, welcher seiner Fleischeslust wie einer unheilbaren Krankheit erlegen war, so wie ein Schwein eben, das, kaum dass man es gewaschen hat, sich gleich wieder in den Morast seiner Suhle wirft, also ein richtiges Schwein von einem Mann, sei keusch geworden vom Beten an ihrem Grab und habe die Todsünde der Unkeuschheit für alle Zeiten abgelegt. Warum zitterst du?
Wieso erzählen sie gerade mir gerade das? fragt er sich selber. Laut erkundigt er sich: – Was habe ich damit zu tun?
Der Vernehmer, an den der Bischof nun das Wort weitergibt, feixt wie über einen ertappten Sünder: – Warum trübt sich deine Stimme? Davon war ja noch keine Rede. Aber nun gebt Ihr selbst uns einen Anhaltspunkt. Der Beichtvater der Landgräfin, Herr Konrad von Marburg, hat es in einem Schriftstück festgehalten: Ihr, Herr Rodeger von Serimunt, hättet sie zur Unzucht bewegen wollen. Sie selber hätte es nicht abgestritten. Nun, das ist eine Frage der Wortwahl. Ein Wunder könnte dich retten, ganz im Sinn dieses Wortes. War es nicht irgendein Wunder, das dich davon zurückgehalten hat, das schwache Weiblein zu verführen? Wenn keins geschah, dann gab es gar kein Hindernis. Dann hast du sie verführt. Oder hast du sie gar genotzüchtigt?
Nun bebt ihm die Brust wirklich. Nun zittern ihm Knie und Schultern.
– Das alles ist an den Haaren herbeigezogen. Ihr, meine Herren, notzüchtigt hier die Wahrheit. Ich hatte Frau Elisabeth sehr lieb, das ist wahr. Aber nicht minniglich habe ich sie geliebt, nicht buhlerisch, sondern rein geistig.
– Und wenn sie Herrn Konrad eine sündige Liebe zu dir gestanden hat? Auch das steht in dem Pergament, das wir nach dieser Verhandlung gern vernichten, wenn sie gut verläuft. Der Sündenpfuhl ist aufgedeckt! Du warst in Sünde getaucht wie in eine Jauchengrube. In Sünden hast du dich gewälzt wie im Mist! Warum stotterst du! Was stammelst du?
Sie hat mich also doch geliebt. Den Satz formt Rodeger lautlos mit den Lippen. Und ich habe es nicht glauben wollen. Soll ich so liebesblind gewesen sein?
– Was hast du dir da übrigens für Teufelssteine unter die Augen gehalten?
– Das sind zugeschliffene Berylle. Sie vergrößern, gewissermaßen als zusätzliche Augen aus geschliffenen Steinen, geschwächten Sehwerkzeugen alles Geschriebene. Diese hier sind zwar aus dem Morgenland. Aber die ersten, die ich brauchte, schenkte mir ein edler Burgherr in Frankreich.
– Teufelszeug! Beschlagnahmt!
Ein Wink genügt. Die Berylle werden dem gelehrten Ritter weggenommen.
– Herr Konrad von Marburg hat mich diese Sehhilfe gebrauchen sehen. Warum ist Herr Konrad von Marburg hier nicht zugegen? Er nahm daran keinen Anstoß.
– Weißt du das auch nicht? Er ist bei der Verfolgung von Ketzern zum Märtyrer geworden. Man kann auch sagen: Er hat sie sehr weit getrieben und sogar Edelleute vor die Heilige Inquisition gezogen. Er war nicht nur Elisabeths Beichtvater, er war auch ihr Peiniger, ein frommer Peiniger allerdings, den sie selbst bei ihren Andachtsübungen sehr schätzte. Als sie gestorben war, fahndete er nach anderen edlen Sündern. So ist er dann nächtens von Unbekannten überfallen und ermordet worden. In seiner eigenen Kapuze haben sie ihn erdrosselt. Mit seinen Predigten hat er große Menschenmengen hinter sich zu bringen gewusst, Laien wie Mönche, und bußfertig gemacht, und Ritter hat er für den Kreuzzug gewonnen, die Häresie und Ketzerei in die Enge getrieben. Aber nicht alle waren so fromm, wie sie taten, nicht alle erhofften sich die Gnade des Himmels. Einige trachteten nach dem Lohn des Teufels.
Der Herr vergebe mir, dass ich dabei gern mitgetan hätte! seufzt Rodeger still in seinem Herzen. Mit eigenen Händen hätte ich ihn erwürgen können! Eins hat er aber herausgehört: Die Kirchenoberen hatten sich dieses Mannes zwar bedienen wollen, hielten aber nicht viel von ihm. Nun scheinen sie froh, dass er nicht zugegen ist.
– Zurück zur Verblichenen! fährt einer der Dominikaner fort. – Im ganzen Reich sind diese Heiligen Gebeine und ihre Wunderkraft bekannt geworden, Gebete von Pilgern, die zu Elisabeth nach Marburg kamen, wurden an ihrem Grab erhört. Noch jetzt werden Sieche gesund, Aussätzige rein, Besessene und Wassersüchtige geheilt. Taube hören, Stumme sprechen, Lahme gehen, Blinde sehen wieder. Die es bezeugen, werden aus den Händen des Bischofs und des Kaisers reich beschenkt, zum zweiten Mal, denn diese Wunder sind das erste Geschenk Gottes an sie gewesen.
– Gibt es Beweise? fragt der gelehrte Ritter.
– Beweise? entrüstet sich der Mönch. – Von überallher sind sie gekommen! Und sie haben all die Dinge vorgewiesen, welche sie von ihr besaßen und welche die Wunder bewirkten: Haare, Haarbüschel, Fingernägel, auch ganze Fingerglieder, Ohrläppchen und Brustwarzen, die sie dem Leichnam der Verstorbenen abgeschnitten hatten, um sie der Heiligen Kirche als Reliquien zu überlassen, falls sie heiliggesprochen würde, wie Herr Konrad von Marburg, der diese Gläubigen gewähren ließ, ihnen versicherte. Sie waren überaus stolz darauf und haben die heiligen Reliquien nur sehr ungern und widerstrebend abgeliefert. Dass Ritter etwas davon an ihre Schilde hefteten wie ein Liebeszeichen, das allerdings haben wir verbieten müssen.
Ein Zug des Ekels umspielt den schmalen Mund des Bischofs, der sich als Oheim Elisabeths ausgegeben hat. Vermutlich ist er es wirklich, was verschlägt es?
Rodeger wiegt den Kopf: – Ich begreife nicht, dass Teile von Toten Wunder wirken sollen. Als Kind und späterhin habe ich zwar derlei gehört. Aber ich dachte mir nichts dabei. Ja, ich sah zu Neapel das Blut des Heiligen Gennaro flüssig werden und erblickte darin ein Werk des Heiligen Geistes. Ich habe Frau Elisabeth genau gekannt, habe viele Andachten mit ihr gehalten, gebetet und gesungen aus ihrem Stundenbuch und in der Heiligen Schrift gelesen und mich auch über gelehrte Dinge mit ihr unterhalten. Ich war der Magister disciplinae spiritualis für ihre Freude an Gesprächen, ohne die kirchlichen Weihen zwar, nur ein Laienbruder der Franziskaner, aber nicht weniger gottesfürchtig als ein Mönch. Die Landgräfin hätte über das alles, was Ihr mir erzählt, nur laut gelacht! Ihre Hände mögen Wunder gewirkt haben, solange sie warm waren von ihrem Blut. Ich selbst habe ein wenig dazu beitragen dürfen, denn ich hatte an der Hohen Schule zu Salerno die Heilkunst studiert und half ihr oft in ihrem Spital. Dass Teile von Toten heilen können, haben meine Lehrer nie gelehrt und niemals anerkannt.
– Die Lehre der Heiligen Kirche besagt: Wo ein Teil ist, da ist auch das Ganze.
– Aber, ich wiederhole, unser Herr und Heiland hat doch oft gesagt, er tue seine Wunder allein für Kleingläubige. Selig seien die, die nicht sehen und doch glauben! Herr Ursus von Lodi verwarf sogar jederlei Wundsegen. Die Hohe Schule zu Salerno bestreitet nicht, was die Kirche lehrt. Jedoch sie lehrt nur, was sich beweisen lässt.
Rodeger ertappt sich dabei, dass er mit den Gebärden Abdallahs spricht, die Hand in die Luft krallt und dann streckt, den Zeigefinger hebt und schwingt, ein unsichtbares Tuch glattstreicht. Ach, durchfährt es ihn, das wird mir schaden!
–Die Hohe Schule von Salerno! ruft Bischof Ekbert. – Ihr Glanz ist längst verblasst, und die Universität Neapel, die Kaiser Friedrich gegründet hat, steht über ihr, und das nicht zuletzt wegen ihres frommen Einvernehmens mit dem Heiligen Stuhl, nachdem der Kaiser und der Papst wieder miteinander ausgesöhnt sind durch Gottes Gnade. Zu Salerno hat man zahlreiche heidnische und musilmanische Irrlehren gepflegt und hat sie verbreitet. Uns wundert nicht, dass du noch solche Gedanken hätschelst, zumal du doch aus dem Morgenland gekommen bist. Wie kamst du denn zu den Sarazenen?
– Als Gefangener.
Der Bischof schüttelt ungläubig den Kopf: – Wenn das wahr ist, bist du ja mit der Gefangenschaft vertraut, und wenn es nicht wahr ist, hast du die Kerkerhaft verdient.
Scharniere quietschen, ein Gitter fällt knallend in seinen Rahmen. Gott ist Gnade, und auch seine Diener, geistliche wie weltliche, sollen Gnade üben. Diese Ritter und diese Mönche kennen keine Milde. Sie sind eine Gefahr, der er sich nicht zu stellen vermag, und sie tun ihm nichts Gutes. Dieser Kirchenmann hat hinter seinen glatten Worten nur harte, hinterhältige Gedanken! Ach! Ist es jemals möglich, Banditen zu entkommen, ohne anderen Banditen in die Hände zu fallen? Rodeger hatte nie gehasst. Oder war er des Glaubens gewesen, niemanden zu hassen, weil das der guten Meinung entsprach, die er über sich selber hegte? Weil man zu den guten Menschen gehörte, wenn man niemanden hasste? Nun hasst er, nun gesteht er es sich ein, dass er einen Hass fühlt.
# – HERR, verzeih, wenn ich dir nicht verzeihen kann!
Wie viele Tage bleiben mir noch in diesem Verlies? Da bleckt lachend der Tod die lippenlosen Zähne. Es riecht nach Staub, nach Ratten und nach Moder. Er weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, denn er hat oft geschlafen und Wirres geträumt. Und wenn es Jahre wären, die er noch hätte, wäre die Zahl nicht allzu groß, und auch die Zahl der Stunden wäre nicht unvorstellbar. Er fängt an zu rechnen und braucht nicht lange, hört irgendwann ein Frauenlachen. Aus weiter Ferne oder aus den Tiefen dieses Gemäuers? Er fragt sein verwildertes Herz: War das Alima oder Irene? Gismunda oder Yolanda? Miraflor hat nie gelacht. War es Olinda, Uriane oder Melisande? Laudine? Kelabane? Oder Melinda? Die Kapsel mit seinen Schriften haben sie ihm abgenommen. Unter den Dattelpalmen in Kelabenes Garten ist er schreibfaul gewesen. Aber man kann sie gegen ihn verwenden. Und was ist aus dem versiegelten Bündel von Schriften geworden, die er Frau Elisabeth in Verwahrung gab vor seinem Aufbruch in den Kreuzzug? Lange findet er keinen Schlaf.
# – HERR, ich liege hier in dieser Grube wie in einem Grab! HERR, bitte, lass mich auferstehen! Ich habe Angst. Ich kann mich nicht rechtfertigen. Alles werden sie gegen mich verwenden. Ich bin keineswegs unschuldig. Darum fühle ich mich so schwach. Wäre ich ganz ohne alle Schuld – aber wer wäre das –, dann wäre ich auch stark. Was habe ich in meinem Leben falsch gemacht? Falsch macht man doch nur etwas, wenn man anders gekonnt hätte. Hatte ich andere Möglichkeiten? Habe ich sie vielleicht nur nicht gesehen? Nicht sehen wollen?
Und er entsann sich der Worte, die ihm bei seinem Abschied von Frau Elisabeth, er wusste nicht woher, auf einmal in den Sinn gekommen waren: Erst wenn wir unsere Ohnmacht vor uns selber und vor Gott bekennen, kann uns geholfen werden.
Ihm träumt von einer steilen Küste über einem warmen taubengrauen Meer, die er entlanggeht, das dickhalmige Gras ist feucht vom Tau eines milden Morgens, der alles, den Himmel, das Meer, die Felsen, in ein matt rosenfarbenes Licht taucht, in der glatten Meeresfläche liegen die Umrisse ferner Inseln, geht er nicht selbst auf einer Insel in der Ägäis, am hohen Gestade der Insel Keos entlang, und liegt dort unten nicht das Kloster Prodromos, da werde ich Michael Akominatos finden und auch den Weg in die Berge zu den Grammatikern, aber der Fels, an dem der Pfad entlangführt, zerbröselt, sooft er sich mit der Rechten daran stützt, in den Fingern wie zusammengebackener Sand, und unter seinen Tritten gibt er nach wie der Wüstensand zwischen Jerusalem und Bagdad
Eben war es noch warm. Jetzt ist es kalt und feucht. Er liegt noch immer in dem Keller. Wahrscheinlich hat er Fieber. Ist denn nur die Jungfrau Maria die hohe, reine, verehrungswürdige Frau? Aber Elisabeth! Sie, sie hat mich zugrunde gerichtet.
Sie holen ihn in ein Gewölbe, das nach Kohlenrauch und heißem Eisen riecht.
Ein Mönch des neuen Ordens der Dominikaner, die sich der Seelsorge bei der Heiligen Inquisition zugewandt haben, ist zugegen. Der Folterknecht und seine drei Gesellen sind ganz in enges Leder gehüllt, bis über den Kopf. Nur für die Augen, den Mund und die Nase stehen Schlitze offen. Wie sollte das Land der eisernen Barbaren nicht auch lederne Barbaren haben. Lacht darunter das lippenlose Gesicht des Todes?
– Hier wirst du das Lachen verlernen. Sieh dir das an! Das ist die Ketzergabel! An einem Riemen schnalle ich sie dir um den Hals, damit sie dir ins Kinn sticht, wenn du schlappmachst, den Kopf hängen lässt oder einschläfst. Eine andere Gabel kann ich auch heiß machen. Das ist die Glut, in der ich sie erhitze, um dich damit zu zwicken. Ich darf dich damit auch blenden. Ein Wort genügt. Und sieh dort auf dem Hof das viele Schlehenreisig und das kleingespaltene Holz! Schlehenreisig macht gute Hitze für Ketzerfeuer! Auf solch einem Stapel wirst du vielleicht lebendig brennen. Engel sollen dich retten, wenn du keine Schuld hast. Oder willst du lieber ersaufen?
Abdallah hat also nichts von dem erfunden, was er sagte.
– Ich bin ein Edelmann. Ein Edelmann darf nicht gefoltert werden.
– Ein Edelmann? Wer sagt uns das?
– Und es beweist auch keine Schuld, fährt Rodeger fort, wenn jemand, den man ins Wasser wirft, ertrinkt, oder wenn jemandes Hand verbrennt, weil er ein glühendes Eisen anfasst. Ich lege bei Kaiser Friedrich Beschwerde ein. Er kennt mich schon von unserer Kindheit an und wird meine adlige Geburt bezeugen. Ohnehin habe ich ihm etwas über die Sarazenen zu berichten.
– Warum nicht uns? Vielleicht bist du ein Spion der Sarazenen.
– Ich führe derlei nicht im Schilde, und ich habe nichts verbrochen.
– Irgendwas hat jeder ausgefressen. Bei jedem reicht es für solche Strafen. Wofür hätte denn unser Heiland sonst gelitten? Keiner braucht es ganz genau zu wissen, die Prozesse könnte man sich eigentlich sparen. Es gibt keinen, der unschuldig verurteilt wird. Ich selber bin kein geringer Satansbraten.
Der Folterknecht lacht, als bekäme er das schwarze Maul nicht wieder zu.
– Aber du stehst jetzt nicht an seiner Stelle, mischt sich der Dominikaner ein, du hast lediglich von mir den Auftrag, die Gabel in der Hand und in der Glut zu halten, die diesem Sünder vielleicht die Höllenflammen ersparen wird.
Das Nahen des heißen Eisens erinnert ihn an frühe Kindersommertage, als in Palermo das Pflaster der Gassen zu heiß wurde, um barfuß zu laufen. Wenn sie mich jetzt umbringen, fehlt mir nur die Lehre, für die ich sterbe. Eine Lehre, für die ich zum Märtyrer werden könnte wie die verbrannten Katharer, von denen Miraflor erzählte! Das täte mir gut! Sterbensmüde bin ich ja. Ist ein Märtyrer nicht der Selbstmörder, der seinen Henker sucht und findet?
Irgendetwas wird er gestehen müssen. Aus den Bibliotheken, in denen er sich vor der Welt hat verbergen wollen, kennt er Schriften kirchlicher Rechtsgelehrter, die den Gebrauch der Folter verwerfen, weil die Erfahrung lehrt, dass der Gefolterte sich jeder Untat bezichtigt, nur um den Schmerzen zu entkommen. Aber was helfen uns Bücher, wenn die Gelehrsamkeit selber in Verruf gekommen ist?
Sie legten ihn in Beinschellen und streckten ihn mit Handschellen, die sie über seinem Kopf an eine über ein Rad laufende Kette schlossen. Sie quälten ihn langsam und mit Sorgfalt. Mit Backenstreichen fingen sie an, mit dem Strecken seiner Gelenke ging es weiter. Die glühende Zange brachten sie ihm nur so nahe, dass er das Sengen an den Haaren spürte, über der Haut und dann an den Brauen, den Wimpern. Aus den Backenstreichen wurden Faustschläge. Drei Zähne, die ihn manchmal auf der Reise mit pochendem Schmerz gequält hatten, gingen dabei zu Bruch. Da er dennoch nicht schrie, stießen sie Schmähungen aus. Er fühlte sich schmächtig werden, er schmachtete. Die Wiederholung eines Schmerzes stumpfte ihn keineswegs ab, wie er gehofft hatte. Sie steigerte ihn, bis er endlich schrie. Er war dabei nicht mehr er selbst, war nur noch sein Schmerz. Doch aus dem äußersten Schmerz glitt er wie in eine Fata Morgana über der flimmernden Wüste hinauf in die süßeste Wonne, so dass er zunächst gar nicht gewahr wurde, dass sie aufhörten. Ist das der Tod? fragte er sich. Das Gesicht des Todes ist das eines lippenlos grinsenden Unbekannten.
Alle Menschen müssen sterben, denkt er. Aber niemand wird dazu geboren, so zu sterben, wie er sterben wird. – Ich möchte etwas aussagen, keucht er.
Dann durfte er ausruhen. Der Dominikanermönch hatte Einhalt geboten. Die Zeit seines Stundengebetes sei gekommen. Der Schmerz ließ nach. Er blieb ihm aber nah. Sein Selbst kehrte wieder, und er und sein Schmerz lächelten einander an. Waren das Einbildungen? Ein runder Weiberhintern kam ihm nahe, oder waren es nicht Brüste? Volle Lippen küssten ihn. Dann fiel er in schwarze Tiefen. Media vita … Er ist vom Tod umgeben, jedoch nicht mehr mitten im Leben.
Da er nun die Schmach der Folter selbst geschmeckt hatte, da nun die Schmerzen in seinen Wunden weiterwühlten, nicht in einem ritterlichen Kampf erlitten, erschien ihm der schmächtige Schmerzensmann, wie er ihn in manchen Kirchen gesehen hatte, auf einem groben Holzklotz sitzend, von Blut überströmt, mit der Dornenkrone auf dem Haupt, die Wange bekümmert in die Hand gelehnt, und schaute ihm lange traurig und unverwandt tief in die Augen. Er schien zu fragen: Wissen sie nicht, dass sie das alles ihrem Herrgott antun? Da fühlte er sich weder als Judas noch als Galahad, da war er ein Bruder Jesu, fühlte die Gottesminne, die Elisabeth ihn hatte lehren wollen.
# – HERR! betete er, Herr, wirf mich nicht zu den Scherben!
War die Folter nur eine Drohung gewesen? Er wurde gewaschen, gekämmt und mit einem alten groben Hemd bekleidet. Das Licht, das durch Spitzbogenfenster in die Halle schoss, blendete ihn, als wäre es die heiße Gabel.
– Dieses Gericht nennt sich Heilige Inquisition. Es verfolgt die gottlosen Irrtümer, die sich jetzt zunehmend ausbreiten. Herr Konrad von Marburg selbst hat es mit der Billigung des Papstes und des Kaisers ins Leben gerufen. Was du leiden musstest, das haben wir dir angetan, weil wir dich lieben. Wir wollen dich davor bewahren, dass du deine Seele unbedacht den Höllenqualen auslieferst. Dass Ihr ein Kundschafter der Sarazenen seid, halten wir für unwahrscheinlich. Was also habt Ihr uns zu sagen?
– Hat sich Herr Heinrich von Anhalt nicht für mich verbürgt?
Die Antwort war ausweichend: – Anhalt liegt weit von hier.
– Gebt mir Schreibzeug und einen Boten. Ich werde mich bei Kaiser Friedrich über Euch beschweren.
– Der Kaiser selbst hat Herrn Konrad und uns dazu ermächtigt, räudige Schafe aus der Herde der Gläubigen auszumerzen. Die Sorge um die Ihm von Gott übertragene Herrschaft drängt Ihn, die Ketzerordnung, die er erließ, auch zu vollstrecken.
– Was wird mir vorgeworfen?
– In Kaiser Friedrichs Kanzlei liegt ein Befehl vor, Euch zu suchen. Ihr habt Euch unerlaubterweise aus dem Kreuzfahrerheer des Königs von Jerusalem entfernt.
– Ich ritt in Seinem Auftrag aus, und Sarazenen nahmen mich gefangen. Er war der letzte Christ, den ich gesehen und gesprochen habe. Er würde es bezeugen, wenn ich mich vor Ihm verantworten dürfte.
– In Seinen Reihen wart Ihr schon ein Feind des Glaubens, und Ihr gehört zu den Schlangensöhnen des Unglaubens. Ihr habt die Kirche herabgesetzt und beleidigt, also den Mutterleib aller Segnungen der Religion entweiht. Ihr habt den Namen Gottes geschmäht. Ihr hattet Umgang mit dem Teufel.
– Der Teufel ist mir nie unter die Augen gekommen.
– Er ist es sehr wohl, denn auch ich habe ihn gesehen. Er nannte sich Klingsor von Ungerland. Er nannte sich den Unbehausten, der kein Haus brauche, weil er in allem wohne, was Natur ist, er nannte sich sogar unsterblich, denn wenn er sterbe, sagte er, sei er nicht tot, er schlafe nur in den Dingen dieser Welt, verwandle sich, um da und dort noch einmal zu erscheinen. Den Heiden der Vorzeit diente er als der Zauberer Merlin. Wir sahen ihn als Lehrer und Minnesänger, als den Lehrer in der ungarischen Königsburg, als Minnesänger bei den Festen auf der Wartburg. Morgen wirst du uns etwas von der Wartburg erzählen, nicht wahr? Morgen!
Der Hang fällt steil einem Meer entgegen, tiefblau schimmert es zwischen den lichtgrünen Nadeln der Pinienschöpfe, in denen hell die Zikaden kreischen, und die rosenfarbenen, den Lilien ähnelnden Blütentrauben der Asphodelen schaukeln in der auflandigen Brise, von oben her kommt ihm in einer Staubwolke die Ziegenherde entgegen, Mäuler rupfen, die Ziegen meckern, die Böcke stellen sich voreinander auf, neigen die Hörner, um sich zu stoßen
Das hat er wieder nur geträumt. Irgendwo singt jemand zu gezupften Saiten, es klingt wie die Stimme des Troubadours Giovanni Bernadone, der sich später lieber Francesco nannte. Auch Francesco hätten sie auf einen Scheiterhaufen gestellt, wenn er nicht so klug gewesen wäre. Das Gesicht des Folterknechts: Teufel sollen Menschen zu Engeln machen? Zu Heiligen? Jesus wollte das Reich Gottes, auch Augustinus hat es gemeint, doch diese Kirche meint es nicht. Sie ist nur ein weltliches Reich wie andere Reiche. Durch welche Fluten von Blut und Schmutz hat Jesus Christus waten müssen, um auch zu mir zu finden! Warum brauchen sie eine Heilige, die Wunder tat. Warum ist ihnen nicht wichtig, dass diese Frau nicht essen wollte, weil sie nichts essen konnte, während andere nichts zu essen hatten, die sich nicht prächtig kleiden wollte, weil so viele andere in Säcken steckten, die weder ihre Schönheit noch ihre Kleidung noch ihre Gesundheit pflegte, während so viele dahinsiechten. Vor einer Heiligen weicht man scheu zurück. Sie aber ist …
– Wollt Ihr nun Euern Starrsinn fahrenlassen und bezeugen, was Ihr wisst?
Was ist das für eine hübsche Zelle? Wie weich liegt man auf dieser Pritsche und dem heugestopften Sack. Der Dominikaner hat gefragt.
– Wer hat vor mir schon bezeugt, was ich nun auch bezeugen soll?
– Die Magd Guda wusste zu berichten, Elisabeth sei, als vier ungarische Ritter beim Landgrafen zu Gast waren und es ihr an prachtvollen Kleidern fehlte, weil sie wieder alle weggegeben hatte, bei der Tafel dennoch in einem kostbaren Gewand aus grünem Samt erschienen, und da ihr Gatte sich verwunderte, weil er es nicht kannte, erwiderte Elisabeth, Gott habe es ihr geliehen für diesen Tag, damit ihrem Vater von ihr nichts Unpassendes berichtet werde.
Guda, erinnert er sich, hatte ihm erzählt, sie selbst wäre im grünen Samtkleid vor den ungarischen Gästen anstelle von Frau Elisabeth erschienen, weil ihre Herrin das Büßerinnenhemd nicht hatte ausziehen wollen. Aber er sagte nichts.
– Frau Isentrud von Hörselgau, die Zwillinge Ildikó und Tünde von Egér, die dazu eigens aus Ungarn kamen, auch alle ihre Dienerinnen bezeugten uns glaubwürdig ihre Keuschheit. Nun?
– Über die Keuschheit der Frau Landgräfin kann ich sagen, dass sie ihre Ehe mit Herrn Ludwig niemals gebrochen hat. Wenn das Ausbleiben jeglichen Ehebruchs als Keuschheit gilt, so war es eine keusche Ehe. Freilich, aber das wisst Ihr ja, kinderlos wie die Kaiser Heinrichs des Zweiten mit Frau Kunigunde ist sie nicht geblieben.
– Herr Heinrich Raspe hat reumütig bezeugt, dass Gott im Korb die Brotwecken, die er ihr für ihre Armen und Kranken nicht gönnen wollte, vor seinen verstockten Augen in Rosen verwandelte.
– Davon hörte ich auf meiner Reise. Als das geschah, war ich schon im Gefolge des Herrn Landgrafen auf dem Weg ins Heilige Land.
– Was hast du uns noch zu sagen.
Da ist noch einer. Er beharrt darauf, ihn unehrerbietig anzureden. Jemand steht weiter im Hintergrund: Es ist der Bischof.
– Sie roch immer gut. Immer.
– Was für ein Unsinn. Willst du uns foppen?
Der andere Vernehmer fragt den Frager: – Warum nicht? Ging nicht von ihrem Leichnam eine heilige Feuchte aus und ein balsamischer Duft?
– Sie roch immer sehr gut, fährt Rodeger, davon ermuntert, fort. – Auch wenn sie sich tagelang nicht gewaschen hatte. Ohnehin ließ sie sich nicht gern baden. Es war ein Duft wie Weihrauch und Honig. Vor dem Beten wirkte sie krank und ältlich. Nach dem Gebet erstrahlte ihr Gesicht wieder in jugendlicher Frische. Und um ihr Haupt war oft ein sonnenhaftes Leuchten, wie ein Heiligenschein.
Den Lavendelduft verschweigt er. Ihm hängt ein Hauch von Wollust an, und sofern die Vernehmer dasselbe meinen, wäre er des Teufels überführt.
– Das stimmt zu dem, was andere behauptet haben, sagt der Dominikaner. – Das nehmen wir ins Protokoll. Aber hütet Euch! Der Böse, so spricht Salomo, wird leicht gefangen in seinen eigenen falschen Worten! Wie kamt Ihr denn mit Eurem Rüssel an ihren Geruch ohne Unkeuschheit?
– Die Sprüche Salomonis sagten auch, entgegnet Rodeger, ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer eine Schmähung überhört, ist klug.
Der Ton wurde jetzt harscher: – Gestehe endlich deine Unkeuschheit im Umgang mit ihr, dein Trachten nach Unkeuschem! Gestehe endlich die versuchte Buhlschaft! Wir haben nicht lediglich Vermutungen, wir wissen es. Sie hat es selber Herrn Konrad von Marburg gebeichtet. Und er hat es aufgeschrieben. Immer und immer wieder hat sie verlangt, dass er sie geißelte dafür, dass sie sich hatte hinreißen lassen. Du brauchst es uns nur zu bestätigen. Dann bezeugst du uns ein Wunder oder mehrere, eure Sünde ist getilgt, und wir vernichten ihr Geständnis und auch deins. Anderenfalls richten wir dich nach ihrem Zeugnis als einen Ketzer, der keusche Weiber verführt mit gescheiten Reden, Irrlehren und siebengescheiter Gottesgelahrtheit nach der Weise der Katharer und Patarener, der Waldenser und der Albigenser. Viele von ihnen waren geständig. Wir haben ihre armen Seelen durch das Feuer des Scheiterhaufens dem Höllenfeuer entrissen. Was hast du uns zu sagen?
Da ist sie wieder, die Angst. Ist es Höllenangst? Ist er nicht durch die Hölle schon gegangen? Die Hölle mag heiß sein, das Verlies war feucht und kalt. So muss es auch eine kalte Hölle geben. Ist es Dämonenangst? Hüte dich vor Leuten, die an den Teufel glauben, hatte ihn Ursus von Lodi gelehrt. Lebt er noch? Oder haben sie ihn schon als Ketzer verbrannt? Es ist die Angst vor diesen rohen Menschen, die den Gefühlen seines Herzens schlechte Namen geben und nach Belieben mit ihm machen können, was sie wollen. Aber wenn sie mit mir diesen Handel schließen, brauchen sie mein Leben mehr als meinen Tod.
– Ich kam ihr, sooft wir in ihrem Gebetbuch lasen, nahe genug, sagt er, und ihr Wohlgeruch nährte unkeusche Wünsche in mir. Aber es blieben nur Wünsche. Alle Schuld liegt bei mir. Sie hatte keine Schuld. Gott wird mich strafen, mich allein.
Da sah er unwillkürlich wieder, wie in Sankt Katharinen zu Eisenach ein durch die Kirchenfenster wandernder Sonnenstrahl sich im Haarschopf der Landgräfin verfing und ihn so erleuchtete, so hell und klar, dass der Priester innehielt und einen Schritt hinter sich trat und alle zu ihr schauten, und wie sie hernach einander bestätigten, ein Heiligenschein habe ihr Haupt umgeben. Ein glückliches Lächeln sei über ihr Gesicht geglitten, sie habe die Augen geschlossen und geweint, zuerst mit verzerrtem Mund, doch dann beglückt und wie verklärt.
Das erzählte er mit einfachen Worten: Er habe ihr Haupt bei einer Andacht in einem sonnengleichen Glanz gesehen.
– Diese Aussage trifft auffallend zu, ließ der Bischof sich nach einem kurzen Schweigen und einem Räuspern hören.
– Der Priester, den wir auch befragten, sagte, ihre ganze Gestalt sei von dem heiligen Licht wie weggelöscht gewesen. War es so?
Rodeger ahnte, dass man ihm eine Brücke baute. Obwohl er dieses gänzliche Verschwinden selbst nicht wahrgenommen hatte, erhob er auch hier keinen Einwand, sondern bestätigte:
– Ja, Herr, so war es. Sie beichtete mir auch, es war kurz bevor mir das Amt eines Magister disciplinae spiritualis entzogen wurde, sie habe in solch einem Zustand oft eine große Wonne empfunden und das Himmelreich offen gesehen und Jesu Christi Augen, die hätten gütig und verzeihend zu ihr herabgeschaut, er habe sich abgewandt, da wären ihr Tränen über die Wangen geronnen, und da habe er, gerührt von ihrem Sehnen, sie wieder angeschaut und ihr mit seiner göttlichen Kraft das Herz gestärkt, ihr wäre darüber zum Lachen froh zumute geworden, und sie hätten, sie und Jesus Christus, einander wie Brautleute für die Ewigkeit versprochen.
Er hatte, dem Kratzen der Federn lauschend, gesenkten Blickes gesprochen und, zu Einzelheiten zurückkehrend, manches noch ausgeschmückt und schaute auf. Er sah in zufriedene Gesichter.
– Und, beeilte er sich anzufügen, sie fing einmal mit dem Eimer einen Fisch im Brunnen, als ein Bettler sich mit Brot nicht mehr zufrieden geben wollte, mit einem Eimer!
Aber sie ließen ihn nicht gehen. Sie wussten noch etwas, das sie bestätigt haben wollten. Herr Konrad von Marburg hatte das Beichtgeheimnis umgangen. Durch sein Pergament waren sie über alles, was Elisabeth dem Beichtvater eröffnet hatte, genau unterrichtet.
– Hast du die Passionswunden an ihr gesehen?
– Nur in den Handflächen. Mehr sah ich nie von ihrem Körper.
– Wie war das mit dem Aussätzigen im Bett der Frau Landgräfin?
– Ich kann bezeugen, dass Frau Elisabeth während der Abwesenheit des Herrn Landgrafen, der zu Gericht geritten war, einen Aussätzigen in ihrem Ehebett gepflegt hat, der sich in dem Augenblick, als unverhofft der Herr zurückerschien, durch ein Wunder, mit dem Gott sie schützen wollte, in ein Kruzifix verwandelte.
– Das stimmt zu deinem Glück mit den Aussagen den Dienerinnen Ildikó und Tünde von Egér überein. Der Aussätzige allerdings bist du gewesen, nicht wahr? Gestehe die Missetat, so soll die Sünde ausgetilgt sein und das Wunder stehenbleiben für die Nachwelt.
– Ich gestehe es.
– Gelobt Ihr Reue und Buße?
– Ich gelobe es.
– So soll denn besagtes Pergament des Herrn Konrad von Marburg vernichtet werden. Gut, dass er es nicht zusammen mit den Aussagen der Zeugen nach Rom geschickt hat! Es hat nun seinen Dienst getan, und es hätte auch nicht weiter bestehen dürfen. Denn es ist selbst ein Dokument der Sünde und der Schande, beweist es doch, dass dieser Mann bei allen seinen Verdiensten um das Wohl der Heiligen Kirche zu weit ging und sogar das Beichtgeheimnis brach. Aber als unser Heiland den Sünder Petrus einsetzte zu seinem Stellvertreter auf Erden, gab er ihm Macht und Autorität, die Sünden aller Sünder tilgen zu helfen, wenn sie zum Wohl der Kirche eingesetzt werde. So hat die Mutter Kirche es mit den Kreuzfahrern gehalten, so hält sie es auch mit dir.
– Ich will gehorchen.
– Gut. Noch eine Frage: Was steht in den Schriften, die du mit dir führtest? Sie sind in arabischen Zeichen geschrieben. Kannst du sie lesen? Lies sie uns vor. Damit ersparst du der Heiligen Inquisition viel Arbeit.
– Es sind Dichtungen aus Persien. Ich bin vor allem Dichter. Ich fand sie schön.
– Lies sie uns vor!
Ein Mönch entrollte langsam, was Rodeger in der Wüstenhelle unter Palmen geschrieben hatte. Warum misstrauen sie mir nicht? Ich kann ihnen ja lesend alles vorgaukeln, was ich will? Vielleicht haben sie in ihrer Inquisition niemanden, der des Arabischen mächtig ist.
– Ohne meine Berylle kann ich nichts erkennen.
Man gab sie ihm zurück.
Es waren seine eigenen Verse. Er fing an, daraus vorzulesen. Was Anstoß hätte erregen können, übersprang er. Theologische Bemerkungen, die er nach Gesprächen mit Abdallah festgehalten hatte, verwandelte er in Schmähungen gegen den Islam und Lobpreisungen der Christenheit und ihrer Kirche. Die geistlichen Herren begannen zu gähnen.
Der Bischof unterbrach ihn: – Genug! Ihr seid auf Ehrenwort entlassen, Herr Rodeger von Serimunt!
Die Buße, die ihm feierlich auferlegt wurde, bestand darin, im folgenden Jahr zur Erhöhung von Elisabeths Gebeinen nach Marburg zu reisen und sich bis dahin in ein Kloster zu begeben. Für seinen anschließenden Aufenthalt war ein Kloster vorgesehen, das er in Halberstadt finden werde. Er solle sich in der Vogtei melden, dort werde man es ihm nennen. Einstweilen habe er die Frist bei den Dominikanern in Bamberg, auf sein Ehrenwort, abzuwarten. Wenn es Zeit sei, aufzubrechen, werde ihm ein Reisiger des Erzbischofs, seinen Weg zu überwachen, beigegeben.
Wohin ist er mit seinem Edelmut gekommen? Es braucht viel Mut, edel zu sein und edel zu bleiben. Ihm wird, als hätte er Elisabeth verraten und auch sich selber, als hätte er das Zarteste, das sie verbunden hatte, preisgegeben. Was mir fehlt, denkt er, gibt es aber nicht mehr, und hätte ich es behalten wollen, wäre es nicht mehr das, was mir fehlt. Aus Göttern und guten Geistern haben sie Teufel und Dämonen gemacht und Hexen aus Elfen und Nymphen. Wie hätten sie es nicht schaffen sollen, mich, einen Königssohn, in einen mit Asche bestreuten Sünder zu verwandeln! Ist es ihnen nicht auch mit dem vierten Heinrich, dem Salier, gelungen? Hat sich nicht sogar der stolze Staufer, der zweite Friedrich, vor ihnen demütigen müssen?
Das karge Leben im Kloster kannte er aus seiner Studienzeit in Salerno. Auf den Ablauf eines Tages in der Gemeinschaft der Mönche verstand er sich. Die Regel des neuen Ordens wich nur wenig ab von der Benediktinerregel, die ihm geläufig war. Er saß meist unter den Rußmalen der Talglampen bei den Büchern und las. Niemand hatte ausdrücklich gesagt, dass er nichts schreiben durfte. Aber sooft er um Tinte und Feder und um Pergament oder auch nur schlechtes Papier bat, wurde er abgewiesen.
Zum Pfingstfest des Jahres 1235 läuteten in den Kirchtürmen von Bamberg und im ganzen Reich die Glocken: Elisabeth von Thüringen war heiliggesprochen worden. Am ersten Tag des Mai im Jahr darauf sollte, so wurde verkündet, im ludowingischen Marburg, das zum Besitz der Landgrafen von Thüringen gehörte, die Erhöhung ihrer heiligen Gebeine gefeiert werden. Herr Rodeger von Serimunt verbrachte auch den Winter im Klosteralltag und wurde gut behandelt. Ein Jahr nach seiner Rückkehr aus dem Morgenland erschien bei ihm der Reisige des Erzbischofs, um ihn nach Marburg zu geleiten. Er klapperte mit Ketten. – Der Bischof, sagte er, hat Euer Ehrenwort. Aber ich bitte Euch dennoch: Macht keinen Versuch.
Man gab ihm sein Pferd zurück. Die Stute Muntane war abgemagert. Sie schnob verdrossen, erkannte aber sofort ihren Reiter.
Er ließ sich leiten wie ein Tier und behielt fast keine Erinnerung an diese Reise. Nur dass die Dörfer und auch die Städte der meisten Landstriche ähnlich verwüstet waren wie manche bei seinem ersten Ritt durch teutsches Land vor Jahr und Tag, entging ihm nicht. In den Unterkünften, in die man erst nach langem Rufen mürrisch eingelassen wurde, herrschte bis tief in die Nacht ein grober Ton. Bat Rodeger um etwas, erhielt er lange keine Antwort. Dann wurde ihm mit einem bösen Blick gesagt, das sei ein ganz besonderer Wunsch, man habe es nicht. Oder das Gewünschte wurde ihm wortlos hingeworfen. Oft lagen die Gäste in einem einzigen Raum beieinander, fraßen und soffen, schrien und sangen dazu. Einer entfilzte sich bei Tisch die Haare, ein anderer klopfte seine Kleider aus oder wichste die Stiefel. Beschwerden wurden in schroffem Ton zurückgewiesen: – Du bist wohl was Besseres? Fick dich doch selber! Ein Popel in meiner Nase ist mehr wert als du! So unflätige Beschimpfungen arteten in Raufereien aus. Man aß mit Holzlöffeln aus einer großen Schüssel. Einmal war es Brot in warmer, dünner Brühe, ein andermal in saurer Milch oder in schlechtem Wein. Gab es Fleisch, war es entweder zu fett oder schon alt. Spät wurde es in den Nestern aus Lumpen und Stroh voll Ungeziefer ruhig genug zum Schlafen. Der erzbischöfliche Reisige schien nichts anders gewöhnt.
Alle, die in Zeugenaussagen ihre Wunder beschworen hatten, waren in die Stadt Marburg beschieden worden. Mehrere hundert Frauen und Männer fanden sich ein. Die Aussagen wurden verlesen. Schon unterwegs auf den Straßen und in den Dörfern und Städten beklagten sie ihre Sünden und verfluchten die Dämonen, die ihnen die Augen hartnäckig hatten verschließen wollen. Sie schmähten alle Ketzer, die an der gottgewollten Ordnung rüttelten, sich frech anmaßten, einem vermeintlich klügeren und reineren Glauben zu folgen, den ihnen der Teufel vorgaukelte, sie flehten um die Gnade, von diesem und jenem Bann und seiner bindenden Gewalt erlöst zu werden. Sie dürsteten nach Segen und nach Weihe. Einige geißelten sich selbst auf den öffentlichen Plätzen und schrien: – Das Ende aller Zeiten ist angebrochen!
Was hätte Elisabeth dazu gesagt? Sie ist das Menschenopfer, sagte sich Rodeger, das sich die aussätzige Kirche, um sich zu heilen, zu verschaffen wusste, das nötig scheint, wo man die Liebe nicht mehr kennt. Sein Begleiter blieb so stumm wie er und bekreuzigte sich nur dann und wann. Niemand zwang den frommen Ritter, der ein Mönchsgewand trug, es den anderen Frommen nachzutun. Am Stadttor von Marburg überließ der Reisige ihn und das Pferd einem städtischen Fußknecht und trat ohne ein Wort und ohne Gruß den Rückweg an. Mit der Torwache hatte er in Wachs gehüllte Pergamente gewechselt. Der Fußknecht hieß ihn absitzen, sein Pferd in Verwahrung geben und führte ihn durch das Gedränge der Straßen, herrschte die Leute an, Platz für einen frommen Ritter zu machen, und reihte sich mit ihm in den heiligen Festzug ein. Ordensritter wie die Johanniter mit roten Kreuzen und die Tempelritter mit schwarzen Kreuzen auf weißen Mänteln hatten allein das Recht behalten, zu Ross zu reiten. Die Mönche gingen hinter ihnen zu Fuß. Der Bewacher schien den Platz, wo er sich mit dem Halbgefangenen einzufinden hatte, genau zu kennen. Die Reihen weißgewandeter Prämonstratenser, graugewandeter Zisterzienser, die Franziskaner in braunen Kutten, die Benediktiner, deren Kutten die Farben grober Wolle behalten hatten, zogen vorüber. Bei den Dominikanern im schwarzweißen Elsternhabit wurden sie aufgenommen.
Sonderbar schnell gelangt die Gruppe unter gregorianischen Gesängen in die Nähe der edleren Häupter, um die Reiter mit Trompetenschall und blanken Klingen im Kreis den Raum freihalten. Herr Heinrich Raspe, der Landesherr, Jung-Konrad und die greise Landgrafenwitwe Sophie gehen mit in dem kleinen Zug. Und es ist wahr, was überall im Land herausgeschrien worden war: Der Kaiser Friedrich schreitet in einem härenen grauen Bußgewand, der Kutte der Zisterzienser, barfuß, hinter dem Sarg her. Dicht an Rodeger kommt er vorüber. Ein stechender Blick trifft ihn kurz aus den Augenwinkeln seines Widerbildes: Hat ein Büßer den anderen erkannt? Erinnert er sich des Examens zu Jerusalem und des Auftrages, den ich nicht erfüllen konnte? Man munkelte, dass sein Sohn Heinrich, als der Siebente teutscher König, nicht mehr im Land sei. Tief in einem Kerker Apuliens schmachte er, nachdem er sich empört habe gegen seinen Vater, schon zum zweiten Mal. Der Kaiser habe die englische Prinzessin Isabella geheiratet, rüste zu einem neuen Kreuzzug und reise dazu nicht einmal weit, nur über die Alpen, um die rebellischen Städte der Lombardei niederzubrennen wie sein Großvater, Kaiser Friedrich Barbarossa, voreinst. Der große Frieden, den er der Welt bringen wollte, läuft schnellen Fußes wie die wandelbare Fortuna auf einer Kugel vor ihm her, so schnell oder so langsam wie er. Mit diesem Frieden hatte er unter den Kaisern aller Zeiten der wiederkehrende Römerkaiser Augustus sein wollen, der Kaiser, zu dessen Zeiten Jesus geboren wurde! Einem Menschen hat er nachgeeifert, der Gott werden wollte, als Gott in Menschengestalt auf die Erde kam? Aus solchen Händen konnte nur ein Frieden der Totenstille kommen. Dass seine Pläne gescheitert sind, bedeutet aber auch mein Ende.
Rodeger verhielt den Schritt und wiederholte sich tonlos, nur mit den Lippen: Dass seine Pläne gescheitert sind, bedeutet auch mein Ende.
Der Kaiser ist stehengeblieben. Das blinkende Kopfreliquiar der Heiligen hebt er empor, damit die Menge ihn erblicke.
– Da mir auf Erden nicht vergönnt war, sie als Kaiserin zu krönen, verkündet er mit volltönender Stimme, ehre ich sie mit dieser Krone als Königin in Gottes Reich!
Sie haben ihr also den Kopf vom Leib getrennt. Alles zerschnippeln sie, um es zu Markte zu tragen. Sogar mich hätten sie beinahe zerschnippelt, obschon man aus mir nie wird einen Heiligen machen können. Ein gutes Geschäft bin ich für niemanden.
Rodeger wandte sich ruckartig ab. Er wollte jedoch sein Widerbild so einfach nicht entkommen lassen und fasste den Kaiser erneut ins Auge.
Ungebunden fiel Herrn Friedrich das kaum angegraute, noch immer rotbraune Haar in Locken auf die Schultern des Bußgewandes. Nur ein Kreuz fehlte auf seiner Schulter, damit er wie Jesus Christus aussah. Muss der Herrscher sich wieder einmal aus einem Kirchenbann lösen? fragte sich Rodeger. Sind Papst und Kaiser wieder oder immer noch zerstritten? Geht denn von der Heiliggesprochenen solch ein Zauber aus? Ein Seitenblick des Büßers zwischen seinen Würdenträgern, deren Gewandungen neben ihm desto prächtiger ins Auge stachen, schien den büßenden Ritter plötzlich zu erkennen: Rodeger hatte das maskenhafte Grinsen wiedererkannt: Da sah sein inneres Auge die gespannten Fäuste des kleinen Federico, die geballten Fäuste Friedrichs, des Stauferkönigs. Und er hörte die Stimme Konstanzes, der Normannin, der Stauferwitwe: – Die Staufer kommen aus den schwarzen Wäldern im Norden und tragen deren Finsternis in ihren Herzen.
Der Sarkophag wurde in die Kirche hineingetragen und dort auf einem Katafalk erhöht. Die ungarische Gesandtschaft überbrachte hier erst die Huldigungen König Andreas‘ des Zweiten, des Thronfolgers Béla, ihres Bruders, und der Königin Yolante. Man zeigte das kostbare heilige Gefäß nochmals herum, aus einer Krone und einem Prunkkelch gearbeitet, das ihren Kopf bewahrte, die kostbarste Reliquie der Heiligen. Ein Prunkkelch, wozu? fragte Rodeger unwillkürlich den Unbekannten neben sich, den er etwas Ungarisches hat brümmeln hören, ohne eine Antwort zu erwarten. Aber er sagte nicht laut, woran er sich jetzt erinnert fühlte: Trank nicht ein gewisser Krum, der Herrscher der Bulgaren, einst aus dem mit getriebenem Silber ausgelegten Schädel des Kaisers Nikephoros? War ihm das nicht am Hof des ungarischen Königs András als ein Beispiel schlimmer Barbarei erzählt worden, als er das Mädchen Elisabeth zum ersten Mal gesehen hatte? Nun diente in einer sonderbaren Umkehrung ein Trinkgefäß zur Aufbewahrung ihres Hauptes!
Die Grabkapelle war schon dem Heiligen Franziskus geweiht. Auch die Gebeine des Konrad von Marburg hatten darin Ruhe gefunden. Die Grafen von Sayn und von Solms, die ihm bei Beltershausen aufgelauert hatten, um ihn zu ermorden, knieten unter den strengen Augen ritterlicher Schergen nieder, in Büßerhemden und mit flach aneinandergelegten Händen flehentlich um Vergebung bittend.
Der Bewacher zog Rodeger in eine Nische des Portals: – Hier müssen wir den edlen Herrn erwarten, der Euch nach Halberstadt führen wird.
Rodeger fühlte sich gleich darauf beäugt von Augen, in die er schon geschaut hatte. Ein alter Ritter pflanzte sich vor ihm und dem Bewacher auf. Sein Haupthaar war sehr stark geblieben, aber mit einem silbrig schimmernden Glanz ergraut.
– Ja, mein lieber Herr Ritter Kupferdach! Nannte man dich nicht einst so in früheren Jahren? Was hast du noch für glänzend rotes Haar! Ich habe längst ein Silberdach!
Da erkannte Rodeger ein bekanntes Gesicht: Herr Heinrich von Askanien, der Fürst von Anhalt! Sie fielen stumm einander in die Arme.
– Ich habe aus Bamberg Auftrag, dich aus dem Gewahrsam des Wächters zu lösen, um dich nach Halberstadt zu geleiten. Machen wir uns schleunigst auf den Weg! Dass ich mich nicht nach Bamberg bemühen konnte, das entschuldige bitte.
Unter den Augen des Bewachers entrollte der Fürst ein schmales Pergament, an dem zwei schwere Siegel hingen. Der fremde, in Eisen gehüllte Schatten brummte, er überlasse nun dem Fürsten von Anhalt diesen Mann auf Ehrenwort, trennte eines der Siegel mit seinem Messer ab, verneigte sich und schritt davon.
– Schnell aus der Stadt! seufzte der Fürst. – Was bin ich froh, dass du in Bamberg mich als Gewährsmann nanntest. Es hätte dir schlimmer ergehen können.
– Es ist mir schlimm genug ergangen. Ja, machen wir, dass wir diesem frommen Jahrmarkt schleunigst entkommen. Es ist ein Ort des Jammers, der mich mehr leiden macht als die Folter.
Aber sie kamen nur langsam voran im Lärm der Gassen. Mönche verkauften das heilige Öl, das aus dem Bleisarg Elisabeths getropft sein sollte, an Pilger, die ihnen die verlangte Anzahl Silbermünzen in die ausgestreckten Hände zählten. Der eine Pilger stützte sich auf Krücken, der andere wackelte unaufhörlich mit dem Kopf, ein dritter hatte beständig Schaum vorm Mund und konnte sich die Zunge nicht mehr hinter die Zähne ziehen, und ein Weib in mittleren Jahren musste ihn am Ellenbogen führen. Ein Vierter war blind und gab dem Klosterbruder seinen ganzen Beutel hin.
Sie hat, dachte sich Rodeger, wie eine Heilige gelebt und, wider ihren Willen, sogar die Aufmerksamkeit derer gefunden, die Heilige machen. Ganz wie Fransesco. Das ist jetzt nützlich. Wenn alle Wohltätigkeit üben, braucht man die Güter dieser Welt nicht anders zu verwalten, nicht besser zu verteilen.
Man zeigte den Leuten die aus Holz und Lehm unter ein steiles Dach aus Reisig und Laub geflochtene Hütte, in der Frau Elisabeth zuletzt gelebt hatte. In eine andere Behausung habe man sie nicht einmal mit Gewalt zu bringen vermocht. Man zeigte auch die Kapelle, in der sie tagelang betend flach auf dem Boden liegengeblieben war, ohne sich zu rühren, so dass sie danach immer wieder in schlechter Kleidung krank darniederlag und keinerlei Speise zu sich nahm. Man zeigte das Hospital am Ufer des Schwarzen Wassers, das sich unweit wieder in die Lahn ergoss, nachdem es sich, den Marbach aufnehmend, von ihr abgezweigt hatte. Am Tor lösten sie ihre Pferde aus.
– Du bist gefoltert worden? fragte Herr Heinrich, als sie die Mauern Marburgs hinter sich gelassen hatten. – Das hat man mir verschwiegen! Erzähle! Was hat man dir angetan?
– Nein, erwiderte Rodeger, das werde ich nie jemandem erzählen. Aber wie ist es dir ergangen in allen den Jahren?
Herr Heinrich lachte auf und seufzte: – Ich dichte schon lange keine Minnelieder mehr.
Unter den Abreisenden erkannten sie an flatternden Fähnlein unweit den Tross der Ludowinger.
– Heinrich, genannt Raspe, mein Schwager und Namensbruder, auf den ich nicht stolz sein kann, ist inzwischen Landgraf von Thüringen geworden, erklärte ihm der Fürst. – Und Elisabeths Sohn lässt man damit warten, obwohl er volljährig ist. Und Herr Konrad, Jung Konrad einst, des seligen Landgrafen Ludwig jüngster Bruder, der ist Heinrichs Mitregent, und da der Hochmeister des Teutschen Ordens Hermann von Salza dem Sterben nahe liegt, erzählt man einander als ein offenes Geheimnis, dass Konrad von Thüringen sein Nachfolger im Ordo Teutonicorum werden soll.
Sie ritten von Marburg gen Mitternacht und nächtigten in dieser und jener Herberge. Am Lauf der Weser stießen sie auf die Reichsabtei Corvey und fanden Aufnahme für ein paar Tage der Rast.
– Kommt die Weser nicht aus der Werra, die unweit der Wartburg aus den Wäldern tritt? fragte Rodeger.
Heinrich von Anhalt schaute ihm fragend in die Augen.
– Ach nein, sagte Rodeger mit gesenktem Blick, nein, die Wartburg möchte ich nicht wiedersehen, und auch die Creuzburg nicht und nicht die Neuenburg und keinen aus der Familie der Ludowinger, die inzwischen gottlob andere Wege genommen haben, und auch die Zwillinge Ildikó und Tünde möchte ich nie wieder sehen.