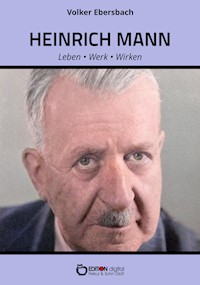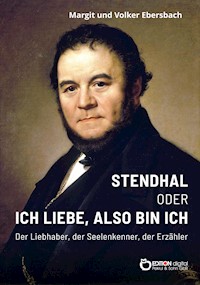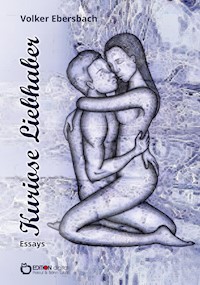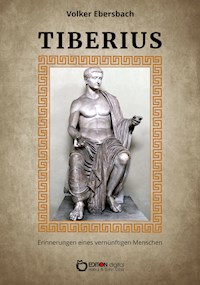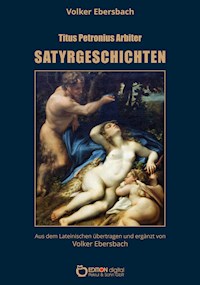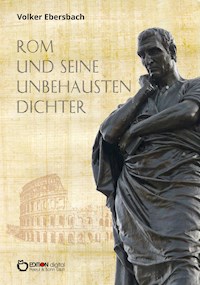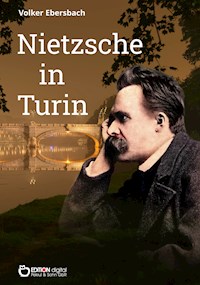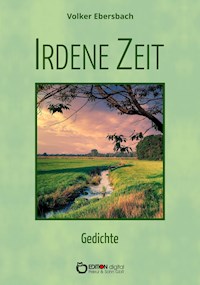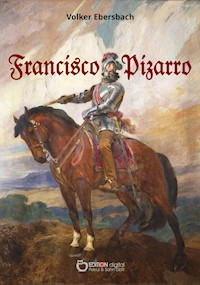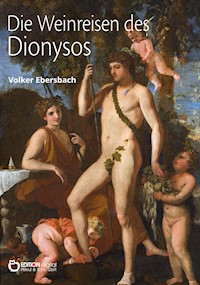8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
„Spannend erzählt“ – als dieser historische Roman erstmals 1985 in dieser Reihe von Verlag Neues Leben Berlin erschien, trug er dieses Prädikat völlig zu Recht. Es geht sehr spannend und zugleich informativ zu und man meint, man wäre bei den Geschehnissen im Alten Rom dabei gewesen, von denen der Autorh erzählt. Die Handlung seines Romans spielt vor 1958 Jahren, als Kaiser Nero in Rom regierte. Eben dorthin sind Gajus und sein Begleiter Longus, der Lange, unterwegs. Beide sind eben einem Sklavenaufstand in den Steinbrüchen von Luna, wo sie als Freie fast genauso schuften mussten, entkommen und haben verschiedene Gründe, in die Stadt der Städte gelangen zu wollen. Für Gajus, den zwanzigjährigen Bauernsohn, der schon schlimme Zeiten hinter sich hat, sind es vor allem zwei: Er will die schöne Gärtnerstochter Eirene wiederfinden, in die er sich im Hause seines Onkels verliebt hatte, die aber nach Rom verkauft wurde. Und er will seinen Bruder wiederfinden, der ein berühmter Gladiator geworden ist. Wer kann ihm helfen, sie im großen Rom zu finden? Weiß vielleicht Longus jemanden, der ihm einen Tipp geben kann? Aber der ist, kaum dass beide in Rom angekommen sind, erst einmal verschwunden. Dafür trifft Gajus jemand anderen, eine Frau, die ihm später noch sehr viel helfen wird: Dieser Garten ist zu unruhig, dachte Gajus, stand auf, als die Frauengestalt auch den Schlüssel zum Landhaus gefunden hatte, rollte seine Decke ein und wollte hinausschleichen. „Halt!“, rief eine helle Stimme aus dem Schatten der Terrasse. „Komm her!“, lockte sie. „Hierher, zu mir!“ Die Beine wollten es anders als Gajus. Sie trugen ihn nicht hinaus ins Freie. Was bin ich für ein Tölpel, warf er sich vor, während er dem Ruf folgte. Sie hielt sich im Dunkel neben einer Säule. „Was machst du hier?“, fragte sie nicht unfreundlich. Die Stimme klang jung, noch mädchenhaft. „Ich habe geschlafen.“ „Allein?“ „Ja, wie denn sonst?“ Sie kicherte. „Wie alt bist du?“ „Zwanzig.“ „Sieh an! Wie ich! Hast du Geld?“ „Was fragst du mich aus? Wer bist du?“ Gajus schaute sich forschend um. Vielleicht machte sie für Räuber den Lockvogel oder kundschaftete für Einbrecher etwas aus. „Eine Nymphe bin ich. Du kannst mich Aganippe nennen.“ „Nymphen gibt es nicht.“ „Wie du siehst, gibt es sie doch.“ „Und was machst du hier?“ „Ich erwarte meinen Faun, wenn du verstehst, was ich meine. Er ist kein Freund von Pünktlichkeit, wie ich sehe. Sag, hast du Geld? Dann können einstweilen wir beide uns die Zeit vertreiben.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 440
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Gajus und die Gladiatoren
ISBN 978-3-96521-620-4 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1985 im Verlag Neues Leben Berlin (Band 195 der Reihe „Spannend erzählt“).
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
I. Blutiger Marmor
An diesen Tag wird er sich immer wieder erinnern müssen. Im Morgengrauen ist er schon wach, bevor das Weckhorn mit seinen dumpf anschwellenden Rufen zwischen den Schlafbaracken die Runde macht. Denn er weiß, es wird kein gewöhnlicher Tag. Jupiter, den Allmächtigen, hat er am Abend zuvor gebeten, die Wahnwitzigen zu warnen. Zu Apollo, dem göttlichen Seher, dem Orakelkundigen, hat er gefleht, den thrakischen, judäischen, germanischen und anderen fremdländischen Sklaven Traumgesichte zu schicken, damit sie ihr Vorhaben aufgeben, vorerst wenigstens. Je näher er den Hornruf spürt, umso stärker klopft sein Herz. Sie schnarchen und pusten auf ihren Pritschen, wälzen sich noch einmal auf die andere Seite, so dass die Pfosten knarren, und drücken ihre Kohlfürze in die Strohsäcke, ohne eine Ahnung, wie viel Blut sie heute sehen werden. Wie es auch ausgehen mag, es wird viel Blut fließen. Das weiß Gajus. Unbegreiflich, dass er überhaupt Schlaf gefunden hat in dieser Nacht.
Er sieht, wie das erste, matte Tageslicht in der Luke Farbe gewinnt. Für ihn ist es nun zu spät. Jetzt können nur noch die Götter das Blutbad verhindern. Glaubt er an sie? Bis zu dieser Nacht hat er gedacht, dass er an die Götter glaube. Aber die Angst vor dem Weckhorn ist stärker als jeder Glaube. Warum, fragte er sich, bin ich nicht in der Dunkelheit hinüber zu den Sklavenbaracken geschlichen? Dort hat diese Nacht kaum jemand ruhig geschlafen. Ist es möglich, dass der Ablauf eines ganzen Tages von einem einzigen Menschen abhängt? Und der sollte diesmal ich gewesen sein? Aber auch die Wachen haben gewiss nicht geschlafen. Und wie sich Gardys, dem Thraker, bemerkbar machen oder Bacaeus, dem Judäer, oder auch nur Derxenus, dem Armenier, ohne dass ein Hund anschlägt, ohne dass ein Soldat die Ohren spitzt? Aber Worte sind rascher als Klingen. Ein einziger Ruf aus seiner Kehle, ehe man zuschlüge: „Alles ist entdeckt!“ oder: „Ihr seid erkannt!“ Hunderte von Menschen könnten diesen Tag überleben, der nun mit Sicherheit ihr letzter ist. Doch er, Gajus, wohl nicht.
Keine Ausrede hätte ihm geholfen. Nicht einmal dem findigen Longus, dem Meister der Ausrede, wäre da eine glaubwürdige eingefallen. Der Hand des Soldaten ist nicht zu entkommen. Auf die bohrenden Fragen des Verwalters gibt es keine ausweichende Antwort. – Nur ich weiß, wer ich bin. – Mit diesem Satz muss Gajus seit seiner Flucht aus Neapel leben. Er ist in den Marmorbrüchen von Luna ein Zugelaufener. Niemand kann ihm nachweisen, dass er ein Sklave sei; nicht jeder Sklave trägt in diesen Zeiten noch Brandmale. Besonders solche, die man in seinem Haus täglich um sich hat, verschont man damit, um sie nicht nutzlos zu verunzieren. Haussklaven genießen Vorrechte, die ihre Treue gewährleisten. Seit die Preise für Sklaven gesunken sind, ist Arbeit für Freie rar geworden, und schon mancher freigeborene Italiker, dessen Können niemand mehr mit einem täglichen Lohn bezahlen will, gab sich für ein Taschengeld in den Sklavenstand, um Brot und Nachtlager sicher zu haben. Für einen von denen könnte man ihn halten.
Als er kam, fragte niemand danach. Was er nirgends in ganz Italien mehr hatte finden können, in den Marmorbrüchen von Luna gab man es ihm: täglichen Lohn für tägliche Arbeit. Der Kaiser baut in Rom. Eine Unzahl von Marmorblöcken für Säulen und Pfeiler, Stufen und Platten, Reliefs und Statuen braucht er. Ein Heer von Sklaven haut sie aus dem angeschnittenen Berg, schlägt sie zurecht nach Maß und karrt sie weg. Aber es ist nicht gut, so viele Sklaven an einem Ort schuften zu lassen, auch wenn sie aus allen Völkerschaften zusammengewürfelt sind. Sie begehren wieder und wieder auf gegen die römischen Feldzeichen: Thraker, Britannier, Germanen, Judäer, Armenier. Leichter wird es für die Aufseher, wenn zwischen den Sklaven Freie arbeiten. Sie drängen sich danach, da so viele sich brotlos herumtreiben. Den Sklaven sind sie ohnehin nicht gewogen, da sie ihnen überall die Arbeit wegnehmen. Man braucht nur mit etwas besserem Futter ihren Dünkel ein wenig zu nähren, und die .Aufseher haben ein Netz von kleinen Aufpassern in Händen, das eine Hundemeute ersetzt.
Gajus schließt die Augen. Diesen Tag will er nicht sehen. Hätte er die Sklaven gewarnt, hätte er wenigstens in eine der Baracken halblaut gerufen, dass ihre geplante Erhebung kein Geheimnis mehr ist, und sich dann, war es schon nicht mehr zu vermeiden, von der Wache fassen lassen – der Tag wäre ihm nicht so verhasst. Warum bleibt das Weckhorn so lange aus? Halten sie es nicht mehr für nötig, zu tun, als wüssten sie nichts? Oder zieht sich die Zeit nur hin wie immer, wenn man etwas Bestimmtes erwartet?
Gajus hat Tag für Tag von Gardys, dem Thraker, die zugehauenen Blöcke in Empfang genommen, hat sie, in Seile verzurrt, auf Holzrollen niedergelassen und zusammen mit Bacaeus, dem Judäer, den flachen Schutthang hinunterbugsiert. Derxenus, der Armenier, ist jedes Mal zurückgeblieben, um die Holzrollen aufzuheben und vorn wieder unterzulegen. Täglich heiße Sonne, täglich ein längerer Weg, täglich schwerere Blöcke, aber weder mehr Wasser noch in der Kohlsuppe mehr Fett. Die Striemen und Blasen, die von den Seilen und Kanten in der Haut zurückblieben, an Händen und Armen und über den Schultern, sind immer wieder frisch aufgerissen. Jeder Marmorblock wurde feucht von Schweiß, und mancher nahm bräunlich verkrustetes Blut mit auf den Weg nach Rom, Blut von Gardys, dem Thraker, von Bacaeus, dem Judäer, von Derxenus, dem Armenier, Sklavenblut, und Blut von Gajus, dem Freigeborenen, dem das römische Bürgerrecht zusteht, er kann es nur nicht beweisen; denn sein Name ist noch nirgends eingetragen. Nur in der Steuerliste von Neapel steht er mit dem Vermerk „Mündel“ unter dem seines Onkels Gnaeus. Doch dem ist er davongelaufen, um endlich frei zu sein, wie er geboren wurde. Dem Blut an den rohen, scharfkantigen Marmorblöcken ist nicht anzusehen, ob es aus freien oder unfreien Adern floss.
Gajus bekommt täglich eine schlechte Kupfermünze, dünn wie Blech, mit dem Porträt des Imperators Lucius Domitius Nero. Der Kaiser ist großzügig. Der Kaiser baut. Der Kaiser gibt gern und hat deshalb viele Freunde, und sie alle bauen, sie alle bestellen den Marmor in Luna, der so gut ist wie der von Paros, aber billiger. So nagen mehr eisenbestückte Hände als je zuvor in dem aufgeschnittenen Berg von Luna. Die Staubwolke senkt sich erst bei Einbruch der Dunkelheit, und wenn der letzte Tagesschein hinter dem Ligurischen Meer schwindet, leuchten noch in mondener Helle die schweigenden Marmorwände.
Die Sklaven bekommen nur Strohsack, Essen und Trinken. Sie arbeiten in klirrenden Ketten. Eine Münze dürfen sie sich nicht einmal schenken lassen. In ihrem lumpigen Schurz hätten sie auch gar keine Tasche, um sie zu verstecken. Ihre Bewegungen sind langsamer wegen der Ketten. Doch Gajus scheint es mitunter, dass Derxenus auch mit der Kette ein wenig schneller hangab laufen könnte, dass die Seile nicht so in seine Schulter zu schneiden brauchten, wenn Bacaeus aufhören würde, mit dem Kopf zu wackeln und seinen alleinigen Gott anzurufen, dass Gardys den Block, wenn er ihn abliefert, eine Spur sanfter ins Seil kippen lassen könnte. Derxenus lässt oft die Holzrolle los, ehe der Quader aufliegt. Sie rollt fort, er muss hinterherlaufen, und alle haben eine Pause.
Allmählich hat Gajus verstanden, dass Fleiß und Sorgfalt keineswegs Tugenden sind für Menschen, denen ihre Arbeit nichts einbringt. Doch dieses Verständnis hilft wenig, wenn wegen der Schlamperei der Sklaven manchmal die Härte der Arbeit ihn mehr trifft als sie. In Reichweite der Peitschen, mit denen die sparsam postierten Aufseher wedeln, kann Bacaeus sehr gut seinen Teil der Last übernehmen und Derxenus behände mit seinen Hölzern vorausspringen. Und Gardys ist ein wahrer Künstler im Abkippen eines behauenen Quaders, sobald ihm jemand zuschaut, der einen Riemen in der Hand hält.
Manche unter den Freien beschweren sich laut über das faule Sklavenpack, sobald ihnen ihr Anteil an der Arbeit zu groß erscheint. Einige schwärzen die Sklaven aus ihrer Nähe sogar grundlos an, um sich bei ihnen Respekt zu verschaffen. Es macht ihnen nichts aus, verhasst zu sein, wenn man sie nur fürchtet. Sie sind deshalb auch bei den anderen Freien nicht beliebt. Aber niemand tut ihnen etwas, denn sobald einer Streit mit einem Freien hat, schwärzt er auch den Freien an. Es gibt wenige dieser Art, diese wenigen jedoch sind eine Macht, weil sie gnadenlos verfahren und keine Ausnahme kennen. Sie bekommen am Monatsende eine Silbermünze, mit der sie bei den Bauern der Umgebung bessere Lebensmittel kaufen und bei den Handwerkern Geräte bestellen können, die das tägliche Leben erleichtern: Holzschüsseln, Bronzebecher, Kämme, Schuhwerk, Gürtel, Kappen, Waschzuber. Sie haben Posten, an denen fast nie ein Unfall vorkommt. Sie geben sich als Prügelknechte her. Ihre Peitschen haben auch manchem Freien schon den Rücken zerrissen, und sie antworten lieber mit der Faust als mit dem Wort.
Einer von ihnen ist Bassus, der unten am Fuß des Hanges, wo die Straße zum Hafen beginnt, mit Manimus, dem auf Brust und Rücken blond behaarten Germanen, die Blöcke auf die Karren hebt. Bassus kennt Rom. Er stammt aus einer armen Familie. Sein Vater war Bauer, verlor sein Land, ging in die Stadt, wo ihn der Kaiser ernähren musste. Gajus ist es ähnlich ergangen, arm sind die Freien hier alle gewesen, als sie kamen, und reich werden sie sich nicht nennen können, wenn sie fortgehen. Aber Bassus gibt an mit seiner Armut und mit seiner niederen Herkunft. Bei den Mahlzeiten, wenn manche sich erinnern, was sie zu Hause als essbar betrachten mussten, übertrumpft er sie alle. Hat einer sein Brot aus Abfällen gebuddelt, so hat Bassus sich Eidechsen gebraten. Hat ein anderer von den Samen der Gräser gelebt, so ist Bassus darauf verfallen, Heuschrecken auszusaugen. Bassus will auch bessere Zeiten gesehen haben, als er zur Zeit des Kaisers Claudius an der neuen großen Wasserleitung für Rom mitbaute. „Das ist eine Einrichtung“, erklärte er für die Tölpel, die Rom nie gesehen haben, „in der das Wasser über die Brücke fließt statt unter ihr hindurch.“ Davon hat Gajus auch seinen Onkel in Neapel schon voll Bewunderung reden hören. Überhaupt spitzt Gajus die Ohren, sobald von Rom die Rede ist, von der Stadt der Städte, um die er auf seiner Flucht nach Norden einen Bogen schlug aus Angst vor ihrer Größe und vor den Ungeheuerlichkeiten, die dort in Kaiserpalästen wie in Mietshäusern alltäglich sein sollen. Doch wenn er Bassus fragte, was aus dem Geld geworden sei, das ihm die Arbeit an der Aqua Claudia einbrachte, erntete er ein gehässiges Gelächter. „Roma frisst Menschen“, sagte Bassus, „wie sollte da Geld vor ihr sicher sein. Roma eine Göttin? Eine dreckige, unverschämte Hure ist sie! Aber ich liebe sie und muss wieder zu ihr, koste es, was es wolle.“
Der einzige, der Bassus in Schranken hält, wenn er schwadroniert, ist Hortensius Longus, der Lange, der sie alle um einen Kopf überragt, der Wortkarge, über den gemunkelt wird, er entstamme einer einstmals vornehmen römischen Familie. Er sitzt immer nur da, hört zu, mischt sich nie ein, und Bassus schaut manchmal verstummend zu ihm hinüber, als schätze er ab, wie weit er noch gehen dürfe, solange ein gebürtiger Römer ihm zuhört. Und es verwirrt Bassus sehr, wenn Longus einfach lächelt.
Was wird jetzt von einem Römer erwartet? Der Lehrer, in dessen Schule Gajus gegangen ist, solange die Eltern ihm regelmäßig ein paar Münzen, etwas Korn, einen Krug Öl oder Wein, ein Bund Zwiebeln, einen Topf Honig mitgeben konnten, der einarmige Kriegsveteran, der unter Kaiser Claudius in Britannien und Mauretanien gegen die Barbaren gekämpft hatte, würde jetzt wieder sagen: „Du bist arm, aber freigeboren! Halte es immer mit den Freien! Für deinesgleichen sei tapfer, zäh, treu, hart, wahr, gerecht. So wollen es die Götter. Das ist deine Ehre. Unter den Freien traue dem Freigeborenen mehr als dem Freigelassenen, denn der ist einmal Sklave gewesen, und Sklaven sind der Freiheit nicht würdig, weil sie von Geburt an Faulheit, Lüge, Tücke und jede Art niedriger Gesinnung in sich tragen. Barbaren sind von den Göttern zur Sklaverei bestimmt. Ich habe ihnen in ihren Nebelwäldern und Staubsteppen gegenübergestanden. Was sie ihre Freiheit nennen, ist Wildnis, und sie gehorchen erst, wenn sie ihr eigenes Blut sehen.“
Gajus kann kein Blut sehen. Der Anblick von offenem Fleisch ist ihm ein Gräuel, seit der Stier auf seinen Vater losgegangen ist. Die Striemen, die von Peitschenhieben auf den Rücken und in den Gesichtern der Sklaven zurückbleiben, bereiten ihm Übelkeit. Darum beschwert er sich nie über Bacaeus und Derxenus, nie über Gardys. Er warnt sie sogar, wenn sie schludern, obwohl ein Aufseher sie im Auge hat. Er hat sie auch schon gebeten, es ihm nicht allzu schwer zu machen, und sie zeigten sich eine Weile einsichtig. Aber Sklaven haben kein Gestern, kein Morgen. Das macht sie vergesslich. Seinesgleichen? Wer ist das hier? Wem müsste er die Treue wahren? Bassus, das weiß er genau, ist ein Freigelassener. Die Freigelassenen unter den Aufsehern, das hat sich herumgesprochen, sind die grausamsten. Warum fühlen sie nicht mit denen, die einmal ihresgleichen waren? Was ihm der Lehrer auch eingeschärft haben mag, Gajus fühlt mit den Sklaven. Er selbst ist hier der Freigeborene, der ihm am nächsten steht. Sich selber müsste er treu bleiben. Nur, wie macht man das?
Die Sklaven verstehen einer des anderen Sprache nicht. Sie müssen mit den wenigen, meist verstümmelten lateinischen, manchmal auch griechischen Brocken auskommen, wenn sie miteinander reden wollen. Da Gajus kein Anschwärzer ist, haben sie bald kein Blatt mehr vor den Mund genommen, ihn oft sogar schon in ihr Geschwätz einbezogen, sich raten lassen, wie man dem Aufseher einen Wunsch mitteilt, ohne dass er sofort in Wut gerät. Es ist aber auch mehrmals vorgekommen, dass Gardys, der Thraker, zu dem Judäer und dem Armenier etwas Griechisches sagte, das sie Manimus mitteilen sollten, dem Germanen, der kein Wort Griechisch versteht. Sie ahnten nicht, dass Gajus bei dem Gärtner seines Onkels in Neapel ein wenig Griechisch gelernt hatte, und wenn sie ihm prüfend in die Augen blickten, tat er stumpf, als verstünde er nichts. Allerdings waren es wirklich rätselhafte Sätze, die da weitergetragen wurden, Schlüsselworte ohne deutlichen Zusammenhang, und wahrscheinlich hatte Manimus sie, gleichgültig, ob er sie verstand, wieder jemandem zu sagen, mit dem er bei den Karren zusammenkam.
Einmal aber, als das Seil riss und sie auf ein neues warten mussten, hatte Gajus fast alles verstanden, weil Derxenus, der Armenier, sich widersetzte: „Kein Kampf“, sagte er mit erhobenen Händen in schlechtem Griechisch, „wir niemals siegen und dennoch gerettet! Ich nicht Kampf!“
„Doch Kampf!“, hat Gardys gerufen. „Mein Volk im Gebirge gibt immer noch keinen Tribut an Rom: durch Kampf! Die unten, die nicht kämpfen, die zahlen. Kämpfen oder zahlen!“
„Aber du jetzt Sklave!“, widersprach der Armenier. „Geld keine Rettung der Seele. Also dem Kaiser geben und die Seele behalten! Kampf frisst die Seele!“
Da ballte Bacaeus, der Judäer, beide Fäuste, schlug sich gegen die Brust, blickte zum Himmel und rief: „Wahrlich, meines Volkes Gott ist Kampf, und Kampf ist die Seele. Ohne Kampf keine Seele! Wer Tribut gibt, verkauft auch seine Seele. Wo sind all die Völker, die seit Menschenaltern lieber zahlen als kämpfen? Sogar ihre Sprachen sind vergessen! Ich weiß, Derxenus, du glaubst dem falschen Propheten aus Nozri, der unseren Tempel zerstören wollte, dem galiläischen Großmaul. Wahrlich, Gott wird unsere Feinde vernichten, wie König David sang.“
„Du sagst es!“ Der Armenier lächelte. „Gott soll kämpfen, nicht wir Menschen.“
Da hat Gajus mit seiner Miene verraten, dass er dem Streit gefolgt ist. Grimm trat in die Miene des Thrakers: „Du verstehst? Wir müssen dich töten.“ Erschrocken hat Gajus den Kopf geschüttelt. „Du schwärzt uns auch diesmal nicht an?“ Und statt Gajus antwortete der Judäer: „Aber gewiss nicht! Der nicht!“ Gardys mahnte dann finster: „Du weißt, der Marmorblock kippt, wohin ich will. Pass auf, dass du nicht drunterliegst!“
Gestern nun hat Gardys, der Thraker, Gajus halblaut eingeschärft: „Morgen gibt es hier ein großes Durcheinander. Wir feiern blutige Saturnalien. Siehe: Wir Sklaven wollen die Herren sein! Ich kann nicht jedem von uns einschärfen, dass du gut zu uns warst. Hau ab, sobald du kannst!“
Am Abend ist dieser Bassus mit Totengräbermiene vor Gajus hingetreten: „Steh mal auf! Heb mal deinen Strohsack an! Sieh da, wie sauber du ein Bündel zu schnüren verstehst! Du willst uns verlassen? Den heutigen Lohn willst du der Verwaltung schenken? Wie großzügig! Findest du es nicht sonderbar, dass heute kein Lohn gezahlt worden ist? Kennst du den Kaiser so geizig? Morgen werden alle gebraucht, das ist es. Auch du wirst morgen gebraucht. Bist du ein Schafskopf oder ein Heuchler? Deine Betulichkeit mit den Sklaven straft dich Lügen, wenn du behauptest, du wärest freigeboren! Morgen kannst du zeigen, wohin du gehörst.“ Bassus zog an einem Zipfel des Bündels, so dass der Knoten sich löste und Gajus seine Habe zu Boden purzeln sah. „Übrigens“, fuhr Bassus spöttisch fort, „heute Nacht kommt sowieso keiner raus. Dafür ist gesorgt.“ Bassus sah sich um. Sie waren noch immer allein. Die anderen saßen draußen und hörten einem Flötenspieler zu. Gajus hatte sich schon hingelegt, um zu schlafen. Gegen Mitternacht wollte er sich davonschleichen. „Nebenbei: Du kannst mir dankbar sein“, zischelte Bassus weiter. „Ich stecke nicht jedem solch ein Licht auf. Wir wissen sehr gut, dass es mehrere Freie mit den Sklaven halten. Darum lassen wir sie zuerst losschlagen. Wenn man ein Geschwür öffnet, bevor es reif ist, wird es nur schlimmer. Wir lassen es von selbst aufbrechen, damit der ganze Eiter herauskommt.“
„Warum erzählst du mir das?“, keuchte Gajus. Er hätte jetzt gern den Taubstummen gespielt, eine Verstellungsnummer, in der er Übung besaß. Aber er hätte dann nie mit Bassus sprechen dürfen. Zu so einem, dachte er, ist jedes Wort zu viel. „Warum?“, wiederholte Gajus.
„Weil ich dich mag“, flüsterte Bassus und kam ihm seltsam nahe. Gajus roch seinen Weinatem und zuckte zu spät zurück. Bassus klebte mit seinen Lippen an seinem Hals. „Ich mag dich schon lange, du! Und morgen will ich dich haben. Sei also nicht leichtsinnig, es wäre schade um dich. Ich sag dir noch mehr, damit du glaubst, dass ich es gut mit dir meine: Die Holzfäller vom Berg, in den wir uns fressen, verstärken die Reihen der Soldaten mit ihren Äxten. Aus dem Kessel kommt keiner heraus. Geschlagenes Holz liegt genug bereit, dass jeder sein Kreuz kriegen kann, auch du. Lauf also nicht gleich fort, wenn etwas Ungewöhnliches eintritt, sondern such dir einen von dem Gesindel aus und fang ihn! Dann wirst du morgen zu den Siegern gehören, und am Abend wollen wir feiern.“
Eigentlich sind Gajus die Sklaven gleichgültig. Er kann nur nicht sehen, wenn sie leiden, weil er sich gerade dann daran erinnert fühlt, dass sie Menschen sind und keine Tiere. Der Lehrer hatte recht, ein Freier hält es mit den Freien. Gajus wüsste schon, wohin er gehört, sähe er die Sklaven nicht so oft leiden. Seinethalben braucht es keine Sklaven zu geben. Er hat nichts von ihnen, sie nehmen ihm nur Arbeit und Brot weg. Der Gedanke, den er manchmal schon hörte, alle Sklaven sollten freigelassen werden, gefällt ihm auch nicht. Das brächte weder mehr Arbeit noch mehr Brot. Auch vergisst er nicht, dass ein Freigelassener, unverhofft reich geworden, wegen einer Ohrfeige seinen Vater ruiniert hat. Er weiß mit Sklaven einfach nichts anzufangen. „Man kann sie schließlich nicht abschaffen.“ Bassus hat einmal beim abendlichen Wein dieses Wort gebraucht und zum Besten gegeben: „Je mehr Sklaven ans Kreuz kommen, desto weniger Freie brauchen als Bettler herumzulungern!“ Jetzt versteht er erst ganz, weshalb Bassus den armen Schlucker hervorkehrt, wie andere mit ihren Reichtümern prahlen, und wären sie noch so gering. Gajus kann nur den Anblick von Blut und offenem Fleisch nicht ertragen, und wo auf seinem Weg durch Campanien, Latium, Umbrien und Etrurien Kreuze aufgetaucht sind, hat er einen weiten Bogen gemacht, schon wegen des Geruches. Vielleicht wäre er nie darauf gekommen, die Sklaven zu warnen, hätte ihn dieser Bassus nicht dazu genötigt, an der Schlächterei teilzunehmen. Auf und davon und kein Blick zurück wie in Neapel, als er es satt hatte mit Onkel Gnaeus, mit der gebieterischen Fürsorglichkeit seines Vormundes. Aber das geht nun nicht mehr.
Der Ruf des Weckhorns beginnt tief und heiser, als wäre es selbst noch müde, klettert dann allmählich und immer steiler in die Höhe wie das Muhen eines durstigen Rindes, überschlägt sich und endet nach kurzem, aufreizendem Gellen, das dem Bläser den meisten Atem abverlangt. So wiederholt er sich auf dem Rundgang der letzten Nachtwache zwischen den Baracken. Gajus sieht an der Farbe des Lukenlichtes, hört an den Flüchen der Erwachenden, dass der Ruf weder später noch früher als sonst erklingt. Nur ihm ist die Zeit lang geworden in seinen Gedanken.
Gedränge am Mittelgang und am Barackentor, Geschubse draußen am hölzernen Waschtrog, durch den ein Bach geleitet wird. Jeder will ans obere Ende zum reineren Wasser. Die Sparsamen und die Langgedienten, die Ungeselligen, die es mit den Aufsehern halten, haben sich einen eigenen Zuber angeschafft und ihn schon abends volllaufen lassen. Die Sklaven müssen mit der Brühe am untersten Teil der Waschrinne vorliebnehmen. Manche begießen sich mit tönernen Gefäßen und führen seltsame Bewegungen aus, wie es die rätselhaften Kulte südlicher und östlicher Völkerschaften erfordern. An langen, hölzernen Tafeln wird dicke, abends vorgekochte und flüchtig aufgewärmte Dinkelgrütze verteilt, die jeder verzehrt, je nach Gewohnheit liegend, sitzend oder stehend. Wieder sind es die Sparsamen und die Langgedienten, die Ungeselligen, die von Bauern Honig, Lauch oder Beerenobst gekauft haben und sich die Grütze damit würzen. Die Sonne schickt erste Strahlen über die Kastanienwipfel des Bergkamms, und die beschatteten Marmorschroffen färben sich blau.
Die Soldaten der Wache blasen ihre langen Kriegstuben. Sklaven und Freie müssen in gesonderten Karrees antreten. Der Platz ist mit dem Marmorschotter bedeckt, der beim Behauen der Quader anfällt. Eine Gruppe von Flötenspielern und Vorsängern stimmt den Hymnus auf Apollo, den Lichtgott, an, der soeben in Gestalt der Morgensonne über die Berge kommt. Der Text ist, manche sträuben sich noch immer, es zu glauben, ein Werk des Kaisers. Seit einiger Zeit hat Nero sich drängen lassen, mit seinen poetischen Bemühungen an die Öffentlichkeit zu treten. Der Kaiser entstammt einem göttlichen Geschlecht, das sich von Venus herleitet, und seine Vorgänger Augustus und Claudius wurden bei ihrem Ableben unter die Götter aufgenommen. Der Kaiser kann alles. Der Kaiser ist der beste Herrscher, den die Welt je gesehen hat, wie sollte er nicht auch der beste Dichter sein! Rom darf sich im Zirkus Maximus davon überzeugen, dass er der beste Wagenlenker ist. Seine Redekunst, zweifellos die beste seit Menschengedenken, bringt er nur sparsam zur Geltung, um andere Redner, die Zierde römischen Geistes von jeher, nicht zu entmutigen. Hätte der Kaiser Zeit dazu, bewiese er der Welt gewiss auch, dass er der beste Schuster, der beste Tischler, der beste Steinmetz ist. Der Tag ist nicht fern, an dem er selbst nach Luna kommt, um aus der weißen Felswand vor aller Augen mit der Kraft und dem Geschick eines Herkules den Marmorblock zu brechen, aus dem sein Standbild entstehen soll, und ein rührend bescheidener Zug seiner Person wird es sein, wenn er es einem gewöhnlichen Bildhauer überlässt, dem rohen Stein sein einmaliges und unverwechselbares Antlitz zu verleihen.
Derlei lässt der kaiserliche Verwalter der Marmorbrüche von Luna jeden Morgen in Abwandlungen verkünden. Er ist ein leidenschaftlicher Liebhaber der Kunst und durchdrungen vom Glauben an die göttliche Sendung Neros. Heute verweist er auf eine Reihe lodernder Schmiedefeuer. Der Kaiser habe beschlossen, das Los der Sklaven zu mildern. Aus Pisae seien die wackeren Gesellen des Vulcanus gekommen, um ihnen leichtere Ketten anzulegen. Vor allem die schwere Kugel an den Füßen komme nun in Wegfall. Daraus erhelle sich, dass der Kaiser allen, die ihr Volk zum Aufbegehren gegen den Römischen Frieden verführt hätten, milde gesonnen sei. Seiner Hoffnung verleihe er Ausdruck, dass in den leichteren Ketten emsiger gearbeitet werde und sich die tägliche Ausbeute an Rohmarmor von nun an erhöhe. Denen, die sich durch besonderen Eifer hervortäten, winke eine baldige Freilassung, und als Freigelassener des Kaisers genieße man Vorteile, die einem auf italischem Boden ein besseres Leben gewährleisten als in der fernen kargen oder gar wüsten Heimat. Damit das Umschmieden möglichst rasch vonstatten gehe, mögen die Freien dem rußigen Gefolge des hinkenden Feuergottes zur Hand gehen. Die Einteilung werde von den Unteraufsehern vorgenommen.
Schweigen liegt über den Karrees. Das Umschmieden ist vor drei Tagen bekanntgegeben worden. Wahrscheinlich wollen die Sklaven, vermutet Gajus, sich diese Abweichung vom täglichen Trott zunutze machen. Die Unteraufseher stellen sich vor die Glieder des Karrees, in dem die Freien angetreten sind, und rufen Namen auf. Gajus wird einem Schmiedefeuer zugeteilt, an dem Bassus ihn schon erwartet.
Gajus versucht sein Zittern zu bezwingen. Er senkt den Blick. Er will nichts sehen, vermag aber die Augen nicht zu schließen. Er sieht den Fuß des Gesellen, der gemächlich den Blasebalg tritt, den birnenförmigen tragbaren Schmiedeofen, in dessen glühender Öffnung die neuen Ketten hängen. Fußringe und Halseisen zu öffnen, wäre zu aufwendig. Die alten Ketten werden auf Ambossen aufgemeißelt, die neuen, an ihren beiden Enden rot glühend, mit langen Zangen in die Öffnungen der Laschen hineingebogen. Es wird ein paar Brandwunden geben. Doch wer nicht stillhält, ist selbst daran schuld. Schon klirren die Ambosse unter den ersten Hammerschlägen. Die Blasebälge schnaufen emsiger. Die kurzen Befehle und die unflätigen Flüche, mit denen die Schmiede ihre Gesellen antreiben, kreuzen einander wie heiseres Hundegekläff. Ketten prasseln zu Boden.
Gajus rechnet damit, dass gleich die ersten zwei Dutzend Sklaven den Augenblick nutzen, in dem ihre Gliedmaßen frei sind. Bassus hat ihn angewiesen, die alten Ketten auf einen bereitstehenden Wagen zu werfen. Er tut es geduckt. Aber nichts geschieht. Sind sie doch gewarnt worden? Dutzend um Dutzend werden die Sklaven paarweise an die Ambosse geführt. Manchmal ist unterdrücktes Stöhnen zu hören und ein gehässiges „Pass doch auf, du Ratte!“
Schon hofft er, die Götter hätten sich das blutige Spektakel versagt, das Schicksal werde einen anderen Lauf nehmen, da hört er den Ruf des Käuzchens, unpassend für die Tageszeit und so laut, dass es nur eine menschliche Nachahmung sein kann. Vielstimmiges Gejohl bricht los. Gajus wirft sich flach auf den Boden. Eine im Kreis geschwungene Kette faucht über ihm durch die Luft. „Aufgepasst!“, hört er Bassus neben sich schreien. Er wälzt sich auf den Rücken mit angewinkelten Beinen und wehrt einen Angreifer ab, indem er ihm mit beiden Füßen in den Bauch tritt. Glühende Kohlen purzeln auf ihn zu. Er weicht in Hockstellung zurück. Überall werden die Schmiedeöfen umgeworfen. Nur jetzt nicht aufspringen. Die Luft ist in Aufruhr von wirbelnden Ketten, schwirrt von Lanzen und Pfeilen. Am besten sich seitwärts abkippen lassen, als wäre man getroffen. Jemand springt über ihn, ein anderer tritt auf ihn. Er hört, wie Schmiedewerkzeuge gegen Kurzschwerter prallen, hört römische Soldatenflüche gegen unverständliches kehliges Geheul branden. Die Kriegstuben der Söldner schmettern kurz, abgehackt, meckernd, wie Hohngelächter. Ein Körper fällt auf ihn, etwas Warmes, das fade riecht, läuft ihm übers Gesicht. Ein Weilchen entfernt sich der Tumult von ihm. Dann hört er das hysterische Gebell schwerer Molosserdoggen. Aus dem Gebrüll entschlossener Angreifer wird das Geschrei Gehetzter. Kaum noch klirrt Metall gegen Metall. Gajus blinzelt. Durch die verkrampfte Armbeuge des Mannes, der über ihm liegt, sieht er einen Teil des Platzes. In dichter Reihe entfernen sich die braunen Rücken grobleinener Holzfällerkittel. Zwischen ihren Beinen wedeln die langen, dünnen Doggenschwänze, blecken stumpfe Schnauzen die Zähne. Ein Tier jault auf unter einem Kettenhieb; aber überall krümmen sich Menschenleiber, zusammengerollt wie Igel, blutige Hände vorm Gesicht.
Der Mann über ihm bewegt sich. Ein besorgtes Augenpaar: Bassus wälzt ihm den Leichnam des erschlagenen Sklaven vom Leib, fährt ihm mit dem Zeigefinger übers Gesicht. Den Finger rötet Blut. „Bist du verletzt?“, fragt Bassus. Gajus fühlt nirgends Schmerz. Er möchte sich jetzt mit jemandem freuen, dass er davongekommen ist. Aber ihm graut auch davor, mit diesem Bassus einen Sieg zu feiern. Um ihn herum ist der Marmorkies blutbespritzt. Niemand könnte unterscheiden, ob es Blut ist von Sklaven oder Freien. „Ja“, sagt Gajus tonlos, als verginge ihm der Atem. Das Blut des toten Sklaven soll ihm helfen, sich von diesem Bassus zu befreien. Bassus ist der einzige, der ein Auge auf ihn hat. Wenn er den los ist, kann er fortlaufen. „Warte“, sagt Bassus beinahe zärtlich, „ich hole Hilfe.“
Eine der Baracken, zu denen Bassus gerannt ist, brennt. Gajus kann jetzt einen größeren Teil des Geländes überblicken. Zu den Wäldern ist es weit. Überall, an den Halden und zwischen den Kränen, auf den Zufahrtswegen und auf den Wiesen, die sich die Berghänge hinaufziehen, sind Flüchtende unterwegs, überall setzen ihnen Verfolger nach, heften sich Hunde an ihre Fersen, springen sie an, reißen sie zu Boden. Wie eine Schafherde, wenn die Wölfe eingefallen sind, denkt Gajus. Er hat gern Schafe gehütet, als der Vater noch lebte. Die Wölfe aus den samnischen Bergen kamen manchmal, wenn dort der Winter hart wurde, in die milde campanische Ebene herab, und die Hirten mussten sich zu kriegsmäßig gerüsteten Abteilungen zusammentun, um die Rudel, die der Hunger dreist machte, von ihren Herden fernzuhalten. Aber er hatte dabei immer zu Hause bleiben müssen. Als er groß genug war, musste auch das letzte Schaf verkauft werden.
Diese Wölfe da treibt kein Hunger. Sie wollen Rache nehmen und Schrecken verbreiten unter den Wehrlosen, die allen Erfahrungen zum Trotz wieder einmal geglaubt haben, es wäre zu schaffen, die einem Wahnwitz nachgaben oder vielleicht schon lebensmüde waren und nur eines herbeisehnten: ohne Ketten, Auge in Auge mit den Peinigern, den Tod zu finden.
Bassus bleibt aus. Gajus spielt den Toten mit offenen Augen. Wenn er schon nicht davonlaufen kann, will er wenigstens – vor allem sich selber – Abwesenheit vormachen. Denn die Sieger haben es eilig. Sie bilden schon wieder Karrees. Befehle gellen. Peitschen knallen in die hohlen Schreie der Wiedereingefangenen. Hämmer pochen schwere Nägel in das frischgeschlagene Holz des Marmorberges. Gajus ahnt, was die verzweifelten Wimmerlaute bedeuten. Dann hört er das Knarren der Keile in den Erdlöchern. An den Seilen, die sonst zum Fortbewegen der Marmorblöcke dienen, wird ein Kreuz nach dem anderen aufgerichtet, und der daran geheftete Mensch wirft heulend den Kopf hin und her, der Brustkorb tritt hervor, der Körper windet sich in krampfhaften Zuckungen zwischen den vernagelten Gliedmaßen. Es werden viele Kreuze. Gajus wagt nicht, sie zu zählen. Es sind mehr, als er mit einem Blick erfassen kann. Ein Teil der Freien wird, die Hände auf dem Rücken gefesselt, aus den Karrees von Soldaten fortgeführt. Ein paar Tagelöhner helfen dabei beflissen. Es sind die Ungeselligen mit den eigenen Waschzubern und dem Honig in der Grütze. Vielleicht wird Bassus dort aufgehalten.
Als die Leichenträger über den Platz schwärmen, rafft Gajus sich auf und hilft ihnen, als gehöre er dazu. Unter den Erschlagenen entdeckt er Manimus, den Germanen. Irgendjemand hat schon die Füße des Toten angehoben, Gajus packt ihn bei den Armen. Sie kommen dicht an den Kreuzen vorüber. Die Sonne brennt aus der Höhe des Sommermittags. Fliegen summen um die Wunden der Gekreuzigten und tummeln sich auf den ermatteten Augen, auf den stöhnenden, ächzenden Mündern. Gajus sucht nach Gardys, dem Thraker, nach Bacaeus, dem Judäer. Da erkennt er Derxenus, den Armenier. Derxenus stöhnt nicht, sein Kopf hängt nicht auf dem Schlüsselbein. Derxenus spricht laut vor sich hin und schaut mit weitgeöffneten, seltsam klaren Augen in den glühenden Himmel.
„Derxenus!“
„Gajus!“ Der Armenier blickt zu ihm herab. Sein Gesicht ist fast ohne Qual, nur der von Fliegen umschwärmte Mund hängt schief, und Gajus scheint es einen Augenblick, als schaue Derxenus ihn mitleidig an. „Siehst du“, hört Gajus den Armenier mit letzter Anstrengung raunen. „Gott soll kämpfen, nicht wir Menschen! Ich habe es dir gesagt.“ Derxenus blickt wieder über Gajus hinweg, und Gajus traut seinen Ohren nicht. Vielleicht ist es ein ähnlich klingendes Wort aus dem Armenischen, das sein Gehör ihm verfälscht? Gajus kann es nicht glauben: Soll dieser Gekreuzigte wirklich gesagt haben: „Ich danke euch?“
Der andere Träger hat sich misstrauisch umgedreht. „Was soll das? Was hast du mit dem da?“
Gajus, wie von Sinnen, lässt den toten Germanen fallen. Der andere torkelt. „Haltet ihn! Haltet ihn!“ Aber jetzt ist keiner mehr auf Jagd eingestellt. Schon werden Weinfässer auf den Platz gerollt. Gajus rennt auf sie zu. Die Männer dort haben keine Hände frei und passen auf ihre Füße auf. Schon hat er sie hinter sich, und dort tritt der Kastanienwald weit den Hang herab. Er keucht zwischen Gestrüpp und Berg hinauf. Rollende Steine täuschen seinen Ohren die Schritte von Verfolgern vor, bis er atemlos stehenbleibt, bereit, sich fangen zu lassen, und nur den Wind in den Wipfeln hört.
Er flüchtet ins Gebirge, wo es am unwegsamsten ist. In einem Stau des Baches zwischen Farnbüscheln und moosgrünen Felsen wäscht er sich das Blut ab, das der unbekannte Sklave über ihm vergossen hat. Auch seine grobe Tunika wäscht er gründlich. An seinem Hals baumelt das Lederbeutelchen mit dem Geld, das er in den Marmorbrüchen von Luna verdient hat. Damit wird er vorerst weiterkommen.
Er schrickt zusammen. Jemand tritt aus dem Gebüsch: Longus, der Lange aus Rom. „Dich schickt mir Merkur!“, ruft er freundlich. „Bist du auch getürmt?“ Er wiegt den Beutel in der Hand. „Das reicht bis Rom!“
II. Auf dem Hügel der Gärten
Da lag sie nun vor ihm, die Stadt der Städte. Er hatte viel von ihr gehört, oft an sie gedacht. Nun war er überrascht, dass es sie wirklich gab.
Gajus vergaß seinen Durst. Der schwüle, staubige Septembertag lastete nicht mehr auf seinen mageren Schultern, biss nicht mehr durch die Löcher der Tunika in seine ausgedörrte Haut. Auch Longus verstummte. Schon nach dem Mittagsschläfchen unter den weit ausladenden Zweigen eines schlitzblättrigen Feigenbaumes, der nicht nur Schatten spendete, sondern auch Schutz vor neugierigen Blicken bot, hatten sie die belebte Via Salaria, die „Salzstraße“, verlassen, waren eine Zeit lang querfeldein gelaufen und dann zwischen den Mauern der Villengrundstücke und den Flechtzäunen der Obstgärten umhergeirrt, immer der Sonne nach, denn dort musste Rom liegen. Zweifel waren Gajus gekommen, ob sie so wirklich den Weg abkürzten, die sichtliche Aufregung des Gefährten, seine forschenden Blicke hinter jedes Gebüsch, sein Verharren vor jeder Ecke, sein unablässiges Geschwätz hatten ihn misstrauisch gemacht. Longus erwies sich zwar als ortskundig, aber die Herrlichkeiten der Hauptstadt wurden in seinen Worten auf einmal von zahllosen Gefahren verdüstert.
Nun standen sie auf dem Hügel, dessen Hang nach Südwesten dem großen Tiberbogen entgegenfiel, tiefer hinab als das Gartenland hinter ihnen. Mons Pincius nannte der Lange die Erhebung, auch „Hügel der Gärten“ manchmal. Aber es waren hier keine Gärten mehr, in denen Äpfel, Oliven, Feigen oder Gemüse gezogen wurden. Ein Park aus Laub- und Nadelhölzern schmiegte sich in die Hügelfalte. Mächtige Steineichen reckten gebieterisch ihre Wipfel. Schlankere Bergeschen behaupteten sich dazwischen. Zedern wölbten ihre fächerförmigen Nadeldächer. Der Park sei an die hundert Jahre alt, bemerkte Longus und zog selbstgefällig die Mundwinkel herab, als er hinzufügte, der große Pompejus, einstmals Gönner seiner Familie, habe ihn anlegen lassen. Einige dieser Bäume aber müssten gut zwei Jahrhunderte älter sein und hatten wohl schon in den besten Jahren der Republik auf die Stadt herabgesehen, als ihre nördlichen Hügel noch von wildreichen Wäldern bedeckt waren.
Schwarz-grün standen die Baumwipfel vor dem faden Blau des frühabendlichen Himmels, vor der verschleierten Sonne und dem gelben Dunst des Horizontes. Weiter unten breiteten Pinien ihre pilzförmigen Schirme, stachen Zypressen spitz aus beschnittenem Gebüsch, quoll lindgrün ein Weingarten über eine Bodenwelle, der die ersten Häuser des Stadtrandes ihre Rückseiten zuwandten. „Da hast du das Marsfeld“, sagte der Lange und wies nach rechts, wo das Licht kupfern über die Erde flutete, die der Tiber in einem Bogen umfloss. Die Namen der Tempel und Theater rauschten Gajus an den Ohren vorüber. Er sah nur die weitläufigen, von Säulengängen umgebenen Gebäude, die sich zwischen Baumgruppen in die Grasflächen vortasteten. Doch als sein Gefährte den kahlen, runden Marmorsockel im Vordergrund, auf dem sich ein dicht mit Zypressen bepflanzter Erdkegel erhob, das Grabmal des Augustus nannte, horchte er auf. Oft schon hatte er einfache Leute, seine Eltern zuerst, aufseufzen hören: „Wenn doch der Kaiser Augustus noch lebte!“ oder: „Wenn dies der vergöttlichte Augustus mit ansehen müsste!“
„Zeig mir, wo Kaiser Nero wohnt!“, verlangte Gajus.
Der Lange wandte den Blick nach links, sagte aber schroff: „Man sieht es von hier aus nicht.“
Einander in diesige blaugraue Schatten hüllend, staffelten sich Häuser um Hügel, deren Hänge überall fast bis zu gleicher Höhe anstiegen. Gajus suchte, um sie sich einzeln zeigen zu lassen, in seinem Gedächtnis die Namen aller sieben, von denen er gehört hatte, zusammen: Aventinus, Caelius, Esquilinus, Viminalis, Quirinalis … Da fiel ihm der schroffe, felsige Abhang des einen auf, den eine Mauer krönte. Starke Säulenschäfte ragten darüber. Sie trugen ein breites Dach, das, obwohl beschattet, hell schimmerte. Ein gerader Blitz auf dem First, der rötlich durch den Dunst stach, verriet, dass es vergoldet war.
„Wohnt er nicht dort?“, fragte Gajus und streckte den Arm aus.
„Nein“, antwortete der Lange. „Das ist der heiligste der sieben Hügel, das Capitol. Dort wohnt in seinem Tempel Jupiter, der Beste und der Größte, der Herrscher der Götter und der Gebieter der Menschen, dem auch der Kaiser gehorchen muss. Nero wohnt auf dem Palatin, den das Capitol überragt.“
„Lass uns in die Stadt hinuntergehen!“, drängte nun Gajus. Doch der Lange setzte sich ins Gras und kaute einen Halm.
„Wir werden erst morgen in die Stadt gehen“, entschied er.
„Was denn“, murrte Gajus, „noch eine Nacht im Freien? Es wird jetzt schon ziemlich kühl gegen Morgen. Die Sonne steht noch hoch genug, sich ein Dach überm Kopf zu suchen.“
Longus sah ihm seit dem Mittag zum ersten Mal wieder gerade ins Gesicht: „Diese Nacht werde ich kaum zum Schlafen kommen. Ich hatte einen Feind in dieser Stadt. Ich muss auskundschaften, was aus ihm geworden ist. Dabei kann ich einen wie dich nicht gebrauchen. Bleib noch eine Nacht hier draußen in den Gärten. Morgen hole ich dich. Vielleicht wirst du auch auf mich verzichten und dich allein in Rom zurechtfinden müssen. Nämlich wenn Cornutus, der Gehörnte, noch frei herumläuft. Er will mir ans Leben, für ihn und mich ist nicht genug Platz in der Stadt.“
„Davon hast du mir nie etwas erzählt“, sagte Gajus enttäuscht.
Der Lange lächelte. „Du wärst nur fortgelaufen, du Kind, deine Angst vor dieser Stadt hätte deine Neugier wieder übermannt, und du hättest, wie schon einmal, einen Bogen um sie gemacht. Hab ich nicht recht?“
Gajus nickte und setzte sich neben den Langen. Schweigend schauten sie auf das graugrünblaue Gewimmel von Dächern und Baumwipfeln, das wie die Schuppen und Warzen auf der Haut eines feuchten, nur von der Sonne angewärmten Reptils wirkte. Der goldene Blitz auf dem Dachfirst des Jupitertempels hätte aus dem Auge einer Kröte kommen können. Durch das Rasseln der Heuschrecken hörte Gajus nun auch einen dumpfen, fernen, scheinbar rhythmisch anschwellenden Ton wie aus der Kehle einer Unke. Die Furcht des Bauernjungen vor der Stadt packte ihn wieder, und er hätte es nicht über sich gebracht, die Stadt der Städte ohne den Langen zu betreten, der darin geboren und aufgewachsen war und sich gerade in ihren dunkelsten Winkeln auskannte.
Der Lehrer hätte ihm jetzt geraten, mit seinen Tugenden käme der freigeborene Römer, was auch um ihn herum geschähe, am weitesten: Tapferkeit und Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor den Göttern, Liebe zur Wahrheit, ein zäher Wille, Ausdauer, Härte gegen sich und andere. Aber das waren Legionärstugenden, die im Feldlager und im Gefecht fruchteten, und der Schulmeister hatte alles darangesetzt, sein Gewölbe am Markt diesen Schauplätzen ähnlich zu machen. Sprach er von Treue und Zuverlässigkeit, meinte er nichts als Gehorsam. Andere Tugenden, die einem Römer ebenso anstehen sollten, waren ihm kaum über die Lippen gekommen: Mäßigung etwa und Großzügigkeit. Davon sprachen manchmal die Eltern, nicht ohne Leute zu nennen, die reich genug dafür waren und sie dennoch nicht aufbrachten. Gajus hatte sich angewöhnt, in den Tugenden seiner Väter und Vorväter ein Paar ererbter Schuhe zu sehen, die für seinen Weg zu schön und kostbar waren, die einen anderen Schritt erforderten als den seiner kurzen Bauernbeine und an seinen Füßen gedrückt und gescheuert hätten. Gewohnt, viel barfuß zu laufen, fand er sich nicht aufgefordert, sie anzuziehen.
Auch der Lange schien von solch hochhackigem Schuhwerk nichts zu halten. Er schüttelte den Sand aus seinen Landstreichersandalen und band sie sich wieder an die hornigen Sohlen.
„Troll dich in einen der Gärten und lass dich von niemandem sehen. Kommt dir aber einer in die Quere, lass dich nicht ausfragen, verstanden? Du kennst meinen Pfiff. Gib mir noch etwas von unserem Geld! Also dann bis morgen!“ Der Lange stand auf und schlenderte unter den Parkbäumen davon. Nicht ein einziges Mal sah er sich um.
Er ging in die Stadt, in der man mehr als irgendwo einander nach dem Leben trachtete. Das war der Eindruck, der Gajus blieb von allem, was ihm über Rom gesagt worden war. Vater und Mutter hatten es die Stadt der Mörder, Erbschleicher und Giftmischer genannt, wie unter den Bauern Campaniens üblich. Onkel Gnaeus in Neapel wollte, obwohl er es sich leisten konnte, nicht in Rom wohnen, weil ein Mann seines Vermögens dort nicht einmal bei Tag ohne Leibwächter spazieren gehen konnte; und die sparte er lieber ein. Wie Gajus’ älterer Bruder Servius, der sich vor Jahren unter die Gladiatoren verkauft hatte und nun mit dem Ehrennamen Invictus, „der Unbesiegte“, in ganz Italien bekannt war, konnte dort anscheinend jedermann nur dann überleben, wenn er jemanden tötete. Nichts anderes meinte der Lange, der sich nun in die Stadt schlich, um etwas über seinen Todfeind zu erfahren. Selbst Kaiser, der vorige und auch der vor ihm, waren ermordet worden.
Gajus blieb noch ein Weilchen auf seinem Rasenplatz über der unkenden, gurrenden Stadt. Er hatte sich das Ledersäckchen nicht wieder um den Hals gehängt. Nun stülpte er es um und ließ die Münzen, die er sich in den Marmorbrüchen von Luna verdient hatte, in den Schoß seiner Tunika fallen, um nachzuzählen, wie viel ihm geblieben war. Longus war den Peitschen und Kreuzen nur mit dem nackten Leben entkommen. Auf der Wanderschaft durch Etrurien hatten sie bei äußerster Sparsamkeit miteinander geteilt.
Der Lange musste soeben noch einmal ziemlich tief in den Beutel gegriffen haben, denn der Rest fiel, das war mit einem Blick zu erfassen, kümmerlich aus.
Der große Schweißfleck auf seiner Tunika war noch nicht getrocknet. Nun überrieselte Gajus ein Kälteschauer, dass es ihn schüttelte. Einzig weil Longus sich so gut in Rom auskannte, hatte Gajus es aufgegeben, ihn abzuschütteln, und sich auf die gemeinsame Reisekasse eingelassen. Nun musste er gewärtigen, doch noch allein in diese fremde, schöne, bedrohliche Stadt gehen zu müssen, mit einer Barschaft, die vielleicht zehn Tage reichte, vielleicht auch nur zwei. Er versuchte sich mit den Beispielen erstaunlicher Zuverlässigkeit zu beruhigen, die ihm der Lange unterwegs mehrfach geliefert hatte. Aber er traute dieser Stadt nicht, die, wenn sie Menschen verschlang, wohl auch gute Vorsätze nicht schonte.
Alles würde sich zeigen. Er brauchte nur abzuwarten. Fröstelnd stand er auf und stapfte den Grasweg zurück in die ländlichen Gärten, wo es zwischen den niedrigen Obstbäumen noch sonnige Stellen gab. Aber da es kühler wurde, belebten sich die Parzellen. Hier kam ein Pächter auf einem Esel geritten, dort zog ein Esel einen zweirädrigen Karren mit einem bäuerlich gekleideten Paar. In einem Olivenhain klapperten die Hacken, mit denen die Sklaven das Erdreich lockerten. Mädchen, die gebückt umherliefen, warfen das Unkraut auf Haufen. Ein Göpelrad knarrte, das Wasser in ein Villengrundstück beförderte. Kopfnickend und schweifwedelnd lief das geblendete Pferd, das es in Bewegung hielt, seine Kreise, und wenn es zu langsam wurde, knallte der halbgeschorene Sklave, der dabeistand, mit der Peitsche. „He! Zu wem willst du?“, rief der Halbgeschorene barsch.
Gajus schrak zusammen. Das gab es also auch in Rom, dass ein Sklave einen Freigeborenen anherrschen durfte? Aber er besann sich auf seine abgerissene, verschmutzte Kleidung. – Nur ich weiß, wer ich bin! – Wie hätte er beweisen wollen, dass er selbst kein entlaufener Sklave war? Um irgendeinen Namen zu nennen, behauptete er frech: „Zu Cornutus.“
„Gibt es hier nicht“, sagte der Halbgeschorene und knallte mit der Peitsche. Betont gleichgültig wandte Gajus sich ab und ging weiter. Er fand es an der Zeit, sich ein Versteck zu suchen. Da klaffte in einer Mauer aus rohem Kalkstein ein offenes Tor. Ein gerader Kiesweg führte zwischen jungen Zypressen auf die Terrasse eines Landhauses zu. Gajus wischte hinein und kroch hinter einen der Torflügel. Hinter der Mauer war er zunächst einmal sicher. Nun galt es, den Garten zu beobachten. Irgendwo fände er schon ein Gebüsch, in dem er unbemerkt nächtigen konnte. Auf der Terrasse hielt ein Herr in purpurgesäumter Toga, vor den vier zierlichen Säulen auf und ab wandernd, eine Schriftrolle in der Hand und las laut. Er war nicht so dick wie Onkel Gnaeus in Neapel, zog aber ebenso hämisch die Mundwinkel herab. Seine Glatze war mit ein paar silbergrauen Strähnen zugeklebt. Immer wieder unterbrach er sich und schaute prüfend in die Runde, hüstelte, sagte etwas in abschätzigem Tonfall. Ein kleiner Glatzkopf trat in gebückter Haltung vor ihn hin, tänzelnd und gestikulierend. Aber der Senator mit dem Purpursaum an der Toga winkte ab, rollte die Schrift zusammen, steckte sie in die lederne Kapsel, die ein Sklave bereithielt, und wandte sich zum Gehen. Der Glatzkopf wich ihm nicht von der Seite und redete auf ihn ein. Aus dem Schatten eines alten Feigenbaumes löste sich eine Sänfte, getragen von vier muskulösen Kerlen, und folgte den beiden über den knirschenden Kiesweg. Mit knapper Not schlüpfte Gajus hinter die verwilderte Myrtenhecke, die einen Rasenplatz vom Obstgarten trennte, denn der Glatzkopf lüpfte einen großen Schlüssel, und es hatte den Anschein, dass er das Tor schließen wollte.
„Wie kann man nur so eine günstige Gelegenheit ausschlagen“, hörte Gajus ihn im Näherkommen zetern. Aber der Herr antwortete ungeduldig. „Genug! Ich kaufe nicht! Die Gegend ist mir zu laut und zu gewöhnlich.“ – „Jetzt vielleicht noch, Herr“, beharrte der Makler, „aber bald wird die ganze Gegend hier von Senatoren und Rittern aufgekauft sein, und du befindest dich in der besten Gesellschaft. Die Preise steigen schon. Morgen bereits kann ich mehr für diesen Garten verlangen, als du mir heute geboten hast. Wahrhaftig, unser Kaiser Nero sorgt dafür, dass Geld unter die Leute kommt, ein göttlicher Mann, möchte ich meinen …“ – „Dann verlang morgen, was du willst, von wem du willst und lass mich für heute in Ruhe!“, unterbrach ihn der Herr und stieg in die Sänfte.
Der Alte brummelte etwas vor sich hin, spuckte auf den Weg und schloss das Tor von außen. Doch er entfernte sich nicht gleich. Gajus bestieg vorsichtig einen alten Holzhaufen, der an der Mauer lehnte, und lugte aus der Deckung eines Baumwipfels hinüber. Da beobachtete er, wie der Makler, nachdem er sich in beiden Wegrichtungen vergewissert hatte, dass niemand in der Nähe war, vorsichtig einen Stein neben dem Tor aus den Fugen hob und dahinter den Schlüssel versteckte. Dann ging der Glatzkopf davon.
Gajus war allein in dem großen, wenig gepflegten Garten, in dem allmählich das Sonnenlicht erlosch. Die weit erblühten Rosen verfärbten sich lila. Kurze Vogelschreie kreuzten sich im Geäst der Bäume, herabgefallenes Laub raschelte unter hüpfenden Vogelfüßchen. Er streckte sich ins Gras und schloss die Augen. Auf einmal wusste er, was ihn verlockt hatte, gegen alle Vorsicht durch das offene Tor in diesen Garten zu laufen. Zuerst war es die bruchsteinerne Mauer mit den mächtigen Huflattichwedeln gewesen, die ihn an den Garten zu Hause in Campanien erinnerte. Auf solch einer Mauer, die den elterlichen Garten vom Feld trennte, hatte er oft in der Sonne gesessen. Dort hatte alles seinen Anfang genommen. Seine Augen bewahrten noch den Sonnenglast der Luft, und es war ihm auf einmal wie an jenem Frühlingstag, dem letzten, den er sorglos auf dieser Mauer zugebracht hatte. Er sah wieder das Gras durch die grauen Zweige der Obstbäume mit ihren platzenden Knospen leuchten, sah draußen auf dem Feld das knochige Ochsenpaar den Pflug durch die feuchte, braunglänzende Erde ziehen, sah, wie der Vater gebeugt den Pflug in die Erde drückte und sein älterer Bruder die Ochsen führte und antrieb, spürte wieder den herben Geschmack einer zerkauten Huflattichblüte auf der Zunge. Er genoss es von neuem, in den Baumwipfeln verborgen, auf seiner Mauer zu sitzen und in den steigenden Tag zu blinzeln, schwer zu erreichen für die Rufe der Mutter, wenn sie irgendeine kleine Arbeit für ihn hatte.
Die Schulstube im nahe gelegenen Marktflecken war schon fast vergessen. Immer weniger hatten Gajus und Servius dem einarmigen Lehrer mitbringen können, Geld bald gar nicht mehr. Anfangs hatte es die Brüder gefreut, dass der Schulmeister sie nichts mehr fragte und ihre Aufgabentäfelchen unbesehen zurückwies. Dann aber hieß es bei jeder Störung, bei jedem Streich, die beiden Ummidier wären die Anstifter gewesen, und es dauerte nicht lange, bis der Einarmige seine Gerte schwang und schrie: „Ihr braucht nicht mehr zu kommen!“ Sie begriffen, das hieß: Ihr dürft es nicht. Da war Gajus mit seiner Freude allein geblieben, denn als der Ältere musste Servius am nächsten Tag schon mit auf den Acker. „Es ist ohnehin besser so“, hatte der Vater gebrummt. „Der Buchstabenkrämer bringt euch nur Flausen bei.“
Gajus achtete die Meinung des Vaters gern. Seither gehörte der Tag ihm. Nur die Mutter behielt sich vor, ihn gelegentlich zu Handreichungen zu rufen. Doch er kannte genug Stellen, wo ihre Stimme nicht zu ihm drang. Welch ein Genuss, gebraucht zu werden und unauffindbar zu sein! Wo das Ochsengespann mit dem Pflug wendete, standen die Pinien an der Landstraße nach Capua. Dahinter begannen die Weinberge des Mannes, den der Vater nie mit Namen nannte. Immer sprach er nur vom Patron, wie es sich für Sklaven oder Freigelassene gehört hätte. Die Weinberge türmten sich blaugrün, je ferner, je matter, nordwärts die campanische Ebene entlang, aus der im Süden sich ganz unvermittelt der blasse, seine dünne Rauchsäule in den Himmel schmauchende Kegelstumpf des Vesuv erhob. Manchmal, wenn die Mutter ihn nicht suchte, blies er die Syrinx, seine Hirtenflöte.
Inzwischen wusste Gajus, was es hieß, die Pacht nicht zahlen zu können und selbst mit den Zinsen in Verzug zu kommen. Besser verstand er nun auch, weshalb seine Eltern sich so gern auf den vergöttlichten und dennoch keine Hilfe mehr gewährenden Kaiser Augustus beriefen: Sein Urgroßvater nämlich hatte das Land als Veteran des Augustus erhalten. Der alte Zenturio, der ein Jahr lang in Germanien verschollen war und erst spät hatte heiraten können, wurde als Ahnherr der Familie verehrt, denn weiter zurück reichte die Erinnerung an Vorfahren nicht; er war aus dem Nichts gekommen. Aber schon sein Sohn hatte Land und Hof nach und nach verkaufen und es als Gnade des Latifundienbesitzers ansehen müssen, dass er das kleine Gut als Pächter weiterführen durfte. Doch der Grundherr war kinderlos gestorben und hatte den Besitz einem seiner Freigelassenen vermacht. Dem war Marcus Ummidius Sedulus, der Vater, gnadenlos ausgeliefert. Der genoss es, einen Freigeborenen auszusaugen, sich Patron von ihm nennen zu lassen, ihm Eintreiber ins Haus zu schicken. Der Vater musste in Capua ein Darlehen aufnehmen, um die Zinsen der geschuldeten Pacht zu begleichen. Täglich verfluchte er die Ohrfeige, die er als Gast des vorigen Grundherrn einmal einem Haussklaven wegen frecher Antworten verpasst hatte, denn eben der war wenig später der Patron geworden. Und seinen Beinamen Sedulus, „der Emsige“, verwünschte der Vater, wenn er sich nach einem Arbeitstag nicht mehr aufrichten konnte. „Emsig ist auch der Tod“, pflegte er zu sagen. „Ich ackere im Feld, er aber ackert in mir.“
Nichts davon hatte das Herz des Kindes erreicht. Er kannte den Vater nicht anders als krumm, die Mutter nicht anders als dürr, den Bruder nicht anders als mürrisch und angriffslustig. Den Hunger, der Dauergast im Haus war, bekam Gajus kaum zu spüren, denn ihm, dem Jüngsten, dem Hübschen, dem Verspielten und Verträumten, gab die Mutter immer zuerst.
Er wusste lange nicht, dass auch nach ihm eine harte Hand griff: bis zu jenem Frühlingstag, als der Hund wieder so wild mit sich überschlagender Stimme bellte und die Mutter aufs Feld hinausrief, der Einnehmer sei da, als der Vater das Ochsengespann Servius überließ und durch die Schollen herüberstapfte, als der Jungstier, den durchzufüttern der Vater, um einen Teil der Pacht abzugelten, einstweilen übernommen hatte, wütend die Hörner gegen seinen Verschlag rammte, wohl erregt durch das Gebell des Hundes. Eine Ahnung hatte Gajus diesmal aus seinem Versteck gelockt. Der Einnehmer, den der Hund nicht leiden konnte, und der fremde Stier, der den Hund nicht ertrug, waren ihm verdächtig. So sah er seinen Vater gekrümmt zu dem feisten Eintreiber emporblicken und heftig mit den Armen fuchteln, hörte ihn flehentlich die Götter anrufen, verstand sonst aber nichts, weil der Hund sich nicht beruhigte und der Stier gegen seinen Verschlag rammte. Da sprang die Brettertür auf. Die Mutter floh kreischend hinter den Brunnen. Der Stier streckte verdutzt den Kopf vor und blinzelte. Plötzlich trabte er gemächlich, aber mit gesenkten Hörnern auf den Einnehmer los. Mit einem verzweifelten Ausruf lief der Vater herzu, packte den Flegel und schob den unliebsamen Sendboten des Patrons zur Seite. Wirklich änderte der Stier seine Richtung und preschte auf den Flegel zu. Als er die Vorderbeine spreizte und verharrte, flog der Vater, sich überschlagend, gegen die Brunnenmauer. Er schrie nicht, er stöhnte und röchelte nur und hielt sich die eingefallene Brust. Blut rann zwischen seinen Fingern hindurch. Ein Horn des Stiers musste ihn getroffen haben.
Unwillkürlich zuckte Gajus bei dieser Erinnerung zusammen und öffnete die Augen. In tintigem Blau versickerte das letzte Tageslicht. Der Himmel über dem Gezweig wurde tief und leer, ehe der erste Stern aufleuchtete. Weit fort kläffte jetzt wirklich ein Hund. Aber kein Menschenlaut war mehr zu vernehmen. Gajus stieg auf die Gartenmauer und setzte sich, mit den Armen die Beine an sich ziehend und das Kinn auf die Knie legend, um noch einmal die träumerische Haltung nachzuvollziehen, aus der er damals jäh gerissen worden war.
Der Eintreiber hatte die Flucht ergriffen. Der Stier trabte hinaus in die Felder. Als Servius mit dem Ochsengespann in den Hof kam, war der Vater schon tot. Ehe der Eintreiber wieder erschien, verkaufte Servius die Ochsen, um die Bestattung des Vaters zu bezahlen. Dann ging er zum Patron, um ihm zu sagen, er werde den Hof übernehmen, aber er kam sehr niedergeschlagen zurück. Der Vater hatte ihn, obwohl er alt genug war, noch nicht für volljährig erklären lassen, um ihn auf dem Hof zu halten. Denn junge Männer wie Servius zog es in die Städte oder in die Lager der Legionen. Nun lag die Entscheidung über die Volljährigkeit beim Grundherrn, der aber verweigerte sie. Hof, Land und Gerät fielen zur Begleichung der Schulden gänzlich an ihn, und einen Winkeladvokaten hatte dieser schlaue Freigelassene errechnen lassen, dass auch dann noch eine Restschuld blieb. Sogar das Darlehen in Capua hatte er mit Zins und Zinseszins aufgekauft. Er begnügte sich nicht damit, der Familie des Mannes, der ihn einmal geohrfeigt hatte, alles wegzunehmen. Er verlangte auch, dass einer der drei Hinterbliebenen sich ihm in die Sklaverei gab. Erst dann wäre seinen Geldforderungen entsprochen. Er wollte den freigeborenen Hänflingen einmal zeigen, wie billig sie ihr Römertum verlieren konnten. Das hatte er Servius ins Gesicht gesagt mit der Frage, ob er nicht gleich bleiben und sich in der Winzerbaracke einquartieren wolle. Doch Servius war zurückgekommen mit einem ausgeklügelten Plan, wie sie des Nachts alle drei auf Nimmerwiedersehen auf und davon gehen könnten.
Da hörte die Mutter auf zu weinen und schüttelte den Kopf. „Wir müssten auf Jahre in den Wäldern hausen wie Tiere“, sagte sie, „denn schneller, als unsere Füße uns tragen, weiß in jeder Stadt der Prätor von uns. Wir brauchen uns nur auf dem Markt oder in einer Herberge blicken zu lassen, so hat uns ein Liktor beim Schopf, und dann musst du, Servius, womöglich auf die Galeere. Ihr, meine beiden Jungs“, sagte sie und schaute entschlossen von einem zum andern, „ihr müsst eure Freiheit behalten. Ich verkaufe mich dem Patron als Magd, wenn er uns schon die Wahl lässt. Ich habe einen entfernten Vetter in Neapel; euer Onkel Gnaeus ist vermögend. Ich schreibe an ihn ein Briefchen und schicke euch damit zu ihm. Wenn er nicht gleich die Summe herausgibt, die ihr braucht, um mich loszukaufen, lässt er sie euch gewiss in seinem Weingeschäft verdienen. Du vor allem, Servius, kannst doch schon zupacken. Du wirst mich eher freikaufen als ich dich.“
Müdigkeit und Nachtkühle verscheuchten Gajus von der Mauer. Er schlich durch den Garten, um nachzusehen, ob das Landhaus offen war. Die Tür erwies sich als verschlossen, doch am Rahmen hing ein Beutelchen, und darin steckte der Schlüssel. Irgendjemandem musste der Makler die Möglichkeit gegeben haben, allein hineinzukommen. Gajus fürchtete eine Falle, wenn er drinnen schliefe. Hinter dem Vorraum fand er eine Kammer, in der wollene Decken lagen. Davon nahm er eine, dann schloss er die Tür ab. In die Decke gewickelt, legte er sich neben dem Tor unter die Mauer. So konnte er am ehesten den Pfiff des Langen hören und, falls jemand ihn überraschte, am leichtesten entwischen.