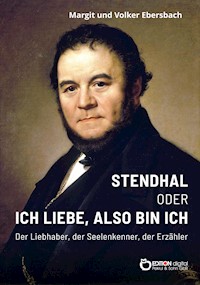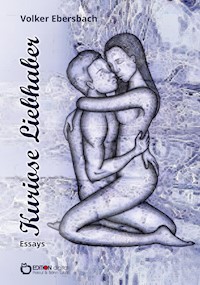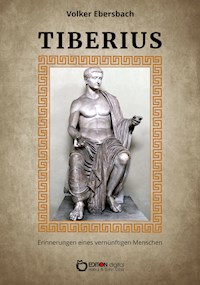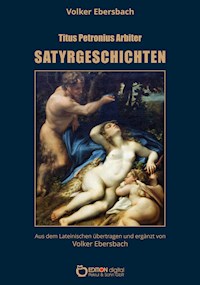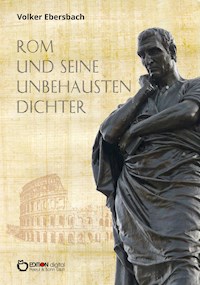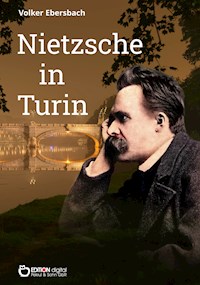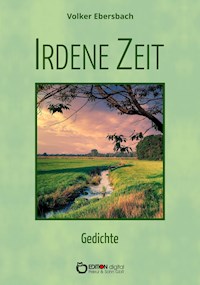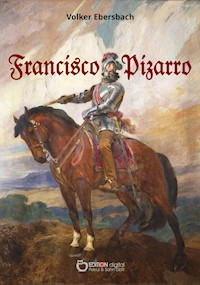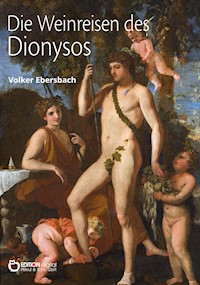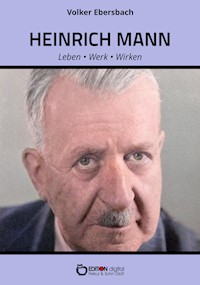
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Thomas Mann (1875 bis 1955), der berühmte Schriftsteller und Literatur-Nobelpreisträger von 1929, und einige seiner wichtigsten Werke wie die „Buddenbrooks“ und „Der Zauberberg“ dürften auch heute noch vielen Menschen ein Begriff sein – zumindest in groben Umrissen. Aber was ist mit seinem älteren Bruder Heinrich Mann (1871 bis 1950), der kurz vor seinem Tode zur Übersiedlung aus seinem amerikanischen Exil in die junge DDR und zur Übernahme der Präsidentschaft der Deutschen Akademie der Künste in Berlin eingeladen worden war? Was weiß man von ihm, von seinem Leben und von seinen Büchern, von denen wahrscheinlich „Professor Unrat“ und „Der Untertan“ noch immer ein wenig im Gedächtnis geblieben sind? Wer mehr darüber erfahren möchte, der kann zu diesem großen Buch greifen, das sich sowohl mit seinem Leben und seinen politischen Auffassungen wie auch mit seinen literarischen Arbeiten und mit seiner Rezeption beschäftigt. Die Anerkennung für Heinrich Mann fiel in den damals beiden deutschen Staaten – auch das erfahren wir aus der Biografie von Ebersbach – sehr unterschiedlich aus: Während er im östlichen Teil 1947 mit der Ehrendoktorwürde der Berliner Humboldt-Universität und 1949 mit dem Nationalpreis I. Klasse sowie mit der Wahl zum künftigen Präsidenten der Akademie der Künste geehrt wurde, blieb er im westlichen Teil ein lange Zeit unbekannter und eher abgelehnter Autor: Heinrich Böll nannte mit den Motiven, aus denen er sein positives Verhältnis zu Heinrich Mann ableitete, zugleich die Ursachen für die Fremdheit des Dichters in einer Gesellschaft, die seine Kritik nicht verwindet: „Im ‚Untertan‘ ist die deutsche Klein- und Mittelstadtgesellschaft bis auf den heutigen Tag erkennbar. Es bedarf nur weniger Veränderungen, um aus diesem scheinbar historischen Roman einen aktuellen zu machen: den Missbrauch alles ‚Nationalen‘, des ,Kirchlichen‘, der Schein-Ideale für eine handfest-irdisch-materielle bürgerliche Interessengemeinschaft, der alles Humanitäre, sozialer Fortschritt, Befreiung jeglicher Art verdächtig ist, deren Moral heuchlerisch ist, die kritiklos untertan ist. Ich war erstaunt, als ich den ,Untertan‘ jetzt wieder las, erstaunt und erschrocken: fünfzig Jahre nach seinem Erscheinen erkenne ich immer noch das Zwangsmodell einer untertänigen Gesellschaft“, so Böll. Eine Anregung, sich erstmals oder erneut mit Heinrich Mann zu beschäftigen und seine Bücher zu lesen – auch und erst recht 151 Jahre nach seiner Geburt und kurz vor seinem 75. Todestag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Heinrich Mann – Leben, Werk, Wirken
ISBN 978-3-96521-622-8 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 1978 im Röderberg-Verlag GmbH, Frankfurt am Main (Röderberg-Taschenbuch Band 71) und im Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Verachtung und Güte
In der letzten Phase seines Schaffens, während Europa in Flammen steht, blickt Heinrich Mann auf ein Zeitalter zurück. Noch weiter kann ein Misserfolg nicht gehen. Der Strich unter einem Zeitalter war niemals dicker (1) Dies über das zu Ende gehende Abenteuer des imperialistischen Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt hat sich Heinrich Mann zu umfangreicheren Äußerungen nicht nur über seine Zeit, sondern auch über sich selbst entschlossen. Bis dahin war er sparsam geblieben mit Worten zur eigenen Person. Sein ausgeprägter Sinn für das öffentliche Leben (Heinrich Mann, Briefe an Karl Lemke, Berlin 1963, S. 122) verschmolz immer wieder unmittelbar persönliche Lebenserfahrung mit dichterischem und publizistischem Werk, mit einem leidenschaftlichen, ununterbrochenen Kampf, der an verschiedenen Fronten, mit unterschiedlichen Mitteln und von zeitbedingt widersprüchlichen Positionen aus der Verteidigung der Kultur, der Wahrung der Menschenwürde galt. Doch das Autobiografische tritt auch in „Ein Zeitalter wird besichtigt“ (2) noch hinter die essayistische Verarbeitung des Zeitgeschehens und seiner historischen Wurzeln zurück. Die Energie der antifaschistischen Streitschriften und Essays aus der Zeit des französischen Exils strömt weiter; statt einzelner Aufsätze entsteht ein Buch, ein Riesenessay über die erlebte Zeit und nur dadurch vermittelt über ihn selbst. Zu Privatem äußert er sich kaum.
Diese Zurückhaltung der eigenen Person gegenüber hat Heinrich Mann 1922 als Teil seiner Kunstauffassung begründet. Anderes als das in Kunstgebilde Gewandelte und aus uns Fortgestellte sollten wir weder von uns noch von einander preisgeben, es wird notwendig missverstanden (3). Vor Missverständnissen auf der Hut sein, ihnen nach Möglichkeit vorbeugen, wenn sich schon ein Geschichtsschreiber (4) des eigenen Lebens gefunden hat, ist auch der Duktus vieler Briefe an Karl Lemke (5). An den Memoiren Napoleons I. wie auch an Flaubert bewundert Heinrich Mann die göttliche Unpersönlichkeit (6), und so schreibt er längere Passagen im „Zeitalter“ über sich in der dritten Person. – Vielleicht ist er es; vielleicht bin ich es (7) beantwortet er Vermutungen, dass im „Zola“-Essay und im „Henri Quatre“ Züge eines Selbstporträts enthalten seien. Schwerlich ist zu übersehen, dass in den Porträtessays Heinrich Manns, vor allem in denen über Franzosen, Aussagen gemacht werden, aus denen sich Umrisse eines Selbstporträts zusammensetzen ließen. Nicht nur, dass über sich selbst spricht, wer über seine Vor- und Leitbilder spricht. Sondern Heinrich Mann rückt in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen über andere Dichter jeweils auch eigene Problematik und stellt gern als Lebens- und Schaffenskonflikt eines anderen dar, womit er soeben selbst fertig geworden ist. Die Zeitnähe und die Bedeutsamkeit seiner Probleme berechtigen ihn dazu. Sei es der antibürgerliche Ästhetizismus Flauberts, die Entwicklung zumsozialen Roman und zur Demokratie bei Zola oder die linksintellektuelle Hinneigung eines Anatole France zum Kommunismus – immer entlocken ihm die Reflexionen Selbstzeugnisse.
Was braucht ein Denkender, um das Leben recht zu fassen und nicht an ihm zu scheitern? fragt er im Zusammenhang mit Anatole France. Verachtung und Güte. Jene, um nicht zu hassen, diese, um von Menschen nur zu fordern, was sie leisten können (8).Am Schaffen seines langjährigen Freundes Lion Feuchtwanger ist ihm wichtig, dass es lehrt, weniger zu hassen als zu erkennen: es gewährt seinen Romanen und ihm die Lebenskraft und Dauer. Ihm ist erlaubt, gütig zu sein; Güte verlangt Echtheit, und er hat sie (9).
Wer Heinrich Manns „Untertan“ kennt und danach zu Novellen wie „Pippo Spano“ oder zu einem Alterswerk wie „Der Atem“ greift, mag sich einen Augenblick lang fragen, ob er es mit demselben Autor zu tun hat. Nicht sofort wird er die heterogenen Themen und die unterschiedliche Gestaltung mit einem einheitlichen Ausdruckswillen identifizieren. In den beiden Romanen „Die Jugend des Königs Henri Quatre“ und „Die Vollendung des Königs Henri Quatre“ hat man ihn aber ganz, den Rationalisten, Moralisten und Skeptiker, den streitbaren Humanisten, dessen Ziel es ist, weniger zu hassen als zu erkennen, dem Güte nur durch Echtheit zu verwirklichen ist, der sich gegen die Widervernunft, gegen die Widermoral, gegen die Widernatur mit Verachtung wappnet, um nicht zu hassen, der in seinem guten König darstellt, wie Geist zur Tat wird, die für den Menschen geschieht (10), wie Menschlichkeit und Menschenwürde zur Macht gelangen, wie die Güte gebietet, um von Menschen nur zu fordern, was sie leisten können.
Wenn ich Überzeugungen hatte, ich behielt im Grunde von früh an immer dieselben, glaubte ich sie formen zu müssen. Der geformte Ausdruck vollendet die Überzeugungen, er macht sie erst wirklich wahr, vielleicht für andere, für mich gewiss (11). Die Stetigkeit solcher Grundüberzeugungen und ihre humane Selbstverständlichkeit, zugleich das Bewusstsein, dass er vor allem anderen Künstler, also Gestalter, also ein Bildner von Menschen sei, machen Heinrich Mann so wortkarg, wo es um ihn selbst geht. Ein Bildner von Menschen ist zuletzt nicht dagewesen, um sie mit seinem Talent zu beschäftigen. Sie sollten eine innige Teilnahme erlangen, weniger für ihn als für sich. Die intellektuelle Menschenliebe allein ermächtigt uns, zu denken, zu schreiben. Das Ziel und Ende ist wieder, zu machen; dass der Vorgang des Lebens besser begriffen werde, bis zu der Einsicht, nur was in Wachsamkeit, Vernunft und Güte getan wird, ist getan. Man weiß übrigens, dass selten etwas wirklich getan ist (12). In ihrem Verschmelzen mit dem öffentlich ausgetragenen Kampf wird die eigene Persönlichkeit nicht nebensächlich, aber sie geht – so Heinrich Manns Auffassung zu der Frage, was ein Schriftsteller sei (1926) – ganz im Engagement auf. Ein Schriftsteller bat doch in beherrschter Leidenschaft viel Schicksal, viel Menschliches zu seiner Sache gemacht – und sich zu ihrer … Denn merkwürdig bleibt, dass jemand, der schließlich nur Erfindungen schreibt, eine Art Mitschuld fühlen kann am Gang der wirklichen Welt. Ihre Taten, die oft schlimm waren, haben ihn beschwert wie eigene Fehler und Misserfolge. Ihre Langsamkeit im Bessern macht ihm noch immer heiß, als bliebe er selbst schmählich hier stecken (13). Solche beherrschte Leidenschaft für den Menschen vertraut dennoch auf die von Wachsamkeit und Vernunft getragene, also rationalistisch und streitbar verstandene Güte der menschlichen Tat, Güte als eigene Haltung, Güte als die in anderen Menschen vorhandene, zu erweckende, zu vermehrende Qualität.
Heinrich Manns Lebenszeit deckt sich ziemlich genau mit einer Epoche der deutschen Geschichte. Er kann ein Zeitalter besichtigen, dessen Zeuge er seit dem Anfang war. Die Kindheit fällt in den verspäteten Aufschwung des Kapitalismus in Deutschland, die Jugend in seinen Übergang zum Monopolkapitalismus und Imperialismus. Dadurch ist sein Werk angelegt auf die Kritik am Bürger und seiner Gesellschaftsordnung, daran, dass das Bürgertum die Zustände, die es geschaffen hat, für endgültig hält. Einer Welt von geschäftstüchtigen Faunen, die ihm halb imponieren, halb ihn abstoßen, setzt der junge Romancier und Novellist seine provokante Fantasie entgegen. Der Autor der „Göttinnen“ hat sich zu entscheiden zwischen dem Dienst am Antlitz des Menschen und dem Kult mit seiner Fratze. Stolz bäumt sich auf gegen den Verlust an menschlicher Würde, gegen die Verhässlichung des Menschen im Bourgeois. Güte lässt sich für ihn allenfalls noch, gepaart mit Verachtung gegen alles Bürgerliche, von der Warte eines natürlichen menschlichen Adels, eines Adels der Empfindung aus verteidigen. Das ist die Haltung des leidenschaftlichen Individualisten. Immer wird das behutsame Ja des Menschen zu sich selbst, wenn Heinrich Mann es ausspricht, gespeist sein von diesem Stolz. Er entdeckt die Macht der Lüge. Die herausgeforderte Wahrhaftigkeit wird didaktisch. Ein spitzer Finger legt sich überallhin, wo verlogene Geschäfte verlogene Ideen erzeugen und verlogene Ideen wieder verlogene Geschäfte ermöglichen; dieser eine Finger wiegt mehr als zehn andächtig gefaltete vor der Lüge der Macht.
In der Novelle „Heldin“ (1905), die neben anderen Werken dieser Zeit Heinrich Manns Wandlung vom ästhetisierenden Individualisten zum sozial denkenden bürgerlichen Demokraten widerspiegelt, versucht eine junge Frau einen jugendlichen Kranken von seiner neurasthenischen Misanthropie zu erlösen, indem sie ihm sagt: Das Böse im Menschen kann man wohl aussprechen; seine Güte ist unsagbar und dabei so tief gewiss. Das Böse ist nur obenauf; es geschieht nur, weil man nicht achtgibt, sich nicht bedenkt: aus Lässigkeit, durch Irrtum (14). Den eigenen Bart kennt man übrigens am besten. Und was man so durchaus kennt, gibt man gelassen preis. Was liegt dem Bildner von Menschen an sich selbst! Freilich hat es immer einen gewichtigen Unterschied gemacht, wer den Bart trug, wer konservativ dachte, weshalb er die Monarchie verteidigte und gegen wen. Als reifer Mann erlebt Heinrich Mann den ersten Weltkrieg, die blutige Auseinandersetzung, die die imperialistischen Mächte untereinander austragen um die Vorherrschaft in der Welt, und den Zusammenbruch des Wilhelminischen Kaiserreiches. Der Untertan, dessen aufgezwirbelten Renommierbart sein Autor selbst einmal getragen hat, erreicht sein Ziel, aber auch seine einstweilige Niederlage, die ihm sein Autor ohne Kenntnis aller fürchterlichen Konsequenzen, aber vermöge richtig gesehener, stark gezeichneter Personen (15) vorausgesagt hat.
Zu Heinrich Manns wichtigsten Erfahrungen gehört zu dieser Zeit, dass Vorurteile zwar schützen können, aber sehr einsam machen. Da sieht er auch, dass die Worte des Bruders umso ohnmächtiger werden, je klüger sie sich gebärden. Im „Zola“-Essay, der in der Auseinandersetzung mit einer Reihe deutscher Schriftstellerkollegen, unter ihnen Thomas Mann, über den ersten Weltkrieg entsteht, ist die Legierung von literarischer Porträtbiografie und autobiografischem Bekenntnis geradezu Methode. Die Zensur erlaubt keine offene Polemik gegen die Befürworter des Krieges, die Meinungsverschiedenheiten mit dem Bruder enthalten die Gefahr, dass darin allzu persönlich, allzu privat ein „Bruderzwist“ gesehen wird. Der Ausweg in die dritte Person ist lange vorbereitet durch andere Essays, Romane, Erzählungen. Dennoch verkennt man einander zeitweilig. Heinrich Mann bleibt nur das unbeirrbare Achselzucken, unerbittliche Güte. Sie soll sich bewähren: Gerade Güte ist später das Prädikat, das am Bruder Thomas Mann hervorgehoben wird, wenn dieser es schwer hat, noch an die von Hitler an den Rand des Untergangs geführte Nation, an die Deutschen zu glauben (16).
Aber Heinrich Mann selbst ist auch manchmal unter den letzten, an deren Ohr die eigenen Voraussagen ankommen. Zur Zeit der Weimarer Republik glaubt er, bis die Bourgeoisie die Macht dem Faschismus übergibt, noch an die Möglichkeit einer Wiederherstellung humaner bürgerlicher Ordnung. Während der Naziherrschaft jedoch, angesichts des Kapitalismus in seiner verworfensten Gestalt, bankrott und gewalttätig (17), erkennt der mit dem erstarkenden Sowjetstaat sympathisierende bürgerliche Humanist den historischen Zusammenhang zwischen 1917 und 1789, überzeugt er sich davon, dass seine Vorstellungen von Kultur und Menschlichkeit nur dann verwirklicht werden können, wenn die Arbeiterklasse die Macht übernimmt. Während das alte Zeitalter zu Ende geht, hat das neue bereits begonnen. Die faschistische Aggression gegen die Völker Europas scheitert an ihrem heldenhaften Widerstand. Heinrich Mann hat während seines französischen Exils energisch für eine deutsche Volksfront gegen den Faschismus gewirkt. Das Einmünden der Weimarer Scheindemokratie in die faschistische Barbarei zerstörte die letzten Illusionen des bürgerlichen Demokraten und linken Intellektuellen über die Realisierbarkeit humanistischer Ideale im Rahmen der kapitalistischen Gesellschaftsordnung. Ohne mit den Lehren des Marxismus-Leninismus vertraut zu sein, erkennt er die historische Bedeutung der Arbeiterklasse und stellt sein künstlerisches und kulturpolitisches Schaffen in ihren Dienst. Deutsche Arbeiter! Ihr seid die Hoffnung! schreibt er in einer illegal im Dritten Reich verbreiteten Tarnschrift. Ihr Arbeiter habt von der Bestimmung des Menschen den richtigen Begriff. Euer Staat soll auf der Vernunft und auf der Gerechtigkeit begründet sein … Ihr sollt die Macht erobern und in ihrem Besitz bleiben (18). Der bewährte Verteidiger des bürgerlichen Humanismus zieht die einzig mögliche Konsequenz: Der neue Humanismus wird sozialistisch sein(19). Damit wird Heinrich Mann zu einem der eindrucksvollsten Repräsentanten des Übergangs vom bürgerlichen zum sozialistischen Humanismus.
Er hat die menschliche Güte bis dahin zu retten versucht als einzelner mit wenigen Gefährten, hat die intellektuelle Menschenliebe verteidigen wollen durch eine Diktatur der Vernunft, die er sich von einem engen Kreis Intellektueller über den Klassen, über den Nationen ausgeübt dachte. Nun weiß er sie für die Zukunft gesichert bei einer Klasse, die mit ihrer Selbstbefreiung alle unterdrückten Menschen befreit. Gerade weil seine Liebe den Milden gehört, weil er wie sein guter König Henri die Macht der Güte auch als Macht durch Güte will, gibt er den Strengen recht und mobilisiert mit ihnen die ganze Gewalt seiner Verachtung, wenn der Kampf dem profitablen Hass gilt. Henri hat zeitlebens mit Güte und mit dem Schwert gegen Widernatur, Widermoral, Widervernunft gekämpft und musste am Ende noch unterliegen aus Unachtsamkeit, aus versäumter Wachsamkeit. Da ist Heinrich Mann, der während des ersten Weltkrieges dem Hass der Nationen mit Pazifismus begegnete, der während der Jahre der Weimarer Republik dem Hass der Klassen einen didaktisch gefärbten sozialen Pazifismus als Alternative anbot, schließlich vorbehaltlos fürs Zuschlagen.
Denn der Hass war es, der die wirtschaftlichen Zwecke des Bürgertums, vielmehr seiner reichsten Schicht (20) kaschieren sollte, der den Untertanen reif machte für den imperialistischen Krieg, das Geschäft der Rüstungsindustrie und für den Rassenunfug des Nazistaates, mit dem die Aufmerksamkeit der Massen von den wirklichen sozialen Problemen abgelenkt wurde. Dieser Hass ist für den Rationalisten Heinrich Mann Bestandteil und Instrument jenes Irrationalismus, der im Faschismus seine aggressivste und verlogenste Ausprägung findet, mit seiner Herkunft aus der Unfähigkeit, mit seinen für nichts und wieder nichts verübten Untaten (21). Diesem Hass sagt er mit dem ersten Essayband seiner antifaschistischen Publizistik den Kampf an, diesen Hass muss er nach der zweiten Katastrophe bei den weiterhin unbelehrten wiederfinden, wenn er die Szenerie im westlichen Teil Nachkriegsdeutschlands beobachtete. Im Grunde arbeitet ein Hass, böser als je, weil er die Reue zu verdrängen hat. Man führt sich auf wie unmittelbar vor Hitler. Die herrschende fremde Macht erlaubt und findet nützlich, dass man ausschreitet (22). Der Untertan hat sich als bemerkenswert resistent erwiesen vermöge der Gesellschaftsordnung, die ihn integriert, die ihn immer wieder braucht und neu hervorbringt. Heinrich Mann hat ihn mit Verachtung bis in die letzten psychischen Schlupfwinkel verfolgt, bis in seine raffiniertesten sozialen Verkleidungen, um der Güte willen.
Dass die Verfolgungsjagd auf das Verächtliche im Menschen und seine sozialen Vorbedingungen im Interesse der Güte geschieht, verleiht den entstandenen Werken die dauernde Wirkungskraft, die ihnen der Autor selbst mitunter nur zögernd zugestehen wollte. Mag sein, nichts bleibt, schreibt er am 10. Januar 1949 an Karl Lemke (23), und wenige Wochen vorher: Eigentlich haben sie mich nie gemocht, andere Generationen so wenig wie die vorläufig junge (24). Diese Skepsis war wohl berechtigt angesichts der Hartnäckigkeit, mit der sein Werk nach der Zerschlagung des Faschismus weiterhin von restaurativen Kräften ignoriert wurde. Gerade hatte Heinrich Mann in seinem vorletzten Roman „Empfang bei der Welt“ eine Gesellschaft, in der die Kunst zur Ware degradiert wird, am Vorabend ihrer Katastrophe dargestellt, gerade hatte die verarmte Madame Kowalsky im letzten Roman „Der Atem“ auf ihren vergeblichen Gängen zur Bank die Erfahrung Heinrich Manns allegorisch nachvollzogen, dass seine Kunst also eine schlecht gehende Ware sei. Ich bin in fünfzig Jahren nicht so völlig übersehen worden. Wer keine Dollars nötig hätte, würde lachen (25). Die Ausbürgerung, die 1933 der Nazistaat ausgesprochen hatte, wurde von der BRD niemals rückgängig gemacht.
Der vom Hass Ausgebürgerte hat 1933 sein Land verlassen müssen, 1940 auch das Land seines Königs Henri und damit seinen Kontinent, weil er sich selbst, dem Gesetz, nach dem er angetreten war, treu blieb. Im Blick des Greisen, der sich im kalifornischen Exil auf die Rückkehr in das befreite Berlin vorbereitet, liegt, auch wenn er müde geworden ist, die gleiche Festigkeit wie in dem des jungen Mannes und auch noch die gleiche Unruhe der Klarheit. Hinzugekommen ist vielleicht die – immer noch stolze – Demut des Wissens. Die Tyrannei der Schlechtesten ist schimpflich abgestunken (26). Unentrinnbar ist seinem Volk das Antlitz des Menschen aufgegangen. Der Strich unter einem Zeitalter war niemals dicker. Eine Republik hat ihn gerufen, deren tieferen Sinn er in einer anderen, der Weimarer, vergeblich gesucht hat. Demokratie und Republik brauchen Güte so sehr wie Erkenntnis. Ihr Beruf wäre, beide in der Welt zu vermehren. Das Gegenteil von Demokratie ist Ideenhass, die Verfolgung von Gesinnungen (27). Auch die Zukunft der Nation sieht er gesichert, wenn sie in den Händen der Arbeiterklasse liegt. Die Deutsche Demokratische Republik wählte ihn zum Präsidenten ihrer Akademie der Künste und verlieh ihm den Nationalpreis für Kunst und Literatur. Ihre Gründung begrüßte er, zusammen mit Lion Feuchtwanger, in einem Glückwunschschreiben an die Regierung. Als Heinrich Mann am 12. März 1950 kurz vor seiner Rückkehr nach Berlin in Santa Monica starb, war entschieden, dass sein Werk von all denen gepflegt und weitergeführt würde, die Güte verbinden mit Vernunft, Erkenntnis und Wachsamkeit. Sein Werk hat nie eine so weite Verbreitung gefunden wie heute in den sozialistischen Ländern. Das Vertrauen, das er während seiner ganzen Schaffenszeit, über ein ganzes Zeitalter hinweg in das junge Geschlecht setzte, war begründet. Güte und die Annahme einer menschlichen Gleichheit, jene schöne Vorliebe des gereiften achtzehnten Jahrhunderts, warum sollten sie nicht wiederkehren – und auf festerem Erdboden vielleicht, seitdem er so viel Blut getrunken hat? Demokratie, Erkenntnis, Friede sind Wege. Pflicht ist nur, das Glück zu erleben (28).
1. Der Älteste
Die Stadt Lübeck, Heinrich Manns früheste Umgebung, entwuchs gegen Ende des 19. Jahrhunderts nicht stürmisch, aber stetig der Enge einer mit noch mancherlei mittelalterlichem Requisit behafteten bürgerlichen Stadtrepublik. Während der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hatte sie rund 37 000 Einwohner gezählt, zu Beginn der zweiten Hälfte, um 1860, aber bereits 50 000). Aus einer Hafenstadt, deren fast ausschließliche Bedeutung im Handel lag und die einen traditionsreichen Kaufmannsstand entwickelt, aber nur wenig zur Herausbildung der Gewerbezweige beigetragen hatte, entwickelte sich eine Industriestadt. Preußen war immer näher an die kleine Stadtrepublik herangerückt. 1866 war Holstein preußisch geworden. Mit dem Anschluss des benachbarten Mecklenburg an den Zollverein drohte eine wirtschaftliche Einkreisung, der Lübeck 1868 nur durch denselben Schritt zu entgehen hoffte. Aber der Verlust der Zollautonomie beschnitt die Einkünfte aus dem Handel, auf dem einzig die 1848 geschaffene bürgerlich-demokratische Verfassung des Gemeinwesens ruhte. Zur Konkurrenz der Hafenstädte Hamburg und Kiel trat nun auch die des preußischen Stettin. Der Bau des Nord-Ostsee-Kanals 1887 bis 1895 verschaffte Hamburg einen direkten Zugang zur Ostsee und damit endgültig ein Übergewicht, dem Lübeck nicht mehr gewachsen war. Sollte es nicht wie manche andere deutsche Mittelstadt, die früher einmal Freie Reichsstadt gewesen war, in kümmerliche Abgeschiedenheit versinken, musste es sich die Zuwanderung der verschiedensten Industriezweige, die in den Siebzigerjahren einsetzte, gefallen lassen.
Zuerst fasste die Konservenindustrie Fuß; ihr folgte als unentbehrlicher Zulieferer die Blech- und Emaillewarenindustrie. War einmal der Bezug von Blechdosen gesichert, konnte sich auch, besonders im benachbarten Schlutup, eine fischverarbeitende Industrie entwickeln. Der vorhandene Holzschiffbau wurde abgelöst und rasch überholt vom Metallschiffbau. Als Anhängsel des Überseehandels lebte die Tabakindustrie auf, musste aber bald der Konkurrenz im Reich weichen. Bis um 1900 überwog noch die industrielle Produktion von Verbrauchsgütern. Aber kletternde Beschäftigtenzahlen in den einzelnen Betrieben erweisen, dass die ständig steigende Einwohnerzahl Lübecks vor allem ein Anwachsen des Proletariats bedeutete. Die alte achtundvierziger Verfassung genügte der sich verändernden Wirtschafts- und Bevölkerungsstruktur nicht mehr und wurde 1875 durch eine neue ersetzt. Sie war gutbürgerlich-konservativ, versuchte stadtstaatlich-demokratische Institutionen vor der Verpreußung zu retten, denn der Fortschritt, der aus Preußen kam, hieß zunächst Kapitalismus mit starker Tendenz zur Monopolisierung. Lübeck wählte noch ein paar Jahre wie gewohnt. Der Reichstag wurde abwechselnd nationalliberal und freisinnig beschickt. Aber die Industrialisierung der Wirtschaft und die Proletarisierung der Bevölkerung brachten bald andere Stimmenverhältnisse. Ab 1890 musste die Stadt sich fast kontinuierlich im Reichstag sozialdemokratisch vertreten lassen. Ungefähr aller vier bis fünf Jahre verdoppelte sich die Mitgliederzahl der Lübecker Sozialdemokratie, entsprechend waren die Stimmenanteile gewachsen. Nichts war natürlicher, wenn sich die Zahl derer vervielfachte, deren Wochenlohn selten mehr als fünfundzwanzig Mark betrug, meist weniger.
Aber der lübische Konservatismus war tief verwurzelt. Er grub sich ein und ließ das neue Zeitalter über sich ergehen, oder er liierte sich mit ihm und verlor dabei zusehends an Seriosität. So lag etwas Unsicheres, Unentschlossenes über Lübeck. Die Stadt wollte und konnte sich nicht ganz vom Alten trennen, durfte sich aber auch nicht dem Neuen verschließen, das die gewohnte und lange intakte Ordnung ins Wanken brachte. (1) 1931 fand Thomas Mann sie auf einer Reise wieder als „eine Mittelstadt wie eine andere, modern schlecht und recht, mit einem sozialdemokratischen Bürgermeister und einer kommunistischen Fraktion im Bürgerschaftsparlament – tolle Zustände, wenn man sie mit den Augen unserer Väter ansieht, aber durchaus normal“ (2.). Die freie und Hansestadt hatte bis zu diesem nach Weimarer Muster regierten, mit jeder anderen etwa gleich großen Stadt des damaligen Deutschen Reiches vergleichbaren Gemeinwesen einen weiten Weg zurückzulegen gehabt. Und so scheint es Thomas Mann „um ihre bürgerliche Gesundheit eigentümlich suspekt zu stehen, nicht ganz geheuer, nicht ganz uninteressant. Es hockt in ihren gotischen Winkeln und schleicht durch ihre Giebelgassen etwas Spukhaftes, allzu Altes, Erblasthaftes – hysterisches Mittelalter, verjährte Nervenexzentrizität, etwas wie religiöse Seelenkrankheit –, man würde sich nicht übermäßig wundern, wenn dort, dem marxistischen Bürgermeister zum Trotz, noch heutigentages plötzlich der Sankt-Veits-Tanz oder ein Kinderkreuzzug ausbräche – es wäre nicht stilwidrig.“ (3) Die Wiederkehr des „hysterischen Mittelalters“, eines „Sankt- Veits-Tanzes“ stand, als dies geschrieben wurde, politisch für Deutschland unmittelbar bevor, und die Vorboten davon reichen bis in die früheste Kindheit Heinrich Manns zurück, als durch den Wegfall der Zollschranken und die Eingliederung des Stadtstaates in das deutsche Kaiserreich von Preußens Gnaden auch im Geschäftsleben der Lübecker Veränderungen eintraten, als die solide, traditionsgefestigte Bürgerlichkeit der regierenden Familien – unter ihnen die Manns (alias Buddenbrook, alias West) – durch skrupellose Emporkömmlinge wie Hagenström („Buddenbrooks“) und verschlagene Spekulanten wie Pidohn („Eugenie oder Die Bürgerzeit“) übervorteilt und korrumpiert wurde. Der Übergang des Kapitalismus der freien Konkurrenz zum Monopolkapitalismus und Imperialismus, der sich in den entwickeltsten Staaten vollzog, blieb für Lübeck nicht ohne Folgen, wenngleich Hamburg, schon immer die größere Metropole, ungleich rascher und tiefer davon ergriffen wurde. Die Geschäftsleute mussten allmählich entdecken, dass ihre Chancen schwanden, wenn sie am Buddenbrookschen Leitspruch festhielten: „Mein Sohn, sey mit Lust bey den Geschäften am Tage, aber mache nur solche, daß wir bey Nacht ruhig schlafen können.“ (4) Und doch wollte ein Christian Buddenbrook auch darin schon eine Spur von Gaunerei entdeckt haben. (5) Konsul West sagt in Heinrich Manns Roman „Eugenie oder Die Bürgerzeit“ über Pidohn: „Er sieht nur, dass durch Spekulation jetzt häufiger Vermögen entstehen als mit gediegener Arbeit. „ (6) Zu seinen Maximen gehört auch die: „Zu großer Reichtum ist selten achtbar“ (7). Diesem Krankheitsherd der bürgerlichen Gesellschaft, dem Vorzug der Geldgeschäfte gegenüber gemeinnützigem Handel, dieser nach Blut riechenden Hochstapelei des hochkapitalistischen Börsenwesens, der Anhäufung riesiger Vermögen in den Händen weniger geist- und gefühlloser Emporkömmlinge wird Heinrich Manns besonderes Interesse gelten, von Türkheimer („Im Schlaraffenland“) zu Knack alias Krupp („Der Kopf“) bis zu Kobes alias Stinnes und Balthasar („Empfang bei der Welt“).
Der 18. Januar 1871 stellte für diese Entwicklung wichtige Weichen. Im Spiegelsaal von Versailles wurde nach dem Sieg über das französische zweite Kaiserreich Napoleons III. der preußische König Wilhelm I. zum deutschen Kaiser proklamiert. Das deutsche Kaiserreich hat pünktlich das zweite französische abgelöst. (8) Es übernahm den brüchigen Pomp und die Scharlatanerie. Preußen hatte sich nach seinem Sieg über Dänemark und Österreich als militärisch stärkster und ökonomisch sich am raschesten entwickelnder Staat im Verteidigungskrieg gegen Frankreich 1870/71 an die Spitze der deutschen Feudalstaaten gesetzt und ihn in einen annektionistischen Aggressionskrieg verwandelt. Aus „Blut und Eisen“ schmiedete der Kanzler Fürst Otto von Bismarck eine kleindeutsche Einheit „von oben“, die Elemente des Feudalismus konservierte und seine reaktionäre Allianz mit der Bourgeoisie förderte. Die „Reichsgründung“, der die „Gründerjahre“ mit ihrem durch französische Reparationszahlungen angeheizten industriellen Aufschwung folgten, geschah nicht nur auf okkupiertem Territorium und ohne Vertreter des deutschen Volkes, sie richtete sich auch gegen das als „Erbfeind“ verschriene französische Volk durch die Annektion von Elsass-Lothringen und die Schützenhilfe, die die deutschen Besatzer der französischen Bourgeoisie bei der Niederschlagung der Pariser Kommune leisteten. Das zwölf Jahre wirksame „Sozialistengesetz“ Bismarcks war die innenpolitische Parallele. Traditionen der bürgerlichen Revolution von 1848, soweit sie noch wach geblieben waren, erstickten unter der junkerlich-bourgeoisen Vorherrschaft, die sich durch einen von militärischen Siegen überfütterten militaristischen Staats- und Beamtenapparat stützen und schützen ließ. Es hatte die Geschichte einer deutschen Verirrung (9) begonnen.
Die „Reichsgründung“ lag keine zehn Wochen zurück, als Ludwig (Luiz) Heinrich Mann am 27. März 1871 in Lübeck geboren wurde, erstes Kind des Konsuls Johann Thomas Heinrich Mann und seiner Frau Julia, geborene da Silva-Bruhns. Die Familie Mann gehörte in Lübeck zu den ersten und blickte auf eine Reihe von Vorfahren zurück, die es im Laufe von zwei Jahrhunderten zu immer ansehnlicheren Vermögensverhältnissen und zu immer bedeutenderen gesellschaftlichen Positionen gebracht hatten. Diesen stetigen Aufstieg dokumentiert die als Quelle für Thomas Manns „Buddenbrooks“ berühmt gewordene „Familienbibel“. Der älteste bekannte Ahne (10) war „Gewandschneider“ in Nürnberg gewesen, ein Johann Mann, 1644 in Parchim geboren, wurde Ratsherr in Grabow. Sein Sohn ging nach Rostock und übte dort, wie der Vorfahr in Nürnberg, das Handwerk der Gewandschneiderei aus. Joachim Siegmundt Mann (1728–1799) vermehrte das Vermögen in Rostock als Brauer und Kaufmann, und Johann Siegmund Mann wechselte als Kaufmann nach Lübeck über, erhielt den Bürgerbrief und gründete 1790 eine Getreidegroßhandlung. Er heiratete eine Hamburgerin, wurde „Aeldermann und Bergenfahrer“ und verschaffte sich während der Befreiungskriege gegen Napoleon I. durch Getreidelieferungen an die Armeen einen beträchtlichen Vermögenszuwachs. Darauf bezieht sich das Vorspiel „Neunzig Jahre vorher“ zu Heinrich Manns Roman „Der Kopf“. 1848 starb dieser Urgroßvater an einem Schlaganfall, den zornige Erregung über Lübecker Straßenkrawalle, Randerscheinungen der Revolution, ausgelöst hatte. Der Großvater Johann Siegmund Mann (1797–1863) wurde Königlich Niederländischer Konsul und verstärkte die Handelsbeziehungen der Firma ins Baltikum und nach Russland. Er heiratete 1837 die Tochter des aus der Schweiz stammenden begüterten Konsuls Johann Heinrich Marty, Elisabeth Marty. Es ist die leutselige Großmutter, die den essenden Steinklopfern am Straßenrand „Guten Appetit, Leute!“ zurief, in deren weitläufigem Haus eine Sonntagsschule für arme Kinder mit einer eigens dafür angelegten Bibliothek gehalten wurde, wohin es Heinrich oft zog. (11)
Dass der letzte Inhaber der Firma Mann ein erschöpfter, zur „decadence“ neigender Epigone gewesen wäre, bezeichnet Viktor Mann als eine „dichterische Lizenz der Buddenbrooks“ (12). Heinrich Mann schildert ihn anders: Mein Vater war damals ein schöner und stolzer junger Mann. Ob heiter, ob zornig, immer erschien er mir auf der Höhe des Lebens. Er trug weiches Tuch, niedrige Hemdkragen, an den Schläfen noch die vorgebürsteten Haarbüschel, die Napoleon III. getragen hatte. Er ging wiegend und so sicher wie ein Kapitän auf seinem guten Schiff. Trat er ein, ward das Zimmer ein bewegter Raum, worin etwas vorging. (13)Johann Thomas Heinrich Mann (1840–1891) hatte Ostern 1855 die kaufmännische Lehre im Geschäft seines Vaters aufgenommen und sich ab September 1859 „als Commis bei Herren van Hensleben & Vollenhoven in Amsterdam“ (14) weitere geschäftliche Erfahrungen erworben. Auch er wurde Königlich Niederländischer Konsul und erreichte durch seine Wahl zum Senator auf Lebenszeit 1877 den Gipfel des gesellschaftlichen Einflusses der Familie.
Er war einer der vierzehn Senatoren, die in der Verfassung von 1875 vorgeschrieben wurden. Acht seiner Kollegen hatten Gelehrte zu sein, von ihnen wiederum sechs Juristen; er selbst gehörte zu den fünf Kaufleuten, die neben einem Senator aus beliebigem Stand die restlichen Sitze innehatten. Seine Stimme wog mit, wenn der Bürgermeister aus ihrer Mitte gewählt wurde, mit dem zusammen der Senat sich als kollektives Staatsoberhaupt jedem Landesherrn eines monarchisch regierten Teilstaates im Deutschen Reich gleichrangig fühlte. Eine „Bürgerschaft“ von hundertzwanzig Mitgliedern bildete das Parlament.
Senator Mann war zuständig für die Steuern, aber auch durch eine Reihe anderer öffentlicher Verpflichtungen – in der Baudeputation, in der Zentral-Armendeputation, in der Kommission für Handel und Schifffahrt – wurde er beansprucht. Mein Vater verwaltete im Staat die Steuern, seine Macht war die allen furchtbarste. (15) Und noch im Alter erinnert sich Heinrich Mann: Unser Vater arbeitete mit derselben Gewissenhaftigkeit für sein Haus wie für das öffentliche Wohl. Weder das eine noch das andere würde er dem Ungefähr überlassen haben. Wer erhält und fortsetzt, hat nichts anderes so sehr zu fürchten wie dasUngefähr. (16) Dennoch erlitt der Steuersenator Mann (17) gerade während der fieberhaften, aber auch skandalumwitterten Konjunktur der Gründerjahre durch Konkurse anderer Firmen größere Kapitalverluste. Er, der nur leichte und heitere Gespräche führte, stöhnte Namen von Leuten, die zusammenbrachen, alles verloren hatten und sein Geld mit … Mein Vater brauchte sein ganzes noch übriges Leben, bis er wieder hatte, was in wenigen Tagen verloren gegangen war. (18) „Die Zeiten sind ernst und die Aussichten für die Zukunft noch mehr“, schreibt der Senator 1890, im Jahr des hundertjährigen Bestehens der Firma Mann, seinem ältesten Sohn nach Dresden. „Mehr denn je ist es geboten auf persönliche Tüchtigkeit, Unabhängigkeit und Einschränkung der Bedürfnisse hinzuarbeiten.“ (19) Das heiterpatriarchalische Auftreten des Konsuls West in „Eugenie oder Die Bürgerzeit“ zeigt unverkennbar Heinrich Manns Vater: Er nahte mit wiegenden, schnellen Schritten, in hellen Beinkleidern, dunklem Rock, und über einem Arm lag sein Mäntelchen, mit dem seidenen Futter nach außen. Er hielt den steifen grauen Hut in der Hand. Aus dem Hause lief ein Dienstmädchen und nahm ihm beides ab. Er begrüßte die Gesellschaft mit Würde und Leichtigkeit. Seine Frau küsste er auf die Wange, dann hob er seinen Jungen zu sich auf. Der Fünfjährige musste berichten, womit er den Tag verbracht habe. Er wurde gefragt, wer in der Stadt drinnen, rechts und links von ihrem Stadthause und die ganze Straße entlang, ihre Nachbarn seien. (20)
An seine Mutter erinnert sich Heinrich Mann als an eine in den Jahren seiner Kindheit ganz junge, ahnungslose Frau (21). Julia Mann (1851–1923) war die Tochter des aus Lübeck stammenden Johann Ludwig Hermann Bruhns, der, ein „blonder Hüne“ mit norwegischen Vorfahren (22), mit neunzehn Jahren nach Brasilien ausgewandert war, dort Plantagen und Zuckermühlen erwarb, Kaffee- und Zuckerexport betrieb und 1848 die brasilianisch-portugiesische Großgrundbesitzerstochter Maria da Silva geheiratet hatte. Die dramatische Geburt „Dodos“, wie sie von ihren Eltern genannt wurde, unterwegs im tropischen Regenwald, ihre Kindheit auf dem Anwesen der da Silvas, einer „alten Kolonialfamilie“ (23), und die Verpflanzung der kleinen Exotin nach Lübeck, dargestellt in Julia Manns eigenen Aufzeichnungen „Aus Dodos Kindheit“ (24), bilden eine stoffliche Grundlage für Heinrich Manns Roman „Zwischen den Rassen“ und liefern auch Material für die Novelle „Liebesprobe“. Sie wurde in einem Lübecker Mädchenpensionat erzogen und heiratete 1869, achtzehnjährig, den neunundzwanzigjährigen Chef der Firma Mann.
Die junge südliche Schönheit machte das Haus Mann zu einem gesellschaftlichen Anziehungspunkt wie das des Konsuls Breetpoot im „Professor Unrat“. Das Kind ist heimlich Zeuge von geselligen Zusammenkünften, Diners und Maskenbällen, in denen die Atmosphäre vom Hof Napoleons III. nachklingt. Die Kultur des Salons war nie wichtiger als damals, Höflichkeit nie wieder so bekannt. In einem rokokoisierenden Saal tanzte man Quadrillen, veranstaltete Scharaden und andere Rätselspiele, stellte „lebende Bilder“, die Damen bemalten die Fächer ihrer Freundinnen mit Aquarellen, Herren, die sie verehrten, schrieben ihre Namen darauf (25). Schon die Festvorbereitungen versetzen den Knaben in fieberhafte Erregung: Ich darf Mama bewundern. Und dann der heimliche Blick in den Ballzauber: Nackte Schultern, mild vom Licht überzogen, Haare, schimmernd, wie Schmuck und Juwelen, die blitzen vom Leben, wenden sich mühelos im Tanz. Mein Vater ist ein fremder Offizier, gepudert, mit Degen, ich bin durchaus stolz auf ihn. Mama Coeurdame schmeichelt ihm mehr als je … Ich stehe mit sieben Jahren hinter der Tür des Ballsaales, ratlos ergriffen von dem Glück, dem alle nachtanzen. (26) Der Vergleich der Konsulin mit der Kaiserin Eugenie, Gemahlin Napoleons III., Leitmotiv des Romans „Eugenie oder Die Bürgerzeit“, mag seinen Ursprung in solchen Ballabenden haben. Die junge Frau war halb fremd hier, heißt es im Roman. Als noch Unerwachsene … verwechselte sie beim Sprechen eine Menge Worte. Seither hatte sie, wie ein kleines Kind, wieder von ihrer ersten Sprache das meiste verlernt. Auf Alteingesessene wirkt sie gefallsüchtig, wohl nicht anders als alle dort unten. (27) Und doch spricht aus ihren einfachen Worten, an die ihr Ältester sich erinnert, die ganze bürgerliche Solidität führender Lübecker Familien: „Wir sind nicht reich, aber sehr wohlhabend. „ … Meine Mutter wusste vielleicht, dass Geld wohl wünschenswert, sehr viel Geld aber weder förderlich noch gern gesehen sei. (28)
Das hinderte allerdings nicht, dass man sich in seinem eigenen Bewusstsein als Angehörige des Patriziats einer alten Stadtrepublik, die von jeher keinem Feudalherren außer dem Kaiser rechenschaftspflichtig gewesen war, unausgesprochen dem Adel der umliegenden Gebiete, Mecklenburgs und Holsteins, aber auch Preußens, ebenbürtig fühlte, wie in den „Buddenbrooks“ Morten Schwarzkopf herausfindet. (29) Die Familie Mann führte ein Wappen, das bei der Wahl des Vaters zum Senator mit ihm in den Ratssaal einzog, „ein wilder Mann mit einem Fell um die Lenden, in einer Hand eine Keule und in der anderen einen ausgerissenen Baum“ (30). Heinrich Manns Altersroman „Der Atem“ enthält eine ferne Reminiszenz an dieses mehr inoffizielle Bewusstsein seiner Herkunft: Madame Kowalski, die im Wesentlichen die soziale und ideologische Entwicklung des Autors widerspiegelt, ist eine geborene Gräfin Traun.
Gute vier Jahre war Heinrich Mann das einzige Kind des jungen, lebensfrohen und hoch angesehenen Paares. Als der Älteste vor Paul Thomas Mann (1875–1955), Julia (1877 bis 1927), Carla (1881-1910) und Viktor (1890–1949) war er zunächst auch traditionsgemäß zum künftigen Chef der Firma bestimmt, und der Vater versuchte ihn entsprechend zu lenken: Als Knaben nahm er mich auf die Dörfer mit. Damals hoffte er noch, ich könnte ihm nachfolgen. Er ließ mich ein Schiff taufen, er stellte mich seinen Leuten vor. Das alles schlief ein, als ich zu viel las und die Häuser der Straße nicht hersagen konnte. (31)
Die ersten zehn Lebensjahre spielten sich sommers in einem Gartenhaus vor der Stadt ab, winters im berühmten „Buddenbrookhaus“. 1881 wurde das neue, prunkvolle, den großbürgerlichen Ambitionen der Gründerzeit entsprechende Haus in der Beckergrube bezogen. Von dort war es nicht weit zur Börse, zum Stadttheater und zur Trave, wo die Speicherhäuser der Firma standen, und zum Hafen mit seinen Handelsschiffen, die nach Skandinavien und ins Baltikum, nach Bergen, Riga, Helsinki oder St. Petersburg ausliefen. Als Achtzehnjähriger beschreibt Heinrich Mann die Szenerie in der Manier Heinrich Heines einer imaginären jungen Dame: Halten Sie sich nicht das Näschen zu, mein Fräulein, wenn Sie, zum ersten Male die Straßen meiner geliebten Vaterstadt durchschreitend, durch den in einigen derselben herrschenden, Fremde mehr oder weniger beleidigenden Unwohlgeruch unangenehm berührt werden sollten. Das ist nämlich kein gewöhnlicher Gestank, das ist ein Gestank, wie ihn nicht jede Stadt besitzt, das ist ein Millionengestank. (32) In diesen Gassen, „Twieten“, „Gruben“ und „Gängen“ gab es für den Knaben verbotene Bereiche mit Unwohlgerüchen anderer Art als vom Handel und Fischfang, die Millionen einbringen, Gassen etwa mit armseligen Behausungen, Kneipen und Spelunken in der Art des „Blauen Engel“. Deshalb war der erlaubte Straßenbereich für Alleingänge genau abgesteckt: Die Straße reichte für einen kleinen Jungen vom Krämer Dreifalt bis zum Hotel Duft. Weiter reichte sie nicht, weil sie verboten war und in fremde Bereiche führte. (33) Größere Ausflüge waren nur im Kreis der Familie oder an der Hand des Vaters üblich. Mit ihm durch die Straßen zu gehen, war eine meiner schärfsten Übungen hinsichtlich der Grüße, die ich, je nach Würdigkeit der Person, zu erwidern oder vorwegzunehmen hatte. Mit ihm im gemieteten Zweispänner über Land zu fahren, war ein Fest. Die großen Bauern erschienen auf den Türschwellen, wir wurden bewirtet, und alles Getreide ging dabei in seine Speicher über. Das ungemeine Ansehen, das der Vater als Steuersenator genoss in der Stadt und dem kleinen Staat, dem sie vorstand, brachte allerdings auch viel Schmeichelei mit sich, sogar für den Sohn; auch Unaufrichtigkeiten, sie entgingen schon dem Halbwüchsigen nicht. (34)Die Gehobenheit des Elternhauses bedeutete für das Kind zugleich eine traurige Einengung seines Lebenskreises, das Zimmer ersetzte Spielplätze, aber nicht weniger als seine Fibel beanspruchten es die Kornsäcke, die auf Leiterwagen vorüberrasselten (35). Man ist viel mit sich allein, beobachtet die Umwelt aus einer melancholisch stimmenden inaktiven Haltung heraus und verliebt sich in Bücher (36), man knüpft eine altkluge Freundschaft mit dem Oberkellner im Hotel Duft an, mit dem auf der Schwelle des Hotels … die menschlichsten Gespräche geführt werden, in deren Erfolg man eine Schaumrolle versprochen bekommt. (37) Die Freundschaft mit dem gleichaltrigen stolzen, verschlossenen Carl, Sohn einer schönen, verarmten, fremdartig lebenden Dame, der Fürstin, die man heimlich anbetet, wird von den Eltern nur zögernd geduldet und findet ein plötzliches unerwartetes Ende damit, dass der Hauswirt die seltsame Frau, die überall die Rechnung schuldig bleibt, einfach hinauswirft. (38) Der Tuchhändler bedient die Mutter völlig anders als eine ärmere Frau, die neben ihr vor den Ladentisch trat. Er hatte für diese Kundin nicht dieselbe Rücksicht und Geduld, wies sie mit einer geringschätzigen Kopfbewegung an eine unfreundliche Verkäuferin und ließ auch vom Preis nichts nach. Meine Mutter dagegen durfte mit ihm handeln, er begleitete sie trotzdem bis zur Tür. (39)
Im Progymnasium, der Privatschule eines Dr. Huttenius, entsteht eine gewisse Solidarität mit Gleichaltrigen über soziale Unterschiede hinweg; sie sind beiderseits arme Teufel, hart geplagt mit übertriebenen Hausaufgaben und tagtäglich einem anderen Verderben ausgesetzt, und sie verbindet die Feindschaft gegen die Gymnasiasten, so dass man in absurdem Trotz immer Huttenianer bleiben möchte. (40) Dem „Schüler der 4ten Classe“ werden das Betragen mit „Gut“, „Aufmerksamkeit, Häuslicher Fleiß und Fortschritte“ mit „im Ganzen gut“ bewertet. In allen Fächern erhält er die Zwei, Tendenzen zur Drei fallen in Biblischer Geschichte und Geografie auf, im Rechnen zur Eins. (41) Den Geschwistern gegenüber entwickelt der Älteste, nachdem er eine Zeitlang Einzelkind gewesen ist, einen unbeugsamen Rechtssinn, gelegentlich größerer Nachsicht der Mutter mit dem jüngeren Thomas gekennzeichnet vom Bewusstsein erlittenen Unrechts und der eigenen Unangreifbarkeit. (42) Eine kleine Spielzeuggeige, die ihm gehört, aber regelmäßig, während Heinrich zur Schule geht, von Thomas benutzt wird, bis sie zerbricht, verursacht eine Vertrauenskrise: Eifersucht quälte ihn, denn ihre Mutter schützte nicht ihn, sondern den anderen. Sein Sinn für Gerechtigkeit war beleidigt in seiner eigenen Person, wo er bei jedem am sichersten zu beleidigen ist. (43) Die erzieherische Hand der Mutter wird deutlich, ihre ausgleichend gemeinte höhere Gerechtigkeit legt dem Jungen nahe: Es sei kindisch, sei nutzlos und trage zum Glück nichts bei, besitzen und nicht mitteilen zu wollen. Aber sie sät ahnungslos auch einen Widerspruch, der ihn frühzeitig Skepsis gegen die Bürgerwelt lehren soll: Den Erwachsenen traute er zu, sie wüssten dies und handelten anders. (44) Erfahrungen auf Geschäftsgängen an der Hand des Vaters und Erziehungsprinzipien der Mutter entwickeln Heinrich Manns feines Gespür für die Doppelbödigkejt bürgerlicher Moral.
Die isolierende Wirkung so exponierter Eltern, die für Kinder empfindliche Zurücksetzung, die sich hinter jeder sozialen Sonderstellung verbirgt, entwickeln in dem Heranwachsenden eine vergrübelte, zwischen Aggressivität und Resignation pendelnde Gefühls- und Gedankenwelt. Meine Gedanken waren meist kühn und trotzig, wenn sie nicht gerade mutlos und besorgt waren. (45) Der Hang zu Beschäftigungen, bei denen man stundenlang allein sein kann, begleitet von hochfliegenden Fantasien, beispielsweise Feldherr zu sein und eine Hauptstadt zu erobern (46), prägt sich aus. Beflügeln mochte solche Träumereien der Siegestaumel nach 1871 mit dem Glorienschein um Wilhelm I. und Bismarck, von dem Heinrich eine Figur besaß, in Kürassieruniform, aber stark verkleinert und auf Pappe gezogen, zum Gebrauch des Puppentheaters (47). Doch der Widerspruch zwischen fantastisch bunt belebter Innenwelt und eintöniger, mit bürgerlicher Leistungsforderung drohender Umwelt bereitet auch den später wesentlichen Gegensatz von Kunst und Leben vor, der erste erotische Erlebnisse überschattet. Verehrung für ein Mädchen mischt Anspruch und Minderwertigkeitsgefühl: Ich indes sann darauf, sie aus Lebensgefahr zu retten, während ich zugleich jeden anderen ihrer würdiger hielt.(48)
Der Dreizehnjährige darf in den Sommerferien 1884 die oft missmutig stimmende Enge seiner Heimatstadt verlassen und an Bord des Schiffes „Newa“ nach St. Petersburg reisen, um dort Tante Olga und Onkel Gustaf Sievers (in den „Buddenbrooks“ das Ehepaar Tiburtius) zu besuchen und die betriebsame, großzügig angelegte und an Kunstschätzen reiche russische Metropole kennenzulernen, wo der Vater gute Geschäftsbeziehungen unterhält. Diese erste „Bildungsreise“ Heinrich Manns vom 5. Juli bis 3. August 1884 regte ihn nicht nur zu ausführlichen brieflichen Berichten an die Eltern an, sondern auch zu einem Tagebuch, das nach sorgfältigster Führung zwei Jahre später grammatisch und stilistisch durchkorrigiert und mit einem Nachtrag versehen wurde. (49) Mein Tagebuch führe ich ganz sorgfältig, und kann ich dann zu Hause hoffentlich Euch alles vorlesen, meldet er am 17./29. Juli den Eltern. Aber neben dieser praktischen Absicht, hinter der auch ein elterlicher Auftrag vermutet werden kann, darf in dem Tagebuch auch eine erste schriftstellerische Bemühung gesehen werden, denn zwischen der Niederschrift und ihrer Überarbeitung liegt die 1885 geschriebene Novelette „ Apart“. (50)Sonnabend, den 5. VII. 84 fuhren wir von Lübeck ab und hatten den ganzen Nachmittag und Abend sowie auch den nächsten Vormittag am Sonntag äußerst ruhiges Wetter. Am Sonntag Nachmittag bekamen wir etwas Wellenschlag, der jedoch bald wieder nachließ. Der Reisende beobachtet entgegenkommende Schiffe, notiert Namen und Heimathafen, beschreibt die Wetterverhältnisse mit Ausdauer und berichtet den Eltern stolz, dass er auf der ganzen Fahrt von Lübeck nach hier gar nicht seekrank geworden ist. Sehr beeindruckt hat ihn die Ankunft in der frühabendlichen Hafenstadt: Auf der Fahrt von Cronstadt nach Petersburg lag hinter uns das weite Meer, vorne aber und an beiden Seiten hatten wir Land in Sicht! Um 6 Uhr konnten wir die Stadt Petersburg ganz deutlich erkennen; die goldenen Kuppeln der Isaaks Kirche leuchteten wunderschön im Schein der untergehenden Sonne. Und die Eltern erfahren: Gestern abend um 7 Uhr bin ich glücklich hier angekommen. Onkel Gustaf war schon am Hafen, als das Schiff anlangte und erkannte mich gleich, wie ich beim Capitain auf der Commandobrücke stand. Man fährt sogleich mit ihm in einem Wagen … auf die Datsche nach Pargala zu Tante Olga, und der Weg erscheint ungefähr so weit wie der von Lübeck nach Travemünde, wohin sonst in den Ferien gefahren wurde. Der Gymnasiast stellt zufrieden fest, dass er schon etwas russisch lesen kann, da die russische Schrift sehr viel Ähnlichkeit mit der griechischen hat, und datiert fortan seine Aufzeichnungen zusätzlich nach dem russischen Kalender. Der Sommer ist in den nächsten Tagen trotz der nördlichen Lage recht heiß. Wir setzten uns daher in einen Iswoschtik, wie hier die kleinen, leichten Einspänner genannt werden, und Onkel Gustaf kutschierte selbst. Der Onkel verbindet Geschäftliches in Petersburg mit einer Stadtbesichtigung. Dort angekommen, fuhren wir mit einem kleinen Dampfboot die Newa herauf und konnten auf dieser Fahrt die vielen herrlichen Paläste am „Palais-Kai“ bewundern. Besonders gefiel mir der Palast des Großfürsten Constantin, welcher, ganz aus Marmor gebaut, neben dem Winter-Palais des Kaisers steht. Wir fuhren zuerst in Onkel Gustafs Geschäft, wo ich mich, solange dieser zu thun hatte, mit Briefe schreiben und Lesen beschäftigte. Den stärksten Eindruck empfängt er von der Casanschen Kirche, welche nach dem Muster der Peterskirche in Rom erbaut ist. An beiden Seiten stehen viele Säulen von einer ungeheuren Dicke und Höhe. Ebenso imponiert ihm die Architektur der Isaakskathedrale mit ihrer vergoldeten Kuppel: Schon vor dem Eingange stehen Säulen aus dem herrlichsten Malachit. Noch im Alter erinnert sich Heinrich Mann der für ihn damals ungewohnten Proportionen: „Umarme die Säule!“, sagte mein Onkel auf den Stufen der Isaakskirche. Als ich meine Arme an sie gelegt hatte, fasste ich von ihrem Umfang so gut wie nichts. (51) Fremdartig berührt ihn, den protestantisch erzogenen Jungen, das prachtvolle Innere der Kirchen mit den Szenen orthodoxer Liturgie: In der Kirche sieht man überall Heiligen- und Muttergottesbilder; und vor jedem werfen sich die Leute nieder, bekreuzigen und besegnen sich. Als wir dort waren, wurde gerade geräuchert. Dies geschah mit silbernen Gefäßen, welche von den Popen geschwenkt wurden. Dazu sangen diese Priester einen schrecklich monotonen Gesang, der einen zum mindesten melancholisch stimmen konnte. Ein anderer Besichtigungstag gilt der berühmten Ermitage: Mächtige Vasen aus schönen sibirischen Steinen, viele Bildsäulen der Kaiser und Kaiserinnen, endlos viele ausgegrabene pompejanische Sachen und vor allem eine fast zahllose Menge prachtvoller Bilder aus der holländischen, italienischen, spanischen, russischen Schule, u. s. w. Immer wieder, wie schon in den Kirchen, schenkt er den kostbaren Baumaterialien besondere Beachtung. Am besten gefallen ihm jedoch die Reliquien Peters I.: Er selbst sitzt, in Wachs nachgebildet, in den Kleidern, welche er sterbend angehabt hat, auf einem Throne mit blauseidenem Baldachin. Sein Pferd, namens Pultawa, steht ausgestopft ihm gegenüber. Seine verschiedenen Spazierstöcke sind ebenfalls aufbewahrt, unter ihnen ein eiserner, mit welchem er abends ganz allein ausging.
Zwischendurch werden einige Tage auf der Datsche in Pargala verbracht, wo sich leichterer Zeitvertreib mit Lektüre und Schreiben verbinden lässt: … ich arbeitete, las, spielte Dame u. Mühle und ging mit Tante Olga und O(nkel) G(ustaf) spazieren. Bekanntschaften mit gleichaltrigen Jungen bleiben äußerlich und kühl: Nach dem zweiten Frühstück und den Schularbeiten folgt die übliche Ausfahrt zum Grundstück einer mit dem Onkel bekannten Familie. Hier machte ich mit Eugene de Rossi Bekanntschaft, spielte mit demselben und machte Thurnübungen bis ungefähr 3 Uhr. Oder es wird geangelt: Ich fing einen ganz schönen, ziemlich großen Fisch, welcher aber leider beim Ausdemwasserziehen wieder in dasselbe zurückfiel. Der Nachtrag vom 14. Mai 1886 schließt: Morgens 6 Uhr kamen wir in Lübeck an. Papa war verreist, Mama überraschte ich noch im Bette. ---
So waren diese schönen und genussreichen Ferien nun beendet; mit dem nächsten Tage, Montag, begann das neue Schul-Vierteljahr. Die mittlere, wohlhabende Gesellschaftsschicht bleibt der Blickwinkel dieses gewissenhaften, mitunter possierlich steifen Schülerberichts. Von den ungeheuren sozialen Gegensätzen des zaristischen Russland vermittelte höchstens die verzweifelte Religiosität in den Kirchen eine dunkle Ahnung. Schon die Erwähnung der Bettler davor wäre nicht schicklich gewesen. Viel wichtiger schien vor der Börse ein Portier in langem, schlarlachrotem Mantel, mit Gold besetzt, welcher in der Hand einen langen Stock mit messingnem Knopf trägt. Diesen stößt er, sobald ein Herr in die Börse tritt, auf die Erde. Die tiefgreifende Zerrüttung der Gesellschaft im Petersburg Dostojewskis musste ihm noch verborgen bleiben. Später, nach den gewaltigen revolutionären Veränderungen, mit denen er sich in zunehmendem Maße identifiziert, gedenkt Heinrich Mann nochmals dieser frühen Bekanntschaft mit der Stadt der Oktoberrevolution: In dem ehemaligen Sankt Petersburg bevölkert eine gleichförmig mittlere Menge den Newa-Prospekt, der alles andere als bescheiden ist. Das Winterpalais, schwer und feierlich wie je, die Ermitage, deren mächtige Quadern behaupten: Auch wir! Auch wir sind Europa, einige der höchsten Kunstwerke unseres Erdteiles sind hinter diese Mauern gerettet. Sie sind nunmehr Volksbesitz.
Anzunehmen ist, dass die Säle am Sonntag von ihren Besitzern übervoll sind. Sie waren einsam, als ich, mit dreizehn Jahren, hineingeführt wurde. Mehr als die Rembrandt interessierten mich damals der Schlitten Peters des Großen und der goldene, radschlagende Pfau, den Mentschikoff seiner Zarin gewidmet hat. Kommt eins nach dem anderen …
Leningrad, die erste Kapitale, die das junge Kind einer alten deutschen Kleinstadt voreinst besucht hat, bleibt ihm nach langen Zeiten die überlebensgroße Erinnerung. (52)
Anmerkungen
1 Vgl. Thomas Mann, Buddenbrooks, Berlin und Weimar 1969.
2 Zit. nach HMWL, S. 5.
3 Ebenda, S. 5f.
4 Thomas Mann, Buddenbrooks, a. a. O., S. 495. Vgl. Heinrich Manns autobiografische Skizze in Albert Langens Verlagskatalog 1894–1904, München 1904, S. 92: Man kennt meine Herkunft ganz genau aus dem berühmten Roman meines Bruders.
5 Thomas Mann, Buddenbrooks, a. a. O., S. 324ff.
6 GW 9, S. 209.
7 GW 9, S. 210.
8 GW 24, S. 11.
9 AW XII, S. 31.
10 Über die Familiengeschichte vgl. Viktor Mann, Wir waren fünf, Berlin 1975, S. llff.
11 AW IX, S. 11, 19f.
12 Viktor Mann, a. a. O., S. 14.
13 AW IX, S. llf.
14 HMA SB 47/2, zit. nach HMWL, S. 7.
15 AW IX, S. 13.
16 GW 24, S. 219.
17 AW IX, S. 14.
18 AW IX. S. 12.
19 HMA SB 1/7, zit. nach HMWL, S. 43.
20 GW 9, S. 199. Über den autobiografischen Bezug in „Eugénie oder Die Bürgerzeit“ vgl. auch Elöd Halász, Buddenbrooks und Eugénie, in: Arbeitshefte, S. 74.
21 AW IX, S. 11.
22 Viktor Mann, a. a. O., S. 16.
23 Ebenda, S. 17.
24 Veröffentlicht im Südverlag Konstanz 1958.
25 AW IX, S. 9.
26 AW IX, S. 8f.
27 GW 9, S. 191.
28 AW IX, S. 11.
29 Thomas Mann, Buddenbrooks, a. a. O., S. 140. Vgl. auch die Begegnung Thomas Buddenbrooks mit dem mecklenburgischen Junker, a. a. O., S. 470f.
30 Viktor Mann, a. a. O., S. 14.
31 GW 24, S. 218. Vgl. Thomas Mann, Buddenbrooks, a. a. O., S. 524f., wo der Senator den kleinen Hanno nach den Namen der zur Firma gehörenden Speicher und nach allen Nachbarn fragt, sowie „Eugénie oder Die Bürgerzeit’’, GW 9, S. 199, wo Konsul West seinem Sohn ähnliche Fragen stellt.
32 Heinrich Mann, Fantasieen über meine Vaterstadt L., zit. nach HMWL, S. 12.
33 AW IX, S. 34.
34 AW IX, S. 12f.
35 AW IX, S. 34.
36 AW IX, S. 19f.
37 AW IX, S. 35.
38 AW IX, S. 36ff.
39 AW IX, S. 49.
40 AW IX, S. 14.
41 HM A 511.
42 AW IX, S. 17.
43 AW IX, S. 18.
44 AW IX, S. 19.
45 AW IX, S. 14.
46 Ebenda.
47 GW 24, S. 180.
48 AW IX, S. 14.
49 HMA 465, 553, 723, 725, auszugsweise veröffentlicht in HMWL, S. 18ff. Die Zitate folgen der überarbeiteten Fassung von 1886.
50 Vgl. HMWL, S. 27ff.
51 GW 24, S. 213.
52 Ebenda.
2. Bürgerzeit
Was das neue Schul-Vierteljahr auch gebracht haben mochte – die wesentlichen Bildungsimpulse für Heinrich Mann können von dort nicht ausgegangen sein. Die Unterrichtsführung eines Professor Unrat und die blutrünstige Schneidigkeit eines Kühnchen im „Untertan“ lassen durch die satirische Zeichnung bestimmte Grundtypen von Lehrern erkennen, die zusammen mit den Wulicke, Hückopp und Mantelsack aus Thomas Manns „Buddenbrooks“ das Schulwesen im damaligen Lübeck zu prägen begannen. Mit einer Überbetonung altsprachlicher Fächer, in denen ein beträchtliches Quantum an Wissensballast auswendig zu lernen war, ging eine von Preußen her zunehmend beeinflusste Erziehung zu absolutem Gehorsam bis ins Absurde einher, die sich auf Kants „kategorischen Imperativ“ berufen zu dürfen glaubte. Der frühe novellistische Versuch Heinrich Manns, „Beweise“, zeigt einen solchen Gymnasiallehrer im Privatleben in der kläglichen Rolle des betrogenen Ehemannes (1), und später schildert die meisterhafte Novelle „Abdankung“, wie das Pathos des Kadavergehorsams auf die Schülerschaft übergreift und einem Knaben zum Verhängnis wird.
Das Elternhaus und die gebildete Großmutter verfügten über weitaus tiefer dringende Anregungen für die geistige Entwicklung. Die Mutter las den Kindern vor, Romantiker – Fouqué, Brentano und Arnim (2) –, und spielte Klavier, „gerade ein wenig zu gut für eine Dame in ihrer Stellung, und sang fremdländische Lieder, die lieblich, aber auch verfänglich klangen“ (3). Sie musizierte mit dem Ersten Kapellmeister des Stadttheaters. Das romanische Temperament dieser Frau – „Schmelz und Feuer ihres Blickes hatten schon den Stich ins Skandalöse“, wie Thomas Manns ältester Sohn Klaus noch wissen will (4) – bedeutete der Biederkeit Lübecks etwas Ungewöhnliches und machte den ältesten Sohn frühzeitig, mehr noch und nachhaltiger als seinen Bruder Thomas, empfänglich für die Anziehungskraft Italiens und Frankreichs.
Die Orientierung nach Frankreich wurde auch durch den Vater angelegt. Der spätere Senator Mann reiste als junger Mensch um 1860 von Amsterdam nach Frankreich und gebrauchte die Kur in Pau am Fuß der Pyrenäen, eben in dem Ort, wo Heinrich Mann 1925 seinen Henri Quatre für sich als Romanstoff entdecken wird. (5) Von dieser Reise bewahrte sich der Vater das Interesse für Neuheiten der französischen Literatur bis in eine Zeit, in der es verdächtig machte: 1885 musste mein Vater um den Band Zola einen Schutzumschlag tragen, die Leute hätten ihm den Autor verdacht. (6) Auch die „Buddenbrooks“ kennen diesen in Lübeck befremdenden Zug in den geistigen Interessen des Getreidehändlers: „Er sprach ein mit spanischen Lauten untermischtes Französisch und setzte jedermann durch seine Liebhaberei für gewisse moderne Schriftsteller satirischen und polemischen Charakters in Erstaunen.“ (7)Heinrich Manns spätere Briefe an den Vater 1889/90 (8) zeigen, dass er ihn als Gesprächspartner in literarischen Fragen sehr ernst nimmt und mit lebhaftem Interesse rechnen darf.
In seinen politischen Auffassungen hatte der Vater seine hanseatisch-republikanische Mitgift, die auch leicht das Pfahlbürgertum vieler seiner Lübecker Geschäftsfreunde hätte erzeugen können, durch die Kenntnis der Niederlande, einer konstitutionellen Monarchie mit alten bürgerlich-demokratischen Traditionen, erweitert. In Lübeck war man geneigt, die Revolution von 1848 zu einem, wenigstens was die eigene Stadt betraf, untauglichen Aufruhrversuch der „Kanaille“ abzuwiegeln, ihren Ideen von demokratischer Reichseinheit aber allenfalls resignierend nachzuträumen. Die etwas belustigte Nonchalance, mit der Heinrich Mann achtzehnjährig der Ereignisse von 1848 gedenkt, steht der Darstellungsweise in den „Buddenbrooks“ nicht fern und gibt in noch unentschlossener Ironie Meinungen aus damaligen Lübecker Bürgerkreisen wieder. Lediglich ein grimmiger Unterton und die textliche Nachbarschaft des Millionengestanks und des Tabacks- und Branntweinmonopols schaffen Distanz: … gewiss sehr anregende Gesprächsstoffe, bei deren Behandlung jedoch seinerzeit den Großvätern der jetzigen L’er Generation recht unangenehme Dinge passiert, wovon auch noch jetzt ein steinerner Klotz beredtes Zeugnis ablegt, der genau an der Stelle steht, wo in jener schlimmen Zeit ein wackerer L’er Bürger, der seiner patriotisch-politischen Begierde etwas zu unvorsichtig die Zügel hatte schießen lassen, zum großen Schrecken seiner sämtlichen Mitbürger wie seiner selbst füsiliert wurde. (9)
Zum Kanzler Bismarck und seiner Einigung unter preußisch- junkerlicher Hegemonie verhielt sich der repräsentative Teil der Lübecker Bürgerschaft jedoch ebenfalls skeptisch: Man hielt noch keinen Könner für unfehlbar, wie später jeden Nichtkönner, sobald er an der Macht war. (10) Man verfolgte Bismarcks Politik mit dem Interesse, das ihre Aktualität forderte, und war bereit, ihre geschäftlichen Vorteile zu akzeptieren, aber ein Unbehagen an ihrer herausfordernden Selbstsicherheit konnte man kaum verbergen: Mein Vater, ein Kaufmann, der den Freistaat Lübeck zum guten Teil regierte, denn er verwaltete die Abgaben, las die Zeitung: eine neue Rede des Fürsten. Sie sollte lange in aller Mund bleiben, besonders der Satz: „Wir Deutsche fürchten Gott, sonst nichts in der Welt.“ Senator Thomas Heinrich Mann war skeptisch wie sein Jahrhundert. Er schnob die Luft aus und meinte leichthin: „In Wirklichkeit fürchten wir manches.“ Dies mit Zärtlichkeit für den gewagten Ausspruch und seinen Urheber. (11)Im gleichen Atemzug mit dieser Erinnerung an das politische Klima seines Elternhauses gesteht Heinrich Mann, dass er selbst diesen abwartenden Standpunkt des Vaters nicht teilte: Der Knabe, der ich war, las über die Schulter des Vaters mit. Er hat gedacht: „Wahr oder nicht, es ist gut gesagt.“ … Ungefähr fünfzehn Jahre später betrachteten mein Bruder und ich die beiden Erscheinungen des abgelaufenen Jahrhunderts, Napoleon und Bismarck. Ich gab Bismarck den Vorzug. Mein Bruder bezweifelte es, und ich wusste, dass meine Meinung angreifbar war (12). Noch der Autor der Romane „Der Untertan“ und „Der Kopf“ verurteilt Wilhelm II. als den Herrscher, der Bismarck entließ, in „Der Kopf“ tritt der Kaiser in der Frage der Kriegsschuld sogar weit hinter seine unfähigen Kanzler zurück, und noch in der abschließenden Wertung des „Zeitalters“ will der alternde Romancier die relative soziale Sicherheit seiner Jugendjahre als Verdienst Bismarcks verstanden wissen: Er hat, von 1875 bis 1890, den Frieden nicht nur erhalten, ihn auch stark gemacht. Dank dem Fürsten ist der Friede, dessen seine Nachfolger schlecht achteten, noch fünfundzwanzig Jahre fähig gewesen zu dauern, gegen Übermut und bösen Willen (13) Freilich macht Heinrich Mann für dieses eigentümliche Festhalten am frühzeitig gebildeten Urteil über Bismarck eine wesentliche Einschränkung selbst, indem er dessen Feindschaft gegen die Arbeiterbewegung nicht berührt.
Wahr oder nicht, es ist gut gesagt, denkt der Gymnasiast über die selbstherrlichen Worte des zweifelhaften Helden der Reichseinigung: Künstlerisches Interesse überwiegt vorerst das echt politische. Früh hat er Anregungen für künstlerische Neigungen empfangen. Das Lübecker Theater lag wie die Börse, aus seinem Zimmerfenster sichtbar, nahe der Stadtwohnung. Die Börse hatte nur Bedeutung für den Vater: Oft stand er mit vielen anderen Herren auf dem Bürgersteig, bevor wir zu Mittag aßen. Die Börse war vorhanden, damit Papa von dort zum Essen kam (14) Viel heftiger wurde die Fantasie des Kindes durch das Theater und den Schauspieler Gewert in Anspruch genommen, der gegenüber wohnte. Das Kindermädchen Mine verwies auf gewisse Abendstunden, wenn ich schon schliefe. Dann werde das Theater mit Gas beleuchtet, wer schon groß sei, dürfe hineingehen, und es geschähen dort Dinge (15) Der erste Theaterbesuch bringt ihm Spiel und Wirklichkeit so perfekt durcheinander, dass er den Namen des Schauspielers laut durch den Zuschauerraum ruft. (16) Zu den Spielen mit Carl, dem Sohn der Fürstin, die als ehemalige Sängerin auf den Knaben großen Eindruck macht und später im Roman „Der Kopf“ wieder auftauchen soll, gehört außer einem Kaufladen ein Puppentheater, auf dem ihm Carl beharrlich vorspielt, wie der Hausbesitzer die Miete eintreibt. (17) Das Gegenüber von Börse und Musentempel wirft seinen Schatten auf frühe Kinderspiele. Solche Eindrücke stimulieren erste Schreibversuche: Fragen wir das Kind, das schon schreibt. Es kennt Märchen und es versucht, selbst eins zu machen. Warum nur? Es hatte auch Zehnpfennighefte, worin sowohl das Käthchen von Heilbronn wie Aschenbrödel für das Puppentheater bearbeitet waren. Aber das Kind unternimmt nicht ohne Erregung, ein neues Stück zu schreiben. Es könnte sich die Mühe doch sparen, besonders da zum Schluss keine reine Befriedigung bleibt. Die Erregung war glücklicher als das Erreichte. Dies seine früheste literarische Erfahrung. (16) Die Besuche im Lübecker Stadttheater, das sich nicht von den üblichen Provinzbühnen unterschied, die später in der Novelle „Schauspielerin“ und im Roman „Die Jagd nach Liebe“ eine Rolle spielen werden, fanden eine Ergänzung im Sommertheater Tivoli, einer noch anspruchsloseren Bühne vor der Stadt, die weniger Kunstgenüsse als Affären lieferte. Durch Onkel Friedel, den Christian der „Buddenbrooks“, blieb die Familie Mann davon nicht unberührt, und eine frühe titellose novellistische Skizze erwähnt einen Onkel des Autors, der über die scandalöse Geschichte von der X. sehr andere Ansichten äußert als die biederen Bürger. (19)Er unterschied sich freilich von ihnen vorwiegend durch geringeren Eifer, seine Affären zu verbergen. Diese Zwiespältigkeit des Bürgers gegenüber der Kunst und den Künstlern gehört ebenfalls zu den sehr frühen Eindrücken Heinrich Manns. Er ahnt den waren Charakter der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft, wenn er erlebt, wie der Bürger besonders Schauspielerinnen erst sozial, dann moralisch degradiert, um sich dann über die von ihm selbst genährte Prostitution zu entrüsten. Welch’ ein bedauerliches Institut! ruft er 1889 über das Lübecker Theater aus. Wer verdient denn etwas dabei? Kaum der Direktor; denn die weit einträglicheren und erfolgreicheren Geschäfte, welche gewisse Damen vom Theater zuweilen mit wohlaccreditierten L’er Herren eingehen, sind viel zu diskreten – Geruches, um hier erwähnt zu werden. (20) Von den Schauspielerinnen Ute („Die Jagd nach Liebe“) und Leonie („Schauspielerin“) über die Künstlerin Fröhlich („Professor Unrat“) bis zum verwachsenen Sänger Tamburini („Empfang bei der Welt“) werden Gestalten Heinrich Manns in vielen Abstufungen diesem ungeschriebenen Gesetz der Bürgerwelt unterliegen.
Genauere Aufschlüsse über die Lektüre geben erst nach seinem Weggang von Lübeck Heinrich Manns Briefe an den Schulfreund Ludwig Ewers. Das schwärmerisch verehrte und dem Freund innig empfohlene Vorbild ist Heinrich Heine. Nimm ein Gedicht von Heine – welches Du willst. Da jagt eine Idee die andere. Bald ist’s ein tiefer philosophischer Gedanke, bald ein leichtes Wortspiel. Immer ist’s poetisch. Vermissest Du jemals Wohlklang? Findest Du überhaupt irgendwo mehr Wohlklang? (21)
Außer der Vorliebe für Lyrik fällt an dieser Huldigung die Betonung der artistischen Qualitäten Heines auf. Der revolutionäre Gehalt dieser Dichtung wird mit der formalen Vollendung noch nicht mitgelesen: Der einzige Dichter, der so glücklich ist, alle meine Ansprüche zu erfüllen, ist Heinrich Heine. Ich liebe ihn also als Dichter und kann ihn als Menschen mindestens nicht verachten; denn seine Schwächen entstammen heißem Blut und kühner Fantasie; und langes, geduldig ertragenes Leiden hat ihn geadelt. (22) Dieses Bild von Heine enthält auch eine Wurzel für die Art, wie Heinrich Mann Realismus versteht. Was sich hier noch unklar artikuliert, wird für die neunziger Jahre folgenreich sein. Nach einem weiteren Bekenntnis zu Heine als dem, der mich gebildet und erst zum Menschen gemacht, der mein einziger Lehrer ist, für den ich volle Achtung und Liebe habe, kommt die Rede auf die „Lazarus“-Gedichte: Welche Kraft in diesem sogen. Pessimismus! „Idealist“ im althergebrachten Sinne bin ich niemals gewesen, denn ich habe mich von Anfang an nach Heine gebildet, der von einem solchen „Idealisten“ nichts an sich hat. Wahrer Idealist ist auch er, wie jeder andere echte Realist; denn das höchste Ideal ist die Wahrheit; ein Ideal, das mit allen anderen Idealen vornehmlich auch das gemeinsam hat, dass es ohn’ Unterlass verfolgt und verleumdet wird. (23) Etwa gleichzeitig unterscheidet Heinrich Mann im modernen Realismus bereits einen deutschen oder französischen und macht den deutschen Realisten, den Alles mit platter Natürlichkeit „porträtierenden“ Fotografen, als Naturalisten kenntlich, während er dem französischen zugesteht, dass er bei allem Streben nach Wahrheit die Schönheit nie aus dem Auge verliert. (24)
Diese privaten literaturkritischen Auslassungen kolportieren noch, was Heinrich Mann in Zeitschriften gelesen hatte. Aber sie enthalten auch Überlegungen, in denen die Keime zu persönlichen geistigen Entscheidungen späterer Jahre liegen: In diesen Überlegungen liegen Keime zu vielem: rein ästhetisch motivierte Abneigung gegen den Naturalismus und Bevorzugung der französischen Literatur, obwohl dort gerade ein großer Naturalist am Werk ist, Zola, den Heinrich Mann aber viel später entdecken wird, aber auch ein idealistischer Rationalismus, in dessen Folge Heinrich Mann der Kategorie des Geistes in Identität mit Vernunft bis zuletzt den Vorrang gibt.
Das anfangs überwiegend lyrische Interesse (25) des jungen Literaten musste durch eine Erscheinung berührt werden, die im kulturellen Leben seiner Heimatstadt Aufsehen erregte: Der 1815 in Lübeck geborene Dichter Emanuel Geibel war nach langen Reisejahren in seine Geburtsstadt zurückgekehrt und starb dort 1884. Sein Ebenbild begegnet in „Eugenie oder Die Bürgerzeit“ als ein sehr von sich eingenommener poetischer Scharlatan. Dieser von Anhängern als „silberner Klassiker“ angesehene Epigone avancierte 1870/71 mit der hohlen Politesse seiner nationalistischen Verse zum Modedichter des junkerlich-bourgeoisen „Reiches“, zum „Reichsherold“, und die Stadt Lübeck stiftete ihm ein Denkmal. Geibels Werke befinden sich zwar, wie es sich gehörte, in der kleinen, anwachsenden Bibliothek Heinrich Manns neben Lenau, Bürger, Platen, Scheffel, Storm, aber dieses Geibel-Denkmal versetzt ihn, dem der noch immer denkmallose Heine ungleich selbstverständlicher sogar als Schiller und Goethe (26) ist, in grimmigen Ärger:
Ihr wollt Ihm kein Denkmal setzen,
Ihr lieben, braven Leut’?
So dumm, wie ihr wart, als Er lebte,
So dumm seid ihr noch heut.
Ihr habt euch stets nur wenig
Beschäftigt mit Literatur,
Drum habt ihr auch vom Verständnis
Der Dichter keine Spur.
Man setzt, um ihn nicht zu vergessen,
Ein Denkmal manch’ elendem Wicht,
Doch ist das bei Ihm nicht nötig –
Einen Heine vergisst man nicht! –
Geschrieben 1888. (27)
1931 wird Heinrich Mann sich für ein Heine-Denkmal in Düsseldorf einsetzen: Er ist das vorweggenommene Beispiel des modernen Menschen. Er hatte schon damals die uns gewohnte Geisteshaltung, er war sachlich bei aller Fantasie, scharf zugleich und zärtlich, ein Zweifler, doch tapfer (28)
Ganz dem „Buch der Lieder“ und anderen Dichtungen seines Lehrmeisters nachempfunden sind die Verse, die Heinrich Mann selbst seit 1887 verfasst.
Lied.
Der Morgen war so liebeslind,
Der Tag schließt schmerzensschwül –
Und was mit Tändelei beginnt,
Das endet mit Gefühl.
Was weinest Du, mein blasses Kind?
Das ist das alte Spiel.
Bald hat’s ein End’.
Bald Der Tag verrint.
Ist es aus.
Die ewige Nacht ist kühl.
14. Januar (18)90 (29)
Die ihm am gelungensten erscheinenden Arbeiten sammelt er unter dem Titel „Im Werden“ und bietet sie zur Veröffentlichung an. M. G. Conrad, Redakteur der Zeitschrift „Die Gesellschaft“, schreibt ihm zu dem Gedicht „Geh’ schlafen“: „Das Gedicht ist eine gute Talentprobe. Ich nehme es mit Dank für die „Gesellschaft“ an.“(30) R. Zoozmann bescheinigt ihm neben formalem Können eine „nicht gewöhnliche Begabung“, gibt aber zu bedenken: „Ob der Inhalt dieses oder jenes Liedes nach dem Geschmack vieler Leser sein wird, bezweifle ich ebenso wie Sie es gewiss unparteiisch thun.“ Das Publikum habe „sich an zu monströsen Realisten den Magen gründlich verdorben.“ (31) Zum Druck der begutachteten Gedichtsammlung ist es nie gekommen.
Der zweite Dichter, dem die uneingeschränkte Verehrung des jungen Heinrich Mann gilt, führt ihn, ihm selbst noch unmerklich, der Prosa näher. Kennst Du Theodor Fontane? Er ist mein Leibpoet unter den Neuen. Ich kenne ihn als Kritiker von brillantem, freiem Urteil und als Romancier von Schneid und Geschick. Aber an ‘s Herz gewachsen ist er mir durch seine Gedichte. Herrgott! sind die schön! Die Balladen! Stahl und Stein –, gegen sie sind die gepriesenen Meisterwerke des hochseligen Uhland Gummi. (32) Zu Fontane gewinnt Heinrich Mann allmählich die wohl dauerhafteste und nachhaltigste Beziehung in der deutschsprachigen Literatur. Um die Mitte der neunziger Jahre ist er, als ein Nachfolger Flauberts, größter Romandichter in neuer Zeit. (33). Lange folgt dieser Huldigung keine weitere nach. Aber aus dem französischen Exil wird er als Nachkomme der Hugenotten beschworen, französischer Emigranten in Deutschland, die dazu beigetragen hatten, dass Frankreich und Deutschland immer wechselseitige Einflusssphären behielten. Mit Theodor Fontane dringt der Grundgehalt des französischen Romans in die deutsche Literatur. Es ist nicht bewiesen, dass wir ohne diesen Vorläufer wirkliche soziale Romane hätten. (34) Im kalifornischen Exil hängt über dem Arbeitsplatz das Bildnis Fontanes, die Kreidezeichnung von Max Liebermann.
An Karl Lemke zitiert Heinrich Mann wiederholt den Meister: „Wer alt wird, erlebt alles“