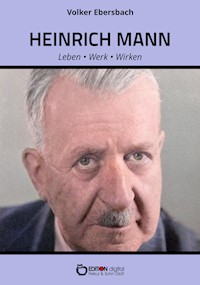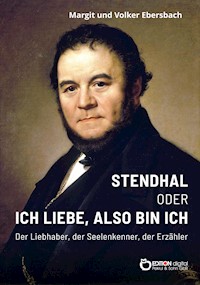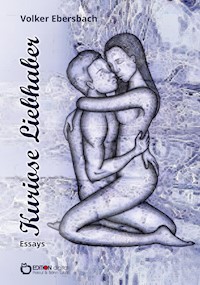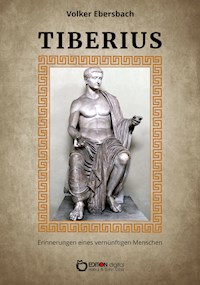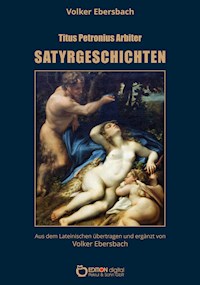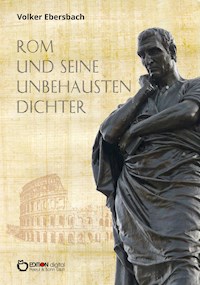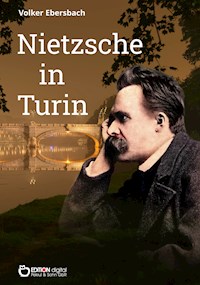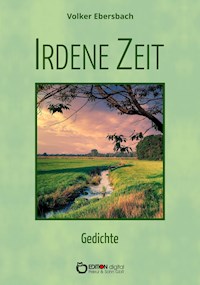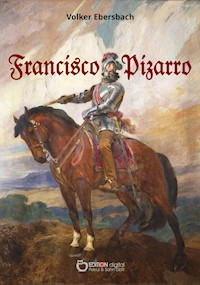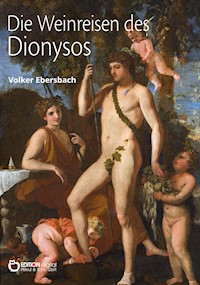9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Drei Jahreszahlen spielen in diesem bemerkenswerten Buch eine wichtige Rolle: 1942, 1949 und 1961. Wie lange kann eine Freundschaft zwischen zwei Jungen halten? Als Siegfried Stufenhauer und Wolfgang Siebensohn, beide Jahrgang 1942 zur Welt und 7 Jahre später, als sowohl die Bundesrepublik als auch die DDR gegründet werden, zur Schule gekommen, glauben sie, dass ihre Freundschaft ein Leben lang dauern wird. Aber dann kommt der 13. August 1961, die Mauerzeit beginnt, und einige Zeit später passiert ein Unglück. War es ein Unfall, war es Absicht? Der TRABANT knattert durch einen Wald, hüpft über Schlaglöcher. Oktobersonne blendet scheinwerfergrell aus mancher Schneise. Hier waren wir noch nie, wundert sich Wolfgang. Ich kenne, sagt sie hastig, da, wo jetzt Sperrzone ist, jeden Weg und Steg. Als ich Kind war, konnte noch jeder hin. Ich habe dir zu Pfingsten eine Stelle gezeigt, von der Kurve zur Burg Kranichstein aus, du erinnerst dich? Ich wusste gar nicht, dass du mit solchen Gedanken spielst. Ich spiele nicht! Es gibt da eine Brücke. Die ist vermint. Mein Vater meint, die nicht. Wir sollten nachsehen. Ich will nicht mehr. Es war eine Schnapsidee. Ach! Diese Frau will dich nicht mehr, nicht wahr? Ich, ich will es nicht! Er brüllt es fast. Sie hat die Katze aus dem Sack gelassen: Es kostet eine Stange Geld. Man muss das abzahlen wie einen Kredit. Ich bin kein Sklave, der sich freikauft oder freikaufen lässt. Ja, ich sah das lockerer in Budapest. Da schien alles leicht, da gab es kein Problem, vor dem ich kapituliert hätte. Der Mief hier, die Unentschlossenheit, deine Eifersucht, das ist alles so lähmend. Die DDR ist irgendwie klebrig. Ist man draußen, wird alles leicht. Drin traut man sich einfach nichts mehr. Du, aber ich trau mich jetzt, ich will jetzt auch raus! Einfach über die Grenze? Du musst verrückt sein. Warum nicht gleich zum Mond, zum Mars, in eine andere Galaxis. Bloß nachschauen, ob die Brücke noch da ist. Es wird eine Fahrt ohne Wiederkehr. Von den beiden Freunden, die sich in dieselbe Frau verliebt hatten, bleibt nur einer am Leben. Wolfgang und Ulrike sterben beim Passieren der Zonengrenze, auf der ein großes HALT-Schild vor dem Weiterfahren warnt. Viel, viel später, VOR DEN TRÜMMERN seines Lebens wird Siegfried Stufenhauer sich fragen, was seine Freundschaft mit Wolfgang Siebensohn zusammenhielt trotz der Belastungen, Krisen, Zerwürfnisse, von denen jedes eine Freundschaft hätte beenden können. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Volker Ebersbach
Kinder des Narziss
Roman
ISBN 978-3-96521-626-6 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 2000 im Heidrun Popp Verlag, Waldsteinberg.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Alle Gestalten dieses Romans sind frei erfunden.
Übereinstimmungen mit wirklichen Personen ergeben sich nur zufällig.
Dieses Buch hat eine lange Geschichte. Ich schrieb daran in den Siebziger- und den Achtzigerjahren.
Nach 1990 förderten es die Stiftung Kulturfonds, das Sächsische Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst und das Schriftstellerhaus Stuttgart.
Dafür hier mein Dank.
VORGESCHICHTE
Im Sommer des Jahres 1941 sagte sich die Kontoristin Gertrud Siebensohn, eine geborene Zscheilitz, das Radio leiser drehend: Krieg mit Russland. Das wird lange dauern. Das wusste schon mein Vater. Der hat einen Russlandfeldzug mitgemacht. Ich will nicht länger warten. Ich möchte ein Kind. Und wiewohl sie nicht sicher war, ob sie ihn liebte und ob sie seine Treue hatte, aber wer prüft das in solchen Zeiten so genau, überredete sie in einem nachweihnachtlichen Urlaub ihren Mann, den Chemiker Kurt Siebensohn, der beim Bodenpersonal eines schwäbischen Flugplatzes als Unteroffizier einen gemütlichen Krieg genoss, ein Kind zu zeugen. Er hoffte auf einen Jungen; sie wünschte sich eine Tochter. Im Februar 1942 verspürte sie erfreut zum ersten Mal das erwartete Unwohlsein.
Im Juli desselben Jahres verbrachte der Maschinenmeister Kurt Stufenhauer mit seiner Frau Viktoria, einer geborenen Gelbke, sonnig-stürmische Urlaubstage in Ostpreußen. Bevor er an die Front abreiste, wo er wenig später im Kessel von Stalingrad eingeschlossen werden sollte, zeugte der Feldwebel mit der schönen, spröden, rötlichblonden Verkäuferin in den Dünen der Halbinsel Hela den Sohn Siegfried, den er dem Führer versprochen hatte.
Als Viktoria in den dritten Monat ihrer Schwangerschaft ging, hörte Gertrud ihren Sohn Wolfgang schon schreien. Wenige Wochen nach Sigis erstem kleinen Schrei brachte die Bauerntochter Martha Herbst, eine geborene Stubenrauch, ihre Tochter Ulrike zur Welt. Der Oberleutnant Kurt Herbst, vor seinem Eintritt in die Wehrmacht ungelernter Landarbeiter und Polizeischüler, kam zu der Zeit in Nordafrika in britische Gefangenschaft.
Er war im September des Vorjahres aus Griechenland zu einer Kriegstrauung heimgekehrt und hatte im Brautbett gesagt: Ich glaube, es ist besser, wenn es ein Mädchen wird. Aber der Braut, die, kinderlos verwitwet, das Bild ihres ersten Mannes noch im Herzen trug, wäre es lieber gewesen, wenn er sich vorgesehen hätte, mitten im Krieg.
Warum ich das erzähle? Ich bin Narziss. Ich lebe, ewig jung, in meinen Kindern, die verflucht sind wie Narziss und Echo. Dir mag es anders gehen: Du bist nicht anders als die meisten Menschen. Du liebst, weil du sterben musst, und du musst sterben, weil du liebst. Ich, Narziss, kenne die Liebe nur als Täuschung. Darum kann ich nicht sterben.
Ich bin unsterblich und wäre doch lieber tot. Schon seit Äonen erzähle ich meine Geschichten. Du hast eben in drei Schicksale geblickt. Der schönsten der Schönen, Aphrodite, die mich verfluchte, die mir mein Spiegelbild zur Falle machte, zur Liebesfalle, zur Todesfälle, habe ich Tausende erzählt. Ich habe erzählt, als ob ich zu ihr betete, und ich habe zu ihr gebetet, als ob ich erzählte. Vielleicht habe ich nicht so geschickt erzählt wie Echo. Echo war eine große Erzählerin, findig und stimmbegabt, bevor ein Fluch ihr das gerade nahm.
Ich glaubte, nur die Göttin der Liebe könne mich, könne uns alle vom Fluch der Gewalt erlösen, indem ich erzähle, was meinen Kindern widerfährt, wenn ich und Echo einander wieder und immer wieder verfehlen in ihrem Herzen. Aber es ist wohl nur ein Stammeln wie Echos Stammeln. Aphrodite schweigt. Ihr Groll währt lange. Sie selbst ist eine Feindin der Gewalt. Mit dem Kriegsgott schläft sie lieber als mit ihrem Gatten.
Meine Geschichte ist bekannt. Zumeist wird sie falsch erzählt. Als hätte Narziss sich in sich selbst verliebt. Dass ich nicht lache! So stellen es sich die vor, die in sich selbst vernarrt sind. Die haben nichts mit mir zu tun.
Es war mein Spiegelbild. Das allerdings ist gleichfalls lächerlich. Ich hatte aber nicht die geringste Ahnung. Darin liegt ein Unterschied. Ich wusste nicht einmal, ob ich ein Mädchen oder einen Jüngling sah. Noch nie war es mir unter die Augen gekommen, das Lichtecho meiner Erscheinung, bevor es eine Quelle mir zum ersten Mal entgegenhielt. Für alles gibt es ein erstes Mal. Für dich ist ein Spiegel das Alltäglichste. Doch lass dich warnen: Sei niemals sicher, dass wirklich du es bist, der dir im Spiegel gegenübertritt.
Alles nahm seinen Lauf, als der uralte weltweise Silen, befragt, ob ich lange leben würde, die Antwort gab: Wenn er sich selbst nicht kennt!
Wir waren durchaus kein ungleiches Paar, Narziss, der Ahnungslose, und die missbrauchte Echo: Kinder der Gewalt, füreinander bestimmt aufs schlimmste, in Flüchen einander zugesprochen.
Leiriope, eine Nymphe, gebar mich, nachdem der Flussgott Kephissos sie beim Bad in seine kalten Arme gezwungen hatte.
Die Nymphe Echo hatte mir die Gabe des Erzählens voraus, und zwar so vollendet, dass sie göttliche Ohren damit bezauberte. Während der Göttervater mit ihren Schwestern neue Nymphen machte, umgarnte sie die Göttermutter mit angenehmer Stimme und erfindungsreichem Plaudern.
Nicht etwa an Zeus, dem Mächtigsten, ließ seine Gattin Hera, die Hüterin der Ehe, ihren Zorn aus, als sie sich betrogen sah. Die kleine Echo verfluchte sie, bis sie kein eigenes Wort mehr sagen, bis sie nur noch stammeln, von allem, was sie hörte, nichts als die letzten Silben nachplappern konnte.
Ich glaubte noch an die Gerechtigkeit der Götter, als ich das erste Wort zwischen uns beide warf. Ich hatte in den Büschen Füße rascheln hören. Da fragte ich: Ist jemand hier?
Hier! sagte Echo.
Ich sah sie nicht. Wer schlich mir nach? Ich rief: Komm her!
Sie rief dasselbe. Es machte sie schüchtern, dass sie auf meine Worte angewiesen war. Ich hörte wieder Schritte.
Warum läufst du fort?
Läufst du fort? kam es zurück, obwohl ich wartete und wartete. Das fand ich albern.
Und wenn ich komme? rief ich.
Sie zurück: Ich komme! Und niemand zeigte sich.
Dann komm! verlangte ich. Lass uns zusammen gehen!
Echo: Lass uns Zusammengehen!
Ich war schreckhaft. Ich streifte allein umher. Ich weiß nicht mehr, ob ich den anderen davongelaufen war, ob sie mich mieden. Heftig fuhr ich zusammen, als Echo, von meinem Ruf gelockt, mit meinen eigenen Worten hinter mir aus dem Gezweig sprang und mir so stürmisch ihre nackten Arme um die Schultern schlang, dass mir die Knie einknickten. Ich hatte sie gerufen, und ich stieß sie, kaum dass sie gehorchte, dahin zurück, woher sie kam.
Was willst du?
Willst du? kam meine Frage aus dem Busch, von Echos Mund verstümmelt.
Echos Stimme und diese Frage versetzten mich in einen Taumel, als verlöre ich mich selbst. Die andere Wärme kam so unverhofft und war mir schon vertraut, ein fremdes Gefühl wie Atemnot und Todesangst machte mich weich.
Ich sterbe! rief ich. Ich sterbe eher, als dass ich dir gehöre!
Dass ich dir gehöre! gab Echo zurück.
Sie schlug die Hände vors Gesicht, bedeckte sich mit Laub. Sie floh vor mir, wie ich zuerst vor ihr. Wie einen Spott warf sie aus Wäldern und Felsentälern mir jeden meiner Rufe um die Ohren. Die Schwestern, die ihr folgten, um sie zu trösten, sahen sie hinschwinden, bis sie nur eine Stimme war und ihnen wortgetreu den Fluch nachsprach. Von ferne hörte ich, wie sie die Hüterin der Liebe und der Schönheit, die Vertraute aller Spiegel, Aphrodite, anflehten: Auch er, Narziss, soll lieben, was ihm nie gehören kann!
Ich war erschöpft, hatte mich in der Sonnenglut erhitzt wie sonst nur bei der Jagd. Ich fand einen Quellsee, klar wie Kristall. Kein Hirt, kein Vieh hatte ihn getrübt. Kein Lüftchen kräuselte ihn. Kein Wild trat an seine Ufer, kein Vogel ritzte die Fläche mit Schnabel oder Flügel, kein Zweig fiel aus den Bäumen. Auf frischem, feuchtem Gras, im Schatten streckte ich mich hin. Ich neigte meinen Mund zum Wasser, um zu trinken.
In mir war noch die fremde Wärme, die weiche Nähe. Ich hatte für andere Gesichter immer nur denselben flüchtigen Blick gehabt wie sie für mich. Auf einmal sah ich ein Gesicht, das mir so tief und verwundert in die Augen schaute wie ich ihm, mein Lächeln erwiderte, wie Echos Wort mein Wort erwidert hatte. Ich beugte mich mit einem Kuss zu diesen Lippen. Sie kamen mir entgegen, zum Kuss sich wölbend. Das Wasser küsste meinen Kuss, kalt und gestaltlos. Ich breitete die Arme aus nach sich ausbreitenden Armen. Sie tauchten in ein Trugbild, das zerrann.
Lange lag ich im Gras, den Widerschein betrachtend, der mir näherkam, sooft ich mich über ihn neigte, mir naheblieb, wenn ich verharrte, sich entfernte, wenn ich mich losriss. Kein Meer trennte uns, keine Wüste, kein firniges Gebirge, kein Gitter, kein verriegeltes Tor, nur die unendlich zarte, spiegelnde Haut des Wassers. Auch Tränen, wie sie mir die Augen wärmten, erkannte ich in dem Augenpaar, das ich schon liebte, und zu meinem bitteren Nicken kam ein unerreichbar bitteres Nicken. Und als ich rief: Ich liebe dich! da sah ich, während ich sprach, die Lippen, die ich vergeblich hatte küssen wollen, ebendie Worte formen, da hörte ich von ferne Echos gleichlautende Antwort. Jeden Seufzer, jeden Klagelaut äffte uns Echo nach, ohne dass sie es wollte. Der Abend versetzte das Gesicht, von dem ich meinen Blick nicht lösen konnte, in die Sterne.
Da erkannte ich mich, da kannte ich mich selbst. Das Urteil, vor dem der uralte weltweise Silen gewarnt hatte, war gefallen. Ich wurde sterbensmüde. Mich ängstigte der Tod nicht mehr. Nur er vermochte meinen Schmerz zu löschen. Allein das Sterben hätte mich mit meinem Spiegelbild vereint. Aber nie durfte mir gehören, was ich liebte. So konnte ich nicht sterben. Ich klagte: Habe ich also vergebens geliebt?
Echo rief aus den Wäldern: Vergebens geliebt!
Ich welkte hin. Tränen tropften in die Tränen meines Spiegelbildes. Wenn ich mich abwandte, sickerten sie salzig in die Erde.
Inzwischen weiß ich: Es waren Tränen des Selbstmitleids. Viele Tränen werden aus Selbstmitleid vergossen.
Mag sein, dass Schwäche mir den Kopf ins Gaukelspiel des Wassers tauchte und ich den Nymphen, die mich so liegen sahen, ein Ertrunkener schien. Sie flohen wie vor einem Toten. Ich schwand dahin wie Echo. Als sie wiederkamen, fanden sie nichts mehr zu begraben, nur die Blume wuchs da, der sie meinen Namen gaben.
Ich habe mich gesehen. Vielleicht fändest du mich schön. Aber ich bin ein Fluch. Ich habe geliebt, und Liebe will Kinder. Mit meinem Spiegelbild konnte ich keine Kinder haben. Der Blume erst war es gegeben, anderen meine Seele einzuhauchen.
Ich schaue aus den Spiegeln, wo eine Liebe nicht erwidert wird. Ich will die ungewollten Kinder. Sie gehören mir an Kindes Statt. Wo immer ein Kind gezeugt wird, werfe ich in die Herzen des Paares die Frage, ob sie es beide wollen, und ich springe für den, der es nicht will, ein als Vater oder Mutter. Ich horche auf den ersten Schrei eines Neugeborenen, ob nicht ich es bin, nach dem es schreit. Es treibt mich hin zu allein spielenden oder sich langweilenden Kindern, die eigensinnig und begabt sind und umzingelt von Verboten. Ich hoffe sie und mich zu trösten, für sie bete ich zu Aphrodite.
Aber ich schleppe ihnen nur immer meinen Fluch ins Herz. Schutz verspreche ich und mache doch wehrlos. Ich verheiße Größe und hinterlasse Leere. Wer sich gerettet glaubt, der träumt nur, dass er erwache, um in einen neuen schweren Traum zu gleiten. In jeder Seele, die ich quäle, leide ich aufs Neue. In jeder fürchte ich den Untergang der Welt, das nahe Ende aller Dinge.
Es muss nicht etwa das gleiche Geschlecht sein, das meine Kinder aus dem Spiegel narrt. Was hat der Spiegel zu schaffen mit Geschlechtern! Aber es kommt vor. Gern wohne ich auch in spröden Mädchen, in schönen Frauen, die ihre Söhne über alles lieben, die so geliebt sein wollen, wie sie, ohne es zu ahnen, ihr Bild im Spiegel lieben. Nur im Spiegel ist alles gegenseitig. Das ist sie, die ewige Saat der Gewalt:
Sie möchte willfährig machen. Ein Spiegelbild ist willfährig, aber nur scheinbar: willfährig und unerreichbar. In Spiegeln ist alles Täuschung. Es gibt aus ihnen keinen Ausweg. Ich bin die Liebe, und ich bin ihr Verrat. Ich bin Till Eulenspiegels, des verratenen Verräters bitteres Gelächter, und ich bin die trostlose Frage: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich bin Christus. Und ich bin Judas.
Lass dir von meinen Kindern erzählen. Es sind die Kinder, die ich und Echo hätten haben können. Jedes ist Narziss, jedes ist Echo. In jedem dieser Herzen verfehlen wir uns wieder. Höre, wie sie, was sie bewegt, nur missverständlich stammeln, wie sie ihr Spiegelbild entdecken und bewundern, sich wütend abwenden, sobald es nicht das tut, was sie von ihm erwarten, wie sie füreinander erkalten und doch nicht loskommen voneinander. Das ist die einzige Art, in der sie aneinander schuldig werden können. Es dauert eine Kindheit lang bis in die Reifejahre. Für den, der überlebt, geschieht dann nicht mehr viel. Das Leben ist ein Nachspiel der Jugend.
Eben bist du in meine Liebesgeschichten eingestiegen. Zu Tausenden habe ich sie aus allen Zeiten zu erzählen. Und nun habe ich in dieser zum letzten Male ICH gesagt.
I. Buch: Narzissen in Meißner Porzellan
1. Kapitel Gespenster
Wer zu sich kommt, taucht auf aus Dunklem. Aus Tiefen. Urtiefen. Sternenfernen. Waren da Klänge? Herzschläge? Stimmen? Schemen? Schatten? An der Schwelle des Lichts vergisst er, was war – ob etwas war. Ungestalt: Auch Helleres bleibt hinter den Schleiern. Sie werden allmählich dünner, eine gedehnte, durchscheinende Haut, zäh und geschmeidig. Löcher reißen auf, weiten sich, schrumpfen. Darin formt sich die Welt. Hände versuchen, den Schleier zu zerreißen. Der aber fließt. Wer schon da war, aus dem Schlaf erwacht oder aus einer Ohnmacht, weiß, sich besinnend, sich erinnernd, die klebrigen Fetzen abzutun. Wer zum ersten Mal kommt – war der nur länger fort? Weiter fort?
Wolfgang Siebensohn kehrte zu der Frage oft zurück: Woher komme ich? Er konnte es sich niemals vorstellen: das Nichts. Mit seiner Geburt war etwas zu Ende gegangen, an das er sich nie erinnern würde. Mit dem Tod begänne etwas von vorn, etwas anderes vielleicht oder genau dasselbe, geringfügig gewandelt, mit anderen Gesichtern und Namen, in anderen Gegenden der Welt, des Universums, im Grunde jedoch dasselbe, nur ohne Erinnerung an Voriges. Dem Träumenden erscheinen ein Leben lang Landschaften, Bauwerke, Gestalten, die er nie in Wirklichkeit sah. Der Wache sieht eine Farbe im Sonnenlicht, ein gelbes Ahornblatt, eine im Wind wippende Narzisse, hört eine Stimme Beglückendes oder Schreckliches sagen, zum allerersten Mal – und doch: als sei ihm gerade das schon einmal widerfahren. Er sieht für Sekunden seine Zukunft wie klare Fernen an einem Mittsommerabend. Nur der Spiegel, der in einen Spiegel schaute, sähe das Nichts. Wer sich zwischen Spiegel stellt, sieht dort, wo sich, wären sie klar genug, das Unvorstellbare, das Nichts auftäte, immer sich selber. Darum bezweifelte es Wolfgang, ob er zum ersten Mal gekommen sei, ob er je endgültig verschwände.
Das Kind sträubt sich gegen den Schlaf. Es will nicht zurück ins Dunkel. Sinkt es weg aus dem Licht, in dem es heimisch werden will, erscheinen ihm Wesen anderer Welten. Sie wollen ihm wehtun. Sie leiden selber. Fahl und faltig kommen sie, grämlich blickend oder bedrohlich, knopfäugig, trieflippig, die Haare gesträubt, der Mund zerrissen, oder ganz ohne Gesicht. Dürr, stelzbeinig, in schlotternden Kleidern staken sie plumpe Kähne durch schwarze Wasser, durch Scharen taumelnder Sterne, blecken schrundige Gebisse; Papierohren flattern, Greifhände spreizen sich in mattschimmernden Geweben. Das Gezücht wohnt in einer weidenden Kuh, geht durch ihren Hintern ein und aus, brüllt und kreischt im durchscheinenden Gitter der Rippen. Bräunlich krabbelt es auf Käferbeinen aus dem Lampenschirm, weißlich windet es sich unterm Tisch aus wurmigem Knäuel, einander umschlingende Arme, geriffelte, im Tasten sich längende Finger. Schweinerüssel lauern in Zimmerecken, Vogelschnäbel im Bettzeug. Äffisch Behaarte reiten auf kleinen flinken Pferden die Straße herauf, durchs Haus, über die Dächer. Gierig, gehetzt, bilden sie einen Kreis. Über wessen Ergreifung, wenn nicht über seine, beraten sie? Ein zirpender, wispernder, pfeifender Schwarm stürzt mit Insektenflügeln zum Fenster herein. Das Kind spürt Krallen im Haar, Pfoten an der Kehle, Zungen an den Füßen, hört den eigenen Schrei, sieht Licht, erkennt ein Gesicht. Das Gesicht der Mutter ist entsetzt und sorgenvoll. Auch sie müsste das alles gesehen haben.
Sie nennt die Wesen Gespenster und will nicht wahrhaben, dass es sie gibt außer in Träumen. Was sind Träume? Die Gespenster kommen, wenn er schläft, und sie schlafen, wenn er wacht.
Später, als er gelernt hatte, Träume von der Welt zu unterscheiden, sich selbst als den Träumenden anzunehmen, lauerte Wolfgang wachend Signalen auf, die, wenn er schlief, Gespenster weckten. Er suchte nach den alltäglichen Brutstätten der Plagegeister, die nachts über ihn herfielen. Der Schlaf machte ihn wehrlos. Dem fernen Fauchen, Stampfen, Bellen einer Dampflokomotive lauschte er, die einen Güterzug anschleppte: Winterlicher Ostwind trug ein Schnaufen herüber, dem rasches Gebell folgte, in Brüllen sich überschlagend. Das Kollern und Poltern von Kalk, mit dem Solvay die Brennöfen beschickte, scholl über die schwarzen Dächer. Wenn Mutter eine Lampe brennen ließ, schauten in silbernem Rahmen grimmige Fratzen aus den Felsschroffen der Zugspitze zu ihm herab. Kaum begannen sie augenrollend zu reden, schreckte ihn, in einem Brei von Störgeräuschen ertrinkend, die Radiostimme eines Nachrichtensprechers aus erstem Schlummer. Mit Schrecken erkannte er die beiden hölzernen, hölzern hackenden Trommler eines Orchestrions auf dem Rummelplatz und die Affenfratzen in der Gespensterbahn. Die riesigen Insekten waren Sirenengeheul und Flugzeugbrummen. Mutter führte ihn am Fenster vorüber aus dem dunklen Zimmer. Die Sterne waren in Bewegung. Sie ordneten sich zu Dreiecken: Christbäume ohne Weihnachten. Unter nicht allzufernem Donner, der die Wände zittern machte, zogen ihnen Funkengarben entgegen. Mutter sagte: Das ist die Flak. Die trifft nur Luft. Fremde Leute schützten sich im Keller vor der Luft, Hausbewohner, Nachbarn. In Decken gehüllt, zwischen Koffern und Rucksäcken, grüßten sie Mutter, sprachen von Bombentreffern in der Bahnhofstraße, freuten sich über das Feuer im Finanzamt, schäkerten mit dem Kind, holten Bonbons mit Fusselklümpchen aus den Manteltaschen, machten sich wieder davon, weil Wasser in den Keller lief.
Am Tag ist die Luft voll Geplärr. Stiefel glänzen und krachen. Wolfgang steht auf einem Stuhl am Fenster und sieht hundert vollkommen gleiche Gespenster vorüberziehen. Manche halten sich goldene Rohre vor die Gesichter; Kessel auf den Köpfen lassen nicht erkennen, ob sie hineinblasen oder hindurchschauen. Der Lärm kommt aus den Männern, die sich in Uniformen und Stahlhelmen verstecken, hohl und hart. In der Welt ist Krieg. Wer aus dem Feld kommt und eine Schlacht mitgemacht hat, ist wahrscheinlich hohl wie das Kaninchen, das er Mutter im Hof hat schlachten sehen. In den Schlachten dieses Krieges werden einem die Eingeweide herausgenommen. Manche Männer fallen, aber nicht so wie er, der, so weh es tut, gleich wieder aufsteht. Sie bleiben liegen. Sie sind tot. Einem ist zwischen Krücken das Hosenbein mit einer Nadel hochgesteckt. Haben sie ihm an der Front das Bein abgebrochen? Andere sind vermisst. Die Frauen, deren Mienen er betrachtet, um zu verstehen, was sie meinen, finden es weniger schlimm, wenn ihr Mann oder ihr Junge in den Mist fällt.
Im Hinterhaus richten sich Uniformierte ein. Der Steppke spart der Postfrau einen Weg und bringt ihnen Briefe. Sie haben auf Armbinden und auf ihren Papieren ein schwarzes Zeichen, ein auf Kante stehendes Fenster mit einer Lücke auf jeder Seite. Jungs, die mit Kreide das Pflaster bemalen, streiten, wie herum es gehört. Zum Steppke und zu Frauen sind Uniformierte freundlich. Männer schnarren sie an. Von Männern wird mehr verlangt. Sie blicken gern feierlich und streng wie das Gesicht auf dem Bild, unter dem sie schreiben und verhandeln. Hätte nicht einer von ihnen dasselbe Oberlippenbärtchen, könnte man es für den Schmutzfleck unter der Nase halten, der den Steppke verrät, wenn er aus dem Wasserhahn in der Hofecke getrunken hat. Mutter meint dieses Gesicht, wenn sie ihm dann beim Kämmen zum Spaß den Scheitel auf der anderen Seite zieht und kichert: wie der Führer! Der Führer heißt Adolf. Mutter kämmt den Scheitel richtig, liest aus einem Kinderbuch: Adolf heiß ich, die Hosen zerreiß ich, die Nüsse zerbeiß ich und sonst nichts weiß ich. Im Spiegel hat er den Scheitel dann doch auf der Seite des Führers.
Uniformierte, das war die Wehrmacht. Das waren Nazis. Auf einmal verschwanden die Männer vom Hinterhaus. Dann waren es Amis. An einem sommerlichen Apriltag standen sie in einem sandfarbenen Panzer vorm Haus und verteilten Süßes, das Schokolade hieß und aussah wie einer von ihnen.
Dann waren es Russen. Das schwarze Zeichen war verboten, wie nur etwas verboten sein konnte. Es wurde ein Unzeichen, das man heimlich mit Herzklopfen dennoch malte und mit dem Schließen aller Lücken zu einem Fenster verharmloste.
Auch was die Russen singen, klingt hart, hohl, unverständlich. Alle fürchten sich vor den Russen. Wenn über Leute gesprochen wird, ist das Wichtigste, ob einer Nazi war oder nicht. Wer Nazi war, wird abgeholt.
Abends steht plötzlich ein Uniformierter am Kinderbett. „Ein Russe!“, schreit das Kind.
Das ist dein Vater! sagt die Mutter. Sie muss es immer wieder sagen.
Der Uniform fehlen die glitzernden Stellen, wo bei denen im Hinterhaus ein Hakenkreuz geblinkt hat. Kein Nazi, kein Ami, kein Russe. Sollte das der sein, der schon einmal da war, sich im Spiegel mit dem Pinsel das Gesicht weißschmierte und einem das Weiße auf die Nase tupfte? Seitdem gab es eins mehr unter den Gespenstern. Sie poltern inzwischen nicht mehr. Der Russe baut die SOLVAY-Werke ab. Soda braucht man für den Krieg, und der Krieg ist aus, und nie mehr soll Krieg sein. Vater hat keine Arbeit. Er kommt aus Italien, aus kurzer Gefangenschaft beim Ami. Zu einem trübseligen Amischlager aus dem Radio steht Angst in allen Gesichtern. Das Spielzeugpferd fällt ihm aus den Händen.
Nun ist einer mehr da, der aufpasst, dass Wölfchen mittags schläft. Er liegt seine Zeit ab, horcht auf das Knallen der Kreiselpeitschen, das Geschrei anderer Kinder. Sonne sickert durch die Knitterstellen der Verdunkelungsrollos. Die Gespenster, die er hineinsieht, folgen ihm in den Schlaf. Er hält sich wach, versucht zu weinen. Der Anfang ist mühsam, klingt unecht, bleibt trocken. Aber er tut sich selber leid in der Verlassenheit am hellen Tag, bis erste Tränen salzig und warm in die Mundwinkel laufen. Das Weinen macht selig, und irgendwann kommt dann die Mutter doch.
Den Vater machen Tränen nur härter. Du willst doch ein Mann werden! Er tut Unrecht, wenn er weint. Weinen ist verboten. Vater schickt ihn unbarmherzig zu den Gespenstern. Mit denen muss er fertig werden. Und dann, aufgeschreckt, sieht er den Fremden, der sein Vater ist, am Bett kauern, hört die ernste Frage wie einen Tadel: Was hast du wieder geträumt? Du hast ja gebrüllt!
Wenn er die Träume erzählt, macht er alles nur schlimmer. Keiner versteht sie. Sie stoßen auf Widerwillen. So dummes Zeug träumen nur Kranke, und mit Kranken will man nichts zu tun haben. Mutter hat ihn beruhigt. Sie steht auf Vaters Seite, seit er da ist. Man darf nicht weinen und nicht von Gespenstern träumen. Man muss mittags schlafen. Man muss essen, auch wenn man es nicht mag, schlimmer: Dann gerade!
Wölfchen kriegt einen steifen Hals. Will er zur Seite schauen, muss er die Schultern herumnehmen. Die Eltern wundern sich, dass er es selbst nicht merkt. Er muss es Leuten vormachen. Er hat kein Fieber, klagt nicht über Schmerzen. Nur wenn Vater seinen Kopf bei den Ohren packt und den Hals zu drehen versucht, tut es weh. Weder Dampfbäder helfen noch Umschläge. Der Arzt verordnet Rotlicht, stülpt über Kopf und Hals einen Tunnel, in dem es warm wird. Der Hals bleibt steif.
Tante Karla weiß Rat. Wolfgang läuft an Mutters Hand über die Alte Bibel, den stillgelegten Gottesacker. Auf dem von Wurzeln gewölbten Pflaster des Fußwegs, unter verschnittenen und wieder ausgewucherten Linden geht es vorüber an den zerschlagenen Fenstern der Leichenhalle, an erblindeten Marmortafeln, efeuumwucherten Grüften, steinernen Engeln, Rasenbuckeln, auf denen verwilderte Narzissen blühen. Feuchtgrün führt eine Treppe auf den Saalplatz. Überm Portal des Hotels Goldene Kugel trägt ein Muskelriese den Erdball. Vorm ersten Freien Laden, dem Kaufhaus, das dem Juden Cohn gehört hat, stehen die Leute Schlange nach Butter ohne Marken. Eine Notbrücke ersetzt die gesprengte SA-Brücke, verbindet über der Saale Bergstadt und Talstadt. Das Rathaus am dreieckigen Markt hat ein Dach wie ein Sargdeckel. Die schwarze Spitze der Marienkirche ragt nur wenig über die Reisigwände des Gradierwerkes. Die Breite Straße ist eigentlich krumm. Am alten Kloster warten ständig Leute mit Blechgeschirr auf die Kübel der Essküche. Am Niederstedter Tor kann man wählen, ob man auf der Straße bleibt oder über die bruchsteinerne Flutbrücke geht, die den bei Hochwasser überspülten Gänseanger überwölbt. Wolfgang bevorzugt die Brücke, Mutter die Straße, und immer gibt es Streit.
Dort, über einem toten Arm der Saale, auf dem im Sommer Mücken tanzen und im Winter Schlittschuhe kratzen, überm Krumbholz, dem immer mehr Bäume fehlen, weil die Leute sonst nichts mehr zum Heizen haben, liegt, umkreist von Krähenschwärmen, hinter hohen, mit Scherben und Stacheldraht bestückten Mauern, auf denen Schilder, wie Wolfgang später liest, vor Fußangeln und Selbstschüssen warnen, wie eine in Parkwipfeln verborgene Fabrik, denn nur Kesselhaus und Schornstein sind von außen sichtbar, die Nervenklinik.
Er kennt den Weg von Sonntagsbesuchen bei Tante Karla. Die gelben Klinkerkästen mit ihren vergitterten Fenstern sind ihm nicht geheuer. Der Krankenhausgeruch, den die Tante bei Gegenbesuchen in ihrer geplätteten, gestärkten Schwesterntracht mitbringt, zieht auch in die Haut der Puddings, die sie dem Jungen aufdrängt, und macht sie ungenießbar. Sie nicht zu essen ist eine Beleidigung. Man soll sich bei ihr wie zu Hause fühlen.
Die Tante ist Vaters ledige Schwester. Aber sie ist auch Stationsschwester bei den Idioten. Vater zieht sie gern mit Ausdrücken auf, die sie sich verbittet: Irrenhaus. Klapsmühle. Klapper.
Sie führt den Neffen zum Chef. Der jagt Wolfgang einen Schreck ein, wie er ihn nur aus Gespensterträumen kennt. Ein paar Tage soll er dableiben, weil die Bestrahlung nicht wirkt. Jetzt gibt er sich mehr Mühe mit dem Hals. Aber sie lachen über ihn. Er kann den Hals nicht dazu bringen, dass er sich dreht. Dann muss es eben doch sein. Mutter findet sich damit ab und packt ein paar Sachen aus. Sie hat es schon gewusst.
Täglich kommt Tante Karla ans Bett. Man meint es gut mit ihm. Sie erspart ihm aber keine einzige Zwickerei und antwortet nie auf die Frage, wann er nach Hause dürfe. Sie geht mit ihm im Anstaltspark spazieren, führt ihn ans Tor. Da sieht er Welfenburg. Die ganze Stadt mit ihren schwarzen Dächern liegt ausgebreitet fast wie auf dem alten Stich zu Hause überm Sofa, die Talstadt mit dem Gradierwerk, der buckligen Marienkirche, der anderthalbtürmigen Martinskirche, den Russenkasernen, dahinter die Bergstadt, Schlossberg und Schloss, Türme, Giebel, Zinnen und Erker, in denen tief stehend die Sonne sich spiegelt, Schlosskirche, Wasserturm, Lyzeum und Gymnasium. Von der Stadtmauer, an der auf dem Stich die Saale vorüberfließt, wo jetzt der tote Arm verlandet, klebt am Niederstädter Tor ein Stück. Die Saale strömt den Solvay-Werken und ihren Halden zu. Die Schlote rauchen nicht, die Ofenbatterie schweigt über den Gerippen der Maschinenhallen, in denen Vater zu Vorkriegszeiten Ingenieur war. Wo die Saale herkommt, ragt der Kurhausturm in die Schleusentore und den Mühlensilo, schimmern weiter seitab die Fördertürme und Schornsteine des Kalischachtes WINTERSHALL.
In seinem Zimmer liegen zwei Ruhige. Aber auf Korridoren und Parkwegen laufen sie nun wie Gespenster, die blassen, faltigen Kranken in ihren gestreiften Bademänteln und Anstaltskleidern, Augenrollende und die mit stierem Blick, Fuchtelnde und Kopfwackler, Sabbernde, Auflachende und die mit den tierischen Schreien vor allen Mahlzeiten, die Verwirrten, Halbirren und Irren.
Das Unfassliche geschieht: Tante Karla gibt ihn morgens angezogen einem Pfleger an die Hand, der ihn den Weg durch die Talstadt zurückführt, über die Brücke, die Stufen hinauf zur Alten Bibel, unter die strengvertrauten Fensterkreuze der Klüthener Straße. Er darf hinauf zur Mutter und in der Küche sitzen, beim Kartoffelnschälen zuschauen, Puffer essen. Und er fühlt die Freude wie eine letzte, und er wünscht sich, dass sie immer währe. Aber die Kartoffelpuffer schmecken ihm nicht. Der Pfleger wird nicht vergessen, ihn abzuholen. Denn sein Hals ist noch immer steif. Abends, wieder in gestreifter Anstaltskleidung, am Flurfenster, die Sonne sinkt durchs bunte Laub des Parks, ist ihm, als wäre er zum letzten Mal durch seine Stadt gegangen, als hätte er das alles haargenau so schon einmal erlebt. Die Freude am Leben hält sich in Grenzen, wenn man, um es zu behalten, so viel über sich ergehen lassen und dann trotzdem sterben soll.
In der Schule, aus Dokumentarfilmen im ZEITKINO, erfuhr er später: An die dreißigtausend Menschen hatten tatsächlich ihren letzten Weg durch diese Stadt genommen, in gestreifter Häftlingskleidung. So viele Einwohner zählte Welfenburg. Auf jeden Einwohner kam ein Vergaster. Die Lehrerin erinnerte sich, alle Tage wären geschlossene grüne Lastautos ohne Auspuff in den Straßen herumgefahren. Mutter, gefragt nach dem Unterschied zwischen Heizhaus und Krematorium, wusste noch: Immer war so viel Rauch aus dem Schornstein der Heilanstalt gekommen, sogar im Sommer, und hatte sich, wenn es heiß war, drückend auf die Stadt gelegt. Dass Menschen verbrannt worden wären, wusste keiner. Auch Tante Karla wusste nichts; sie hatte der Krieg aus einem Lazarett ins andere verschlagen. Vater wollte gehört haben, ein paar verrückt gewordenen Stukafliegern hätte man da den Gnadentod gegeben.
Wölfchen vergaß, wie es kam, dass er den Hals doch wieder drehen konnte. Er versuchte, sich schlechte Träume abzugewöhnen. Er nahm sich vor, den Gespenstern eins auszuwischen. Den Eltern erzählte er Traum-Heldentaten, die er erwartete. Bald glückten sie ihm auch: Sah er einen dieser schlauchlangen Arme durch den Türspalt greifen, riss er die Tür zu, und die abgeklemmte Hand hing weiß und welk herunter. Den Affenartigen entkam er, indem er ihnen eins ihrer kleinen flinken Pferde stahl.
Gern hörte er Mutter erzählen. Wie er gelallt und Daumen gelutscht, sich nachts heiser geschrien hatte, bis er ein Fläschchen mit Alete-Milch bekam. Dabei erlebte er nach, wie er durch die Stube krabbelte, laufen lernte, wie Ärzte um sein Leben rangen; er hatte sich im Lazarett, wo sein Kindermädchen einen Soldaten besuchte, mit Typhus angesteckt. Wie seine Krankheiten verliefen, Keuchhusten, Masern, Windpocken. Wie seine Kiefer zahnten. Wie ihm in Träumen Gespenster nachstellten. Nach und nach las er es in Schulbüchern, sah er es im ZEITKINO: Während all dessen wurden Menschen in Folterkellern gebrochen, vor Gruben, die sie selbst ausheben mussten, erschossen, in Lastautos mit Auspuffgasen erstickt, in Auschwitz fabrikmäßig vergast, durch die Schlote der Krematorien geblasen.
War das wirklich gleichzeitig geschehen? Wurden in denselben Sekunden Soldaten von Granaten zerfetzt? In den Weltmeeren Schiffe aufgeschlitzt, U-Boote versenkt? In Luftschutzkellern Frauen, Kinder, Greise verschüttet? In den Ruinen der Städte halbverkohlte Leichenstapel verbrannt? In unabsehbarem Zug auf den Schneefeldern Russlands halb erfrorene, halb verhungerte, todkranke Gefangene nach Sibirien geführt? Hatten unerlöste Geister den Wohlbehüteten gequält? Oder war in ihm, nach kurzem Warten in der schwarzen Schleuse zwischen zwei Welten, die Seele eines Gejagten, Verfolgten, Ermordeten wiedererstanden? Geschah tatsächlich alles in derselben Welt?
Solch einen Krieg haben die Deutschen vom Zaun gebrochen und verloren, dachte Wolfgang, die trübselig gleichgültige amerikanische Radiomelodie im Ohr. Und ich bin Deutscher. Was erwartet mich in der Welt?
Noch später genießt er es oft, eine Tür hinter sich abzuschließen, als wäre er Verfolgern entkommen. Kurz vor seinem Tod wird er noch einmal von einem Gespenst träumen, vor ihm zittern, ihm im Halbdunkel des Zimmers nachgehen, ein Beil in der Hand. Er will es ein für alle Mal erledigen, damit es niemals wieder kommt, damit Frau und Kind endgültig Ruhe haben. Es ist, obwohl er längst woanders wohnt, wie oft in seinen Träumen die Stube in der Klüthener Straße. Er sieht nichts von dem Gespenst, hört nur, wie es bei der Jagd um den Tisch vor ihm herhuscht. Er greift hinter sich, schließt leise die eine Tür ab, schleicht sich zur zweiten, dreht den Schlüssel. Da entwischt es durch die dritte Tür.
2. Kapitel Ruinen
Sommersonne legte auf das Schlackepflaster denselben dunkel durchbrochenen Glanz wie auf die Wellen des Stroms, der hinter den Ruinen nordwärts drängte. Als rötlichgraue, von Verdorrtem überwucherte Ufer, säumten Trümmerberge die Schienen, über die sich klappernd die Straßenbahn quälte. Der Junge, an den sich Siegfried Stufenhauer später erinnert, sooft er in die Scherben seines Lebens schaut, hatte sich an den Beinen Stehender vorbeigezwängt, um zwischen den Knien Sitzender ein Fenster zu erreichen. Er konnte sich nicht sattsehen an verstaubtem Gebälk, schiefliegenden Ziegelklumpen, angekohlten Türen, die in verrußten Treppenaufgängen über Leerem hingen, an Fenstern, durch die der Himmel schien, an im Wind flatternden Fetzen abgewohnter Blumentapeten, an glitzernden Kachelwänden und vom Regen verwaschener Tünche, an verbogenen Rohren, herabhängenden Wannen und Badeöfen, zerborstenen Waschbecken. In einem dieser zerbombten Gebäude war sein Opa Gelbke beim Feuerlöschen umgekommen.
In der flirrenden Luft über enttrümmerten Flächen schaukelten, alle gleich ausgerichtet, doppeltürmige Kirchen, die Turmspitzen eingeschlagen, kahle Gerippe die Dachstühle, leer die hohen, schmalen Fenster, eine Flotte zerschossener Schiffe, die noch nicht sank. Mutter bekam Platz und nahm Sigi auf den Schoß. Die Schiffe trugen die Namen von Heiligen. Einen hatte er sich gemerkt. Sankt Nikolai. Das war nicht etwa der Alte, der einem vor Weihnachten Süßes in die hohen Schnürschuhe steckte, sondern ein Soldat, sein Freund, und er fuhr mit der Mutter zu ihm.
Mutter beschrieb ihm die Schönheit der Stadt Magdeburg vor dem Bombenangriff. Das tat sie jedes Mal auf solch einer Fahrt in der wimmernden Straßenbahn, und sie fand immer neue Einzelheiten, vergaß nie zu erwähnen, dass eine Domspitze schon General Tilly im Dreißigjährigen Krieg heruntergeschossen hatte, nannte die Namen von Geschäften, verwies auf Fotos, die sich zu Hause in Kartons häuften. Der Anblick der Trümmerlandschaft und Mutters bittere Huldigungen an die versunkene Pracht nährten in dem Jungen die Überzeugung, es sei die Bestimmung der herrlichsten Städte, in Kriegen zerstört zu werden.
Dass Kriege kamen und gingen wie Jahreszeiten, war in dem Album zu sehen, in dem er gern blätterte, wenn er mit dem Fotokarton fertig war: Bilder Deutscher Geschichte. Vater hatte die Zigarettenbilder gesammelt, bevor er in den Krieg musste, aus dem er noch nicht zurückgekehrt war. Man durfte nur selten mit anderen Kindern spielen. Mutter sorgte sich, dass ihn die Älteren in die Trümmer mitnahmen, wo sich Kerle herumtrieben und manchmal noch eine Bombe explodierte. Der Junge durfte sich auch AUS Deutschlands Vogelwelt anschauen. Er zog die Geschichte vor. Da sah er zwischen buntgekleideten Fürsten, Prinzessinnen, Königen, Kaisern immer wieder Helme, Schilde und Schwerter, Uniformen, Gefallene, Qualm und zerschossenes Gemäuer, Kanonen und Pferde mit den Hufen nach oben.
Hatte er das Album durchgeblättert, immer auf der Hut, dass keine Seite, keins der eingeklebten Bilder knickte, denn sonst würde Mutter es wegschließen wie schon einmal, war es wieder zu den anderen Büchern hinter der gläsernen Mitteltür des Schrankes gestellt, zog Sigi aus der Nische zwischen Kredenz und Standuhr einen Persilkarton und begann aus Holzklötzen eine Stadt zu bauen. Er baute die schönste Stadt, die er sich vorstellen konnte, und schmückte die breiten Straßen und Plätze mit doppeltürmigen Kirchen. Als Turmkuppeln nahm er Männchen aus dem Mensch-ärgere-dich-nicht. Säulen und Bögen erinnerten, auch wenn die Größenverhältnisse nicht stimmten, an reich verzierte Fassaden, die er in einem der unversehrten Viertel gesehen hatte, wo Nikolai wohnte. Der Vorrat aus mehreren alten Baukästen reichte, unterm Stubenfenster die braunen Dielen zwischen Scheuerleiste und Teppichfransen zu bebauen. Eine Weile überließ er seine Stadt friedlichem Treiben. Anfangs hatte er aus den Bauklötzen Trümmer errichtet, wie sie nun einmal zu einer bedeutenden Stadt gehörten. Mutter war das nicht recht gewesen. Es erinnerte sie an den Tod ihres Vaters.
Im Persilkarton lag zuunterst eine Zigarrenkiste, gefüllt mit kleinen runden Stanzplättchen aus der Schiffswerft, in der Sigis Vater wieder arbeiten würde, wenn er zurückkäme. Der Junge hatte sich damit die Hosentaschen füllen dürfen, als Mutter mit ihm durch die Werkhalle gegangen war, um der Tante eine Blechkanne mit Suppe zu bringen. Sie sahen nicht aus wie Bomben, eher wie Tellerminen, von denen Erwachsene manchmal redeten. Er horchte, ob Mutter nicht eben vom Einkauf zurückkam. Bei diesem Spiel ließ er sich nicht gerne ertappen.
Der Frieden seiner Stadt fand sein Ende, wenn Sigi eine Handvoll Stanzplättchen nahm. Das dumpfe Motorengebrumm, das er nun anstimmte, hatte er den Flugzeugen abgelauscht, die manchmal noch in Staffeln die Stadt überflogen und sich von alten Männern zählen ließen. Dann regneten die Plättchen aus seinen hingestreckten Händen über die Stadt. Aus dem Brummen seiner Lippen löste sich der Donner der Detonationen. Immer achtete er darauf, dass ein Kirchturmpaar stehenblieb.
Er dachte an seinen umgekommenen Großvater, den er nur von Fotos kannte, wartete über dem Trümmerfeld ein paar heftige Atemzüge lang, etwa eine halbe Nacht im fast erloschenen Leben der Stadt. Mutter hatte ihm erzählt, sie sei am Tag nach dem Bombenangriff unter den Türmen einer brennenden Kirche vorübergegangen. Aus dem durchgeschwelten Gebälk habe sie da die Glocken mit einem fürchterlichen Jaulen herabsausen hören. Er wusste später nicht mehr, ob es Sankt Nikolai gewesen war, Sankt Ulrich oder eine andere der vielen zerbombten Kirchen. Aber der Name des Freundes wog in seinem Gedächtnis schwer, Sigi stellte sich nun den Weg seiner Mutter vor, und wenn er sie am Fuß des Turmpaares sah, glaubte er das Jaulen zu hören, mit dem die Glocken in die Tiefe gefahren waren, versuchte er es nachzuahmen. Bevor er anfing, die Straßen seiner Stadt zu enttrümmern, musste er verschnaufen. Es war ein kaltes Spiel. Nie wagte er, Feuer zu verwenden, obgleich er wusste, wo Streichhölzer lagen.
Fast jeden Tag hatte er Zeit für das Spiel, dessen erregendste Phase die Augen der Mutter scheute. Mutter ging stundenweise sauber machen. Manchmal brachte sie ihn zu Oma Gelbke. Aber die Fremdheit der alten schwarz gekleideten Frau, die nichts mit ihm anzufangen wusste, machte ihm bange. Lieber wollte er zu Tante Gelbke. Der ältere Cousin tobte mit seiner kleinen Schwester und einem Freund durchs Haus. Anfangs fand Sigi Spaß daran; aber die zügellose Jagd rief schimpfende Mieter auf die Treppenabsätze, die wahllos ihn, von den Jungs den kleinsten, am Ohr packten, um ihn auszuschimpfen. Neuerdings endete sie mit einem Besuch der Bodenkammer, dem Schauplatz ihres Lieblingsspiels: Luftschutz. Im Gerümpel hatten Harald und sein Freund in einem Haufen alter Decken Gasmasken gefunden. Vor Eifer grunzend zogen sie sich graugrüne Gummibeutel über Kopf und Ohren. Sogar die Cousine steckte ihre aschblonden Löckchen hinein. Die fremden, unheimlichen Wesen, in die sie sich verwandelt hatten, hoben silbrige, vom Gewinde geriffelte Rüssel, über denen dünne Gummischnäbel zitterten, schauten ihn aus kreisrunden, in Metallringe gefassten Insektenaugen an, nahmen ihn in die Klemme, versuchten auch ihm eine Maske aufzustreifen. Da es an den Haaren wehtat, half er nach. Ihm wurde beklommen wie beim Bombenspiel mit den Stanzplättchen über der Baukastenstadt, anders als zu Oma Gelbkes steinernem Schweigen. Es war schaurig und doch auch ganz angenehm. Dem Geruch aus Schweiß und Gummi und der kleinen Atemnot hing leise Wonne an, wenn sie sich nun in den Decken balgten. Es gab keine groben Knuffe wie sonst, sondern sie vertieften sich keuchend ins Kitzeln, Kichern und in sanfte, beinahe zärtliche Ringergriffe, und wenn einer den anderen in den Schwitzkasten nahm, geschah es wegen des knappen Atems mit Schonung. Es rieselte in seinen Händen, wenn sie die warme, straffe Glätte einer Gummihaut zu fassen kriegten. Und dann saß er staunend da und wusste, dass etwas Geheimes, Unerlaubtes geschah, wenn sie auf einmal innehielten, wo der Kampf sie hingeworfen hatte, sich die Hosenställe aufrissen und jeder seinen Stängel mit der Faust bearbeitete, bis irgendetwas sie tief innen krümmte, das vielleicht wehtat, aber nicht sehr. Karin klatschte in die Hände, als geschähe alles nur für sie, und gleich ging, als wäre nichts gewesen, das Kichern und Balgen weiter.
Mutter ließ ihn nie allein. Sie brachte ihn nicht gern zur Tante, die, wie sie von Leuten im Haus erfahren hatte, auf die Kinder nicht aufpasste. Sie nahm Sigi mit, wenn sie sauber machen ging. Ihr Ruf, es sei Zeit zu gehen, beendete das qualvolle Ruhen mit offenen Augen, denn er schlief zu Mittag längst nicht mehr. In Vaters Bett liegend hatte er nur immer die gelbliche Glasschale der Lampe angestarrt, über die sich bräunliche Streifen schlangen wie Schalenreste von Pellkartoffeln. Mutter kramte dann aber noch in der Küche, suchte eine Tasche, lief hin und her. Er wartete vorm Spiegel der Frisiertoilette, verglich sein Knabenjackett und die kurze, auf Kniff gebügelte Hose, die schnell angezogen waren, mit Strickjacke und Wollhöschen auf einem Foto im Steckrahmen, das ihn zwei, drei Jahre jünger zeigte. Verstohlen behielt er auch das Spiegelbild der Messingklinke im Auge. Senkte sie sich, fuhr er herum und sah zum Fenster. Mutter hatte ihm den Spiegelaffen verwiesen, sooft sie im Kleiderschrank des Schlafzimmers wühlte, der nach den Mottenkugeln in Vaters Anzügen roch, eine Bluse suchte, einen Rock, ein Kleid.
Dann schaukelte die jammernde Straßenbahn sie durch das Trümmermeer, in dem die zerschlagenen Kirchenschiffe trieben, vorüber an Inseln angekohlter Baumstrünke, die neu ausgeschlagen hatten. In der schattigen Allee, in die sie tauchte, hallte ihr Jammern an unversehrten Häuserfronten wider. Wo Vorgärten begannen, wo Fenster und Türen Säulen und Bögen hatten, wie sie in Sigis Baukasten vorkamen, war es Zeit auszusteigen. In einem grünen Zaun klaffte ein grünes Tor. Aus einem Schilderhäuschen trat ein grüner Soldat, die ölglänzende Maschinenpistole geschultert. Er ließ sich von Mutter ein Papier zeigen. Sobald seine Hand ans Käppi fuhr, durften sie durch. In dem Park, durch den sie gingen, begegneten ihnen Grünuniformierte mit großen Tellermützen. Mutter grüßte sie mit einem fremden Wort, das wie Strass klang; auch Sigi grüßte mit diesem Wort, das Wujtje, das ihn die Mutter hinzugelehrt hatte, so lässig verschluckend wie die Tellermützigen.
Mutter machte bei Russens sauber. Sie sagte das so zutraulich, dass Sigi die grünen Villenbewohner für eine große, weitverzweigte Familie hielt, die ebendarum auch wichtiger war als alle anderen Familien, die Stufenhauers, die Gelbkes. Zu Russens gehörte auch Nikolai. Er saß in der Pförtnerloge des Casinos. Sobald er durchs Glasfenster die beiden kommen sah, stand er auf und holte seinen kleinen Freund herein. Nur einmal war Sigi tiefer in die Villa vorgedrungen, hatte zugeschaut, wie Mutter ein riesiges Parkett mit dem Bohnerbesen bearbeitete, hochgewölbte Fenster putzte, den schwarzen Flügel im Erker polierte, wie sie mit dem Federbusch über weiße Büsten huschte, daneben die Falten eines Straußes roter Fahnen ordnete und mit einer Trittleiter zum Bildnis Stalins emporstieg, um den goldenen Rahmen abzustauben und geradezurücken. Den Namen Stalin hatte Sigi sich gemerkt wie den Gruß, denn Stalins Bildnis hing auch außen an den Villen und stand an den Kreuzwegen des Parks, und da ihm Mutter manchmal ein VÄTERCHEN voransetzte, musste Stalin das Oberhaupt dieser großen grünen Familie sein. Gerade hatte er in dem schöngeschwungenen Schnurrbart und den leutseligen Krähenfüßen Väterchen Stalins die Bestätigung dafür gefunden und eine Galopprunde übers Parkett begonnen, als ein Tellermütziger hereingekommen war, um der Mutter zu bedeuten, das Kind dürfe sich hier nicht aufhalten.
Seither verbrachte Sigi die Zeit, in der Mutter bei Russens saubermachte, in der Pförtnerloge. Nikolai roch nach Stiefelwichse, Veilchenparfum und Machorka. Genießerisch drehte er sich in der geöffneten Blechbüchse eine Zigarette aus dem Kraut, das er dem Tabak vorzog. Er redete, fragte, sah sich nicht verstanden, gab es mit einer Miene verständnisvollen Bedauerns auf. Paffend lehnte er sich zurück, nahm die Mütze ab und strich mit roter Pranke über die frische Glatze. Sigi ging staunend um den Stuhl herum, betrachtete von allen Seiten die wächsern graue Schädelkugel, seine Augen wanderten von den starken Sehnen unterm Hinterkopf zum Haaransatz, der wulstig die straffe Kopfhaut von den rosigen Querfalten der Stirn trennte. Da begann Nikolai zu lachen. Er lachte immer lauter, hustete, schlug sich, die Zigarette im Mundwinkel, beidhändig auf die Schenkel. Ohne Worte hatte er an der halb erhobenen Hand erkannt, wonach es den Jungen gelüstete. Langsam neigte er ihm den Kopf entgegen und ließ sich über die Glatze streichen. Sigi war darauf gefasst, etwas Glattes zu fühlen wie den Gasmaskengummi. Aber seine zaghaften Fingerkuppen fühlten die Rauung winziger, unsichtbarer Stoppeln. Befangen kicherte er, und da er in Nikolais Gesicht keinerlei Missfallen entdeckte, verlangte er laut herauslachend: Noch mal! Und Nikolai ließ es sich noch einmal gefallen.
Nikolai zog aus seinem Uniformrock eine dunkelgeschwitzte Brieftasche, öffnete sie, fächerte aus dem gesprungenen Zelluloidfenster wie ein Kartenspiel zerknickte Fotos auf, eine blonde Frau, drei Kinder, etwa so alt wie Harald und Karin. Zuchause! sagte er, streckte den Arm aus und suchte ihn winkend zu verlängern, eine weite Entfernung, eine lange Zeit. Sein Zeigefinger wanderte von Sigis Schulter auf die Fotos, auf seine Brust, mit der anderen Hand strich er sich über die Glatze, nickte: Verstanden!
Auch seine Kinder hatten das gern getan. Er rammte seinen Zeigefinger nach oben in die Luft, was Neues war ihm eingefallen. Aus einer ledernen Tasche förderte er Bonbons zutage, groß wie mittlere Bauklötze. Die Kanten drückten Zunge und Gaumen auseinander. In ihre Süße mischte sich eine Veilchennote.
Sie schwiegen lange, der eine paffend, lutschend der andere. Nikolai sprach durch das Logenfenster, ließ sich von Uniformierten Papiere zeigen, trug etwas in sein Buch ein. Der Junge war für ihn nicht mehr da; ein Fremder saß vor Sigi und wischte sich mit einem nach Veilchen duftenden Spitzentaschentuch Schweißperlen von den porösen Stirnwülsten. Der mit der Tellermütze, der Sigi aus dem Saal gewiesen hatte, kam herein, ging in die Hocke, gab dem Jungen mit ernsten Augen einen sanften Klaps auf die Wange, sagte etwas, lachte, und Nikolai lachte auch.
Beim nächsten Mal zog der Soldat einen Stapel Hefte aus der Ledertasche, klatschte ihn auf den Tisch, blätterte sie vor: Farbige Glanzfotos von Lokomotiven, Eisenbahnwagen, Lastautos, Schiffen, Flugzeugen. Das erste Heft gab er her, die anderen stopfte er zurück in die Tasche, mit dem Zeigefinger auf den Tisch trommelnd: Wiederkommen!
Wenn Mutter im Logenfenster erschien, brauchte sie Geduld. Der Junge wollte bei Nikolai bleiben, und der gab ihn ungern her. Auf dem Heimweg waren die Trümmer, die Kirchenschiffe, die herabsausenden Glocken ohne Reiz. Nikolais Faust gab noch ein Bonbon frei: Wiederkommen! Mutter nickte heftig: Morgen! Oft fuhr der Junge in diesem heißen Sommer zu Russens. Immer roch er in der Pförtnerloge Stiefelwichse, Veilchenparfüm und Machorka. Immer hatte Nikolai Bonbons und Hefte mit Bildern. Jedes Mal durfte ihm Sigi über die Glatze streichen. Warum ziehen wir nicht ganz zu Russens? fragte der Junge. Vater ist doch auch schon bei denen! Warum lassen sie uns nicht zu ihm? Dazu sagte die Mutter nichts. Und es kam der Tag, an dem sie Sigi nicht mehr mitnahm, wenn sie bei Russens sauber machte, und dann der, an dem sie gar nicht mehr zu Russens ging.
Es begann damit, dass Nikolai nicht mehr da war. Ein fremder Soldat saß in der Pförtnerloge, der nicht daran dachte, sich über die Glatze streichen zu lassen, dem nichts einfiel, womit er sich und dem Jungen die Zeit hätte vertreiben können. Regen schwärzte die Trümmer. Die doppeltürmigen Kirchruinen standen starr. Sie glichen Wracks am Grund eines trüben Meeres. Wo ist Nikolai? fragte Sigi unentwegt.
Er ist weg, erklärte Mutter, verschob die genauere Antwort auf später.
Ist er nach Hause gefahren? Da sagte sie ja, fügte aber, seinem Blick ausweichend, hinzu: Frag nicht mehr!
Er glaubte ihr nicht. Da durfte er nicht mehr mit zu Russens und musste wieder zu Gelbkes oder zur Oma, die mit dem Tod unterm selben Dach zu wohnen schien.
Er verschnaufte gerade mit Harald, dessen Freund und Karin von einer Treppenhausjagd, als es klingelte. Sigi war zuerst an der Haustür. Da stand ein hagerer Mann in zerschlissenem Staubmantel. Er trug ein schwarzes Köfferchen mit zwei Bäuchen. Die Tante beugte sich aus der Küche, wo die Selleriekoteletts brutzelten. Sie rief mit veränderter Stimme: Männe! Sie rannte dem Mann, Onkel Männe, Männe Gelbke, von dem so oft die Rede gewesen war, in die Arme und drehte sich mit ihm auf den Dielen des Korridors im Kreis. Onkel Männe kam aus der Gefangenschaft, aber nicht von Russens, sondern von den Amis. Er ließ die Schlösser des Köfferchens springen. Wie eine Nuss klappte es auseinander: Blinkende Konservendosen, Gläser mit Eingemachtem, eine Wurst, Päckchen mit Reis, Tee, Kaffee, Zigaretten, eine Flasche Öl, eine Flasche Schnaps und Seide für eine Bluse. Die Tante stammelte ihr Erstaunen, die Gelbkekinder und der Freund guckten blöd, und Sigi wiederholte einen Satz, den er seine Mutter hatte sagen hören, als sie solche Dinge vom Schwarzmarkt mitbrachte, ein einziges Mal nur, für eine Prämie von Russens: Jetzt hat die liebe Not ein Ende! Das erinnerte die Tante daran, dass Onkel Männe unbedingt zu seiner Schwester gehen und mit ihr ein Wörtchen reden musste.
Er übernahm es, den Jungen nach Hause zu bringen. Mutter wartete schon. Ihr blieb der Mund offen, als sie Onkel Männe sah. Er stellte etwas von dem Mitgebrachten auf den Tisch, bot Mutter eine Zigarette an, sie rauchte mit, und es gab noch einmal Tränen und Gelächter. Wenn nur Kurt auch bald käme, sagte Mutter. Das geht nicht so schnell, wusste der Onkel, die Russen behalten einen länger. Die Russen, sagte er, nicht Russens.
Ob sie eine Nachricht von ihm habe.
Nein, sagte Mutter, er ist vermisst.
Dann fragte er mit leisem Vorwurf, wieso sie überhaupt bei denen arbeite.
Das sind anständige Leute, verteidigte sich Mutter. Sie werden Kurt auch anständig behandeln. Sie hatte gehofft, auf der Kommandantur etwas über Vater zu erfahren. Vielleicht behandeln sie ihn besser, wenn ich … Der Satz erstickte in Schluchzen.
Anständige Leute! äffte Onkel Männe sie nach. Ob sie nicht wisse, was die Russen mit deutschen Frauen gemacht hätten.
Ja! antwortete Mutter mit dem starren Blick, den Sigi an ihr fürchtete. Aber der galt jetzt ihrem Bruder. Sie schien gar nicht zu wissen, dass der Junge in der Stube geblieben war und mit Klötzen an einer großen, prächtigen Stadt baute, deren Schicksal es war, zerstört zu werden.
Und ich weiß auch, wie sie mit denen verfahren! fuhr sie fort. In den Ruinen, ich weiß. Ich kenne einen. Aber die hat sich in seine Schultern verkrallt und ihm eine Achselklappe abgerissen, und als sie antreten ließen, haben sie gesehen, bei wem sie fehlte! Die fackeln da nicht lange. An die Wand stellen die so einen! Sie halten auf Ordnung.
Sigi wusste von Harald, was das heißt: einen an die Wand stellen. Und er wusste auch sofort, dass die Mutter von Nikolai sprach. Er brauchte sich nicht durch eine Frage bemerkbar zu machen. Seine Stadt stand noch. Aber er hörte in seiner Kehle das Jaulen der Glocken, die aus dem durchgeschwelten Gebälk der Kirchtürme herabsausten.
3. KapitelDer Hakelmann
Kein Fluss fließt zurück, sagt Opa Karl, sooft er den Hakelmann zeichnet. Der Hakelmann oder Nickert, Oberhaupt aller Nixen, bewohnt Saale, Bode und Elbe, zeigt manchmal sein zottiges Haupt, die langen Krallen und die schiefe, dreizinkige Gabel und wartet unterm Spiegel eines Wassers auf kleine Jungs, die sich zu dicht heranwagen. Aber wenn Wölfchen in einen Wasserspiegel schaut, erkennt er sich selbst, von den Wellen verzerrt, zottig und schief, wie Opa Karl mit seinem Datterich den Hakelmann malt. Oma lacht, wenn er Opa den Hakelmann mit Datterichzotten nachzeichnet. Ein Taggespenst, die Langeweile, lästiges Geschwister der Nachtgespenster, lässt sich damit auf Abstand bringen. Unsichtbar, nicht abzuschütteln, legt es einem Schnürarme um die Brust. Es lauert auf der Straße im Nachmittagsglanz der Pflastersteine, es faucht aus fremden Haustüren: Scher dich fort, Dreikäsehoch! Es reitet auf dem schwarzen Dachfirst gegenüber, es quillt aus dem Radio als trauriger Blues, kriecht durchs Labyrinth des Teppichmusters, nistet im dunkleren Grau der Zimmerecken. Vater verdient als Handelsreisender, Mutter geht schneidern. Wolfgang Siebensohn erinnert sich später der leeren Stunden wie eines schlechten Geruches, dem man doch nachschnuppert. So riecht der Wunsch nach einem Bruder, die Angst vor der Welt, die Sehnsucht nach einem Anderwärts, das es nicht gibt.
Wolfgang wusste später auch nicht, ob er Wochen, Monate, ganze Jahreszeiten bei den Großeltern in Klüthen verbracht hatte. Die Tage glichen einander wie in der Klüthener Straße, und Klüthen glich der Klüthener Straße. Kein Schlossberg überragte Bode und Mühlgraben. Aber Klüthen hatte einen schiefen Turm. Vater kannte den schiefen Turm von Pisa. Es war kein Zufall, dass es der Krieg gut mit ihm gemeint und ihn nach Italien geschickt hatte, wenn es doch in seiner Geburtsstadt auch einen schiefen Kirchturm gab. Der aber wurde mit den Jahren schiefer und tat wie ein Zeiger, von einem volllaufenden Salzschacht unterirdisch bewegt, ihr Verstreichen kund.
Ob es den Hakelmann gibt oder nicht, das verhält sich wie mit dem lieben Gott, den man nicht sieht und der doch überall Augen und Finger drinhat. Der Hakelmann lauert in der Bode, gleich neben dem Paradies, Opas Garten. Er brummt in den Saalemühlen. Gewiss zieht er auch durch den innerirdischen Salzstrom unter dem schiefen Turm. Er riecht wie Opa Karl nach Pfeifenknaster und Hund. Purzel, der immer dabei ist, wenn die Großeltern den Enkel vom Bahnhof abholen, es sind nur drei Stationen, die Mutter nimmt den nächsten Zug zurück, der weiße Spitz Purzel verbellt den Hakelmann, wenn sie über die Brücken von Mühlgraben und Bode gehen. Das Hündchen grüßt alles Lebendige, Wölfchen auf dem Bahnsteig und, kaum dass sich in der Weißenburger Straße die Wohnungstür einen Spalt auftut, die anderen Tiere. Ein Wellensittich antwortet in der Küche und ein Kanarienvogel, im Lautsprecherloch eines Radios, von einer Sonnenblume ummalt, quiekt ein Meerschweinchen. Weiße Mäuse springen in ihre Laufräder. Im Aquarium schwimmen die Prachtbarben rascher umher. Sie schnappen nach den Fliegen, die Opa Karl, kaum hat er Hut und Stock abgelegt, ihnen mit lederner Klatsche fängt oder aus dem Vorrat einer Blechdose zustreut.
Die Oma, deren Name nicht so wichtig ist, dass er immer genannt werden müsste, packt aus, was Wölfchen mitgebracht hat, Kartoffeln, Brot, Margarine, Quark. Seit der Nervenklinik isst er nichts mehr bei anderen Leuten, auch nicht bei Verwandten. Vergebens hat man ihm gezeigt, dass am Geschirr, an den Speisen nichts Schlimmes ist. Heimweh würgt ihn bei jedem Bissen, der nicht von zu Hause kommt. Aber es ist wieder eine schlechte Zeit, eine Nachkriegszeit. Da empfiehlt es sich sogar, ihm etwas mitzugeben, und bis er merkt, dass er beschummelt wird, ist alles Heimweh abgeflaut.
Nach dem Essen setzt sich Oma in den Armsessel des kleinen Durchgangszimmers, wo im Schatten vielstieliger, rillenblättriger Schusterpalmen leise die Fische platschen, wo Fliegen um senffarbene Leimstreifen summen, wo Tabakblätter, an Fäden hängend, im Luftzug rascheln und die Gärröhrchen der Obstweinballons glucksen. Opa stopft den weißen, von Pfeifenrauch angegilbten Schnauz unter eine Bartbinde, setzt ein Filzkäppi mit Luftlöchern auf seine Glatze, legt sich im Schlafzimmer auf sein Bett und ruft Purzel ans Fußende.
Sein Schnarchen hallt durch einen gemalten Garten. Der Malermeister Karl Siebensohn hat nicht nur Stuben getüncht und gewalzt, Türen und Treppengeländer lackiert, sondern auch alle Verwandten in der Magdeburger Börde mit Heidelandschaften versorgt und sein Schlafzimmer mit Tulpen, Rosen, Narzissen und Sonnenblumen ausgemalt, als wären alle Jahreszeiten auf einen Tag gefallen. In Netzen, mit ein, zwei Pinselhaaren gezogen, lauern Spinnen den Schmetterlingen, Libellen und Hummeln auf. Über den Türrahmen turteln Täubchen, an der Decke spreizen bläuliche Schwalben Schwingen und Gabelschwänze, eine Sonne umflammt das Lampenpendel. Wie sähe die Langeweile aus, hätte Opa Karl sie dazugemalt?
Wölfchen muss auf der Pritsche im Durchgangszimmer ruhen. Er beobachtet, wie Omas Kopf mit dem silbrigen, zur Schnecke gewickelten Haarzopf sich ins Doppelkinn senkt und mit einem Grunzen emporfährt. Er darf sich auch in die gute Stube aufs Sofa legen, unter die beiden geschnitzten Berliner Straßenjungen. Die aber, statt ihn zum Spielen einzuladen, bleiben mit ihren Schiebermützen, die Hände in den Hosentaschen, auf den Konsolen stehen. Was könnten sie auch spielen? Sie stehen unter der Aufsicht der Urgroßmutter.
Opa Karl hat sogar ein Porträt gemalt, ein einziges, von einer Girlande aus Rosen und Maiglöckchen umwunden und in Gold gerahmt: Seine Schwiegermutter. In der Familie gilt sie als rassig. Ihre Augen, von dunkel südlichem Ernst, passen zu ihrem italienischen Mädchennamen wie das streng gescheitelte ergraute Haar zu ihrer Geschichte: Ihr Mann, ein gewisser Gelbke, Flussschiffer, hatte in Pirna seinen Kahn verspielt, war nur mit einem Bündel in Schönebeck erschienen, war, nicht über seine Schwelle gelassen, stockbesoffen zur Elbe gegangen, zum Hakelmann, und nie mehr gesehen worden. Wolfgang fürchtet sich davor, von diesem Bild zu träumen.
Die Langeweile flattert nicht sofort davon, wenn drüben in der Kesselschmiede wieder die Niethämmer losrattern. Die Großeltern schnarchen dagegen an. Er tastet nach Omas Augenlid, zieht es vorsichtig hoch, sieht nur das Weiße, huscht erschrocken weg. Oma erwacht. Purzel bedeutet dem Opa mit kaltschwarzem Schnäuzchen, es sei Zeit, aus dem gemalten Garten in den gewachsenen zu gehen.
Der Handwagen wird aus dem Keller geholt und mit Gartengerät beladen. Es ist der Wagen, der früher Farbtöpfe, Bürsten und Musterwalzen beförderte, als Malermeister Siebensohn und sein Lehrling durch die Straßen von Klüthen und über die Dörfer zogen, bei Leuten klingelten, fragten, ob sie die Stube gemalt haben wollten. Opa Karl war selbstständig gewesen, weil sein Dickkopp keinen Chef ertragen konnte. Fast wäre er Kunstmaler geworden, hätte seine Frau ihm nicht die Stelle in Klüthen verschafft, die er dann doch wieder aufgab.
Oma erzählt es immer dann, wenn Wölfchen alles darf, denn Wölfchen ist Opas Junge, der Stammhalter, der einzige Enkel, der den Namen Siebensohn weitergeben wird. Und er darf wirklich alles, wenn sie durch Klüthen marschieren, als gehe es zu einer Kundgebung, die nicht in der Zeitung steht. Er hatte vom Rummel einen Luftballon, der die Luft durch eine Pfeife entließ. Seit der Gummi geplatzt ist, klemmt Wolfgang das Mundstück in die Zähne und pfeift zum Marschtritt, was er am Ersten Mai Fanfarenbläsern abgelauscht hat. Opa fragt, weil die Pfeife nur einen Ton hat, immer, was es sein soll. Bau auf, bau auf! Das kennt er nicht. Mit uns zieht die neue Zeit! Das kann er mitsingen. Mit ihm zog die neue Zeit schon vor den Nazis. Und wenn sich Leute umdrehen, kläfft der Spitz sie an, und Opa Karl sagt: Immer fiepe man, immer fiepe, mein Junge, wenns dich Spaß macht! Wölfchen korrigiert ihn nicht. Denn nur für Mutter, die aus Sachsen kommt, heißt es DIR.
Opa liebt Musik. Er wird, wenn sie zurückkommen, auf seiner Geige kratzen, die im blauen Himmel des Schlafzimmers neben der Zither hängt, und singen: Goldne Abendsonne, wie bist du so schön. Oder er holt sich den dicken Hubert aus der Mansardenwohnung, setzt ihn auf einen Küchenhocker, lässt ihn Harzerjodlerstücke trällern und gibt ihm einen blauen Fünfzigpfennigschein. In Charlottenburg hat er, als die Möbelpacker kamen, mit der Zither bis zuletzt auf diesem Hocker gehockt und keine Hand gerührt, weil er Kunstmaler werden und in Berlin bleiben wollte, dort, wohin das Flugzeug brummt, das gerade wieder über den Himmel zieht.
Im Garten steht ein Schweizerhäuschen; Malerhand hat Sitze und Tisch in Fliegenpilze verwandelt. Oma macht sich ans Unkraut und beklagt die Wildnis. Opa führt Wolfgang von einem Beerenstrauch zum andern, zu Kirschen und Mirabellen, sein Pfeifchen schmauchend, für das er den Tabak selbst anbaut. Im Wasserbecken haben aber Goldfische ältere Rechte als das Kind. Die Langeweile ist ein Gartenzwerg, der mit der Ziehharmonika auf einer Schnecke reitet. Sie riecht nach Jasmin, Kompost und Plumpsklo mit Zeitung und nährt eine schillernde Fliegenart. Sie setzt sich im Sandhaufen zwischen die ausgeleierten Holzräder der Kipploren. Sie brummt über den Himmel und heißt Luftbrücke. Nicht aus dem Gartentor laufen! Ruft sie. Da fließt die Bode, da sitzt der Nickert drin, der Hakelmann, der holt sich kleine Jungs, die sich rumtreiben. Wölfchen treibt sich mit einem schiefrädrigen Holzroller herum, läuft mit Kindern, die ihn Wojank rufen, hänselnd einer alten Zauchtel nach, gelangt, wieder allein, ans Hintertor der Gartenkolonie, wo die Bode fließt.
Dort öffnet sich die stille Landschaft. Ein Zug dampft eine korngelbe Bodenwelle entlang, zu der heiß die Sonne niedersteigt. Er hat kein Heimweh mehr; zu Hause riecht die Langeweile nur anders. Die unbekannte Ferne lockt. Wolfgang wünscht sich Brüder oder einen Freund. Das Tor ist stets verschlossen. Im geriffelten Spiegelbild gleißender Wolkenränder lauert der Hakelmann. Und wenn es mir nun beim Hakelmann gefiele? Wozu bin ich auf der Welt? Um den Eltern zu gehorchen, Opa und Oma eine Freude zu machen, bald in die Schule zu gehen, was Ordentliches zu werden und dem lieben Gott zu gefallen. Da kommt er sich vor wie die Kirschen und Beeren, die in Mutters Kochbuch auf wurmdünnen Beinchen über Leitern selber in die Einweckgläser wandern, um gekocht zu werden. In Opas Garten, den alle, keine Widerrede duldend, ein Paradies nennen, ist es wirklich schön. Aber man fühlt sich auch wie ein Gefangener.
Den Winter mit seinen früh erlöschenden Tagen erlebt er wie einen Tunnel. Einmal wird er durchleuchtet. Ob einer TBC hat, einen Schatten auf der Lunge, oder nicht, ist so wichtig geworden wie ob einer Nazi war. Fremde gespenstische Menschen im Dunkel von Vorhängen und Türen. Wie im Luftschutzkeller. Im kalten Licht eines Fensters, hinter das sich ein Nächster gestellt hat, weitet ein Gerippe seinen Brustkorb, zuckt wie ein Sack ein anderes Herz als das, das ihm im Halse schlägt. Eine Stimme findet die Lungen beiderseits hell. Sein eigener Befund, er hat nicht aufgepasst, macht Mutter Sorge: Ein kleiner Schatten. Halb, aber nur halb gehört er nun zu den Lungenkranken, von denen man, weil sie ansteckend sind, spricht, als wären sie schmutzig. Er muss besondere Dinge essen, sonst wird er sterben. Die meisten gibt es nicht. Lebertran gibt es in der Herz-Drogerie, den muss er schlucken mit zugehaltener Nase. Onkel Heinrich schickt aus Westberlin einen Lebertran, der nach Apfelsine schmeckt, ein Hauch Bonbon, eine trügerische Haut auf dem Trangeschmack. Nach Tran schmeckt auch der Fisch, den er in Happen hinterwürgt auf viel Brot, der Bückling und der Bismarckhering, einen Happen für Opa Karl, der wie der eiserne Bismarck auf dem Lindenplatz aussieht, einen für Oma und einen für Kaiser Wilhelm, der jetzt Pieck heißt. Er würgt; der Fisch würgt zurück. Alles kommt wieder raus, Mutter sagt mit weiten Augen: Er kanns halt doch nicht. Und er ist stolz auf seinen Körper, der den elterlichen Willen bricht.
Man will nicht, dass sein Hals wieder steif wird. Vater setzt ihn auf den Kindersattel und radelt ihn mit kurbelnden Knickerbockerschenkeln durch die Auen nach Reckenstedt zum Bauern, einem Kriegskameraden. Die Bäuerin, schlank und krank, das Haar zum Storchennest gesteckt, zeigt sich nur kurz unter der Erntekrone aus Roggenähren, Haferwedeln, Klatschmohn und Kornblumen, die im Luftzug des Hausflurs schaukelt. Die dicke Ella in der weißen Gummischürze lächelt aus fast nackten Äuglein und bietet Platz an im Herrenzimmer. Die Speichenräder einer Kutsche rattern, Pferdehufe klappern unterm Taubenschlag über die Katzenköpfe des Gutshofes und um den Dunghaufen wie sonntags in aller Frühe durch die Klüthener Straße. Denn Schwinhorsts sind katholisch. Sie gehen nicht in die evangelische Dorfkirche. Ein Peitschenknall ruft den Knecht zum Ausspannen.
Vater raucht mit dem Bauern unter einem Kronleuchter aus Hirschgeweihen in ledernen Sesseln. Sie lachen viel. Sie reden einander mit Kurt an. Alle Väter heißen Kurt. Sie haben viel im Krieg erlebt, waren immer schlauer als andere, hatten fast immer Glück, und dass der Krieg verloren war, lag nur an Adolf. Der Ami, der Tommy, der Russe, die Partisanen, er hatte sich einfach zu viel vorgenommen. Was sich der Ami geholt hat, Fotoapparat, Schmalfilmkamera, Schreibmaschine, kann nun der Russe nicht mehr klauen. Eine Decke ließ der Ami da, seither die Amidecke. Gut, dass er das Hitlerbuch mitnahm; so wars fort, als der Russe kam.
Wolfgang fragt: Und wenn wir den Krieg gewonnen hätten? Die Männer lachen freudlos. Einmal hat Vater geantwortet: Dann hätten wir ein Auto und könnten nach Italien fahren. Jetzt sagt er: Dann hätten wir satt zu essen und ein Haus auf der Krim. Da ist es fast wie in Italien. Italien kennt Wölfchen. Sonntagmorgens, wenn Schwinhorsts Kutsche unten vorüberrattert, darf er sich zu den Eltern in die Besuchsritze legen. Dann fahren sie mit dem Auto nach Italien. Wölfchen macht den Motor, Vater beschreibt, was es zu sehen gibt, Mutter bewundert den Schnee am Brennerpass, die blühenden Bäume Südtirols, Bozen, den Gardasee, den schiefen Turm von Pisa, muss sich merken, dass die Zypresse ein geschlossener Regenschirm ist, die Pinie ein offener.
Aber die Krim, wo ist das, will Wolfgang wissen.
Weit von hier. In Russland.
Dann hätten also wir dem Russen alles geklaut? Das denkt sich Wolfgang aber nur. Vater äfft schon wieder mit gepresster Kehle einen Feldwebel nach, stolz, dass der Bauer lacht. Wolfgang ahnt, er muss hierbleiben. Von Durchfüttern war die Rede. Vater besteigt sein Rad allein. Wölfchen klammert sich an die Knickerbocker. Du willst doch ein Mann werden!
Muss ich auch Soldat werden?
Schon möglich.