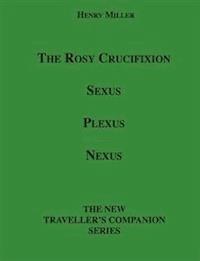8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Der Autor der vielumstrittenen «Wendekreis»-Bücher bekennt sich hier mit leidenschaftlicher Diesseitsfrömmigkeit zu einem Leben fern aller Zivilisation, in ursprünglichem Einverständnis von Mensch und Natur, wie er selbst es lange Jahre in bizarrer Einöde an der kalifornischen Küste im Kreise von Künstlern, Intellektuellen und gleichgesinnten Originalen verwirklichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Henry Miller
Big Sur und die Orangen des Hieronymus Bosch
Aus dem Englischen von Kurt Wagenseil
Über dieses Buch
Der Autor der vielumstrittenen «Wendekreis»-Bücher bekennt sich hier mit leidenschaftlicher Diesseitsfrömmigkeit zu einem Leben fern aller Zivilisation, in ursprünglichem Einverständnis von Mensch und Natur, wie er selbst es lange Jahre in bizarrer Einöde an der kalifornischen Küste im Kreise von Künstlern, Intellektuellen und gleichgesinnten Originalen verwirklichte.
Vita
Henry Miller, der am 26. Dezember 1891 in New York geborene deutschstämmige Außenseiter der modernen amerikanischen Literatur, wuchs in Brooklyn auf. Die dreißiger Jahre verbrachte Miller im Kreis der «American Exiles» in Paris. Sein erstes größeres Werk, das vielumstrittene «Wendekreis des Krebses», wurde – dank des Wagemuts eines Pariser Verlegers – erstmals 1934 in englischer Sprache herausgegeben. In den USA zog die Veröffentlichung eine Reihe von Prozessen nach sich; erst viel später wurde das Buch in den literarischen Kanon aufgenommen. Henry Miller starb am 7. Juni 1980 in Pacific Palisades, Kalifornien.
Inhaltsübersicht
Für Emil White vom Anderson Creek, einen der wenigen Freunde, die mich nie enttäuscht haben
Ich bin überzeugt, daß das Leben auf dieser Erde keine Qual, sondern ein angenehmer Zeitvertreib ist, wenn wir einfach und klug leben.
THOREAU
Zu meinem Kummer und zu meinem Vergnügen gehe ich mit den Dingen nach meinem Gutdünken um … Ich bringe alles in meine Bilder, was mir gefällt. Um so schlimmer für die Dinge – sie müssen sehen, wie sie miteinander auskommen.
ICASSO
Ich habe die Malerei geliebt, seitdem ich im Alter von sechs Jahren mit ihr bekannt wurde. Ich malte einige Bilder, die mir ziemlich gut erschienen, als ich fünfzig war, aber in Wirklichkeit waren alle meine Sachen nichts wert, bevor ich die Siebzig erreicht hatte. Mit dreiundsiebzig habe ich schließlich jede Seite der Natur erfassen können – Vögel, Fische, Säugetiere, Insekten, Bäume, Gräser, kurz, alles. Wenn ich achtzig bin, werde ich mich noch weiter entwickelt haben, und mit neunzig werde ich die Geheimnisse der Kunst wirklich meistern. Wenn ich hundert Jahre alt werde, könnte man meine Kunst vielleicht als vollkommen bezeichnen, aber mein letztes Ziel werde ich erst mit hundertzehn erreichen, wo dann jede Linie und jeder Strich voll Leben sein werden.
HOKUSAI, «Der kunsttolle alte Mann»
Vorwort
Dieses Buch besteht aus drei Teilen und einem Epilog, der ursprünglich als Flugschrift unter dem Titel: Dies ist meine Antwort! erscheinen sollte. Ich schrieb ihn 1946, als ich in Anderson Creek wohnte, und habe ihn seitdem gekürzt und umgearbeitet. Er bildet jetzt eine Art Wurmfortsatz, den man zuerst oder zuletzt lesen kann, wie es dem Leser beliebt.
Ich hatte beabsichtigt, eine Bibliographie meiner veröffentlichten Werke, und zwar sowohl der amerikanischen und englischen als auch der fremdsprachlichen Ausgaben hinzuzufügen, aber das ist ja nun in einem kürzlich veröffentlichten Buch geschehen, auf das ich interessierte Leser hinweise.[*]
Das einzige Werk, an dem ich jetzt arbeite, ist Nexus, der Schlußband der Trilogie The Rosy Crucifixion. Von The World of Lawrence sind Bruchstücke in einem Sammelband bei New Directions erschienen, die weitere Arbeit an diesem Buch habe ich aber seit langem aufgegeben. Draco and the Ecliptic ist noch nicht ausgebrütet.
Die folgenden Bücher, die alle, mit einer Ausnahme, ursprünglich auf englisch in Paris erschienen und von denen die meisten ins Französische, Deutsche, Dänische, Schwedische und Japanische übersetzt sind, durften jahrelang nicht in Amerika veröffentlicht werden: Tropic of Cancer[*], Aller Retour New York, Black Spring[*], Tropic of Capricorn[*], The World of Sex, The Rosy Crucifixion (Sexus und Plexus [*]). Sexus darf gegenwärtig in Frankreich auch nicht veröffentlicht werden, in keiner Sprache. In Japan ist die japanische Ausgabe dieses Buches, aber nicht die englische, verboten worden. Quient Days in Clichy, das gerade in Paris in Druck gegangen ist, wird wahrscheinlich auch verbrannt werden – hier und anderswo.
Der einfachste Weg, die verbotenen Bücher zu erhalten, wäre ein Sturm auf die Zollhäuser in allen unseren Einfuhrhäfen.
Meinen wärmsten Dank spreche ich Charles Haldeman aus, der den weiten Weg von Winter Park in Florida zurücklegte, um mir Wilhelm Fraengers Buch über Hieronymus Bosch zu übergeben. Möge er mir verzeihen, daß ich ihn an jenem Tage so wenig feierlich empfangen habe!
Zeitliches
Anfang 1930 verließ ich New York mit der Absicht, nach Spanien zu gehen. Ich gelangte nie dorthin. Dafür blieb ich bis Juni 1939 in Frankreich. Dann fuhr ich nach Griechenland, weil ich dringend Entspannung brauchte. Anfang 1940 mußte ich Griechenland wegen des Krieges verlassen und kehrte nach New York zurück. Bevor ich mich in Kalifornien niederließ, zog ich ein ganzes Jahr in Amerika umher, das war der «Albdruck mit Klimaanlage». Während dieser Zeit von zweieinhalb Jahren schrieb ich The Colossus of Maroussi[*], The World of Sex, Quiet Days in Clichy[*], Teile von The Air-conditioned Nightmare und das erste Buch von The Rosy Crucifixion (Sexus).
Im Juni 1942 ließ ich mich für immer in Kalifornien nieder. Über ein Jahr lang wohnte ich in Beverley Glen, gleich vor Hollywood. Dort traf ich Jean Varda, der mich veranlaßte, nach Monterey auf Besuch zu kommen. Das war im Februar 1944. Ich blieb mehrere Wochen bei Varda in seiner «Roten Scheune» und machte dann auf seine Anregung hin einen Ausflug nach Big Sur, um Lynda Sargent zu besuchen. Lynda wohnte damals in dem Blockhaus, um das später das berühmte «Nepenthe» erbaut wurde. Ich blieb dort zwei Monate als Gast. Dann bot mir Keith Evans, der damals zum Heeresdienst eingezogen war, sein Blockhaus auf Partington Ridge an – durch Lynda Sargents Bemühungen. Hier blieb ich von Mai 1944 bis Januar 1946. Während dieser Zeit machte ich eine kurze Reise nach New York, verheiratete mich wieder in Denver und bekam eine Tochter, Valentine. Nach Keith Evans' Rückkehr ins bürgerliche Leben mußten wir uns ein anderes Quartier suchen. Im Januar 1946 zogen wir nach Anderson Creek, fünf Kilometer weiter, wo wir eine der ehemaligen Sträflingsbaracken mieteten, die am Rande einer Klippe gelegen war. Im Februar 1947 kehrten wir nach Partington Ridge zurück und bezogen das Haus, das ursprünglich Jean Wharton für sich gebaut hatte. Am Ende dieses Jahres traf Conrad Moricand bei uns ein, harrte aber nur ein Vierteljahr auS. 1948 wurde mein Sohn Tony geboren.
Partington Ridge liegt etwa zwanzig Kilometer südlich vom Postamt Big Sur und etwa sechzig Kilometer von Monterey entfernt. Abgesehen von einer Vergnügungsreise nach Europa im Jahre 1953, als ich wieder heiratete, habe ich seit Februar 1947 ständig auf Partington Ridge gelebt.
Topographisches
An einem Februartag vor zwölf Jahren, bei einem heftigen Platzregen, kam ich in Big Sur an. Am Abend desselben Tages aß ich nach einem verjüngenden Bad im Freien in den heißen Schwefelquellen (Slades Quellen) bei dem Ehepaar Ross in der sonderbaren Hütte, die sie damals in Livermore Edge bewohnten. Damit fing etwas mehr als eine Freundschaft an. Man könnte es vielleicht besser eine Einweihung in ein neues Leben nennen.
Erst ein paar Wochen nach dieser Begegnung las ich Lillian Ross' Buch Der Fremde. Bis dahin war ich hier nur auf Besuch gewesen. Aber die Lektüre dieses «kleinen Klassikers», wie man das Buch nennt, bestärkte mich in meinem Entschluß, hier Wurzel zu fassen. In Zuande Aliens Worten «fühlte ich mich zum erstenmal in der Welt, in die ich hineingeboren war, heimisch».
Jahre vorher besang unser großer amerikanischer Dichter Robinson Jeffers in seinen Prosagedichten diese Gegend zum erstenmal. Jack London und sein Freund George Stirling besuchten diesen Landstrich oft in nun längst vergangenen Tagen. Sie legten den langen Weg vom Mondtal her zu Pferd zurück. Im allgemeinen wußten die Leute aber von diesem Teil des Landes so gut wie gar nichts, bis 1937 die Carmel-San-Simeon-Straße eröffnet wurde, die sich achtzig oder mehr Kilometer an der Küste des Stillen Ozeans entlangzieht. Bis dahin war dies tatsächlich die unbekannteste Gegend in ganz Amerika.
In den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts kamen die ersten Ansiedler hierher, meistens abgehärtete Bergbewohner, Abkömmlinge der ersten Pioniere des Westens. Sie waren nach den Worten von Lillian Ross den Büffelpfaden gefolgt und verstanden es, von ungesalzenem Fleisch zu leben. Sie kamen zu Fuß und zu Pferd, und sie hatten Boden unter sich, den Weiße noch nie betreten hatten, nicht einmal die unerschrockenen Spanier. Soweit man weiß, waren die Esselen-Indianer die ersten menschlichen Wesen, die vorher hier gewesen waren, ein auf niedriger Kulturstufe stehender Stamm, der ohne feste Wohnsitze umherschweifte. Diese Indianer sprachen eine Sprache, die in keinem Zusammenhang mit der anderer kalifornischer oder sogar amerikanischer Stämme stand. Als um 1770 die Padres nach Monterey kamen, erzählten ihnen die Indianer von einer alten Stadt Excelin, die ihnen einmal gehört habe, von der aber nie Spuren gefunden worden sind.
Doch vielleicht sollte ich zuerst erklären, wo die Gegend von Big Sur eigentlich liegt. Sie beginnt nicht weit nördlich vom Kleinen Sur (Malpaso Creek) und erstreckt sich bis Lucia, das wie Big Sur auch nur ein nadelspitzer Punkt auf der Karte ist. Von der Küste geht sie ostwärts bis zum Salinastal. Ungefähr umfaßt die Gegend von Big Sur eine Fläche von der zwei- oder dreifachen Größe der Republik Andorra.
Manchmal fällt einem Besucher die Ähnlichkeit dieser Küsten mit gewissen Teilen des Mittelmeergestades auf; andere vergleichen sie mit der Küste Schottlands. Aber solche Vergleiche besagen nichts. Big Sur hat ein eigenes Klima und einen eigenen Charakter. Hier berühren sich die äußersten Gegensätze. Es ist eine Gegend, wo man sich immer des Wetters, des Raumes, der Großartigkeit der Landschaft und ihres beredten Schweigens bewußt ist. Hier treffen sich die Zugvögel aus Nord und Süd. Es sollen hier tatsächlich mehr Vogelarten zu finden sein als in irgendeinem anderen Teil der Vereinigten Staaten. Es ist auch die Heimat der Mammutbäume. Man stößt auf sie, wenn man nach Norden kommt, und läßt sie hinter sich, wenn man sich südwärts wendet. Nachts kann man noch den Präriewolf heulen hören, und wenn man sich über die nächste Bergkette traut, kann man Berglöwen und anderen wilden Tieren begegnen. Der graue Bär ist hier nicht mehr zu finden, aber mit der Klapperschlange muß man noch rechnen. An klaren, hellen Tagen, wenn das Blau des Meeres mit dem des Himmels wetteifert, kann man Habichte, Adler, Bussarde über den tiefen Canyons sehen, aus denen kein Laut dringt. Im Sommer, wenn die Nebel heranrollen, sieht man von oben auf ein langsam über den Ozean hinflutendes Wolkenmeer. Oft sehen diese Wolken wie große, in Regenbogenfarben schillernde Seifenblasen aus, über die sich dann und wann ein doppelter Regenbogen spannt. Im Januar und Februar sind die Berge am grünsten, fast so grün wie die Smaragdinsel. November bis Februar sind die besten Monate, die Luft ist dann frisch und kräftigend, der Himmel rein und klar, die Sonne noch so warm, daß man ein Sonnenbad nehmen kann.
Von unserem Horst, der etwa dreihundert Meter über dem Meer liegt, kann man die Küste nach beiden Richtungen dreißig Kilometer weit überblicken. Die Zickzackkrümmungen der Straße lassen einen an die Grande Corniche denken. Anders als an der Riviera aber sind hier weniger Häuser zu sehen. Wer schon länger hier ist und umfangreichen Landbesitz hat, ist nicht begierig darauf, die Gegend für den Fremdenverkehr geöffnet zu sehen. Sie wollen alle ihren jungfräulichen Charakter erhalten. Wie lange wird sie sich gegen die Eindringlinge wehren können? Das ist die große Frage.
Die Aussichtsstraße, von der ich oben schon gesprochen habe, hat sehr viel Geld gekostet und wurde buchstäblich aus dem Felsen herausgesprengt. Sie bildet jetzt einen Teil der großen internationalen Autostraße, die eines Tages vom Norden Alaskas bis nach Feuerland führen wird. Wenn sie fertig ist, kann vielleicht das Auto, wie früher das Mastodon, ausgestorben sein. Aber Big Sur wird für immer bestehen, und möglicherweise wird im Jahre 2000 die Bevölkerung auch nur ein paar hundert Seelen zählen. Vielleicht wird es dann wie Andorra und Monaco eine Republik für sich sein. Vielleicht werden die gefürchteten Eindringlinge nicht aus anderen Teilen des amerikanischen Festlandes, sondern über den Ozean kommen, auf welchem Wege ja ehemals die Indianer hierher gelangt sein sollen. Dazu werden sie dann aber keine Schiffe oder Flugzeuge benutzen.
Und wer kann sagen, wann dieses Gebiet wieder einmal von den Wassern der Tiefe bedeckt sein wird? Geologisch gesprochen ist es noch gar nicht so lange her, daß es sich aus dem Meer erhoben hat. Seine Berghänge sind fast so verräterisch wie das eisige Wasser, in dem man übrigens kaum je ein Boot oder einen abgehärteten Schwimmer sieht, wohl aber gelegentlich einen Seehund, einen Seeotter oder einen Pottwal. Das Meer, das scheinbar so nahe ist und so verlockend aussieht, ist oft schwer zu erreichen. Wir wissen, daß es den Konquistadoren nicht möglich war, an der Küste entlangzuziehen, auch konnten sie sich nicht den Weg durch den Busch bahnen, der die Berghänge bedeckt. Ein einladendes Land, aber schwer zu erobern. Es versucht, unberührt und unbewohnt zu bleiben.
Wenn ich dem Pfad folge, der sich über die Berge schlängelt, reiße ich mich manchmal zusammen und bemühe mich, die Pracht und die Großartigkeit der Aussicht in mich aufzunehmen. Wenn sich die Wolken im Norden auftürmen und das Meer von tanzenden Schaumkronen bedeckt ist, sage ich mir manchmal: «Das ist das Kalifornien, von dem die Menschen früher träumten, dies ist der Pazifik, auf den Balboa von den Bergen Dariens hinausblickte, dies das Gesicht der Erde, wie es der Schöpfer haben wollte.»
Im Anfang
Ehemals, in alten Zeiten, gab es nur spukhafte Schatten. Im Anfang der Dinge, wenn jemals ein Anfang war.
Es war eine wilde Felsenküste, trostlos und abschreckend für Pflastertreter, einladend und bezaubernd für Taliessins. Dem Kleinhäusler gelang es nie, frische Sorgen auszugraben.
An Vögeln fehlte es nie, Raubvögel und Aasgeier hoch oben im Blau, Zugvögel in Mengen. (Zuweilen schwebte der Kondor vorüber, groß wie ein Ozeandampfer.) Das Gefieder war schön bunt, aber die Schnäbel waren hart und grausam. Sie schossen über dem Horizont hervor wie Pfeile, die an einer unsichtbaren Schnur befestigt sind. Wenn sie nahe waren, schien es ihnen Spaß zu machen, herunterzusausen, zu tauchen, zuzupacken, Purzelbäume zu schlagen. Einige fühlten sich an den Klippen und an der Brandung wohl, andere suchten die Talschluchten auf, die rotbehelmten Hügel, die marmorweißen Gipfel.
Da waren auch die kriechenden, schleichenden Geschöpfe, einige träge wie das Faultier, andere voll Gift, aber alle merkwürdig schön. Die Menschen fürchteten sie mehr als die unsichtbaren, die bei Anbruch der Nacht wie Affen schwatzten.
Wenn man sich vorwärts bewegte, ob zu Fuß oder im Sattel, mußte man mit Stacheln, Dornen und Schlingpflanzen kämpfen, mit allem, was sticht, haftet, stößt und Gift spritzt.
Wer lebte hier zuerst? Vielleicht Troglodyten. Der Indianer kam erst spät. Sehr spät.
Obwohl das Land im geologischen Sinn jung ist, hat es doch ein altersgraues Aussehen. Aus den Ozeantiefen stiegen sonderbare Felsgebilde auf, mit eigenartigen verführerischen Umrissen. Als wenn die Titanen der Tiefe Äonen gearbeitet hätten, um die Erde zu modeln und zu formen. Selbst vor Tausenden von Jahren waren die großen Landvögel verdutzt, wenn sie plötzlich diese seltsamen Gebilde sahen.
Es sind keine nennenswerten Ruinen oder sonstigen Überreste vorhanden. Ein geschichtsloses Land. Was nicht war, spricht beredter als das, was war.
Hier bezog der Mammutbaum seine letzte Verteidigungsstellung.
In der Morgendämmerung tut es fast weh, diesen majestätischen Baum zu betrachten. Auch er hat dasselbe vorgeschichtliche Aussehen. Als wäre er immer da gewesen und würde immer da sein. Im Spiegel der Ewigkeit lächelt die Natur über sich selbst.
Weit unten liegen die Seehunde auf dem warmen Felsen, ein Gewimmel wie von fetten braunen Würmern. Über dem ständigen Tosen der Brandung kann man ihr heiseres Bellen meilenweit hören.
Gab es einmal zwei Monde? Warum nicht? Es gibt Berge, die ihre Kopfhaut verloren haben, Ströme, die unter hohem Schnee kochen. Dann und wann poltert die Erde, um eine Stadt dem Erdboden gleichzumachen oder eine neue Goldader zu öffnen.
Nachts leuchtet der Boulevard von Rubinaugen.
Und was gleicht dem Sprung eines Fauns, wenn er plötzlich aus dunkler Leere stürzt? Gegen Abend, wenn alles verstummt, wenn die geheimnisvolle Stille niedersinkt, alles umschließt, alles sagt.
Jäger, lege dein Gewehr hin! Nicht die Erschlagenen klagen dich an, sondern die Stille, die Leere. Du lästerst Gott.
Ich sehe den einen, der dies alles träumt, wenn er unter den Sternen dahinfährt. Schweigend betritt er den Wald. Jeder Zweig, jedes abgefallene Blatt – eine nicht enträtselbare Welt. Durch das gezackte Laub sprüht das zersplitterte Licht Edelsteine der Phantasie. Große Köpfe tauchen aus ihnen auf, die Reste gestohlener Riesen.
«Mein Pferd! Mein Land! Mein Königreich!» Das Gestammel von Idioten.
Im Rhythmus der Nacht atmen Pferd und Reiter tief den Duft von Tannen-, Kampfer- und Eukalyptusbäumen ein. Der Friede breitet seine nackten Schwingen aus.
War es jemals anders gedacht? Sollte es nicht immer so sein?
Liebe, Güte, Friede und Barmherzigkeit. Weder Anfang noch Ende. Die Wiederkehr, die ewige Wiederkehr.
Und immer weicht das Meer zurück. Der Mond zieht es hinter sich her. Nach Westen, neues Land. Neue Erdgestalten. Träumer, Ausgestoßene, Vorläufer. Weiter gegen die andere Welt, die Welt, die einst war und weit weg ist, die Welt von gestern und morgen.
Die Welt innerhalb der Welt.
Von welchem Lichtreich waren wir Schatten, welche die trächtige Erde verdunkeln?
Erster TeilDie Orangen des Tausendjährigen Reiches
Die kleine Gemeinde, die zuerst nur aus dem sagenhaften «Ausländer» Jaime de Angulo bestand, hat sich auf ein Dutzend Familien vermehrt. Der Berg (Partington Ridge) nähert sich seinem Sättigungspunkt, so schnell geht das hier. Der große Unterschied zwischen dem Big Sur, das ich vor elf Jahren vorfand, und dem heutigen besteht darin, daß jetzt so viele Kinder geboren werden. Die Mütter scheinen hier ebenso fruchtbar zu sein wie der Boden. Die kleine Landschule, nicht weit vom Staatspark gelegen, ist schon fast überfüllt. Sie gehört zu jener Art Schulen, die zum großen Nachteil unserer Kinder schnell vom amerikanischen Boden verschwinden.
Wer weiß, wie es hier in zehn Jahren aussehen wird! Wenn man hier Uran oder anderes für Kriegszwecke wichtiges Material findet, wird Big Sur bald nur noch eine Legende sein.
Schon heute ist es kein Vorposten mehr. Die Ausflügler und Besucher nehmen von Jahr zu Jahr zu. Emil Whites Führer durch Big Sur allein bringt Schwärme von Touristen an unsere Türen. Was mit jungfräulicher Bescheidenheit begonnen wurde, droht als Goldgrube für Reisebüros zu enden. Die ersten Ansiedler starben weg. Sollte ihr Landbesitz in kleine Parzellen aufgeteilt werden, kann sich Big Sur schnell zu einem Vorort (Montereys) entwickeln, mit fahrplanmäßigem Omnibusverkehr, Wurstbratereien, Tankstellen, Geschäftsfilialen und all dem anderen widerlichen Firlefanz, der einen Vorort so schauderhaft macht.
Du siehst aber schwarz, wird man sagen. Mag sein, daß uns die sonstigen mit dem Fortschritt verbundenen Greuel erspart bleiben. Vielleicht bricht inzwischen, ehe wir herausgesetzt werden, das Tausendjährige Reich an.
Ich denke gerne an meine erste Zeit auf Partington Ridge zurück. Damals gab es hier noch kein elektrisches Licht, kein Propangas, keine Kühlschränke, und die Post kam nur dreimal in der Woche. Damals und selbst später noch kam ich ohne Auto aus. Ich hatte allerdings einen kleinen Wagen (der einem Kinderspielzeug nicht unähnlich war), den Emil White für mich zusammengezimmert hatte. Ich hatte leider keinen Ziegenbock, den ich vorspannen konnte, und so mußte ich mich selbst ins Geschirr legen. Geduldig zog ich damit die Post und alles, was ich (meistens für andere) eingekauft hatte, einen etwa zweieinhalb Kilometer langen steilen Weg hinauf. Wenn ich an die Straßenkehre bei Roosevelts kam, zog ich bis zum Schulterzugriemen alles aus, was ich anhatte. Was sollte mich davon abhalten?
Damals kamen fast nur junge Leute zu Besuch, die kurz vor dem Militärdienst standen oder gerade entlassen worden waren. (Die jungen Leute sind heute noch immer mit dem Militär beschäftigt, obwohl der Krieg 1945 zu Ende ging.) Die meisten dieser jungen Burschen waren Künstler oder wären gerne welche gewesen. Manche blieben und schlugen sich jämmerlich durch. Manche kamen später wieder und machten dann den Versuch, durchzuhalten. Sie waren alle von der Sehnsucht erfüllt, dem schauderhaften Leben der Gegenwart zu entgehen, und entschlossen, lieber wie Ratten zu leben, wenn sie nur in Ruhe und Frieden leben könnten. Eine sonderbare Gesellschaft war das! Einer der ersten, die sich hier verkrochen, war Judson Crews aus Waco in Texas. Er erinnerte einen wegen seines struppigen Bartes und seiner Redeweise an einen Mormonen. Er lebte fast ausschließlich von Erdnußbutter und wildem, grünem Senf. Er rauchte und trank nicht. Norman Mini, der schon eine ungewöhnliche Laufbahn hinter sich hatte – sie fing damit an, daß er wie einst Poe aus West Point entlassen wurde –, blieb (mit Frau und Kind) lange genug, um einen Anfängerroman zu vollenden – den besten Anfängerroman, den ich je gelesen habe und der deshalb noch unveröffentlicht ist. Norman unterschied sich dadurch von den anderen, daß er zwar auch arm wie eine Kirchenmaus war, aber einen Keller hatte, an dem er sehr hing. Er enthielt einige der feinsten Weine, die man sich nur wünschen konnte (inländische und ausländische). Walker Winslow schrieb damals gerade seinen Roman Wenn der Mensch verrückt ist, der ein Erfolgsschlager wurde. Walker schrieb mit Eilzuggeschwindigkeit und anscheinend ohne Unterbrechung in einer winzigen Hütte an der Straße, die einmal White gebaut hatte, um den ständigen Strom von Herumstreichern abzufangen, die ihm Tage, Wochen, Monate, ja, Jahre auf der Pelle lagen.
Alles in allem sind seit meiner Ankunft etwa hundert Maler, Schriftsteller, Tänzer, Bildhauer und Musiker hier gewesen und wieder abgezogen. Mindestens ein Dutzend besaß echtes Talent und kann noch Spuren in der Welt hinterlassen. Der einzige, der zweifellos ein Genie und der bemerkenswerteste von allen außer Varda war, der aber einer früheren Zeit angehörte, war Gerhart Münch aus Dresden. Gerhart gehört in eine eigene Kategorie. Als Pianist ist er unübertrefflich, wenn nicht unvergleichlich. Er ist auch Komponist und dazu noch gelehrt bis in die Fingerspitzen. Wenn er nichts Weiteres getan hätte, als uns Skrjabin zu interpretieren – und er tat weit mehr, leider ohne Ergebnis! –, müßten wir in Big Sur ihm für immer dankbar sein.
Da ich gerade von Künstlern spreche – es ist sonderbar, daß nur wenige von dieser Gilde es hier lange aushalten. Fehlt hier etwas? Oder gibt es hier vielleicht zuviel – allzuviel Sonnenschein, zuviel Nebel, zuviel Freude und Zufriedenheit?
Fast jede Künstlerkolonie verdankt ihren Beginn dem Verlangen eines reifen Künstlers, sich der Clique, die sich an ihn hängt, zu entziehen und mit ihr zu brechen. Der ausgewählte Platz ist gewöhnlich ideal, besonders für den Entdecker, der den größten Teil seines Lebens in dumpfen Löchern und Dachstuben zugebracht hat. Die «möchte-gern»-Künstler, für die Ort und Atmosphäre von überragender Bedeutung sind, bringen es immer fertig, einen solchen stillen Winkel in eine lärmende, operettenhafte Kolonie zu verwandeln. Es bleibt abzuwarten, ob dies auch mit Big Sur geschehen wird. Glücklicherweise gibt es einige Abschrekkungsmittel.
Ich bin davon überzeugt, daß der noch nicht ausgereifte Künstler selten in einer idyllischen Umgebung gedeiht. Er braucht in erster Linie, obschon man so etwas nie wie ein Rezept empfehlen kann, Lebenserfahrung aus erster Hand – bittere Erfahrungen, um es deutlicher zu sagen, mehr Kampf, mehr Entbehrungen, mehr Schmerz, tiefere Enttäuschungen. Er darf nicht hoffen, solche Anstachelungen oder Stimulantien hier in Big Sur zu finden. Wenn er nicht auf der Hut ist, wenn er nicht bereit ist, sich ebenso mit Phantomen wie mit bitteren Wirklichkeiten herumzuschlagen, kann er hier leicht geistig und seelisch einschlafen. Wenn sich hier eine Künstlerkolonie niederlassen sollte, wird sie den Weg aller anderen gehen. Künstler gedeihen nicht in Kolonien. Ameisen eher. Der Künstler braucht im Anfang vor allem das Vorrecht, mit seinen Problemen in Einsamkeit ringen zu können – und dann und wann ein gutes, saftiges Beefsteak.
Wer für sich leben will, für den ist das Hauptproblem, lästige Besuche fernzuhalten. Man kann sich nie darüber klarwerden, ob Besuche ein Fluch oder ein Segen sind. Bei all der Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gesammelt habe, weiß ich noch immer nicht, wie oder ob ich mich gegen die ständige Invasion, gegen die schnüffelnde, zudringliche Spezies des «homo fatuoso» schützen soll. Sie besitzt die erstaunliche Fähigkeit, mich immer im ungeeignetsten Augenblick zu überfallen. Ein schwerer zugängliches Versteck zu suchen, halte ich für nutzlos. Der Besuchsfanatiker, der sich in den Kopf gesetzt hat, einen unbedingt kennenzulernen, wenn auch nur um einen Händedruck auszutauschen, würde sich nicht scheuen, selbst den Himalaja zu erklimmen, um sein Ziel zu erreichen.
Ich habe seit langem bemerkt, daß man in Amerika jedem Besucher schutzlos preisgegeben ist. Es wird von einem erwartet, daß man jederzeit zur Verfügung steht, sonst wird man als komischer Kauz angesehen. Nur in Europa leben Schriftsteller hinter Gartenmauern und verschlossenen Türen.
Zu allen anderen Problemen, mit denen er fertig werden muß, hat der Künstler auch noch einen ständigen Kampf um seine Freiheit zu führen, einen Ausweg aus dem täglichen, sinnlosen Trott zu finden, der jeden Aufschwung zu lähmen droht. Noch mehr als andere Sterbliche bedarf er einer harmonischen Umgebung. Als Maler oder Schriftsteller kann er seine Arbeit so ziemlich überall tun. Es ist nur fast unmöglich, dort, wo das Leben billig, die Natur einladend ist, das bloße Existenzminimum zu erwerben, das man braucht, um Körper und Seele zusammenzuhalten. Ein Mann mit Talent muß seinen Lebensunterhalt nebenbei erwerben oder seine schöpferische Arbeit nebenbei tun. Eine schwierige Wahl!
Wenn er das Glück hat, einen idealen Ort oder eine ideale Gemeinschaft zu finden, so folgt daraus noch nicht, daß ihm dort auch die Ermutigung zuteil wird, die er so dringend nötig hat. Im Gegenteil, er wird wahrscheinlich entdecken, daß sich niemand für seine Arbeit interessiert. Im allgemeinen wird man ihn als sonderbaren Heiligen ansehen. Und das ist er natürlich, da das, was ihn dazu macht, dieses geheimnisvolle Element ist, ohne das seine Mitmenschen so gut auskommen können. Er wird fast immer auf eine andere Art als sein Nachbar essen, reden und sich kleiden, und das genügt, um ihn der Lächerlichkeit, Verachtung und Vereinsamung auszuliefern. Wenn er durch Übernahme einer bescheidenen Arbeit zeigt, daß er nichts Besseres sein will als sein Nachbar, kann er seine Lage vielleicht etwas erleichtern. Aber nicht für lange. Zu beweisen, daß er «nichts Besseres ist als sein Nachbar», bedeutet für einen Künstler wenig oder nichts. Zum Künstler macht ihn seine «Andersartigkeit», und wenn er Glück und Gelegenheit dazu hat, wird er auch seine Mitmenschen anders machen. Früher oder später wird er auf diese oder jene Weise seinen Nachbarn auf die Hühneraugen treten. Anders als der Durchschnittsmensch wird er alles hinwerfen, wenn ihn der Teufel reitet. Überdies wird er, wenn er wirklich ein Künstler ist, Opfer bringen müssen, die nur weltlich gesinnten Menschen töricht und unnötig erscheinen. Wenn er seinem inneren Licht folgt, wird er unvermeidlich die Armut zum treuen Freund und Begleiter wählen. Und wenn er die Anlage zu einem großen Künstler in sich hat, verzichtet er womöglich auf alles, selbst auf seine eigene Kunst. Dies ist für den gewöhnlichen Bürger, besonders den guten Bürger, lächerlich und unvorstellbar. So geschieht es eben manchmal, daß ein geachtetes, sehr ehrenwertes Mitglied der Gesellschaft, das den Genius in einem Menschen nicht erkennt, von ihm sagt: «Vor dem seid auf der Hut, der hat nichts Gutes im Sinn!»
Wie die Welt nun einmal ist, bin ich der aufrichtigen Meinung, daß jeder, der mit seinen zwei Händen arbeiten kann, der willens ist, für einen guten Tagelohn gute Arbeit zu leisten, besser daran täte, seine Kunst aufzugeben und an einem so entlegenen Platz wie diesem ein eintöniges Leben zu führen. Ja, es kann sogar viel klüger sein, hier in einer paradiesähnlichen Gegend ein Niemand als in einer Welt, die jeden Sinn für Werte verloren hat, eine Berühmtheit zu sein. Aber dies ist ein Problem, das selten im voraus zu lösen ist.
In unserer Gemeinde ist ein junger Mann, der die Art Weisheit, von der ich gerade gesprochen habe, für sich gewählt hat. Er ist ein Mann, der mit seinem Geld unabhängig leben kann; er besitzt eine große Intelligenz und Bildung, Feingefühl und einen ausgezeichneten Charakter. Bei diesen geistigen und charakterlichen Anlagen ist er obendrein ein guter Handarbeiter. Er hat sich offenbar vorgenommen, nicht mehr im Leben zustande zu bringen, als eine Familie zu ernähren, seine Angehörigen mit allem zu versorgen, was sie brauchen, und das Leben von Tag zu Tag zu genießen. Er tut alles allein, baut Häuser, bestellt seinen Garten, macht Wein und so weiter. Inzwischen geht er mal zur Jagd oder zum Fischfang oder einfach in die Wildnis, um Zwiesprache mit der Natur zu halten. Der Durchschnittsmensch würde ihn nur für einen braven Bürger ansehen, nur sieht er besser aus als die meisten Bürger, erfreut sich bester Gesundheit, hat keine Laster und keine Spur der üblichen Neurosen. Er besitzt eine ausgezeichnete Bibliothek und ist in ihr daheim, er hört gerne und häufig gute Musik. Er steht bei jedem Sport und Wettkampf seinen Mann, kann es bei der Arbeit mit den Zähesten aufnehmen und ist im allgemeinen ein sogenannter «netter Mensch», das heißt, ein Mensch, der weiß, wie er mit anderen umgehen muß und wie man sich in der Welt zurechtfindet. Aber er weiß noch etwas und tut auch noch etwas mehr, als ein braver Bürger tun kann oder will: er ist nämlich gern in der Einsamkeit, lebt einfach, hat keine übertriebenen Wunschträume und teilt gern, falls es nötig ist, mit anderen, was er besitzt. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, aus Furcht, ihm einen schlechten Dienst zu erweisen. Lassen wir ihn dort, wo er ist, Herrn X, einen Meister des anonymen Lebens und ein wunderbares Beispiel für seine Mitmenschen.
Als ich vor zwei Jahren in Vienne (Frankreich) war, hatte ich das Glück und die Ehre, Fernand Rude, den Unterpräfekten von Vienne, kennenzulernen, der eine bemerkenswerte Sammlung utopischer Literatur besitzt. Beim Abschied überreichte er mir ein Exemplar seines Buches Voyage en Icarie[*], das von zwei Arbeitern aus Vienne berichtet, die vor hundert Jahren nach Amerika fuhren, um in Etienne Cabets Versuchskolonie in Nauvoo, Illinois, einzutreten. Die Beschreibung, die es vom Leben in Amerika gibt, nicht nur in Nauvoo, sondern in den Städten, durch die sie kamen – sie gelangten zuerst nach New Orleans und verließen Amerika wieder über New York –, ist heute noch lesenswert, weil man daran sehr gut feststellen kann, daß unsere amerikanische Lebensweise sich im Grunde kaum geändert hat. Walt Whitman gab uns allerdings um dieselbe Zeit (in seinen Prosawerken) ein ähnliches Bild der Gemeinheit, Gewaltsamkeit und Korruption in höheren und niederen Stellen. Etwas ist aber besonders bemerkenswert, und das ist die angeborene Neigung der Amerikaner, zu experimentieren, die hirnverbranntesten Pläne bei sozialen, wirtschaftlichen, religiösen und sogar geschlechtlichen Problemen auszuprobieren. Wo das Geschlechtliche und Religiöse überwogen, kamen die erstaunlichsten Ergebnisse zum Vorschein. Die Oneida-Gemeinde (New York) zum Beispiel wird immer ein ebenso denkwürdiges Experiment bleiben wie Robert Owens' «Neue Harmonie» (in Indiana). Im Vergleich zu den Anstrengungen der Mormonen hat nie wieder ein so großartiges Experiment auf diesem Kontinent stattgefunden und wird auch wohl nicht mehr stattfinden.
Bei allen diesen idealistischen Unternehmungen, besonders bei den von religiösen Gemeinschaften durchgeführten, besaßen die Teilnehmer einen scharfen Wirklichkeitssinn, eine praktische Klugheit, die nirgendwo (ganz anders als bei gewöhnlichen Christen) mit ihren religiösen Überzeugungen in Widerspruch geriet. Es waren ehrliche, gesetzesfürchtige, fleißige, selbstgenügsame Bürger, die sich mit eigenen Mitteln fortbrachten und einen unbescholtenen und individuellen Charakter hatten. Sie waren allerdings – nach unserer jetzigen Denkweise – von puritanischer Nüchternheit und Strenge angekränkelt; es fehlte ihnen nie an Glaubenskraft, Mut und Unabhängigkeitssinn. Ihr Einfluß auf das amerikanische Denken und Handeln ist sehr stark gewesen.
Seit meinem Aufenthalt in Big Sur ist mir dieser Zug zum Experiment mehr und mehr aufgefallen. Heute sind es aber nicht mehr Gemeinschaften oder Gruppen, die das «gute Leben» wählen, sondern einzelne Personen. Die Mehrzahl von diesen sind, wenigstens nach meinen Beobachtungen, junge Leute, die schon im Berufsleben gestanden haben, bereits verheiratet waren und geschieden sind, ihren Militärdienst abgeleistet und, wie man so sagt, ein bißchen von der Welt gesehen haben. Aufs äußerste enttäuscht dreht diese neue Art von Experimentierern allem, was sie einmal für wahr und begehrenswert gehalten haben, den Rücken und macht einen tatkräftigen Versuch, wieder von vorne anzufangen. Für diesen Typ besteht der neue Anfang darin, daß sie keinen festen Wohnsitz mehr haben, alles aufgreifen, sich an nichts hängen, ihre Wünsche und Bedürfnisse herabsetzen und schließlich – in einer aus Verzweiflung geborenen Einsicht – das Leben eines Künstlers führen. Nicht aber solcher Künstler, wie wir sie kennen. Eines Künstlers vielmehr, dessen Interesse das Schaffen ist, den Belohnungen, Ruhm und Erfolg gleichgültig lassen, kurz, eines Menschen, der von Anfang an sich mit der Tatsache ausgesöhnt hat, daß er, je besser er ist, desto weniger Aussichten hat, infolge seiner Leistungen anerkannt zu werden. Diese jungen Männer, von Ende Zwanzig oder Anfang Dreißig, streifen wie Sendboten von einem anderen Planeten bei uns umher. Durch ihr Beispiel, durch ihre vollkommene Ablehnung überkommener Werte und, wie ich sagen möchte, durch ihre Taktik, «keinen Widerstand zu leisten», erweisen sie sich als eine mächtigere, anspornendere Kraft als die beredtesten Wortführer der anerkannten Kunst.
Der wesentliche Punkt dabei ist, daß diese Individualisten sich nicht mehr damit befassen, ein verderbliches System zu unterminieren, sondern – am Rande der Gesellschaft – ihr eigenes Leben zu führen. Es ist nur natürlich, daß Orte wie Big Sur – in einem großen Land gibt es ja mehrere Orte dieser Art – eine besondere Anziehungskraft für sie haben. Wir sprechen gewöhnlich von der «letzten Grenze», aber für Individualisten wird es immer neue Grenzen geben. Für den Menschen, der ein gutes Leben führen will, was im Grunde heißt sein eigenes Leben, gibt es immer einen Platz, wo er Fuß fassen und Wurzel schlagen kann.
Aber was haben denn nun diese jungen Leute entdeckt, und was verbindet sie sonderbarerweise mit ihren Vorfahren, die freiwillig Europa mit Amerika vertauscht haben? Dieses: daß die amerikanische Lebensart nur ein Scheindasein ist und daß der Preis für die Sicherheit und den Überfluß, die sie angeblich bietet, zu hoch ist. Wenn auch diese «Renegaten» noch klein an Zahl sind, so weist doch ihre Existenz schon darauf hin, daß die Maschine einen Knacks bekommen hat. Wenn der große Schlamassel kommt, wie es jetzt als unvermeidlich erscheint, werden sie wahrscheinlich die Katastrophe leichter überstehen als wir anderen. Sie wissen wenigstens schon, wie man ohne Autos, ohne Kühlschränke, Staubsauger, elektrische Rasierapparate und die anderen «Unentbehrlichkeiten», ja, sogar ohne Geld, auskommen kann. Wenn wir jemals eine neue Erde bekommen sollten, so darf Geld auf ihr keine Rolle mehr spielen, es muß vergessen und gänzlich wertlos sein.
Hier möchte ich eine Stelle aus einer Besprechung des Buches von Helen und Scott Nearing Living the Good Life zitieren. Hier heißt es: «Wir wollen klarmachen, daß man sich aus einem verfehlten, jede freie Betätigung hemmenden Leben nicht einfach dadurch befreien kann, daß man aufs Land zieht und ein ‹einfaches› Leben führt. Die Lösung kann nur durch eine andersartige geistige Einstellung gegenüber physischen und wirtschaftlichen Tatsachen erfolgen, die sie fast zu einer moralischen und ästhetischen Notwendigkeit machen. Erst ein größeres Lebensziel gibt den kleineren Dingen des Lebens – der Beschaffung von Nahrung, Unterkunft und Kleidung – ihre harmonische Ausgeglichenheit. So oft träumen Leute von einem idealen Leben in der ‹Gemeinschaft› und vergessen dabei, daß eine ‹Gemeinschaft› kein Selbstzweck ist, sondern nur ein Rahmen für höhere Werte – die stets die des Geistes und des Herzens sind. Die Bildung einer Gemeinschaft kann nicht wie eine Zauberformel Glück und Zufriedenheit schaffen, sie ist vielmehr das Ergebnis des Glücks und der Zufriedenheit, die man schon im Prinzip besitzt, und die Gemeinschaft, ob sie sich nun aus einer oder aus mehreren Familien zusammensetzt, ist der unendlich verschiedenartige Ausdruck der besten Eigenschaften menschlicher Wesen und nicht ihre Ursache.»
Als ich vor elf Jahren nach Big Sur zog, dachte ich nicht im geringsten an ein Leben in Gemeinschaft, auch hatte ich gar keine Vorstellung davon. Eine Bevölkerung von hundert Seelen war damals über ein Gebiet von mehreren hundert Quadratmeilen verteilt, so daß ich von einer dort bestehenden «Gemeinschaft» gar nichts merkte. Meine Gemeinschaft umfaßte damals einen Hund, Pascal (so genannt, weil er das grüblerische Aussehen eines Denkers hatte), ein paar Bäume, die Bussarde und ein Gestrüpp von Gifteschen. Mein einziger Freund, Emil White, wohnte fünf Kilometer weit unten an der Straße. Ebenso tief unten waren die heißen Schwefelquellen. Dort endete von meinem Standpunkt aus die Gemeinschaft.
Ich fand natürlich bald heraus, in welchem Irrtum ich befangen war. Es dauerte gar nicht lange, da tauchten von allen Seiten (aus dem Busch, wie es schien) Nachbarn auf, immer mit Geschenken beladen und immer mit einem sehr diskret angebrachten, aber vernünftigen Ratschlag für den «Neuen». So gute Nachbarn hatte ich noch nie kennengelernt. Ich mußte immer wieder staunen, von wie feinem Takt sie waren. Sie kamen nur, wenn sie das Gefühl hatten, daß man sie brauchte. Es kam mir vor, als wäre ich wie in Frankreich wieder unter Leuten, die einen so nehmen, wie man ist. Und ständig luden sie einen ein, doch zu Tisch zu kommen, wenn man Hunger hätte oder Gesellschaft brauchte.
Da ich zu jenen «hilflosen» Menschen gehörte, die nur das Stadtleben kannten, dauerte es nicht lange, bis ich meine Nachbarn aus diesem oder jenem Grunde zu Hilfe rufen mußte. Irgend etwas ging immer verloren, irgend etwas ging immer daneben. Nur ungern denke ich daran, was mir passiert wäre, wenn ich ganz allein gewesen wäre. Aber der Beistand, um den ich gebeten hatte, wurde immer willig und freundlich auf einen größeren Umfang ausgedehnt, und so erhielt ich die wertvollste aller Belehrungen, nämlich wie man sich selbst helfen kann. Ich entdeckte sehr schnell, daß meine Nachbarn nicht nur äußerst zugänglich, hilfreich und in jeder Weise großzügig waren, sondern daß sie weit intelligenter, weiser und genügsamer waren, als ich es dünkelhafterweise von mir selbst angenommen hatte. Die Gemeinschaft, die mich zuerst nur wie ein unsichtbares Netz umgeben hatte, wurde allmählich zur fühlbaren Wirklichkeit. Zum erstenmal in meinem Leben fühlte ich mich von gütigen Seelen umringt, die nicht ausschließlich an ihr eigenes Wohlergehen dachten. Ein seltsames neues Sicherheitsgefühl, wie ich es noch nie gekannt hatte, entwickelte sich allmählich in mir. Ich prahlte sogar Besuchern gegenüber mit der Behauptung, daß, wenn man einmal in Big Sur Wurzeln gefaßt habe, einem nichts mehr passieren könne, fügte aber immer vorsichtig hinzu: «Man muß sich aber erst als ein guter Nachbar erwiesen haben!» Obwohl ich diese Worte an andere richtete, waren sie doch für mich selbst bestimmt, und oft, wenn ich wieder allein war, wiederholte ich sie mir wie eine Litanei. Man sieht, es dauerte eine gewisse Zeit, bis einer, der im Dschungel großer Städte gelebt hatte, begriff, daß auch er ein «guter Nachbar» sein konnte.
Hier muß ich offen und nicht ohne schlechtes Gewissen sagen, daß ich zweifellos der schlechteste Nachbar bin, den sich eine Gemeinschaft überhaupt denken könnte. Daß man mir immer noch mit etwas mehr als bloßer Toleranz begegnet, überrascht mich immer wieder.
Oft ist mir dies alles so fremd, daß der einzige Weg, «zurückzufinden», darin besteht, meine Welt durch die Augen meiner Kinder anzuschauen. Ich beginne immer damit, daß ich an die glorreiche Kindheit zurückdenke, die ich in dem schmutzigen Viertel Brooklyns, in Williamsburg, verbracht habe. Ich versuche jene dreckigen Straßen und schäbigen Häuser mit den Ausblicken auf das weite Meer und die Berge dieser Gegend zu kombinieren. Darum schaue ich so gerne die Vögel an, denn in Brooklyn habe ich höchstens einen Spatzen gesehen, der sich auf einem frischen Dunghaufen niedergelassen hatte, oder eine verirrte Taube, nie einen Habicht, einen Bussard, einen Adler, ein Rotkehlchen oder einen Kolibri. Ich denke an den Himmel, der immer durch Häuserdächer und häßliche rauchende Kamine in Stücke zerhackt war. Ich atme wieder die Luft jenes Himmels, eine Atmosphäre ohne Duft, bleiern und drükkend, gesättigt mit dem Gestank beißender Chemikalien. Ich denke, wie wir in den Straßen spielten, ohne den Zauber von strömendem Wasser und Wäldern auch nur zu ahnen. Mit Zärtlichkeit denke ich an meine damaligen Gefährten, von denen einige später im Gefängnis landeten. Trotzdem führten wir zu jener Zeit ein «gutes Leben», ja, ich möchte sagen, ein geradezu wundervolles Leben. Dort in den schäbigen Straßen meines Viertels lernte ich mein erstes «Paradies» kennen, und wenn es auch für immer verschwunden ist, so ist es doch in der Erinnerung noch zugänglich.
Aber jetzt, wenn ich unsere Kleinen im Vorgarten spielen sehe, wenn ich ihre Umrisse gegen den blauen, mit weißen Schaumkronen bedeckten Pazifik sehe, wenn ich zu den großen, gefährlich erscheinenden Bussarden aufblicke, die da oben lässig schweben, plötzlich tiefer tauchen, aber immer in Kreisen, wenn ich die sanft im Winde sich wiegenden Weiden beobachte, deren lange, zarte Zweige sich immer tiefer, immer grüner und zärtlicher neigen, wenn ich den Frosch im Teich quaken oder einen Vogel aus dem Busch singen höre, wenn ich mich plötzlich umwende und eine an einem Zwergbaum reifende Zitrone sehe oder bemerke, daß die Kamelie gerade aufgeblüht ist, sehe ich meine Kinder vor einem ewigen Hintergrund. Sie sind nicht einmal mehr meine Kinder, sondern einfach Kinder, Kinder der Erde … Dann weiß ich, daß sie den Platz, wo sie geboren und aufgewachsen sind, nie vergessen und nie für immer verlassen werden. In meiner Vorstellung bin ich bei ihnen, wenn sie von fernen Küsten zu ihrer alten Heimat zurückkehren. Meine Augen sind feucht von Tränen, wenn ich sehe, wie sie sich zärtlich und ehrfürchtig in einem Schwarm goldener Erinnerungen bewegen. Ob sie wohl den Baum bemerken, bei dessen Einpflanzen sie mir helfen wollten, aber dann doch die Spiellust die Oberhand über sie gewann? Werden sie bei dem kleinen Anbau verweilen, den wir für sie errichteten, und sich staunend fragen, wie sie nur in einem solchen Schächtelchen Platz finden konnten? Werden sie vor dem winzigen Arbeitsraum stehenbleiben, in dem ich meine Tage verbrachte, und wieder an die Scheiben klopfen und fragen, ob ich mit ihnen spielen will – oder mußt du noch arbeiten? Werden sie die Murmeln finden, die ich im Garten zusammensuchte und versteckte, aus Besorgnis, sie könnten sie verschlucken? Werden sie träumend auf der Waldlichtung stehen, wo der Bach noch immer murmelt, und nach den Töpfen und Pfannen suchen, mit denen wir aus Lehm ein herrliches Frühstück bereiteten, ehe wir tiefer in den Wald tauchten? Werden sie den Ziegenpfad an der Berglehne hinaufklimmen und staunend und ehrfürchtig das alte windschiefe Trotterhaus betrachten? Werden sie, wenn auch nur in der Erinnerung, zu den Rosses hinunterlaufen, um zu fragen, ob Harrydick das zerbrochene Schwert zusammenflicken oder Chanagolden uns ein Glas Marmelade leihen könne?
Für jedes wunderbare Ereignis in meiner Kindheit müssen sie ein Dutzend unvergleichlich wunderbarere besitzen. Denn sie hatten nicht nur ihre Spiele, ihre kleinen Spielkameraden und ihre geheimnisvollen Abenteuer, sie hatten auch Himmelsweiten von reinstem Blau, Nebelschwaden, die auf unsichtbaren Füßen aus Schluchten stiegen, Berge, die im Winter smaragdgrün und im Sommer rot wie Gold waren. Sie hatten noch mehr. Die unergründliche Stille des Waldes, die glitzernde Unendlichkeit des Ozeans, von Sonnenlicht ausgedörrte Tage und funkelnde Sterne bei Nacht – «Oh, Papa, komm doch schnell, sieh nur den Mond, er liegt unten im Teich!» Und zu den Nachbarn, die sie vergötterten, noch einen Tölpel von Vater, der lieber mit ihnen spielte, als daß er seinen Geist kultivierte und sich zu einem guten Nachbarn entwickelte. Glücklich der Vater, der nur Schriftsteller ist, der seine Arbeit hinwerfen und mit Kindern wieder Kind sein kann! Glücklich der Vater, der vom Morgen bis Sonnenuntergang durch zwei gesunde, unersättliche Gören geplagt wird! Glücklich der Vater, der lernt, wieder durch die Augen seiner Kinder zu sehen, selbst wenn er der größte Tor wird, den es je gegeben hat!
«Die Brüder und Schwestern des Freien Geistes nannten ihr frommes Gemeinschaftsleben ‹Paradies› und erklärten die Bedeutung des Wortes als Inbegriff der Liebe.»[*]
Als ich neulich einen Ausschnitt aus dem «Tausendjährigen Reich» von Hieronymus Bosch betrachtete, wies ich unseren Nachbarn, Jack Morgenrath (aus Williamsburg, Brooklyn), darauf hin, wie täuschend echt die an den Bäumen hängenden Orangen sind. Ich fragte ihn, wie es wohl käme, daß diese in ihrem Aussehen so übernatürlich echt erscheinenden Orangen etwas mehr an sich hätten als zum Beispiel Orangen von Cézanne (der besser durch seine Äpfel bekannt ist) oder sogar von van Gogh. Jack wußte darauf eine einfache Antwort. (Für Jack ist alles einfach. Das ist ein Teil seines Charmes.) Er sagte: «Das kommt von ihrem Doppelsinn.» Er hat recht, absolut recht. Die Tiere in demselben Triptychon sind ebenso geheimnisvoll, in ihrer Überwirklichkeit ebenso täuschend echt. Ein Kamel bleibt immer ein Kamel und ein Leopard ein Leopard, und doch sind sie hier ganz anders als andere Kamele und andere Leoparden. Man kann auch kaum sagen, daß sie die Kamele und Leoparden des Hieronymus Bosch sind. Sie gehören einer anderen Zeit an, als der Mensch noch eins mit der Schöpfung war, «als der Löwe friedlich neben dem Lamm lag».
Bosch gehört zu den sehr wenigen Malern – er war in Wirklichkeit mehr als Maler! –, die einen magischen Blick hatten. Er sah durch die Welt der Erscheinungen, machte sie durchsichtig und zeigte sie uns so, wie sie ursprünglich war.[*] Wenn wir die Welt mit seinen Augen sehen, erscheint sie uns wieder als eine Welt unzerstörbarer Ordnung, Schönheit und Harmonie, die wir als Paradies hinnehmen oder in ein Fegefeuer verwandeln können.
Das Bezaubernde und manchmal Erschreckende ist, daß die Welt für so verschiedene Seelen etwas völlig Verschiedenes sein kann. Daß sie dies zu ein und derselben Zeit sein kann und ist.
Was mich dazu gebracht hat, hier vom «Tausendjährigen Reich» zu sprechen, ist der Umstand, daß ich durch die vielen Leute, die aus allen Teilen der Welt hierher zu Besuch kommen, ständig daran erinnert werde, daß ich in einer Art Paradies lebe. («Wie haben Sie nur einen solchen Platz gefunden!» ist der übliche Ausruf. Als wenn ich damit was zu tun hätte!) Mich erstaunt nur, und das ist der wesentliche Punkt, daß so wenige beim Abschied daran denken, auch sie könnten die Früchte des Paradieses genießen. Fast immer gesteht der Besucher, daß es ihm an Mut fehlt – richtiger wäre, an Phantasie -, mit der Vergangenheit zu brechen. «Sie sind glücklich», sagt er und meint damit, daß ich Schriftsteller bin – «Sie können Ihre Arbeit tun, wo Sie wollen.» Er vergißt dabei, was ich ihm – und zwar in ziemlich anzüglicher Weise – von den anderen Mitgliedern unserer Gesellschaft erzählt habe, die eigentlich den Karren in Gang halten und keine Schriftsteller, Maler oder Künstler sind, außer im Geist. «Zu spät», murmelt er wahrscheinlich in sich hinein, wenn er zum letztenmal wehmütig auf die Gegend blickt.
Wie enthüllt doch diese Haltung die klägliche Resignation, der Männer und Frauen unterliegen! Einem jeden kommt sicher an irgendeinem Punkt des Weges zum Bewußtsein, daß er ein weit besseres Leben führen könnte als das, welches er erwählt hat. Was ihn gewöhnlich zurückhält, ist das Opfer, das eine Änderung zur Folge hat. (Selbst seine Ketten abzuschütteln, erscheint ihm als Opfer.) Und dabei weiß jeder, daß nichts ohne Opfer erreicht werden kann.
Die Sehnsucht nach dem Paradies, ob es nun im Jenseits oder hier auf Erden gedacht wird, hat fast aufgehört. Aus einer idée force ist eine idée fixe geworden. Ein mächtiger Mythus ist zu einem Tabu entartet. Menschen opfern ihr Leben, um eine bessere Welt zu schaffen – was immer sie darunter auch verstehen mögen –, aber sie rühren keinen Finger, um das Paradies zu finden. Auch bemühen sie sich nicht, in der Hölle, in der sie sich aufhalten, einen kleinen Bezirk abzugrenzen, der einem Paradies ähnlich wäre. Es ist eben viel leichter – und blutiger –, eine Revolution zu machen, das heißt, einfach ausgedrückt, einen anderen Status quo herzustellen. Wenn das Paradies verwirklicht werden könnte – dies ist eine klassische Entgegnung –, wäre es kein Paradies mehr.
Was soll man zu Menschen sagen, die darauf bestehen, ihr eigenes Gefängnis zu bauen?
Es gibt auch solche, die sogleich, wenn sie etwas gefunden haben, was sie für ein Paradies halten, Mängel daran entdecken. Das Paradies dieser Leute wird dann sogar noch schlimmer, als die Hölle war, der sie entkommen sind.
Sicher hat jedes Paradies, wo es auch sein mag, Mängel. (Paradiesische Mängel, wenn man will.) Wenn das nicht so wäre, könnte es die Herzen von Menschen oder Engeln nicht bewegen.
Die Fenster der Seele sind zahllos, so sagt man. Und mit den Augen der Seele wird das Paradies erblickt. Wenn euer Paradies also Mängel hat, dann macht mehr Fenster auf! Das Schauen ist ganz und gar eine schöpferische Fähigkeit. Es benützt den Körper und den Geist wie der Seemann seine Instrumente. Wenn man offen und wach ist, bedeutet es wenig, ob man einen abgekürzten Weg nach Indien findet oder eine neue Welt entdeckt. Alles will entdeckt werden, es bettelt gleichsam darum – aber nicht zufällig, sondern intuitiv. Wenn man intuitiv sucht, so liegt unser Ziel niemals in einem zeitlichen oder räumlichen Jenseits, sondern immer jetzt und hier. Wenn wir immer ankommen und scheiden, so ist es gleichfalls wahr, daß wir ewig vor Anker liegen. Unser Ziel ist nie ein Ort, sondern eine neue Art, die Dinge zu sehen, das heißt, dem Schauen sind keine Grenzen gesetzt. Ebenso hat das Paradies keine Grenzen. Jedes Paradies, das den Namen verdient, kann alle Mängel der Schöpfung enthalten und doch unverkleinert und unbefleckt bleiben.
Wenn ich hier auf einen Wesenszug eingegangen bin, der, wie ich gestehen muß, in unserem Kreis wenig erörtert wird, so bin ich trotzdem überzeugt, daß er insgeheim den Geist vieler Mitglieder unserer Gemeinschaft beschäftigt.
Jeder, der hierhergekommen ist, um einen neuen Lebensweg zu suchen, hat seine gewohnte Lebensweise vollständig umgekrempelt. Fast alle kommen von weit her, gewöhnlich aus einer Großstadt. Damit mußten sie einen Beruf und eine Lebensweise aufgeben, die ihnen verabscheuenswert und unerträglich geworden waren. Bis zu welchem Grade jeder ein «neues Leben» gefunden hat, kann nur nach den Anstrengungen ermessen werden, die jeder zur Erreichung dieses Ziels gemacht hat. Manche, glaube ich, würden «es» auch gefunden haben, wenn sie dort geblieben wären, wo sie waren.
Die bedeutendste Erfahrung, die ich hier seit meiner Ankunft gemacht habe, ist die Umwandlung des eigenen Wesens, die manche hier mit allen Kräften herbeigeführt haben. Nirgendwo habe ich Menschen so ernst und beständig an sich arbeiten sehen. Oder so erfolgreich. Und doch werden hier keine Lehren verkündet oder Predigten gehalten, wenigstens nicht offen. Manche haben sich bemüht und haben versagt, zum Glück für uns andere, möchte ich sagen. Aber selbst diese haben etwas gewonnen. Vor allem hat sich ihre Lebensanschauung verändert, erweitert, wenn nicht «verbessert». Und was könnte besser sein, als wenn der Lehrer sein eigener Schüler wird oder der Prediger sein eigener Bekehrter?
In einem Paradies predigt und bekehrt man nicht. Man übt sich im vollkommenen Leben – oder gleitet wieder in das alte zurück.
Es scheint hier ein ungeschriebenes Gesetz zu geben, wonach man mit dem, was man vorfindet, zufrieden und glücklich sein muß, widrigenfalls man aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Man verstehe mich richtig. Niemand ordnet diesen Ausschluß an. Keine Gruppe würde sich ein solches Richteramt anmaßen. Nein, der Ort selbst, die Elemente, die sein Wesen ausmachen, bewirken das. Es ist ein Gesetz, wie ich gesagt habe. Und es ist ein gerechtes Gesetz, das niemandem schadet. Ein Zyniker wird sagen, na also, da stellt sich der alte liebe Status quo von selbst wieder her. Aber der Enthusiast weiß, daß der paradiesische Charakter dieser Gegend nichts mit einem Status quo zu tun hat.
Nein, das Gesetz ist wirksam, weil die Kräfte, die einen paradiesischen Zustand herbeiführen, sich nicht mit jenen assimilieren können, welche die Hölle schaffen. Wie oft sagt man, daß wir uns unseren Himmel und unsere Hölle selbst bereiten. Und wie wenig nimmt man sich das zu Herzen! Doch die Wahrheit dringt durch, ob wir an sie glauben oder nicht.
Paradies oder nicht Paradies, ich habe den bestimmten Eindruck, daß die Menschen in dieser Gegend sich bemühen, der Großartigkeit und dem Adel der Landschaft gerecht zu werden, die so wesentliche Bestandteile ihrer Umgebung sind. Sie verhalten sich, als wäre es ein Vorrecht, hier zu leben, als hätte sie ein Gnadenakt hierher versetzt. Die Landschaft ist viel zu überwältigend großartig, als daß irgend jemand hoffen könnte, diesen Eindruck durch eigenes Zutun noch zu verstärken, und erzeugt daher eine bei Amerikanern nicht häufig zu findende Demut und Ehrfurcht. Da an der Landschaft nichts zu verbessern ist, wird das Verlangen geweckt, selbst besser zu werden.
Es stimmt zwar, daß mit Menschen in einer häßlichen, hemmenden Umgebung – Gefängnisse, Gettos, Konzentrationslager und so weiter – gewaltige Veränderungen vor sich gegangen sind, daß sie einen weiteren Blick bekommen haben, kurz, andere Menschen geworden sind. Aber nur selten bleibt einer gern an solchen Plätzen. Wer das Licht gesehen hat, folgt dem Licht. Und dieses Licht führt ihn gewöhnlich zu solchen Orten, wo er seine Funktion am besten erfüllen, das heißt, seinen Mitmenschen von größtem Nutzen sein kann. In diesem Sinne bedeutet es wenig, ob das im dunkelsten Afrika oder auf den Höhen des Himalaja geschieht. Gottes Arbeit kann sozusagen überall getan werden.
Wir kennen alle den Soldaten, der in fernen Ländern gewesen ist. Und wir alle wissen, daß jeder eine andere Geschichte zu erzählen hat. Wir sind alle wie heimgekehrte Soldaten. Wir sind alle in geistigem Sinne irgendwo gewesen, und das Erlebnis hat uns entweder gefördert oder zurückgeworfen. Der eine sagt: «Nie wieder!» Ein anderer: «Mag kommen, was will. Ich bin auf alles gefaßt!» Nur der Tor hofft, eine Erfahrung noch einmal zu machen. Ein kluger Mensch weiß, daß jedeErfahrung als Segen angesehen werden muß. Was auch immer wir zu vermeiden oder zurückzuweisen versuchen, ist gerade das, was wir nötig haben, und gerade diese Notwendigkeit lähmt uns oft, hindert uns daran, eine (gute oder schlechte) Erfahrung zu begrüßen.
Ich komme noch einmal auf jene zurück, die hierherkamen, weil ihnen etwas fehlte, und die nach einiger Zeit flohen, weil sie nicht das fanden, was sie erhofften, oder weil sie nicht das waren, wofür sie sich hielten. Soviel ich weiß, hat noch keiner von ihnen «das» oder sich gefunden. Einige kehrten zu ihren früheren Herren zurück wie Sklaven, unfähig, die Vorrechte und Verantwortlichkeiten der Freiheit auf sich zu nehmen. Einige gerieten in geistige Sackgassen. Einige gingen vor die Hunde. Andere kehrten einfach zu dem scheußlichen Status quo zurück.
Ich spreche, als ob sie von der Peitsche gezeichnet wären. Ich will nicht grausam oder rachsüchtig sein. Ich will nur einfach klarmachen, daß keiner – meiner unmaßgeblichen Meinung nach – auch nur eine Spur glücklicher oder besser dran ist, auch nur um eine winzige Strecke in irgendeiner Hinsicht weitergekommen ist. Den Rest ihres Lebens werden sie unaufhörlich von ihrem Abenteuer in Big Sur erzählen – wehmütig, bedauernd oder schwärmerisch, wie es die Gelegenheit erfordert. In den Herzen einiger, so weiß ich, lebt die tiefe Hoffnung, daß ihre Kinder mutiger, ausdauernder und ehrlicher sein werden als sie selbst. Aber übersehen sie dabei nicht etwas? Sind nicht ihre Kinder schon von den Fehlern angekränkelt, die sie, wie sie gestehen, selbst hatten? Sind sie nicht bereits von dem Virus der «Sicherheit» angesteckt?
Am schwersten finden sich die Menschen anscheinend mit Frieden und Zufriedenheit zurecht. Solange es etwas zu kämpfen gibt, trotzen sie allen Entbehrungen. Sobald das Element des Kampfes fehlt, sind sie wie Fische außerhalb des Wassers. Wer sich um nichts mehr zu sorgen braucht, lädt sich oft verzweifelt die schweren Lasten auf die Schultern, die immer in der Welt daliegen und nur darauf warten, aufgehoben zu werden. Das geschieht nicht aus Idealismus, sondern weil die Menschen etwas zu tun haben müssen oder mindestens etwas brauchen, worüber sie sprechen können. Wären diese unausgefüllten Seelen wirklich um die Lage ihrer Mitmenschen besorgt, würden sie sich in den Flammen ihres Eifers verzehren. Man braucht kaum über seine eigene Türschwelle hinauszugehen, und schon hat man ein Reich entdeckt, das groß genug ist, um die Energie eines Riesen oder, besser gesagt, eines Heiligen zu erschöpfen.
Je mehr Aufmerksamkeit man allerdings auf die bedauernswerte Lage unserer Mitmenschen verwendet, desto weniger kann man genießen, was man an Frieden und Freiheit besitzt. Selbst wenn wir uns in einem Himmel voll Seligkeit befinden sollten, können wir so viel daran aussetzen, daß er uns zweifelhaft und verdächtig wird.
Manche sagen, sie hätten keine Lust, ihr Leben zu verträumen. Als wenn das Leben selbst nicht ein Traum wäre, ein sehr wirklicher Traum, aus dem es kein Erwachen gibt! Wir gehen von einer Form des Traumes in eine andere über, vom Traum des Schlafes in den Traum des Wachens, vom Traum des Lebens in den Traum des Todes. Wer je einen guten Traum gehabt hat, klagt nie, daß er seine Zeit verschwendet hat. Im Gegenteil, er freut sich, einer Wirklichkeit teilhaftig geworden zu sein, welche die alltägliche erhöht und verstärkt.
Die Orangen des «Tausendjährigen Reiches» hauchen, wie ich schon einmal gesagt habe, die traumgleiche Wirklichkeit aus, die uns immer entgeht und die geradezu das Wesen des Lebens ist. Sie sind weit schmackhafter und wirksamer als die Sunkist-Orangen, die wir täglich verzehren, in dem naiven Glauben, sie enthielten wunderwirkende Vitamine. Die Millenniumsorangen des Hieronymus Bosch stärken die Seele. Ihr Fluidum ist das Unvergängliche des Wirklichkeit gewordenen Geistes.
Jedes Geschöpf, jeder Gegenstand, jeder Ort hat sein eigenes Fluidum. Selbst unsere Welt besitzt ein einzigartiges Fluidum. Aber Welten, Gegenstände, Geschöpfe und Orte haben das eine gemeinsam: sie sind in fortwährender Umwandlung begriffen. Die Wonne des Traumes liegt in dieser Fähigkeit der Umformung. Wenn die Persönlichkeit sich sozusagen verflüssigt, wie es so wunderbar im Traum geschieht, und unser tiefstes Wesen alchimisiert wird, wenn Form und Substanz, Zeit und Raum weich und elastisch werden und unserem kleinsten Wunsch nachgeben und gehorchen, weiß der aus seinem Traum Erwachende ohne jeden Zweifel, daß die unvergängliche Seele, die er sein eigen nennt, nur ein Werkzeug dieses ewigen Elements der Veränderung ist.
Überlassen wir uns nicht gern im wachen Zustand, wenn alles in Ordnung ist und Sorgen fehlen, wenn der Intellekt einschläft und wir in eine träumerische Stimmung geraten, dem ewigen Fluß, schwimmen wir da nicht ekstatisch auf dem stillen Strom des Lebens? Wir haben alle Augenblicke vollkommener Versunkenheit erlebt, wenn wir uns als Pflanze oder Tier, als Geschöpf der Tiefe oder des Äthers empfanden. Manche von uns haben sogar Augenblicke gekannt, in denen sie den alten Göttern glichen. Wohl jeder hat wenigstens einen Augenblick in seinem Leben gehabt, wo er sich so gut, so im Einklang mit allen Dingen fühlte, daß er nahe daran war, zu rufen: «Oh, jetzt möchte ich sterben!» Was ist im Innersten dieser Euphorie verborgen? Der Gedanke, daß sie nicht dauern wird, nicht dauern kann? Das Gefühl eines Letzten? Vielleicht. Aber ich glaube, man kann diesen Zustand noch ganz anders ansehen. Ich glaube, daß wir uns in solchen Augenblicken über etwas klarzuwerden versuchen, was wir immer gewußt haben, aber nie zugeben wollten – daß Leben und Sterben eines ist, daß alles eines ist und daß es keinen Unterschied macht, ob wir einen Tag oder tausend Jahre leben.
Konfuzius drückte das so aus: «Wenn ein Mensch am Morgen die Wahrheit sieht, kann er am Abend ohne Bedauern sterben.»
Zu Beginn meines Aufenthaltes dachte ich, Big Sur sei ein geradezu idealer Ort zum Arbeiten. Heute sehe ich das mit anderen Augen, obwohl ich immer gern arbeite, wenn ich kann. Ob ich arbeite oder nicht, ist im Laufe der Zeit von immer geringerer Bedeutung geworden. Ich habe hier einige der bittersten Erlebnisse meines Lebens gehabt. Aber ich habe hier auch einige der erhabensten Augenblicke gekostet. Ob nun ein Erlebnis süß oder bitter ist, ich bin heute davon überzeugt, daß jede Erfahrung uns bereichert und belohnt. Vor allem ist sie lehrreich.
In den letzten zehn Jahren habe ich mit Hunderten und aber Hunderten von Menschen in allen Lebenslagen gesprochen. Die meisten Besucher, so scheint mir, kommen hierher, um ihre Probleme abzuladen. Gewöhnlich gelingt es mir, ihnen ihre Probleme zurückzugeben und ihnen noch dazu einige neue aufzuladen, die schwieriger und dornenreicher sind als diejenigen, die sie mitbrachten.
Viele, die mir einen Besuch abstatten, bringen Geschenke mit, alle Arten von Geschenken, Geld und Bücher, Eß- und Trinkwaren, Kleidungsstücke und sogar Briefmarken. Als Gegengabe kann ich mich ihnen nur selbst anbieten. Es erstaunt mich immer, daß jetzt, da ich, wie man glauben sollte, an einem entlegenen Ort lebe, die Welt näher an meine Tür heranrückt als damals, da ich mitten in ihr lebte. Ich brauche keine Zeitungen zu lesen und auch keinen Rundfunk zu hören. Was immer ich von den Verhältnissen «draußen» wissen muß, erfahre ich hier geklärt und konzentriert.
Und wie sehr sich das alles gleicht! Warum soll ich meinen Kadaver deshalb herumschleppen? «Bleibe, wo du bist, und sieh zu, wie die Welt sich dreht.»