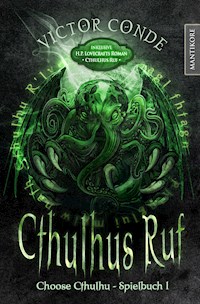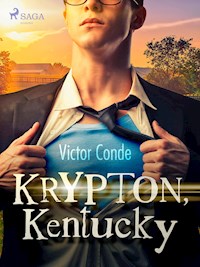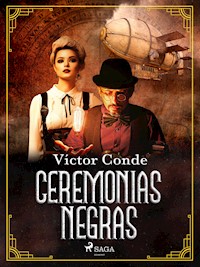13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thienemann ein Imprint der Thienemann-Esslinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Tanya, Erik und Mauro sind die Auserwählten – in ihren Adern fließt das Blut echter Erzengel und nur sie haben die Macht, den Kampf Himmel gegen Hölle, Engel gegen Dämonen, zum Guten zu wenden. Doch es fällt den drei Jugendlichen nicht leicht, ihr Erbe zu akzeptieren, schließlich ist es verdammt schwierig, ein Engel zu sein! Wenn sie sich nicht zusammenraufen, übernehmen die Dämonen die Herrschaft über die Erde und die Menschen sind verloren! Die Zeit drängt: im Himmel ist die Hölle los! Actionreiche Fantasy vom spanischen Fantasy-Experten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Buchinfo
Tanya, Erik und Mauro sind die Auserwählten – in ihren Adern fließt das Blut echter Erzengel und nur sie haben die Macht, den Kampf Himmel gegen Hölle, Engel gegen Dämonen, zum Guten zu wenden. Doch es fällt den drei Jugendlichen nicht leicht, ihr Erbe zu akzeptieren, schließlich ist es verdammt schwierig, ein Engel zu sein! Wenn sie sich nicht zusammenraufen, übernehmen die Dämonen die Herrschaft über die Erde und die Menschen sind verloren! Die Zeit drängt: im Himmel ist die Hölle los!
Actionreiche Fantasy vom spanischen Fantasy-Experten
Autorenvita
© Sara Moana
Victor Conde wurde 1973 in Santa Cruz de Tenerife geboren, er ist verheiratet und hat eine Tochter. 2010 gewann er den angesehenen »Premio Internacional Minotauro« für den besten fantastischen Roman. Zuvor war er schon zweimal für den Preis nominiert. Auch seine letzten Romane wurden von Kritikern und Lesern gleichermaßen begeistert aufgenommen. Die Trilogie »Boten des Lichts« ist Victor Condes ambitioniertestes Projekt im Bereich Fantastisches Jugendbuch.
Für Thais, mit Liebe.
Es ist das erste Buch, das ich dir widme,
aber gewiss nicht das letzte.
Nichts an ihm mehr muß zerfall’n,
Nur verwandelt hat’s die Flut:
Seltsam ist es nun und gut.
W. Shakespeare, Der Sturm
[Übers. v. Erich Fried]
… For nothing is more precious Than the time we haven’t sold.
AMS.
DIE FREMDE
An irgendeinem Ort. Zu irgendeiner Zeit.
Eine Sekunde, bevor die junge Frau in der Gasse auftauchte, war dort nichts. Nur Dunkelheit. Der blasse Schein einer fernen Straßenlaterne. Die lose Seite einer Tageszeitung, die vom Regen durchweicht auf dem Asphalt kleben geblieben war, sodass der Wind sie nicht forttragen konnte. Ein Tier aus der Kanalisation, das auf der Suche nach etwas Essbarem einen Abstecher nach oben riskierte.
Nichts von Bedeutung.
Dann kam das Licht, der goldene Glanz, der den Mülleimern und der Wäsche in den Fenstern ihre Schatten abrang und das Wasser in den Pfützen erhitzte und verdunsten ließ. Als das Licht wieder verlosch, blieb an seiner statt eine menschliche Gestalt zurück.
Die junge Frau wirkte kaum älter als zwanzig. Sie hatte eine dunkle Haut, dichte schwarze Brauen und zerzaustes Haar, das ihr wie eine Löwenmähne vom Kopf abstand. Am Körper trug sie einen engen dunklen Anzug aus winzigen aneinandergenähten Steinchen. Sie war barfuß. Und in der einen Hand hielt sie einen kleinen Gegenstand aus Silber.
In den ersten Sekunden nach ihrer Materialisation wirkte das Mädchen verwirrt, ohne Orientierung. Es beugte sich vor, als die Übelkeit es überkam, aber sein Magen war leer. Die junge Frau hatte seit Tagen nichts gegessen.
Als es ihr gelang, die Übelkeit zu überwinden, hob sie den Blick zum Himmel. Die Gebäudemauern erhoben sich wie stumme Wächter, die das Geschehen in den Gassen überwachten. Die Wäsche peitschte gegen die Fensterscheiben. Darüber ein sternloser Nachthimmel: schwarze Wolken, die nach Unwetter aussahen, und hier und da das blinkende Licht eines Helikopters.
Das Mädchen sah sich nervös um. Als es sich sicher war, dass seine Füße es tragen konnten, lief es dicht an der Hauswand entlang bis zum Ende der Gasse und blickte um die Ecke. Eine breite Straße ohne Autoverkehr erstreckte sich bis zum Horizont. Ein paar vereinzelte Fußgänger liefen eilig von einem Ort zum anderen. Sie sahen einander nicht an. Die Reste der herrenlosen Zeitung flatterten zwischen den Straßenlaternen hin und her.
»Hier ist es …«, murmelte das Mädchen. Von dem kleinen Gegenstand in seiner Hand, einem Spiegel in Tropfenform, ging ein schwacher rosafarbener Schein aus, und auf der Hauswand zeichneten sich die Umrisse eines Kruges ab. Das Mädchen umschloss den Spiegel mit der Hand und ließ den Krug wieder verschwinden. »Ich weiß«, flüsterte es dem Spiegel zu. »Diesmal haben wir uns nicht geirrt. Ich glaube, wir sind in der richtigen Zeit und am richtigen Ort.«
Die junge Frau schnappte sich eine vorbeifliegende Zeitungsseite. Obwohl sie stark verwittert war, gelang es ihr, das Datum der Ausgabe zu entziffern.
Sie lächelte. Diesmal hatte der Meister sie der Zeit der Veränderung ziemlich nahe gebracht. Damit hatte er ein Effizienz-Niveau bewiesen, das trotz seiner enormen Macht recht ungewöhnlich für ihn war. Fest stand, dass die Schüler noch am Leben waren und in dieser Stadt wohnten, die sich wie eine Fata Morgana vor ihr ausbreitete. Wenn sie sich ein bisschen beeilte, würde sie sie noch finden, bevor …
Ein Laut versetzte sie in Alarmbereitschaft.
Er kam aus den Tiefen der Gasse, aber nicht aus der Erde, sondern von oben, aus den mittleren Stockwerken eines Gebäudes. Das Mädchen suchte ängstlich nach dem Ursprung des Geräuschs, bis es aus dem Augenwinkel ein paar Schatten wahrnahm, schwärzer als die Nacht, eine Symphonie von Hell und Dunkel, die wie ein Schwarm Vögel mit hoher Geschwindigkeit über seinem Kopf kreiste.
»Oh nein. Sie sind mir gefolgt!«
Der Spiegel in der Hand des Mädchens leuchtete hell auf. Mit seinem Widerschein versuchte er vergeblich eine schützende Glocke über es zu legen.
»Nein, lass das! Du musst deine Kräfte schonen«, mahnte es ihn. »Wenn sie uns jetzt angreifen, sind wir verloren. Wir müssen den Tempel finden und das Mädchen dorthin bringen.«
Auch das Tier aus der Kanalisation nahm die Finsternis wahr, die schwarz in schwarz über ihnen schwebte. Es hatte gerade in den Schutz der Kloake zurückkehren wollen, als jemand es blitzschnell gepackt haben musste. Nicht einmal die geschulten Sinne der jungen Frau hatten etwas bemerkt.
Ein gellender Todesschrei, und das Tierchen war nicht mehr.
Die junge Frau überlegte es sich nicht zweimal. Instinktiv versuchte sie den maximalen Ausdruck ihrer geheimen Macht, das Schwert-Zeichen, heraufzubeschwören, aber es gelang ihr nicht. Der durchdringende Schmerz in ihrer Brust gab ihr deutlich zu verstehen, dass sie zu erschöpft war. Wenn sie jetzt darauf bestand, das Schwert zu materialisieren, wäre die Anstrengung für sie mit aller Wahrscheinlichkeit tödlich. Und sie hatte nicht einen so weiten Weg zurückgelegt, um alles auf den letzten Metern zu vermasseln.
Die Schatten, die sie mit ihrem besonderen Sehvermögen sofort wahrgenommen hatte, hatten noch keine physische Gestalt angenommen. Aber sie konnte sie spüren, sie waren ganz nah. Und manchmal waren sie auch so schon in der Lage, große Schäden anzurichten oder Menschen, die ihnen über den Weg liefen, einfach zu töten.
Ihre Aufgabe war es, genau das zu verhindern. Sie verließ die Gasse und ging mutig eine Straße entlang, in der sie noch nie zuvor gewesen war, in einer Stadt, die ihr völlig unbekannt war. Sie betete. Noch war es nicht zu spät, um das erste Mädchen zu retten.
Wenn sie sich jetzt erwischen ließ, wäre nicht nur ihre Mission gescheitert, sondern die Menschheit als Ganzes, als große Einheit, als Versprechen für die Zukunft. Sie sähe sich zu einem vorzeitigen, schrecklichen Ende verurteilt.
Nicht im Traum dachte sie daran, das zuzulassen.
Aber wenn sie den bevorstehenden Weltuntergang verhindern wollte, musste sie sich beeilen.
Normalerweise fanden alle kulturellen Veranstaltungen im schuleigenen Festsaal statt. Beim Hochbegabtenwettbewerb machte man eine Ausnahme. Weniger als kulturelle denn als gesellschaftliche Veranstaltung diente sie den höheren Schulen und Gymnasien – und ihren jeweiligen Heerscharen von Eltern – als Vorwand, mit ihren besten Schülern zu prahlen. Und damit auch wirklich alle das hohe Bildungsniveau der Schulen bestaunen konnten, präsentierten sie ihre Schützlinge in aller Öffentlichkeit.
Der pädagogische Leiter des Verdemar-Gymnasiums Señor Velasco hatte sich schon während der letzten drei Trimester mental auf diesen Tag vorbereitet. Er machte keinen Hehl daraus, dass er sich angesichts der möglichen Beförderung die Hände rieb, und konnte den Augenblick, wenn seine Schüler die Streber der anderen Schulen in sämtlichen Fächern vernichtend schlugen, kaum erwarten. In Mathematik würde eine Salve auf sie niedergehen, gefolgt von einem Granatfeuer in Chemie, Literatur und Philosophie. Wenn das nicht reichte, durften sie sich in Geografie auf ein Artilleriefeuer mit Luftwaffenunterstützung der Sozialwissenschaften gefasst machen. Und sollte die Eroberung des Pokals dann immer noch nicht gesichert sein, würden die Überflieger aus der Kunstgeschichte im Sirenengeheul vom Flugzeugträger starten.
Es versprach ein denkwürdiger Abend zu werden, den man noch oft zitieren würde wie die Heldensagen der Antike. Und es wäre sein Abend. Der Abend, für den man ihn mit einer Beförderung zum örtlichen Schulleiter belohnen würde.
Er würde dieses Ereignis in vollen Zügen genießen. Wenn nur Tanya nicht wäre.
Velasco wusste, dass es in jedem Jahrgang ein schwarzes Schaf gab, eine verfaulte Traube, die, wenn man sie mit den anderen in einen Korb warf, am Ende alle verdarb. So war es in allen Gymnasien, überall auf der Welt. Alle hatten ihre Tanya Svarensko.
Das Mädchen stammte aus einer russischen Einwandererfamilie, die sich im Land niedergelassen hatte, als Tanya gerade ein paar Monate alt war. Die wenigen Male, die ihre Eltern zu den Sprechstunden erschienen waren, hatten sie einen anständigen Eindruck gemacht. Der Vater hatte große, schwielige Hände von seiner Arbeit auf dem Bau. Die Mutter war bei einer Versicherung angestellt, wo sie den ganzen Tag telefonierte, sodass sie die Sprache um Welten besser beherrschte als ihr Mann, und sie hatte große ehrliche blaue Augen und schönes alabasterfarbenes Haar, das sie ihrer Tochter weitervererbt hatte.
Sie fielen kein bisschen unangenehm auf, aber Velasco traute den Ausländern nicht. Wenn sie ihr Land verlassen müssen, um uns mit ihrer Anwesenheit zu belästigen, wird das schon seinen Grund haben, pflegte er gerne zu sagen.
Velasco hatte die Probleme schon gerochen, als Tanyas Eltern sie damals in der Schule angemeldet hatten. Die Jugendliche war aufrührerisch, rebellisch auf eine verborgene, elegante Weise (sie war nicht straffällig, aber es schien auch nicht möglich, sie auf den rechten Weg zu bringen), und obendrein hatte sie an einer Kultur Gefallen gefunden, die derzeit unter den Mädchen ihres Alters kursierte und die ihn völlig aus dem Häuschen brachte. Es handelte sich um eine aus Japan importierte Mode, die eine ganz bestimmte Art der Kleidung, des Verhaltens, des Einkaufengehens und sogar des Denkens vorschrieb, und die diese Mädchen einfach »Lolita« nannten.
Peinlich. Man konnte es nicht anders nennen. Velasco ging innerlich die Wände hoch, wenn er die Mädchen sah, die sich wie Püppchen kleideten, mit knielangen Röcken und Rouge auf den Wangen. Er sah sie auf den Gängen der Schule, wo sie sich versammelten, um vor ihren männlichen Mitschülern in der Cafeteria auf und ab zu stolzieren, oder wenn sie an die Tafel vorkamen, um eine Aufgabe zu lösen, und ihre Unmengen von Spitzen erzittern ließen.
Velasco knirschte mit den Zähnen. Die echten Straftäter hatte er unter Kontrolle. Da wusste er, woher der Wind wehte, und konnte ihnen zuvorkommen und die Polizei rufen, wenn es nötig war. Aber diese Mädchen, die einem Tim-Burton-Film entsprungen zu sein schienen … Wie sollte er sie verstehen? Wie sollte er das Handeln einer Gruppe vorhersehen können, deren Regeln und Motivationen ihm gänzlich fremd waren?
Wenn es nach ihm ginge, würde er diesen Jugendbanden strikte Grenzen setzen. Seine erste Amtshandlung als künftiger Schulleiter wären ein paar entscheidende Änderungen in der Schulordnung. Und natürlich hätte er dann besonders das Fräulein Svarensko mit ihren feinen Manieren und unkonventionellen Umgangsformen im Visier.
Leider hatte die Sache einen Haken. Alles hatte immer einen Haken.
Tanyas Intelligenzquotient entsprach praktisch dem eines Genies. Sie war seine beste Karte, sein einziger Trumpf, den er in der Schlacht der Intellektuellen an diesem Abend ausspielen wollte.
Velasco hatte nicht gut geschlafen. Die Tränensäcke unter den Augen zeugten von einem langen Kampf gegen die Peinlichkeit, gegen die Angst vor dem Augenblick, in dem die Jury mit ansehen musste, wie eine übergeschnappte Lolita die Bühne betrat, um den krawattentragenden Schülern des gegnerischen Gymnasiums den Preis wegzuschnappen. Wie das exzentrische Mädchen die wohlerzogenen Talente der konkurrierenden Schule gleichsam in Unterwäsche dastehen ließ.
Beinahe hätte er es vorgezogen, auf den Preis zu verzichten und resigniert in der angenehmen Anonymität zu verharren.
»Komm, Kleine, tauch endlich auf!«, murmelte er. Er blickte zum achten Mal auf die Uhr, aber die Zeiger hatten sich noch keinen Millimeter weiterbewegt. Die Jugendlichen des gegnerischen Teams hatten sich bereits auf der Bühne des Opernpalastes eingefunden und nahmen in diesen Minuten hinter den in V-Form angeordneten Tischen Platz.
Der pädagogische Leiter zitterte vor Neid, als er die anderen Teilnehmer sah. Die Jungen trugen einen Anzug, die Mädchen ein ordentliches Kostüm, und alle legten sie ein vorzügliches Benehmen an den Tag … Sie waren genau so, wie man sich ein Wunderkind vorstellte. Bei dem Gedanken, wie sich seine Truppenführerin hier präsentieren würde, gefror ihm das Blut in den Adern.
»Señorita, so können Sie hier nicht durch! Ihr … was Sie da anhaben, verstößt gegen die Regeln!«
Die Stimme drang deutlich aus dem Bereich hinter der Bühne. Wahrscheinlich jemand vom Fernsehen (der Wettbewerb wurde von einem unabhängigen Sender ausgestrahlt). Einer Schülerin war es offenbar gelungen, ihn aus der Fassung zu bringen.
Der pädagogische Leiter schloss die Augen. Es ist so weit, dachte er. Seine schlimmste Befürchtung hatte sich bestätigt. Mutlos ging er nachsehen, was los war. Bei dem folgenden Anblick sank ihm das Herz in die Hose.
Natürlich war es Tanya. Sie war wie immer zu spät, aber dafür in voller Lolita-Montur gekleidet. Wenn die Aufmachung, mit der sie tagtäglich zum Unterricht erschien, extravagant war, so hatte sie jetzt ihr ganzes Arsenal aufgefahren, und das alles nur, um ihn, Velasco, in den Wahnsinn zu treiben.
Das Mädchen war von zierlicher Gestalt, knapp einen Meter sechzig groß, aber von einer Aura umgeben, die den meisten ihrer männlichen Altersgenossen unangenehm war. Etwas an ihr war befremdlich, so als wäre sie nicht von dieser Welt. Von ihrer Mutter hatte sie die blauen Augen, aber von ihrem Vater jenen typischen osteuropäischen Blick, der jeden warnte, sie nicht zu unterschätzen.
Velasco hatte sie im Vorfeld gebeten (Herrgott, angefleht hatte er sie!), sie möge nur ein einziges Mal und als Zeichen des Respekts vor dem Bildungssystem als »anständige« Schülerin auftauchen. Mit einem stinknormalen Hemd, einem Rock ohne Spitze und einer Frisur, die ohne diese Unmengen von schwarzen Blumen und Schleifchen auskam, mit denen sie aussah wie ein kitschiges Grabgesteck.
Es war offensichtlich, dass Tanya die Bitte zum einen Ohr hinein und zum anderen wieder hinausgegangen war, ohne auch nur auf den geringsten Widerstand zu stoßen.
Sie trug einen Reifrock aus festem Stoff, der von etwas unterhalb des Bauchnabels bis knapp über die Knie fiel, wo er mit einer Quastenborte abschloss, die ebendort auf ein paar hohe Kniestrümpfe traf, ganz im japanischen Stil. Ein Korsett schob ihre Mädchenbrüste zu zwei blassen kreisrunden Bällen zusammen und so weit nach oben, dass sie beinahe die schwarze Perlenkette berührten. Auf dem Kopf trug sie einen Minihut mit Tüll und um die Handgelenke weiße Bänder, deren Enden fast bis auf den Boden herunterhingen.
Am eindrucksvollsten aber war das Make-up. Tanya schien ihr Gesicht in Gips getaucht und dann zwei Riesenaugen und ein paar Schatten darauf gemalt zu haben, die sie ein bisschen hässlich machten, ihr aber jene Aura einer lebendigen Toten verliehen, die perfekt zu ihrer Kleidung passte. Insgesamt erinnerte sie an ein Gespenst, das der Weihnachtsgeschichte von Dickens oder einem Gothic angehauchten Pulcinella-Film entsprungen schien.
Der Anblick war definitiv zu viel für ihn. Velasco musste sich an der Wand abstützen, um nicht an Ort und Stelle zusammenzubrechen.
»Was hast du gemacht?«, schrie er, obwohl nur ein Flüstern zu hören war. »Schau dich mal an, Herrgott! Als was hast du dich verkleidet?«
Sie blickte ihn abschätzig an. »Das ist keine Verkleidung. Ich mag diesen Stil.«
Velasco wusste, dass es ein verlorener Kampf war, also mäßigte er den Ton und appellierte an ihre Vernunft. Sonst nichts. Nur an ihre Vernunft. Das war doch wirklich nicht zu viel verlangt.
»Hör zu, Tanya, es ist zwar weder der richtige Moment noch der richtige Ort, aber … Ich bitte dich, bei allem, was dir heilig ist oder was du an deinem Gymnasium, deinem Unterricht oder unserer verdammten Zivilisation zu schätzen weißt: Zieh dich um! Das ist eine persönliche Bitte.« Er fuhr mit dem Handrücken über die Brieftasche. »Es geht zwar jeden Augenblick los, aber … ich spendiere dir ein Kostüm, wenn es nötig ist. Lass uns ins Einkaufszentrum um die Ecke gehen, und ich kauf dir eins. Jetzt müssten sie noch offen haben.«
Die Schülerin starrte ihn an, ihr Lächeln war eingefroren. »Was können Sie an mir am wenigsten leiden, Señor Velasco?«, fragte sie gelassen.
»Was ich an dir am …? Schluss. Schluss! Lass uns darüber jetzt nicht diskutieren. Wir haben keine Zeit.« Er deutete auf die digitale Stoppuhr, die die verbleibenden Minuten bis zum Beginn des Wettbewerbs anzeigte. »Ich will nicht, dass du so auf die Bühne gehst. Du siehst aus wie … die Nichte von Edward mit den Scherenhänden. Komm mit.«
»Nein«, erwiderte sie scharf. »Sie wollen etwas von mir. Und ich will etwas von Ihnen. Wenn Ihnen etwas daran liegt, dass wir zusammenarbeiten, lassen Sie mich in Ruhe, oder ich gehe jetzt auf der Stelle nach Hause und verbringe den restlichen Abend mit Abschminken.«
Velasco sah sie eiskalt an. Der enorme Größenunterschied zwischen den beiden ließ ihn wie einen Riesen dastehen, der im Begriff war, eine Fliege zu zerquetschen.
»Und was willst du von mir, du kleine Erpresserin?«, wagte er zu fragen.
»Respekt.«
»Respekt?« Er lachte höhnisch auf. »Du glaubst doch nicht im Ernst, dass dir in diesem Aufzug jemand Respekt entgegenbringt?«
»Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Ich werde für die Schule und für Ihre Beförderung kämpfen, wenn Sie möchten, aber wie, das müssen Sie schon mir überlassen, sonst …« Sie öffnete ihre Tasche, die im gleichen Stil gehalten war, und zeigte ihm den Make-up-Entferner.
Velasco fasste sich an den Kopf. Er ergriff das wenige, das von seinen Haaren noch übrig war, widerstand aber der Versuchung, daran zu ziehen. Schließlich gab er nicht ein Vermögen für Haarwuchsmittel aus, um sich das Ergebnis aus einer dummen Laune heraus büschelweise wieder auszureißen.
Der Sekundenzähler näherte sich in rasenden Schritten der Null. Der Spielleiter gab der Technik ein Zeichen, und das Deckenlicht erlosch. Der Saal war gestopft voll, das Publikum bestand zum größten Teil aus Angehörigen und Freunden der Teilnehmer. Hinter den Tischen warteten die Jugendlichen ungeduldig auf den Beginn des Abends, nur Tanyas Platz war noch leer.
Ihre Klassenkameraden tauschten irritierte Blicke aus. Warum war ihre merkwürdige Wissensfürstin nicht da? Würde ihre wichtigste Geheimwaffe sie heute Abend im Stich lassen?
»Okay, okay.« Velasco gab klein bei und heftete den Blick auf etwas, das über ihm schwebte. Vielleicht die letzten Überreste seiner Karriere. »Schon gut. Du hast gewonnen. Geh auf deinen Platz. Aber wehe dir, wenn du auch nur eine Aufgabe vermasselst«, warnte er sie.
Tanya nickte. In einer der hinteren Reihen entdeckte sie ihre Eltern. Sie waren ganz aufgeregt und versuchten, die Kamera zu verstecken, mit der sie das ganze Spektakel filmen würden. Sie winkte ihnen zu, als sie über die Bühne ging und ihren Platz einnahm. Gelächter wurde laut, erstaunte Ausrufe und vereinzelt auch Beifall. Das Gelächter traf Velasco wie unzählige kleine Messerstiche mitten in die Seele, aber dem Mädchen schien es nichts auszumachen. Im Gegenteil, sie schien über die Meinung, die die Leute von ihr hatten, erhaben zu sein.
Das Licht im Saal wurde gedämpft. Das Publikum verstummte, eine bleierne Stille legte sich über den Opernpalast.
Der Spielleiter gab das Zeichen, und die Vorführung der Crème de la Crème beider Schulen begann.
Das Mädchen mit der dunklen Haut glänzte im Schein der Straßenlaternen, so dicht stand ihm der Schweiß auf Gesicht und Armen. Einen Augenblick lang wurde es von den Scheinwerfern eines vorbeifahrenden Autos geblendet, aus dem laute Musik dröhnte. Der Wagen geriet ins Schleudern und fuhr dann unter alkoholisiertem Gelächter weiter.
Am Himmel bildeten die Wolken eine Formation, die an das Auge eines Wirbelsturms erinnerte.
Es konnte nicht mehr weit sein, das spürte die junge Frau deutlich, aber sie war praktisch am Ende ihrer Kräfte, und selbst wenn sie die Auserwählte noch vor ihren Feinden erreichte, hieß das gar nichts. Vielleicht würde sie gerade noch Zeugin ihres Todes werden, und das war’s dann. Sie musste sich so lange strikt an den Plan halten, bis etwas schiefging, und dann improvisieren.
Die Wolken waren der Schlüssel. Das Auge formierte sich über einem Gebäude im nächsten Block, einer Art Theater, das hell erleuchtet war.
»Hier ist es«, sagte sie zwischen zusammengebissenen Zähnen, »also los, es ist ganz nah …«
Ein schrilles, unmenschliches Lachen drang von der anderen Straßenseite herüber. Sie hatte es sich nicht eingebildet: Sie waren da. Von einer plötzlichen Panik ergriffen, wirbelte sie herum und konnte ein paar Schatten ausmachen, die sie vom gegenüberliegenden Bürgersteig aus beobachteten. Es waren sechs schmale Gestalten, von der Dunkelheit wie von einem Glorienschein umgeben und unmöglich von ihr zu trennen. Sie hatten keine zusätzlichen Gliedmaßen, nur die üblichen menschlichen.
Und sie starrten sie durchdringend an.
Das Mädchen presste den Spiegel an die Brust und zwang seine schmerzenden Beine, sich noch schneller zu bewegen. Im Umkreis des Gebäudes befanden sich Leute: Passanten, Neugierige, vielleicht ein Sicherheitsbeamter. Wenn es jetzt laut genug schrie, würde man es hören, und der instinktive Impuls der meisten Sterblichen zu helfen, würde bewirken, dass ihm jemand beisprang.
Aber nur, wenn ihm diese Scheusale nicht den Weg versperrten.
Die junge Frau warf einen Blick über die Schulter. An der Stelle, wo sie eben noch die sechs Gestalten gesehen hatte, war niemand mehr.
Verdammt.
Sie wusste nicht wie, aber eine unbestimmte Zahl an Flüchen, Verwünschungen und Schmerzenslauten später erreichte sie die Freitreppe des Gebäudes. Über der großen Doppeltür hing ein gewaltiges Schild, auf dem in großen goldenen Lettern stand:
OPERNPALAST
HEUTE ABEND:
Große Gala des Wissens
WETTBEWERB DER HOCHBEGABTEN!
Das Mädchen machte auf der untersten Treppenstufe halt, die Hände auf die Knie gestützt, als wäre es gerade einige Kilometer gerannt, und blickte die leere Straße hinunter.
Von den Verfolgern gab es nicht die geringste Spur. Aber sie waren da, in unmittelbarer Nähe, das war das Einzige, worauf die junge Frau in dieser Situation ihren Kopf gewettet hätte.
Ein Nachtwächter kam zu ihr herüber. »Alles in Ordnung, Señorita?«
Seine Sprache war ihr in höchstem Maße unverständlich. Der Spiegel, der das Problem sofort erkannte, verbrauchte einen kleinen aber lebenswichtigen Teil seiner Essenz dafür, das Gehirn seiner Besitzerin mit sämtlichen Sprachen des Planeten zu füttern, selbst jene, die gemeinhin als tot galten, nur damit sie niemals wieder in eine solche Verlegenheit geriet.
Als sie den Satz des Wächters aus dem Gedächtnis übersetzt hatte, pfiff sie leise durch die Zähne.
»Wie bitte … Entschuldigung? Ah, Sie meinen mich? Ja, mir geht es gut, es ist nur …« Sie rieb sich die Beine. »Ich will nicht nach Hause, bevor ich nicht meine persönliche Bestleistung von zehn Blöcken geschafft habe. Was manchmal nicht ganz leicht ist.«
»Sie gehen an einem Abend wie heute joggen?«, wunderte sich der Mann. »In diesem Aufzug?« Er musterte sie von oben bis unten. »Und barfuß noch dazu!«
Mist! Ein kulturelles Problem. Ihr Gewand aus lauter kleinen aneinandergenähten Steinen schien nicht gerade das zu sein, was die Leute hierzulande beim Sport anhatten. Und zu allem Überfluss trugen sie auch noch Schuhe.
Sie versuchte, die Situation zu retten. »Das hier … ist, zugegebenermaßen, auf den ersten Blick ein wenig befremdlich. Wissen Sie, ich trainiere für eine besondere Sportart. Eine besonders harte Form des Joggings mit einem sehr … sehr fremd klingenden Namen. Und die Regeln erst …« Sie machte eine wegwerfende Handbewegung und setzte ein überdrüssiges Gesicht auf.
Der Wächter stemmte die Arme in die Hüften. Der jungen Frau fiel auf, dass er als einzige Waffe einen Schlagstock bei sich trug. Das war schon mal schlecht.
»In Ordnung. Ruhen Sie sich aus, aber sobald es Ihnen besser geht, laufen Sie weiter. Auf dieser Treppe hier können Sie nicht bleiben.«
»Ist gut, Señor, vielen Dank. Ach, eine Frage hätte ich noch, was findet denn hier heute Abend statt?« Sie deutete auf das Schild über dem Eingang.
»Ach, das? Nichts, absolut unbedeutend. Ein Wettbewerb von jugendlichen Hochbegabten oder so was. Eine Veranstaltung der Stadtverwaltung.«
»Aha. Und kann man da rein?«
»Nein, unmöglich. Nur geladene Gäste. Außerdem ist das Fernsehen da.«
»Ich verstehe. Aber es ist so, dass ich …«
Der Mann schob die Hände wie eine Zugbrücke zwischen sie beide.
»Die Diskussion ist hiermit beendet, Señorita. Und jetzt muss ich Sie bitten zu gehen, sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als …«
Der Ausdruck auf seinem Gesicht, der eben noch mürrisch und unerbittlich gewesen war, wurde plötzlich sanft und entgegenkommend.
Der Spiegel leuchtete wieder auf.
Das Mädchen versuchte ihn mit den Händen zu verdecken, aber der Zauber war bereits vollbracht.
Der Wächter schenkte der jungen Frau sein gütigstes Lächeln und begleitete sie zur Eingangstür. »Ich bitte Sie vielmals um Entschuldigung, ich weiß gar nicht, wo zum Teufel ich mit meinen Gedanken war«, entschuldigte er sich. »Normalerweise lassen wir niemanden mehr rein, sobald die Türen geschlossen sind, aber in Ihrem Fall werden wir selbstverständlich eine Ausnahme machen. Wenn Sie so freundlich wären …«
Er öffnete einen Türflügel halb und hätte sich beinahe vor ihr verbeugt, ehe sie hineinschlüpfte.
Sie befand sich alleine in einem großzügigen Eingangsbereich, in dem gewaltige Kristallleuchter von einer gewölbten Decke hingen.
Nachdem der Wächter die Tür wieder geschlossen hatte, hielt sie sich den Spiegel vors Gesicht und warf dem Spiegelbild einen wütenden Blick zu. Es war nicht ihr eigenes, sondern das einer Greisin, die sich trotz ihres weit über hundertjährigen Alters eine glänzende blonde Mähne bewahrt hatte.
»Lass diese Dummheiten, du bist viel zu schwach dafür!«, fauchte das Mädchen verärgert.
Es war absolut notwendig. Sie waren kurz davor, dich einzukreisen, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf.
»Tu – das – nie – wie – der«, schalt das Mädchen, wobei es jede einzelne Silbe betonte. Dann versteckte es den Spiegel unter dem Hemd.
Die Antwort des Spiegels drang gedämpft an ihr Ohr:
Du weißt genau, dass ich entbehrlich bin, Séfora. Das Wichtigste ist, dass du diese jungen Leute rettest. Im schlimmsten Fall musst du mich opfern, und wenn es die letzte Energiespritze ist. Sie könnte dir das Leben retten.
Séfora ließ sich nicht dazu herab, darauf noch etwas zu sagen. Natürlich wusste sie über diesen Trumpf im Ärmel Bescheid, aber selbst, wenn es das allerletzte Mittel auf Erden wäre, dachte sie nicht daran, ihn auszuspielen. Sie würde ihre beste Freundin nicht aufgeben, um sich selbst zu retten.
Applaus drang gedämpft aus dem angrenzenden Saal. Das Mädchen schlich auf Zehenspitzen zur Tür und drehte an dem Knauf.
Séfora staunte nicht schlecht, als sie den riesigen, zum Bersten gefüllten Festsaal sah. Hunderte von Köpfen starrten auf eine Art Podium, auf dem hinter zwei großen Tischen zwei Gruppen von jeweils zehn Jugendlichen saßen, die alle in etwa das gleiche Alter wie ihr Zielobjekt hatten.
Auf einem Bildschirm tauchten jetzt ein paar Zeilen auf, woraufhin einer der Teilnehmer blitzschnell mit der flachen Hand auf einen Buzzer schlug.
»Antworten wird … das Team des Cospedal-Gymnasiums«, ertönte eine weibliche Stimme aus dem Lautsprecher.
Die Kameras zielten auf den jungen Mann, der sich stolz erhob. Eine Assistentin reichte ihm das Mikrofon.
»Die Frage lautet: Was ist das Zytosol in einer Zelle? Meine Antwort: ein Gel auf Wasserbasis, in dem viele wichtige Funktionen des Zellstoffwechsels stattfinden.«
Der Punktestand auf der Anzeigetafel wechselte von 49 auf 50, das Publikum applaudierte. Es war sogar eine lustige kleine Melodie zu hören.
Ein Anfall von Nostalgie überkam sie. Sie war schon zu lange von der Welt getrennt, um ganz zu begreifen, was da vor sich ging, aber die Szene erinnerte sie an einen der letzten Augenblicke ihres irdischen Lebens, als sie nichts weiter als eine Obstverkäuferin in Fanar war, dem griechischen Viertel von Konstantinopel, wenige Monate, bevor die Stadt in die Hände der Kreuzritter fiel. Sie konnte sich nicht einmal an das Jahr erinnern, aber doch an die Freude, die die Spiele der Kinder im Forum verbreiteten. Die Leute versammelten sich, um sie singen oder Gedichte aufsagen zu hören oder Ball spielen zu sehen, und klatschten Beifall, wenn eines der Kinder etwas besonders toll gemacht hatte. Straßenverkäufer wie sie gesellten sich unter die Zuschauer und hielten sich in der Nähe der Eltern auf, für den Fall, dass jemand frisches Obst kaufen wollte. Sie erinnerte sich sogar noch an das prasselnde Geräusch, mit dem der Tremissis, die damalige Goldmünze, in ihre Tasche fiel, begleitet vom heiteren Gelächter der Kinder.
Was für Erinnerungen! Aber das war, bevor die geflügelte Gestalt in ihr Leben gekommen war, um sie vor der Invasion zu warnen. Bevor sich ihr ganzes Leben von einem Tag auf den anderen veränderte.
Séfora blickte zum Spielstandsanzeiger: Es stand fünfzig zu fünfzig. Beide Teams lagen gleichauf, und die Anspannung, die sie in den Gesichtern der Teilnehmer (und in denen der Eltern, die sich hinter Dutzenden von Videokameras verschanzten) lesen konnte, verriet ihr, dass die Veranstaltung dem Ende zuging. Das war eine gute Nachricht:In dem Gedränge von Leuten, die erwartungsgemäß alle gleichzeitig aufstehen würden, um den Saal zu verlassen, könnte sie sich ihrem Zielobjekt unauffälliger nähern.
»Letzte Aufgabe«, verkündete die unpersönliche weibliche Stimme aus dem Lautsprecher. Zwanzig Jugendliche hielten den Atem an.
Auch das Make-up konnte die Angst nicht verbergen, die den Schülern ins Gesicht geschrieben stand.
Den Teilnehmern war es verboten, die Hände während der Fragestellung in der Nähe der Antwortknöpfe abzulegen. Tanya trommelte mit den Fingern auf ihren Knien. Mit höchster Konzentration starrte sie auf den Bildschirm. Die Schüler des Cospedal waren gut, besser als sie erwartet hatte. Aber sie begingen einen Fehler: Sie dachten zu schnell. Sie waren ganz offensichtlich darauf getrimmt worden, schnell und effizient zu antworten. Man hatte sie gleichsam zu Antwortmaschinen erzogen.
Natürlich blieb ihnen auf diese Weise keine Zeit, mögliche Doppeldeutigkeiten zu erkennen, Fallen, die sich hinter absichtlich uneindeutigen Formulierungen verbargen. Diese Schwäche hatte sie bereits mehr als einen Punkt gekostet.
Die Anzeige leuchtete ein letztes Mal auf. Wer jetzt die richtige Antwort gab, durfte den Pokal mit nach Hause nehmen, und mit ihm den Ruhm und die Beihilfe zum Studium.
Tanya kniff die Augen zusammen.
Die Frage lautete: Könnt ihr mir sagen, in welcher künstlerischen Disziplin der Serialist Byron zu Weltruhm gelangte?
Neunzehn Hände schnellten fast gleichzeitig zum Buzzer. Nur eine hielt sich zurück, ruhte wie eingefroren auf dem Oberschenkel.
Am schnellsten war der Spielführer des gegnerischen Teams, ein ziemlich überheblicher Bursche, der jedes Mal, wenn er eine Frage richtig beantwortet hatte, seinen Konkurrenten einen verächtlichen Blick zuwarf, als wäre jeder Punkt für ihn ein weiterer Nagel in ihren Sarg. Als die Zuschauer sahen, wer zum Mikrofon griff, ging ein Raunen der Enttäuschung durch die Zuschauerreihen.
»Meine Antwort lautet wie folgt«, begann der Schüler selbstbewusster denn je. »Die bevorzugte künstlerische Disziplin Lord Byrons war die Poesie, mit der er weltweit große Berühmtheit erlangte. Er wird als einer der vielseitigsten Autoren der Romantik betrachtet, in dem Maße, dass sogar der Argentinier José Mármol jedes seiner Gedichte mit einem Leitspruch von Byron beginnen lässt.«
Er hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da erhoben sich die Lehrer des Cospedal-Gymnasiums von ihren Plätzen und begannen laut, Hurra zu rufen. Die Eltern stimmten in den Applaus ein oder fielen sich gegenseitig um den Hals, und die ersten griffen nach ihren Handys, um Freunde und Bekannte zu informieren und mit ihren Kindern zu prahlen …
Bis die zwanzigste Hand schließlich die Annulliertaste drückte.
Verblüfftes Schweigen legte sich über den Saal.
Alle Augen, auch die der Spionin, die vom Eingang aus alles beobachtete, ruhten auf dem merkwürdigen Mädchen im Hintergrund, dem Mädchen, das die meisten Fragen des Wettbewerbs beantwortet hatte, nur nicht eine so offensichtliche wie die letzte.
Der pädagogische Leiter Velasco, der hinter den Kulissen auf den Nägeln kaute, pfiff auf seine Haarwurzelbehandlung und riss sich vor lauter Frust, Verwunderung und Groll ein ordentliches Büschel Haare aus. Zu dem Gefühl der Blamage gesellte sich jetzt noch der Hohn.
Tanya ließ sich ein paar Sekunden Zeit mit ihrer Antwort. Ihre Mutter warf ihr manchmal vor, dass sie niederträchtig sei, weil sie sich auf Kosten anderer amüsierte und damit bewirkte, dass sich die Leute um sie herum schlecht fühlten … Aber selbst wenn es so war und sie es in den meisten Fällen hinterher auch bereute, so musste sie diesen Moment jetzt einfach voll und ganz auskosten.
»Eine Schülerin des Verdemar-Gymnasiums hat die Antwort angefochten«, sagte die Stimme aus dem Lautsprecher. »Das Wort hat die Teilnehmerin mit der Nummer acht. Sollte ihr Einspruch nicht gerechtfertigt sein, werden ihrem Team zwei Punkte abgezogen.«
Tanya stand auf und strich sich den Rock glatt. Sie konnte die Verachtung in den Gesichtern der Zuschauer lesen: Wer ist diese Rotzgöre, die etwas so Offensichtliches infrage stellen will wie die Tatsache, dass Lord Byron ein Dichter war?
Sie nahm das Mikrofon, räusperte sich und sagte: »Die Frage bezieht sich weder auf einen Lord noch auf einen Romantiker, sondern auf den ›Serialisten‹ Byron. Dass Lord Byron einer der berühmtesten Dichter seiner Zeit war, ist natürlich richtig. Der Vorreiter in der Entwicklung des Serialismus aber war ein ganz anderer Byron, nämlich der Komponist Milton Byron Babbitt.« Bis dahin hatte Tanya mit dem Gesicht zum Publikum gesprochen, nun wandte sie sich an den Spielführer des Cospedal-Teams: »Bleibt also noch zu sagen, dass Byrons künstlerische Disziplin, die ihm zu Weltruhm verhalf, die Musik war, nicht die Poesie.«
Der Bildschirm ließ die Teilnehmer noch ein wenig zappeln, denn er nahm sich mit der Punktevergabe mehr Zeit als nötig. Schließlich aber ging der Punkt auf das Konto des Verdemar-Gymnasiums.
Diejenigen Zuschauer, die bislang geschwiegen hatten, brachen in Beifallsstürme aus, klatschten und weinten vor Freude, dass die Objektive ihrer Kameras ganz beschlagen waren. Tanya beehrte ihren Herausforderer, der in seinem Stuhl mutlos zusammengesunken war, mit einer Verbeugung aus dem achtzehnten Jahrhundert und versuchte dann zunächst ihre Eltern in der Menge zu entdecken (die ebenfalls aufgesprungen waren, aber noch immer vergeblich versuchten, ihre Digitalkamera zum Laufen zu bringen).