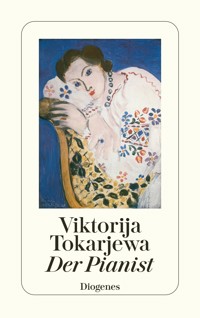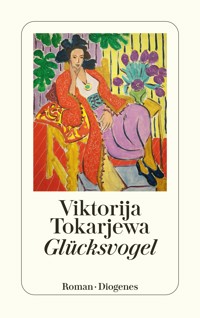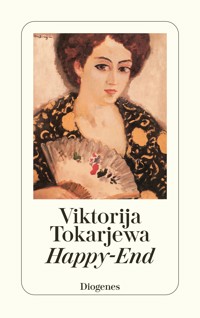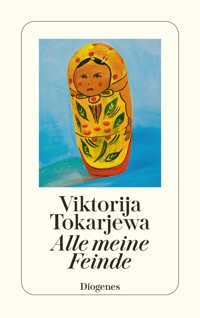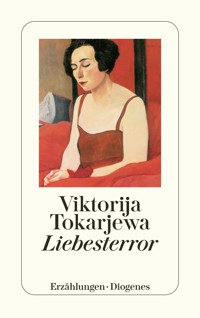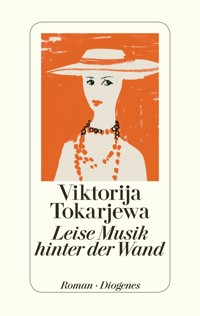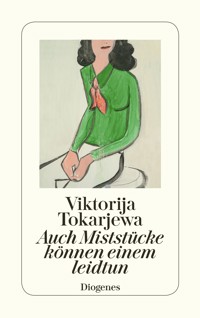7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es gibt Dinge, die man nicht gerne teilt. Den eigenen Mann zum Beispiel. So sanft Vera auch ist, sie sieht nicht tatenlos zu. Doch in diesem Spiel sind sich Siege und Niederlagen oft zum Verwechseln ähnlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Viktorija Tokarjewa
Der Baum auf dem Dach
Roman
Aus dem Russischen von Angelika Schneider
Diogenes
Matrjona
Sie hieß Matrjona, aber wie sollte man mit so einem Namen leben? Um sie herum gab es jede Menge Iskras, Klaras, Wilenas und Stalinas … Im Pass ließ man es stehen, wie es war – Matrjona, aber in ihrer Familie und im Bekanntenkreis nannte man sie nur Vera. Das klang kurz und klar. Und ganz und gar revolutionär.
Vera war im Bezirk Kaluga geboren, drei Jahre nach der Oktoberrevolution. Was direkt nach dem Umsturz alles los war, daran erinnerte sie sich nicht mehr. Diese Zeit der Finsternis lastete auf den Schultern ihrer Eltern.
Als Vera herangewachsen war, stellte sich heraus, dass das Mädchen eine Schönheit war und ihr Weg Richtung Schauspielkunst führte. Alle hübschen Mädchen wollten damals Schauspielerin werden, wollten ihre Schönheit zeigen, wollten alle beeindrucken, und einen Einzigen ganz besonders. Ihn wollten sie heiraten, Kinder bekommen und in Liebe und nationalem Ruhm leben. Na, wer will das nicht …
Vera packte ihr Bündel – einen Koffer hatte sie nicht – und machte sich auf nach Leningrad. Die aus ihrem Dorf wegzogen, gingen alle nach Leningrad – zum Geldverdienen, zum Studium und sogar zum Stehlen. Als wenn es außer Leningrad keine anderen Orte auf der Welt gegeben hätte.
Vor der Abreise sagte die Mutter zu Vera: »Merk dir das: Du bist interessant, zu dir werden viele verheiratete Männer kommen. Wenn du erfährst, dass einer verheiratet ist – dann lass dich nicht mit ihm ein. Sag ihm: ›Nichts da … Geh heim zu deiner Frau …‹«
Welch naiver Wunsch. Denn natürlich waren all ihre späteren Verehrer verheiratet. Außerdem fragt die Liebe nicht, ob einer verheiratet oder ledig ist … Aber Vera, so seltsam das auch war, hielt sich an die Anweisung ihrer Mutter. Und sie befolgte sie ihr ganzes Leben lang.
Vera schaffte es, ins Leningrader Theaterstudio aufgenommen zu werden. Man nahm sie nicht wegen ihres Talents, sondern wegen ihres Typs. Sie war eine Russin, mit rotblonden Haaren, blauäugig, und schlank wie eine junge Birke. Sie war die Verkörperung Russlands.
Die neu Aufgenommenen waren mehrheitlich dunkelhaarig, mit feurigen Augen, eher südländische Typen. Die Revolution hatte die Sesshaftigkeit aufgehoben, und aus allen kleinen Orten kam die talentierte jüdische Jugend herbei. Das erwies sich für die Kultur als äußerst nützlich. Oder wie man in China sagt: »Lasst tausend Blumen blühen«, die südlichen genauso wie die nördlichen.
Vera bekam einen Platz in einem Wohnheim.
Sie hungerte sich durch. Aber damals lebten alle so. Solange man Kartoffeln hatte, Mehl und Wasser, brauchte man sich keine Sorgen zu machen.
Zum Tanzen ging sie in das Wohnheim des Polytechnischen Instituts.
Ein großer Kerl mit dicker Brille forderte sie auf. Die Augengläser waren rund wie bei einem Binokel.
Der Bursche – er hieß Alexander – war gebürtiger Leningrader und wohnte im Haus der Spezialisten, so hieß ein Haus, das für die rote Professorenschaft gebaut worden war. Er kam nur zum Tanzen ins Wohnheim, genauer gesagt, er kam nur wegen Vera. Er presste sie an sich, und Vera spürte, wie laut sein Herz schlug. Und nicht nur sein Herz. Das Ende seines Unterleibs wurde hart und schwer, wie eine Lokomotive. Alexander rammte die Lokomotive in ihren Bauch. Er überfuhr sie regelrecht.
Vera sah den jungen Mann vorwurfsvoll an. Aber was konnte er schon tun? Sein Körper gehorchte ihm nicht. Der Körper hat seine eigenen Gesetze.
Nach dem Tanzen begleitete Alexander Vera zu ihrem Wohnheim. Er musste die angesammelte Leidenschaft irgendwie loswerden, und so trug er Vera die Treppe hoch. Er hob sie mit einer Hand unter den Kniekehlen an, mit der anderen stützte er ihren Rücken, und so trug er sie bis in den vierten Stock. Vera kicherte und wurde noch schwerer.
All das ging über Alexanders Kräfte. Und so heiratete er sie.
Vera zog zu ihm ins Haus der Spezialisten, in die Professorenfamilie ihres Mannes.
Seine Eltern waren angenehme Leute, wenn auch für das Alltagsleben völlig untauglich. Sie konnten nur Bücher lesen. Wie alt gewordene Einserschüler.
Vera legte Kohl ein, buk Kartoffelkuchen und briet Heringe.
Die Katzen setzten sich unters Fenster und schauten nach oben. Der gebratene Hering roch gut. Der Geruch zog alle an. Die Katzen wurden ganz nervös.
Vera schaffte alles. Um sie herum waren alle glücklich, jeder auf seine Art. Der Professoren-Papa hatte noch nie im Leben so gut gegessen. Alexander musste seine Lokomotive nicht mehr auf dem Abstellgleis lassen, und sie fuhr auf geraden Schienen rund um den Erdball, wobei sie triumphierendes Getute von sich gab. Die Professoren-Mama litt ein bisschen darunter, dass ihr Sohn eine vom Dorf, eine einfache Frau, geheiratet hatte. Aber was konnte man da machen … Die Revolution vermischte eben alle Schichten und Abstammungen.
Außerdem war Vera zwar ein einfaches Mädchen, aber so einfach nun auch wieder nicht. Sie war schließlich Schauspielerin, spielte Čechov und Gorki …
Vera wurde einundzwanzig.
Ihren Geburtstag feierten sie fröhlich und laut, sie saßen bis drei Uhr nachts beieinander. Und um vier Uhr begann der Krieg mit Deutschland.
Niemand stellte sich das Ausmaß und die Schwere dieses Krieges vor. Man dachte: Na ja, das geht jetzt einen Monat, oder zwei … Genau so lange, wie man brauchen würde, um den Feind auf dem eigenen Territorium zu schlagen. Die Panzerabwehr war solide, die Panzer selbst waren schnell …
Niemand kannte so etwas – oder hätte es sich überhaupt nur vorstellen können – wie das, was später als die Blockade von Leningrad bezeichnet wurde.
Leningrad wurde später zur Heldenstadt ernannt. Doch in Wirklichkeit war es eine Märtyrerstadt gewesen.
Die Menschen kamen vor Hunger schier um den Verstand.
Alexanders Eltern gingen nicht mehr auf die Straße vor Schwäche. Sie hatten Angst, umzufallen und nicht mehr aufstehen zu können. In der Stadt blühte der Kannibalismus. Es wurde Menschenfleisch gegessen. Man sagte, das Fleisch schmecke gut, ähnlich wie Schweinefleisch.
Alexander war wegen seiner Kurzsichtigkeit vom Militärdienst befreit. Aber es wäre besser gewesen, man hätte ihn an die Front geschickt. Dort wäre er wenigstens ausreichend ernährt worden.
Alexander war jung und groß. Sein Organismus verkraftete den Hunger nicht. Er fing an, Vera ihre 125-Gramm-Brotration zu klauen. Aber auch dieses Stückchen Brot rettete ihn nicht. Es schien, ganz im Gegenteil, als ob das den leidenschaftlichen Wunsch zu essen nur noch mehr anfachen würde.
Eines Morgens sah Vera, dass die Schwiegereltern tot waren. Sie waren in der Nacht gestorben, beide zusammen, oder einer nach dem anderen, das wusste man nicht. Aber das machte auch keinen Unterschied mehr. Die Blockade von Leningrad machte den Tod zu einer gewohnten, ja fast alltäglichen Erscheinung. Es war, als ob sich alle in eine Schlange gestellt hätten, um in die andere Welt zu gelangen, und als warteten sie gehorsam auf ihre Stunde. Ganz ohne Angst. Das Leben hatte sich in ein ununterbrochenes Leiden an Hunger und Kälte verwandelt. Und der Tod war das Ende dieses Leidens.
Alexander sah mit Entsetzen auf die toten Eltern, auf ihre Nasen, die spitz und gelb geworden waren.
Er wusste, wo Vera ihre Lebensmittelkarten aufbewahrte: in einem Kästchen in der Kommode unter der Wäsche.
Er zog das Kästchen hervor, nahm den Streifen Lebensmittelkarten heraus und versteckte die Hand hinter dem Rücken. Wie ein Kind.
Vera versuchte die Hand zu erwischen, um ihm die Karten wegzunehmen. Dieser Streifen mit den Karten bedeutete Leben. Er war das ganze Leben eines einzelnen Menschen.
Aber Alexander war stärker als sie. Er packte Vera mit einem Arm unter den Knien, den anderen schob er unter ihren Rücken und trug sie zum Fenster, um sie aus dem fünften Stock hinabzuwerfen.
Aber auf halbem Weg überlegte er es sich und ging Richtung Eingang. Er hatte beschlossen, sie vor die Tür zu setzen. Auf dem Treppenvorplatz ließ er Vera einfach fallen, ging zurück in die Wohnung und verschloss die Tür von innen.
Vera hatte sich nicht einmal wehren können. Sie hatte einfach keine Kraft mehr gehabt.
Zurück in die Wohnung konnte sie nicht. Alexander hätte sie umgebracht. Vera war nicht einmal böse auf Alexander. Sie verstand ihn. Der Hunger war stärker als der Mensch.
Vera hatte eine Fähigkeit: Sie konnte in die Haut eines anderen Menschen hineinkriechen, ihn verstehen. Und verstehen heißt verzeihen.
Vera ging die Treppe hinunter. Sie trat in den Hof, setzte sich auf eine Bank.
Es war ein wunderschöner, frostiger Morgen.
Vera wandte das Gesicht der Sonne zu und blinzelte. Vor ihren geschlossenen Augen tanzten bunte Kreise. Und plötzlich tauchte ein Gesicht auf, braungebrannt, mit ausgeprägten Wangenknochen, die Haut spannte über dem Jochbein.
Es war ein älterer Soldat in einer Wattejacke und mit einer Mütze mit Ohrenklappen. Er schaute Vera schweigend an, dann sagte er: »Du wirst wenig zu essen haben, aber du wirst nicht sterben. Und eines Tages wirst du alles haben. Du musst jetzt nur aushalten.«
Er wandte sich um und ging davon. Auf seinem Rücken war ein Rucksack zu erkennen, der einem Hund ähnelte. Vera sah ihm nach. Woher war er gekommen? Wo ging er hin?
Vera saß auf der Bank und wusste nicht, was sie jetzt tun sollte, wohin sich wenden?
Sie erhob sich und ging zu einer Kirche. Die Kirche war offen. Die Gesichter der Heiligen schauten leidenschaftslos von den Wänden. Einer von ihnen war Iwan Bogoslow. Und er sah nicht irgendwohin, sondern genau zu Vera. Vera trat einen Schritt nach rechts. Der heilige Iwan folgte ihr mit den Augen. Vera ging ein paar Meter nach links. Iwan lenkte seinen Blick nach links. Er verfolgte sie. Sein Antlitz war braungebrannt, die Farbe war wohl mit der Zeit nachgedunkelt. Iwan Bogoslow erinnerte sie quälend an jemanden, aber an wen … Vera konzentrierte sich und verstand plötzlich: Der Mann mit dem Rucksack, das war er! Auf der Ikone trug er keine Mütze, natürlich nicht, er war ja schließlich ein Heiliger …
Vera wurde klar, dass Iwan Bogoslow zu ihr gekommen war. Er war ihr in einer schicksalhaften Minute erschienen, um ihr Kraft zu geben und sie zu unterstützen.
Aber warum ausgerechnet der heilige Iwan Bogoslow? Vera hatte eine kleine Ikone von Nikolaj Ugodnik, die ihr die Mutter mitgegeben hatte. Es wäre logischer gewesen, wenn ihr der heilige Nikolaj erschienen wäre. Aber es war Krieg. Sterbende gab es zu Tausenden. Zu allen konnten sie es nicht schaffen. Vera war wohl der Heilige erschienen, der gerade frei war. Was machte das auch für einen Unterschied … Heiliger ist Heiliger.
Vera atmete die Kirchenluft tiefer ein, und es war, als tränke sie Wasser. Dann ging sie davon.
Jetzt war sie nicht mehr allein, sie hatte einen Schutzengel. Und nicht irgendeinen Schutzengel aus den hinteren Reihen, sondern Iwan Bogoslow.
Vera konnte bei ihrer Landsmännin Schura Golubewaja wohnen. Schura war zum Studium nach Leningrad gekommen, hatte aber die Aufnahmeprüfungen nicht geschafft und arbeitete jetzt als Kindermädchen bei einem einjährigen Kind.
Das Kind weinte vor Hunger, und Schura dachte ernsthaft daran, sich ein Stück Fleisch abzuschneiden. Sie wollte es abschneiden und kochen.
Die Zeit verging wie im Nebel. Das Volk murrte: Besser hätte man die Stadt den Deutschen gegeben, als diese tägliche Folter des Hungers. General Kutusow hatte im neunzehnten Jahrhundert die Stadt Moskau auch dem Feind übergeben, er hatte das Leben seiner Soldaten nicht riskieren wollen. Denn es gab nichts Wertvolleres auf der Welt als das Leben.
Aber für Stalin war ein Menschenleben nicht der Rede wert. Er wollte den Sieg um jeden Preis. In diesem Preis waren das Leben von Vera und Alexander inbegriffen, und das seiner Eltern und das der ganzen Stadt.
Alexander benutzte Veras Lebensmittelkarten, aber er starb trotzdem. Die Jungen starben schneller als die vertrockneten Alten.
Vera wurde im letzten Stadium der Unterernährung über den Ladoschsker See geschickt, oder wie man es damals nannte, über die ›Straße des Lebens‹. Die Lastwagen mit Menschen schleppten sich einer hinter dem anderen übers Eis. Die Deutschen bombardierten die ›Straße des Lebens‹ ohne Unterlass. Hier und dort spritzten Wasserfontänen auf. Die Lastwagen brachen im Eis ein. Die Menschen erstarrten klaglos, und auch Vera war fast ruhig. Sie wusste, dass ihr Schutzengel sie nicht im Stich lassen würde.
Und so war es auch. Veras Lastwagen kam durch.
Vera fing in einer Wäscherei an zu arbeiten. Es war eine höllische Arbeit. Alles wurde von Hand gemacht. Aber dafür gab es einen ganzen Laib Brot. Sie konnte daran riechen, so viel sie wollte, und es ganz langsam kauen, mit geschlossenen Augen.
Der Krieg ging zu Ende. Vera kehrte nicht nach Leningrad zurück. Sie brachte es nicht über sich. Die schweren Erinnerungen umwaberten sie wie klebriger Nebel. Sie wollte Klarheit, Sonne, weiten Raum.
So zog Vera nach Moskau. Sie trat ins Filminstitut ein, kämpfte sich durch.
Die Studenten, die Soldaten von gestern, trugen noch Uniform, denn sie hatten noch keine Zivilkleidung.
Die Mädchen waren modisch angezogen und satt, lebten bei Papa und Mama. Und zwischen ihnen stand Vera, dünn wie ein Stecken, immer hungrig, in dem immerselben Rock mit der immerselben Bluse. Sie hatte sich angewöhnt, auf Vorrat zu essen, zu jeder Zeit, denn man wusste ja nie, wann es wieder etwas gab. Vielleicht nie wieder … Die Blockade saß ihr noch in den Knochen, verwandelte sich in eine Manie.
Vera mietete sich ein Zimmer in einem Dorf bei Moskau. Dort war es billiger. Sie ernährte sich nur von Kartoffeln.
Nach der Ausbildung wurde sie im Theater angenommen. Wegen ihres Typs. Sie war ein einfaches russisches Mädchen. Die anderen sahen nach allem Möglichen aus, nach einer Deutschen, Französin oder Schwedin. Aber so eine, ein einfaches, erdverbundenes russisches Mädchen, so eine war nur Vera.
Manchmal schminkte man sie aufwendig und steckte ihr die Haare hoch, dann sah sie aus wie die junge Tarassowa. Aber die Tarassowa war vom Typus her eine stolze Generalin. Und Vera war ewig an allem schuld. So war jedenfalls ihr Gesichtsausdruck.
Der Mitstudent Wasja Beljajew scherzte über sie: »Das Geschlagen-Sein bestimmt das Bewusstsein«, in Anspielung auf den Satz von Marx, ›das Sein bestimmt das Bewusstsein‹, Und das Leben schlug Vera ohne Unterlass.
Richtige Rollen gab man ihr keine, nur kleinere Auftritte. Sie wusste nicht, wo sie wohnen sollte. Der Lohn war eine einzige Schande. Sie hatte nichts als die Bezeichnung ›Schauspielerin‹.
Vera knauserte, wo sie konnte. Eines Tages fuhr sie nach der Aufführung nicht nach Hause, um das Fahrgeld zu sparen. Sie übernachtete in den Kulissen, in einer Ecke zwischen zwei Stellwänden.
Am Morgen stand sie vor Betriebsbeginn auf, wusch sich in der Toilette, frühstückte am Büffet Brot und Tee. Die Büffetfrau schenkte ihr eine Wurst.
Dann kamen die Leute. Die morgendlichen Proben begannen. Wenn Vera im Stück einen Auftritt hatte, nahm sie an den Morgenproben teil.
Danach, nach diesem Testlauf, übernachtete Vera oft in den Kulissen. Sie konnte eine alte Matratze ergattern und eine wattierte Decke. Morgens rollte sie alles zusammen und versteckte es.
Viele wussten von dieser Verletzung der Hausordnung, aber sie hielten dicht. Auch die Putzfrau, Tante Nadja genannt, sagte nichts. Vera tat ihr leid. Sie versetzte sich in ihre Lage: sich jeden Abend nach der Aufführung noch zum Bahnhof schleppen, dann die Fahrt mit der Vorortbahn, danach noch mal zwei Kilometer zu Fuß. Das alles bloß, um zu übernachten. Und morgens das Ganze umgekehrt, zwei Kilometer laufen, dann die Vorortbahn, dann vom Kazaner Bahnhof zum Theater. War es da nicht leichter, sich in die Kulissen zu verdrücken und den Arbeitstag ohne Hetze zu beginnen, ohne die Angst, zu spät zu kommen? Und außerdem sparte es Geld.
So übersiedelte Vera praktisch in die Kulissen. Nach Hause in das gemietete Zimmer fuhr sie nur, wenn sie einen freien Tag hatte, wenn sie weder im Stück auftreten noch am nächsten Morgen zu einer Probe musste.
Das Leben verlief einförmig, schleppte sich in einer vorgezeichneten Spur dahin, versprach weder Freuden noch Überraschungen. Was hatte Iwan Bogoslaw nur gemeint, als er ihr ›alles‹ vorausgesagt hatte? Oder hatte er sie vergessen? Warum hatte er ihr dann überhaupt etwas versprochen?
Vera weinte oft. Ohne mit dem Weinen aufzuhören, zog sie unter dem Kopfkissen einen Kanten Brot hervor und knabberte daran. Seit der Blockade aß sie, wann immer sie konnte.
Vera aß und weinte, und währenddessen war Iwan Bogoslow wohl irgendwo in anderen Angelegenheiten unterwegs, die wichtiger waren. Also musste sie warten. Und es einfach aushalten. »Trage dein Kreuz und glaube …«. Das sagte immer Nina Zarjetschnaja, ebenfalls eine Schauspielerin.
Veras sämtliche Freundinnen, die Schauspielerinnen, mit denen sie zusammen studiert hatte oder arbeitete, hatten sich inzwischen irgendwie ein Leben aufgebaut. Einige hatten Kollegen geheiratet, andere hatten reiche Männer ihren Ehefrauen ausgespannt. Nach dem Krieg tobte unter den Frauen ein grausamer Überlebenskampf.
Vera hielt sich strikt an die Anordnung ihrer Mutter: ›Lass dich nicht mit Verheirateten ein.‹ Die Ehefrau war heilig.
Veras Freundinnen sahen in Vera ein Dummerchen. Die Ehefrau war doch keine Wand, die konnte man sehr wohl wegschieben. Alle versuchten irgendwie zurechtzukommen. Sie drehten Filme, bekamen Hauptrollen. Nur Vera wurde vom Leben behandelt wie ein Boxauto auf dem Jahrmarkt.
Von Zeit zu Zeit bekam sie eine Rolle, wegen ihres Typs, sie spielte die einfache, gute Frau. Die ohne Charakter.
Eines Tages kam nach der Aufführung der Bühnenbildner Vilja Kronberg auf sie zu. Er fragte, ob Vera nicht ein paar Stunden für ihn Zeit hätte, um für ihn Modell zu stehen.
»Nackt?«, fragte Vera erschrocken.
»Nein, auf keinen Fall …«
So war Vera einverstanden. Vilja vereinbarte mit ihr einen Zeitpunkt am Ende der Woche.
Die ganze Woche lang quälte sich Vera mit Warten.
Vilja war schön und reich, wie im Märchen. Und er war ledig.
Vera posierte ein paarmal für ihn. Sie saß mit kerzengeradem Rücken auf dem Stuhl. Das strengte sie sehr an.
»Entspannen Sie sich«, bat Vilja. »Sitzen Sie einfach da, sonst nichts.«
Schließlich räumte Vera das Atelier auf. Sie säuberte die Bilder, auf denen sich der Staub der Jahrhunderte angesammelt hatte. Dann buk sie eine Pirogge mit Kohlfüllung.
Vilja aß und konnte sein Glück kaum fassen.
»Wie machen Sie das bloß?«, fragte er.
»Man darf den Kohl nicht vorher kochen«, erklärte Vera, »nur kurz blanchieren, das reicht.«
»Es schmeckt wie Spargel«, erklärte Vilja entzückt.
Vera wusste nicht, was Spargel war, aber sie genierte sich zu fragen.
»Sehr interessant …«, sagte Vilja und gab sich ganz der Geschmacksempfindung hin.
Vera trug dieses ›sehr interessant‹ die ganze Woche mit sich herum. Warum hatte er das gesagt? Was bedeutete das wohl?
Sie erzählte es zwei Schauspieler-Freundinnen, erzählte von Vilja, von der Pirogge und von dem ›sehr interessant‹.
Die Freundinnen waren skeptisch.
Eine von ihnen, die freche Walka Sanina, meinte: »Wo steckst du da deine Nase rein? Mädchen, wo ist er, und wo bist du?«
»Wie meinst du das?«, fragte Vera verständnislos.
»Na, ganz allgemein. Du bist weder Fisch noch Fleisch, hast keinen Pfennig auf der Naht. Und er – er ist einer der besten Partien in Moskau. Weißt du, wer hinter ihm her ist? Die Schachweltmeisterin Saroja. Eine erstklassige Schönheit.«
»Sie spielt schon kein Schach mehr. Das Schachglück hat sie verlassen«, präzisierte Ljubotschka Kuzmina, eine Travestie-Künstlerin, dünn wie ein Junge. »Diese Saroja reist nur noch in der ganzen Welt herum und wirft sich allen an den Hals.«
»Und Vilja?«, fragte Vera.
Die Ex-Schachweltmeisterin interessierte sie nicht.
»Vilja ist ihr von der Schippe gesprungen«, antwortete Ljubotschka. »Er springt immer ab.«
»Na, also«, sagte Vera zu Walka Sanina gewandt. »Und du erzählst …«
Walka zuckte die Achseln, warf ihren Pelzmantel über die Schultern, einen Pelzmantel, der lang und fast quadratisch war wie eine Burka. Sie steuerte mit einem merkwürdigen Gang auf den Ausgang zu. Sie bewegte sich vorwärts, als würde sie mit den Brüsten den Weg frei räumen.
Walka hatte vor kurzem einen reichen Professor geheiratet und fühlte sich als die Siegerin ihres Lebens.
Vera beneidete sie nicht. So einen Professor, glatzköpfig und rundlich, hätte sie nicht geschenkt gewollt. Da war Vilja Kronberg doch was ganz anderes – klug und gut erzogen, er sagte nie ein überflüssiges Wort. Alle Worte waren genau am Platze.
Vilja war wirklich immer korrekt, freundlich, zeigte keinerlei unsittliche Initiative. Diese Initiative ging von Vera aus. Sie führte zu einer unerwünschten Schwangerschaft.
Aber wieso eigentlich unerwünscht? Vera überlegte es sich und beschloss, das Kind zur Welt zu bringen – für sich und für ihn. Für sie beide.
Aber Vilja sagte einen merkwürdigen Satz: »Ach, lass mich doch in Frieden sterben …«
»Wieso? Bist du krank?«, fragte Vera besorgt. »Ich pflege dich wieder gesund.«
Vilja lachte seltsam auf. Er litt an derselben unheilbaren Krankheit, an der auch Nikolaj Ostrowskij gestorben war. Die Ärzte bestätigten, dass diese Krankheit nur die Besten befällt. Also braucht die Natur eine solche Überfülle an Gutem nicht.
Vilja verbarg seine Krankheit sorgfältig. Es war seine persönliche Tragödie, die er mit niemandem teilen wollte.
Abtreibung war damals verboten. Vera gab man die Adresse von einer Tatjana, die alle Probleme in fünf Minuten regeln würde. Da war ein Embryo – und schon war er nicht mehr da.
Vera verabredete sich mit Tatjana am Telefon und ging am bewussten Tag zur genannten Stunde zu ihr.
Sie kam zu früh. Tatjana war noch nicht zu Hause.
Vera setzte sich auf den Treppenabsatz und wartete.
Nach einer halben Stunde kam die mürrische Tatjana und sah nur kurz zu Vera hin.
Vera saß da, gut angezogen und mit getuschten Wimpern. Tatjana erstaunte das immer wieder, dass die Frauen so geschminkt und gut angezogen zu ihr kamen, als gingen sie zu einem Rendezvous und nicht zu einer illegalen Abtreibung.
Vera folgte Tatjana in ihr Zimmer.
Alles ging schnell und geschäftsmäßig vonstatten. Tatjana machte eine Seifenlösung aus einfacher Seife und führte sie in die Höhlung ein, wo der kleine Embryo saß. Im Grunde war es ja noch eine Erbse.
Dann stand Vera auf und fuhr ins Theater. Sie hatte abends eine Aufführung.
Sie spielte eine kleine Nebenrolle im Stück eines modernen Autors. In diesen Jahren erlaubte die Zensur nur den Konflikt zwischen dem Guten und dem noch Besseren. Alles ringsum war gut, aber es konnte noch besser werden. Das war die ganze Handlung.
Während des Stücks bekam Vera Wehen. Ein unerträglicher Schmerz ergriff ihren ganzen Körper. Vera vermochte die Rolle in ihrem Zustand kaum zu spielen. Sie fürchtete, dass ihr die Seifenlauge für alle sichtbar an den Beinen herunterfließen würde.
Nachts kam die Fehlgeburt.
Die Toilette war weit weg von den Kulissen, auf einem anderen Stockwerk. Vera zog ihren Körper die Stufen hoch, wobei sie sich am Geländer festhielt. Etwas fiel klatschend aus ihr heraus. Vera kam es vor, als wäre ihr Herz aus ihr herausgefallen. Sie heulte laut auf, wie ein Hund. Das Heulen widerhallte im weiten Raum. Ringsumher war keine Menschenseele. Vera heulte mutterseelenallein, wie auf dem Mond.
Und Vilja wusste nichts von alledem.
Vera versetzte sich an seine Stelle und wollte seine Ruhe nicht stören. Sollte er in Ruhe sterben, dann, wenn er es wollte. Und unglaublicherweise starb Vilja tatsächlich ein paar Jahre später, ohne Nachkommen zu hinterlassen. Er war so jung und so schön – und starb trotzdem.
Nach der Fehlgeburt wurde Vera nicht mehr schwanger. Aber das war ja auch gut so. Wie hätte sie auch ein Kind zur Welt bringen können, sie hatte keinen Ort zum Wohnen, hatte weder Geld noch Liebe.
Alexander der Zweite
Er hieß Alexander. Zu der Zeit hießen alle Alexander, als gäbe es keine anderen Vornamen.
Alexander war aus einer guten Familie. Seine Mutter war Chorleiterin, Dirigentin eines Kinderchors. Sie war klug und schön und ganz und gar durchdrungen von Klängen.
Der Vater war General in der Reserve, arbeitete im Verkehrsministerium. Er arbeitete nachts, kam erst gegen Morgen nach Hause. Zu der Zeit arbeiteten alle nach dem verrückten Zeitplan Stalins, diesem ›Vater aller Nationen‹.
Die Familie war gut, aber für den Sohn Alexander blieb wenig Zeit. Die Eltern hatten ernsthafte Erwachsenenaufgaben zu erfüllen. Das Kind wuchs auf der Straße auf.
Auf der Straße erhielt Alexander seine Hauptausbildung: Er lernte, was Beziehungen bedeuteten, lernte Rang und Alter zu respektieren. Er lernte Gitarre zu spielen und Trinklieder zu singen. Er lernte sich zu prügeln, in sich die Bereitschaft zum Kampf zu wecken. Stehlen lernte er nicht, er schaffte es nicht. Und er wuchs heran.
Der Vater schlug ihm leicht auf den Rücken: Mach mir bloß keinen Unsinn. Alexander straffte den Rücken, wodurch sich der Hintern anspannte und er den Bauch rausstreckte. Dafür war der Hals lang und gerade wie ein Stiel und der Kopf schaute stolz. Und der Blick veränderte sich. Alexander sah jetzt aus wie ein Hahn, der seinen Hühnerhof betrachtet. Vielleicht sah er aber auch wie ein junger Adler aus, der von oben über unermessliche Weiten schaut.
Alexander vergötterte seine Eltern. Vor allem seine Mutter. Niemand hatte eine so schöne und so verständnisvolle Mutter.
Eines Tages wurde Alexander krank. Seine Mutter war auf Tournee. Dass ihr Sohn hohes Fieber hatte, erfuhr sie erst abends.
Die Tournee führte gerade durch irgendein Dorf in der Pampa, ›wo nicht mal ein Vogel hinfliegt, kein Tier hinkriecht‹, wie man sagt. Es gab nichts, womit man zum nächsten Bahnhof hätte fahren können. Also ging seine Mutter zu Fuß. Sie marschierte die ganze Nacht hindurch und den ganzen Morgen. Sie gelangte zum nächsten Bahnhof. Dann fuhr sie mit dem Zug. Vierundzwanzig Stunden später tauchte sie zu Hause auf, staubbedeckt, wie ein Soldat, der aus dem Krieg heimkehrt.
Alexander hatte sich die ganze Nacht herumgewälzt, schwamm durch irgendwelche Trugbilder. In einem dieser Fieberträume sah er seine Mutter. Da sagte er nur ein Wort: »Mama …« Und er schlief sofort ruhig ein.
In diesem Moment begann er, wieder gesund zu werden.
Die Verbindung zwischen Mutter und Sohn war fest und unzertrennlich. Alexander tat alles, was seine Mutter ihm riet, denn sie wusste am besten von allen, was er brauchte.
Die Mutter hieß Margarita, abgekürzt Margo. So war sie für alle Margo und weiter nichts. Der Name passte gut zu ihr. Margo – das hatte etwas Kapriziöses, nicht Greifbares, voller Charme und Macht. Die Königin Margo.
Mit dem Alter wurde sie grauhaarig, aber sie färbte ihr Haar nicht. Wozu auch … Das Grau stand ihr. Die grauen Haare waren halb und halb mit schwarzen gemischt – Salz und Pfeffer –, das war viel schöner als nur schwarz.
Alexander hatte von seiner Mutter die Augen und Wangen geerbt. Und den unerklärlichen Zauber. Er war nicht schön. Aber er war bezaubernd. Etwas lugte aus ihm hervor, etwas, das es sonst bei keinem anderen gab. Der stolze Blick, der gerade Rücken, die Bereitschaft, sich zu schlagen, und gleichzeitig eine gewisse Schüchternheit. Er hatte etwas von einem Gassenjungen und gleichzeitig etwas Aristokratisches. Und Margo hatte ständig Angst um ihn.
Nach dem Abitur schickte Margo Alexander ins Architektur-Institut. Er zeichnete gut. Aber das Land brauchte keine Architekten. Wieso? Damals blühte der Stalin-Zuckerbäckerstil. Hoch, höher, am höchsten. Und stabile achtstöckige Wohngebäude. Was brauchte man mehr?