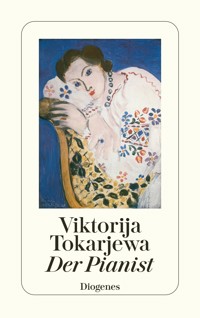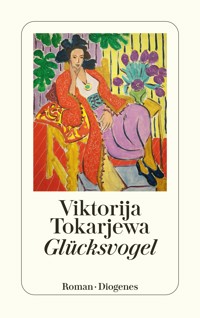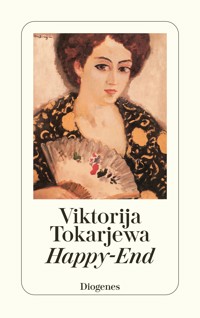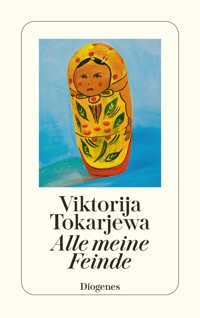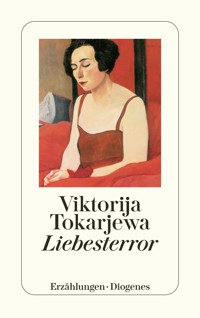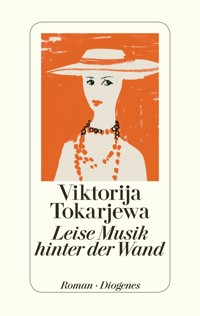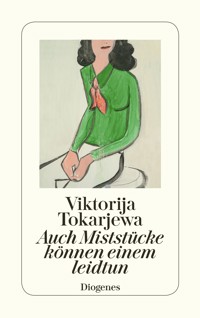8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
›Sag ich's oder sag ich's nicht?‹ lautet die bange Frage, die sich durch das Leben einer jungen Frau zieht wie ein roter Faden. Als reife Frau hält sie Rückschau auf alle Gelegenheiten, die sie durch ihr langes Abwägen verpaßt hat. Als sich eine letzte Gelegenheit bietet, wagt sie schließlich den Sprung ins Ungewisse. ›Je suis, tu es, il est‹ ist die Geschichte einer alleinerziehenden Mutter, deren ganzer Lebensinhalt ihr Sohn ist. Eines Tages bringt der Sohn ein junges Mädchen mit nach Hause. Die Mutter findet die junge Frau unsympathisch und wartet, daß ›der Besuch‹ wieder geht. Da teilt der Sohn ihr mit, daß das Mädchen seit ein paar Tagen seine Ehefrau ist. ›Pascha und Pawluscha‹ heißen zwei Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Pascha, der Introvertierte, ist Lehrer in einer Sonderschule und geht in der Sorge um ›seine‹ behinderten Kinder auf. Pawluscha, der Sunnyboy, interessiert sich vor allem für Autos und wie man sie gewinnbringend weiterverkaufen kann. Trotzdem verbindet die beiden eine lange Freundschaft – bis Pawluscha eines Sommers auf der Krim dem Freund die Freundin ausspannt…
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Viktorija Tokarjewa
Sag ich's oder sag ich's nicht?
Aus dem Russischen von Angelika Schneider, Monika Tantzscher und Elsbeth Wolffheim
Diogenes
Was brauchen wir fremde Leute
Der Ballerina Antipowa passierten zwei Dinge: erstens, man schickte sie in Pension. Zweitens, ihr Ehemann verließ sie.
Im Endeffekt hieß das: sie war eine Strohwitwe auf dem Altenteil. Siebenunddreißig – das ist das Pensionsalter für eine Ballerina. Aber was ist schon siebenunddreißig für einen heutigen Menschen? Nichts. Die Grundsteinlegung. Das Fundament eines Hauses, das gebaut wird. Dann kommt die erste Etage, dann die zweite, dann die dritte – bis hin zur fünfzehnten. Und nun soll das plötzlich alles gewesen sein. Schluß mit der Bauerei. Sie war abgeschrieben. Und unweigerlich zog sie Bilanz. Was hatte sie nicht alles für den Beruf geopfert: essen durfte sie nichts – ständig war sie unterernährt. Kinder waren unerwünscht – sie blieb für immer kinderlos. Nichts durfte sie. Eine unterernährte Waise. Ihr Mann war zu einer anderen gegangen, die alles durfte – Kinder haben und Makkaroni essen vorm Schlafengehen.
Nachdem diese beiden Ereignisse in ihr Leben getreten waren, dachte die Antipowa über ihre weiteren Perspektiven nach.
Erste Variante: Sie könnte sich aufhängen, was das einfachste wäre. Sie bräuchte nur eine Wäscheleine zu kaufen und ein Stück Kernseife. Damit würde sie sich an der Gesellschaft rächen, dafür, daß sie ausrangiert worden war. Der Haken an der Wand würde es aushalten. Die Antipowa war leicht, fünfzig Kilo, bei einer Größe von einem Meter siebzig.
Zweite Variante: Die äußeren Umstände ändern; ans Meer fahren beispielsweise. Das Baltikum ist genausogut wie das Ausland: die kleinen Häuser, Inschriften in einer fremden Sprache, die Sauberkeit, die zurückhaltende Art. Es wäre für die Antipowa wie eine Reise nach Finnland.
Im Sommer war es im Baltikum überlaufen, die nördliche Sonne soll angeblich gesünder sein als die südliche. Aber in diesem Sommer waren die Strände leer, das Meer war nicht zum Baden freigegeben. Im Meer schwamm irgendein bösartiger Virus, über den man in den Zeitungen geschrieben hatte. Die Antipowa hegte den Verdacht, daß dieser Virus schon siebzig Jahre lang im Meer herumschwamm. Nur hatte man früher nichts über ihn gesagt; aber jetzt war Glasnost, und man konnte darüber schreiben. Also schrieb man darüber.
Die Antipowa ging jeden Tag ans Meer und schwamm lange in Richtung Horizont. Dann schwamm sie genauso lang zurück an den Strand und begann sich mit einem Handtuch abzutrocknen. Das Handtuch hatte sie in Palermo, zu ihren besten Zeiten, gekauft. In den Zeiten, als sie noch tanzte, auf Tournee ging und von ihrem Mann geliebt wurde; und nicht nur von dem. Vielen Männern war sie im Corps de Ballet aufgefallen; sie konnten die Augen nicht von ihrem durch den Raum schwebenden Rücken abwenden. Der bezauberndste Teil ihres Körpers war ihr Rücken. Ihr Mann hatte gesagt: Zu so einem Rücken braucht es kein Gesicht mehr. Aber die Antipowa hatte auch ein Gesicht. Und ein Herz. Und eine naive vertrauensvolle Seele. Aber niemand brauchte sie. Sie war aufs Altenteil abgeschoben worden. Heute hatte sie weder Mann noch Bühne noch Zuschauerraum hinter sich. Hinter ihrem Rücken war bloß ein einsamer Komponist. Der Komponist und die Antipowa machten im selben Erholungsheim Urlaub, aber sie nahmen keinerlei Notiz voneinander. Der Komponist lief immer im Konvoi mit seiner dicken Ehefrau herum. Und die Antipowa existierte im Trio: sie und ihre zwei Ereignisse.
Aber zu dieser frühen Stunde, als die Sonne sich noch nicht bis zur Mitte des Himmels emporgearbeitet hatte, das Meer sanft seufzte und der böse Virus seine Hauptaufgabe vergaß und mit den Fischen spielte, in diesem Moment ging eine ›Femina‹ an den Strand.
Keine Frau, sondern eine ›Femina‹, denn eine einfache sowjetische Frau hat keinen solchen Rücken. Der Komponist wurde unruhig. Der Grund seiner Beunruhigung war ihm zunächst unklar. So nervös rennen Hunde vor einem Erdbeben hin und her.
Aber plötzlich erkannte er den Grund seiner Unruhe: die Schönheit. Dieser Rücken war Teil einer Weltharmonie, wie eine geniale Melodie. Und mit Melodien kannte sich der Komponist aus. Er war ein ausgezeichneter Melodienarrangeur. Nur in der letzten Zeit war irgend etwas geschehen. Er komponierte nach wie vor, und es kam auch etwas dabei heraus. Aber seine neuen Melodien ähnelten seinen früheren wie ein Apfel einer Attrappe. Genau dasselbe und doch nicht dasselbe: Äußerlich ähnlich, aber essen konnte man ihn nicht. Er arbeitete mit dem Handwerk und nicht mit dem Herzen. Noch vor ganz kurzer Zeit – gestern, wie es schien – war er schlank, jung und arm gewesen. Das Leben war direkt auf seinen entblößten Nerven gelegen, es hatte ihn in die Luft emporgewirbelt, und er hatte die bewußten Melodien geschrieben, die Generäle und Alkoholiker sangen, das Volk genau wie die herrschende Oberschicht. Aber jetzt war er dick und starr geworden, seine Nerven waren wie von einer Isolierschicht umhüllt. Und seine Melodien waren wie Attrappen.
Der Komponist verstand nicht: War es eine Krise, oder war es das Ende. Er sprach mit niemandem über seine Zweifel, aber er dachte ständig daran. Er war in einem Zustand, in dem sich Menschen befinden, die im Wartezimmer eines Onkologen sitzen: ›Ja‹ oder ›nein‹. ›Leben‹ oder ›Tod‹. Und sogar jetzt, während er am Meeresufer stand, dachte er daran, bevor er sich von dem Rücken ablenken ließ. Der Rücken tauchte vom Meeresgrund auf wie ein Rettungssymbol. Bekanntlich retten ja die Frauen und die Schönheit die Welt.
Die Antipowa warf sich unterdessen ihren Frotteebademantel über und ging an ihm vorbei, als sei nichts gewesen. Als hätte sie mit ihrem Rücken nicht das geringste zu tun.
»Guten Morgen«, grüßte der Komponist. Er klammerte sich an diese Worte und war bemüht, sie mit seinem Gruß irgendwie aufzuhalten. »Wie geht’s?«
Sie hätte jetzt ehrlich bekennen können ›besch … eiden‹. Sie hätte sagen können: »Schlecht.« Aber was ändert das schon. Die Antipowa antwortete:
»Danke.« Sie bedankte sich für die Aufmerksamkeit.
»In welcher Beziehung stehen Sie zu Kasanzew?« fragte der Komponist unvermittelt.
Kasanzew war ein General der Musiker, er beherrschte die ganze moderne Musikszene des Landes.
»In gar keiner«, sagte die Antipowa. Sie tanzte zur Musik von Tschaikowski und Bizet. Über die herrschte Kasanzew nicht.
»Also in guter Beziehung?«
Der Komponist dachte: Keine Beziehungen sind keine schlechten Beziehungen. Und keine schlechten Beziehungen sind gute Beziehungen.
»Worum geht es denn?« fragte die Antipowa erstaunt.
»Er kommt heute zu uns zu Besuch. Mit seiner Frau. Um sechs Uhr. Kommen Sie doch auch.«
»Und wozu?« wunderte sich die Antipowa.
»Wir sitzen ein Weilchen beisammen. Trinken ein bißchen Cognac.«
Von dem ›bißchen Cognac‹ hätte sie den ganzen nächsten Tag lang Kopfschmerzen. Der Tag wäre im Eimer. Für zwei Stunden des zweifelhaften Vergnügens, einen Abend mit zwei Ehepaaren zu verbringen, ginge ihr ein ganzer Urlaubstag verloren. Die Antipowa hatte eine Gesetzmäßigkeit herausgefunden: Für alles muß man bezahlen. Für den Rausch mit dem Kater, für die gute Figur mit Kinderlosigkeit, für das Ballerinendasein mit dem frühen Ausrangiertsein. Und es war noch fraglich, ob der Preis, den man zahlte, nicht zu hoch war, ob man nicht vielleicht sogar übers Ohr gehauen würde.
»Ich hole sie ab«, versprach der Komponist. »Welche Zimmernummer haben Sie?«
»Sechzehn«, antwortete die Antipowa, halb in die Luft.
Sie wollte nicht durch ihr Wort, durch eine Erwartung gebunden sein. Ihre Seele lechzte nach Freiheit und Stille, wie bei Lermontow. Auf ihrem Nachttisch neben dem Bett lag Nikolaj Gogol, den sie seit der Schulzeit nicht mehr gelesen hatte. Es wäre gut, die ganze Klassik noch einmal zu lesen. Wann soll man denn lesen, wenn nicht als Pensionärin?
Die Antipowa konstatierte still für sich, daß sie nicht zu diesem unnötigen Besuch gehen würde. Aber um fünf Uhr, eine Stunde vor dem Ereignis, überlegte sie es sich plötzlich anders. Sie wollte etwas, noch etwas mehr als Einsamkeit, Bücher und das Meer. Sie wollte sich schminken und das gewagte rückenfreie Kleid, mit der Schleife um die Taille, anziehen. Sie wollte wo hingehen – egal wohin –, mit jemandem beisammensitzen – egal mit wem –, ein bißchen was trinken, sich treiben lassen und leere Reden hören. Es war unwichtig, wer redete und über was geredet wurde. Wichtig war, daß sie nicht allein war und daß das Leben weiterging. Das war doch besser, als sich aufzuhängen oder zum zweitausendsten Male die erlittenen Kränkungen wieder in sich aufzukochen, deren Geschmack an beißende Seife erinnerte.
Die Antipowa ging zum Spiegel. Der Meerwind hatte ihr Gesicht über den Backenknochen gestrafft, die Sonne ihren Teint vergoldet. Sie sah aus wie siebenundzwanzig, und wenn man nicht wußte, daß sie schon pensioniert war, wäre einem so was nie in den Sinn gekommen. Hauptsache, nichts erklären. Nur die, die sich schuldig fühlen, geben Erklärungen ab. Und woran war sie schuld? Daß sie siebenunddreißig war? Es würde noch dicker kommen. Sie würde fünfzig werden. Und sechzig. Na und? Das Alter sind die Früchte des Lebens.
Die Antipowa schaute sich im Spiegel an, und stellte sich vor, wie die Ehemänner innerlich zusammenbrechen würden und die Ehefrauen ächzen würden. In diesem Moment klopfte es.
Die Antipowa riß die Tür abrupt sperrangelweit auf und stand in solch furchteinflößender Schönheit vor ihm, daß der Komponist zurückprallte, als hätte man ihn mit Autoscheinwerfern angestrahlt.
Darum zog er die Stirn in Falten und sagte:
»Wissen Sie, es wird leider nichts daraus … Sie sind mit ihrer ganzen Clique gekommen …«
»Ja, und?« sagte die Antipowa. Sie verstand nicht.
Der Komponist schwieg gequält.
»Nicht genug Platz zum Hinsetzen?« sagte die Antipowa ihm schließlich vor.
»Ja, ja, genau … Nicht genug Platz zum Setzen«, sagte der Komponist plötzlich wieder lebhaft.
Das hieß also, man ließ die Antipowa nicht herein, weil alle Sitzplätze belegt waren, wie im Flugzeug. Aber sie begriff sehr wohl: Darum ging es nicht. Freie Plätze gab es bestimmt. Zur Not kann man sich auch auf ein Fensterbrett oder auf den Boden setzen. Dann wäre es zwar eng, aber niemand wäre deshalb beleidigt. Die Sache lag anders: Kasanzew war mit seiner Frau gekommen. Und zwar ohne Clique. Der Komponist hatte freudig verkündet: ›Ich hab noch unsere Nachbarin eingeladen. Eine Ballerina. Eine sehr nette Frau.‹
›Ach, wissen Sie was, lassen Sie uns doch unter uns bleiben‹, hatte dann Kasanzews Frau gebeten, eine Dame im zweiten Stadium der Herzverfettung. ›Wir sind die vielen Menschen so leid. Was, zum Teufel, brauchen wir fremde Leute?‹
Kasanzew hatte geschwiegen, und dieses Schweigen war wie eine Resolution: ›Weg mit ihr.‹
Der Komponist hatte sich getrollt wie ein schuldbewußter Hund und stand jetzt da und log. Überhaupt war der Komponist ein komischer Kauz, wenn auch ein hübscher. Die Energie des Talents ging wie in heißen Wellen von seinem Gesicht aus. Aber jetzt, im gegebenen Moment, strahlte er nur Demütigung aus, wie ein schuldbewußter Hund. Und genau wie einem Hund hätte sie ihm gern einen Fußtritt verpaßt.
Die Antipowa schloß die Tür und grenzte sich so von der Lüge ab.
›Mistkerle‹, dachte sie. ›Diese Bourgeois …‹
Wenn sie noch in Amt und Würden gewesen wäre oder ihr Ehemann hinter ihr gestanden hätte, hätte man nicht gewagt, so mit ihr umzugehen. Sie kam sich vor wie eine Kiste, die man auf den Müll geworfen hatte, ungeachtet ihrer schönen, grellbunten Etiketten.
Die Antipowa wußte nicht, was sie jetzt mit ihrem schönen Kleid und ihrem gut geschminkten Gesicht anfangen sollte. Dann trug sie das Ganze in den Speisesaal des Erholungsheims. Es war schon fast Abendessenszeit.
Im Speisesaal drängten sich viele Augenpaare ihr entgegen, es flogen verschieden geladene Teilchen durch den Raum. Wie Staubteilchen schwebten sie in der Luft, Strahlen mit Neidpartikeln, mit Entzückenspartikeln, Strahlen voller Begehren, neutraler Neugier, Neugier mit positivem Vorzeichen und Neugier mit einem Fragezeichen. Die Antipowa fühlte sie auf ihrer Haut wie Spritzer einer Kreislaufdusche, die belebt und anregt. Sie war eine Ballerina und daran gewöhnt zu bezaubern.
Das Essen war wie immer. Zu Gast bei dem Komponisten hätte es bestimmt etwas Besseres gegeben.
Die Antipowa ging aus dem Speisesaal und sah den Komponisten sofort. Anscheinend hatte er sie abgepaßt. Vielleicht hatte er inzwischen im Nachbarzimmer noch einen Stuhl ergattert und für sie einen Sitzplatz organisiert. Und jetzt war er hinuntergegangen und wartete auf sie. Aber der Komponist stand nur da und schaute sie mit ungewöhnlichem Gesichtsausdruck an.
»Na? Haben Sie ein bißchen Cognac getrunken?« fragte die Antipowa leichthin.
»Tja …, der Schluck ist mir im Halse steckengeblieben«, bekannte der Komponist. »Aber wer konnte auch ahnen, daß sie ihre ganze Clique mitbringen würden …«
Also war er noch mal gekommen, um ihr zu sagen, daß für sie kein Platz an der Ehrentafel war.
»Jetzt hören Sie doch auf zu lügen«, sagte die Antipowa ruhig. »Es gab überhaupt keine Clique.«
Die Augen des Komponisten öffneten sich in mystischem Schrecken, als hätte er ein Gespenst gesehen.
»Soll ich Ihnen sagen, wie es war?« schlug die Antipowa vor. »Kasanzew kam mit seiner Frau. Zu zweit. Und sagte: ›Wir wollen ganz unter uns bleiben. Was, zum Teufel, brauchen wir fremde Leute.‹«
»›Was, zum Teufel, brauchen wir fremde Leute‹ hat er nicht gesagt. Nur ›wir wollen ganz unter uns bleiben‹.«
Sie schwiegen einen Moment. Die Antipowa schluckte zum dritten Mal die Demütigung.
»Was hätte ich machen können?« fragte der Komponist.
»Mich nicht einladen. Oder auf der Einladung bestehen – sofern sie ein Mann sind, versteht sich.«
Der Komponist verstand, daß sie recht hatte, aber er wollte Mitgefühl, Vergebung, wie ein dummer Junge. Oder besser gesagt, wie ein gealterter dummer Junge.
»Sie sind eine grausame Frau«, kokettierte er vorwurfsvoll.
»Wieso soll ich Sie bedauern?«
Die Antipowa ließ den Komponisten wie einen Gegenstand stehen und fuhr mit dem Aufzug zu ihrer Etage hinauf.
Neben dem Aufzug stand die Frau des Komponisten, in einer weißen festlichen Bluse mit großem rundem Kragen. Ihr Hals war kurz, fast fehlte er ganz, und ihr Kopf lag auf dem Kragen, wie eine Melone auf einem Teller. Sie stürzte sich sofort auf die Antipowa und sah ihr naiv in die Augen; sie schien geradezu durch die Pupillen in die Antipowa hineinfließen zu wollen.
»Ach, was für nette Leute doch diese Kasanzews sind. So einfach. Was für eine Familie … So was gibt es heutzutage ja fast gar nicht mehr. Rundherum läßt sich alles scheiden, jeder läßt jeden im Stich, nichts ist mehr heilig. Wie vor dem Weltuntergang. Aber die Kasanzews …«
Die Frau des Komponisten runzelte die Stirn, als täten ihr die Wohltäter Kasanzew eine süße Qual an.
»Es hat ihnen bei uns so gefallen. Wissen Sie, ich nehme von zu Hause immer eine Blumenvase mit und Servietten. Ich decke den Tisch festlich, stelle hier und da was Hübsches hin – das sieht doch gleich ganz anders aus …«
Die Antipowa hörte geduldig zu, und ihr wurde klar: Es ging nicht um Servietten und Vasen. Die Sache war die, daß die Macht zu Besuch gekommen war. Sie war gekommen und hatte gesagt: ›Wir sind auf eurer Seite und ihr auf unserer.‹ Sie hatten sich die Hände gereicht und sich zu einem freundschaftlichen Reigen zusammengeschlossen. Sie, die Antipowa, gehörte nicht dazu. Aber wozu mußten sie ihr das die ganze Zeit unter die Nase reiben?
»Gute Nacht«, verabschiedete sich die Antipowa und ging auf ihr Zimmer. Sie schloß von innen ab. Fehlte bloß noch, daß jetzt der angetrunkene Kasanzew erscheinen würde, und ihr sagte, daß sie sie, zum Teufel noch mal, nicht bräuchten.
Nur eins war merkwürdig: Wieso saßen sie nicht bei Tisch, Schulter an Schulter, tranken Cognac und sangen die frühen Lieder des Komponisten? Wieso rannten sie statt dessen auf dem Flur umher und lauerten der Antipowa an allen Ecken auf?
Sie waren gar nicht gekommen … dämmerte es der Antipowa. Sie begriff das intuitiv. Das geht tiefer als jedes Faktenwissen. Sie waren überhaupt nicht gekommen. Die Macht hatte sich danebenbenommen. Die Macht hatte gesagt: ›Wir kommen auch ohne euch aus. Was, zum Teufel, brauchen wir fremde Leute.‹ Und jetzt befürchteten der Komponist und seine Frau, daß das durchsickern könnte, daß es allgemein bekannt würde. Alle würden wissen, daß es mit dem Komponisten zu Ende ginge, daß er nicht in einer Krise steckte, sondern wirklich am Ende war. Es gab ihn nicht mehr. Er hatte existiert, und jetzt gab es ihn nicht mehr. Er konnte in Pension gehen. In den verdienten Ruhestand treten.
Die Antipowa erinnerte sich an die zudringliche ›Aufrichtigkeit‹ der Frau des Komponisten. An was für einem Abgrund mußte man stehen, um sich so vor einer völlig fremden Ex-Ballerina aufzuführen. Sie wurden von der Angst gequält: »Was wird jetzt?« Die Antipowa kannte diese Angst. Von ihr stehen einem die Haare zu Berge. Sie hatte plötzlich Lust, in die Bar hinunterzugehen, eine Flasche Wodka zu kaufen und zu dem Komponisten und seiner Frau zu sagen: »Kommt, laßt uns was trinken! Sitzen wir ein bißchen beisammen, ganz unter uns, ohne fremde Leute.«
Und wirklich: Was hat denn ein Künstler mit der Macht zu tun? Selbst wenn dieser Kasanzew ein höchst anständiger Familienvater war. Die Antipowa erinnerte sich an sein Gesicht, das einmal über die Mattscheibe geflimmert war. Kasanzew hatte ein Doppelkinn. Aber das war nicht von Fett ausgefüllt, sondern hing herunter – ein leerer Hautsack, wie bei einem Truthahn. Und wenn Kasanzew temperamentvoll seine Reden herausbrüllte, wackelte sein Gesicht, die Haare flogen hin und her, und der Hautsack schlenkerte nach allen Seiten.
Der Erfolg hält die Menschen zusammen, nicht die Niederlagen. Die Niederlagen treiben die Menschen in die Isolation. Den Kasanzews stand der Sinn nicht nach Besuch. Die Macht wackelte unter ihren Füßen, wie die Erde bei einem Erdbeben. Man weiß nicht, von woher etwas auf einen fallen und einen zermalmen kann. Der Mensch kann sich seine Epoche nicht aussuchen, die Epoche sucht sich den Menschen aus. Was kann man dafür, daß man in seiner Epoche gelebt hat und so gelebt hat wie alle anderen?
Das Jahr 1989 kränkte Kasanzew. Kasanzew kränkte den Komponisten. Und der Komponist wiederum die Antipowa. Gut, daß diese Kette bei ihr endete. Sie hatte niemanden, den sie hätte kränken können.
Draußen vor dem Fenster atmete das Meer. Die Antipowa stellte sich vor, daß das Meer ein gigantischer Suppenteller voller Kummer war. Jeder steht mit seiner Kelle davor, löffelt und schluckt. Niemand schiebt den anderen weg. Der Platz reicht für alle. Und auch der Kummer reicht für alle. Der Suppenteller ist groß. An der Seite, wo Schweden liegt, stehen die Schweden. An der Seite von Finnland die Finnen. Und an unserer Seite stehen wir. Die Antipowa und die Kasanzews. Und niemand ist dem anderen fremd.
Die Antipowa nahm ihre Jacke und ging an den Strand. Was war schon passiert? Sie hatte doch sowieso nicht zu ihnen zu Besuch gehen wollen, und sie war nicht gegangen. Wie hatte alles angefangen? Ein Komponist hatte sie eingeladen. Warum hatte er sie eingeladen? Er hatte sie am Strand gesehen. Er hatte ihren Rücken gesehen. Sie hatte einen schönen Rücken. Und einen leichten Schritt.
Die Antipowa ging zum Wasser und hob das Bein nach der Seite im rechten Winkel an. Es klappte wunderbar. Sie stieß sich mit dem Fuß in der Luft ab und drehte sich langsam um ihre eigene Achse. Eine große, schwere Möwe flog ans Ufer und schaute die Antipowa erstaunt an.
Weit draußen auf dem Meer schwamm ein Schiff auf dem tiefen Wasser, und der Kapitän betrachtete durch das Fernrohr den Strand und die sich lautlos bewegende Ballerina.
Die Sonne ging unter, sie verabschiedete sich von dieser Seite der Erde, vom Meer und dem Kummer, von den Vögeln und den Menschen, von einem gelebten Tag. Ein abstraktes Gemälde stand am Himmel – ganz in rosa- und himbeerrot. Es war so schön, es herrschte eine so erfüllte Stille, wie es immer vor einem Abschied ist.
Deutsch von Angelika Schneider
Pascha und Pawluscha
Pascha war glatzköpfig, sein Kopf glich einer Melone. Doch Schönheit ist für einen Mann allenfalls in Spanien von Bedeutung, in mittleren Breiten schätzt man andere Eigenschaften. Diese anderen waren bei Pascha nicht zu übersehen, schon auf den ersten Blick wurde einem klar, daß man einen guten Menschen vor sich hatte.
Heutzutage sagt man oft: Ein guter Mensch ist noch lange kein Beruf. Außerdem ist die Auffassung verbreitet, ›gut‹ sei im Grunde nur ein Synonym für mittelmäßig, unscheinbar, denn erst die Widersprüche seien es, die eine komplizierte Persönlichkeit ausmachen, in der schwindelerregende Höhen mit Abgründen vermengt sein müssen, alle möglichen Höhen mit allen möglichen Tiefen. Bei Pascha fanden sich weder Tiefen noch Abgründe. Er hatte ein Pädagogikstudium an der ›Defak‹, einer Hochschule für Behinderten-Pädagogik absolviert. Da es behinderte Kinder nun mal gibt, muß es für sie auch Schulen und Pädagogen geben.
Das Gehalt der dort Beschäftigten war höher als in den Normalschulen. Zwanzig Prozent Zuschlag. Doch Pascha arbeitete nicht wegen der Vergünstigungen in der Hilfsschule. Er liebte diese Kinder, fühlte eine innere Verwandtschaft zu ihnen. Unverfälscht, naturnah wie Tierchen, drückten sie offen ihre Gefühle aus. Sie traten an Pascha heran, streichelten seine Hand, sein Gesicht und sagten: »Du bist gut.« Was sie dachten, sagten sie auch. Ihre Vertrauensseligkeit war grenzenlos, es kam ihnen gar nicht in den Sinn, daß man sie kränken oder hintergehen könne. Wenn man sie dennoch verletzte und betrog, reagierten sie stürmisch, protestierten mit Schreien und Tränen. Doch sie vergaßen sehr rasch. Ihre Gefühlsregulierung funktionierte irgendwie nicht. Eben noch in Tränen aufgelöst, hatten sie im nächsten Augenblick schon alles vergessen, nur eine Träne haftete noch an der Wange.
Pascha brachte ihnen die simpelsten Dinge bei: etwa wie man eine Kopeke von einem Knopf unterscheidet, wozu die Kopeke und wozu der Knopf da ist und wie man sie im Leben gebraucht. Er brachte es fertig, Kinder, die als schwergeschädigt galten, als vollkommen angepaßte Menschen ins Leben einzugliedern. Die Jungen dienten sogar in der Armee, die Mädchen arbeiteten in der Textilindustrie. Eine von ihnen, Walja Tjurina, mauserte sich zu einer stillen, fleißigen Bestarbeiterin. Man wollte sie sogar zur Abgeordneten machen, doch nach der Durchsicht ihrer Papiere ließ man davon ab.
Pascha holte das Letzte aus den Kindern heraus. Überließ nichts sich selbst. Anders ging es nicht. In einer Normalschule genügt es, den Kindern einen Anstoß zu geben, so wie man eine Maschine ankurbelt, damit sie läuft. Bei diesen Schülern dagegen würde auf diese Art gar nichts laufen. Ihr inneres Schwungrad würde stehenbleiben.
Als Pascha im Jahre siebzig seine Tätigkeit aufgenommen hatte, gab es in der Einrichtung ganze fünfzehn Schüler, doch schon zehn Jahre später waren es hundert. Der Prozentsatz an kranken Kindern wuchs. Dafür gab es mehrere Gründe: schlechtes Erbgut, alte Väter, vor allem aber der Alkoholismus. Solche ›Schnapskinder‹, wie man sie nannte, wuchsen heran, heirateten und setzten ihrerseits behinderte Sprößlinge in die Welt. In der Schule lernten bereits die Kinder dieser Kinder. Die zweite Generation.
Pascha war mit seinen Schülern verwachsen und schaltete sie niemals völlig aus seinem Bewußtsein aus. Was auch immer in seinem Leben ablief – Theaterbesuche, Tischrunden, Rendezvous –, sie waren gegenwärtig. Nicht daß er unverwandt an sie dachte – sie waren in ihm. Wie ein schlecht schließendes Fenster im Haus: ständig entweicht die Luft, es zieht. Eben daran lag es wohl auch, daß Pascha nie lauthals lachte, niemals aus dem vollen schöpfte. Es war, als ob er sich von der Tafel des Lebens immer nur ein Bröckchen nimmt, es eine Weile hält, daran schnuppert und es zurücklegt. Kein Appetit.
Pascha lebte in einer Gemeinschaftswohnung im Stadtzentrum. Seine Mutter hatte sie von ihrem Betrieb erhalten, noch vor dem Kriege. Sie bestand aus einem einzigen, allerdings riesigen Zimmer, achtundvierzig Quadratmeter maß es und hatte drei Fenster – heutzutage hätte man eine Dreizimmerwohnung daraus gemacht. Einst hatten sie zu viert darin gewohnt: der Vater, die Mutter, die ältere Schwester und Pascha. Als Junge war er mit dem Fahrrad um den Tisch herum gekurvt. Dann war die Schwester herangewachsen, sie heiratete und erwarb eine Genossenschaftswohnung in Jasenewo. Die Mutter starb. Sie war lange bettlägerig gewesen, hatte schon nicht mehr leben wollen, als dann aber ihre Stunde kam, stellte sich heraus, daß sie sehr am Leben hing. Den Vater hatte die Schwester zu sich genommen, und so war Pascha in dem großen, öden Zimmer allein geblieben. Die Wohnung lag in der obersten Etage, das Dach war undicht, an der Decke prangte ständig ein großer, unschöner Fleck.
Die Mitbewohner wechselten ein paarmal. Von den alten blieb nur die Kraschenaja, mit der die Mutter nicht gut zurechtgekommen war. Die Kraschenaja war um die achtzig und Pascha um die vierzig. Die Zeit verfliegt.
Pascha war unverheiratet. Ihm gefielen schöne, kecke Mädchen, doch denen gefielen andere Männer. Diese anderen wohnten in keiner Gemeinschaftswohnung, arbeiteten nicht in einer Hilfsschule und waren auch sonst das genaue Gegenteil von Pascha, dem Seelsorger dahindämmernder Seelen. Den schönen und selbstbewußten Mädchen gefielen solche wie Pawluscha.
Pascha und Pawluscha waren seit der sechsten Klasse miteinander befreundet, seit ihrem dreizehnten Lebensjahr, beide hießen Pawel, und um sie nicht zu verwechseln, rief man den einen Pascha und den anderen Pawluscha. Dabei blieb es dann auch später. Pawluscha war ein schönes Kind, dann ein schöner Bursche und schließlich ein schöner Mann. Er hatte schwarzes, wirres Haar wie ein Sizilianer, leuchtend blaue Augen und kurze, wie abgesägte Zähne. Im allgemeinen sind solche Zähne nicht schön. Bei Pawluscha aber wirkte dieser Makel vorteilhaft, weil er seiner Erscheinung einen Schimmer Kindlichkeit verlieh. Man sah ihm alles nach. Was konnte man schon von ihm verlangen? Ein großes Kind.
Sie waren ein Herz und eine Seele. Pascha hatte das, was Pawluscha nicht hatte, und umgekehrt. Sie ergänzten einander wie die Süße und die Säure in einem Antonowapfel. Zwar bewarben sie sich nach der Schulzeit gemeinsam am Pädagogischen Institut, doch aus ganz verschiedenen Gründen. Pascha wollte wirklich Pädagoge werden, Pawluscha dagegen liebte Kinder nicht, er nannte sie ›Kroppzeug‹. Nicht daß er sie überhaupt nicht ausstehen konnte, es mochte sie ruhig geben, nur stören sollten sie ihn nicht. Die eigenen Kinder beachtete er kaum, fremde demnach noch weniger und geistig Zurückgebliebene schon gar nicht. Er brauchte einfach ein Diplom, das ihm Hochschulbildung bescheinigte, später war es dann egal, ob er Kürschner oder auch Aufzugsführer wurde. Es ist etwas ganz anderes, Fahrstuhlführer mit Hochschulbildung zu sein, als einfach Fahrstuhlführer. Ein Liftboy mit Bildung gilt als Rebell, ein einfacher Liftboy dagegen als Ausgesonderter wie etwa ein Rentner oder Hilfsschulabsolvent.
Nach dem Studium ging Pawluscha zum Autoservice. Er werkelte gern an Motoren und liebte außerdem das Geld. Nicht an sich, sondern das, was man dafür einheimsen konnte: schöne Kleidung, Technik, Frauen, Geselligkeit. Pawluscha genoß den Umgang mit angesehenen, prominenten Leuten, mit Komponisten, Kosmonauten. Sie umgab so etwas wie ein Dunstschleier der Exklusivität, in ihrer Nähe geriet auch er in diesen Bannkreis, der Hauch des Besonderen streifte sein Gesicht mit belebender Frische. Selbstredend gab er mit seinen Bekannten an und nannte sie sowohl in deren Anwesenheit als auch in deren Abwesenheit ›Aljoscha‹ und ›Kescha‹. Besagte Aljoschas und Keschas pflegten ihrerseits zwar Umgang mit Pawluscha, taten dies aber nur auf dem Territorium des Autoservice. Außerhalb dieses Bereiches funktionierte diese Freundschaft nicht. Nicht weil Pawluscha ihnen nicht paßte, sondern einfach darum, weil wirkliche Freundschaften sich in einem bestimmten Alter herausbilden, in den Schul- und Studentenjahren. Danach verhärtet sich etwas im Menschen, wird unnachgiebig. Neue Bindungen kommen nur noch selten und nur sehr mühsam zustande. Es ist wie im Antiquariat: Nur das weit Zurückliegende wird geschätzt.
Pawluscha hatte die Figur eines Modellathleten.
›Sport, Busineß und Sex‹ lautet die Lebensdevise des Durchschnittsamerikaners. Pawluscha bekannte sich zu diesen Prinzipien in allen Punkten. Zwischen achtzehn und sechsunddreißig wechselte er die Frauen dreimal – jeweils nach sechs Jahren. Er hatte seine Theorie, die die Praxis zu bestätigen schien: die Liebe reicht für höchstens sechs Jahre, dann versiegt sie wie das Wasser in einem Bewässerungsgraben. Die Moslems hatten dieses Spezifikum erkannt, und nach ihren Gesetzen kann sich der Mann nach sechs Jahren eine neue Frau kaufen, wobei er die vorige, genannt ›Erstfrau‹, bei sich behält. Neben der Liebe existiert ja auch noch der Alltag, und es wäre gemein, sich der nicht mehr geliebten Gefährtin zu entledigen wie eines abgetragenen Schuhs. Pawluscha indes erfüllte nur einen Teil des muselmanischen Brauchs: er wechselte die Frauen, während er die verflossenen der Willkür des Schicksals aussetzte. Sie wiederum verfluchten ihn, beschworen die schlimmsten Verwünschungen auf sein lockiges Haupt. Doch diese prallten daran ab wie ein Tennisball an einer Wand. Pawluscha genoß seine neue Liebe, an die vergangene verschwendete er keinen Gedanken.
Im Autoservice arbeitete er sich hoch und leitete schließlich eine ›Firma‹, wie er die unansehnliche Bude nannte, gelegen in einer gottverlassenen Gegend an der Stadtausfahrt. Die Aljoschas und Keschas aber ließen ihn nicht im Stich, es waren ihrer sogar mehr geworden, als ihm lieb war. Er bewirtete sie in seinem Büro mit Kaffee und teurem Cognac, erlaubte ihnen, in seinem Sessel zu sitzen, sein Telefon zu benutzen. Geld nahm er von ihnen nicht an. Als Geschäftsmann liebte er die Künstler. Indem er ihnen zeitraubende Wege ersparte, sie vor Streß und Ausgaben bewahrte, diente er der hohen Kunst und fühlte sich demzufolge auch selbst ein wenig als Künstler.
Seine Frauen gebaren ihm je ein Kind. Er hatte drei gesunde, hübsche Sprößlinge, fünf, zehn und fünfzehn Jahre alt. Seinem Freund Pascha hatte er nicht nur die Frauen, die Kinder und das Glück voraus; sein größtes Glück bestand darin, daß seine Mutter Taissija Leonidowna, kurz Tassja genannt, noch lebte.
Vor dem Krieg und auch noch in der Nachkriegszeit war sie eine schöne, katzenhafte Frau gewesen – mit dreieckigem Lärvchen und großen Luchsaugen. Sie wurde von ihrem Mann und allen, die sie umgaben, vergöttert, und so war es kein Wunder, daß sie auch die entsprechenden Allüren annahm. Als ihre Schönheit dahinschwand und von Vergötterung keine Rede mehr war, blieben nur noch ihre Allüren.
Pawluschas Vater starb ziemlich früh, mit sechzig, und das hätte nicht passieren müssen. Er erlitt nachts einen Infarkt, wagte es aber nicht, seine Frau zu wecken, sie zu ›behelligen‹. Er nahm sich vor, bis zum Morgen durchzuhalten, schaffte es aber nicht. Tassja wurde von seinem Röcheln wach, sah, daß er in den letzten Zügen lag, und schrie auf: »Häschen, wo willst du hin …?«
›Häschen‹ drohte ihr mit dem Finger, als wollte er sagen: Leise, du weckst die Nachbarn … Er war ein selten taktvoller Mensch.
Als ihr ›Häschen‹ nicht mehr war, saß Tassja auf dem trockenen. Sie hatte nichts Eigenes vorzuweisen – ein Leben lang war sie eine professionelle Schönheit gewesen. Die Enkel wuchsen fern von ihr auf, es gab nichts, was sie vom Alter ablenken konnte. Nur Pawluscha war ihr geblieben, und er wurde ihr ein und alles. Ihre unverbrauchten Kräfte konzentrierte sie auf den Sohn und verlangte von ihm das gleiche zurück. Pawluscha nannte das ›Terror aus Liebe‹. Über jeden Schritt mußte er Rechenschaft ablegen, durfte keine heimlichen Freunde haben, keine eigenen Gedanken. Seine jeweiligen Frauen passierten Tassjas rauhen, vielschichtigen Prüffilter und fielen letzten Endes allesamt durch. In ihren Augen hätte nur eine Frau Gnade gefunden, die ihr Sohn nicht geliebt hätte. In diesem Fall hätte seine ganze Liebe ihr, Tassja, gehört. Sie wollte ihn ungeteilt besitzen und ihn gleichzeitig glücklich sehen, wollte das Unvereinbare miteinander vereinbaren.
Seine erste Scheidung verlief qualvoll für ihn, er zog sich gar eine neurotisch bedingte Hautkrankheit zu. Die zweite Scheidung war schon leichter und die dritte geradezu ein Kinderspiel. Was sich allzuoft wiederholt, wird zur Gewohnheit. Pawluscha entschied für sich, nie mehr zu heiraten, da er so etwas wie eine Gesetzmäßigkeit entdeckt zu haben glaubte: Einem Flugzeug gleich gewinnt die Liebe an Höhe, zieht dort, vom Autopiloten gelenkt, eine Zeitlang seine Bahn, doch dann, unmerklich zunächst, gibt es den ersten Defekt – der Aeroplan der Liebe verliert an Höhe, kommt ins Trudeln … Dann Explosion, Feuer, ausgebrannte Seelen.
Mit sechsunddreißig waren Pascha und Pawluscha also mithin Junggesellen. Paschas Boden war bereitet – fruchtbar harrte er des Saatkorns, Pawluschas Herz dagegen glich einem verbrannten, öden Feld, übersät mit Erinnerungsbruchstücken, Alimenten, flüchtigen Bekanntschaften … Die Mutter alterte, trocknete an Seele und Körper aus, nur ihre Liebe zum Sohn blieb lebendig und immergrün.
Doch zurück zu Pascha.
Wenden wir uns ihm an einem gewöhnlichen sonnigen Junitag zu. Sein Freund Pawluscha saß an diesem Tag in Sotschi in einem Hotel mit dem schönen Namen ›Kamelie‹. Über Sommer hielt er sich gern am Meer auf – überall im ganzen Land hatte er seine Beziehungen. Während Pawluscha also die See genoß, geriet sich Pascha gerade mit der Schuldirektorin Alewtina Warfolomejewna Panasjuk in die Wolle. Die Lehrer nannten sie Panasjutschka. Alewtina erzählte gern, ihr Vater sei Franzose gewesen, er habe Bartolomé geheißen; Warfolomej sei die russische Version dieses Namens. Pascha glaubte nicht so recht daran, er bezweifelte sogar, daß der Gute jemals von der Existenz einer solchen Nation auf Erden gehört hatte.
Alewtina hatte breite, zobelfellähnliche Brauen, und wie ein Zobel hielt sie mit wachsamem, lauerndem Blick Ausschau nach Beute. Auch in Pascha hätte sie sich gern gekrallt, sie streckte sogar schon ihre Pfötchen nach ihm aus, er aber war auf der Hut und ließ sich nicht schnappen, worauf sie so tat, als wäre nichts gewesen, als hätte er sich all dies nur eingebildet. Alewtina war selbstgefällig und nicht eben dumm. Überhaupt hätte Pascha sich mit dieser Direktorin zufrieden gegeben, hätte sie nicht die lästige Angewohnheit gehabt, dauernd privaten Dingen nachzujagen, die nichts mit der Schule zu tun hatten. Fortwährend organisierte sie irgend etwas für ihre Familie und ihre Freunde, rief ihretwegen an, verabredete sich, verschwand. Die Kinder, die ihr von der Gesellschaft anvertraut waren, kamen nicht selten in ein Haus ohne Hausherrn, und wären Pascha und einige seiner Kollegen nicht gewesen, wäre dort rundum schon alles mit Kletten und Unkraut überwuchert wie in einem vernachlässigten Garten. Die Schule wurde von Kindern mit Elternhaus, aber auch von Heimkindern besucht. Früher waren die einen nach dem Unterricht ins elterliche Haus zurückgekehrt, die anderen in die staatliche Einrichtung, einst Waisenhaus genannt. In einem waren sie sich gleich: Sie kamen und gingen wieder. In letzter Zeit aber hatte das Kinderheim seine Zöglinge vollkommen in die Schule umquartiert, die ein Hilfsschulinternat wurde. Jetzt wurden sie in der ersten Tageshälfte in der einen Abteilung unterrichtet und wechselten dann in die andere über. Dort standen ihre Betten, befand sich ihr Speisesaal. Nun verließen sie die Schule weder an Feiertagen noch in den Ferien. Der Unterschied zwischen den Haus- und Heimkindern trat kraß zutage. Ungerechtigkeit und Leid wurden offenbar, die Kinder spürten es selbst durch die Scheidewand ihres verringerten Intellekts hindurch.
Pascha forderte von der Panasjutschka, die frühere Ordnung wieder herzustellen. Diese erklärte, sie habe die neue nicht eingeführt und es sei nicht ihre Sache, sie zu ändern. Dabei wählte sie eine Telefonnummer und erbat von irgendeinem Wolodja fünfzig Büchsen Rindfleisch. Die Datschasaison hatte begonnen.
Pascha hatte es sich zur Regel gemacht, Neujahr zusammen mit den Internatskindern zu feiern. Lange vorher begannen sie im Werkunterricht, Tannenbaumschmuck zu basteln, mit dem sie dann das Bäumchen behängten. So verging die Zeit rasch und in freudiger Stimmung.
An dem Tag, von dem die Rede ist, hatte die Panasjutschka in der dritten Klasse den Literaturunterricht abgesetzt und die Kinder hinausgescheucht, um das Gelände zu säubern.
Als Pascha seinen Unterricht antreten wollte, fand er die Kinder im Hof vor. Sie trugen gerade alles mögliche Gerümpel auf einen Haufen zusammen.
Pascha schaute zur Panasjutschka herein und fragte, warum sie den Literaturunterricht abgesetzt habe. Die Panasjutschka gab zur Antwort, daß der Lesestoff die Kinder ohnehin nicht zu geistig vollwertigen Menschen mache, mochten sie also lieber frische Luft schöpfen. Pascha bemerkte daraufhin, daß es hier nicht um die Kinder ginge, sondern um die Lehrkräfte. Die seien Gott sei Dank nicht geschädigt und müßten ihre Arbeit in Übereinstimmung mit dem Lehrplan, ihren Pflichten und ihrem Berufsethos verrichten. Die Panasjutschka hörte ihn aufmerksam an und entgegnete, eine derartige Haarspalterei und demagogische Krittelei sei typisch für Rentner, die über zuviel Freizeit verfügen. Wäre Pascha ein General, das heißt, besäße er die Lebensphilosophie eines Generals, würde er Kleinigkeiten dieser Art nicht eine solche Bedeutung beimessen. Übrigens hatte auch Alewtina einen ›inneren General‹ in Gestalt ihrer Tochter, einem hübschen, unverschämten Ding.
Alewtina setzte also ihren Monolog fort und wählte dabei eine Telefonnummer. Pascha wartete nicht erst ab, bis der Angerufene sich meldete und sie ihre Bitten äußerte. Er machte kehrt und verließ das Arbeitszimmer türknallend, wobei er in diesen Knall all seinen Protest gegen das ›Panasjutschkentum‹ legte. Alewtina war die offenkundige Schluderei nicht nur nicht peinlich, sie trumpfte sogar noch auf, so wie manche Trinker damit auftrumpfen, wieviel sie inhaliert haben. Bereitwillig verbreiten sie sich darüber, was sie alles geschluckt haben und mit wem sie sich obendrein auch noch gerauft haben. Was im Grunde beschämen müßte und besser verschwiegen würde, wird als großer Lebensstil gepriesen. Und nachher werden die ›Schnapskinder‹ geboren. Das ›Panasjutschkentum‹ ist vielgestaltig …
Pascha schlug die Tür so heftig zu, daß an der Decke ein Stück Putz von der Größe eines Suppentellers abplatzte und herausbrach. Nun verunzierte ein unregelmäßiger Kreis die Decke, und der zerbröckelte Stuck lag auf dem Tisch der Panasjutschka. Sie fegte ihn mit dem Taschentuch herunter, bis keine Spur mehr blieb.
Pawel verließ die Schule und schlug eine unbestimmte Richtung ein. Er hätte zu seiner Schwester nach Jasenewo fahren können, doch die würde ihn ausfragen, und er müßte von der Panasjutschka und dem Panasjutschkentum erzählen und gleichsam von neuem in diese Jauche tauchen.
Wie gut, wenn man jetzt zu Pawluscha gehen könnte. Bei dem war alles einfach, dem mußte man nichts erzählen. Pawluscha würde eine Videokassette einlegen, Tassja würde ihm ein gediegenes, ausgewogenes Mittagsmahl vorsetzen … Doch Pawluscha weilte in der ›Kamelie‹ unter südlicher Sonne. Blieb nur, in die Apotheke zu gehen und sich Beruhigungspillen zu besorgen. Sie würden den Ärger und die Aufregung ausschalten. Einen Sinn hätten sie aber nur, wenn sie das Schlechte an sich ausschalten und das Erfreuliche lassen würden. Da sie aber zusammen mit der Aufregung auch die gute Stimmung bremsten, empfand man das Dasein nur noch gedämpft wie durch eine Mauer. Hinter ihr lief das Leben ab, und man selbst existierte nebenher.
Wenn einem das Herz schwer ist, muß man es mit geistigen Vitaminen stärken. Man muß sich dem Schönen öffnen und auf diese Weise ein Übergewicht des Guten gegenüber dem Bösen schaffen.
Pascha begab sich auf eine Ausstellung moderner, zeitgenössischer Maler. Während er von Bild zu Bild schritt, dachte er: Wieviel talentierte Leute es doch gibt auf unserem Erdball … Seltsam, wie weit die Auffassung verbreitet ist, daß Großes in der Kunst entweder stets Vergangenheit ist oder Zukunft sein wird. Dabei wird auch das Heute einmal gewesen sein – vom Standpunkt der Nachkommen aus, so wie es aus dem Blickwinkel der Vorfahren das Zukünftige war. Wer weiß, vielleicht hing hier etwas an den Wänden, was man dereinst klassisch nennen wird …
Pascha gefielen einfache Sujets, in denen alles verständlich ist. Er liebte das Schlichte. Alles Komplizierte erschien ihm als etwas nicht zu Ende Gedachtes. Das bezog sich auf Bilder, Bücher und auf das Leben. Oft mußte er sich anhören, daß das Leben kompliziert sei. Komplikationen aber entstehen bei denen, die lügen und sich verheddern. Oder bei denen, die darauf aus sind, auf fremde Kosten zu reisen. Sobald sie spüren, daß man sie nicht mitnehmen, daß man sie also abschütteln will, wird das Leben kompliziert, mitunter auch unerträglich. Bei der Panasjutschka ist alles kompliziert, weil sie eins gegen das andere eintauscht: die Arbeit gegen eine Scheintätigkeit, die Liebe gegen Scheinliebe. Bei Pawluschas Mutter lag die Kompliziertheit im Alter und der Einsamkeit. Bevor man alt wird, müßte man beizeiten überlegen, wie man es bewerkstelligt, sich nicht an die Füße der Angehörigen zu klammern und sie zu sich herabzuziehen. Man müßte einen Platz für sich finden, an dem man gebraucht wird und niemanden behindert.
Pawluschas Kompliziertheit war Folge seiner Unersättlichkeit in allen Dingen. Alles fiel ihm zu: Geld, Frauen, Sonne und Meer, so daß er es nicht fertigbrachte, »genug« zu sagen. Setzt man dem nicht rechtzeitig ein Stoppzeichen entgegen, läuft man Gefahr, sich zu überfressen, und das ist ebenso qualvoll wie das Hungern. Hungern ist sogar nützlicher …
Pascha ging von Bild zu Bild, schaute, dachte nach. Jeder Künstler hatte seinen ›General‹. Bei dem einen sind die Liebe, die Schönheit und die Frau die Erlöser der Welt. Beim anderen der Glaube an die Unsterblichkeit des Geistes. Vom Kopf aus läßt der Maler Lichtsäulen gen Himmel steigen. Der Mensch wird als Teil des Kosmos gesehen. Ein dritter Künstler plagt sich mit der Suche nach dem Sinn des Lebens. Auf dem Bild steht ein Haus mit einer Unzahl von Fenstern. Diese stellen Spielkarten dar, demnach ist das Leben ein Spiel. Im Hintergrund des Hauses ist ein großer Primuskocher zu sehen. Das Dasein als Verbrennungsprozeß oder als Experiment. Leben heißt auf kleiner Flamme schmoren … Es lohnte sich, darüber nachzudenken. Pascha wollte sich gerade konzentrieren, doch in diesem Augenblick sah er sie. Sie