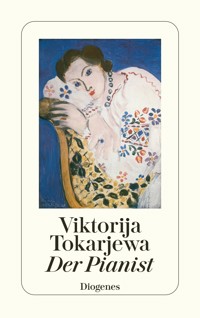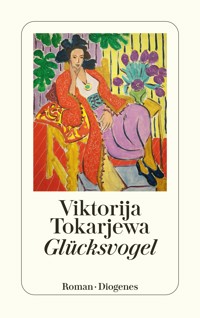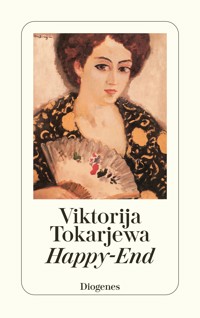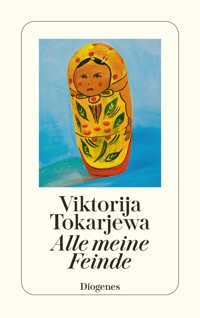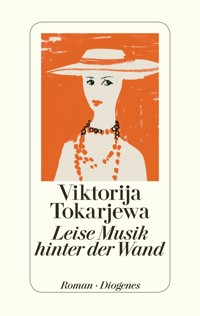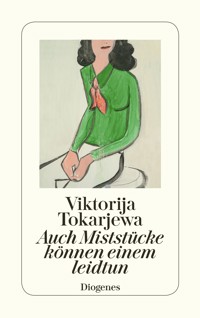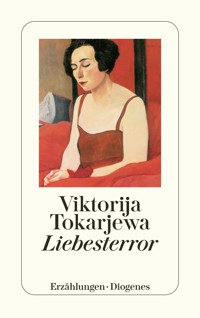
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Vier Geschichten über die Liebe in verschiedenster Form: die Mutterliebe, die durchaus nicht immer uneigennützig ist; die Nächstenliebe, durch die eine Notlage in einen Glücksfall verwandelt werden kann; die körperliche Liebe, die auch selbstlos sein kann, und die romantische Liebe, die sehr wohl ganz realistisch enden kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 233
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Viktorija Tokarjewa
Liebesterror
Roman
Aus dem Russischen von Angelika Schneider
Diogenes
Liebesterror
Wir treiben uns im Hof herum und spielen Ball. Meine Schwester Lenka – erdverbunden und robust wie ein Hocker, im goldgelben Sarafan-Kleid, mit goldgelben Haaren. Sie läuft schnell, windet sich geschickt heraus, schlägt treffsicher zu. Ein äußerst wertvolles Mitglied unserer Mannschaft.
Ich selbst habe blauschwarze Haare, schmale Augen, sehe aus wie eine kleine Chinesin. Ich kann jeden x-beliebigen Feind besiegen, aber nur unter einer Bedingung: Alle müssen es sehen. Ich brauche den Ruhm. Ein Sieg nur für mich allein – das interessiert mich nicht. Die Sucht nach Ruhm ist in meinem inneren Computer schon einprogrammiert.
Die Dritte im Bunde ist Nonna, die Tochter von Tante Tossja. Wir wohnen alle in derselben Gemeinschaftswohnung, spielen auf demselben Hof. Nonna unterscheidet sich von allen anderen Kindern: In ihre Zöpfchen sind kleine Glasperlen eingeflochten, sie trägt ein kompliziert geschnittenes Kleidchen mit Spitzenbesätzen. Wie ein Souvenir-Püppchen sieht sie aus, wunderhübsch und zierlichelegant, und außerdem hat sie viel Phantasie. Nonna versteht es, die Bewegungen des Gegners vorauszuahnen. Sie hat die unabdingbaren Voraussetzungen für den Sieg.
Wir rennen herum, ins Spiel vertieft. Meine Mannschaft ist schon am Siegen, es fehlt nur noch eine winzige Kleinigkeit, und dann …
In den Fenstern erscheinen fast gleichzeitig die Gesichter unserer Mütter.
»Nonna! Mittagessen!« ruft Tante Tossja.
»Mädchen, heimkommen!« ruft unsere Mutter.
Tante Tossjas Gesicht ist bleich und langgezogen wie eine Gurke. Das Gesicht unserer Mutter ist rot und rund wie eine Tomate. Alle beide sind sie um die dreißig, schön und männerlos.
Unser Vater ist im Krieg gefallen, und Nonnas starb nach dem Krieg an einer schweren Verletzung. Nicht am Alter werden wir sterben, sondern an unseren alten Wunden … Diese Zeilen von Semjon Gudzenko habe ich erst viel später gelesen. Aber damals … Damals lautete der immer wiederkehrende Standardsatz meiner Mutter: »Ich bin Witwe mit zwei kleinen Kindern.« Und das war sie ja auch.
Aber jetzt wollen wir nicht heim. Wir sind mitten im Spiel. Doch mit unserer Mutter ist schlecht Kirschen essen. Sie schlägt uns mit der flachen Hand. Diese Hand ist meist wie ein Brett.
Mit hängenden Köpfen trotten wir nach Hause und setzen uns an den Tisch.
Mama hat uns Kartoffelpüree gemacht, mit Frikadellen. Vor fast einem halben Jahrhundert gegessen, erinnere ich mich noch immer ganz genau an diese goldbraune knusprige, fettglänzende Frikadelle mit dem Geruch von frisch gemahlenem Pfeffer. Wie oft in meinem späteren Leben habe ich versucht, diese Frikadellen so hinzubekommen wie meine Mutter, doch vergebens. Genau wie alle möglichen Maler immer wieder vergeblich versucht haben, die Sixtinische Madonna zu kopieren.
Ich glaube, daß meine Mutter eine Frau mit Talent war. Denn Talent kann sich in allen möglichen Dingen ausdrücken, sogar in der Art, Frikadellen zuzubereiten.
Meine Mutter arbeitete für ein Schneideratelier als Stikkerin und bestickte die Taschen von Kinderkleidern. Das hatte ihr niemand beigebracht. Diese Begabung sprudelte einfach so hervor. Meine Mutter nahm die Arbeit mit nach Hause, und an einem Tag bestickte sie drei Taschen. Eine kleine Erdbeere mit Blättchen, einen weißen Pilz mit dikkem Stamm und ›das Mosaik‹. ›Das Mosaik‹ waren bunte Dreiecke und Quadrate, ganz willkürlich zusammengefügt. Wenn man sie lange ansah, kam es einem vor, als ob sie sich bewegten und sich schließlich drehten wie ein Kaleidoskop.
Jede Tasche bedeutete einen Entwurf und seine Ausführung. Ein schöpferischer Prozeß. Der Lohn für dieses Schaffen war nicht hoch. Für jede Tasche zahlte man meiner Mutter einen Rubel. Und immer wenn meine Mutter etwas in einem Geschäft kaufte, so rechnete sie den Preis in Gedanken in bestickte Taschen um. Ein Kilo Wurst beispielsweise – zwei Taschen. Fast einen ganzen Tag Arbeit.
Eines Tages, meine Schwester und ich waren schon junge Mädchen von fünfzehn und achtzehn, kamen wir vom Theater heim. Wir hatten ein Taxi genommen, und meine Mutter sah uns aussteigen. Diese Taxifahrt bedeutete zwei Tage Arbeit, neunzehn Stunden ununterbrochener Arbeit. Meine Mutter konnte eine solche Geldverschwendung nicht ausstehen, konnte aber nichts mehr machen, da wir schon am Aussteigen waren. Wir hatten kaum gezahlt, da öffnete sie das Fenster sperrangelweit und schrie wie in einem italienischen Film quer über den Hof: »Da schaut sie euch an! Die Millionärinnen sind da!«
Natürlich starrten uns alle an, und meine Schwester und ich standen auf dem Hof und kamen uns vor wie in der heißen Bratpfanne.
Und außerdem wußten wir, daß wir jetzt eins auf den Kopf oder auf den Mund kriegen würden, was ganz besonders wehtat, weil ihre Hand, wie gesagt, wie ein Brett war.
Aber das war später. Damals waren wir noch kleine Mädchen von sechs und acht Jahren im Leningrad der Nachkriegsjahre. Wir aßen unsere Frikadellen auf, und unsere Gedanken waren noch auf dem Hof: Ein Schlag mit dem Schlagholz, der Ball fliegt, Lenka rennt, Nonna in Habachtstellung …
Manchmal spielten wir auf Nonnas Initiative hin Theater.
Wir wählten ein Stück aus, lernten die Rollen auswendig und gaben eine Vorstellung. Ein Wandschirm diente uns als Kulisse. Was hinter dem Schirm war, war die Garderobe, was davor war, war die Bühne.
Unsere Mütter und die Nachbarn setzten sich auf die Stühle, schauten uns wohlwollend zu und applaudierten.
Die Eintrittskarten mußten übrigens bezahlt werden, zwanzig Kopeken das Stück. Ich weiß noch, wie ich die Bühne betrat, meinen Text sprach und mich in den Strahlen des Ruhmes sonnte. Der Ruhm war nicht sehr groß – das Publikum bestand aus sieben schlecht angezogenen Leuten –, aber die Ruhmesstrahlen waren doch echt. Ich erinnere mich genau an diesen Zustand: Da stand ich vor allen und ganz zuvorderst, alle schauten auf mich und lasen mir jedes Wort von den Lippen ab. Ich war die Erste!
Woher kam nur dieser Wunsch, sich hervorzutun? Wahrscheinlich hatte es etwas mit der Überwindung der Todesangst zu tun, mit dem Selbsterhaltungstrieb: Um jeden Preis die Beste zu sein und dadurch zu überleben. ›Nein! Ganz sterbe ich nicht …‹ Anders ist es doch kaum zu erklären, daß alle die Besten sein wollen. Als ob das im Endeffekt nicht völlig gleichgültig wäre …
Das Stück war in vollem Gange. Unsere Mütter verdrückten eine Träne. Ihre Mädchen taten ihnen leid, diese Halbwaisen, die ohne Väter aufwuchsen. Und sie taten sich selbst leid, sie, die den Launen des Schicksals ganz allein ausgeliefert waren. Ihre Männer waren wer weiß wo, denen war es egal. Aber die Mütter rackerten und plackten sich ab, mußten einen Tag nach dem anderen überstehen.
Unsere Ernährung war nicht gerade abwechslungsreich, aber wir mußten nicht hungern. Wir wuchsen ohne Väter auf, aber wir fühlten uns nicht als Halbwaisen. Unsere Mütter hatten keine Ahnung von Pädagogik, aber sie liebten uns von ganzem Herzen. Und wir liebten sie. Ob wir Kinder glücklich waren – ich weiß es nicht. Aber unglücklich waren wir ganz sicher nicht.
Doch unsere Mütter …
Mein Vater war irgendwo weit weg gefallen. Es hieß: ›Er ist den Heldentod gestorben.‹ Ob das ein besonderer, ein angenehmer Tod war …
Der Bruder meines Vaters, unser Onkel, schrieb meiner Mutter damals eine Karte mit der traurigen Nachricht: Dort sah man einen schwarzen Baum mit abgerissenen Zweigen und ein einsames, leeres Boot, das am Baum angelehnt ist. Darunter stand: ›Das Boot der Liebe ist zerschellt, o Leben!‹ … Meine Mutter betrachtete die Karte und weinte. Der Baum mit den abgerissenen Zweigen, das war das Leben meines Vaters, das so früh zu Ende gegangen war. Und das einsame Boot war sie. Das Leben hatte damit gar nichts zu tun. Das Boot der Liebe ist zerschellt, o Krieg!
Meine Mutter weinte, während sie auf die Karte sah. In dem Moment kam meine Schwester Lenka herein. Sie stand ein wenig herum, dann ging sie weg, wobei sie mit ihrer fast tonlosen Stimme sang, sie brummte wohl eher einen einzigen Ton.
Meine Mutter riß sich von der Karte los und sagte vorwurfsvoll: »Unser Papa ist gestorben – und du singst auch noch …«
Nachts wachte ich dann davon auf, daß Licht brannte. Mama und Lenka umarmten sich und weinten gemeinsam.
Das war zwei Jahre vorher gewesen, in der Evakuierung. Ich erinnere mich noch genau an die hölzerne Isba, in der wir gewohnt hatten, an das Geheul der Wölfe und an das Feuer, das im Ofen prasselte.
Onkel Pavel, Tante Tossjas Mann, kehrte aus dem Krieg heim, aber nach einer schweren Verwundung. Ihm war der Körperteil abgerissen worden, über den man sich schämte zu reden, und er konnte seine ehelichen Pflichten nicht mehr erfüllen.
Tante Tossja konnte sich mit der Lage der Dinge nicht abfinden: Witwe trotz lebendigen Ehemannes.
Sie machte Onkel Pavel einen Skandal nach dem anderen, als wenn er schuld an der Sache wäre. Und schließlich holte sie sich einen anderen Mann ins Haus, und Onkel Pavel und Nonna saßen dabei in der Küche. Onkel Pavel hatte die Zeitung vor den Augen, aber er las nicht darin.
Und dann fiel Onkel Pavel um. Wir rannten in die Apotheke, holten ein Sauerstoffkissen, aber es half nichts mehr. Er starb. Still starb er. Als ob er sich geschämt hätte, Aufsehen zu erregen.
Tante Tossja erkannte zu spät, was für ein guter Mensch er gewesen war, im Gegensatz zu ihren Verehrern, von denen es genug gab.
Onkel Pavel hatte seine Tochter Nonna mehr als sein Leben geliebt, hatte sie nicht nur geliebt, sondern geradezu vergöttert. Und das hatte ihn mit Tante Tossja verbunden. Für die Verehrer aber war Nonna ein leerer Fleck, wenn nicht noch weniger, denn sie störte.
Nach Onkel Pavels Tod ging Tante Tossja als Kranführerin arbeiten. Eines Tages sollte sie ein Dokument unterschreiben. Sie ging zum Kontor der Werkschefin. Das Kontor war ganz am Ende der Werkshalle – es war nur eine Umzäunung aus Sperrholz, über der Umzäunung war eine Glasfront, damit Licht in das Büro kam.
Tante Tossja klopfte an die Tür. Es wurde ihr nicht aufgemacht, obwohl sie genau spürte, daß hinter der Tür jemand war. Es gibt verschiedene Arten von Stille. Diese war von der Art, wie wenn sich jemand versteckt, eine angespannte Stille.
Tante Tossja klopfte nochmals. Sie lauschte mit angehaltenem Atem, aber offensichtlich hielt man auch drinnen den Atem an.
Tante Tossja zerrte einen Tisch zu der Sperrholzwand, und auf den Tisch stellte sie einen Stuhl, und kletterte hinauf wie auf eine Barrikade. Ihre Augen waren nun in Höhe des Glasteils. Dahinter passierte etwas völlig Unverständliches.
Tante Tossja schaute unerschrocken hin und zählte die Anzahl der Beine. Es waren vier, je zwei an einer Person. Aber es erschien Tante Tossja, als wären es viel mehr, so verworren war das alles, und in der Mitte von all dem – war ein nackter Hintern.
›Ein Arsch‹, stellte Tante Tossja fest und rief: »Sina!«
Ihre Ablösung, Sina, kam und fragte: »Was ist denn?«
»Dort ist ein Arsch.«
»Wessen Arsch?«
»Keine Ahnung …«
Sina kletterte auf den Tisch, stellte sich auf die Zehenspitzen. Ihre Größe reichte aus, daß sie bis an die Glasfront kam.
»Das ist Kolja«, identifizierte Sina.
»Kolja ist dünn, hat Tuberkulose, und der ist wohlgenährt …«, sagte Tante Tossja zweifelnd.
Um die Holzpaneele versammelten sich langsam Menschen. Das Volk rennt ja immer da hin, wo was los ist.
Später sagte die Werkschefin zu Tante Tossja: »Was bist du doch bloß für ein Luder, Tossja.«
»Wieso?« fragte Tante Tossja nur naiv.
»Du bist doch auch jung und ohne Ehemann, könntest ruhig ein bißchen mehr Mitgefühl haben.«
»Aber wieso auf der Arbeit? Habt ihr denn keinen anderen Ort?«
»Eben nicht.«
Tante Tossja dachte nach und sagte: »Ich hab doch nur die Wahrheit gesagt …«
Tante Tossjas Wahrheit war, daß sie ein Dokument hatte unterschreiben wollen und man ihr nicht aufgemacht hatte. Sie hatte ins Büro gesehen und einen Hintern erblickt. Das war die ganze Wahrheit. Und so war es ja auch tatsächlich, wieso es also nicht sagen? Begriffe wie Feinfühligkeit und Mitgefühl waren für sie einfache Dinge, die mit der Wahrheit nichts zu tun hatten.
Als sie von der Arbeit nach Hause kam, erzählte Tante Tossja die erschütternde Tatsache meiner Mutter.
Das Gespräch fand in der Küche der Gemeinschaftswohnung statt. Meine Mutter kochte ihre berühmte Perlmuttsuppe, die so hieß, weil sie mild und perlmuttfarben war. Die Suppen meiner Mutter waren nicht nur schmackhaft, sie waren außerdem auch schön.
»Und wenn du an ihrer Stelle gewesen wärst?« fragte meine Mutter, wobei sie die Suppe mit einem Löffel probierte.
»Mit diesem Kolja?« fragte Tante Tossja verwundert.
»Und deinen Namen würde man jetzt überall durch den Dreck ziehen?«
»Wär mir doch völlig egal!« rief Tante Tossja und spuckte der Anschaulichkeit halber aus. »Sollen doch alle reden, was sie wollen. Wegen mir würde ich mir keine Sorgen machen. Aber wegen Nonna –«
»Gib mir mal die Zwiebel«, unterbrach sie meine Mutter.
Tante Tossja holte aus dem Küchenschränkchen eine runde, goldgelbe Zwiebel hervor.
»Aber wegen Nonna –« setzte sie den unterbrochenen Gedanken fort.
»Gib mir mal den Pfeffer«, unterbrach sie meine Mutter erneut.
Für meine Mutter war die Suppe wichtig, und für Tante Tossja zählte nur die Liebe zu ihrer Tochter. Nonna – das war ihr Heiligtum.
»Aber wegen Nonna –« versuchte Tante Tossja es noch einmal.
»Gib mir mal das Salz«, unterbrach sie meine Mutter.
Da nahm Tante Tossja das Salzfaß und leerte es über Mutters Suppe aus. Meine Mutter erstarrte. Die Kinder warteten auf ihr Mittagessen. Was jetzt?
Meine Mutter krallte sich in die Haare ihrer besten Freundin. Tante Tossja verteidigte sich, so gut sie konnte. Die Nachbarin, Sofja Moisejewna tat so, als ob nichts wäre, sie hielt auf Neutralität. Sie wußte, daß diese zwei Schicksen sich schon eine Stunde später wieder versöhnt hätten und zusammen ein Glas Wein trinken würden.
Und so geschah es auch.
In unserer Wohnung trieben Ratten ihr Unwesen. Man versuchte sie auszusiedeln, aber die Ratten waren auch nicht dümmer als die Menschen.
Eines Tages geriet eine junge Ratte trotzdem in die Rattenfalle. Ich stand da und betrachtete sie. Die Schnauze war wie bei einem Eichhörnchen geformt, aber der Schwanz … Das Eichhörnchen hat einen festlichen, buschigen Schwanz von perfekter Form. Und die Ratte hat einen, der nackt und lang ist und eher Abscheu erregt.
Die Ratte in der Falle war nervös, denn sie erwartete von den Menschen nichts Gutes.
Und damit hatte sie recht.
Meine Mutter stellte die Rattenfalle in einen Eimer und goß immer mehr Wasser in den Eimer, wollte die Ratte so ertränken.
Bis heute verstehe ich nicht, wieso meine Mutter mich nicht vorher aus der Küche geschickt hat, um mir diesen Anblick zu ersparen. Es verging ein halbes Jahrhundert, und noch immer sehe ich diese winzigen, rosigen Pfötchen der Ratte vor mir. Sie schließen sich um die Gitterstäbe der Falle, um sich so hoch wie möglich zu ziehen, wie bei einem untergehenden Schiff …
Meine Mutter lebte, wie es gerade kam, ohne jeglichen Plan.
Das Leben spülte zwei Freier an ihre Ufer, die beide Jaschka hießen. Den einen nannten wir ›Jaschka, den Dicken‹, den anderen ›Jaschka, den Ausgehungerten‹.
Der Dicke führte ein Möbelgeschäft. Meine Mutter beschloß, die Situation zu nutzen und das Mobiliar unserer Wohnung zu erneuern. Jaschka half uns, aber bald stellte sich heraus, daß er nur zu seinem eigenen Nutzen geholfen hatte. Meine Mutter war fassungslos. Sie zuckte die Achseln. Betrügen – das war verständlich. Ein Geschäftsmann ist ein Geschäftsmann. Aber eine geliebte Frau betrügen, die schon fast seine Braut war, noch dazu, wo sie zwei Kinder hatte …
Jaschka, der Dicke schied damit aus.
Der andere Jaschka war fast krankhaft dünn. Aber sein Hauptnachteil war: Er hatte einen zehnjährigen Sohn. Ein fremder Junge, den meine Mutter nicht liebgewinnen konnte. Sie vermochte nur ihre eigenen Kinder zu lieben, und verheimlichte das auch nicht.
Der zweite Jaschka verlor sich mit der Zeit. Oder besser gesagt, meine Mutter liebte weder den einen noch den anderen. Ein echtes Gefühl empfand sie erst später. Das war bei Fjodor, dem Bruder von Tante Tossja, einem Kapitän in Kriegsuniform. Fjodor war jung, erst dreißig Jahre alt, groß, mit grünen Augen im braungebrannten Gesicht. Solche Männer waren damals in Mode. Man nannte sie ›Kriegsschätzchen‹. Eine stattliche Figur, gerader Rücken, Gallifetthosen, Epauletten auf der Jacke.
Jetzt sind ganz andere Männer in Mode, und ganz andere Accessoires gelten als Sexsymbol. Zum Beispiel ein Mercedes. Aber damals …
Die grünen Augen und die starken Arme machten meine Mutter verrückt. Ständig erklang im Hause das Grammophon, ein süßlicher Tenor säuselte: Es tut mir so unendlich leid, um deine unerfüllten Träume …
Abends verschwand meine Mutter regelmäßig, und meine Schwester und ich blieben allein zurück.
Eines Abends wollten wir uns schlafen legen. Da sahen wir plötzlich, wie sich unter der Bettdecke ein kleiner Hügel hin und her bewegte. Das mußte eine Ratte sein. Wie sollten wir uns ins Bett legen, wenn da eine Ratte war … Also warfen wir Bücher und Stühle aufs Bett, alles, was uns in die Hände geriet. Da bewegte sich der Hügel nicht mehr. Die Ratte wurde still. Entweder hatten wir sie betäubt oder gar umgebracht.
Da sahen wir aufs Bett und fingen leise an zu schluchzen. Wir fühlten uns schlecht durch das doppelte Böse: das Böse, das von der zudringlichen Ratte ausging, und das Böse, das wir selbst getan hatten.
Tante Tossja kam herein. Sie sah zwei unglückliche, weinende Kinder und begann uns zu trösten, zu umarmen und uns zum Lachen zu bringen. Sie brachte uns sogar Zwieback mit dicker, süßer Kondensmilch auf einem Tellerchen. Das finde ich auch heute noch ziemlich lecker. Aber damals erst … Wir vergaßen die Ratte und unsere ganze Angst.
Tante Tossja zog die Decke weg. Da kroch das arme, halb ohnmächtige Tierchen auf den Boden und verschwand plötzlich. Offensichtlich hatte die Ratte unter dem Bett im Boden ihr Nest, ihre Höhle mit ihren Kindern und einem Mann, genauso schön wie Onkel Fjodor.
Mutters Liebe hielt ein Jahr lang. Ein ganzes Jahr lang war sie fröhlich und glücklich. Und dann heiratete Fjodor. Er brachte seine junge, schon schwangere Frau zu Tante Tossja nach Hause, wollte sie allen vorstellen. Es war doch immerhin seine Verwandtschaft.
Tante Tossja deckte den Tisch und rief meine Mutter, der Himmel weiß, warum.
Alle setzten sich gemeinsam an den Tisch. Fjodor umarmte seine junge Frau vor allen Leuten und erklärte nebenbei, es sei doch besser, ein eigenes Kind zu haben als zwei fremde. Und alle stimmten zu, Tante Tossja lauter als alle anderen.
Meine Mutter saß da und ließ den Kopf hängen, als wenn sie schuldig wäre daran, daß sie zwei Kinder hatte und deshalb nicht zur Ehefrau dieses gutaussehenden Fjodor taugte.
Sie stand vom Tisch auf und ging in den Flur hinaus, auf den Treppenabsatz. Dort stand sie und weinte, die Stirn an die Wand gelehnt. Dieser miese Fjodor war ihr ans Herz gewachsen, man hatte ihn aus ihr herausgerissen, und unsichtbares Blut floß in Strömen.
Am nächsten Tag sagte meine Mutter zu Tante Tossja: »Was bist du bloß für ein Aas!«
»Ich bin doch seine Schwester«, entgegnete Tante Tossja ruhig.
Die Schwester ist immer auf der Seite des Bruders, und leibliche Neffen und Nichten sind besser als angenommene. Das war ihre Wahrheit. Und solche Kleinigkeiten wie Freundschaft und Mitgefühl waren für sie Feinheiten, die mit der Wahrheit nichts zu tun hatten.
Mit Tante Tossjas Privatleben klappte es übrigens auch nicht. Ein kurzes Glück endete mit einer geheimen Abtreibung. Abtreibung war damals verboten. Man machte sie zu Hause, im Schutz der Nacht.
Nonna verstellte sich, tat, als ob sie schliefe. Aber sie hörte alles: das metallische Klappern der Instrumente, die schweren Seufzer, das unterdrückte schmerzerfüllte Stöhnen …
Und irgendwo weit, weit weg mußte es ein ganz anderes Leben geben. Irgend jemand hatte seinen leiblichen Vater, eine Wohnung für eine Familie und Schokoladenkonfekt. Die konnten das Konfekt essen und an dem Einwickelpapier riechen. O wie gut allein diese Papierchen riechen mochten!
Im Jahre dreiundfünfzig starb Stalin. Wir wollten zu dritt nach Moskau fahren: Lenka, Nonna und ich. Wir wollten den großen Führer und Lehrer unseres Volkes auf seinem letzten Weg begleiten. Aber unsere Mutter mischte sich wie üblich ein. Wir bekamen alle eine heftige Ohrfeige. Sogar Nonna. Diese Ohrfeige entschied alles.
Wir fuhren nirgendwohin und beruhigten uns ziemlich schnell wieder. Tot ist tot. Und was jetzt, sollten wir deswegen etwa nicht leben?
Wir liefen zur Tram, fröhlich und leichtsinnig, wie Kinder eben sind. Die Menschen saßen an der Haltestelle und sahen uns schweigend und befremdet an. Eine bleischwere Stille lag in der Luft, als wenn das Leid nicht weit weg auf Stalins Datscha geschehen wäre, sondern bei jedem zu Hause. Der Tod des Führers wurde als persönliche Tragödie erlebt.
Nonna kicherte über irgendeinen Blödsinn, ich weiß sogar noch, welchen: Lenka hatte gepupst. Wir starben vor Lachen. Aber die Leute in der Tram sahen uns ohne Tadel an, eher mitleidig. Das ganze Land war mit einem Schlag ohne Führung, und wohin würden wir jetzt alle, in tiefer Nacht, treiben?
Die Zeit vergeht langsam im Kindesalter. Jeder einzelne Tag ist ein ganzes kleines Leben. Und es schien, daß wir nie erwachsen werden würden und unsere Mütter niemals älter würden. Alles würde immer so sein wie jetzt.
Ich lernte ohne sonderliches Vergnügen, aber ich erfüllte trotzdem alle schulischen Anforderungen. Was sein mußte, mußte eben sein. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man zur Schule kommen konnte, ohne seine Hausaufgaben gemacht zu haben.
Meine Schwester Lenka dagegen tat nur das, was ihr gefiel. Sie setzte sich zum Lernen hin, legte das Lehrbuch auf den Tisch – und unter dem Tisch legte sie sich ein Buch auf den Schoß, das sie interessierte. Sie konnte so dasitzen, ganz unbeweglich, drei, vier Stunden lang. Meine Mutter dachte, daß Lenka am Granit der Wissenschaft knabberte, aber in Wirklichkeit las sie Schwester Kerri. Das Ergebnis war eine Fünf im Vierteljahreszeugnis. Meine Mutter rannte in die Schule, und die Fünf wurde in eine Vier verwandelt. Man dachte, daß es bei Lenka noch nicht ›richtig gezündet hatte‹. Aber Lenka war nicht dümmer als andere. Sie hatte nur gelernt, ihre Probleme auf fremde Schultern abzuwälzen. Und das gelang ihr gut. Die Mutter rannte herum, die Lehrerin wedelte mit den Armen, allgemeiner Aufruhr. Und Lenka stand dabei mit verträumtem Gesichtsausdruck und wußte genau: Alles wird gutgehen. Man würde ihr gerade noch eine Vier verpassen und sie in die nächste Klasse versetzen, und ihr irgendwann das Abschlußzeugnis geben. Wofür sollte sie sich groß krummlegen, sich Zeug eintrichtern, das man nie wieder brauchen würde, in der Art von ›A-Quadrat plus B-Quadrat gleich C-Quadrat‹…
Nonna dagegen lernte glänzend. Tante Tossja triumphierte im geheimen. Manchmal murmelte sie still vor sich hin: ›Aus einer Kartoffel wächst eben keine Ananas‹ … das sollte wohl bedeuten, daß meine Mutter die Kartoffel war – und Tante Tossja die Ananas.
Die Rivalität zwischen meiner Mutter und Tante Tossja war verdeckt aber beständig da, wie ein latentes Fieber.
Es ging uns langsam besser, weil unsere Mutter sich noch mehr abrackerte. Sie arbeitete im Schneideratelier und nahm sich Arbeit nach Hause mit, dazu hatte sie noch private Aufträge. Wenn ich mich an sie erinnere, so sehe ich sie vor mir am Fenster sitzend, den Kopf gesenkt, mit deutlich sichtbarem ›Bärenhügel‹. Ihre Hand folgte der Nadel, oder besser gesagt, die Nadel folgte ihrer Hand.
Eines Morgens wachte ich um sechs Uhr auf, da saß meine Mutter schon am Fenster, und ihre Hand fuhr hin und her wie ein Weberschiffchen. So lebte sie ohne den Rücken aufzurichten, ohne den Kopf zu heben, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr …
Tante Tossja dagegen ging jeden Tag zu ihrer schlecht bezahlten Arbeit, dann kehrte sie nach Hause zurück und hatte frei. Sie bemühte sich nicht um eine andere Arbeitsstelle und auch nicht um ein Zubrot. Tante Tossja verfluchte dieses Leben, aber sie kämpfte nicht um ein anderes. Wie es kam, so kam es eben.
Und das Ergebnis blieb nicht aus. Wir waren satt, waren besser angezogen. Manchmal tätigte meine Mutter sogar Luxuseinkäufe: einen Fernseher zum Beispiel. Das juckte Tante Tossja. Sie tratschte über meine Mutter, nannte sie Kulakin und Ausbeuterin. Die Nachbarn sahen meine Mutter schräg an. Es gab einen kleinen Funken, und das Feuer eines großen Skandals brach aus. Ausgerissene Haare – die goldgelben meiner Mutter und die rotblonden von Tante Tossja – schwebten den Flur entlang.
Die Nachbarn mischten sich nicht ein. Sie wußten, daß ein Sommergewitter viel Lärm macht, aber am Abend die frisch gewaschene Sonne wieder herausschaut. Und die geläuterten Nachbarinnen würden später ein Glas Wein zusammen trinken. Und tatsächlich: Was hatten sie auch schon auseinanderzudividieren? Sie teilten das Schicksal aller Nachkriegsfrauen, und ihre Jugend ging dahin wie Rauch durch den Kamin.
Mit zwölf bekam ich einen Rheumaanfall und lag ein paar Monate lang im Krankenhaus. Dadurch lernte ich die Medizin lieben und träumte davon, Ärztin zu werden.
Lenka träumte von gar nichts. Sie lebte vor sich hin wie ein Hofhund. Obwohl, ein Hofhund hat auch ein Leitmotiv: die Liebe und Ergebenheit gegenüber seinem Herrchen. Also war Lenka doch kein Hund. Eher ein anderes Tier. Vielleicht ein Bär: ruhig und stark, mit einem langen Winterschlaf.
Nonna träumte nur von einem: Sie wollte Schauspielerin werden. Es lockte sie die Verwandlung, die Möglichkeit, in einem einzigen Leben doch viele Leben auszukosten; die elegante Kameliendame, die unschuldige Desdemona, die gewitzte Ljubow Jarowaja und so weiter – eine unendliche Reihe. In ihr entwickelte sich ein unglaubliches Talent, ganz im verborgenen, wie ein Kind sich im Mutterschoß entwickelt. Aber noch mehr träumte sie davon, ihre Lebensumgebung zu verändern. Sie wollte dahin, wo es Einzelwohnungen gab, edle Gefühle, höhere Gespräche. Es zog sie zu Ruhm, Liebe und Reichtum. Nun ja, wer will das nicht?
Nonna stellte ganz allein eine Theatergruppe auf die Beine. Dorthin fuhr sie mit der Tram und kam erst gegen Abend zurück. Ein Jüngling mit schwarzen Haaren, der unsterblich in sie verliebt war und Andrjuscha hieß, brachte sie nach Hause.
Ich erinnere mich noch an ein Bild, das in mein Gedächtnis wie eingegraben ist: Nonna geht auf unser Haus zu, ein starker Wind bläst ihr entgegen, weht ihre Haare nach hinten. Der Stoff des Kleides zeichnet ihre Formen nach, die Hüfte, die Beine und die Mündung, in der die Beine zusammenkommen wie zwei Flüsse. Da war nichts Überflüssiges, pure Symmetrie, Perfektion und Eleganz. Ein kleines Meisterwerk. Die Mündung war wie ein Punkt. Der Schöpfer hatte hier den Schlußpunkt gesetzt.
Nonna ging vorwärts und erschauerte im Wind. Ihre Wimpern zitterten. Andrjuscha war anmutig und traurig. Er hatte wohl ein Vorgefühl, daß Nonna bald auf und davon wäre. Für sie taten sich andere Horizonte auf. Sie hatte in diesem Fabrikgebiet nichts mehr zu suchen, zwischen all diesen einfachen Menschen. Sie war eine Ananas und mußte unter anderen Ananaspflanzen erblühen, die elegant und wohlriechend waren.
Nonna bekam ihr Abschlußzeugnis und ging nach Moskau. Sie bestand die Aufnahmeprüfung in der Schauspielschule. Dann riß sie sich sofort und vollständig von uns los, es drängte sie von uns weg wie einen Reiher von den Hühnern. Ein Reiher fliegt hinauf zu den Wolken, ein Huhn kann nur ein bißchen flattern, kann höchstens bis auf den Zaun hochfliegen.
Tante Tossja erzählte überall rum, daß sich der Dekan der Schauspielschule in Nonna verliebt hatte, ein Professor mit dem Namen Zarenkow.
Unsere Mutter weinte still vor Neid und in dem Bewußtsein: Die einen bekommen alles – die anderen gar nichts. Warum gab es solche Ungerechtigkeit?
Ich war aufrichtig froh für Nonna. Wenn ihr solches Glück zugefallen war, dann hieß das, daß es das immerhin gab. Das Glück war kein Mythos, sondern Wirklichkeit. Und die Wirklichkeit war jedem zugänglich – also auch mir.
Lenka ließ weder Freude noch Neid erkennen. Ihr war es gleichgültig.
Lenka trat ins pädagogische Institut ein, ich wollte Richtung Medizin. Wir bereiteten uns vor, um die Reihen der sowjetischen Intelligenzija zu vervollständigen.
Ich hatte gleichzeitig zwei Verehrer. Der eine war Garik: fröhlich, ein Draufgänger, zu allem bereit. Der andere war schön, aber einer, der einem immer entgleitet, wenn man ihn packen will. Seine Mutter hielt nichts von mir. Sie sagte zu ihm: »Die schleppt dich bloß von einem Secondhandladen zum anderen. Aber du mußt deine Dissertation schreiben …«
Lenkas Privatleben stand still. Sie hatte immer noch den verträumten Ausdruck im Gesicht, keinerlei Interesse an gar nichts. Die Liebe zog an ihr vorbei, sie ging nicht in Lenkas Hafen vor Anker.