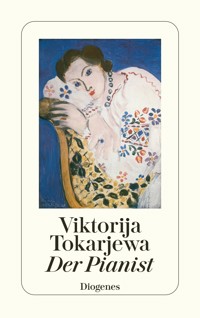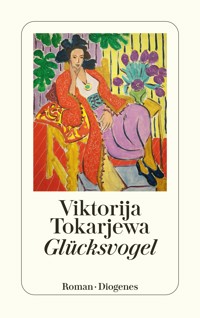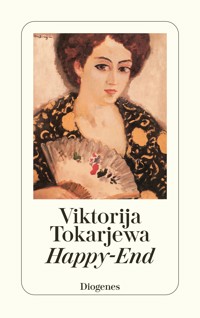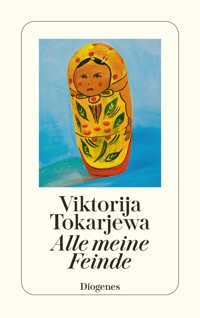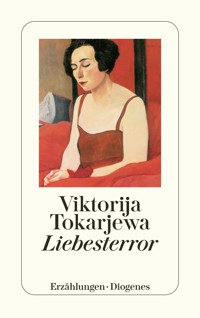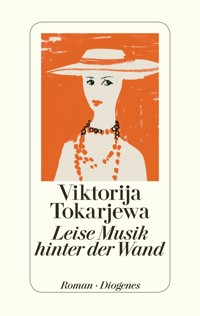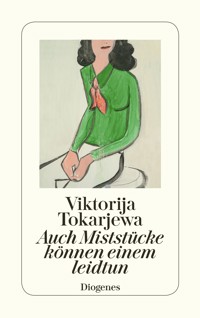16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Viktorija Tokarjewa, die Grande Dame der russischen Literatur, erzählt ihr Leben anhand der Männer, die ihr geholfen haben, Schriftstellerin zu werden und ihr Talent zum Blühen zu bringen. Indem sie an sie geglaubt, sie zur Weißglut getrieben, sie geliebt, ihr Land revolutioniert, sie herausgefordert haben. Und als Zugabe: ein sehr persönlicher Essay über Viktorija Tokarjewas großes literarisches Vorbild Anton Cechov.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Viktorija Tokarjewa
Meine Männer
Aus dem Russischen von Angelika Schneider
Diogenes
{7}Meine Männer
Ich ging zur Schule Nummer hundertvier. In Leningrad. Auf der Wyborger Seite. Erst im Jahre 1991 hat der neue Bürgermeister Sobtschak die Stadt in Sankt Petersburg umbenannt und gab ihr damit den historischen Namen zurück. Aber zu meiner Zeit nannte man die Stadt Leningrad. Ich verband sie jedoch nie mit der Person Lenin. Es war für mich einfach ein sehr schönes Wort, klar und klangvoll: Leningrad.
In der Schule war ich ziemlich mittelmäßig, in den Lernfächern hatte ich meistens eine Vier, im Betragen eine Drei.
In unserer Klasse gab es zwei Einserschülerinnen: Ljusja Kossowa und Ljusja Sundatowa. Beide Ljusjas wollten mit mir befreundet sein, sie wetteiferten miteinander und waren aufeinander eifersüchtig. Ljusja Sundatowa hat sogar manchmal geweint.
Unsere Klassenlehrerin – sie hinkte und trug einen orthopädischen Schuh am rechten Fuß – {8}wunderte sich offen über dieses Trio. Für sie waren Einserschülerinnen Generäle, und ich, die Viererschülerin, von niederem Rang, etwa dem eines gemeinen Soldaten. Und wie konnten Generäle mit einem Soldaten befreundet sein und sich auch noch darum streiten, wer in seiner Gunst an erster Stelle stand …
Heute denke ich: Der Umgang mit mir war einfach unterhaltsam. Ich war fröhlich und hatte eine wohlklingende Stimme. Ich konnte ein gelesenes Buch so nacherzählen, dass alle mit offenem Mund zuhörten. Anscheinend bildete sich irgendwo tief in mir bereits meine Berufung für die Literatur.
Ljusja Kossowa lebte in sehr ärmlichen Verhältnissen. Sie besaß nur ein einziges Kleid – die Schuluniform. Die trug sie jeden Tag, und wenn ein Feiertag anstand, wurde sie gewaschen und gebügelt. So war sie dann ihr Ausgehkleid.
Ljusja, wo bist du jetzt? Wenn du diese Zeilen liest, dann finde mich. Ich habe nichts vergessen. Ich erinnere mich genau an deine hellen, dichten Haare und deinen kleinen Mund.
Ljusja Sundatowa sagte immer: »Ich fürchte mich vor der Zukunft. Sehr sogar.«
Damals waren wir so um die fünfzehn Jahre alt. Die Zukunft hielt Liebe, Familie, Kinder für uns bereit, das Schicksal eben, das alle Frauen erwartete. Und das alles hing von einem einzigen {9}Menschen ab, dem Mann, mit dem man zusammenkam. Und davon, was für ein Mensch er sein würde: ein fröhlicher Romeo oder ein trauriger Dämon oder aber ein egoistischer Schuft à la Petschorin.
Doch Ljusja Sundatowa ereilte weder das erste noch das zweite und auch nicht das dritte Schicksal. Sie entwickelte einen veritablen Verfolgungswahn und warf sich eines Tages aus dem Fenster. Aber davon nicht jetzt.
In der neunten Klasse bekamen wir eine neue Lehrerin im Fach Literatur. Sie hieß Vera Fedorowna. Sie war streng und hochmütig, und sie gab niemandem jemals eine Eins. Vera Fedorowna kannte und liebte die Literatur, deshalb musste sie das armselige geistige Niveau fünfzehnjähriger Wesen zwangsläufig zutiefst beleidigen.
Wir fürchteten Vera Fedorowna, denn man spürte in ihr eine besondere Art Mensch. Sie war anders als die anderen Lehrerinnen. Die anderen waren nette Tanten mit Diplom, die gezwungen waren, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Vera Fedorowna und die Literatur jedoch – das war wie Paganini mit seiner Geige.
Das pädagogische Talent ist so einzigartig wie jedes andere Talent. Und bei ihr spürten wir es und waren voller Ehrfurcht.
Eines Tages rief mich Vera Fedorowna an die {10}Tafel. Ich sollte eine Geschichte nacherzählen, die wir zu Hause hatten lesen müssen.
Ich stand vorne und erzählte sie kühn nach. In meinem Wortschatz befanden sich viele Wörter, die fremdländische Wurzeln hatten, in der Art von »prolongieren«, »infernal«, »sich echauffieren« und Ähnlichem mehr.
Vera Fedorowna war sich nicht sicher, ob ich die Bedeutung dieser Wörter kannte oder sie nur wie ein Papagei wiederholte. So spürte sie diesen Wörtern nach, hetzte mich auf ihre Fährte.
»Prolongieren … bedeutet?«, fragte sie streng.
»Verlängern«, sagte ich.
»Infernal …?«
»Höllisch, vom Wort Inferno, Hölle, abgeleitet.«
»Sich echauffieren …?«
»Sich erregen, sich aufregen.«
Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie man ein Wort gebrauchen konnte, ohne dessen Sinn zu kennen. Wer machte denn so etwas? Doch nur ein hirnloser Auswendiglerner.
Ich antwortete sicher, und ihr muss klar gewesen sein, dass mein Vorrat noch lange nicht ausgeschöpft war. Ich kannte schon viele Wörter, jonglierte mit ihnen hin und her, aber ich setzte sie immer richtig ein.
»Eins! Setzen!«, sagte Vera Fedorowna.
{11}Die Klasse war wie versteinert.
Wie denn das? Den Einserschülerinnen gab sie eine Drei und der Viererschülerin eine Eins? Wie konnte das sein?
Das konnte so sein: Vera Fedorowna hatte das absolute Gehör für Sprache, oder besser gesagt für sprachliche Techniken, und so konnte sie meine Gabe heraushören und herausstellen. Und sie störte mein Status als »gemeiner Soldat« dabei überhaupt nicht.
Auch ich selbst erstarrte bei dieser Bewertung. Aber ich habe sie mir fürs ganze Leben gemerkt. Mit fünfzehn habe ich als Einzige eine Eins bekommen. Jemand hat an mich geglaubt. So begann auch ich, an mich zu glauben.
Ich habe natürlich nicht gedacht, dass in mir eine Schriftstellerin verborgen war, aber ich habe verstanden, dass ich alle überflügeln konnte, wenn ich nur wollte. Ich hätte bis in die Türkei schwimmen können. Ich musste nur ins Wasser steigen – und loslegen!
Ich danke Ihnen, Vera Fedorowna.
Sie sind wahrscheinlich schon längst dort. Aber auch von dort ist alles gut zu sehen, meine Bücher inklusive. Vielleicht blickt Vera Fedorowna auf die Buchumschläge mit meinem Namen und denkt: »Ach, das ist doch dieses Mädchen aus der Schule {12}Nummer hundertvier aus der Neun b … Ich erinnere mich … Ja, ich erinnere mich … Das Mädchen mit dem Pony, das auf den ersten Blick nichts Besonderes war.«
Nach der zehnten Klasse legte ich die Aufnahmeprüfung für das Medizinische Institut ab. Ich liebe die Medizin und lese noch heute medizinische Fachbücher so gern wie beispielsweise Die drei Musketiere.
Die Medizin und die Literatur haben viel gemeinsam. Die Krankheit des Körpers und die Krankheit der Seele sind doch im Grunde dasselbe. Der Zustand des Verliebtseins beispielsweise fällt mit den Symptomen des Wechselfiebers zusammen: hohes Fieber, aber es geht schnell wieder vorbei. Die echte Liebe hingegen ist eine chronische Krankheit. Sie dauert lange an, manchmal das ganze Leben.
Der Bereich der Onkologie – der umfasst die Sehnsuchtskrankheiten. Die Sehnsucht sammelt sich an und konzentriert sich an einem bestimmten Ort.
Ein Magengeschwür ist das Resultat von langer Gereiztheit und Ärger.
Man möchte den Menschen sagen: Liebt euch selbst. Doch andererseits: Ein selbstverliebter {13}Mensch ist ein echtes Ekel, sogar wenn er klug ist und Humor hat.
Wenn ich nicht Schriftstellerin geworden wäre, dann wäre ich heute Ärztin. Und noch dazu eine gute. Aber ich bin nicht am Medizinischen Institut aufgenommen worden. Ich habe den Aufsatz verpatzt, am Ende fehlte mir ein einziger Punkt. Ironie des Schicksals.
Meine Mutter versuchte alles, um mich irgendwo anders unterzubringen.
In der Nähe unseres Hauses war eine Musikhochschule, eine siebenstufige, dorthin schob man mich schließlich ab.
Wenn ich etwas nicht ausstehen kann, dann ist es die musikalische Grundbildung, das Solfeggio, die Notenlehre. Ich mochte es nicht und ich konnte es nicht. Das Dirigieren dagegen gelang mir einigermaßen gut. Und auch den Chor liebte ich. Das gemeinsame Singen – das ist wie ein Gebet der besonderen Art. Die Seelen vereinigen sich und fliegen als ein gemeinsames Bündel zu Gott hinauf. Und wie wir sangen … Wir hatten die gesamte Chorliteratur in unserem Repertoire.
Auch heute bin ich nicht gleichgültig dem Chorsingen gegenüber, und wenn ich einen Kinderchor höre, fange ich an zu weinen. Warum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich weil die unschuldigen Engel {14}ihr Gebet zum Himmel emporschicken und meine Seele damit erschüttern.
Die Musik ist ein Zauberland. Aber es ist nicht mein Land. Ich studierte ohne Begeisterung, ich langweilte mich, wie ein Reisender im Wartesaal, der auf seinen Zug wartet. Und der Zug kam und kam nicht, und wie lange man noch warten musste war ungewiss, vielleicht das ganze Leben lang. Was für eine Sehnsucht …
Heute kann ich sagen, dass die musikalische Erziehung das Leben bereichert, dass sie es polyphoner macht.
In fremden Städten setze ich mich oft auf eine Bank, schließe die Augen und höre zu, höre genau hin, wie die jeweilige Stadt klingt.
Odessa erschreckte mich mit entsetzlichem Kreischen: Es kreischten die Trams und es kreischten die Tauben. Doch über allem lag Hitze und Leidenschaft. Tramway der Wünsche, so heißt A Streetcar Named Desire bei uns.
Die Hauptstadt von Laos dagegen ist mir durch ihre friedliche Ruhe in Erinnerung geblieben. Das Schurren der Gummireifen über den Asphalt – ssst-ssst-ssst … Die jungen Mädchen auf ihren Fahrrädern – perfekte Statuetten: weiße Blusen, dunkelblaue Röcke, die hübschen Füßchen auf den Pedalen. Ssst-ssst-ssst …
{15}Die Angestellten im Hotel sagten zueinander: »Bo-pi-njan.« Das bedeutet wörtlich: »Nimm das nicht in den Kopf.«
Und so leben sie: Ssst-ssst-ssst und bo-pi-njan.
Man mag das langweilig finden, aber in Wahrheit ist es wunderbar. Da ist nichts Überflüssiges.
Manchmal hörte man auf dem Markt oder in einem Geschäft plötzlich jemanden aus Leibeskräften schreien. Das waren russische Touristen, die sich miteinander unterhielten.
Mit zwanzig heiratete ich einen Moskauer, den ich eine Woche kannte. Er hatte ein Auge auf mich geworfen, und noch eins. Sie waren groß und dunkelblau. Nicht hellblau, sondern wirklich dunkelblau, wie der Himmel auf japanischen Postkarten. Außerdem trug er sehr schmal geschnittene Hosen, sogenannte Röhren, und Stiefel mit dicker Sohle aus weißem Gummi, damals Kreppsohlen genannt.
Ich sah all diese Pracht und dachte: »Was für ein Glück hat das Mädel, dem er den Hof machen wird. Wenn mir so einer … Aber das ist ja doch unrealistisch.«
Aber es stellte sich als realistisch heraus. Er lud mich ins Theater ein und baggerte mich an. Und es endete damit, dass ich nach Moskau zog und ein {16}kleines Mädchen gebar. Schade, dass es bei dem einen blieb.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann bedauere ich, dass ich so viel gearbeitet habe. Ich hätte besser noch ein paar Kinder geboren. Genau dort liegt das Glück. In den Kindern, ihren kleinen Gesichtchen, ihren hellen Stimmchen, ihrer puren Anwesenheit. Aber, wie man so sagt, die Geschichte kennt keinen Konjunktiv. »Wenn das Wörtchen ›wenn‹ nicht wär …«
Damals beendete ich also meine Musikhochschule und zog mit zwanzig Jahren nach Moskau in die Gorkistraße Nummer vierundzwanzig. Im selben Gebäude befand sich auch das Restaurant Baku. Was da heute ist, weiß ich nicht …
Ich zog mitten ins Herz von Moskau. Die Energie des Stadtzentrums war völlig anders als alles, was ich bis dahin kannte. Du trittst auf die Straße hinaus, reihst dich ein in den steten Menschenstrom, wirst sogleich Teil von ihm und schreitest voran wie auf dem Weg zu einer Heldentat, alles fällt dir leicht.
Ich musste eine Arbeit finden. Also ging ich zum »regionalen Büro der Volkserziehung«, und man erklärte mich zur Gesangslehrerin in einer allgemeinbildenden Schule. Die Schule lag am {17}Ortsausgang von Moskau, sozusagen am anderen Ende der Welt.
Aber was hatte ich mir denn vorgestellt? Wer war ich schon? Ein Niemand. Keinerlei wichtige Beziehungen, keinerlei Bekanntschaften, nichts als das Vertrauen ins Leben und eine schlanke Taille.
Die Schule, in der ich arbeitete, war einstöckig und aus Holz, ein Gebäude wie in einem Straflager. Die Hälfte der Väter meiner Schüler saß im Gefängnis.
Wenn ich darüber nachdenke, wer mich zur Schriftstellerin gemacht hat, dann bekenne ich: Es war mein Schüler Sobakin. Er ging in die vierte Klasse, war rothaarig und hatte Sommersprossen. Jedes Mal, wenn ich in die Klasse kam, saß Sobakin unter der Decke. Er gelangte über die Wasserleitung hinauf, was nicht gerade einfach war. Dann hing er dort, hielt sich dabei mit Armen und Beinen fest, die er um die Rohre geschlungen hatte.
Ich sagte immer dasselbe: »Sobakin, warum bist du da hochgeklettert?«
»Ich höre und sehe von hier besser.«
»Komm sofort runter«, befahl ich.
»Wieso? Störe ich etwa?«
»Wenn du nicht runterkommst, breche ich die Stunde ab«, sagte ich, um ihn zu erschrecken.
Dabei konnte ich die Stunde gar nicht {18}abbrechen, denn sie war mir ja vom Direktor aufgedrückt worden.
Sobakin hing weiterhin unter der Decke. Ich stand weiterhin im Raum. Quälende Pause.
Die anderen Kinder hielten es nicht länger aus, sprangen von ihren Plätzen und wollten Sobakin an den Hosenbeinen herunterziehen. Daraufhin begann er, mit den Füßen auszuschlagen, versuchte, sie mit den Schuhen ins Gesicht zu treffen. In der Klasse brach ein Bürgerkrieg aus: Die einen schlugen die anderen und umgekehrt.
Ich versteckte mich hinter dem Klavier, denn ich fürchtete, von beiden Seiten etwas abzubekommen.
Darüber habe ich bereits in meiner ersten Erzählung Ein Tag ohne Lügen geschrieben. Ich bin gezwungen, mich zu wiederholen, aber aus einem Lied kann man keinen Ton einfach so hinauswerfen.
Ich hasste meine Arbeit. Jeden Tag musste ich mich überwinden, in die Schule zu gehen. Ich fühlte mich wie Tschechows Kaschtanka. In der gleichnamigen Erzählung über eine kleine Hündin heißt es an einer Stelle: »Wenn Kaschtanka ein Mensch gewesen wäre, hätte sie gewiss gedacht: ›Nein, das ist kein Leben! Ich muss mich erschießen!‹…«
Nach der Arbeit machte ich mich auf den Heimweg. An der Bushaltestelle holte mich mein Mann ab. Gemeinsam gingen wir in eine Kantine und {19}aßen unser Mittagessen an einem Tisch, der nach alten Putzlappen roch. Wir nahmen die kantinenüblichen Frikadellen, die aus achtzig Prozent Brot und zwanzig Prozent Fleisch bestanden. Wir nannten sie die »Ganz-ohne-Fleisch-ging’s-nicht-Klopse«. Manchmal aßen wir auch Schtschi-Suppe, die ebenfalls nach alten Putzlappen roch. Und nichts als die dunkelblauen Augen meines Mannes konnten diese Armseligkeit etwas erhellen.
Der Mensch hat keinen größeren Feind als die Armut. Sie erniedrigt einen, saugt einem alle Kräfte aus.
Ich saß völlig niedergeschlagen da, fast hätte ich geweint. Aber mein Mann sagte zu mir: »Jetzt spuck doch auf diesen Sobakin. Du hast doch mich, und das reicht.«
Nein, das reichte nicht. Ich hatte ihn, das ist wahr. Aber mich selbst hatte ich nicht. Ich saß immer noch am Bahnhof, blickte auf den bespuckten Boden und wartete auf meinen Zug.
Und der Zug kam und kam nicht, und das Warten wurde mir unerträglich.
Der Direktor der Schule rief mich zu sich und ordnete an, dass ich ein Treffen zwischen den Schülern und einem Kinderbuchautor organisieren solle. Denn ich sei ja für die Kultur in der Erziehung verantwortlich.
{20}»Und wen soll ich da einladen?«, fragte ich.
»Ganz egal«, antwortete der Direktor. »Wer sich eben bereit erklärt.«
Ich seufzte schwer und machte mich daran, die nötigen Telefonnummern herauszubekommen.
Die Bekanntesten waren meiner Meinung nach: Swetlow, Twardowskij und Michalkow.
Ich rief sie der Reihe nach an. Der eine lehnte aus Hochmut ab, der andere, weil er gerade in einer Saufphase war, und der dritte war Sergej Michalkow.
»Und wer sind Sie?«, fragte er mich.
»Ich bin die Lehrerin«, sagte ich. Dann überlegte ich kurz und fügte hinzu: »Und Studentin der Moskauer Filmhochschule, im Bereich Drehbuch.«
Das war zwar gelogen, aber dafür gab es zwei Gründe. Erstens träumte ich tatsächlich von einem Drehbuchstudium an der Filmhochschule, und zweitens schien mir, dass es zu wenig war, bloß Lehrerin zu sein. Ich musste irgendwie den Anschein erwecken, mit der Kunst verbandelt zu sein, dann wäre ich mit ihm auf Augenhöhe. Sergej Michalkow war Dichter, und ich war Drehbuchautorin.
»Na gut«, sagte Michalkow. »Wann soll ich kommen?«
»Am Dienstag. Um zwei Uhr mittags.«
{21}»Rufen Sie mich am Dienstag um zehn Uhr morgens noch mal an und erinnern Sie mich, bitte.«
»Danke!«, sagte ich erfreut.
»Aber Sie müssen wissen, wenn der Hörer abgenommen wird und es herrscht erst mal Schweigen, bin ich trotzdem dran. Ich stottere nämlich.«
»In Ordnung.«
Ich war sofort verzaubert von diesem Menschen. Er plauderte mit einer ihm völlig unbekannten Lehrerin, scherzte dabei feinsinnig und nicht etwa grob. Seine eher hohe Stimme klang leicht gepresst und sehr klug. An der Stimme kann man so viel erkennen.
Am Dienstag rief ich wie verabredet an, aber nicht um zehn, sondern um halb elf. Aus irgendeinem Grund hatte ich das Gefühl, dass zehn Uhr zu früh wäre. Ich sollte mich besser etwas verspäten.
Ich wählte seine Nummer. Er nahm sofort ab und fing direkt an zu schreien: »Wieso rufen Sie nicht pünktlich an?! Ich sitze hier und warte, ich habe schließlich auch noch was anderes zu tun.«
Ich war verblüfft. Ich hatte nicht erwartet, dass Sergej Michalkow, der auf seinem Olymp thronte, auf den Anruf einer unbedeutenden Lehrerin wartete, die sich unten am Fuße des Berges herumtrieb und am Gras zupfte wie eine Ziege.
{22}Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass Pünktlichkeit und Verbindlichkeit die Eigenschaften eines Aristokraten waren. Ein Aristokrat lässt niemanden warten, denn das ist unhöflich.
Ein und derselbe Mensch kann sich nach verschiedenen Seiten neigen. Meine Zeitgenossen hatten ihren Michalkow, und ich hatte meinen. Und ich erzähle von meinem, von dem, an den ich mich erinnere.
Sergej Michalkow kam also in die Schule. Er war sehr erstaunt, als er mich sah.
»S-s-ie sind d-die Lehrerin?!«, brachte er heraus.
Ich sah wirklich nicht wie eine Lehrerin aus. Für eine Lehrerin war ich zu jung und zu modisch gekleidet. Ich verdiente mir mein Brot mit ehrlicher, harter Arbeit, obwohl ich es hätte auf entschieden einfachere Weise verdienen können.
Sergej Michalkow begann seinen Auftritt vor den Kindern, und währenddessen verlor ein Mädchen in den hinteren Reihen das Bewusstsein und fiel polternd vom Stuhl. Es entstand eine leichte Panik.
Michalkow fragte: »Was ist denn da los?«