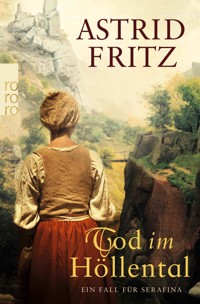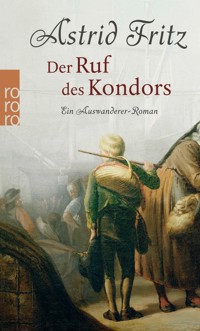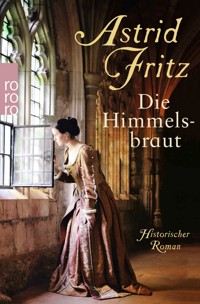9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Drei Leben, ein Dorf, eine Weltkrise. Nach «Der Turm aus Licht» erzählt die Bestsellerautorin Astrid Fritz das berühmte schicksalhafte Jahr 1816, das «Jahr ohne Sommer», als großen packenden Roman – und als berührende Liebesgeschichte. 1816: schwarze Wolken, Dauerregen, Kälteeinbrüche, grelle Sonnenuntergänge. Immer wieder schauen die Menschen aus dem schwäbischen Hohenstetten in den Himmel. Das Wetter spielt verrückt. Ernteausfälle bedrohen ihr Leben. Viele Verzweifelte suchen auf fernen Kontinenten ihr Glück. Strenggläubige sehen die Apokalypse nahen. Und wieder andere versuchen, durch Tatkraft und puren Überlebenswillen das Jahr ohne Sommer zu meistern. Wie der junge Schulmeister Friedhelm. Die starke Paulina. Und der kluge Pfarrer Unterseher. Packend und atmosphärisch erzählt «Der dunkle Himmel» anhand des Leinenweberdorfes von einer historischen Klimakatastrophe globalen Ausmaßes nach einem Vulkanausbruch in Indonesien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 691
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Astrid Fritz
Der dunkle Himmel
Historischer Roman
Über dieses Buch
Das Jahr ohne Sommer: Drei Leben, ein Dorf, eine Weltkrise
1816: schwarze Wolken, Dauerregen, Kälteeinbrüche, grelle Sonnenuntergänge. Immer wieder schauen die Menschen aus dem schwäbischen Leinenweberdorf Hohenstetten in den Himmel. Das Wetter spielt verrückt. Ernteausfälle sorgen für Hunger, Verzweiflung und Tod. Viele suchen auf fernen Kontinenten ihr Glück. Strenggläubige sehen die Apokalypse nahen. Und wieder andere versuchen, durch Tatkraft und puren Überlebenswillen das Jahr ohne Sommer zu meistern. Wie der junge Schulmeister Friedhelm. Die starke Paulina. Und der kluge Pfarrer Unterseher.
Packend und atmosphärisch erzählt «Der dunkle Himmel» anhand der Dorfbewohner von einer historischen Klimakatastrophe globalen Ausmaßes nach einem Vulkanausbruch in Indonesien – und von einer großen Liebe gegen alle Widerstände.
Vita
Astrid Fritz studierte Germanistik und Romanistik in München, Avignon und Freiburg. Als Fachredakteurin arbeitete sie anschließend in Darmstadt und Freiburg und verbrachte mit ihrer Familie drei Jahre in Santiago de Chile. Zu ihren großen Erfolgen zählen «Der Turm aus Licht», «Die Hexe von Freiburg» und «Die Tochter der Hexe». Astrid Fritz lebt in der Nähe von Stuttgart.
Mehr über Astrid Fritz erfährt man auf www.Astrid-Fritz.de.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, April 2022
Copyright © 2022 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg
Coverabbildung Schwarzwaldlandschaft, Hans Thoma, 1867, Kunsthalle Bremen - Lars Lohrisch/ARTOTHEK
ISBN 978-3-644-00942-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Die Liebe höret nimmer auf
(Inschrift an der Grabkapelle von Königin Katharina auf dem Württemberg bei Stuttgart)
Prolog
Auf der indonesischen Insel Sumbawa, den 5. April 1815
Ein krachender Donnerschlag kündigte das Unheil an. Doch diesmal war es kein Gewitter, das sich an der Flanke des Vulkans Tambora über Buschland und Reisfeldern zusammenbraute, vielmehr begann die Erde spürbar zu beben. Sie schüttelte sich, als wolle sie alles Böse von sich abwerfen.
Erschrocken rannten die Menschen des Dorfes aus ihren Hütten hinaus in die schwülwarme Abenddämmerung. Sie kannten den Zorn der Berggötter, die in den Feuerbergen ihrer Inselwelt hausten, doch diesmal war es anders. Kein einziger Vogel war zu hören noch zu sehen, Hunde und Katzen hatten sich in irgendwelche Winkel verkrochen, in der Luft lag Schwefelgeruch. Rasch befahl der Dorfälteste, ein Bündel mit dem Nötigsten zu packen und nach Süden zu ziehen.
Obwohl die Menschen unter dem ersten Ascheregen und auf schwankendem Boden fast ununterbrochen fünf Tage und Nächte marschierten, kamen sie nicht weit genug. Am Abend des 10. April schossen Flammensäulen aus dem Krater des himmelhohen Bergmassivs, dann verwandelte sich der Tambora in ein Inferno aus flüssigem Feuer. In einer gewaltigen Explosion, die über Hunderte Meilen hinweg zu hören war, wurden Gesteinsbrocken in der Größe von Schiffen in die Luft gesprengt. Glühende Ströme von mörderischer Hitze wälzten sich die Flanken herab und verbrannten alles, was ihnen im Weg war: Hütten und Häuser, blühende Kaffeeplantagen und Reisfelder, Maulesel und Federvieh, Männer, Frauen und Kinder. Über Tage hinweg verdunkelte die Aschewolke den Himmel, die niedergehenden grauen Flocken bedeckten ganz Sumbawa und die umliegenden Inseln, Wirbelstürme tobten über das Land hinweg, haushohe Flutwellen türmten sich im Wasser auf und verschlangen an Land das, was bis dahin noch verschont geblieben war. Zehntausende Menschen fanden den Tod. Der Natur war dies alles gleichgültig. Bald schon würde auf den fruchtbaren Böden neues Leben sprießen.
Die Menschen auf der Nordseite der Erdkugel ahnten indessen nicht, was auf sie zukam.
Kapitel 1
Hohenstetten auf der Rauhen Alb im Königreich Württemberg, am Silvesterabend 1815
Aus der alten Wehrkirche im Herzen des schwäbischen Marktfleckens hallte vielstimmiger Gesang in die sternenklare Winternacht.
«Großer Gott, wir loben dich», ertönte es aus Hunderten von Kehlen. In den drei Bankreihen, die gegen eine gute Spende aufs Jahr gepachtet werden konnten, fand sich kein einziger freier Platz mehr, und auch dahinter standen die Kirchenbesucher dicht an dicht. Alle waren sie gekommen, selbst die Alten und die Verkrüppelten mit ihren Gehstöcken oder Krücken. Alle wollten sie an diesem Abend den Herrn und Schöpfer um Segen für das neue Jahr bitten.
Schon während der zweiten Strophe des schönen Eingangsliedes schweiften Pfarrer Untersehers Gedanken ab. Würde es ihm gelingen, seiner Gemeinde Mut zuzusprechen? Ein gesegnetes, ein gutes Jahr hatten sie bitter nötig, war doch die Ernte nach den eisigen Wintern, zu nassen Saatzeiten und zu kühlen Sommern der letzten Jahre alles andere als üppig gewesen. Man war zwar hier oben auf der Rauhen Alb, wo aus den kargen Böden die Steine hervorwuchsen wie andernorts Blumen, an harte Winter und an die Launen des Wetters gewöhnt. Aber die wiederholten mageren Ernten von Flachs, Feldfrucht und Viehfutter hatten die Preise in eine solche Höhe getrieben, dass es einem Angst machen konnte.
Sehr, sehr bald schon mussten sich die Dinge zum Besseren wenden, litt doch das ganze Land noch immer unter den Kriegslasten und Folgen der jahrelangen napoleonischen Truppendurchzüge. Wieder und wieder waren damals die Franzosen durch Württemberg marschiert, hatten Vieh und Pferde requiriert, sich an den Vorräten der Bauern schadlos gehalten. Bis heute ächzten die Menschen unter den hohen Abgaben und Kriegssteuern, und nicht wenige Familien hatten einen Vater, Bruder oder Sohn auf den fernen Schlachtfeldern verloren. Allein der Russlandfeldzug vor drei Jahren hatte sechzehntausend Württembergern das Leben gekostet, nur einige hundert waren zurückgekehrt, viele davon kriegsversehrt. Wie etwa die beiden Webergesellen Fritz und Hannes, die sich jetzt an Krücken herumschleppten, weil ihnen ein Bein zerschossen worden war – dem Fritz das linke, dem Hannes das rechte.
Zu dieser Bedrückung kam etwas Merkwürdiges hinzu. Seit Oktober konnte man seltsame Himmelserscheinungen beobachten: Oftmals war der Himmel mit einem durchsichtigen Gewölk überzogen, das abends, wenn die Sonne unterging, in flammenden Farben zu glühen begann. Und als der erste Schnee kam, später als sonst, fiel er in ungewöhnlich dicken, rötlich braunen Flocken vom Himmel. Blutregen, so nannten ihn die Leute, und dass so manche unter den ganz Frommen dies beides als Vorboten des nahenden Weltendes deuteten, machte die Menschen noch unruhiger und sorgenvoller, als sie ohnehin schon waren.
Immerhin herrschte nun seit Juni endlich der ersehnte Frieden, nach zwei Jahrzehnten Krieg. Über viele Monate hinweg hatten die Mächtigen in Wien um ein neues Europa gerungen und schließlich eine revolutionäre Weltordnung geschaffen, mit Großstaaten, die es derart zuvor nicht gegeben hatte und die unter dem Dach des Deutschen Bundes den europäischen Frieden garantieren sollten. Vor allem aber, dachte sich Carl Unterseher im Stillen, war man diesen Kriegstreiber Napoleon Bonaparte, an dessen Seite und von dessen Gnaden Württemberg zum Königreich aufgestiegen war, ein für alle Mal los. Aus seiner Verbannung auf der fernen Atlantikinsel Sankt Helena würde er hoffentlich nie zurückkehren. Doch das Goldene Zeitalter vor den Kriegen, als hier oben auf der Rauhen Alb der Flachsanbau und die Leinenweberei blühten und gediehen und noch selbst den Tagelöhnern und Kleinbauern ein Auskommen sicherten, war wohl endgültig vorbei.
Kapitel 2
Zur selben Zeit in der Kirche von Hohenstetten
Angesichts der sorgenvollen Mienen der Kirchgänger rundum unterdrückte Friedhelm Lindenthaler ein Seufzen. Er liebte sein Heimatdorf und bereute es keinen Tag, dass er vor bald vier Jahren, nach seiner Ausbildung zum Volksschullehrer am Lehrerseminar Esslingen, hierher zurückgekehrt war. Aber manchmal konnte es einem bei all dieser ängstlichen Frömmigkeit unter den hiesigen Pietisten schon recht eng in der Brust werden.
Unwillkürlich ging sein Blick hinüber zur Mutter, die zusammen mit seiner Schwester Auguste gleich rechts vom Mittelgang in der Bankreihe bei den Frauen saß, während er selbst keine zwei Schritte vor ihr entfernt seinen Platz auf der Männerseite hatte. Nur Auguste wegen hatte er für sich selbst einen Sitzplatz gepachtet, nachdem sie ihm unentwegt zugesetzt hatte, dass es für den Schulmeister des Ortes alles andere als schicklich sei, im Gottesdienst mitten unter dem gemeinen Kirchenvolk stehen zu müssen.
Ganz in sich zusammengesunken, schmächtig wie ein Kind, kauerte die Mutter in ihrer Bank, die Hände im Schoß ineinander gekrampft. Sie verlor zusehends an Kraft, wie Friedhelm mit großer Sorge beobachtete, und gerade heute, an diesem letzten Tag des Jahres, war es ihr besonders schwer: An Silvester vor genau drei Jahren hatte sie von einem heimgekehrten württembergischen Leutnant erfahren müssen, dass ihr Mann und der Vater ihrer Kinder bei Wilna auf freiem Feld von Kosaken schwer verwundet und dann in der Eiseskälte erfroren war. Wie so viele Tausende andere deutsche Soldaten des Rheinbunds auch, die Napoleon auf seinen verheerenden Russlandfeldzug gezwungen hatte.
Plötzlich begannen die mageren Schultern seiner Mutter zu beben. Sie weinte. Eilig stand Friedhelm auf. Seinen Sitzplatz bot er dem einbeinigen Weberhannes an, der sich an der Lehne der Kirchenbank abgestützt hatte, und trat zu seiner Mutter, um ihr tröstend die Hand auf die Schulter zu legen. Da stiegen auch ihm die Tränen in die Augen.
Was den Krieg betraf, hatte er mehr Glück als andere gehabt. Voll freudiger Erwartung hatte er damals, frisch examiniert mit gerade mal 21 Jahren, in Hohenstetten seine erste Stelle als Provisor, als Hilfslehrer, angetreten. Er hatte gewusst, dass es unter den Argusaugen des Pfarrers als Schulaufseher nicht leicht werden würde, erst recht nicht unter seinem gestrengen Vater, dem allseits hochgeschätzten und von den Kindern gefürchteten Schulmeister und Webermeister. Doch nur sechs Wochen später, im Mai des Jahres 1812, war Friedhelm beim Ausbessern des Hausdachs abgerutscht und hatte sich in der Folge einen Knöchel dick wie einen Elefantenfuß zugezogen und den linken Arm gebrochen, zur großen Missbilligung des Vaters und zu seinem eigenen Glück im Unglück: Just an diesem Tag hatten nämlich königliche Werber ihren Flecken aufgesucht, um Rekruten für diesen unseligen Russlandfeldzug auszuheben. Man hatte vor allem ledige Männer zwischen zwanzig und dreißig Jahren im Auge, die das württembergische Kontingent der Grande Armee verstärken sollten. Mit seiner Verletzung kam Friedhelm für den langen Marsch ans baltische Meer selbstredend nicht in Betracht, und so hatte das Schicksal ihn mit diesem Unfall vor dem Krieg bewahrt. Umso größer war der Schrecken, als neben zwei Dutzend Webergesellen trotz fortgeschrittenen Alters sein eigener Vater eingezogen wurde! Dessen Verhängnis war seine Stärke und Gesundheit gewesen, vor allem aber verfügte er über gute Französischkenntnisse. Man hatte der entsetzten Familie zwar hoch und heilig versichert, dass Johann Friedrich Lindenthaler nicht an der Front würde kämpfen müssen, sondern im Tross des württembergischen Kronprinzen Wilhelm als Schreiber und Übersetzer dienen sollte. Beim Abschied am nächsten Morgen hatte Friedhelm jedoch geahnt, dass er ihn nie wiedersehen würde.
Verstohlen wischte er sich über die Augen. Nicht einmal Augustes Hochzeit und die Geburt seines Enkelsohnes Eduard hatte der Vater miterleben dürfen. Auch wenn Friedhelm oft mit ihm aneinandergeraten war, vermisste er ihn nun umso schmerzlicher. Manchmal hatte er sogar ein schlechtes Gewissen: Nur dem Tod des Vaters verdankte er, dass man ihn trotz seiner Jugend und Unerfahrenheit vor drei Jahren vom Hilfslehrer zum Schulmeister befördert hatte.
Pfarrersfrau Dorothea Unterseher, die in der Bankreihe vor ihnen saß, drehte sich zu seiner Mutter um: «Verzage nicht, meine liebe Agnes. Deinem Mann geht es gut an der Seite des Herrn», flüsterte sie ihr zu. Nach einem kurzen Zögern dann: «Und dem Adam auch.»
Adam! Mit Friedhelms drei Jahre älteren Bruder hatte das Unglück in der Familie seinen Anfang genommen. Zum Entsetzen der Eltern hatte Adam sich vor nun fast sieben Jahren im April des Jahres 1809 ganz und gar freiwillig für den Kriegsdienst an Napoleons Seite gemeldet, und das, wo der Vater kurz zuvor neben einigen anderen Männern aus dem Dorf in der Schlacht von Austerlitz hatte kämpfen müssen. Die schrecklichen Erlebnisse hatten aus dem Schulmeister nicht nur einen Kriegsgegner gemacht, sondern auch einen finsteren, ja mitunter verstockten Mann. Nicht erst seit diesem verdammten Russlandfeldzug also hasste man hier die Franzosen und nannte Napoleon nur noch den Teufel. So konnte Friedhelm die maßlose Enttäuschung seines Vaters über Adams Entscheidung damals nur allzu gut verstehen, und seiner Mutter hatte sie schier das Herz gebrochen. Eine Todesnachricht wie vor drei Jahren über den gefallenen Vater war ihnen nie überbracht worden, gehört hatten sie dennoch nie wieder vom Sohn und Bruder. Dass es kein Grab gab, wo die Mutter den Tod ihres Ältesten beweinen konnte, war für sie inzwischen vielleicht das Schlimmste.
Als hätte Pfarrer Unterseher Friedhelms Gedanken erraten, hob der jetzt mit folgenden Worten zu predigen an:
«Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder. Ja, es war wieder ein mageres Jahr – das nächste darf gerne besser kommen, wird sich ein jeder von euch denken. Aber ich will euch sagen: Es gibt keinen Grund, kleinmütig zu sein, denn der Herrgott hat uns in diesem Jahr das allergrößte Geschenk gemacht. Nach mehr als zwanzig Kriegsjahren in unseren europäischen Landen hat er uns endlich Frieden geschenkt. Wir dürfen aufatmen und uns von Herzen freuen. Liebe Schwestern und Brüder, nun danket alle Gott, der Wunderbares schafft an allen Enden, der uns vom Mutterschoß an lebendig erhält und uns alles Gute tut. Er gebe uns ein fröhliches Herz und verleihe uns immerdar Frieden …»
Friedhelm spürte, wie ihn jemand ansah. Kaum merklich wandte er den Kopf nach rechts. Hinter der letzten Bankreihe der Frauen stand Paulina, die Tochter des Postwirts Justus Georg Gutjahr. Wie er selbst hielt sie nichts davon, bei den Honoratioren des Dorfes zu sitzen, obwohl ihr Vater selbstredend dazugehörte, war er doch zugleich Schultheiß und Gemeindeschreiber. Kurz trafen sich ihre Blicke, dann sah sie zu Boden. Dicht neben ihr stand ihre engste Freundin Luise, die Pfarrerstochter.
Friedhelms Herz schlug augenblicklich schneller. Wie er selbst war Paulina hier aufgewachsen, doch da sie um vier Jahre jünger und noch dazu ein Mädchen war, hatte er früher wenig mit ihr zu schaffen gehabt. Als ein reichlich wildes Kind hatte er sie in Erinnerung, das mutig in jede noch so finstere Höhle kroch oder auf Bäume kletterte und sich auch nicht scheute, mit den Dorfbuben zu raufen, wenn es denn sein musste. Nun ja, schließlich war sie auch mit zwei älteren, reichlich großspurigen Brüdern aufgewachsen. Nach seiner Konfirmation hatte Friedhelm sie aus den Augen verloren. Mit bestandenem Landexamen war er sogleich an der altehrwürdigen evangelischen Klosterschule zu Maulbronn angenommen worden und durfte vier Jahre später, mit dem Reifezeugnis in der Tasche, an das neu gegründete Schullehrerseminar Esslingen. Als er im Frühjahr 1812 schließlich in sein Heimatdorf zurückkehrte, war aus dem einstigen Wildfang Paulinchen mit den ewig aufgeschrammten Knien eine anmutige junge Frau geworden.
Wenn er richtig rechnete, musste sie nun zwanzig Jahre zählen. Konnte man sie schön nennen? Ach, was wusste er schon über die Schönheit der Frauen, wo er bislang nie Augen für das andere Geschlecht gehabt hatte. Von seiner ersten großen Verliebtheit als Knabe in Maulbronn vielleicht abgesehen. Da hatte er monatelang heimlich für die kecke, dralle Küchenmagd der Klosterschule geschwärmt, aber zum einen war er damals erst fünfzehn gewesen und die Magd schon mindestens fünfundzwanzig, zum anderen war er nicht der einzige liebestrunkene Trottel gewesen: Eines Tages hatte er herausgefunden, dass diese Magd mit den ältesten Schülern gegen kleine Geschenke heimlich im Kuhstall zugange war, und er hatte sich mit Grausen und voller Enttäuschung von ihr abgewandt. In Esslingen dann hatte die Professorentochter Irmtraut seine Nähe gesucht, ohne dass er das begrüßte. Sie war ihm viel zu eitel und oberflächlich mit ihrem künstlichen Lachen, ihrem makellosen Gesicht mit den riesigen blauen Augen und der porzellanweißen Haut. Vor allem aber war sie zu sehr von sich eingenommen. Nachdem sie ihm in einer dunklen Ecke am Hafenmarkt gezeigt hatte, wie man sich richtig küsste, hatte sie ihn fallen gelassen und fortan keines Blickes mehr gewürdigt. Was ihn, obwohl er gar nicht an ihr interessiert war, verletzt hatte. Fortan hatte er von den Mädchen die Nase voll gehabt und sich mit grimmigem Fleiß nur noch seinen Studien gewidmet.
Erst mit Paulina war das vor gut drei Jahren plötzlich anders geworden. Nie zuvor hatte der Anblick eines Mädchens ihn so tief berührt, und wenn er ihr begegnete, musste er an sich halten, sie nicht wie ein tumber Ochse anzustarren. Ihr lockiges, kastanienbraunes Haar war von den bunten Bändern, die sie meist trug, kaum zu bändigen. Die dunkelgrünen Augen über den hohen Wangenknochen, die schmale Nase und die vollen Lippen ihres Mundes, der, wenn sie lachte, zwei tiefe Grübchen auf ihre Wangen zauberte, hatten etwas Sanftes und Herausforderndes zugleich. Ja, ganz zweifellos: Für ihn war Paulina die schönste Frau auf Erden!
Ohne es zunächst selbst zu bemerken, hatte er schon bald nach seiner Rückkehr ins Dorf immer häufiger ihre Nähe gesucht – vor oder nach dem Kirchgang, beim Wasserholen am Dorfweiher, der sogenannten Hüle, beim Vieh- und Krämermarkt zu Pfingsten oder bei den Dorffesten. Die fanden bei Schönwetter unter der großen Linde vor Gutjahrs Gasthaus Zum Hirschen oder bei Regen im dortigen Tanzsaal statt. Doch zu mehr als zum Austausch von ein paar freundlichen Grußworten war es zwischen ihnen nie gekommen. Dann endlich, zur letzten Kirchweih im Oktober, hatte er allen Mut zusammengenommen und mit ihr getanzt. Und wie sie getanzt hatte, leicht wie eine Feder! Er war sich vorgekommen wie im Paradies, als sie über drei Lieder hinweg mit ihm auf dem Tanzboden geblieben war, bis ihr Bruder Ludwig Georg sie zurück an den Tisch der Eltern geholt hatte. Kurz darauf hatte seine Mutter Friedhelm beiseite genommen. Mit einer tiefen Sorgenfalte auf der Stirn hatte sie ihm gesagt: «Gib acht, was du tust, mein Junge. Mit dem Gutjahr ist nicht gut Kirschen essen, was seine einzige Tochter betrifft. Und dich würde er, da bin ich mir sicher, niemals zum Schwiegersohn haben wollen.» Entschieden hatte Friedhelm ihre Unterstellung, er sei verliebt, von sich gewiesen, dabei hatte sie ins Schwarze getroffen. Obendrein wusste er, dass sie recht hatte. Justus Georg Gutjahr war der Besitzer der größten Schildwirtschaft weit und breit, die an der Straße nach Ulm lag und vor gut fünf Jahren zur offiziellen Post- und Umspannstation erhoben wurde, was ihm einen enormen Vorteil mitsamt dem zugehörigen Umsatz brachte. Obendrein war er nicht nur Ortsvorsteher auf Lebenszeit, sondern auch einer der reichsten Männer von Hohenstetten – wenn nicht gar der reichste überhaupt. Für Gutjahr kam nur einer, der ordentlich Haus, Grund und Vieh besaß, als Schwiegersohn in Frage. Dazu zählte Friedhelm indessen nicht, wenngleich ein Schulmeister, ebenso wie Schultes, Pfarrer oder Gemeindepfleger, zu den Ehrbaren gehörte. Zudem würde Friedhelm sich als durchaus vermögend bezeichnen: Zusammen mit seiner Mutter bewohnte er ein stattliches halbes Weberhaus mit Scheune, Stall und Krautgarten, das eines Tages ihm gehören würde – seine Schwester hatte bereits zu ihrer Hochzeit die andere Haushälfte übernommen –, ebenso wie zwei Morgen Ackerland und ein Kartoffelacker in der Feldmark der Gemeinde. Eine Milchkuh mit Kalb nebst fünf Hennen und einem tüchtigen Ross hatten sie auch im Stall stehen. An den Besitz der hiesigen Wirte, Bäcker, Metzger, Kaufleute und Maierbauern reichte das allerdings nicht heran. Was noch hinzu kam: Sein Vater und der Schultes hatten sich nie leiden mögen. «Dem Gutjahr ist nicht zu trauen», hatte er die Worte des Vaters noch immer im Ohr. «Eines Tages wird es unseren Flecken teuer zu stehen kommen, dass die Regierung einen solchen Mann zu unserem Ortsvorsteher bestimmt hat.»
Insgeheim schüttelte Friedhelm den Kopf über sich selbst, während die Gemeinde wieder ein Lied anstimmte. Was machte er sich da nur für blödsinnige Gedanken? Wusste er doch noch nicht einmal, ob Paulina ihn ebenfalls mochte. Er selbst aber wusste sehr wohl, dass es spätestens seit der Kirchweih vollends um ihn geschehen war, und seither konnte er manchmal vor Aufregung nachts kaum einschlafen. An jenem Nachmittag im Oktober hatte er geschworen, sich Paulina noch vor Jahresende zu offenbaren. Jetzt war Silvester, doch er hatte nie die Gelegenheit gefunden oder vielmehr, wenn er ehrlich zu sich war, sich schlichtweg nicht getraut. Er, der Herr Schulmeister, der seine beiden Klassen – sechsunddreißig kleine Mädchen und vierzig Knaben – fest im Griff hatte, kam sich in Paulinas Gegenwart selbst vor wie ein dummer Schuljunge. Und das wurde mit der Zeit immer schlimmer.
Womöglich hatte sie längst einen Bräutigam. Im Ort, wo viel geschwatzt wurde, war zwar nichts dergleichen zu hören, aber wer weiß, vielleicht hatte sie ja einen heimlichen Verehrer.
In diesem Augenblick geschah ein kleines Wunder. Ohne es zu merken, hatte er wohl während seiner Grübeleien immer noch hinüber zu Paulina gestarrt. Jetzt wandte sie ihm das Gesicht zu – und lächelte ihn an! Ihr offenes, strahlendes Lächeln fuhr im direkt ins Herz, eine gefühlte Ewigkeit lang. Dann drehte sie sich auch schon wieder weg und sah nach vorne zur Kanzel.
«Vertraut also auf den Herrn und danket ihm, er wird schon alles richten», hörte Friedhelm den Pfarrer wie aus weiter Ferne sagen. «Der Herr segne und behüte euch. Amen.»
Nach dem Loblied «Heil unserm König, Heil» verließen sie die Kirche, diejenigen, die hinter den Bankreihen und damit näher zum Portal standen, zuerst.
«Geht ihr nur schon vor an Vaters Grab», sagte er hastig zu Auguste und seiner Mutter. «Ich komme gleich nach.»
Er hatte es eilig hinauszukommen. Nach dem Silvestergottesdienst würden sich alle rasch zerstreuen: Wer Familie hatte, würde sich daheim zu einer gemeinsamen Andacht in diesen letzten Stunden des Jahres versammeln, wer ledig war, in Conrads Gassenschenke auf eine Maß Bier.
«Der Pfarrer hat recht, wir haben allen Grund, wieder Hoffnung zu schöpfen», hörte er hinter sich im Gedränge den alten Webermeister Leberecht sagen. «Die Wintersaat ist rechtzeitig ausgebracht worden, der Herbst war trockener und der Winter bislang milder als sonst. Was meinen Sie, lieber Schulmeister? Wird es für uns Weber auf der Alb endlich einen Umschwung geben?»
Friedhelm wandte sich um. Er mochte den rechtschaffenen Alten, der ihn, obwohl er Friedhelm von klein auf kannte, inzwischen respektvoll siezte.
«Nun ja», erwiderte er, während er schon weiterging, um Paulina noch zu erreichen. «Die Handelsschranken aus Kriegszeiten werden nun fallen, und es werden wieder freie Märkte für unser Leinen entstehen. Aber ob damit auch die goldenen Zeiten zurückkehren, liegt wohl in Gottes Hand. Zumal wir es schwer haben werden gegen diese Billigtuche aus England.»
Bei seinen letzten Worten trat er durch das Kirchenportal in die sternenklare, bitterkalte Nacht und sah sich suchend um. Draußen begannen sich die Menschen in losen Gruppen zu versammeln, als er Paulina auch schon an der Seite ihrer Freundin Luise nahe der Wehrmauer entdeckte. Und sie ihn. Sie winkte ihm wahrhaftig zu!
«Ein gesegnetes neues Jahr, Meister Leberecht», wünschte er dem Weber, um sich dann eilig zu entfernen.
Reichlich verlegen stand er gleich darauf vor den beiden jungen Frauen. Täuschte er sich, oder unterdrückte Luise ein Grinsen?
«Ein gesegnetes neues Jahr, lieber Friedhelm», wünschte ihm die Pfarrerstochter. «Ihr entschuldigt mich, ich muss meiner Mutter den kleinen Gustav abnehmen – die ist von ihrem Enkelsohn gewiss schon völlig enerviert.»
Damit verschwand sie in der Menge der herausströmenden Kirchgänger, und Friedhelm war allein mit Paulina. Mit einem Mal wusste er nicht mehr, was er sagen sollte.
«Nun ja», begann er, «ich sollte dann auch zu meiner Mutter. Sie wartet am Grab meines Vaters auf mich.»
«Drei Jahre ist die Schreckensnachricht nun her, nicht wahr?» Voller Mitgefühl sah sie ihn an. «Das muss immer noch schwer sein für deine Mutter.»
«Ja, das ist es.»
Er biss sich auf die Lippen. Warum nur musste er seinen Vater erwähnen? Eigentlich hatte er die kurze Zeit, die Paulina auf ihre Familie wartete, nutzen wollen. Und zwar um sie zu fragen, ob sie und Luise mit ihm auf dem Weiher Schlittschuh laufen wollten. Gleich morgen Vormittag nach der Predigt zur Jahreslosung, wenn sie denn Zeit hätte.
Stattdessen gab er unbeholfen von sich: «Hoffen wir, dass sich wenigstens das Wetter im neuen Jahr gnädig zeigt. Wir brauchen dringend eine gute Ernte.»
«Neujahrsnacht still und klar, deutet auf ein gutes Jahr», hörte er in diesem Moment eine tiefe Bassstimme. Jovial legte ihm der Schultes die Hand auf die Schulter. «Wenn die gute alte Bauernregel stimmt, kann nichts schiefgehen, junger Freund. In diesem Sinne: dir und deiner Familie alle guten Wünsche für ein gesundes Jahr!»
Friedhelm hätte sich ohrfeigen mögen. Jetzt war es zu spät. Auch Paulinas Mutter und ihr Bruder Ludwig Georg traten hinzu, Letzterer mit misstrauischem Blick.
«Das wünsche ich Ihnen auch, liebe Familie Gutjahr.» Er rang sich gegenüber Gutjahr und seiner Frau ein freundliches Lächeln ab. «Sie werden ja morgen zum Neujahrstag sicher alle Hände voll zu tun haben mit der Gastwirtschaft. Ich selbst habe zum Glück schulfrei und will einmal erproben, ob das Eis der Hüle gut trägt.»
Ob Paulina diese Andeutung verstand? Sie dabei anzuschauen wagte er nicht.
Gutjahr lachte dröhnend. «Dann brich mir nur nicht ein, Lindenthaler. Bislang haben wir ja leider noch immer keinen Hilfslehrer gefunden, der dich halbwegs ersetzen könnte.»
Gutmütig fiel Friedhelm in sein Lachen ein. Da kam ihm blitzartig ein weiterer Gedanke: «Sie bekommen doch dienstags und freitags immer die neuesten Druckerzeugnisse mit dem Postwagen aus Stuttgart und Ulm, nicht wahr?»
Gutjahr nickte. «Wer sich bei uns einen Krug Bier bestellt, darf auch kostenfrei darin lesen.»
«Das Angebot nehme ich gerne an, Herr Schultes.»
Da verzog Paulinas Bruder spöttisch die Lippen.
«Unserem Schulmeisterlein wird wohl das Dorf zu eng, dass er sich über die große weite Welt informieren will?»
«Warum nicht?», erwiderte Friedhelm. «Ein Blick über den Tellerrand hinaus würde auch dir nicht schaden, lieber Ludwig. Eine gesegnete Nachtruhe Ihnen allen und bis bald im neuen Jahr.»
Jetzt war es Paulina, die ganz offensichtlich ein Schmunzeln unterdrückte, und mit einem leisen Glücksgefühl verließ er die Runde, um sich auf den Weg zum Friedhof zu machen. Schmale Wolkenfetzen schimmerten silbern im Licht des Mondes, und der harschig gewordene letzte Schnee knirschte unter seinen Schuhsohlen. Frohlockend, wie ihm schien.
Kapitel 3
Am Neujahrstag 1816
Obwohl der Neujahrstag ein Montag war, hatten die Kinder schulfrei. Nach altem Brauch zogen sie von Tür zu Tür und trugen ein kleines Lied vor, um dafür mit Nüssen, Apfelschnitzen oder Süßigkeiten entlohnt zu werden. Auch im Hof vor der Hirschenpost, der rechts und links von Stallungen und Remise begrenzt wurde, hatte sich am Vormittag eine große Schar eingefunden. Dick eingemummelt und mit vor Kälte roten Nasen und Wangen hoben die Kleinen erwartungsfroh zu singen an: «Hopp, hopp, hopp, Pferdchen, lauf Galopp …»
Lächelnd stand Paulina mit ihrer Mutter und der jungen Schankmagd Rosina auf den Stufen zum Eingang, ein Säckchen mit Kuchenrändern lag in der Diele für die Kinder bereit. Auch wenn der Gesang einem rechten Schulchor nicht gerade zur Ehre gereichte. Da würde Friedhelm wohl noch ein wenig üben müssen mit den Kleinen, besonders mit den Buben, dachte Paulina belustigt und reckte unwillkürlich den Hals in Richtung Dorfweiher, der sich auf der anderen Seite der Landstraße befand, die als Poststraße Stuttgart mit Ulm verband.
Dort auf der zugefrorenen Hüle trieben sich vor allem ältere Kinder und junge Leute herum, aber auch so einige Erwachsene, die am Schlittschuhlaufen ebenfalls ihren Spaß hatten. Den Schulmeister konnte Paulina unter den vielen dunkel gekleideten Gestalten, die da auf dem in der Sonne glitzernden Eis hin und her flitzten, nicht ausmachen, dazu war die Entfernung zu groß. Aber sie war sich sicher, dass sie ihn richtig verstanden hatte und er jetzt dort war. Hatte er das mit dem Eislaufen wohl ihretwegen gesagt, oder war es ihm nur so herausgerutscht?
Liebend gerne würde sie mit den anderen jungen Leuten auf der Hüle herumschlittern, und wenn es nur für ein halbes Stündlein wäre. Was gab es Schöneres an solch einem kalten, sonnigen Wintertag? Auch ihre Freundin Luise hatte versprochen, heute Vormittag dort zu sein. Für Paulina würde es indessen nicht so einfach sein, von zu Hause wegzukommen. Zwar hatte sie mit Rosina eigens vereinbart, dass sie ihr beim Eindecken der Tische und beim Auftragen helfen würde, um dann, wenn alle Gäste bei Tisch saßen, bis zu ihrem eigenen Mittagessen noch ein wenig an die frische Luft zu gehen. Aber dazu brauchte sie natürlich die Erlaubnis des Vaters, denn in einer Wirtschaft half die ganze Familie mit.
Nun, einen kleinen Spaziergang an diesem schönen Neujahrstag würde ihr der Vater gewiss nicht verwehren, und dass sie zum Schlittschuhlaufen wollte, musste sie ihm ja nicht unbedingt unter die Nase reiben. Hütete er sie doch auffälligerweise in letzter Zeit wie seinen Augapfel. Sie erschrak, als ihre Mutter sie in die Seite knuffte.
«Was starrst du da Löcher in die Luft, Mädchen? So bring den Schülern die Kuchenränder hinaus.»
Paulina hatte gar nicht bemerkt, dass die Kinder zu singen aufgehört hatten und nun unruhig von einem Bein aufs andere traten.
Sie klatschte in die Hände: «Schön habt ihr das gemacht! Dafür bekommt ihr jetzt eure Belohnung.»
Kaum waren die Schulkinder verschwunden, stapften auch schon die ersten Gäste die Treppe hinauf. Mit Stirnrunzeln beobachtete Paulina, dass sich die große Stube viel schneller als sonst füllte, und so hatte sie bald alle Hände voll zu tun. Wollten die Leute heuer diesen Tag ganz besonders feierlich begehen, weil sie diesmal besonders große Hoffnung ins neue Jahr legten? Das halbe Pfarrdorf strömte herbei, und wahrscheinlich würde kaum einer, wie sonst üblich an Neujahr, nachmittags an den Webstuhl zurückkehren. Weber und Spinner waren sie hier nämlich fast alle, selbst die Maierbauern. Man lernte das Weben von Kindesbeinen an, und sogar die Frauen verstanden etwas davon. Auch ihr Vater hatte einen Stuhl im Untergeschoss, in der Dunk, wie man hier sagte. An dem arbeitete aber nur noch ihr zweitältester Bruder Ludwig Georg. Der älteste hatte vor zwei Jahren nach einem heftigen Streit mit dem Vater nach Ulm geheiratet, betrieb dort das Gasthaus seiner Schwiegereltern und hatte sich seither nicht mehr zu Hause blicken lassen.
Dass Hohenstetten wie die anderen Flecken in der Gegend ein Weberort war, war für Paulina als Kind das Selbstverständlichste der Welt gewesen – alle Orte mussten Weberorte sein. Bis zu dem Tag, als sie mit den Eltern ihre erste Reise unternommen hatte, in die riesige, uralte Stadt Ulm. Wie hatte sie sich damals gewundert, dass dort in den Gassen auch Schuster und Schneider, Nagelschmiede und Hafner, Seifensieder und Seiler ihre Werkstätten hatten. Da erst hatte sie begriffen, wie klein ihre Welt bis dahin und wie einfältig sie selbst gewesen war: Woher sollten schließlich all diese herrlichen Dinge herkommen, die es in Hermanns Kaufladen oder auch im Gewölbe der beiden Leinwandkaufleute Pinache zu kaufen gab?
Diese drei saßen übrigens – der Krämer und Strumpfstricker Paul Hermann mit Weib und Kindern – drüben am Stammtisch beim Kachelofen, zusammen mit dem Dorfmetzger Lorenz Stumpp, und bestellten sich einen Krug Neckarwein am anderen. Und das, obwohl es im Unterland seit Jahren kein richtiges Herbsten mehr gegeben hatte und der Wein kaum noch bezahlbar war. Sogar der Nebenraum, der ihnen sonst als Wohnstube diente und nur besonderen Gästen vorbehalten war, hatte sich inzwischen bis auf den letzten Platz gefüllt. Wer jetzt noch kam, musste abgewiesen werden. In der Küche herrschte höchste Geschäftigkeit, und Paulina sah schwarz für ihren kleinen Ausflug.
«Wenn für alle aufgetragen ist, kann ich dann für eine halbe Stunde hinaus?», fragte sie den Vater, der neben der Köchin schwitzend am Herd stand. «Zusammen mit Luise?»
«Wo denkst du hin? Du siehst doch, wir brauchen jede Hand», gab er unwirsch zurück. «Oder willst du deine arme Mutter die schweren Krüge schleppen lassen? Wenn viel gegessen wird, wird auch reichlich getrunken.»
«Das kann doch auch der Ludwig machen.»
«Ludwig Georg muss mir heute beim Bierbrauen helfen. Tut mir leid, mein Liebes.» Unbeholfen tätschelte er ihr mit seiner kräftigen Hand die Wange.
«Kann es sein, dass mein Schwesterlein zur Hüle will?», mischte sich ihr Bruder ein, der eben die Küche betreten hatte. «Ein wenig übers Eis sausen, wie unser braver Schulmeister? Den habe ich dort nämlich grad seine Pirouetten drehen sehen.»
Sie spürte, wie sie über und über rot wurde.
«Das geht dich gar nichts an», fauchte sie mit einem Seitenblick auf den Vater. Der schien die gehässige Bemerkung ihres Bruders zum Glück nicht gehört zu haben, denn er war bereits wieder damit beschäftigt, Speckstreifen in der riesigen Pfanne anzubraten, die immer wieder gewendet werden mussten.
Dann war Friedhelm also tatsächlich beim Eislaufen. Enttäuscht und traurig zugleich, nahm sie die beiden Weinkrüge entgegen, die Rosina ihr reichte, und folgte ihr zurück in den Gastraum. In ihrer Vorstellung hatte sie sich schon Hand in Hand mit ihm ihre Kreise ziehen sehen. Daraus wurde nun nichts. Aber vielleicht gab es ja bald schon eine andere Gelegenheit, um mit ihm eislaufen zu gehen.
Fast erschrocken über ihre Gedanken stellte sie die Krüge am Stammtisch ab. War sie etwa verliebt in den Schulmeister? Der eher nachdenkliche, manchmal ein wenig linkisch wirkende Friedhelm war ihr früher nie groß aufgefallen, und wenn, dann, weil er sie in Kinderzeiten manchmal aufgezogen hatte wegen ihrer ungestümen, jungenhaften Art. Wahrscheinlich hielt er sie noch immer für einen reichlichen Kindskopf. Andererseits hatte er an Kirchweih mit ihr getanzt, und sie bekam jetzt noch Herzklopfen, wenn sie daran zurückdachte. Sofort sah sie sein schmales, bartloses Gesicht mit dem ewig verstrubbelten strohblonden Haar wieder vor sich. Mit seinen tiefblauen Augen hatte er sie die ganze Zeit angesehen, und sie hätte den ganzen Abend mit ihm weitertanzen mögen. Zumal er ein sehr guter Tänzer war. Der Vater hatte hinterher eine abfällige Bemerkung über den allzu jungen Schulmeister gemacht, dem das Tanzen wohl leichter fiele, als seinen Kindern lesen und schreiben beizubringen, und hatte ihn wieder einmal einen Reingeschmeckten genannt. Obwohl Friedhelm doch hier geboren war, seine Mutter Agnes vom hinteren Maierhof stammte und nur sein Vater aus Urach zugezogen war, um das Amt des Schulmeisters anzutreten.
«Ach herrje, die arme Paulina», hörte sie mit halbem Ohr den jüngeren der Pinache-Brüder ausrufen. «Jetzt muss die schöne Jungfer für uns so schwer schleppen.»
«Da hast du recht, Robert», pflichtete ihm Lorenz Stumpp bei. «Vor allem was das schön betrifft. Ich wette, liebe Paulina, du hast an jeder Hand zehn Verehrer.»
Sie ging mit einem höflichen Lächeln über die Schmeicheleien der Stammtischbrüder hinweg und beeilte sich, in die Küche zurückzukehren, von wo schon die Schelle für die nächste Bestellung geklingelt hatte. Vor allem die Artigkeiten des Dorfmetzgers gingen ihr gegen den Strich, erst recht, seitdem er sich letztes Jahr ausbedungen hatte, dass sie ihn mit Vornamen und Du anreden solle. Sie mochte den untersetzten Mann mit dem Stiernacken nicht besonders, der den Vater seinen besten Freund nannte und mit Fleisch- und Wurstwaren belieferte. Anfangs hatte er ihr noch ein wenig leidgetan, da seine Frau vor drei Jahren mitsamt dem Neugeborenen im Kindbett verstorben war und er sich allein um seinen fünfjährigen Sohn kümmern musste, doch inzwischen fand sie, dass er sich allzu viele Vertraulichkeiten herausnahm.
Als endlich die letzten Gäste die Schankstube verließen – Lorenz mit einem lautstarken Gruß in Richtung Paulina –, schlug es von Sankt Alban ein Uhr, und in der Küche türmten sich Berge von Geschirr, Töpfen und Pfannen. Das wüste Durcheinander wieder in Ordnung zu bringen, war nun Aufgabe der Frauen, während sich der Vater und der Bruder eine Ruhepause bei einem Pfeifchen Tobak am Kachelofen gönnten, wobei der Vater in den neuesten Zeitungen zu lesen pflegte.
Es war gegen zwei Uhr, als eine große Schüssel mit sauren Kutteln und Pfannenkuchenstreifen auf dem Tisch stand. So spät hatten sie schon lange nicht mehr zu Mittag gegessen.
«Na, wenn das heute kein umsatzträchtiger Neujahrstag war», brummte der Vater zufrieden und legte das Ulmer Intelligenzblatt beiseite.
«Sind das die Zeitungen vom heutigen Postwagen?», fragte die Mutter, während sie Teller und Löffel verteilte.
«Ja, sozusagen postfrisch.»
«Was gibt es denn Neues aus der Welt?»
Der Vater lehnte sich zurück, wobei seine ärmellose Strickweste über dem mächtigen Bauch spannte. «Ach, wieder das übliche Lamento über die unerträgliche Schuldenlast unseres kriegsgebeutelten Staates und die Folgen der abgebrochenen Handelsbeziehungen und der verlorenen Märkte. Aber immerhin auch ein Lob über die neue Friedensordnung. Alle sagen, dass mit Fleiß und Zuversicht die Geschäfte alsbald wieder in Gang kommen werden.» Er erhob seinen Bierkrug. «Das will ich meinen, so gut, wie das neue Jahr heute angefangen hat. Und jetzt kommt endlich alle zu Tisch, ich habe Hunger!», rief er in Richtung Küche, wo Rosina und die alte Köchin Agathe noch immer geräuschvoll hantierten.
«Warte.» Die Mutter deutete auf die abgelegte Zeitung. «Es steht doch bestimmt wieder eine Poesie zum neuen Jahr darin.»
«Ach, ihr Frauen. Euch interessiert wieder mal nur das Schöngeistige.» Er reichte ihr das Blatt.
Sie kniff ein wenig die Augen zusammen, als sie die Zeilen und Spalten überflog. Paulinas Mutter war eine zierliche Frau, die in jüngeren Jahren ausnehmend hübsch gewesen war. Inzwischen aber hatten sich rechts und links ihrer Mundwinkel zwei tiefe Falten eingegraben, und das Haar wirkte schütter und farblos.
«Ah, da ist das Gedicht ja. Ich lese es euch vor.»
Mit ihrer etwas dünnen Stimme begann sie, die Zeilen vorzutragen:
Aufgeheitert durch die Hoffnung froher Zeiten
Lächelt uns ein neues Jahr heut freundlich zu.
Leidensfrei wird endlich es für uns bereiten
Eines dauerhaften Glückes süße Ruh.
«Das ist schön», entfuhr es Paulina, und sie nickte ihrer Mutter zu.
«Nicht wahr? Und nun lasst uns das Tischgebet sprechen.»
Paulina hatte sich getäuscht – zum Schlittschuhfahren sollte es nicht mehr kommen. Schon am Tag nach Neujahr war ein heftiger Sturm übers Land gebraust, der Tauwetter gebracht hatte. Das Eis auf dem Dorfteich wurde erst sulzig, dann verschwand es ganz.
Viel zu mild zeigte sich der Januar. Stürme wechselten sich mit tagelangen Regengüssen ab, sodass man kaum noch vor die Haustür wollte, wenn es denn nicht sein musste. Frost gab es keinen mehr, dafür drohte nach wochenlangem Regen die Wintersaat auf den Äckern zu ersaufen, die Kutschen und Fuhrwerke blieben im Schlamm stecken, und die Brotpreise wurden zum zweiten Mal binnen eines halben Jahres heraufgesetzt. Doch Paulina hatte ganz andere Sorgen: Mittlerweile erschien der Dorfmetzger jeden Sonntag bei ihnen im Gasthaus zum Mittagessen, wobei er auffallend modisch gekleidet war: Statt des üblichen brauntuchenen Sonntagsrocks der Männer trug er nun einen schicken gelben Gehrock, statt des braunen Kamisols eine neumodische, bunt gestreifte Seidenweste, und das Brusttuch war ebenso schreiend rot wie seine Wollstrümpfe unter der ledernen Kniebundhose. Den Vollbart hatte er neuerdings zu einem akkuraten Backenbart gestutzt, mit dem er sein fleischiges Gesicht wohl schmaler wirken lassen wollte.
Die letzten beiden Male war er so spät gekommen, dass er zusammen mit der Gutjahr-Familie bei Tisch saß und diese Vertraulichkeit sichtlich genoss. Paulina nahm sich vor, mit ihrer Mutter zu reden, ob das denn nicht wieder zu ändern sei. Schließlich gehörte dieser Lorenz weder zur Familie noch zum Gesinde. Was sie ihrer Mutter nicht sagen würde, war, dass sie seine Blicke förmlich an sich kleben spürte, sodass ihr gänzlich der Appetit verging. Wie sehr hätte sie sich gerade jetzt gewünscht, dass Friedhelm nach seinem Feierabend die Gaststube besuchte, um in der Zeitung zu lesen. Nicht ein einziges Mal hatte er sich bisher bei ihnen blicken lassen. Lag ihm also doch nichts an ihr?
Erst zum Sankt Valentinstag, nach fast sechs Wochen Regenwetter, hatte der Herrgott ein Erbarmen und bescherte ihnen wieder Sonne. Das ganze Pfarrdorf zog am frühen Nachmittag hinaus auf die Felder, um die Schäden zu besehen, denn ein jeder hier besaß ein Stück Land, und selbst der ärmste Taglöhner bewirtschaftete sein Äckerle, das ihm als sogenanntes Bürgerteil auf der Allmende zur Verfügung stand.
«Was ist? Kommst du nicht mit?», fragte Rosina, während Paulina sich aus dem weit geöffneten Fenster der Gaststube lehnte und das Treiben auf der Straße beobachtete.
«Was soll ich mir die überschwemmten Felder angucken und dabei nasse Füße holen?», gab sie ein wenig unwillig zurück. Andererseits verlockte die ungewöhnlich warme Nachmittagssonne schon dazu, ins Freie zu gehen. Auch wenn ihr das mit den Sonnenflecken zu denken geben hatte, von denen neuerdings die Zeitungen berichteten. Und dem aufdringlichen Metzger wollte sie dort draußen auch nicht begegnen.
Da fiel ihr ein, dass Friedhelm und seine Mutter das kleinere ihrer beiden Feldstücke gleich bei dem großen Gerstenfeld der Gutjahrs hatten.
«Warte auf mich, Rosina», rief sie der Schankmagd zu, die gerade den Hof überquerte. «Ich will nur eben noch Stiefel und Jäckchen anziehen.»
«Hast es dir also doch anders überlegt?», schmunzelte Rosina, als sich Paulina wenig später zu ihr gesellte. Täuschte sie sich, oder hatte das Schankmädchen den Grund für ihren Meinungsumschwung durchschaut? Ihr Herz begann jedenfalls augenblicklich schneller zu schlagen, kaum dass sie sich auf den Weg gemacht hatten.
Kapitel 4
Am selben Tag, Sankt Valentin im Februar 1816
Hohenstetten war ein recht großer Marktort mit über tausend Seelen und von weitläufiger Markung. Die zumeist strohgedeckten Weberhäuser mit ihren Scheunen, Ställen und Krautgärten duckten sich in einer leichten Senke, mit der Hüle und dem angrenzenden Marktplatz als tiefstem Punkt. Rundum erstreckten sich, über flache Kuppen und Senken hinweg, in alle Himmelsrichtungen die Ackerflure, dünn bewachsene, steinige Grasböden, Wacholderheiden und der Gemeindewald. So war es fast ein Wunder zu nennen, dass das Dinkelfeld der Lindenthalers direkt an die Wintergerste der Gutjahrs grenzte, die nun genau wie Friedhelm in ihren klobigen, schlammbespritzten Arbeitsstiefeln durch den Matsch stapften. Alwine Gutjahrs Lamentieren war dabei weithin zu hören. Friedhelm hatte seine Mutter erst gar nicht mitgenommen. Er wollte ihr den trostlosen Anblick der im Wasser stehenden Wintersaat ersparen.
Wieder hörte er die Postwirtin jammern, bis ihr Mann ihr beschied, sie solle endlich still sein, allen anderen erginge es schließlich ebenso. Womit der Schultes vollkommen recht hatte. Jeden hier beschäftigte wohl im Augenblick eine einzige Frage: ob die warmen Tage andauern würden, damit die Felder abtrocknen konnten. Ansonsten würde die Saat unweigerlich verfaulen.
Dabei hatten die Gutjahrs noch Glück, zumindest was diesen Teil ihrer Ackerflächen betraf. Ihr Grund besaß eine leichte, gleichmäßige Neigung zum Feldweg hin, sodass das Wasser an normalen Regentagen gut abfließen konnte. Friedhelms Dinkelfeld hingegen mündete in eine kaum sichtbare Senke, in der sich jetzt ein rechter See gebildet hatte.
Mit einigem Widerwillen trat er an den Rand des Wassers, nahm den Spaten von der Schulter und begann zu graben.
Vom nahen Feldweg her winkten ihm seine Schwester Auguste und Schwager Emil zu, die in der Nähe ihren Krautacker hatten.
«Wir gehen gleich weiter zu unserem Winterroggen. Kommst du allein zurecht?», rief seine Schwester.
«Ja, es geht schon.»
In Wirklichkeit fragte er sich zum zigsten Male, warum sein Vater damals diesen so ungünstig gelegenen Acker überhaupt dazugekauft hatte. Seit er zurückdenken konnte, hoben sie hier Jahr für Jahr aufs Neue Abflussgräben aus, aber was es nutzte, das lag auf der Hand: nämlich gar nichts. Angeblich war der Boden besonders fruchtbar, doch Friedhelm war zu wenig Landmann, um das beurteilen zu können. Wohl aber hatte er gesehen, dass der Ertrag der letzten Jahre hier auch nicht besser gewesen war als auf den anderen Feldern.
Im Augenwinkel nahm Friedhelm wahr, dass die Gutjahrs weiterzogen, in Richtung Eichhalde, wo sich ihr größtes Feldstück befand. Dass Paulina nicht mitgekommen war, hatte ihn noch verdrießlicher gemacht. Wäre ihr nur ein kleines bisschen an ihm gelegen, hätte sie die Gelegenheit genutzt, um wie alle im Ort hinauszugehen und die Schäden zu besichtigen. Zumal sie sicher sein konnte, dass er hier war. In diesen Regenwochen hatte er sie lediglich zwei-, dreimal von Weitem gesehen, jedes Mal in der Nähe des Schulbecks, der so hieß, weil er seine Bäckerei neben dem Schulhaus hatte. Besser, er schlug sie sich ein für alle Male aus dem Kopf. Schließlich war sie ja auch an Neujahr nicht zum Eislaufen gekommen, obwohl Luise ihm erzählt hatte, dass Paulina sich hierfür mit ihr eigens verabredet habe. Tagelang hatte er sich gegrämt darüber, schließlich bot sich die Gelegenheit, sich unbefangen zu begegnen, nicht alle Tage. Schon gar nicht im Winter, wenn sich jeder ins Haus zurückzog. Und mit dem verdammten Regenwetter der letzten Wochen war es nicht besser geworden.
Er hielt inne, um sich Umhang und Kamisol aufzuknöpfen. Was war das nur plötzlich für eine Wärme! Gerade so, als würde einem ein riesiges Pferd seinen warmen Atem ins Gesicht blasen. Das war schon mehr als unnatürlich für Mitte Februar.
Der Graben begann sich mit dem schlammigen Regenwasser zu füllen. Er wollte einen Schritt zurücktreten, als sein linker Fuß wie festgesogen steckenblieb und sein Stiefel prompt voll Wasser lief.
«Mist!», entfuhr es ihm. Er warf den Spaten neben sich, zog mit beiden Händen den Fuß aus dem Morast und rettete sich auf die kleine Uferböschung des Feldweges. Immerhin lief das Wasser nun ab.
«Hast du nasse Füße bekommen?»
Er fuhr herum. Hinter ihm stand Paulina mit der Schankmagd. So peinlich es ihm war, dass sie sein Missgeschick mit angesehen hatte, so sehr freute er sich, sie wiederzusehen. Sie war also doch gekommen! Bildete er es sich ein, oder strahlten auch ihre Augen?
«Grüßt euch», sagte er verlegen. «Deine Familie, liebe Paulina, ist übrigens schon weiter zur Eichhalde.»
«Ach ja?» Sie wandte sich der Schankmagd zu. «Gehst du voraus und sagst, dass ich gleich nachkomme?»
Rosina nickte und schickte sich an weiterzugehen, als Paulina fortfuhr: «Nein, warte. Sag ihnen, dass ich zurück nach Hause muss, weil ich nasse Füße bekommen habe.»
Sie tat einen ungeschickten Schritt und patschte nun ebenfalls in den Graben.
Die Magd lachte laut auf, dann nickte sie erneut und machte sich auf den Weg.
Mit großen Augen sah Friedhelm Paulina an. «War das mit Absicht?»
«Nun ja, jetzt haben wir eben beide nasse Füße. Um ehrlich zu sein, habe ich keine Lust auf die ewigen Klagen meiner Mutter und auf die großsprecherischen Worte von Ludwig. Es ist so ein herrlicher Tag heute. Fast wie im Frühsommer.»
Bei ihren letzten Worten schloss sie die Augen und hielt ihr Gesicht in die warme Sonne. Sie sah dabei so schön aus, dass es Friedhelm die Kehle zuschnürte.
«Wie schade, dass du zurückwillst», brachte er schließlich hervor.
Sie öffnete wieder die Augen. «Aber das habe ich doch nur so gesagt. Musst du noch zu eurem anderen Acker?»
«Eigentlich schon. Ach, was soll’s – das kann ich auch morgen machen. Wollen wir … wollen wir ein wenig spazieren gehen?»
«Mit nassen Stiefeln?» Sie lachte. «Gehen wir lieber zu den Sandgruben beim Buchenhain. Dort ist es sonnig, und wir können unsere Stiefel trocknen.»
Jenseits des Feldweges stapften sie die Magerwiesen von Bauer Schwenk hinauf, dem reichsten Maierbauern im Ort. Am Waldrand bogen sie nach rechts ab, bis sie die aufgegebenen Sandgruben erreichten. Der Weg dorthin hatte vielleicht eine halbe Stunde gedauert, während der sie kaum ein Wort gesprochen hatten. Dass er plötzlich allein war mit ihr, an diesem schönen Tag und draußen in der freien Natur, raubte Friedhelm schier den Verstand. Sein Herz schlug so heftig, dass er glaubte, sie müsse es hören.
In der sonnenbeschienenen Senke war die Luft noch wärmer als unten am Feld, und sie setzten sich auf einen der breiten, fast weiß schimmernden Feldsteine. Dies in so großem Abstand, dass noch zwei Kinder zwischen ihnen Platz gehabt hätten. Er hätte sie gerne so vieles gefragt, brachte aber noch immer kein Wort heraus. Stattdessen folgte er ihrem Beispiel und zog sich Schuhe und Strümpfe aus, um sie auf dem sandigen Boden auszulegen, dessen Oberfläche bereits abgetrocknet war. Dann betrachteten sie stumm, Seite an Seite, das sanft gewellte Land rund um ihr Heimatdorf. Selbst aus dieser Entfernung war zu erkennen, dass auf den Fluren überall das Wasser stand. Auch die kleine, kreisrunde Hüle zu ihrer Rechten, die den Pferden bei der Feldarbeit als Tränke diente, war randvoll gelaufen.
«Was waren das nur für schreckliche Wochen», durchbrach er irgendwann die Stille und blickte scheu zu ihr hinüber. «Man hätte grad meinen können, die Sintflut hätte eingesetzt. Und jetzt diese plötzliche Wärme.»
Eine Sorgenfalte zeigte sich auf ihrer glatten Stirn.
«Heute nach dem Mittagessen hat mein Vater uns aus dem Schwäbischen Merkur vorgelesen. Dass an der Sonne immer mehr Flecken zu sehen wären. Und dass in Kreisen der Wissenschaft die Rede davon ist, dass die Sonne schwächer wird. Du kannst dir vorstellen, wie es meine Mutter sogleich mit der Angst zu tun bekommen hat: Das wäre das Ende der Welt, jetzt endlich würden wir den Zorn Gottes zu spüren bekommen! Schon das mit dem rötlichen Schnee zu Beginn des Winters hatte ihr große Angst gemacht.»
Friedhelm wusste, dass Alwine Gutjahr zu den besonders frommen Frauen im Dorf zählte, die sich mehrmals die Woche zum Gebetskreis trafen.
«Ach Paulina», versuchte er sie zu beruhigen. «Schon seit Ewigkeiten scheint die Sonne auf uns herunter und wird es noch auf ewig weiter tun.»
«Aber ich hab diese Flecken selbst gesehen. In der Zeitung stand, dass man mit einer gerußten Glasscherbe in die Sonne schauen dürfe, was ja ansonsten das Augenlicht zerstört, und mein Bruder hat es prompt ausprobiert. Wir alle haben hindurchgesehen, bloß meine Mutter nicht. Und sämtliche Nachbarn, die auf der Straße standen, haben es uns nachgemacht. Wir waren alle ganz schön erschrocken.»
Als sie ihm während ihrer Rede direkt in die Augen blickte, wurde ihm warm ums Herz.
«Und was genau habt ihr gesehen?», fragte er und hätte am liebsten ihre Hand genommen.
«Nun, eben seltsame Flecken. Für mich haben sie ausgesehen wie ein grimmiges Gesicht.»
Da musste er lachen. «Das wird der Teufelskerl Napoleon gewesen sein, den man nun auf die Sonne verbannt hat, damit er dort auf ewig im Feuer schmort.»
«Du machst dich über mich lustig!»
«Aber nein. Solche Flecken gab es schon immer auf der Sonne, und trotzdem ist sie nie erloschen. In einem Buch über die Welt und das Universum habe ich einmal gelesen, dass diese Flecken sogar eine stärkere Aktivität unseres Sonnengestirns anzeigen. Also nichts mit Erlöschen, wie man an diesem warmen Tag heute ja auch wahrhaftig spürt. Du musst dich wirklich nicht beunruhigen.»
Jetzt ergriff er tatsächlich ihre Hand und drückte sie kurz. «Glaubst du mir?»
«Ja», erwiderte sie und streckte ihre Beine unter dem langen Rock aus, sodass ihre nackten Füße unter dem Saum zu sehen waren. Sie waren zierlich und schmal, und er musste sich zwingen, den Blick wieder abzuwenden.
Lange Zeit sprachen sie kein Wort, aber jetzt war es ein angenehmes Schweigen. Ein sehr vertrautes Schweigen. Es war wunderschön, so ganz allein mit ihr hier zu sitzen. Das Dorf, seine von Sorge erfüllten Bewohner, die kränkelnde Mutter – alles schien weit weg.
Er blickte zum Himmel, der noch immer wolkenlos war. Indessen nicht blau, wie sonst an klaren Wintertagen, sondern mit einem Dunstschleier überzogen.
«Warum bist du eigentlich niemals zum Zeitunglesen zu uns gekommen?», hörte er Paulina fragen.
«Na ja …» Er zögerte. «Ich hatte viel um die Ohren in den letzten Wochen. Du weißt ja, dass ich noch immer allein unterrichten muss, weil sich kein Hilfslehrer findet, und dann ist da noch das Messneramt und der Kirchenchor.»
Das stimmte zwar, und mehrmals die Woche arbeitete er noch dazu am zweiten Webstuhl von Schwager Emil. Aber das war eben nicht die ganze Wahrheit. Auf ein Bier ins Wirtshaus – dazu hätte er allemal hin und wieder die Zeit gefunden. In Wirklichkeit hatte er sich nicht getraut und sich eingeredet, dass Paulina ihn aufdringlich finden würde.
«Das ist schade», sagte sie leise. «Ich hätte dich gerne mal wiedergesehen. Ich hab unser Brot sogar eigens beim Schulbeck gekauft statt wie sonst in der Marktbäckerei. Aber ich bin dir nie begegnet.»
«Wirklich?» Überrascht und erfreut zugleich sah er sie an.
In diesem Augenblick krachte es hinter ihnen wie Kanonendonner. Erschrocken fuhren sie beide herum. Eine schwarze Wolkenwand ragte im Westen steil in den Himmel und begann sich vor die Sonne zu schieben. Schlagartig erhob sich ein starker, kalter Wind, und der erste Blitz fuhr durch die Wolken.
«Ein Gewitter! Wie kann das sein, mitten im Februar?» Paulina war aufgesprungen. «Wir müssen rasch ins Dorf zurück.»
«Das schaffen wir nicht mehr. Komm, laufen wir zum Hohlen Stein.»
Eilends rafften sie Stiefel und Strümpfe an sich und rannten barfuß los. Als sie den Waldrand erreichten, war das Unwetter schon genau über ihnen. Blitz und Donner wechselten sich ab, der Regen peitschte ihnen in dicken Tropfen ins Gesicht, die Äste der Eichen und Buchen über ihnen ächzten bedrohlich im Sturm.
Der Eingang zum Hohlen Stein lag als langgestreckter, mannshoher Spalt in einer Senke. Kurzerhand nahm Friedhelm sie bei der Hand und half ihr den vom Regen rutschig gewordenen Abhang hinab. Gerade noch rechtzeitig, bevor sich der Regen in Hagel verwandelte, erreichten sie die Höhle, die sich hinter dem Eingang als große Halle auftat.
«Das war knapp», murmelte er und ließ sie los. Inzwischen tobte der Gewittersturm mit unbändiger Kraft, es schien vorzeitig Nacht werden zu wollen, und sie waren beide tropfnass. Aber hier waren sie wenigstens in Sicherheit.
«Hast du Angst?», fragte er sie, während sie mit bangem Blick nach draußen starrte, wo ein Blitz nach dem anderen die Bäume vor dem schwarzen Himmel in gleißendes Licht tauchte.
«Nein, jetzt nicht mehr.»
Mit einem Mal hatte er alle Schüchternheit verloren.
«Es ist sehr schade, dass du an Neujahr nicht beim Eislaufen warst. Stundenlang hab ich meine Kreise gezogen, weil ich gehofft hatte, du kommst noch.»
«Ich wäre sehr gerne gekommen», erwiderte sie leise. «Aber mein Vater hat mich nicht weggelassen. Wir hatten zu viele Gäste.»
Er holte tief Luft. «Was kann ich tun, damit wir beide uns öfters sehen?»
Sie zwinkerte ihm zu. «Beim lieben Gott schönes Wetter bestellen, damit man wieder mehr aus dem Haus kommt.»
«Nun ja, wenn Gott jedes seiner Schäfchen erhören würde – was wäre das für ein tägliches Durcheinander beim Wetter.»
Sie lachten beide.
Er strich ihr die nassen Locken aus dem Gesicht und konnte nicht anders, als sie zu seiner eigenen Verblüffung sachte auf die Stirn zu küssen..
«Verzeih … entschuldige …», stotterte er verlegen.
Auch Paulina wirkte verlegen, aber ihre Augen strahlten ihn an. «Setzen wir uns dort drüben auf den Felsvorsprung und warten, bis der Gewittersturm vorbei ist.»
Er nickte, nahm ihr und sich selbst den nassen Umhang ab und breitete alles über einem starken Ast aus, den jemand in die Höhle geschleppt hatte. Dann zog er sein Kamisol aus, legte es als weiche Unterlage über den Felsvorsprung und bat sie, sich zu setzen.
«Sind dein Kleid und deine Jacke wenigstens trocken geblieben?», fragte er sie besorgt. Dass sie ihm den vorwitzigen Kuss nicht übelgenommen hatte, erleichterte ihn ungemein.
«Ja, und kalt ist mir auch nicht.» Im Halbdunkel konnte er sehen, wie sie lächelte. «Fast schon gemütlich haben wir es hier.»
Er nahm noch einmal allen Mut zusammen. «Das mit dem Sich-öfter-Sehen … das ist mir ernst. Du könntest mich vielleicht in der Schule unterstützen.»
«Ach Friedhelm – wo gibt es denn so etwas? Eine Frau als Volksschullehrerin! Das Unterrichten erlaubt man doch allenfalls dem alten Weib eines Schulmeisters.»
«Nun ja, ich dachte auch eher an die Gesangsstunden. Ich schaffe es einfach nicht, den Kindern die richtigen Melodien beizubringen.»
Sie lachte. «Das habe ich beim Neujahrsumgang gemerkt.»
«Wirklich? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich hoffnungslos unmusikalisch bin. Ich treffe beim Singen kaum den richtigen Ton, und in der Kirche schaffe ich es mit Mühe und Not, einhändig die alte Orgel zu bedienen. Und das, wo ich zu Hause ein Cembalo habe, von meinem Vater geerbt. Aber bei mir ist in dieser Hinsicht Hopfen und Malz verloren.»
In Wirklichkeit war ihm der Gesangsunterricht herzlich gleichgültig, und der Männerchor kannte die Kirchenlieder ohnehin in- und auswendig. Er fand es viel wichtiger, den Knaben und Mädchen ordentlich Lesen, Schreiben und Rechnen beizubringen, ihnen einen Einblick in die Welt und in den Glauben zu geben und aufrichtige, rechtschaffene Menschen aus ihnen zu machen.
«Warum übernimmt das dann nicht der Herr Pfarrer?», fragte sie.
«Der hat schon genug Aufgaben mit der Schulaufsicht und dem Kirchenkonvent. Und Bibelunterricht und Christenlehre obliegen ihm ja auch noch.»
«Was ist mit seiner Frau?»
«Die gibt bei den Mädchen schon die Handarbeitsstunden. Nein, ich habe bei der Musik an dich gedacht. Du hast solch eine schöne, klare Stimme, und bei der Tauffeier des kleinen Eduard im letzten Sommer habe ich dich im Gasthaus Klavier spielen hören. Es klang wunderbar.»
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. «Das ist nichts, wenn ich es mit dem Spiel meiner Mutter vergleiche.» Sie machte eine Pause. «Weißt du, ich würde das schon gerne machen, das mit den Gesangsstunden, aber der Kirchenkonvent würde dem niemals zustimmen, auch mein Vater nicht, der ja dort Mitglied ist.»
Das hatte Friedhelm nicht bedacht, und wahrscheinlich hatte Paulina recht.
«Aber», fuhr sie fort, «da gäbe es noch eine andere Möglichkeit. Wenn du in der Lage wärst, die Kinder beim Singen zu begleiten, lernen sie die Lieder viel schneller. Ihr habt doch im Klassenzimmer ein Harmonium stehen. Ich könnte dir also Klavierstunden geben, nachmittags, wenn wir die Gaststube geschlossen haben und du keinen Unterricht hast. Zu Hause müsstest du dann allerdings auch fleißig üben», fügte sie keck hinzu.
Dieser Einfall klang noch viel verlockender, und er sah sich schon dicht neben ihr am Klavier sitzen. Dann schüttelte er den Kopf.
«Das würde dein Vater erst recht nicht erlauben.»
«Aber meine Mutter. Sie findet dich ganz sympathisch, das weiß ich. Und wenn wir uns an Anstand und Schicklichkeit halten, wird sie sich beim Vater dafür einsetzen. Gerade an Kirchenmusik liegt ihr sehr viel, und sie wird das für eine wichtige Aufgabe halten. Sie wird natürlich dabei sein wollen, aber da sie oft bei ihren Gebetsschwestern ist, wird halt», dabei zwinkerte sie verschwörerisch, «hin und wieder Rosina als Anstandswächterin herhalten müssen.»
«Dann fragst du deine Mutter also?»
«Aber ja, heute noch.»
Er glaubte zu träumen. Das war mehr, als er in den letzten Wochen und Monaten zu hoffen gewagt hatte. Er suchte nach Worten, um seine Freude auszudrücken, doch sie sprach schon weiter.
«Was ist eigentlich aus Gottlob geworden? Warum hatte er letzten Sommer seine Stellung als Hilfslehrer hingeworfen und ist nach Stuttgart gegangen? Er ist doch dein bester Freund. Oder habt ihr euch gestritten?»
Gottlob, der älteste Sohn von Pfarrer Unterseher, war einer der klügsten Menschen, die Friedhelm kannte. Ihm war in der Schule ohne große Anstrengung alles zugeflogen. Sie beide hatten nicht nur zusammen die vier Jahre an der Lateinschule in Münsingen verbracht, sondern auch die Zeit in Maulbronn und am Lehrerseminar Esslingen. Zum großen Kummer seines Vaters hatte Gottlob nie die Laufbahn eines Pfarrers einschlagen wollen, sondern Lehrer werden wie er selbst. Da Gottlob ein wenig jünger als Friedhelm war, hatte er sein Examen als Volksschullehrer ein Jahr später absolviert und war dann ebenfalls nach Hohenstetten zurückgekehrt, um die Stelle als Provisor anzunehmen und die kleine Wohnung im Schulhaus zu beziehen. Anfangs hatte Friedhelm gefürchtet, sein Freund würde sich schwertun, eine ihm untergeordnete Stellung anzunehmen, doch das war es nicht, was ihn veranlasste, dem Dorf den Rücken zu kehren. Gottlob war ein Zweifler und Grübler, Ungerechtigkeiten konnten ihn schier rasend machen. Als dann im letzten Sommer nach einer neuerlichen schwachen Ernte die Lebensmittelpreise weiter anstiegen, während König Friedrich in der Residenzstadt Stuttgart Unsummen für seinen Hofstaat verprasste, wurden seine Gedanken immer aufrührerischer. Ein entschiedener Gegner des Königs war er schon vorher gewesen und hatte Friedrich als Tyrannen und Despoten gebrandmarkt. Als einen, der mit harter Hand regiere, mit seiner rücksichtslosen Jagdleidenschaft allerorten der Landwirtschaft schade und für seine üppige Hofhaltung die Untertanen mit hohen Steuern bluten lasse, selbst in diesen schwierigen Zeiten. Nicht zuletzt hätte Friedrich, in seiner Gier nach neuen Territorien und der Königskrone, Zigtausende Männer als Kanonenfutter für seinen Bundesgenossen Napoleon geopfert.
Friedhelm hatte genügend solcher hitzigen Dispute im Pfarrhaus, in Gottlobs kleiner Wohnstube oder bei sich zu Hause miterlebt, um zu wissen, dass sein Freund sich in seinem Eifer mehr und mehr auf gefährlich dünnem Eis bewegte. «Die Not des Volkes schert diesen König von Napoleons Gnaden keinen Deut, solange er sich nur fetter und fetter fressen kann. Und es wird noch viel schlimmer werden, das prophezeie ich dir», hatte er Friedhelm mehr als einmal gesagt und ihm am Ende sogar vorgeworfen, den Kopf in den Sand zu stecken und es sich in diesem weltabgeschiedenen Flecken namens Hohenstetten allzu behaglich einzurichten. In vielem waren sie sich zwar einig, aber Friedhelm sah sich schlicht und einfach nicht zum Rebellen berufen, sondern wollte im Kleinen für Gerechtigkeit sorgen. So hatten sie sich, obwohl bis dahin beste Freunde, tatsächlich nach der letzten Ernte zerstritten, und bald darauf hatte Gottlob sein Bündel gepackt, um sich in Stuttgart Menschen anzuschließen, die nicht mehr nur reden, sondern etwas tun wollten. Seither hatte er nie wieder von ihm gehört, wusste aber von dessen Schwester Luise, dass es ihm gut ging und er mit Gelegenheitsarbeiten sein Auskommen hatte.