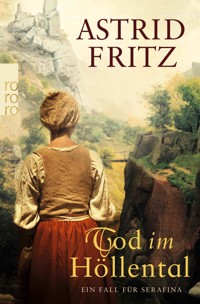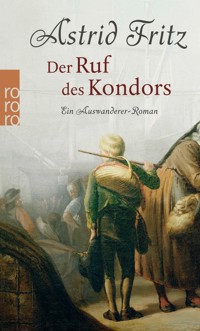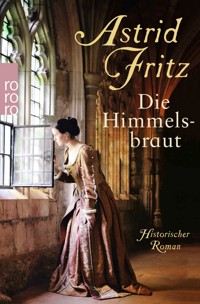9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Packend und modern: spannende Medizingeschichte von der Erfolgsautorin der großen historischen Romane «Turm aus Licht» und «Der dunkle Himmel». Eine starke, wissbegierige junge Frau und der bedeutende Arzt Paracelsus, der bis heute unser Verständnis einer ganzheitlichen Lehre von Körper und Seele prägt. Ausgerechnet in den Dienst des buckligen Stadtarztes von Basel soll Barbara gehen. Als Tochter eines als unehrenhaft geltenden Abdeckers bleibt ihr keine andere Wahl. Mit ihrer patenten und pragmatischen Art ist die junge Frau das Gegenteil ihres neuen Herrn Paracelsus. Sein Zuhause ist die Wissenschaft, die Medizin, die Lehre. Wegen seiner unkonventionellen Methoden und der aufbrausenden Art wird er jedoch immer wieder angefeindet. So sind sie beide Außenseiter. Bald lernt die Magd den Arzt zu schätzen und ist fasziniert von den Geheimnissen des menschlichen Körpers. Doch dann muss Barbara sich entscheiden, ob sie weiter zu ihm halten kann – und was ihr eigenes Ziel im Leben ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Astrid Fritz
Die Magd des Medicus
Historischer Roman
Über dieses Buch
Eine starke, wissbegierige Frau und der weltberühmte Arzt Paracelsus
Ausgerechnet in den Dienst des buckligen Stadtarztes von Basel soll Barbara gehen. Als Tochter eines als unehrenhaft geltenden Abdeckers bleibt ihr keine Wahl. Mit ihrer patenten Art ist die junge Frau das Gegenteil ihres neuen Herrn Paracelsus. Sein Zuhause ist die Wissenschaft, die Medizin und die Lehre. Wegen seiner unkonventionellen Methoden und aufbrausenden Art wird er jedoch immer wieder angefeindet. So sind sie beide Außenseiter. Bald lernt die Magd den Arzt zu schätzen und ist fasziniert von den Geheimnissen des menschlichen Körpers. Doch dann muss Barbara sich entscheiden, ob sie weiter zu ihm halten kann – und was ihr eigenes Ziel im Leben ist.
Lebendige Medizingeschichte von der Erfolgsautorin Astrid Fritz: Paracelsus prägt bis heute unser Verständnis einer ganzheitlichen Lehre von Körper und Seele.
Vita
Astrid Fritz studierte Germanistik und Romanistik in München, Avignon und Freiburg. Als Fachredakteurin arbeitete sie anschließend in Darmstadt und Freiburg und verbrachte mit ihrer Familie drei Jahre in Santiago de Chile. Zu ihren großen Erfolgen zählen «Der Turm aus Licht», «Die Hexe von Freiburg» und «Die Tochter der Hexe». Astrid Fritz lebt in der Nähe von Stuttgart.
Mehr über Astrid Fritz auf www.Astrid-Fritz.de.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2023
Copyright © 2023 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke
Coverabbildung akg-images: Shutterstock
ISBN 978-3-644-01507-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Kapitel 1
Zu Basel, Mitte März Anno Domini 1527
Wann immer das Wetter es erlaubte, standen die beiden Flügel des Holztors weit offen, auch an diesem freundlichen, milden Frühlingstag. Was nichts daran änderte, dass die Luft in der Schindhütte durchdrungen war von den süßlichen Geruchsschwaden nach Blut, frischen Tierhäuten und dem Fett, das heute im Kessel über der gemauerten Feuerstelle zischte und dampfte. Bei Kadavern, die größer als eine Katze waren, lohnte es sich nämlich, aus den Eingeweiden Schmalz und Talg für die Seifensieder und Lichterzieher auszulassen, sofern der städtische Jägermeister sie nicht als Aas für die Wolfsjagd benötigte.
Jeder Nachbar hätte wahrscheinlich laut geflucht über den Gestank, den die Abdeckerei verbreitete, vor allem an den Tagen, an denen die Fischhändler ihren alten oder schlechten Fisch zur Vernichtung abluden. Aber die nächsten Häuser waren mehr als einen Steinwurf entfernt, und auf dem Basler Kohlenberg stank es, wie Barbara fand, ohnehin mehr als anderswo in der Stadt.
Sie streckte den Rücken durch und hielt für einen Augenblick in der Arbeit inne. Sehnsüchtig blickte sie hinaus auf die sonnenbeschienene Gasse. An manchen Tagen hasste sie diesen Gestank, der einem in der Kleidung, in den Haaren, zwischen den Fingern klebte. Aber es half ja nichts, wenn man die Tochter des Wasenmeisters war. Da blieben einem nur die Sonn- und Festtage, an denen man sich, frisch gewaschen und im Sonntagsgewand, als halbwegs normaler Mensch fühlen durfte.
«Träumst dich mal wieder fort?», raunzte der Vater sie an, und ihr Bruder grinste frech dazu. Die beiden hatten gerade eine tote, viel zu magere Sau von der Schindkarre auf den langen, glatt geschliffenen Holztisch neben dem Tor gehievt und würden dem Tier gleich mit geübten Schnitten die Haut abziehen, um diese anschließend in dem riesigen Wasserbottich zu waschen.
Barbara streckte Stoffel die Zunge heraus, bevor sie sich mit ihrem scharfen Messer erneut über den Steintrog beugte, in dem ein ganzer Berg von grob zerteilten Fleischstücken lag, während die Eingeweide bereits im Kessel schmorten. Ihre Aufgabe war es, seit der Kindheit schon, für den Leimsieder in der Steinenvorstadt die Knochen, Knorpel und Sehnen aus den blutigen Brocken herauszutrennen. Dass diese zu einem verendeten Kalb gehört hatten, war nicht mehr zu erkennen. Was ihr mehr als recht war, da sie alles, was vier Beine hatte, mochte. Das gesäuberte Fell indessen, hübsch schwarz-weiß gescheckt, hing bereits neben anderen Häuten zum Trocknen über dem Balken.
Das Kalb hatte Stoffel aus der Johannisvorstadt hergekarrt, die sich ein gutes Stück entfernt den Rhein entlangzog. Hier oben auf dem Kohlenberg wäre auch keiner reich genug für ein Kalb oder Schwein, hier hielten sich die Leute höchstens ein paar Hühner, Ziegen oder, wie der Kohlenbergwirt und der Henker, ein Mastschwein. Das dann übrigens am Ende seiner Lebenszeit von ihrem Vater gemetzgt werden würde. Als Abdecker vermochte er das ebenso fachgerecht wie der Metzger vom Heuberg, obwohl es ihm eigentlich nicht erlaubt war. Aber dafür verlangte er auch weniger Lohn, und verraten würde ihn von den Kohlenbergern ohnehin keiner.
Mit leichtem Widerwillen entbeinte sie eine Kalbshaxe, wobei sie immer wieder eine der zahllosen streunenden Katzen verscheuchen musste. Sie wünschte, morgen wäre Sonntag, und sie könnte nach dem Kirchgang am Rheinufer in der Sonne sitzen. Aber heute war erst Mittwoch. Bis in vier Tagen hatte das Wetter bestimmt wieder umgeschlagen, und die ersten warmen Frühlingstage waren vorbei. Ja, da musste man schon die Zähne zusammenbeißen, um nicht mit dem Schicksal zu hadern. Täglich stundenlang in Kadaverstücken herumwühlen, in dieser stinkenden Hütte, das verlangte einem etwas ab. Sie verstand ihren Bruder nicht, der sich jetzt schon darauf freute, eines Tages die Nachfolge des Vaters zu übernehmen.
Als die nahe Leonhardskirche die fünfte Nachmittagsstunde schlug, war sie erlöst. Den Rest würde Stoffel erledigen, da sie als einzige Frau im Haus obendrein für die Haushaltung zuständig war und nun das Abendessen richten musste. Eine Magd konnten sie sich nicht leisten.
Sie tauchte das Messer in den Waschbottich, streifte es an einem Lumpen ab und legte es zurück in die Werkzeugkiste.
«Mach du den Rest vom Kalb fertig», beschied sie Stoffel. «Ist nicht mehr viel.»
«Nur wenn du mir dafür was Ordentliches zum Abendessen auf den Tisch stellst.»
«Heute gibt’s gepfefferte Gänsebrust mit Mandelmus.»
«Wirklich?» Mit offenem Mund glotzte er sie an.
«Ach Stoffel!» Sie musste laut lachen. «Du glaubst auch jeden Kuhmist. Es gibt Gemüsebrei wie immer.»
Sie mochte ihren älteren Bruder sehr. Er lachte viel, war fast immer guter Dinge und murrte nie über die Arbeit. Ganz anders als ihr anderer Bruder Lienhard, der ein rechtes Großmaul war und aufbrausend dazu. Vor zwei Jahren hatte er in Freiburg eine Lehre beim dortigen Scharfrichter begonnen, um etwas Besseres zu werden als ein gemeiner Schinder. Sie vermisste ihn kein bisschen. Da stand ihr der sanftmütige Stoffel doch um vieles näher. Aber leider war der mit seinen zweiundzwanzig Jahren manchmal noch einfältig wie ein Kind und eher langsam im Denken.
Zu ihrer Überraschung ergriff der Vater das Wort. Der sprach bei der Arbeit manchmal stundenlang gar nichts, war überhaupt ein Mensch, der die Ruhe liebte.
«Komm einmal her», brummte er in seinen rotblonden Vollbart und winkte Barbara zurück an den Steintrog. In der Hand hielt er den Blechnapf ihres Hundes, der während der Arbeit hinten im Hof angekettet war und nur nach Feierabend frei herumlaufen durfte.
«Das Kalb war nicht krank», fuhr er bedächtig fort. «Nur zu schwach zum Überleben, weil die Mutterkuh keine Milch hatte.»
Er bückte sich und lud zwei rosig glänzende Fleischbrocken in den Napf, der fast zu klein war für diese schiere Menge.
«Du brätst das in kleinen Stücken gut durch, verstanden? Das reicht uns für heute, morgen und übermorgen.»
Erstaunt nickte sie. Normalerweise wanderte solcherlei Fleisch nicht in die Pfanne oder in den Kochtopf, weil es, wie der ganze Rest der verendeten Tiere, draußen auf dem Schindanger verbrannt oder verscharrt werden musste. Meist blieb der Vater sogar hart, wenn die Ärmsten der Armen an seine Tür klopften. Dennoch vertraute sie ihm. Wenn er sagte, das Fleisch sei kein schlechtes, dann war dem so. Wie kein anderer kannte er sich nämlich aus mit Viehseuchen und Rosskuren. Manchmal riefen ihn sogar die Bürger unten in der Stadt zu sich, um ihn wegen ihrer Tiere um Rat zu fragen.
«Danke, Vater. Das mach ich gern.»
«Also doch ein Festschmaus!», rief Stoffel freudig, und sie fuhr ihm nicht gerade sanft durch das dunkle Haar, das immer in alle Richtungen abstand. «Glück gehabt, Bruderherz. Bis später also.»
Ihr kleines, strohgedecktes Fachwerkhaus war mit der angrenzenden Schindhütte durch eine Tür verbunden. Dort stand auf einem wackligen Holzschemel eine Schüssel mit frischem Wasser nebst einem Stück Seife bereit. Darauf, dass sie sich hier nach der Arbeit gründlich die Hände wuschen, hatte ihre Mutter immer bestanden, und jetzt war es an Barbara, darauf zu achten. Auch darauf, dass in der Schindhütte alles ordentlich an seinem Platz verstaut war und sich kein abgehäutetes, verwesendes Vieh vor der Tür anhäufte, wie man es von anderen Abdeckereien kannte. «Wir sind zwar nur Schinder, aber dafür saubere Leut», hatte ihre Mutter ihnen immer wieder gesagt.
Für die Tierleichen, die nicht am selben Tag verarbeitet werden konnten, hatte der Vater hinten im Hof eigens einen Schopf aus Holzlatten bauen müssen. Dort allerdings stank es bestialisch. Wenn man das Türchen öffnete, flogen Schwärme von fetten, blau schillernden Fliegen auf. Zu manchen Zeiten allerdings gab es so viele Kadaver, dass der Vater sie wohl oder übel mitten auf dem Hof lagern musste, wenngleich unter dicken Decken. Dennoch wurden jedes Mal Scharen von Ratten und Rabenvögeln angelockt, und in der warmen Jahreszeit war der Gestank nicht mehr auszuhalten. Dann kamen die Taglöhner aus der Nachbarschaft, um bei ihnen auszuhelfen und sich ein paar Rappenpfennige zu verdienen.
Sie öffnete die Zwischentür zum Haus und stellte den Napf auf der Treppe zur Küche ab. Dann trat sie wie immer nach der Arbeit, wenn es nicht gerade Hunde und Katzen regnete, hinaus auf den Vorplatz, um an der frischen Luft erst einmal tief durchzuatmen. Dabei klopfte sie dem struppigen Maultier gegen den Hals. Eingespannt in die schwarz geteerte, zweirädrige Karre, die auch dem Henker für die Hinrichtungen diente, döste es neben dem Hüttentor vor sich hin. Noch vor dem Abendessen würden Stoffel und der Vater mit dem Schindluder hinaus zum Wasen fahren.
«Bald hast auch du deine Ruh», verkündete sie ihm gut gelaunt.
Sie ging ein paar Schritte die Gasse hinunter, die seit den letzten starken Regenfällen von Wagenrinnen durchfurcht war, und blinzelte gegen die tief stehende Sonne. An der Einmündung zur Kohlenberggasse, dort, wo die uralte Linde stand, spielte eine Horde Kinder Fangen.
Sie dachte an ihre eigene Kindheit zurück. Auch sie selbst hatte dort, nach getaner Arbeit, mit ihrer Freundin Marie und den anderen Kindern Fangen oder Murmeln gespielt. Oder Verstecken auf den verwilderten Brachen, die zusammen mit Wiesen und kleinen Feldstücken die Abdeckerei umgaben. Am liebsten mit Marie, ihrem Bruder Stoffel und dem Badersohn Beat Scherlin aus der angrenzenden Steinenvorstadt. Sie vier waren damals ein Herz und eine Seele gewesen. Doch irgendwann war Melcher, der älteste Sohn des Scharfrichters, dazugestoßen, und mit einem Mal wollte man die Mädchen nicht mehr dabeihaben.
Beat hatte sich trotzdem hin und wieder allein mit ihr getroffen. Dann waren sie durch die Talstadt gestreift bis hin zum Rheinufer, wo sie davon träumten, eines Tages zusammen mit einem Schiff hinaus in die Welt zu fahren. Doch ab dem Tag, an dem er bei seinem Vater als Lehrknecht anfing, kam er nicht mehr zu ihnen auf den Berg. Er hatte keine Zeit mehr, und seine Eltern mochten es wohl auch nicht mehr leiden, wenn er sich mit den Kohlenbergern herumtrieb. So begegneten sie sich seit einigen Jahren nur noch selten, und manchmal vermisste Barbara ihn mit leiser Wehmut im Herzen. Sie beide hatten einander ohne große Worte verstanden.
Sie schrak aus ihren Erinnerungen, als eine etwas heisere Stimme sagte: «Bist du nicht die Tochter vom Stegner-Michel?»
Wie aus dem Nichts stand der Mann plötzlich vor ihr, in einem adligen Reitergewand, mit ledernen Beinkleidern, Stiefeln und Sporen, wobei alles ziemlich abgetragen und zerschlissen aussah. Ein seltsamer Mann im Übrigen, denn er war einen halben Kopf kleiner als sie, hatte krumme Beine und einen verwachsenen Rücken, den man schon bucklig nennen konnte. Vor allem aber saß auf dem fast mädchenhaft-zartgliedrigen Körper ein riesenhafter Schädel mit einem breiten, bärtigen Kinn, einem herausragenden Hinterkopf und einer hohen Stirn, die in die fast kahle Schädeldecke überging. Dafür stand das restliche aschblonde Haar in einem dichten, wirren Haarkranz von Kopf ab. Er trug nämlich keinen Hut – den hielt er in den Händen, die ebenfalls etwas Mädchenhaft-Zartes hatten.
Während sie ihn so anstarrte, erinnerte sie sich wieder: Vor etlichen Jahren war dieser kleine Mann einmal bei ihnen zu Besuch gewesen, damals noch ohne Bart und mit mehr Haaren auf dem Kopf und von eher jünglingshaftem Aussehen. Danach hatte der Vater noch häufiger von ihm gesprochen und ihn halb scherzhaft, halb ehrfurchtsvoll den hochgelehrten Scholarenzwerg genannt.
Sie verkniff sich ein Grinsen, als sie daran dachte.
«Ja, die bin ich. Die Barbara Stegnerin. Und Euch erkenne ich nun auch. Ihr habt bei uns in der Schindhütte mal eine Sau zerlegt, zusammen mit dem Vater, und alles genau untersucht und aufgeschrieben.»
Seine hellen Augen leuchteten auf. «Richtig. Weil nämlich das Schwein uns Menschen überaus ähnlich ist. Und du standest neben mir, stundenlang, hattest mir zugeschaut und mich mit Fragen gelöchert. Du warst ein äußerst aufgewecktes Kind, und jetzt bist du zu einer äußerst hübschen Jungfer herangewachsen.»
Was redete der Mann da? Hübsch fand sie sich beileibe nicht. Ihr dunkelbraunes lockiges Haar, das in der Sonne rötlich schimmerte, war kaum zu bändigen, und auf der geraden, stumpfen Nase prangten hässliche Sommersprossen. Außerdem war ihr Gesicht viel zu breit, genau wie der Mund. Nur ihre Augen mochte sie, seitdem Beat ihr einmal gesagt hatte, sie habe so wunderschöne grüne Augen.
Sie beschloss, über die Schmeichelei hinwegzugehen. «Wollt Ihr zu meinem Vater?», fragte sie.
«Ja, das hatte ich vor.»
«Dann bring ich Euch hinein. Kommt.»
Der Vater stand hinten an der Herdstelle, wo er im Kessel rührte. Gemächlich drehte er sich um, als sie ihm zurief, dass Besuch gekommen sei, und kniff die Augen zusammen. Im Feuerschein glänzte sein rundes, rosiges Gesicht noch röter.
«Ja, da schau her. Der Doktor Theophrastus!»
Er wischte sich die Hände am Arbeitsschurz ab, eilte freudig auf ihn zu, nur um dann einen plötzlichen Haken zum Waschtisch zu schlagen.
«Verzeiht, ich will mir erst die Hände waschen, bevor ich einem Doktor beider Arzneien die Hand reiche.»
Barbara, die neugierig neben ihrem Gast am großen Bottich stehen geblieben war, wunderte sich nun nicht mehr über die freudige Aufregung des Vaters: Ein wahrhaftiger Doktor war das also! So jemand kam ihnen sonst nicht ins Haus.
Gleich darauf schüttelten sich die beiden Männer die Hand, und Stoffel, der mit den restlichen Kalbsbrocken beschäftigt war, verneigte sich ehrerbietig.
Der Doktor ließ die Hand des Vaters los. «Wie schön, Euch gesund wiederzusehen, Meister Stegner.»
«Ganz meinerseits, Herr Theophrastus, ganz meinerseits. Aber nennt mich nicht Meister, wo ich nur ein Halbmeister bin, sondern einfach Michel.»
«Stimmt. Ich vergaß, dass Ihr Abdecker in Basel dem Scharfrichter untersteht und ihm darum Abgaben leisten müsst, obwohl er mit Eurer harten Arbeit so gut wie nichts mehr zu schaffen hat. In meinen Augen ist das alles andere als gerecht.»
Der Vater winkte ab. «Hauptsach’, ich hab mein Auskommen. Sagt bloß, wollt Ihr etwa wieder ein Schwein zerteilen?»
Der kleine Mann lachte herzhaft auf, und Barbara musterte ihn verstohlen von der Seite. War er nun hässlich zu nennen oder nicht? Sie konnte es kaum sagen. Trotz seiner buckligen Gestalt hielt er sich stolz und aufrecht, und auf den zweiten Blick hatte er fein gezeichnete Gesichtszüge mit einer kräftigen, geraden Nase, einem entschlossen wirkenden Mund und lebhaften, klaren Augen unter den allzu buschigen Brauen. Er wirkte jung und alt zugleich, mochte dreißig oder aber auch schon vierzig Jahre zählen.
«Nein, bewahre, lieber Michel», erwiderte er nun und wirkte sichtlich erheitert. «Das braucht’s nicht mehr. Aber ich wollte mich endlich erkenntlich zeigen für jenen lehrreichen Tag bei Euch. Als frischgebackener Doktor und kurz zuvor entlassener Feldarzt hatte ich damals keinen Pfennig im Sack.»
Er nestelte an seiner Geldkatze, die am Gürtel hing, doch der Vater wehrte entschieden ab.
«Bitte lasst stecken, Medicus. Ihr beleidigt mich sonst. Es war mir doch ein Vergnügen gewesen. Ja, damals seid Ihr durch die ganze Welt gewandert und wart immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen. Wenn ich mich recht erinnere, kamt Ihr gerade von dem Feldzug der Deutsch-Ritter gegen Poland und wart hier in Basel auf dem Weg nach Frankreich oder Hispanien. Seid Ihr bei jenem Kriegszug nicht sogar von den Tataren gefangen genommen worden?»
Verwundert sah Barbara ihren Vater an. So viele Sätze auf einmal und dazu mit solch wohlgesetzten Worten hatte er schon lange nicht mehr gesprochen. Da klatschte Doktor Theophrastus in die Hände, was reichlich kindlich wirkte.
«Das waren fürwahr spaßige Wochen der Gefangenschaft, lieber Michel. Bald schon war ich Gast in ihren Tatarenzelten, da ich meine Heilkünste demonstrieren durfte, und wir haben zusammen gesoffen und geprasst, so angetan waren die von mir. Stellt Euch das nur vor: Ein Schwabe bringt Heilmittel zu den kriegerischen Tataren!»
Der Vater nickte eifrig. «Ja, davon hattet Ihr erzählt. Seid Ihr etwa noch immer auf Wanderschaft?»
«Nein, nein. Ich denke, nach gut zehn Jahren sollten die Lehr- und Wanderjahre mal ein Ende finden. Ich habe vor, sesshaft zu werden. Schon in Straßburg habe ich es versucht, doch die Umstände sprachen dagegen. Dort nämlich reißt ein Arzt dem anderen den Stuhl unterm Arsch weg. Da will ich lieber hier im schönen Basel bleiben.»
«Was für eine Überraschung! Als Medicus?»
«Mehr noch: als Stadtarzt und Professor an der hiesigen Fakultät für Medizin. Ich komme soeben vom Amtsschwur beim Magistrat.»
«Das müssen wir feiern! Bärbel, was stehst noch hier rum? Hol einen Krug Tresterwein her. Und dann mach dich gefälligst ans Abendessen. Ihr seid natürlich eingeladen, Herr Theophrastus», wandte er sich wieder an den Doktor. «Es gibt etwas Gutes heute, Ihr dürft gespannt sein.»
Innerlich schüttelte Barbara den Kopf. Ob Gebratenes vom Kalbskadaver einem geschworenen Stadtarzt munden würde? Möglichst langsam ging sie zur Tür, um sich zum zweiten Mal an diesem Nachmittag die Hände zu waschen und dabei die Antwort abzuwarten. Einen Stadtarzt hatten sie schließlich noch nie bei Tisch gehabt, auch wenn dieser absonderliche Fremde nicht gerade den Eindruck eines gelehrten Medicus machte.
«Das ist überaus großzügig», hörte sie ihn sagen. «Aber ich habe gerade erst meine Wohnung bezogen, da ist noch viel zu räumen. Ich mache Euch einen anderen Vorschlag: Ich lade Euch gegen später zu einem Abendumtrunk im Wirtshaus ein. Damit kann ich mich wenigstens ein bisschen erkenntlich zeigen. Dich natürlich auch, mein Junge. Stoffel ist dein Name, nicht wahr?»
Ihr Bruder nickte eifrig, während der Vater ein wenig zögerlich erwiderte: «Ach, lieber Herr Doktor – Ihr verkehrt sicher in besseren Häusern. Dort sind wir als Schinder nicht gern gesehen, gelinde gesagt.»
«Unsinn. Wofür habt Ihr hier oben auf dem Kohlenberg ein eigenes Wirtshaus? Das hatte mir schon damals sehr behagt.»
Kapitel 2
Tags darauf
Am nächsten Morgen litt der Vater sichtlich unter einem Brummschädel. Schweigend löffelte er seinen Haberbrei in sich hinein, während er hin und wieder unterdrückt aufstöhnte.
So, wie er bei seiner Heimkehr aus dem Wirtshaus gelärmt hatte, musste er ganz schön betrunken gewesen sein. Barbaras winzige Schlafkammer lag genau über der Haustür, die lauten Stimmen des Vaters und seines gelehrten Zechkumpans hatten sie jäh aus dem Schlaf gerissen. Wie die kleinen Kinder hatten die beiden gekichert und gealbert und zum Abschied noch irgendein Trinklied geschmettert. Umso stiller war der Vater jetzt.
Dafür berichtete Stoffel hellauf begeistert von ihrem Umtrunk im Kohlenbergwirtshaus.
«Stell dir das nur vor, Bärbel, ein Stadtarzt und Professor der Medizin beim Kohlenbergwirt! So einer geht doch sonst in den herrschaftlichen Sternen oder in den Wilden Mann! Was haben die in der Schankstube alle geglotzt, und der Adrian hat dem Doktor fast die Stiefel abgeleckt vor lauter Ehrerbietung!»
«Jetzt übertreib nicht so», knurrte der Vater und rieb sich die verquollenen Augen.
«Bitte, red weiter», bat Barbara ihren Bruder. «Hat dieser angebliche Stadtarzt euch wenigstens eingeladen?»
«Und ob. Seinen besten Wein hat der Adrian aus dem Keller holen müssen. Und wir durften saufen, so viel wir wollten. Ich hab’s dann aber nicht so übertrieben wie der Vater», er zwinkerte ihr zu, «und bin nach dem dritten Krüglein heim. Schließlich wartet heute ein Haufen Arbeit auf uns.»
«Was hat er euch so erzählt?»
«Von seinen vielen Reisen. Der ist überall in der Welt rumgekommen, als Wund- und Feldarzt. In Hispanien war er, in Engelland, in Dennmark und Holland …» Fragend schielte er zum Vater, doch der schüttelte nur unwillig den Kopf. «Warte, da war noch viel mehr … Ungern und Pruchsen und Walachei und ja, Nea… Neapolis in Italien. Der war einfach überall, sogar im Mameluckenreich von Ägypten, also da, von wo die Zigeuner herkommen. Und Bücher schreibt er auch!»
«Richtige Bücher, die gedruckt sind?»
«Na ja, gedruckt sind noch nicht so viele, aber mit der Hand geschrieben hat er etliche. Die hat er aber bei einem Bekannten in Neuenburg gelassen, du weißt schon, in Neuenburg am Rhein, und …»
«Unsinn», unterbrach ihn der Vater müde. «In Neuburg, was an der Donau liegt.»
«Ist ja auch gleich», wehrte Stoffel ab. «Und weißt du, wo der seit gestern wohnt? Nicht etwa unten am Märt oder am Münster, wo die feinen Herrschaften wohnen, sondern hier oben bei uns auf dem Berg, im Haus Zum Roten Hahn! Was für ein wunderlicher Kauz.»
Das fand Barbara allerdings auch. Wie konnte einer als hochgelehrter Mann und angesehener Stadtarzt bloß freiwillig hier wohnen? Keine hundert Schritte vom Henkershaus, da, wo das Brückchen zur Leonhardskirche abgeht.
In diesem Augenblick räusperte sich der Vater und legte den Löffel beiseite.
«Der Doktor braucht eine Magd, die ihm Wäsche und Haushaltung macht.»
«Warum guckst du mich dabei an?», fragte sie argwöhnisch.
«Weil wir am Ende über dich gesprochen haben. Er sucht eine, auf die er sich verlassen kann und die nicht dumm ist. Gegen einen kleinen Lohn und freie Kost.»
Heftig schüttelte sie den Kopf. «Aber ich will gar nicht seine Magd sein!»
Nein, das wollte sie ganz und gar nicht.
Über der Nasenwurzel des Vaters grub sich eine tiefe Falte ein. «Jetzt benimmst du dich aber doch reichlich dumm. Du solltest dich nämlich geehrt fühlen, dass dich ein Stadtarzt und Professor zu seiner Magd will. Oder hast du vergessen, dass du nur eine Schindertochter bist?»
«Wie soll ich das vergessen, wo uns die Bürger der Stadt Racker und Schelm hinterherschreien? Aber dieser Theo… dieser Theophrastus, der ist doch nicht ganz recht im Kopf. Mit den Kohlenbergern saufen gehen und sich hier oben eine Wohnstatt suchen! Und kleidet sich so ein Gelehrter? Der sieht doch aus wie ein Strauchritter mit seinem abgewetzten Reitergewand und dem zerknautschten Hut. Ein Stadtarzt ist ein angesehener Mann und reist mit großem Gepäck, eigenem Pferd und Wagen, hat Magd und Knecht. Habt ihr etwa vor dem Haus Zum Roten Hahn Pferd und Wagen stehen sehen? Ich nicht. Wahrscheinlich stimmt das alles gar nicht, und er hat euch nur einen Bären aufgebunden. Und außerdem – wenn einer studiert hat und zu einem Doktor geworden ist und sogar Bücher schreibt, dann kommt er nicht zu unehrlichen Leuten ins Haus, um ein Schwein zu zerlegen, und redet auch nicht daher wie ein Bauer oder treibt sich zehn Jahre in der Welt herum wie ein Landstreicher. So einer verarztet feine Herrschaften und wohnt im eigenen Haus und hat ein vornehmes Eheweib. Hat er überhaupt ein Weib? Einem alleinstehenden Kerl will ich schon gar nicht dienen, weil …»
«Still!», unterbrach der Vater sie und schlug mit der Faust auf die Tischplatte, dass die Becher hüpften. «Hältst du wohl dein vorlautes Mundwerk? Der Doktor Theophrastus ist ein ehrenwerter Herr. Aber wenn du unbedingt willst, erkundige ich mich nachher beim Bader Scherlin, der muss es ja wissen, ob Basel einen neuen Stadtarzt hat.»
Aha. So hatten ihre Worte ihn also verunsichert. Doch die Befriedigung hierüber wich dem schalen Gefühl, dass dieser verwachsene, kleinwüchsige Mensch keineswegs gelogen hatte. Sondern einfach nur anders als andere Männer seines Standes war.
«Das ist das Mindeste, dass du erst mal den Scherlin frägst.» Sie schob die Unterlippe vor. «Außerdem: Wie wollt ihr beide ohne mich zurechtkommen? Da würde hier alles schön verlottern.»
«Das lass nur meine Sorge sein», fuhr der Vater etwas ruhiger fort, und seine Zornesfalte glättete sich wieder. «Da ist nämlich noch etwas. Stoffel, horch gefälligst her, das geht auch dich an! An Jacobi, zum großen Bettlertanz, wirst du die Guta heiraten. Damit eure heimliche Unzucht ein Ende hat. Ich hab’s nämlich satt, dass Pfarrer Bertschi mich deshalb dauernd ins Gebet nimmt. Die Guta wird dann also im Sommer hier einziehen, ihre Eltern sind einverstanden. Dann wird sie uns den Haushalt führen, und in der Schindhütte mithelfen soll sie auch.»
«Im Ernst? Wir sollen heiraten?» Stoffel war von der Küchenbank aufgesprungen und nahm Barbara bei den Schultern. «Ach Schwesterlein, wie mich das freut!»
Unwillig wehrte sie ihn ab. Auch wenn sie das hatte kommen sehen – die Aussicht, dass Guta sie bald schon als Frau im Haus ersetzen sollte, bestürzte sie nun doch. Und eng würde es in ihrem Häuschen dann auch werden. Stoffels Braut war die Tochter eines Sackträgers, der ihnen manchmal beim Kloakenkehren half und dessen vielköpfige Familie von der Hand in den Mund lebte. Schon als Kinder hatte sie sich mit Guta nur gestritten. Einmal hatte die ihr sogar ein ganzes Büschel Haare herausgerissen, nur weil Barbara ihr keine von ihren Murmeln schenken wollte. Aus dem zänkischen Kind war inzwischen eine ausnehmend hübsche, wenngleich ziemlich eingebildete und eitle junge Frau geworden, und eine Zeit lang ging sogar das Gerücht, dass sie sich hin und wieder in Jakobs Hurenhaus ein Zubrot verdiente. Stoffel hatte deshalb mal einen Kerl, der ihm das frech ins Gesicht sagte, halb totgeprügelt. Aber woher sonst hatte sie das Geld für ihre seidenen Brusttücher und bestickten Fatzenettli? Wie dem auch sei: Barbara konnte Guta noch immer nicht leiden. Die hatte Haare auf den Zähnen und ein Herz aus Stein. Jeder der Burschen hier hatte schon mal ein Auge auf Guta geworfen, sie hingegen hatte sich letztes Jahr für Stoffel entschieden. Wahrscheinlich, weil sie dessen Gutmütigkeit so wunderbar ausnutzen konnte. Aber ihr Bruder liebte und vergötterte sie nun einmal.
«Dann braucht ihr mich ja nicht mehr», brachte sie enttäuscht hervor. «Meinetwegen, jagt mich nur aus dem Haus, mit dieser Guta will ich eh nicht unter einem Dach leben.»
Jetzt lief das Gesicht des Vaters erst recht zornrot an.
«Potzdusig und Sackerment! Was glaubst du, wer du bist? Mit deinen achtzehn Jahren bist du längst alt genug, dich als Magd zu verdingen und auf deine Aussteuer zu sparen. Aber wenn du dir hierfür zu fein bist, dann kannst du auch gleich den Melcher heiraten, und zwar zu Jacobi wie dein Bruder.»
Sie starrte ihn entgeistert an. «Ich soll den Henkerssohn heiraten?»
«Na und? Das haben sein Vater und ich längst abgesprochen. Der Melcher ist einverstanden. Eigentlich wollten wir abwarten, bis er am Jahresende seine Lehrzeit hinter sich hat und zum Gesellen ernannt wird. Aber das lässt sich auch vorziehen, glaub mir.»
«Nie und nimmer heirate ich den! Ich will kein Henkersweib werden. Dann schaff ich mich lieber als Schankmagd beim Ertzstein-Adrian krumm, dann hast auch keine Last mehr mit mir.»
«Ha! Der Adrian braucht gar keine dritte Schankmagd. Aber du kannst ja mal bei den Bürgern unten in der Stadt vorsprechen, die nehmen sich gewiss gern eine Schindertochter ins Haus. Genug geredet. Stoffel, spann das Maultier ein, wir sollen den toten Hofhund aus Küchlins Papiermühle abholen. Und vorher fahren wir beim Bader Scherlin vorbei.»
Gedankenverloren erledigte Barbara den Abwasch und kehrte mehr als gründlich Wohnküche und Diele aus. Das tat sie täglich, da auch im Haus alles sauber und ordentlich sein sollte, dort erst recht. Obendrein kämpften Kräuterbündel und Blütensäckchen mit ihrem Duft gegen den Gestank aus der benachbarten Hütte an. An manchen Tagen bestreute Barbara sogar, wie die Mutter es sie gelehrt hatte, die Böden mit Thymian, Kalmus und Kamille.
Nachdem sie Reisigbesen und Kehrblech verstaut hatte, setzte sie sich auf die Holzbank vor ihrem Häuschen, um auf die Rückkehr des Vaters zu warten. Tatsächlich war das frühlingshafte Wetter bereits wieder vorbei, der Wind blies kühl über die staubige Gasse, und der Himmel zog sich grau in grau zusammen. Von dem guten Dutzend Häuser drüben bei der Linde drangen die Geräusche nur gedämpft zu ihr herüber. Mit der Ruhe würde es zum Tagesende vorbei sein, wenn sich die Leute, vom billigen Tresterwein mehr oder weniger berauscht, auf der Straße zum Tanzen, Singen und Raufen einfanden.
Missmutig scharrte sie mit der Fußspitze Kieselsteinchen hin und her. Der Vater hatte schon recht. Anderswo als auf dem Kohlenberg würde sie keine Arbeit finden. Schon gar nicht, seitdem Pfarrer Marx Bertschi, der Leutpriester von Sankt Leonhard, den neuen Brauch der Tauf- und Heiratsbücher eingeführt hatte, in denen sie alle verzeichnet standen mitsamt ihrem Stand. Und eine Abschrift hiervon musste man vorweisen, wollte man ein Handwerk lernen oder sich irgendwo verdingen.
Somit war sie nicht gerade vom Glück begünstigt, stand der Abdecker im Ansehen der Bürger doch noch weit unter dem des Scharfrichters. Der war immerhin gefürchtet, hatte ein hohes städtisches Amt inne und erhielt dafür auch guten Lohn. Ein Schinder aber tat die Drecksarbeit. Er keulte das kranke und beseitigte das gefallene Vieh, hob stinkende Abortgruben aus, erschlug streunende Hunde ohne Blechmarke, verschnitt das männliche Vieh, trieb fremde Aussätzige und Wanderhuren aus der Stadt. Das war ihr vertraut seit frühester Kindheit, anders kannte sie es nicht, und unter den Kohlenbergern waren sie geachtete Leute. Doch unten in der Stadt war sie eine Ehrlose, mehr noch: ein Wesen, das jeder anstarren durfte. Schon als kleines Mädchen hatte sie, beim Einkauf an der Hand der Mutter, die verächtlichen Blicke auf der Haut gespürt, und war jedes Mal froh gewesen, wenn sie sich auf den steilen Heimweg machten. Es kam sogar vor, dass irgendwelche Rotzbengel mit Rossbollen oder fauligem Obst aus der Gosse nach ihnen warfen. Als sie deshalb einmal in Tränen ausgebrochen war, hatte die Mutter ihr mitten auf der Gasse eine Maulschelle verpasst. «Du hast überhaupt keinen Grund, dich zu schämen, verstanden?»
Womit ihre Mutter recht hatte. Längst hatte Barbara gelernt, hocherhobenen Hauptes über den Kornmarkt oder die Freie Straße zu wandern. Sie hatte wirklich keinen Grund, sich ihrer Herkunft zu schämen. Und war sie nicht auch wohlbehütet aufgewachsen, ohne Hunger und Not? Die ach so vornehm tuenden Bürger brauchten ihren Vater nämlich. Wer sonst leerte nächtens ihre stinkenden Abortgruben und karrte die Kloake vor die Stadt? Wer sonst holte ihr verendetes Vieh? Bloß bezahlen wollte man hierfür am liebsten nichts. Das Entgelt für das Abholen der Kadaver war gering, wie der Vater immer betonte, aber dennoch verheimlichten manche den Tod eines Tieres, nur um den Kadaver nachts selbst zu verscharren oder in den Rhein zu werfen – was bei Strafe verboten war. Erfuhr ihr Vater hiervon, durfte er den Frevler anzeigen, was ihn bei den Leuten selbstredend auch nicht beliebter machte. Dennoch lohnte sich das Amt des Wasenmeisters, denn für das Kloakenkehren, diese ekelhafte und auch gefährliche Arbeit, gab es gutes Geld. Obendrein hatte ein Schinder beim toten Vieh das Recht an Fell und Fett, an Klauen, Horn und Rosshaar – auch wenn er dem Scharfrichter, dem eigentlichen Meister über die Abdeckerei, einen kleinen Teil des Erlöses abgeben musste.
Nein, es hatte ihr im Leben nie an etwas gemangelt, und ihre Eltern waren immer rechtschaffene Leute gewesen. Trotzdem hatte sie sich schon als Kind vorgenommen, dem Kohlenberg und seinen geächteten Bewohnern eines Tages den Rücken zu kehren. Und spätestens, als ihre Freundschaft zu Beat enger wurde, sah sie sich in ihren kühnsten Träumen an seiner Seite, wie sie gemeinsam die Badstube seiner Eltern in der Steinenvorstadt weiterführten. Dann würde sie den Menschen Wohlsein und Gesundheit bescheren, anstatt sich Tag für Tag mit stinkenden Kadavern zu umgeben. Mittlerweile aber war ihr bewusst, was für einem Hirngespinst sie da in jungen Jahren nachgehangen hatte: Das Handwerk des Baders war ein ehrliches und zünftiges, und niemals würde Beats Vater sie ins Haus lassen, nicht als Magd und erst recht nicht als Eheweib seines Sohnes.
Seither quälte sie abends vor dem Einschlafen manchmal die Frage, wie ihre Zukunft aussah. War sie dazu verdammt, hier zu bleiben und auszuharren, bis der Tod sie holte? Auf diesem steilen Hügel über der Basler Altstadt, wo sich die Ausgegrenzten und Unehrlichen durchs Leben schlugen und wohin Gott auch sie hineingeboren hatte? Von ihrem Vater wusste sie, dass der Kohlenberg seit jeher das Reich der Henker, Schinder und Totengräber war, die bei den Bürgersleuten im Ruf standen, mit Geistern und Dämonen umzugehen. Hier lebten die armen Sackträger und Gassenkehrer, die Vieh- und Feldhüter, die Hübschlerinnen mit ihren knallgelben Schleiern und deren Hurenwirte, die Gebrandmarkten und solche, die schon am Pranger gestanden hatten. Hinzu kamen die Blinden, Lahmen und Krüppel, die echten und die falschen Bettler, verarmte Handwerker und nicht zünftige Geißelmacher oder Hausierer. Auch das fahrende Volk mit seinen bunt gewandeten Gauklern, Spielleuten und Zigeunern traf sich hier. Man kam und ging, wie es einem gefiel. Bloß Juden sah man selten, die suchten lieber bei ihren Glaubensgenossen auf dem Land Unterschlupf.
In den Augen der Basler war der Kohlenberg die Welt der Ausgeschlossenen, derjenigen, die keine Bürgerrechte besaßen und den christlichen Zünften nicht beitreten durften. Was zur Folge hatte, dass das Sagen in diesem Quartier nicht die Herren vom Magistrat oder die Pfaffen hatten, sondern der Hurenwirt Jakob, der Scharfrichter Jost und der Totengräber Adrian mit seinem Wirtshaus, einem berüchtigten Hehler- und Glücksspielnest. Bis spät in den Abend ging es in seiner Schankstube hoch her. Der Ruf des Nachtwächters zum Torschluss kümmerte niemanden, und zur Nacht fand bei Adrian noch ein jeder von der Obrigkeit Verfolgte sein Plätzchen zum Schlafen. Hier auf dem Berg galten eigene Gesetze, niemand fragte nach Geburt oder Stand, nach Herkunft oder Ziel. Es gab sogar ein eigenes Bettlergericht, das bei Zwistigkeiten und Raufhändeln Recht sprach. Die Stadtknechte und Büttel wagten sich kaum herauf, und wenn doch, drückten sie angesichts des Treibens rundum beide Augen zu.
Fast schien es, als wolle die Stadt die Kohlenberger sich selbst überlassen, nur um keine Scherereien zu haben. In den Augen der Bürger führten sie nämlich ein ganz und gar ausschweifendes und unzüchtiges Leben, schwärmten tagsüber in die Stadt aus, um durch aufdringlichen Bettel, Betrug oder Diebstahl ihren Unterhalt zu fristen, und kehrten zur Nacht auf ihren Berg zurück, um ihre Beute zu verprassen und zu versaufen, mit käuflichen Weibern zu verhuren oder beim Glücksspiel alles wieder zu verlieren. Was aber nur ein Teil der Wahrheit war. Wer von ihnen eine Arbeit hatte, der arbeitete durchaus hart.
Barbara mochte sich beileibe nicht über diese Menschen erheben, die ihr von klein auf vertraut und ihr Zuhause waren. Und doch wollte sie weg von hier. Die Welt auf dem Kohlenberg wurde ihr zu eng, zu laut, zu schmutzig. Es musste doch noch etwas anderes geben, als in den Tag hinein zu leben, von der Hand in den Mund, immer hart am Elend vorbei. Und sich, wenn man nur genug gesoffen hatte, gegenseitig die Nase einzuschlagen, um sich am nächsten Tag mit großer Geste wieder zu versöhnen.
Ein kühler Windstoß fuhr ihr in die Glieder und ließ sie erschauern. Sie wusste, sie war an einem Scheideweg angelangt und dabei hin- und hergerissen: Sollte sie sich dem Dienst bei diesem wunderlichen, nicht gerade vertrauenerweckenden Mann verweigern, blühte ihr womöglich zu Jacobi die Hochzeit mit Melcher. War es wirklich so schlecht, tagsüber dem Stadtarzt von Basel, wenn er es denn war, den Haushalt zu führen und sich nach Feierabend und an den Sonntagnachmittagen weiterhin mit Marie zu treffen? Und in ihrem Elternhaus wohnen zu bleiben? Ihrer künftigen Schwägerin Guta, die sich mit Sicherheit als Herrin im Haus aufführen würde, wäre sie dann wenigstens tagsüber aus den Augen. Obendrein könnte sie sich von ihrem Lohn endlich ein kleines Sparpolster anlegen.
Sie seufzte tief auf, während sie nach der Schindkarre Ausschau hielt. Nun, sie würde abwarten, was der Vater berichtete. Vielleicht war ja dieser angebliche Medicus längst wieder aus der Stadt verschwunden. Dann tauchte auch schon in einer Staubwolke die Karre auf, umringt von einer Schar Kinder und kläffender Köter. Der Vater saß obenauf und hielt die Zügel, Stoffel lief voraus und machte Faxen mit den Kindern.
Angespannt erhob sie sich von der Bank, während der Vater das Maultier bis dicht vor das offene Tor lenkte. Auf der Ladefläche lag ein gelbbraunes Fellbündel – die Arbeit für heute Morgen.
Stoffel stieß sie in die Seite. «Ich soll dich vom Beat schön grüßen.»
Sie biss sich auf die Lippen. Diese Bemerkung hätte sich ihr Bruder besser gespart, denn sie tat ihr weh. Aber immerhin hatte der Vater sein Versprechen wahr gemacht und beim Bader nachgefragt.
Ungeduldig beobachtete sie den Vater, wie er schwerfällig von der Karre kletterte. Er war ein großer Mann, breitschultrig und kräftig, doch in letzter Zeit merkte man ihm das Älterwerden an. Vor allem der Rücken schmerzte ihn häufig.
Er unterdrückte ein Stöhnen, während er sich mit der Hand an der Karrenwand aufrichtete.
«Verdammte Schlaglöcher», murmelte er.
Mit einem Wink des Kopfes bedeutete er Stoffel und ihr, den toten Hund des Papiermüllers abzuladen. Für schwere Kadaver besaß die Karre eine Seilwinde, doch die brauchte es nicht für diesen mageren Körper.
Nachdem sie den toten Hund auf dem Tisch abgelegt hatten, wandte sie sich nach dem Vater um. Der saß inzwischen draußen auf der Bank und drückte den Rücken gegen die Hauswand.
Fragend blickte sie ihn an.
«Komm her.» Er klopfte aufmunternd mit seiner riesigen Hand neben sich auf die Bank.
Gehorsam nahm sie Platz.
«Der alte Scherlin», begann er, «hat’s bestätigt: Das freie Amt des Stadtarztes ist neu besetzt, und zwar mit ebenjenem Doktor Theophrastus Bombast von Hohenheim, geboren zu Einsiedeln in der Schwyz. Obendrein soll er den Studenten am Collegium die Medizin lehren. Unser Gast hat uns also nicht angelogen.»
«Der Doktor ist zudem fast schon berühmt in Basel», mischte sich Stoffel ein. «Ein richtiger Wunderheiler soll der sein, hat der Beat erzählt. Einem hiesigen Buchdrucker soll er letzten Monat geholfen haben, weil der nicht mehr laufen konnte. Ein Basler Chirurgus wollte dem armen Mann schon den rechten Fuß abhauen, aber dann hat man den Theophrastus aus Straßburg geholt, und der hat den Druckermeister geheilt. Sogar aufs Pferd kann der wieder steigen.»
Der Vater nickte bestätigend. «Der Mann mit dem kranken Fuß ist nicht irgendwer, sondern der König der Buchdrucker, der stadtbekannte Johannes Frobenius. Und seinem Freund, dem noch berühmteren Erasmus von Rotterdam, soll der Doktor auch geholfen haben.»
«Ich kenne weder den einen noch den anderen, und das ist mir auch gleich», erwiderte sie, trotz ihrer Überlegungen zuvor, ein wenig bockig.
«Ich will damit nur sagen, was für ein guter Mann der Doktor ist. Sogar den Markgrafen von Baden hat er erfolgreich behandelt. Deshalb hat man ihn ja hergeholt. Und so einer will dich zur Magd haben!» Jetzt blitzte der Stolz in seinen Augen auf. «Und weißt du auch, warum?»
Da sie keine Antwort gab, fuhr er fort: «Weil er dich für gescheit hält. Er hat mich nämlich gestern auch gefragt, ob du mehr kannst als nur deinen Namen schreiben. Da hab ich ihm gesagt, dass du deinen beiden Brüdern das Lesen und Schreiben abgeguckt hast, ganz von allein.»
«Was soll das? Schreiben kann der Doktor ja wohl selbst.»
«Du sollst halt hin und wieder was aufschreiben, wenn ihn jemand besucht und er nicht da ist. Damit du nichts Wichtiges vergisst. Was der Besucher will, woran er leidet und so. Ach, das wird er dir schon selbst erklären.»
Sie rückte ein Stück von ihm ab und starrte zu Boden. «Das mit dem Melcher – ist dir das ernst?»
«Und ob. Ich bin nicht mehr der Jüngste, und ich will, dass meine Kinder versorgt sind. Eure Mutter hätte das auch so gewollt.»
Sie spürte, wie ihr die Tränen in die Augen stiegen. Ihre Mutter hätte ihr vielleicht nahegelegt, den Melcher zu heiraten, da ein Scharfrichter großes Ansehen genoss, aber gezwungen hätte sie sie niemals. Und an einen ehelosen, buckligen Wunderheiler hätte sie sie auch nicht von jetzt auf nachher verschachert. Streng war sie manchmal zu ihr und den Brüdern gewesen, gewiss, aber auch sehr liebevoll. Obwohl sich Barbara kaum noch an das Gesicht der Mutter erinnern konnte, ergriff sie plötzlich eine tiefe Traurigkeit. Warum nur war sie so früh gestorben? Barbara war gerade einmal neun gewesen. Bei der Geburt des jüngsten Bruders war das, der sein erstes Lebensjahr ebenfalls nicht überlebte.
Da tat der Vater etwas, das er schon seit Jahr und Tag nicht mehr getan hatte: Er zog sie an sich und strich ihr unbeholfen über den Rücken.
«Jetzt zieh nicht so ein Gesicht: Der Doktor Theophrastus weiß dich eben zu schätzen, und das sollte dich freuen. Heute Mittag kommt er vorbei und will dich fragen, wie du dich entschieden hast.»
«Wie ich mich entschieden hab? Das hast doch längst du für mich getan.»
Er ließ sie los und erhob sich. «Du hast aber die Wahl. Der Melcher oder der Doktor. Wenn du künftig dein Auskommen als Magd bei ihm hast, dann lassen wir das mit der Heirat. Und jetzt an die Arbeit.»
Kapitel 3
Am selben Tag, zur Mittagszeit
Barbara schnitt Brot und Käse für den Mittagsimbiss in Scheiben, wobei sie angestrengt nach draußen lauschte, ob Männerstimmen laut wurden. Hin- und hergerissen war sie die letzten Stunden gewesen, während sie beim Zerlegen des Hundekadavers half, wollte in Wirklichkeit weder das eine noch das andere. Sollte sie vielleicht doch in eine andere Stadt ziehen, wo man nicht nach Stand und Geburt fragte? In Freiburg war das anscheinend so, wie Lienhard ihnen einmal geschrieben hatte. Doch zu ihrem prahlerischen jüngeren Bruder wollte sie nicht, und sich ganz allein in eine fremde Stadt aufzumachen, dazu fehlte ihr der Wagemut.
Wie gerne hätte sie sich hierüber mit ihrer Freundin Marie besprochen, doch die hatte sich für heute von ihrer Arbeit als Schankmädchen bei Adrian freigenommen, um nach ihrer kranken Muhme in Kleinbasel zu sehen, und würde erst spät zurückkommen. So hatte Barbara schließlich, kurz bevor sie sich anschickte, hinauf in die Küche zu gehen, den Vater gefragt: «Wie kommt ihr ohne mich zurecht bis zum Sommer, bis Guta hier einzieht?»
«Sie hilft uns tagsüber aus, das ist schon besprochen.» Freudig hatte er sie angestrahlt. «So hast du dich also entschieden?»
«Was bleibt mir anderes übrig? Ein Henkersweib will ich jedenfalls nicht werden.»
Als sie jetzt drei Trinkbecher und einen Krug geronnene Milch auf den Tisch stellte, ertönte von draußen die Stimme des Doktors: «Gott zum Gruße, lieber Michel. Darf ich hereinkommen?»
Seine etwas raue, heisere Stimme war nicht unangenehm, und doch klang sie in ihren Ohren wie die Trompeten von Jericho. Sollte sie also zustimmen? Immerhin hätte sie Marie, Stoffel und den Vater weiterhin in ihrer Nähe und wäre nach getaner Arbeit in wenigen Schritten zu Hause. Und wer weiß, vielleicht würde der Medicus doch über kurz oder lang an den Märt oder ans Münster ziehen. Dort würde kaum einer wissen, dass sie vom Kohlenberg stammte, und wenn doch, würde das irgendwann in Vergessenheit geraten. Damit wäre sie den Makel ihrer Geburt endlich los. Womöglich könnte sich nach ein paar Jahren ihr Traum einer Badstube doch noch erfüllen, vielleicht sogar an Beats Seite. Das wäre das Allerschönste. Eines aber schwor sie sich jetzt schon: Nur weil dieser Medicus ein angesehener Mann war, würde sie nicht vor ihm katzbuckeln.
Schon hörte sie die Stufen der Holztreppe knarzen, und so stellte sie rasch einen vierten Trinkbecher nebst einem Holzbrettchen auf den Tisch. Höflich wollte sie sein, unterwürfig nicht.
«Seid gegrüßt, Herr Stadtarzt», sagte sie möglichst freundlich, als die drei Männer die Wohnküche betraten. «Möchtet Ihr mit uns den Imbiss nehmen?»
«Gerne.» Theophrastus wirkte ernster als am Tag zuvor, fast sorgenvoll. Womöglich hatte er aber, nach der durchzechten Nacht, auch nur mit Kopfschmerzen zu kämpfen. Er trug dasselbe Reitergewand wie am Vortag, sein Biberfellhut vermochte kaum den großen Kopf zu bedecken. Auf dem Kragen seines Rocks entdeckte Barbara Speiseflecken.
Der Vater wies ihm den Platz vor dem halb offenen Fenster zu, wo es vom Herd her nicht gar so verraucht war. Barbara schenkte rundum Milch ein. Wie er da so saß, sah es aus, als würde sein Schädel unmittelbar aus dem buckligen Rücken herauswachsen, und unter seinem kurz geschnittenen Bart wölbte sich deutlich ein Doppelkinn.
«Wollt Ihr lieber Wein?», fragte der Vater.
«Nein, nein, um Himmels willen.»
Er wiegte langsam seinen Kopf hin und her, was wohl ein Kopfschütteln bedeuten sollte, und Barbara vermutete, dass er bessere Tropfen als ihren gepanschten, billigen Tresterwein gewohnt war. Auch den Käse, den Barbara ihm anbot, lehnte er ab.
«Ein Stücklein Brot, das reicht. Gewöhnlich esse ich mittags nichts, erst wieder zum Abend.»
Während er bedächtig kaute, blickte er sich ungeniert um.
«Nun ja.» Der Vater räusperte sich und fuhr sich durch das schüttere blonde Haar, wie immer, wenn er verlegen war. «Wir haben’s halt sehr einfach hier. Für eine gute Stube, wie Ihr sie kennt, ist in unserem Häuschen kein Platz. Grad mal noch die zwei Schlafkammern nebenan haben wir und unten unter der Stiege Stoffels Verschlag.»
Barbara ärgerte sich. Was musste der Vater sich rechtfertigen?
«Wir sind keine armen Leute, wenn Ihr das denkt», sagte sie. «Wir haben alles, was wir brauchen.»
Aus seinen wachen, klaren Augen blickte der Doktor sie durchdringend an und nickte dabei. «Der Reichtum des Menschen liegt in seinem Herzen, seiner Seele und seinem Verstand. Und nicht etwa in Schmuck oder prallen Geldkatzen, in vornehmen Palästen oder edlen Kutschpferden. Dies alles ist unnützer Tand, der die Welt vergiftet.»
Barbara musste ihn ebenso verdutzt angeschaut haben wie der Vater, denn plötzlich begann er zu lachen, wobei das eher einem Kichern glich.
«Verzeiht, ich schwatze schon daher wie ein Bettelmönch. Davon abgesehen habe ich in meinem Leben oft genug unter einer Stiege auf dem Boden schlafen müssen, und das kann schon recht erniedrigend sein. Jedenfalls freue ich mich sehr, dass du, Barbara, bei mir als Magd anfangen magst, wie mir dein Vater eben sagte. Nach meinen langen Wanderjahren will ich nämlich hier in Basel endlich Ordnung in mein Leben bringen. Als Junggeselle wird man ohne Weib in der Haushaltung doch gar zu schnell zum Sonderling. Du möchtest doch Magd bei mir sein, oder?»
Sie zögerte kurz mit ihrer Antwort. Denn ein Sonderling war er ohne Zweifel.
«Ja, Herr», sagte sie schließlich.
«Gut.» Er wurde wieder ernst. «Hast du eigentlich einen Bräutigam hier in Basel?»
«Warum?», fragte sie keck zurück. «Wollt Ihr mich etwa heiraten?»
«Barbara!», fuhr ihr der Vater über den Mund.
Der Doktor war tatsächlich über und über rot geworden.
«Aber nein, wo … wo denkst du hin?», stotterte er. «Mir ist nur meine Ruhe sehr wichtig, vor allem zur Nacht, wenn ich mich ans Schreiben mache. Ein Kommen und Gehen würde mich stören.»
Sie glaubte, sich verhört zu haben.
«Wie? Ich soll bei Euch auch über Nacht bleiben?»
«Daran dachte ich, ja. Zuweilen werde ich auch des Nachts zu Kranken gerufen, dann solltest du da sein und mich wecken, falls ich gerade eingeschlafen bin. Und wenn ich hinaus aufs Land muss, für mehrere Tage, dann sollst du mich begleiten. Keine Sorge, du wirst angemessen entlohnt. Sagen wir, ein Viertelpfund Silber die Woche? Am Tag des Herrn hast du selbstredend frei.»
Der Vater pfiff durch die Zähne. «So viel? Das ist ja der Lohn eines langjährigen Gesellen!»
Der Medicus winkte ab. «Ich verdiene schließlich gut als Stadtarzt und Professor.»
«Kann ich dann deine Kammer haben?», fragte Stoffel dazwischen. «Bitte, Bärbel.»
Barbara hatte es noch immer die Sprache verschlagen. Damit hatte sie nicht gerechnet. Weder mit dem hohen Lohn noch damit, auch die Nächte im Haus dieses Fremden zu verbringen. Und ihr Vater und Stoffel schienen hiervon auch noch begeistert!
Sie schwieg. Noch konnte sie zurück. Aber hatte sie von diesem Mann wirklich etwas zu befürchten? Sie war mit zwei Brüdern aufgewachsen, hatte gelernt, mit sturzbetrunkenen Mannsbildern umzugehen, und da hier auf dem Kohlenberg oftmals ein rauer Ton herrschte, wusste sie sich zu wehren.
«Was soll ich mitnehmen zu Euch?», fragte sie schließlich und sah die Erleichterung im Gesicht des Vaters.
Auch die Miene des Doktors, der fast ängstlich auf ein Wort von ihr gewartet hatte, entspannte sich. «Deinen Strohsack kannst du hierlassen, es gibt in meiner Wohnung ein richtiges Bett für dich. In einer eigenen Kammer selbstverständlich, das vergaß ich zu erwähnen. Ansonsten nimm deine Kleidung, Kamm und Bürste, ein wenig Leib- und Bettwäsche vielleicht … Ach, das weißt du als Weib sicher besser als ich.»
Keine Stunde später verließ sie an der Seite von Doktor Theophrastus das Elternhaus. Ihre wenigen Habseligkeiten zog sie in einer Handkarre hinter sich her.
Diesmal war es ein ganz und gar befremdliches Gefühl, das staubige Sträßchen entlangzugehen, das von der äußeren Stadtmauer am Steinengraben bis vor zur Linde führte. Als ob es das letzte Mal wäre. Dabei zog sie gerade einmal zwei Gassen weiter. Aber sie wusste noch immer nicht so recht, was sie von ihrem neuen Dienstherrn halten sollte.
Als sie die umliegenden Garten- und Feldflächen hinter sich gelassen hatten und die ersten strohgedeckten, windschiefen Lehmhütten erreichten, fiel ihr auf, dass außer ihnen niemand unterwegs war. Auch ein Stück weiter war der freie Platz rund um die alte Linde, den die besseren Kohlenberger Häuser säumten, wie ausgestorben, von streunenden Hunden abgesehen, die hier oben nicht befürchten mussten, erschlagen zu werden. Zwar trieben sich die meisten Kohlenberger um diese Zeit unten in der Stadt herum, doch auch von den Kindern und Alten war niemand zu sehen. Barbara ahnte, wo sie steckten: verborgen hinter den halb offenen Fenstern und Türen, in dunklen Ecken und Winkeln, um in aller Heimlichkeit den Stadtarzt mit seiner neuen Magd beobachten zu können. Dass der gelehrte Mann hier oben wohnte und sich die Schinder-Bärbel zur Magd genommen hatte, war mit Sicherheit wie ein Lauffeuer umgegangen.
«Kommt nur heraus aus euren Löchern!», hätte sie ihnen gerne zugerufen, ließ es aber bleiben. So ging sie weiterhin schweigend neben dem Doktor her, mit dem sie seit Verlassen der Abdeckerei kein einziges Wort, geschweige denn einen Blick gewechselt hatte. Mit vorgerecktem Kinn und in einem für seine kurzen, krummen Beine erstaunlich flinken Schritt eilte er voran. War es ihm doch unangenehm, zusammen mit der Tochter des Abdeckers gesehen zu werden? Nein, das machte in dieser Gegend keinen Sinn. Vielleicht verunsicherte es ihn, ein junges Mädchen an seiner Seite zu haben?
Schon erreichten sie die Kreuzung bei der Linde. Rechts führte die Gasse an Adrians Wirtshaus vorbei, dem größten Haus am Platz, und weiter rund um den Kohlenberg bis zur äußeren Stadtmauer. Links ging es entlang der inneren Mauer am Leonhardsgraben in Richtung Spalenvorstadt, und geradeaus befand sich der steile Abstieg hinunter in die alte Talstadt von Basel.
Sie bogen nach links ab. Um das Schweigen zu brechen, sagte sie: «Hier an der Ecke, im Haus Zur Wildsau, wohnt übrigens der Scharfrichter.»
«Ich weiß. Ich kenne Meister Jost bereits aus jener Zeit, als ich auch bei euch war. Es macht mir nichts aus, in seiner Nachbarschaft zu wohnen, wenn du das meinst. Jost ist ein fähiger Mann, der mehr von den Heilkünsten versteht als so manch hochgelehrter Brunzdoktor.»
Bei seinem letzten Wort musste sie fast lachen. Brunz- oder Pissdoktor nannten auch die Kohlenberger die studierten Ärzte, die bei Kranken nichts anderes zu tun wussten, als sie in ein Glas pinkeln zu lassen, um daran ausgiebig zu schnüffeln oder davon zu kosten und dabei Sätze mit fremd klingenden Worten zu faseln. In diesem Moment öffnete sich neben dem Henkershaus ein Fensterladen. Maries kleine Schwester Anni steckte ihren blonden Lockenschopf heraus.
«Gehst du fort?», fragte sie.
«Nein, ich ziehe nur ein kleines Stück weiter. Ist Marie schon zurück?»
«Die ist noch bei der kranken Muhme.»
«Dann sag ihr, dass ich jetzt beim Stadtarzt Theophrastus wohne. Im Haus Zum Roten Hahn.»
«Warte, ich komme mit.»
«Nein, um Himmels willen. Bleib da, wo du bist.»
Sie musste laufen, um den Medicus wieder einzuholen.
«Ist Marie deine Freundin?», fragte er.
«Ja. Meine beste. Ihr kennt sie aus dem Wirtshaus, wo sie als Schankmädchen arbeitet. Die mit den blonden Locken.»
«Das also ist deine Freundin», murmelte er, ohne aufzublicken. «Freundschaften hat man nur wenige im Leben. Man muss gut auf sie achtgeben.»
Diese vertraulichen Worte ihr als Magd gegenüber erstaunten sie und freuten sie zugleich. Oder hatte er nur mit sich selbst geredet?
An der nächsten Straßenecke, gut hundert Schritte hinter dem Henkershaus, blieb er stehen. «Hier ist es.»
Er wies auf das zwar nicht eben große, aber doch einigermaßen ansehnliche Bürgerhaus, dessen Erdgeschoss sogar gemauert war. Das Fachwerk darüber kragte ein wenig über, das Dach war mit Schindeln gedeckt anstatt mit Strohbündeln. Ab hier, wo der Kohlenberg in die Spalenvorstadt überging, waren die Häuser schon um einiges gepflegter, für Barbaras Empfinden zumindest. Dass hier aber ein Stadtarzt seine Bleibe bezogen hatte, befremdete sie doch ein wenig, auch wenn ihr selbst das Haus gut gefiel.
«Unten im Erdgeschoss», erläuterte er, «hat der ledige Flickschuster Bohnsack seine Werkstatt mitsamt Wohnung, und darüber wohne ich.»
Sie nickte. «Den Bohnsack kenne ich. Da lassen manche von uns die Schuhe richten, wenn sie mal wieder durchgelaufen sind.»
Der Doktor nestelte an seinem Schlüsselbund. «Ein sehr ruhiger und freundlicher Mann, ein wahrhaft erfreulicher Hausgenosse. Das halbe Dutzend Taglöhner unterm Dach», sein Tonfall wurde unwillig, «hat sich leider als weniger erfreulich herausgestellt. Die trampeln einem auf dem Kopf herum wie eine Horde Bullen.»
Er schloss das Törchen unter dem steinernen Rundbogen auf, und sie betraten einen schmalen, lang gestreckten Hof. Der führte um das Haus herum, war mit allerhand Gerümpel und wertlosem Plunder vollgestellt und stank deutlich nach menschlicher Notdurft. Oder besser gesagt, nach männlicher. Wahrscheinlich schlugen die Taglöhner, bevor sie heimkehrten, hier noch einmal das Wasser ab. Seitlich am Haus führte nämlich eine überdachte Treppe nach oben, hinauf in die Wohnung und weiter zu den Dachkammern.
Der Doktor, der nun eines ihrer Bündel trug, stapfte mit eingezogenen Schultern voraus, und sie folgte ihm mit dem restlichen Gepäck die Treppe hinauf. Ihre Muskeln spannten sich an: Was würde sie erwarten?
«Eine Frage noch, Herr – ist das heimliche Gemach im Hof?»
«Nur für den Flickschuster und die Taglöhner», erwiderte er. «Ich – oder ich sage nun besser wir – haben drinnen einen Aborterker, von dem ein Fallrohr in die Grube führt. Das war mir sehr wichtig bei der Wahl meiner Wohnstatt, genau wie eine eigene Küche mit Kohlenwinkel, wo ich ungestört meinen Versuchen nachgehen kann. Vom Hof her gibt es sogar einen Zugang zu einem kleinen Gewölbekeller. Dort können wir Wein, Vorräte und die für mich notwendigen Utensilien lagern.»
«Utensilien?»
«Das, was ich für meine Versuche brauche, wie Antimon, Pottasche oder Eisenvitriol.»
«Aha», sagte sie nur, ohne dass sie verstand, wovon er redete.
Derweil hatte er die Wohnungstür geöffnet, und sie blickte in eine Küche, die deutlich größer war als ihre Wohnküche zu Hause. Neugierig sah sie sich um. Gegenüber dem Fenster, vor dem ein klobiger Tisch samt Eckbank stand, befanden sich der Wasserbottich für den Abwasch, ein halbhohes Holzregal mit allerhand seltsamen Gerätschaften und in der Ecke schließlich die gemauerte Feuerstelle, die zu ihrer Begeisterung so groß war wie die in der Schindhütte: Der Herd war nicht nur hüfthoch gemauert, sodass man sich beim Kochen nicht ständig bücken musste, sondern besaß auch eine weit heruntergezogene Rauchhaube, die Qualm und Funkenflug einfing und durch einen Schlot über das Dach ins Freie führte. Hier würde man kochen und essen können, ohne dabei halb im Rauch zu ersticken! Obendrein war die Wand hinter dem Herd mit feuerfesten Steinen verkleidet, und auf dem Rand des Kaminhuts steckten Holzzapfen, um die Kochgerätschaften aufzuhängen. Doch bis auf eine zerbeulte Stielpfanne, einen Feuerhaken und einen kleinen Herdbesen waren die Zapfen leer, der Stapel an hölzernem Essgeschirr im Korb war eher kläglich. Dafür reichte der Schwenkkessel, der auf halber Höhe an der Kette hing, für eine vielköpfige Familie aus. Die Holzkohle darunter war erloschen, wahrscheinlich seit längerer Zeit schon, und dementsprechend kalt war es herinnen. Aber das würde sie alles ändern. Und mehr Geschirr würde sie auch besorgen.
«Soll ich gleich als Erstes ein Feuer machen?», fragte sie. «Die Küche ist ganz ausgekühlt.»
«Nein, nein, das hat Zeit. Schau dich nur erst einmal um.»
Unwillkürlich wurde ihr Blick von dem halbhohen Regal neben dem Herd angezogen. Zuunterst fanden sich zwei äußerst seltsam geformte Gefäße, das eine aus Glas, das andere aus Metall, sowie ein birnenförmiger Glaskrug und ein kleines dreibeiniges Gestell aus Schmiedeeisen. Auf den beiden Brettern darüber standen mehrere mit Kork verstopfte dunkelbraune Gläschen, irdene Tiegel und abgegriffene Blechbüchsen, die vermutlich, wie sie es einmal beim Apotheker gesehen hatte, Arzneien enthielten. Über dem Regal war ein Nagel in die Wand geschlagen, an dem eine kleine Waage hing. So eine gab es auch im Hinterzimmer von Adrian Ertzsteins Schankstube, mit der er die Münzen für seine Hehlereigeschäfte abwog.
Der Medicus räusperte sich. «Eines versprich mir jetzt schon: Rühre niemals diese Dinge dort an. Vor allem der Alembik ist eine äußerst kostbare Gerätschaft.»
«Was ist ein Alembik?»
Er deutete auf das unterste Fach. «Man nennt ihn auch Destillierhelm oder Brennhut. Darin scheidet man in der Alchemie das Nützliche vom Überflüssigen, das Reine vom Unreinen, sprich: Hiermit braue ich meine Arzneien.» Fast streitbar musterte er sie. «Lass also die Finger von diesen Sachen, auch wenn du meinst, etwas sei schmutzig oder verdorben und müsse weg. Auch dein Staubwedel hat hier nichts zu suchen, sonst hast du den längsten Tag bei mir gearbeitet. Schwörst du das?»
Sie nickte erschrocken. «Ich schwöre es bei der heiligen Barbara und der Muttergottes.»
Sofort wurde seine Miene freundlicher. «Gut. Noch etwas. Wenn ich außer Haus bin, möchte ich nicht, dass du jemanden in die Wohnung lässt, von deinem Vater einmal abgesehen. Auch nicht deine Freundin Marie. Ihr könnt euch gern im Hof oder vor dem Haus treffen, aber nicht hier drinnen.»
«Aber ja, ich verspreche es Euch. Ihr könnt mir vertrauen», bekräftigte sie, wunderte sich aber insgeheim über seinen Argwohn. Hatte er Angst, beklaut zu werden? Oder hatte er etwas zu verbergen?
Er schien zufrieden mit ihrer Antwort.
«Dort drüben», er durchquerte in schnellen Schritten den Raum und öffnete den Verschlag neben der Eingangstür, «ist der Aborterker, und das hier», schon war er wieder auf der anderen Seite der Küche, «die Vorratskammer. Und hier», er riss die Tür zwischen Vorratskammer und Herd auf, «ist dein Reich. Bringen wir also deine Sachen hier herein.»
Wieselflink kehrte er zurück zur Wohnungstür, wo Barbaras Gepäck auf dem Dielenboden lag, und bückte sich danach.
«Verzeiht, Herr Medicus, aber habt Ihr es sehr eilig?»
Ein wenig verwirrt sah er auf. «Ich habe es immer eilig. Aber du hast recht. Du sollst dich ja in Ruhe umschauen. Entschuldige.»
Sie betraten ihre künftige, im Halbdunkel liegende Schlafkammer, und Barbara öffnete als Erstes das Fenster, das wie jenes in der Küche zur Hofseite hinausging. Als sie sich wieder umdrehte, entfuhr ihr ein Freudenruf: «Wie schön das ist!»
Zu Hause schliefen sie, wie der Doktor richtig vermutet hatte, alle auf Strohsäcken, hier aber erwartete sie ein richtiges Bett mit einem Himmel darüber. Mit seiner hölzernen, bunt bemalten Lade und dem schweren, dunkelroten Vorhang kam es ihr wahrhaft fürstlich vor. Darin würde sie auch in kalten Nächten nicht frieren. Und neben der Truhe für ihre Wäsche gab es sogar ein Tischchen mit einer Waschschüssel obendrauf.
«Deine Sachen kannst du später einräumen, komm.»
Er nahm sie beim Arm, ließ sie aber sogleich wieder los, als habe er sich verbrannt. Was sie fast schon belustigte. So angespannt, wie er die ganze Zeit wirkte, war er den Umgang mit Frauen ganz offensichtlich nicht gewohnt.