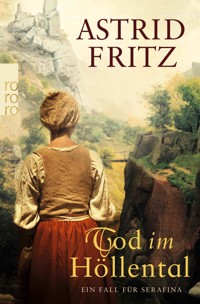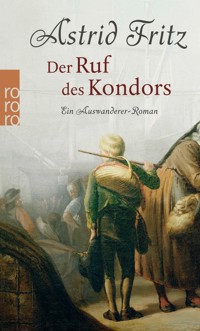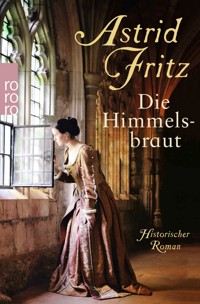9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hexe von Freiburg
- Sprache: Deutsch
«Hexentochter, du wirst sterben!» Als junges Mädchen erfährt Marthe-Marie, dass sie die Tochter einer Frau ist, die als Hexe galt. Sie macht sich auf in die Stadt, in der ihre Mutter grausam sterben musste. Doch als in Freiburg aufs Neue die Scheiterhaufen lodern, bleibt Marthe-Marie nur die Flucht. Sie schließt sich einer Truppe von Gauklern an, die kreuz und quer durch den Südwesten des Deutschen Reiches ziehen. Bald merkt sie, dass ihr zwei Männer auf den Fersen sind. Der eine sucht ihre Liebe, der andere ihren Tod. «Die Tochter der Hexe» ist ein großer Schicksalsroman, eine Liebesgeschichte und ein Porträt der Ausgestoßenen jener Zeit. «Ein sehr lebendiges Portrait der Ausgestoßenen, der Hexen, Bettler, Gaukler, Huren, Henker… Astrid Fritz' Bücher sind nicht nur anregendes Lesefutter für behagliche Abende im Sessel, sondern auch anschauliche Geschichtsstunde.» (Schwarzwälder Bote) «Die Tochter der Hexe bietet wie der Vorgänger nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch detaillierte Einblicke in den Alltag und die Denkweise hier im Land vor 400 Jahren.» (Stuttgarter Zeitung)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Astrid Fritz
Die Tochter der Hexe
Historischer Roman
Über dieses Buch
«Hexentochter, du wirst sterben!»
Als junges Mädchen erfährt Marthe-Marie, dass sie die Tochter einer Frau ist, die als Hexe galt. Sie macht sich auf in die Stadt, in der ihre Mutter grausam sterben musste. Doch als in Freiburg aufs Neue die Scheiterhaufen lodern, bleibt Marthe-Marie nur die Flucht. Sie schließt sich einer Truppe von Gauklern an, die kreuz und quer durch den Südwesten des Deutschen Reiches ziehen. Bald merkt sie, dass ihr zwei Männer auf den Fersen sind. Der eine sucht ihre Liebe, der andere ihren Tod.
«Die Tochter der Hexe» ist ein großer Schicksalsroman, eine Liebesgeschichte und ein Porträt der Ausgestoßenen jener Zeit.
«Ein sehr lebendiges Portrait der Ausgestoßenen, der Hexen, Bettler, Gaukler, Huren, Henker…
Astrid Fritz’ Bücher sind nicht nur anregendes Lesefutter für behagliche Abende im Sessel, sondern auch anschauliche Geschichtsstunde.» (Schwarzwälder Bote)
«Die Tochter der Hexe bietet wie der Vorgänger nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch detaillierte Einblicke in den Alltag und die Denkweise hier im Land vor 400 Jahren.» (Stuttgarter Zeitung)
Vita
Astrid Fritz studierte Germanistik und Romanistik in München, Avignon und Freiburg. Mit ihrer Familie zog sie anschließend für mehrere Jahre nach Chile. Heute lebt sie in der Nähe von Stuttgart. Ihre historischen Romane sind große Erfolge.
Weitere Veröffentlichungen
Die Hexe von Freiburg
Die Gauklerin
Der Ruf des Kondors
Das Mädchen und die Herzogin
Die Vagabundin
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2009
Copyright © 2005 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Bridgeman Berlin; Corbis; neuebildanstalt
ISBN 978-3-644-40491-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
1
Pünktlich zum Gregoriustag erwachte Konstanz aus dem Winterschlaf. Für die Schüler der Habsburger Grenzstadt war dieser Tag gleich zweifach Anlass zu Freude und Übermut: Nach vielen Wochen nasskalter, trüber Witterung wärmte heute zum ersten Mal eine kraftvolle Sonne ihre blassen Gesichter. Und wie jedes Jahr am zwölften März feierten die Knaben mit dem Tag des Schutzpatrons der Gelehrten, Schüler und Studenten auch das Ende des Wintersemesters. Für dieses eine Mal waren Lehrer und Rektoren ihres Amtes enthoben, mussten sie im Scholarengewand mit ihren Schützlingen zum Gregorisingen durch die Gassen ziehen und sich von den Zuschauern manchen Spottvers gefallen lassen. Während vorweg der Knabenrektor mit kindlicher Würde Schulschlüssel und Rute trug, balgten sich seine Mitschüler, als Schulmeister, Pfarrer, Medicus oder Advokat kostümiert, um die Süßigkeiten und Nüsse, die die Erwachsenen ihnen zuwarfen. Wer nicht am Straßenrand stand, lehnte sich aus den weit geöffneten Fenstern, ließ milde Frühlingsluft in die muffigen Stuben und freute sich an dem Treiben der Jungen und dem wolkenlos blauen Himmel.
Einzig in einer Seitengasse nahe des Obermarkts stand ein stattliches Haus abweisend wie ein Fels gegen die Brandung fröhlicher Ausgelassenheit. Die Fenster waren geschlossen und mit schwarzen Tüchern verhängt, die Menschen, die sich dem prachtvollen, mit Stuck reich verzierten Eingangstor näherten, hielten den Blick gesenkt. Nur im Obergeschoss stand ein Fensterflügel offen, um der Seele der sterbenden Hausherrin den Weg vor den Richterstuhl Gottes zu weisen.
Marthe-Marie spürte den eisigen Hauch des Todes, als die Frau, zu der sie zeitlebens Mutter gesagt hatte, den Kopf zur Seite neigte und zu atmen aufhörte. Längst hatte die Ansagerin, ein altes Weib, das sonst von Almosen lebte, ihren Gang von Haus zu Haus beendet, und noch immer saß Marthe-Marie am Sterbebett, die kalte Hand von Lene Schillerin zwischen den ihren, voller Angst, das Band zwischen ihnen endgültig zu lösen. Sie wusste, der Boden würde zu schwanken beginnen, wenn sie aufstünde, wusste, dass die Welt, die sich hinter der Türschwelle auftat, nie wieder hell und warm sein würde.
«Komm zu uns in die Küche.» Franziska berührte sie vorsichtig an der Schulter, dann löschte sie die Sterbekerze. «Die Leichenfrau ist gekommen, ihre Arbeit zu verrichten, und unten warten die ersten Gäste, um sich von Mutter zu verabschieden.»
Zu Marthe-Maries Erstaunen tat sich hinter der Tür kein Abgrund auf. Wie immer empfing sie das vertraute Knarren der Dielenbretter, als sie hinunter in die Küche ging. Neben dem erloschenen Herdfeuer saß zusammengesunken ihr Vater. Ferdi, der Jüngste und ihr Lieblingsbruder, stand am Fenster und starrte hinaus auf die letzten Schneereste im Hof. Aus der Stube drang das Stimmengewirr der Trauergäste, dann und wann hörte sie die tiefe Stimme ihres ältesten Bruders Matthias, der schon morgen zu seinem Fähnlein zurückmusste. Immer mehr Menschen kamen ins Haus zum Goldenen Pfeil, um von der Toten Abschied zu nehmen, denn Lene Schillerin, die Gattin des ehemaligen Hauptmanns, war in Konstanz nicht nur eine geachtete, sondern eine beliebte Frau gewesen.
Marthe-Marie trat an die Wiege, in der Agnes friedlich schlief, als ginge sie das alles nichts an, und strich ihrer Tochter über das winzige Gesicht.
«Warum hat Mutter sich aufgegeben?» Wie aus weiter Ferne drang die Stimme ihres Vaters zu ihr.
Sie blickte ihn an. Seit wann sah er so alt und gebrechlich aus? Das war nicht mehr der Mann, auf dessen Knien sie als Kind in die Schlacht geritten war und der sie heimlich Reiten gelehrt hatte, obwohl sich das für ein Mädchen ihres Standes nicht schickte. Der ihr und ihren Geschwistern bei jedem Heimaturlaub herrliche Süßigkeiten und Spielsachen mitgebracht hatte, um dann mit ihnen ans Seeufer zu schlendern und von seinen Abenteuern zu erzählen. Wie sehr hatte sie diesen stattlichen Mann immer bewundert, dem, wie Lene einmal seufzend und stolz zugleich gestanden hatte, jeder Weiberrock nachgelaufen war. Jetzt schien Raimund Mangolt, der sich in den habsburgisch-kaiserlichen Regimentern über Fähnrich und Feldweybel bis zum Feldhauptmann hochgedient hatte, mit einem Schlag ein gebrochener Mann.
Sie setzte sich neben ihn auf die Bank und schwieg.
«Warum nur?», wiederholte er tonlos.
Fast schmerzhaft spürte Marthe-Marie in diesem Augenblick die Liebe und Achtung, die sie für ihn empfand. Für diesen Mann, der nicht wirklich ihr Vater war und sie doch nie anders umsorgt hatte als seine leiblichen Kinder, der sich mit ihr gefreut hatte, als sie Veit, den Sohn seines besten Freundes, geheiratet hatte und schon kurz darauf guter Hoffnung war. Der sie getröstet hatte, als es zu einer Fehlgeburt kam, und der mit ihr gelitten hatte, als Veit, kaum dass ihre Tochter Agnes auf der Welt war, qualvoll am hitzigen Fieber starb.
Vielleicht erwartete er gerade von ihr Trost. Doch sie fand keine Worte, um diese Leere zu füllen. Ohnehin wusste jeder in der Familie, warum Lene gestorben war: Sie hatte das grausame Ende ihrer Base und zugleich besten Freundin, dazu den Freitod ihres Halbbruders nie verwunden. Drei Jahre war es nun her, dass Catharina Stadellmenin in Freiburg als Hexe den Flammen übergeben worden war und ihr heimlicher Geliebter sich während der Hinrichtung den Dolch ins Herz gestoßen hatte. Lene schien nur noch auf den Zeitpunkt gewartet zu haben, dass ihre älteste Tochter Marthe-Marie selbst Mutter wurde, um ihr die Wahrheit zu sagen, dann hatte sie sich in ihrer Schlafkammer niedergelegt und auf den Tod gewartet.
Die Wahrheit bedeutete: Catharina Stadellmenin, am 24. März Anno Domini 1599 erst enthauptet und dann zu Pulver und Asche verbrannt, war in Wirklichkeit Marthe-Maries leibliche Mutter.
«Willst du deinen Entschluss nicht noch einmal überdenken? Deine Schwester hat ein schönes Haus nahe der Hofkirche ausfindig gemacht, groß genug für uns alle. Ich bitte dich: Komm mit uns nach Innsbruck.»
Marthe-Marie entging das Flehen in Raimunds Blick nicht.
«Nein, Vater.»
Sie konnte verstehen, dass Raimund nach dem Tod seiner Frau nicht länger in Konstanz bleiben wollte. Innsbruck in Tirol war seine Heimat, dort war er geboren und aufgewachsen, dort lebte inzwischen seine Jüngste mit ihrer Familie. Doch Marthe-Marie hatte diese Stadt mit der bedrohlichen Wand des Karwendelmassivs im Rücken, in der sie viele Jahre ihrer Kindheit verbracht hatte, nie gemocht.
«Wovon willst du leben mit der Kleinen? Von dem spärlichen Erbe, das dir Veit hinterlassen hat? Ich selbst kann dir nicht viel Unterstützung zukommen lassen. Bleib doch wenigstens hier in Konstanz, bei Ferdi.»
«Es wird schon reichen.» Sie legte den Stapel Leibwäsche zu den Tüchern in die Kiste, die für den Stadtpfarrer bestimmt war, in der Hoffnung, dass er Lenes Kleidung tatsächlich an die Ärmsten der Armen in der Stadt verteilen würde. In den Augen dieser Leute war sie eine reiche Frau.
«Und was Ferdi betrifft: Er lebt nur für seine Steinmetzwerkstatt. Wir wären ihm ein Klotz am Bein.»
«So darfst du nicht von ihm reden. Ihr wart als Kinder immer ein Herz und eine Seele.»
«Das ist lange her.»
«Sind wir nicht immer noch eine Familie?» Raimund griff nach ihrem Arm. «Als du deine ersten Schritte gemacht hast, da hab ich mich gefreut wie ein Gassenjunge. Und wie stolz war ich auf dich, weil du so rasch lesen und schreiben lerntest. Du hast immer zu uns gehört, von Anfang an habe ich wie ein Vater für dich gefühlt – was ändert Mutters Tod daran?»
Sie lehnte sich an seine Schulter. Wie sollte sie es ihm erklären? Dass sich sehr wohl etwas geändert hatte – tief in ihrem Inneren?
Als sie vor einem halben Jahr die ganze Lebensgeschichte jener Frau erfahren hatte, die sie zum ersten Mal mit fünfzehn Jahren gesehen und sofort ins Herz geschlossen hatte, als sie damals erfahren hatte, dass diese Frau, die als Hexe verbrannt worden war, nicht ihre Muhme, sondern ihre Mutter war, da hatte eine unfassbare Wut auf die Dummheit und Niedertracht der Menschheit sie gepackt. Und es hatte ihr schier das Herz gebrochen, dass sie Catharina Stadellmenin niemals als Mutter hatte kennen lernen dürfen. Doch an ihrer tiefen Bindung zu Lene hatte diese entsetzliche Wahrheit nichts geändert. Als sich Lene dann zusehends in sich zurückzog, machte Marthe-Marie sich mehr Gedanken um ihre Ziehmutter als um sich selbst. Zwar versuchte der Hausarzt sie zu beruhigen: Es sei nur eine vorübergehende Schwächeperiode. Spätestens aber als Veit, dessen uneingeschränkte Liebe sie gerade erst zu erwidern begonnen hatte, nach nicht einmal zwei Jahren Ehe starb und Lene keine Regung über dieses Unglück zeigte, erkannte Marthe-Marie, dass ihre Ziehmutter wohl nicht mehr aufstehen würde. Nächtelang hatte sie Gott und die heilige Elisabeth beschworen, Lene wieder Kraft und Lebensmut zu geben, hatte es kaum noch ertragen, die Schlafkammer zu betreten und sich an das Bett der abgemagerten, weißhaarigen Frau zu setzen, die einmal so selbstbewusst, lebenslustig und schön gewesen war. Doch ihre Gebete wurden nicht erhört, und mit Lenes Tod wurde für Marthe-Marie das Haus ihrer Kindheit zur Fremde.
Jetzt erst senkte sich die Erkenntnis, dass sie eine andere war, wie ein Albdruck auf sie. Sie konnte ihrem Vater nicht weiter die Tochter, ihren Geschwistern nicht weiter die Schwester sein.
Marthe-Maries Blick fiel auf das kleine Ölbild über der Kommode. Sie nahm es in die Hand und betrachtete das Porträt der dunkelhaarigen Frau mit dem blassen, fein geschnittenen Gesicht und den dunklen Augen. Ihr Großvater, der Marienmaler Hieronymus Stadellmen, hatte dieses Bildnis seiner Ehefrau Anna einst gemalt.
Raimund trat hinter sie. «Wie ähnlich du deiner Großmutter siehst. Es ist, als ob du in einen Spiegel blicken würdest. Catharina hatte das Bild immer bei sich gehabt, wie einen Talisman, sagt Lene.» Er räusperte sich. «Aber es hat ihr kein Glück gebracht.»
«Es ist das einzige Andenken an meine Mutter, das ich besitze.»
Zum ersten Mal sprach sie in Raimunds Gegenwart von Catharina als ihrer Mutter. Sie hängte das Bild zurück.
Es war unter seltsamen Umständen in ihre Hände gelangt: An einem heißen Frühlingstag, gut ein Jahr nach der Hinrichtung von Catharina Stadellmenin, war ein Bote erschienen, der das Päckchen nur ihr selbst, Marthe-Marie Mangoltin, aushändigen wollte und der über den Absender nichts sagen konnte oder durfte. Sie hatte das Bild damals Lene gezeigt, die ihr nach einem ersten Augenblick ungläubiger Überraschung zunächst ruhig und gefasst erklärt hatte, dass es Catharinas Mutter darstelle und wie wichtig Catharina dieses Bildnis einst gewesen sei. Dann war sie, von einem Moment auf den nächsten, weinend zusammengebrochen. Um sie zu schonen, hatte Marthe-Marie ihr das beigelegte anonyme Schreiben nie gezeigt: «Ein Andenken an Catharina Stadellmenin. Von einem Freiburger Bürger, der die Stadellmenin sehr gut kannte.»
Inzwischen war sie sich beinahe sicher, dass bei diesem unbekannten Freiburger Bürger auch die anderen persönlichen Dinge ihrer Mutter zu finden wären – ihre Bücher und Briefe, die kleine geschnitzte Flöte und der kunstvoll verzierte Wasserschlauch, den Lenes Bruder Christoph ihr einst als Liebesbeweis geschenkt hatte.
Raimund Mangolt verschloss die Kleiderkiste. Regungslos stand er da, nur seine Schultern bebten. Marthe-Marie trat neben ihn, nahm ihn in die Arme und weinte mit ihm um den Menschen, den niemand in diesem Leben ersetzen konnte. So standen sie, bis das Hausmädchen an die Tür klopfte und verkündete, das Mittagsmahl stünde bereit.
Raimund wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. «Lass die Vergangenheit ruhen, Marthe-Marie. Der Gedanke, dass du nach Freiburg willst, macht mir Angst. Das ist kein guter Ort für dich.»
»Mach dir keine Sorgen, Vater. Niemand dort weiß, wessen Tochter ich bin.»
Vor der Entschlossenheit seiner Ziehtochter hatte Raimund Mangolt schließlich die Waffen strecken müssen. So reiste sie nun mit seinem Segen und seiner Unterstützung. Zum Schutz hatte er ihr seinen ehemaligen Quartiermeister mitgegeben, einen verlässlichen, schweigsamen Mann, dazu ein Bündel Papiere, die ihnen das Passieren der Grenzposten und zahlreichen Mautstellen am Hochrhein und im Oberrheintal erleichtern würden. Zum Abschied hatte sie ihm versprechen müssen, nach Innsbruck zu kommen, falls es ihr schlecht erginge.
Sie näherten sich der alten Zähringerstadt Waldshut, und es regnete bereits den zweiten Tag Bindfäden. Marthe-Marie verkroch sich tiefer unter das Verdeck, wo Agnes in ihrer Wiege ruhig schlief. Dem Quartiermeister vorne auf dem Kutschbock troff das Regenwasser von der Hutkrempe. Regnet’s am Georgitag, währt noch lang des Segens Plag, dachte Marthe-Marie und betrachtete missmutig den bleigrauen Himmel.
«Sollen wir uns nicht irgendwo unterstellen? Ihr seid ja völlig durchnässt.»
«Unsinn, Mädchen. Hab schon ganz anderes Wetter erlebt, wenn ich unterwegs war. Außerdem sind wir bald in Waldshut, dort kenne ich einen formidablen Gasthof.»
Er klatschte dem Rappen, der in langsamen Schritt gefallen war, die Peitsche über die Kruppe. Marthe-Marie schloss die Augen. Das sanfte Schaukeln des Gotschiwagens, eines leicht gebauten, mit Lederriemen gefederten Einspänners, machte sie schläfrig. Sie dachte daran, dass ihre Mutter damals, bevor sie sich zum ersten Mal in Konstanz begegnet waren, genau dieselbe Strecke gereist war, zusammen mit Christoph. Jene Reise musste einer ihrer glücklichsten Momente gewesen sein. Wie hatte sie gestrahlt, als sie über die Schwelle des Hauses am Obermarkt trat – Marthe-Marie konnte sich noch genau an diesen Moment erinnern, obwohl das weit über zehn Jahre zurücklag. Damals schon musste ihre Ziehmutter nahe daran gewesen sein, ihr die Wahrheit zu sagen. Vielleicht hätte das Schicksal dann eine andere Wendung genommen. Noch kurz vor Lenes Tod hatten sie ein langes Gespräch geführt, hatte Marthe-Marie sie ein letztes Mal gefragt, warum ihre Mutter sie einfach weggegeben hatte. Lene war über diese Frage fast böse geworden: ‹Glaube niemals – niemals, sage ich dir –, dass Catharina diese Entscheidung leicht gefallen ist. Ihre Ehe war nichts als die Hölle, und wenn herausgekommen wäre, dass sie vom Gesellen ihres Mannes ein Kind erwartete, wärst du im Findelhaus gelandet und sie und dein leiblicher Vater wären wegen Unzucht verurteilt worden. Und da dieses Scheusal sie schon längst nicht mehr angerührt hatte, außer wenn er sie prügelte, konnte sie ihm nicht einmal weismachen, er sei der Vater, selbst wenn sie es gewollt hätte.»
So war der einzige Ausweg für Catharina gewesen, ihr Kind heimlich bei Lene und Raimund zur Welt zu bringen, fern von Freiburg, und sich dann auf immer von ihm zu verabschieden. Nach außen hin gaben Lene und Raimund zunächst an, Marthe-Marie sei ein Findelkind, das sie an Kindes statt angenommen hätten, und nachdem sie nach Innsbruck gezogen waren, wusste ohnehin kein Mensch mehr um Marthe-Maries Herkunft, nicht einmal Lenes eigene Kinder.
Mit einem Ruck kam der Wagen zum Halten, und Marthe-Marie wurde aus ihren Gedanken gerissen. Sie streckte den Kopf nach draußen. Ein Bauer mit Maulesel hatte sich ihnen in den Weg gestellt und zog jetzt ehrerbietig die Mütze.
«Wenn ich den edlen Herrschaften einen Rat geben darf – kehrt um. Zum Schaffhauser Tor ist kein Durchkommen. Ein riesiger Tross Gaukler verstopft die Straße, weil ihnen der Einlass nach Waldshut verwehrt wird. Ihr könnt aber gleich hier rechts den Weg nehmen, ein kleiner Umweg nur, der geradewegs zum Waldtor im Norden der Stadt führt.»
«Beim heiligen Theodor!» Der Quartiermeister fluchte. «Müssen uns diese Zigeuner ausgerechnet jetzt in die Quere kommen!»
Dann warf er dem Bauern eine Münze zu, der Mann steckte sie in sein Säckel und zog pfeifend davon.
Jetzt waren deutlich dumpfe Trommelschläge zu hören, dazwischen erregte Männerstimmen. In der Ferne sah Marthe-Marie eine Reihe von bunt bemalten Karren, drum herum Weiber, Kinder, Hunde. Ein halbwüchsiges Mädchen in Lumpen, das am Wagenrad seine Notdurft verrichtete, starrte sie an und streckte ihr die Zunge heraus.
Marthe-Marie nahm ihre Tochter aus der Wiege und presste sie unter ihrem Umhang fest an sich. Sie hatte genug Reisen und Ortswechsel mitgemacht, um zu wissen, dass jegliche Wegstörung eine Gefahr darstellen konnte. Vor größerem Unglück aber war sie, St. Christophorus sei Dank, bisher verschont geblieben.
«Wenn das nun eine Falle ist?»
Der Quartiermeister lachte auf. «Man merkt, dass Ihr eine Soldatentochter seid. Immer auf alles gefasst. Aber macht Euch keine Sorgen. Zufällig kenne ich die Gegend hier sehr gut. Außerdem habe ich immer noch mein Kurzschwert, damit parier ich jeden Angriff.»
Agnes erwachte und begann zu schreien. Im Schutz des Verdecks gab Marthe-Marie ihr die Brust und betrachtete sie gedankenverloren. Bereits jetzt war zu erkennen, dass sie im Äußeren ganz nach ihr, nach Catharina und nach deren Mutter kommen würde – das Dunkle, Zarte bei den Frauen dieser Linie schien sich durchzusetzen. Ach, Agnes, dachte sie, du wirst niemals deinen Vater kennen lernen, so wie ich meinen nie gesehen habe.
Das nasskalte Aprilwetter ließ sie frösteln, und sie schob dem Kind die Haube tiefer in das Gesichtchen. Vielleicht würden sie gar nicht lange in Freiburg bleiben. Was sie nämlich Raimund Mangolt verschwiegen hatte: Sie würde sich auf die Suche begeben. Sie wollte Benedikt Hofer ausfindig machen, ihren leiblichen Vater, den Großvater ihrer Tochter.
2
Die alte Wirtin starrte sie stumm an, und ihre Lippen bebten. Schließlich ergriff Marthe-Marie das Wort.
«Es tut mir Leid. Ich hätte Euch nicht damit überfallen sollen. Ich weiß nicht einmal, was Ihr über diese schrecklichen Beschuldigungen denkt, die meine Mutter zu Tode gebracht haben. Vielleicht sollte ich besser meine Sachen nehmen und gehen.»
«Gütiger Himmel nein! Glaubt mir, ich weiß, dass Catharina nie etwas mit Hexerei zu tun hatte. Nein, nein, das ist es nicht. Ich kann es nur kaum fassen, dass Ihr Catharinas Tochter sein sollt. Ihre Lieblingsnichte wart Ihr, von Euch hat sie immer wieder gesprochen, von Euren Briefen erzählt und dabei bedauert, dass Lene und Ihr so weit weg wohnt. Ach Herrje, ach Herrje!»
Die schmale kleine Frau schüttelte den Kopf. «Und dann ist Eure Tochter ja Catharinas Enkelkind. Ach Herrje!» Sie ergriff gedankenverloren ein Händchen der Kleinen, die friedlich in Marthe-Maries Armen schlief. «Jetzt sehe ich auch die Ähnlichkeit zwischen Euch und Catharina in jungen Jahren. Wenn das noch mein Mann erlebt hätte!»
Dann fiel Mechtild wieder in Schweigen. Sie saßen im Schankraum des «Schneckenwirtshauses», eines kleinen Gasthauses, das sich neben der Freiburger Mehlwaage in der südlichen Vorstadt befand. Unter der niedrigen Holzdecke hingen noch der Essensgeruch und die Ausdünstungen der letzten Gäste, von draußen tönte der Singsang des Nachtwächters: «Böser Feind, hast keine Macht. Jesus betet, Jesus wacht.»
Marthe-Marie sah sich um. Hier hatte ihre Mutter als junge Frau bedient, hier hatte sie ihren späteren Ehemann kennen gelernt: den hoch angesehenen Michael Bantzer, Schlossermeister und Mitglied des Magistrats.
Es war ein Fehler gewesen, dachte Marthe-Marie, diese alte Frau, die eine gute Freundin ihrer Mutter gewesen war, mit der Vergangenheit zu belasten.
Als ob sie ihre Gedanken gelesen hätte, hob Mechtild den Kopf und sah sie geradeheraus an.
«Vielleicht ist meine Frage dumm – aber weshalb seid Ihr nach Freiburg gekommen?»
Ja, warum? Marthe-Marie fragte sich das, seitdem sie in Konstanz mit Agnes in die Kutsche gestiegen war. War es die Suche nach den persönlichen Hinterlassenschaften ihrer Mutter? Der Versuch, ihr Bildnis neu zu erschaffen, indem sie die Orte aufsuchte, an denen Catharina Stadellmenin gelebt, gearbeitet, gelitten hatte? Oder wollte sie ergründen, warum sie, Marthe-Marie Mangoltin, niemals ihre Tochter hatte sein dürfen?
Nun – zunächst hatte sie ein ganz konkretes Ziel: «Was wisst Ihr über Benedikt Hofer?»
«Über Benedikt Hofer? Wie kommt Ihr – ach Herrje. Jetzt sagt bloß – er ist Euer Vater!»
Marthe-Marie nickte.
«Selbstverständlich erinnere ich mich an ihn. Er war Geselle im Hause Bantzer. Aber ich wusste nicht, dass die beiden –.» Mechtild verstummte.
«Was für ein Mensch ist er gewesen?»
«Nun ja, ein junger Bursche eben, geschickt und sehr zuvorkommend, einer von Bantzers besten Leuten. Er hatte ein offenes, geradliniges Wesen, mit viel Humor, ganz anders als der Meister. Vielleicht wisst Ihr ja, wie schlimm sich Bantzer Catharina gegenüber aufgeführt hatte.» Sie rieb sich das Kinn. «Jetzt begreife ich auch, warum Catharina im Sommer damals für mehrere Wochen ins Elsass gereist war, zu Eurer Ziehmutter. Wir dachten alle, es sei, um ihre Anfälle von Schwermut zu kurieren. Dort seid Ihr zur Welt gekommen, nicht wahr?»
«Ja.»
«Mein Gott, wie elend muss Catharina zumute gewesen sein. Sie hatte sich nichts sehnlicher gewünscht als eine Schar Kinder, und die einzige Tochter, die sie bekam, musste sie hergeben!» Sie legte Marthe-Marie eine Hand auf den Arm. «Ich bin eine alte Frau, habe viel erlebt und viel gesehen und kannte Eure Mutter gut: Ihr müsst mir glauben, dass sie das nur tat, um Euer Leben zu retten. Denn wenn das ans Tageslicht gekommen wäre, hätte Bantzer euch alle vernichtet. Ich nehme an, dass selbst Benedikt Hofer nichts davon gewusst hat, denn als Catharina aus dem Elsass zurückkehrte, war er aus Freiburg verschwunden. Niemand wusste, wohin. Wir haben auch nie wieder von ihm gehört.»
Sie trank ihren Krug Dünnbier leer.
«Eure Mutter hatte nie jemandem schaden wollen. Ihr Verhängnis war, dass sie als Witwe, nach Bantzers Tod, endlich selbst über ihr Leben bestimmen wollte. Und das, das haben die Leute hier ihr nicht verziehen.»
Marthe-Marie sah die alte Frau an, die versunken neben ihr saß. Etwas ganz Ähnliches hatte Lene ihr einmal gesagt. Zum ersten Mal, seitdem sie das Stadttor von Freiburg passiert hatte, fielen die Anspannung und die Furcht vor dem, was auf sie zukommen würde, von ihr ab. Die Entscheidung, Mechtild aufzusuchen, war richtig gewesen, das spürte sie nun.
Die Wirtin hatte sich erhoben. «Gehen wir zu Bett. Morgen ist auch noch ein Tag. Kommt, ich zeige Euch Eure Kammer.»
«Wartet – nur noch eine Frage. Wo genau ist meine Mutter gestorben? Wo ist ihre Asche?»
Das Gesicht der alten Frau wurde zu einer Maske.
«Ich erzähle Euch alles, was Ihr wissen wollt. Nur über Catharinas Tod möchte ich nicht sprechen.»
«Bitte!»
Mechtild umklammerte mit beiden Händen die Stuhllehne, während sie mit stockenden Worten zu erzählen begann. Sie selbst sei nicht dabei gewesen, flüsterte sie, an jenem unglückseligen Tag habe sie sich in der dunkelsten Kellerecke verkrochen und gebetet.
«Versprich mir eins», sagte sie abschließend und fiel unwillkürlich ins vertraute du. «Verrate keiner Menschenseele hier, dass du die Tochter von Catharina Stadellmenin bist. Das könnte dir großen Schaden zufügen. Es braut sich wieder etwas zusammen in Freiburg. Und es wird schlimmer kommen als vor drei Jahren.»
Eine warme Maisonne strahlte vom Himmel, als sich Marthe-Marie zu ihrem schwersten Gang entschloss. Ihre Tochter, von der sie sich sonst niemals trennte, hatte sie in der Obhut von Mechtild gelassen. Nichts deutete auf die düstere Prophezeiung der Wirtin hin, weder das herrliche Wetter noch die Stimmung der Menschen in den Gassen, die sich, froh über das Ende der dunklen Jahreszeit, ihre Arbeit ins Freie geholt hatten oder schwatzend und scherzend beisammen standen. Hinter dem Schneckentor, das die südliche Vorstadt zur Dreisam hin abschloss, bog Marthe-Marie linker Hand zum Schutzrain ab, einer verdorrten Wiese, die zum Großteil von einem Schießplatz eingenommen wurde. Ihre Schritte wurden langsamer, als sie hinter dem Gelände der Armbrustschützen eine große kahle Fläche erreichte, in deren Mitte verwitterte Steinblöcke lagen. Dunkle Flecken und Schlieren hatten sich wie ein Muster auf den Granit gelegt. Ihr Blick konnte sich nicht lösen von den blutigen Spuren der zahllosen tödlichen Schwerthiebe. Wie viele endlose Momente der Angst, der ungeheuerlichsten Schmerzen und der Verzweiflung hatte ihre Mutter wohl ertragen müssen, bis schließlich die scharfe Schneide des Richtschwerts dem ein Ende bereitet hatte! Doch schlimmer noch, man hatte ihr verwehrt, was jeder Mensch für sich erhoffte: in Würde und Achtung zu sterben.
Marthe-Marie faltete die Hände und sank auf die Knie. «Herr, du bist die Auferstehung und das Leben. Wer an dich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist.»
Die Worte kamen hastig, kaum blieb ihr Luft zum Atmen. Dann endlich, nach vielen Gebeten an die Toten, wurde ihr leichter. «Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen.»
Hier also waren sie zu Tode gekommen, ihre Mutter durch die Folgen abscheulicher Verleumdung und blinder Besessenheit, ihr heimlicher Gatte Christoph durch seinen eigenen Dolch. Marthe-Marie war überzeugt: Auch wenn den beiden kein christliches Begräbnis in geweihter Erde zuteil geworden war, so hatten sie doch Aufnahme in das Reich Gottes gefunden. Christophs Selbsttötung mochte Sünde in den Augen der Kirche sein. Vor Gott, der verstehen und verzeihen konnte, würde er Gnade gefunden haben.
Marthe-Marie wischte sich die Tränen aus dem Gesicht und bekreuzigte sich. Mit einem Mal hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Sie blickte sich um, konnte aber nur einen Mauerwächter ausmachen, der in der Nähe des Tores auf und ab schritt.
Ein letztes Mal berührte sie die Richtblöcke, dann ging sie das kurze Stück hinunter zum Ufer der Dreisam. Ein Floß glitt auf der schwachen Strömung gemächlich an ihr vorbei, der Mann, der es lenkte, winkte ihr zu. Menschen wie dieser Flößer oder die freundlichen Marktfrauen heute Morgen oder der Stadtknecht, der dort oben seinen Dienst tat – sie alle waren vielleicht dabei gewesen, hatten mit gierigem Blick und offenen Mäulern das blutige Tun des Henkers begafft und waren dem Schindkarren auf dem Weg hinaus zum Radacker gefolgt, wo die drei enthaupteten Frauen unter dem Galgen dem Scheiterhaufen übergeben worden waren. Marthe-Marie hatte diesen Galgen bei ihrer Ankunft in Freiburg gesehen, dicht an der Landstraße nach Basel stand er. Doch jetzt erst wusste sie, dass dort die Flammen in den Himmel gelodert waren. Alles, was wichtig war, hatte Mechtild ihr erzählt. Auch dass die Asche der Delinquentinnen in die Dreisam gekippt worden war, genau wie der Leichnam von Christoph. Sie kniete nieder und netzte ihre Stirn mit dem Wasser des Flusses, der die sterblichen Überreste der beiden Liebenden aufgenommen hatte. Sie beschloss, auf dem Rückweg ins Münster zu gehen, um dort vier Kerzen zu entzünden und vier Ave Maria zu beten. Für Veit und Lene, für ihren Oheim Christoph und ihre Mutter.
Endlich hatte sie die Kraft gefunden, Abschied zu nehmen. Nun würde sie die Orte von Catharinas Leben aufsuchen können.
Von Mechtild hatte sie inzwischen Einzelheiten über den Nachlass ihrer Mutter erfahren. Einige Zeit nach der Hinrichtung war ein amtliches Schreiben der Stadt Freiburg nach Konstanz gegangen, mit der Mitteilung, dass die der Hexerei wegen verurteilte Malefikantin Catharina Stadellmenin laut Testament ihre Base zu Konstanz, Lene Schillerin, sowie deren Tochter Marthe-Marie Mangoltin als Erbinnen bestimmt habe. Nach Veräußerung von Haus, Grund und Inventar und nach Abzug der Geldbuße von zehn Pfund Rappen, der Ausgaben für die Turm- und Verfahrenskosten sowie der stattlichen Summe von 100 Gulden für die gewünschte Messe zu ihrem Seelenheil, gehalten durch den Stadtpfarrer des Münsters, sei von der Hinterlassenschaft für die Erbinnen kein Schilling übrig. Persönliche, von der Veräußerung ausgeschlossene Dinge seien desgleichen nicht vorhanden. An Lene in ihrem Schmerz war diese böse Nachricht vollkommen vorbeigegangen, doch Raimund hatte Mechtild und ihren Mann Berthold in einem Brief gebeten, in Erfahrung zu bringen, wer mit der Versteigerung betraut gewesen sei. Denn ihm käme es seltsam vor, dass der Erlös aus Catharinas Vermögen so gering gewesen sein sollte.
Als Wirtsleute kannten Mechtild und Berthold in Freiburg Gott und die Welt, und sie hatten bald herausgefunden, das niemand anderes als der städtische Buchhalter Siferlin die Inventarisierung und Versteigerung beaufsichtigt hatte – jener Hartmann Siferlin, der seine frühere Brotherrin Catharina Stadellmenin maßgeblich bei der Obrigkeit angeschwärzt und damit auf den Scheiterhaufen gebracht hatte.
«Dieser hinterhältige, hinkende Erzschelm», hatte Mechtild zu schimpfen begonnen, als sie Marthe-Marie davon berichtete. «Ich war mir sicher, dass der Kerl dich und Lene um euer Erbe betrogen hatte. Du musst wissen, schon als er noch Bantzers Compagnon war, hatte Catharina ihn in Verdacht, in die eigene Tasche zu wirtschaften.»
«Ich weiß. Ich kenne die Geschichte aus Lenes Berichten. Doch dieser Teufel ist seiner gerechten Strafe ja am Ende nicht entgangen – aufs Rad geflochten ohne die Gnade der Enthauptung.»
«Gott sei der armen Seele gnädig.» Die Wirtin deutete ein Kreuzzeichen an. «Dem hat hier in der Stadt sicher niemand eine Träne nachgeweint. Übrigens hatte ein gewisser Dr. Textor als leitender Commissarius den Fall unter sich. Der hatte Siferlin wohl schon seit langem des Betrugs gegenüber der Stadt verdächtigt und ihn in kürzester Zeit der fortlaufenden Veruntreuung und Unterschlagung überführt. Ein tüchtiger Mann.»
«Ein Henkersknecht, nichts anderes!» Marthe-Marie war erregt aufgesprungen. «Auch im Prozess gegen meine Mutter war er Commissarius. Er hat im Folterturm ihre ganze Geschichte aufgeschrieben, in den wenigen Augenblicken, in denen sie überhaupt fähig war zu sprechen. Angeblich, weil er sie für unschuldig hielt. Aber statt sich für sie einzusetzen, statt seinen Einfluss geltend zu machen, ist er einfach von seinem Amt als Untersuchungsrichter zurückgetreten, als ginge ihn die ganze Sache nichts an. Ein scheinheiliger Feigling, das war er!»
Sie schlug die Hände vors Gesicht. Mechtild ließ ihr Zeit, sich zu fassen, dann fuhr sie in ihrem Bericht fort.
Ihr Mann habe damals all seine Verbindungen zum Rat der Stadt spielen lassen, um Einsicht in die Inventarliste und in die Verkaufsurkunden zu erlangen, doch vergebens. Irgendwann hieß es dann, die Unterlagen seien bei einem Kellerbrand in den Archivräumen verkohlt.
«Du kannst dir denken, dass mir diese Auskunft erst recht keine Ruhe gelassen hat, und so bin ich eines Tages schnurstracks in Siferlins Kontor marschiert. Mochte das Geld verloren sein, so mussten sich doch irgendwo die persönlichen Habseligkeiten Catharinas befinden, die sie für dich und Lene bestimmt hatte. Erst tat der Schweinehund so, als wisse er nicht, wovon ich spräche, und wollte mich schon durch einen Gerichtsdiener hinausbefördern, doch als ich sagte – Gott verzeihe mir die kleine Notlüge –, ich stünde hier im notariellen Auftrag von Marthe-Marie Mangoltin, wurde er plötzlich hellwach. ‹Kennt Ihr die Mangoltin persönlich?› – ‹Ja›, schwindelte ich ein zweites Mal. ‹Und ihr liegt viel daran, ein Andenken an ihre Muhme zu besitzen.› – ‹Meines Wissens war die Mangoltin noch nie hier in Freiburg, oder?› Ich fand seine Fragen höchst seltsam, entgegnete, dass Catharina dich zwei-, dreimal in Konstanz besucht habe und ihr euch Briefe geschrieben hättet, und wollte wissen, was das mit der Hinterlassenschaft zu tun habe. ‹Gute Frau, nach allem, was Ihr erzählt, können sich die beiden nicht allzu nahe gestanden sein. Außerdem war die Stadellmenin laut Gerichtsunterlagen nur eine Tante zweiten Grades, nämlich nur eine Base von der Mutter der Mangoltin, habe ich Recht?› Dann stand er auf und wies zur Tür. ‹Wenn die Mangoltin die leibliche Tochter dieser Hexe wäre, dann hätte sie Anspruch auf den Plunder. So aber –.› Dabei flackerte sein Blick wie ein Irrlicht, mir wurde ganz anders. Kurzum: Als ich nicht gleich gehen wollte, kam ein Büttel und schleppte mich mit Gewalt hinaus. Ich konnte gerade noch fragen, wo denn die Sachen seien. Weißt du, was Siferlin da geantwortet hat? ‹In der städtischen Abortgrube.› Mir würde speiübel – was für ein Ekel dieser Mensch war!»
Marthe-Marie war bleich geworden. Dann war Siferlin dieser Freiburger Bürger, der ihr damals das Bildnis hatte zukommen lassen. Aber wenn sie doch angeblich keinen Anspruch darauf hatte? Und wo waren die anderen Hinterlassenschaften geblieben?
«Irgendetwas stimmt da nicht», sagte sie, nachdem sie Mechtild von der Geschichte erzählt hatte. Die alte Wirtin nahm ihre Hand und drückte sie fest.
«Ich bitte dich, Marthe-Marie, lass die Dinge ruhen. Dieser hinkende Bastard ist tot. Ein Andenken an deine Mutter hast du, und jetzt quäle dich nicht mehr mit unnützen Gedanken.»
Marthe-Marie verbrachte in den folgenden Tagen viele Stunden damit, mit ihrer kleinen Tochter auf dem Rücken die Stadt zu durchwandern.
So stand sie lange Momente vor Catharinas Elternhaus, dem schäbigen Fachwerkhäuschen im Mühlen- und Gerberviertel auf der Insel, wo es nach Lohe, geschabten Häuten und Schlachtabfällen stank, bis Agnes vor Hunger zu weinen begann. Sie wagte einen kurzen Blick in den «Rappen», jene verrufene Schenke in der Neuburgvorstadt, wo ihre Mutter ihre erste Stellung angetreten hatte, und ließ sich von Mechtild das kleine helle Zimmer in dem Gesindehäuschen zeigen, das Catharina während ihrer Zeit im «Schneckenwirtshaus» bewohnt hatte.
Sie verbarg sich im Schutz der hölzernen Lauben auf der Großen Gasse, als sie beklommen das Haus zum Kehrhaken beobachtete, das in seiner Größe und Vornehmheit ihr eigenes Elternhaus in Konstanz in den Schatten stellte: ein dreistöckiger Fachwerkbau mit mächtigem Erdgeschoss aus Stein. Hier hatte Catharina ihre unglücklichen Ehejahre mit dem Schlossermeister Bantzer verbracht. Durch das offene Hoftor war das rhythmische Hämmern auf Metall deutlich zu hören – noch immer befand sich im Hinterhaus eine Schlosserwerkstatt. Und wie ein Blitz traf sie die Erkenntnis: Dort hatte ihr leiblicher Vater als Geselle gearbeitet.
Ein andermal überquerte sie den stillen, mit einer alten Linde bestandenen Platz, der eingefasst war von den Mauern des Franziskanerklosters, vom Kollegiengebäude der Universität und der Ratskanzlei, wo der Magistrat über Catharinas Schicksal gerichtet hatte. Unwillkürlich bekreuzigte sie sich und eilte weiter in Richtung Predigerkloster, bis sie rechter Hand die Schiffsgasse erreichte. Das schmale Haus zur guten Stund schien unbewohnt, die Fensterhöhlen waren mit Brettern vernagelt. Ein toter Ort, wo noch vor wenigen Jahren Catharina als Witwe ihre glücklichsten Jahre verbracht hatte, wo sie Bier gebraut, mit ihren Freunden gefeiert und mit Christoph viele gemeinsame Tage und Nächte verbracht hatte. Marthe-Marie erinnerte sich an einen Satz, den Catharina ihr einmal geschrieben hatte: Die Jungfrau gehört dem Vater, die Ehefrau dem Gatten, nur die Witwe gehört sich selbst.
«Wollt Ihr das Haus kaufen?» Ein Mann, dessen vierkantiges Samtbarett ihn als Magister der Universität auswies, musterte sie eindringlich.
«Nein, nein.» Sie hatte das Gefühl, bei einer verbotenen Handlung ertappt worden zu sein. «Ich frage mich nur, warum das hübsche Haus leer steht. Entschuldigt mich jetzt, ich muss weiter.»
«Das Haus wäre aber zu einem äußerst günstigen Preis zu erwerben.»
«Habt Dank für die Auskunft, aber ich bin nicht von hier und habe keinen Bedarf, ein Haus zu kaufen.» Sie ging rasch weiter.
«Na, dann kann ich es Euch ja verraten», rief er ihr hinterher. «Hier hat eine leibhaftige Hexe gehaust. Deshalb will es niemand haben.»
Ohne Umwege kehrte Marthe-Marie ins «Schneckenwirtshaus» zurück und blieb für den Rest des Tages bei Mechtild.
Eigentlich hatte Marthe-Marie am kommenden Tag das Predigertor und das Christoffelstor aufsuchen wollen, um dort ein stilles Gebet für ihre Mutter zu sprechen. Doch allein der Gedanke, dass Catharina in den beiden Türmen wochenlang gefangen gelegen hatte und unaussprechlichen Qualen ausgesetzt gewesen war, raubte ihr fast den Verstand. Stattdessen mietete sie Maulesel und Karren und fuhr hinaus nach Lehen, wo Catharina zusammen mit Lene und Christoph den größten Teil ihrer Kindheit im Gasthaus der Schillerwirtin verbracht hatte.
Das Weingärtner- und Bauerndorf lag friedlich in der Morgensonne. Es wirkte überraschend wohlhabend und sauber. Auffällig waren die riesigen Ammonshörner, die in die Giebelfronten der meisten Häuser eingemauert waren – kostbare Fundstücke aus der Gegend, die für ewig währende Fruchtbarkeit standen und als Abwehrzauber gegen Feinde und Unwetter dienten. Als sie vor dem prächtigen Gasthof hielt, der direkt an der Hauptstraße lag, zögerte Marthe-Marie, abzusteigen und sich umzusehen. Ihr war nicht entgangen, dass ihr die Blicke sämtlicher Dorfbewohner gefolgt waren, seitdem sie die ersten Häuser passiert hatte. Als sich ein alter Mann ihrem Karren näherte, beeilte sie sich weiterzukommen. Erst vor dem Lehener Bergle, einem lang gestreckten Weinberg oberhalb der Kirche, zügelte sie ihr Maultier im Schatten einer mächtigen Kastanie und kletterte den Hang hinauf. Versonnen betrachtete sie das Dorf, in dem ihre Ziehmutter und ihre leibliche Mutter wie Schwestern aufgewachsen waren. Rechts und links des Kirchturms von St. Cyriak reihten sich die kleinen Fachwerkhäuser aneinander, eingebettet in Wiesen, Felder und Laubwälder in erstem kräftigem Grün. In der Ferne, vor der blassen Silhouette des Schwarzwalds, ragte der Münsterturm in den Himmel.
Doch selbst hier oben fand sie keine Ruhe. Sie kehrte zur Straße zurück und fand den Maulesel inmitten einer Schar von Kindern, die das Tier mit einer Weidenrute piesackten. Sie hatte nicht bedacht, dass sie in diesem beschaulichen Flecken, ganz anders als im Gedränge der Freiburger Gassen, auffallen würde wie ein bunter Hund, und beschloss, umgehend in die Stadt zurückzukehren.
Auf dem Rückweg kam sie an einem vornehmen Anwesen vorbei, das nur der ehemalige Herrenhof von Lehen sein konnte. Sie gab dem Maulesel die Peitsche, denn sie erinnerte sich plötzlich, dass der Hof nach dem Verkauf des Dorfes an die Stadt Freiburg von niemand Geringerem als Dr. Textor erworben worden war, dem Commissarius im Prozess gegen ihre Mutter. In diesem Moment schoss aus der Stalltür ein zottiger Hund auf sie zu und stellte sich ihr mit gefletschten Zähnen in den Weg.
Sie erhob sich vom Bock und schwang die Peitsche. «Verschwinde!»
Ein schriller Pfiff – und der Hund gab mit eingeklemmter Rute den Weg frei. Jetzt erst entdeckte sie den alten Mann auf der Bank, der sie mit einer Mischung aus Erstaunen und Unglauben anstarrte. Seine Kleidung war vornehm, der weiße Backenbart sorgfältig gestutzt, neben der Bank lehnten zwei Krücken.
Textor, dachte Marthe-Marie entsetzt, und trieb den Maulesel in Trab.
«Junge Frau, wartet!» Sie wandte sich kurz um und sah noch, wie sich der Alte mühsam mit Hilfe seiner Krücken erhob, dann war sie hinter dem Stallgebäude verschwunden und gelangte auf freies Feld. Ihr Herz schlug immer noch heftig, als sie die Mauern der Stadt erreichte, und sie schalt sich eine Närrin. Was hatte sie sich eigentlich erhofft von ihrer Reise nach Freiburg? Statt zu ihren Wurzeln zurückzufinden, fühlte sie sich zunehmend verfolgt. Hätte sie doch den Rat ihres Ziehvaters beherzigt und die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Jetzt war es zu spät.
Doch just an diesem Nachmittag kehrte Mechtild mit strahlender Miene von ihrem Gang über den Markt zurück.
«Stell dir vor, Marthe-Marie, da renne ich seit Wochen bei Pontius und Pilatus die Türen ein, um herauszufinden, wohin Benedikt Hofer damals fortgezogen sein könnte, und erfahre es heute ganz nebenbei in der Bäckerlaube. Der alte Geselle des Weißbäckers hat ihn nämlich persönlich gekannt.»
«Und?» Marthe-Marie, die ihrer Tochter gerade ein frisches Windeltuch anlegte, konnte das Zittern ihrer Hände kaum verbergen.
«Er ist nach Offenburg gegangen. Dort lebt wohl der mütterliche Zweig seiner Verwandtschaft.»
Marthe-Marie betrachtete Agnes’ lachendes Gesicht und ihre vom Schlaf verschwitzten dunklen Haare. Seltsam, die Augen wurden von Monat zu Monat blauer, ein klares, dunkles Blau. Dass ihr das noch nie aufgefallen war. Ein Mädchen mit fast schwarzen Haaren und blauen Augen.
«Marthe-Marie? Ist etwas mit dir?»
«Nein, nein. Also Offenburg, sagst du?»
Sie schien kurz vor dem Ziel zu sein. Es wurde Sommer, die Tage waren lang und warm, und schon morgen oder übermorgen konnte sie sich einen Wagen mieten und mit Agnes nach Offenburg reisen. Und dann? Würde sie an Benedikt Hofers Tür klopfen und sagen: Ich bin Eure Tochter, und das hier ist Euer Enkelkind? Sie schüttelte den Kopf.
«Vielleicht ist mein Vater ja längst gestorben.»
«Das findest du nur heraus, wenn du ihn aufsuchst. Aber du musst ja nichts überstürzen. Denk in Ruhe nach, was du tun willst, und entscheide dann. Ich würde mich freuen, wenn du hier bliebest. Du und Agnes, ihr habt wieder Leben in mein Haus gebracht, und so, wie du mir zur Hand gehst, möchte ich dich ohnehin nicht weglassen. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich könnte Erkundigungen einziehen, ob es eine Möglichkeit für dich gibt, das Bürgerrecht zu erwerben. Nur für alle Fälle.»
Aber bereits am nächsten Tag wusste Marthe-Marie, dass sie sich auf den Weg machen würde. Wenn nicht um ihretwillen, dann Agnes zuliebe, die niemanden hatte als sie selbst, ihre Mutter, und das war in Zeiten wie diesen nicht eben viel.
Sie leitete alles für die Reise in die Wege und hatte schon begonnen, ihren Besitz in Kisten zu verstauen, als ein böses Fieber sie packte und tagelang hartnäckig in seinen Klauen hielt. Über eine Woche musste sie das Bett hüten, und auch danach kam sie nur langsam zu Kräften.
«Jetzt siehst du, was du von meiner Hausgenossenschaft hast», sagte sie müde lächelnd zu Mechtild, nachdem sie den ersten kleinen Spaziergang unternommen hatte und sich sogleich wieder niederlegen musste. «Nichts als Kummer und Mühe. Dabei hast du genug zu tun mit dem Schankbetrieb. Aber du wirst sehen, nächste Woche bist du mich los.»
Doch es wurde nichts aus ihrer Abreise. Nun wurde Agnes krank, weinte und jammerte Tag und Nacht, bis Mechtild nach einer Hebamme schickte, die dem Kind mit einer braunen Salbe, die nach Knoblauch stank, den Leib massierte. Die Verdauung, sagte die Frau und wiegte sorgenvoll den Kopf. Höchst ungewöhnlich sei auch, dass das Kind erst jetzt, mit einem Jahr, seine Schneidezähne bekomme. Und dazu noch alle auf einmal.
«Gebt Ihr dem Kind noch die Brust?»
«Nein, seit einiger Zeit nicht mehr.»
«Dann soll es die nächsten zwei Wochen nur ungesüßtes Dinkelmus essen. Und gegen die Zahnschmerzen macht einen Aufguss aus Salbeiblättern. Auf das Zahnfleisch tupft Brennnesselsaft, das hilft gegen die Schwellung. Die Salbe lasse ich Euch da. Wenn Ihr vor Sonnenuntergang den Bauch damit einreibt, wird das Kind ruhiger schlafen.»
Kaum ging es Agnes besser, brach unerwartet früh und mit heftigen Wolkenbrüchen die kühle Jahreszeit an und verwandelte die Landstraßen in Schlammwüsten, bis die ersten Fröste und Schneefälle folgten. Marthe-Marie musste die Reise wohl oder übel auf das Frühjahr verschieben, wenn sie mit Agnes kein Wagnis eingehen wollte. Mechtild bemühte sich erst gar nicht, ihre Freude zu verbergen.
«So bleibt ihr beiden mir noch eine Weile erhalten.»
Auch Marthe-Marie hatte sich inzwischen an das Leben bei der alten Wirtin gewöhnt. Sie half nicht nur beim Bedienen der Gäste, sondern führte auch die Bestellungen, kontrollierte die Vorratshaltung und machte die Abrechnungen – alles Dinge, um die sich früher Mechtilds Mann gekümmert hatte und die Mechtild immer ein Gräuel gewesen waren. Abends, wenn die Gäste fort waren, saßen sie meist noch mit dem Knecht und der Köchin eine Weile zusammen, Agnes in ihrer Wiege nahe dem Kachelofen, und genossen ihren Abendschoppen Kaiserstühler.
Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte Marthe-Marie sich aufgehoben. Sie mochte sich gar nicht wehren gegen dieses tröstliche Gefühl. Und vielleicht hätte sie sich auch wirklich dazu entscheiden können, auf Dauer in Mechtilds Haus zu bleiben, wäre nicht jener Dezembermorgen gewesen, kurz nach Veits Todestag und damit dem Ende ihrer Trauerzeit als Witwe. Ein schriller Schrei weckte sie noch vor der Morgendämmerung. Sie rannte hinunter zur Haustür, wo Mechtild, im Hemd und mit aufgelöstem Haar, im Türrahmen lehnte und schwer atmend auf den Boden starrte. Auf der Schwelle lag eine kleine Holzflöte, in zwei Teile zerbrochen, und auf dem Dielenbrett stand mit Kreide geschrieben:
Die Hexentochter wird sterben!
3
«Und du hast niemanden weglaufen sehen?», fragte Marthe-Marie. «Oder Schritte gehört?»
Mechtild wirkte noch hagerer und kleiner als sonst.
«Nein, nichts. Ich bin von einem dumpfen Schlag aufgewacht; es hörte sich an, als ob jemand einen Stein gegen die Tür schleudert. Doch bis ich geöffnet hatte, war niemand mehr zu sehen. Außerdem war es ja noch ganz dunkel.»
Marthe-Marie legte die zerbrochene Flöte aus der Hand. Es gab keinen Zweifel, es war das Instrument, das Christoph ihrer Mutter in jungen Jahren geschnitzt hatte. Ganz schwach war noch die Gravur zu erkennen: «Für C von C».
«Gütiger Herr im Himmel, wer kann so etwas Schändliches tun?» Mechtild ließ sich auf die Ofenbank sinken. «Und wie kann irgendjemand wissen, dass du Catharinas Tochter bist? Kein Sterbenswort ist jemals über meine Lippen gekommen. Alle hier kennen dich als Marthe-Marie Mangoltin aus Konstanz.»
Vergeblich versuchte Marthe-Marie, ihre Gedanken zu ordnen. Der Schreck an diesem Morgen hatte sie tief getroffen. Wer konnte ihr drohen wollen? Und vor allem warum? Bis vor einem halben Jahr hatte sie hier in Freiburg doch keine Menschenseele gekannt.
Mechtild sah sie ratlos an. «Vielleicht war es nichts weiter als ein böser Scherz. Vielleicht gibt es gar niemanden, der die Wahrheit kennt, und der Übeltäter ist einer von diesen Trunkenbolden, die wir erst kürzlich an die frische Luft gesetzt haben. Aus Rache beleidigt er dich nun als Hexe. Leider Gottes hört man in letzter Zeit die Leute wieder ständig über Teufelsbuhlschaft und Schadenszauber schwatzen.»
«Auf der Schwelle stand Hexentochter – nicht Hexe. Darauf kommt doch niemand aus Zufall. Und außerdem –» Sie stockte. «Siferlin hat dich angelogen, damals in seinem Kontor. Nichts von den Dingen meiner Mutter ist in der Abortgrube gelandet – er hat alles aufbewahrt. Ich bin mir sicher, er hat auch ihre Bücher und Briefe und den verzierten Wasserschlauch von Christoph. Und er hat seine Gründe, dass er alles aufbewahrt. Siehst du es nicht? Er führt etwas im Schilde.»
«Marthe-Marie – Siferlin ist tot!»
«Weißt du das mit Sicherheit? Vielleicht ist er seiner Hinrichtung entkommen? Vielleicht hat man statt seiner irgendeinen armen Teufel aufs Rad geflochten? Und der saubere Dr. Textor hat einmal mehr weggeschaut, weil ihm Recht und Unrecht einerlei sind.»
«So beruhige dich doch. Du machst dich ganz verrückt mit solchen Hirngespinsten.»
«Nein, warte, Mechtild. Was, wenn Siferlin längst weiß, dass ich Catharina Stadellmenins Tochter bin? Und mich nun ebenso als Hexe anzeigt wie damals meine Mutter? Du hast doch selbst erzählt, wie er dich damals ausgefragt hat über mich, und wie seltsam er sich dabei benommen hat. Und weil er herausgefunden hat, wer ich bin, hat er das Bildnis damals ausdrücklich mir und nicht etwa Lene zukommen lassen.»
«Aber der Kerl lebt doch längst nicht mehr! Du verrennst dich da in deine Phantastereien.»
«Er hat meine Mutter gehasst und in den Tod getrieben. Und mich, ihre Tochter, hasst er ebenso.»
«Bitte, Marthe-Marie, hör jetzt auf damit. Mir ist noch ganz schlecht von dem Schrecken, da fängst du an, Gespenster zu sehen und Tote auferstehen zu lassen. Ich weiß wirklich nicht, was mich mehr ängstigt. Komm, lass uns zu Morgen essen und über die Einkäufe sprechen. Das bringt dich auf andere Gedanken.»
Erst jetzt bemerkte Marthe-Marie, wie elend Mechtild aussah. «Du hast Recht. Verzeih, ich wollte dich nicht verrückt machen. Vielleicht war es ja wirklich einer dieser versoffenen Leinenweber.»
Mechanisch machte sie sich an die tägliche Arbeit, und das Entsetzen begann langsam in Wut umzuschlagen. Wer auch immer ihr drohen mochte – sie würde die Augen offen halten und versuchen, es herauszufinden.
4
O ja, Meister Siferlin.
Ich weiß noch jedes Eurer Worte auswendig: «Die Tochter der Hexe heißt Marthe-Marie Mangoltin. Sie lebt in Konstanz. Bevor du sie tötest, frag sie, in welchem Haus sie ihre Wurzeln hat. Dort wirst du deinen Lohn finden, den Wasserschlauch ihrer Mutter, er ist voller Gold. Doch vorher musst du sie töten, sie und all ihre Nachkommen.»
Ihr hattet Recht. Die Hexe hat noch eine in Sünde geborene Tochter. Und das Vögelchen ist in sein Nest zurückgeflogen gekommen – ganz wie Ihr es prophezeit hattet. Wie klug und wohl berechnet von Euch, sie mit dem Bildnis von Stadellmenins Mutter nach Freiburg zu locken. Mit Speck fängt man Mäuse.
Gewiss habe ich ihr einen Todesschrecken eingejagt, als sie diese kleine hässliche Flöte zerbrochen auf der Türschwelle gefunden hat. Nun hat sie erkannt, dass sie nicht unbeobachtet ihrem teuflischen Treiben nachgehen kann.
Ich weiß, es hat seine Zeit gebraucht, bis ich sie ausfindig gemacht habe. Aber ich wohne nun mal draußen vor dem Tor, und seit ich das Amt meines Vaters übernommen habe, muss ich in Wirtshaus und Kirche allein und auf meinem eigenen Stuhl sitzen. Da erfährt man nur noch wenig Neuigkeiten; es sind sich ja alle zu fein, mit mir zu sprechen, und sie haben Angst vor mir. Doch Geduld führt zum Ziel, das habe ich früh gelernt.
Wenn Ihr sie sehen könntet – diese zarten Rundungen ihres Fleisches, fast knabenhaft, mit den festen Brüsten, dazu wie bei ihrer Mutter das dichte schwarze Haar, in dem sich satanische Finsternis spiegelt. Dieser dunkle Blick, der die Sinne des Mannes vernebelt und vergiftet, ihn ins Verderben zu ziehen versucht.
Aber ich bin stärker als sie.
Ihr glaubt mir doch, Meister Siferlin, dass ich es nicht nur um des Goldes willen vollbringe? Ihr und ich, wir sind beseelt vom selben Feuer, vom selben Glauben an den Kampf gegen den Satan im Weib. Wir wissen, dass das Weib von Natur aus wild und triebhaft ist wie ein Tier, nur auf die Erfüllung seiner Begierden und Lüste bedacht. Und so bedient sich der böse Feind der Leiber schöner Frauen, um uns Männer zu den abscheulichsten Ausschweifungen zu verführen. Ekelhaft! Wie Ungeziefer im Garten muss diese teuflische Versuchung von unserer Erde getilgt werden. Muss ausgemerzt werden mit Feuer und Schwert. Denn steht nicht schon bei den Predigern geschrieben: Gering ist alle Bosheit gegen die Bosheit des Weibes?
Ich weiß, mein Freund und Meister, dass Ihr mich hören könnt dort droben im Himmelreich, dass Eure Seele mir zur Seite steht. Seid nur gewiss: In mir habt Ihr einen treuen und fähigen Nachfolger gefunden. Denn ein göttlicher Wille hat mir meine Bestimmung offenbart: Ich bin ausersehen, das Böse aufzuspüren und zu vernichten. Das Gefäß der Sünde, dieses verführerische Weib. Und ich gelobe Euch, ich werde meine Pflicht erfüllen und diese Mission zu Ende bringen.
5
Den ganzen Januar über lag die Stadt unter einer dichten Schneedecke. Wagen und Karren wurden nicht mehr eingelassen, nur zu Fuß kam man durch die Gassen, und selbst das war mühsam genug. Marthe-Marie bot sich an, den täglichen Gang zu den Händlern und Marktleuten auf der Großen Gasse zu übernehmen.
So zog sie jeden Morgen mit der Köchin los, Mechtilds Bestellungen im Kopf – ein gutes Gedächtnis hatte sie schon immer gehabt. Sie genoss die Ruhe und Bedächtigkeit, zu der die verschneiten und vereisten Wege die Menschen zwangen. Mit hoch erhobenem Kopf ging sie von Stand zu Stand, von Laube zu Laube, grüßte freundlich und beobachtete dabei aufmerksam, in welcher Weise die Leute ihr begegneten. Jeder, der sie kannte, sprach sie an, trug ihr Grüße für Mechtild auf oder erkundigte sich nach ihrer kleinen Tochter.
Je länger der Frost anhielt, desto spärlicher wurde das Angebot an Nahrungsmitteln und desto mehr Bettler tauchten in den Straßen auf. Anfangs verteilte Marthe-Marie noch hin und wieder Brotkanten, doch bald standen sie an jeder Ecke, und Marthe-Marie zwang sich, hart zu bleiben.
«Wenn es weiter so kalt bleibt, kann ich meinen Gästen außer Salzfleisch nichts mehr anbieten», seufzte Mechtild. «Außerdem fällt mir hier im Haus bald die Decke auf den Kopf.»
Endlich schlug das Wetter um. Am Morgen hatte es noch einmal heftig zu schneien begonnen, aber als Marthe-Marie ihre Besorgungen beendet hatte, ging der Schnee in Regen über. Der Holzträger neben ihr, der einen Korb Brennholz für sie heimschleppte, fluchte, weil ihm das Wasser ungehindert in den Kragen lief.
«Wir sind ja schon da, guter Mann. Bringt das Holz bitte in die Schankstube.»
Doch der Holzträger blieb mit einem Mal wie angewurzelt stehen. Vor seinen Füßen, direkt am Eingang zum Wirtshaus, hatte jemand mit schwarzer Asche etwas in den fest getretenen Schnee gezeichnet.
Es war ein fünfzackiger Stern, ein Drudenfuß.
Marthe-Marie spürte, wie Übelkeit in ihr hochstieg. Sie schob den Mann brüsk zur Seite und fuhr mit dem Absatz über das Pentagramm, wieder und wieder, bis es sich in Eisbrocken und grauen Schlamm aufgelöst hatte.
«Was glotzt Ihr so?», herrschte sie den Träger an und nestelte mit zitternden Fingern das Handgeld aus ihrer Börse. «Ihr könnt gehen. Los jetzt.»
In der Stube musste sie sich erst einmal hinsetzen. Sie schloss die Augen. Wenn der Holzträger nun überall in der Stadt herumerzählte, was er gesehen hatte?
«Du musst bei Gericht Anzeige erstatten», sagte Mechtild, als Marthe-Marie ihr alles erzählt hatte. «Wenn du dich nicht wehrst, bleibt für immer ein Schatten der Unehre auf deinem Namen.»
«Du weißt doch selbst, dass ich kein Recht dazu habe, vor Gericht zu gehen. Ich bin eine Fremde, ich habe weder Bürgerrecht noch einen Vormund hier in der Stadt.» Sie setzte eine entschlossene Miene auf. «Nein, ich muss schon selbst herausbekommen, wer mir Böses will.»
Wie zum Trotz begleitete sie Mechtild in den nächsten Wochen bei den Einkäufen. Wenn irgendwelche Gerüchte über sie im Umlauf waren, dann wollte sie die auch als Erste erfahren. Doch die Menschen auf dem Markt und in den Gassen verhielten sich wie immer. Mal waren sie freundlich, mal mürrisch, je nach Laune und Stimmung.
Die Häuserwände hallten wider von den Trommelschlägen und Fanfarenstößen, Peitschen knallten, Rätschen schnarrten an jeder Straßenecke. Die ganze Stadt schien zu erbeben vom Lärm der Musikanten, die engen Gassen barsten schier unter dem Andrang der Menschenmassen. Männer, Frauen und Kinder, Bettler und Ratsherren, Geistliche und Adlige schoben sich in dichten Trauben vorwärts, wobei in diesen Tagen von niemandem mit Gewissheit zu sagen war, ob das, was er darstellte, Täuschung oder Wirklichkeit war. Denn die meisten hatten sich verkleidet oder verbargen zumindest das Gesicht hinter einer Maske.
Marthe-Marie saß an einem Holztisch vor der Wirtschaft und verkaufte zusammen mit der Köchin Theres, mit der sie längst ein freundschaftliches Verhältnis verband, frische Krapfen. Es lag nicht nur an Mechtilds Geschäftssinn, dass sie während der Fastnachtstage ihren Schanktisch draußen aufzustellen pflegte. Man hatte von hier auch einen guten Blick auf die Festzüge der Zünfte, die durch die Schneckenvorstadt zum Martinstor und weiter die Große Gasse hinaufzogen. Gerade eben tanzte ein Arlecchino heran, der mit seiner Holzpritsche den Weg frei schlug für den Umzug der Schreinergesellen. Hinter drei Fanfarenbläsern erschien der Fahnenschwinger mit der rot-weißen Fahne, die das Wappen der Zunft, die Arche Noah, zeigte. Ihm folgten zwei helmbewehrte Spießträger, die drei Türken mit Krummsäbel und Turban an Stricken hinter sich herzerrten. Unter Johlen und Gelächter bewarfen die Zuschauer die gefangenen Muselmanen mit Mehltüten.
«Einer von den Türken ist mein Bruder», brüllte Theres Marthe-Marie ins Ohr. «Das geschieht ihm recht.»
Auf dem Eselskarren, der folgte, thronte der Kaiser Rudolf persönlich und grüßte huldvoll nach allen Seiten, während eine vollbusige, grell geschminkte «Hofdame» bunte Zuckerkugeln mit ihren kräftig behaarten Händen unters Volk schleuderte. Als sich Marthe-Marie nach den Süßigkeiten bückte, schlich ein Bursche mit grinsendem Schweinskopf auf den Schultern hinter sie und stahl einen Krapfen. Sie drohte ihm mit der Faust, darauf schwang er eine dicke, rot bemalte Hartwurst, die ihm zwischen den Lenden herabhing, vor ihrer Nase und verschwand dann in der Menge.
«Schweinehund!» Marthe-Marie musste lachen.
Eben flanierten in einer Eskorte von Trommlern die Schreinergesellen vorbei, mit Bändern und Abzeichen geschmückt und mit riesigen Federn auf Hüten von Hobelspänen. Theres sprang von der Bank. Sie hatte unter den Musikanten ihren Bräutigam entdeckt. Mit einem Krapfen in der Hand rannte sie mitten in den Umzug und stopfte ihrem Trommler den Krapfen in den Mund, dass er kaum noch Luft bekam. Die Zuschauer lachten und klatschten Beifall. Als sie zurücklief, war ihr Platz von einer Teufelsgestalt besetzt, die sich an Marthe-Marie presste und den Kopf an ihren Brüsten rieb. Sie hatten Mühe, den aufdringlichen Kerl von der Bank zu stoßen.
«Himmel, hat der gestunken.» Marthe-Marie schüttelte sich. «Wie ein brünstiger Geißbock.»
Hinter der letzten Musikantentruppe rollte ein langer Wagen, der ganz offensichtlich nicht zu den Schreinern gehörte. Die Seitenflächen waren mit Masken und Figuren in schreienden Farben bemalt, an hohen Stangen spannten sich Schnüre mit bunten Wimpeln, und über dem Heck erhob sich ein Blechschild mit dem verschnörkelten Schriftzug «Leonhard Sonntag & Compagnie». Auf dem Wagen selbst drängte sich, eng wie die Heringe im Salzfass, ein gutes Dutzend Gaukler, manche in prächtigen Kostümen, andere fast nackt, den Körper über und über bemalt. Auf einem Podest stand ein glatzköpfiger Priester, schleuderte Asche über die Zuschauer, reckte immer wieder die Arme zum Himmel und schrie: «O gottlose Fasenacht, hinfort mit dir!», bis ein verwegen aussehender Landsknecht ihm von hinten den Mund zuhielt und seinerseits, mit schrecklichem Akzent und falscher Aussprache, brüllte:
«Fastnacht lebe hoch! Kommet zu Leonhard Sonntag und seine in Welt berühmte Compagnie. Heute, morgen und übermorgen auf Münsterplatz. Wir zeigen Firlefanz und Schabernack, Affentanz und Kakerlak. Samt diesem Jammersack Hans Leberwurst.» Er gab dem Priester einen Tritt in den Hintern. «Und exklusiv für Publikum von diese schöne Stadt wir zeigen Paradies, was drei Meilen hinter Weihnacht liegt, wir zeigen Schlaraffenland von berühmte Dichter Hans Sachs.»
Der Priester schlug den Landsknecht mit der Faust nieder und begann wieder zu lamentieren – dann war der Wagen aus Marthe-Maries Blickfeld verschwunden. Ein Großteil der Menschen folgte grölend den Komödianten, die anderen, nicht weniger laut, begannen auf der Straße zu tanzen: Männer in Frauenkleidung mit falschem Busen und Haar, Frauen, die als Soldaten gingen, Mönche, Narren und Teufel, wilde Männer mit Keulen und nackt bis auf ein Fell um die Hüften, Harlekine auf Stelzen, bunte Vögel mit Flügeln und langen Schnäbeln, Affen auf allen vieren, mittendrin ein splitternackter Mann, der sich mit Würsten, Hühnern und Hasen behängt hatte. Trommler, Pfeifer und Narren im Schellenkostüm gaben den Rhythmus vor, die Umstehenden hielten den Tänzern Krüge mit Bier und Wein an die Lippen oder spritzten sie nass. Kaum einer zeigte sein wahres Gesicht, die Welt war auf den Kopf gestellt.
Jetzt erst bemerkte Marthe-Marie, dass am Schanktisch eine schlanke Gestalt lehnte und sie unaufhörlich ansah: Ein Wegelagerer, in buntscheckiger Jacke, mit Federhut und schwarzem Tuch vor dem Gesicht.
«Wollt Ihr einen Krapfen?»
Der verkleidete Räuber nickte stumm. Von seinem Gesicht waren nur die nussbraunen Augen mit dunklen Brauen und langen Wimpern zu sehen. War es eine Frau? Wer mochte das schon wissen an Fastnacht, wo Frauen als Männer und Männer als Frauen gingen, um das andere Geschlecht zum Narren zu halten. Ohne den Blick von Marthe-Marie zu wenden, legte der Räuber ihr ein paar Münzen in die Hand und nahm den Krapfen entgegen. Da drängte ihn einer der wilden Männer beiseite und küsste erst Marthe-Marie, dann Theres mitten auf den Mund.
«Wollt ihr hier versauern? Kommt mit, ich lass euch was Besseres kosten als eure langweiligen Krapfen.»
Marthe-Marie schob ihn weg. «Wir haben zu tun.»
«Ach was, ihr habt lang genug herumgehockt.» Mechtild trat neben sie. «Geht nur los, ich mache hier weiter.»
«Schläft Agnes?»
«Wie ein Stein. Ein Wunder bei diesem ohrenbetäubenden Krach. Nun geht schon, ich werde schon nach der Kleinen sehen.»
Sie schoben sich durch die Menschenmasse Richtung Martinstor. Marthe-Marie drehte sich noch einmal um und sah für einen Augenblick, inmitten der wogende Menge von Masken und geschminkten Gesichtern, die nussbraunen Augen mit den langen Wimpern, dann waren sie verschwunden.
Theres zerrte sie weiter. «Komm, wir suchen die Komödianten.»
Doch auf der Großen Gasse in Richtung Münsterplatz war kein Durchkommen. Ein Mönch neben Marthe-Marie hielt ihr seinen Weinkrug hin, und sie trank ihn kurzerhand leer, so durstig war sie. Als sie seine Hand auf ihrem Busen spürte, schlug sie ihm hart auf die Finger.
«Versuchen wir es über die Salzgasse. Falls wir uns verlieren, treffen wir uns vor dem Kornhaus», schrie sie Theres ins Ohr. Auch die Salzgasse war voller Menschen, doch es ging wenigstens vorwärts. Sie hielten sich, so gut es ging, am Rande des Stroms.
Da spürte sie einen heißen Atem am Ohr.
«Hexentochter!»
Sie fuhr herum. Theres war verschwunden, statt ihrer drängte sich eine Teufelsgestalt gegen ihren Leib. Sie war sich sicher: dieselbe, die sie zuvor am Tresen bedrängt hatte.