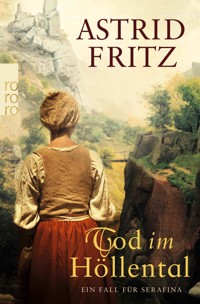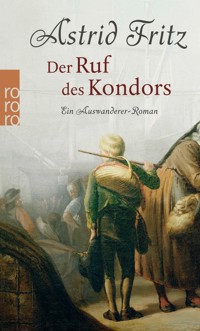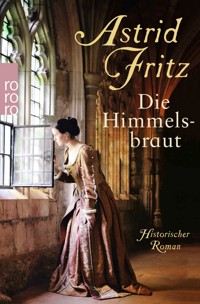9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein fanatischer Inquisitor, eine junge Frau, eine erbarmungslose Hexenjagd Schlettstadt im Elsass 1484: Margaretha, die Mutter der jungen Krämertochter Susanna, liegt tot in der Stube aufgebahrt. Bruder Heinrich, päpstlicher Inquisitor und Prior des hiesigen Predigerklosters, erscheint, um Trost zu spenden. Fast väterlich sorgt er sich um die junge Susanna. Doch bald schlägt die Fürsorge in Wahn um. Er lässt Susanna nicht mehr aus den Augen. Was sie nicht weiß: Seit einiger Zeit verfolgt Bruder Heinrich als Inquisitor die Vernichtung der «brandgefährlichen Sekte der Hexen». Viel zu spät erkennt Susanna, dass auch sie sich vor Heinrich in Acht nehmen muss. Ein fesselnder Roman um die historische Figur des Dominikanerbruders Heinrich Kramer, den Verfasser des berüchtigten «Hexenhammers».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Astrid Fritz
Der Hexenjäger
Historischer Roman
Über dieses Buch
Ein fanatischer Inquisitor, eine junge Frau, eine erbarmungslose Hexenjagd
Schlettstadt im Elsass 1484: Margaretha, die Mutter der jungen Krämertochter Susanna, liegt tot in der Stube aufgebahrt. Bruder Heinrich, päpstlicher Inquisitor und Prior des hiesigen Predigerklosters, erscheint, um Trost zu spenden. Fast väterlich sorgt er sich um die junge Susanna.
Doch bald schlägt die Fürsorge in Wahn um. Er lässt Susanna nicht mehr aus den Augen. Was sie nicht weiß: Seit einiger Zeit verfolgt Bruder Heinrich als Inquisitor die Vernichtung der «brandgefährlichen Sekte der Hexen». Viel zu spät erkennt Susanna, dass auch sie sich vor Heinrich in Acht nehmen muss.
Ein fesselnder Roman um die historische Figur des Dominikanerbruders Heinrich Kramer, den Verfasser des berüchtigten «Hexenhammers».
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2018
Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung bpk, John Foley/Trevillion Images, The Travellers, 1836 (oil on canvas), Christian Ernst Bernhard Morgenstern (1805–67)/Private Collection/Photo © Christie’s Images/Bridgeman Images
ISBN 978-3-644-20056-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
«Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet werden, denn sie richten viel Schaden an, was bisweilen ignoriert wird; sie können nämlich Milch, Butter und alles aus einem Haus stehlen, indem sie es aus einem Handtuch, einem Tisch, einem Griff melken, das ein oder andere gute Wort sprechen und an eine Kuh denken. Und der Teufel bringt Milch und Butter zum gemolkenen Instrument. Sie können ein Kind verzaubern, dass es ständig schreit und nicht isst, nicht schläft etc. Auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, dass der Körper verzehrt wird. Wenn du solche Frauen siehst, sie haben teuflische Gestalten, ich habe einige gesehen. Deswegen sind sie zu töten.»
Martin Luther: Predigt über Exodus 22,18. Wittenberg 1526
Kapitel 1
Schlettstadt im Elsass, Juni 1484
Die letzten Nachbarn hatten das Haus verlassen, um sich an diesem sonnigen Frühsommermorgen an ihr Tagwerk zu machen. In der Wohnstube waren die Kerzen niedergebrannt, die noch immer verschlossenen Fensterläden sperrten die Geräusche von der Gasse aus. Nur die leisen Atemzüge meines um drei Jahre älteren Bruders Martin, der auf der Bank in der Fensternische eingenickt war, durchdrangen die bedrückende, düstere Stille.
Ich wischte mir die Tränen aus dem Gesicht und trat an den Eichenholztisch, auf dem die Mutter im weißen Totenhemd aufgebahrt lag. Ein Leintuch, das ihr bis zu den Schultern reichte, verbarg ihre zerschmetterten Glieder. Allein das Gesicht war unversehrt geblieben von dem Sturz aus großer Höhe, aber es lag so gar nichts Friedvolles darin, wie damals beim Tod unserer kleinen Schwester. In den feinen, noch immer fast mädchenhaften Gesichtszügen schienen Schmerz und Verzweiflung wie eingemeißelt zu sein.
Als ich vorsichtig ihre kalte Wange berührte, schluchzte ich laut auf. Martin schreckte hoch.
«Entschuldige», murmelte er. «Ich muss eingeschlafen sein.»
Er strich sein schwarz-weißes Ordensgewand glatt und sah sich verwirrt um.
«Sind Vater und Gregor noch immer nicht zurück?»
Ich schüttelte den Kopf, ohne den Blick vom Leichnam der Mutter lösen zu können. Gestern Abend noch hatte sie beim Abendessen mit uns gescherzt, war nach etlichen Tagen der Schwermut endlich wieder fröhlich gewesen. Hatte bei dem sauren Kraut mit Schweinespeck herzhaft zugegriffen, sich nach Vaters Geschäften erkundigt und uns mitgeteilt, dass sie am nächsten Tag wieder einmal im Kramladen mithelfen wolle. Nach dem Essen war sie nicht gleich in ihre Schlafkammer verschwunden wie an den Tagen zuvor, sondern hatte gemeinsam mit mir den Küchentisch abgeräumt und den Abwasch gemacht. Als ich schließlich zu Bett ging, hatte ich sie noch leise aus der Nachbarkammer Psalmen singen hören Und jetzt lag sie vor mir, eine leblose Hülle, aus der alles, was ihr Wesen ausgemacht hatte, entschwunden war.
Ein Schauer lief mir über den Rücken. Nie wieder würde ich sonntags an diesem Stubentisch essen können, ohne das Bild der toten Mutter vor Augen zu haben.
«Wo bleiben sie denn nur?», hörte ich Martin sagen. «Sie müssten doch längst hier sein.»
Ich antwortete nicht. Mit einem Mal war ich froh, dass Ruhe eingekehrt war nach dieser schrecklichen Nacht, die ich mit meinem Vater und meinen beiden Brüdern in verzweifeltem Weinen und Beten zugebracht hatte, bevor heute Morgen Nachbarn, Freunde und Bekannte zuhauf ins Haus geströmt waren, um von der Mutter Abschied zu nehmen oder uns Trost zu spenden. Wie ein Lauffeuer musste sich die Todesnachricht in den Gassen verbreitet haben.
Martin trat neben mich. Seine Stimme war sanft, sanft wie die unserer Mutter.
«Du solltest in die Küche gehen und was zu essen vorbereiten, wenn gleich der Herr Pfarrer kommt. Ich hol derweil einen Krug Wein aus dem Keller und neue Kerzen.»
«Das hat doch noch Zeit.»
Wieder und wieder strich ich der Mutter über Stirn, Augen und Wangen, dann wandte ich mich ab und ließ mich kraftlos auf den Stuhl neben der Tür sinken. Durch die Stille hatte ich plötzlich erneut das Rufen meines ältesten Bruders Gregor im Ohr, mit dem er mich in der Nacht geweckt hatte: «Susanna! Wach auf! Es ist was Schreckliches geschehen.»
Draußen im Hof unter dem Sternenhimmel hatte sie gelegen, mit verrenkten Armen und Beinen, die Augen weit aufgerissen. So hatte mein Vater sie gefunden und schleppte sie gerade in den Hauseingang, als ich die Treppe heruntergerannt kam und zitternd in meinem dünnen Hemd vor ihr stehen blieb. Sie war schon nicht mehr bei sich gewesen, ihr Atem ging stoßweise, aber sie lebte noch, als Pfarrer Oberlin, den Gregor geholt hatte, ihr die Absolution erteilte und sie mit Weihwasser besprengte. Als wenig später der Wundarzt eintraf, hatte der nur noch ihren Tod feststellen können. Da war mein Vater mit einem Aufheulen, das mehr an ein Tier als an einen Menschen erinnerte, zusammengebrochen, mitten auf dem kalten Steinboden. Ich hatte da noch nichts begriffen – wie in einem Albtraum rief ich immerzu «Warum?», doch niemand antwortete mir. Erst als Martin aus dem Kloster eingetroffen war, hatte sich mein Vater allmählich beruhigt. Da lag die Mutter bereits in der Stube aufgebahrt, die ersten Totengebete waren gesprochen, und ich erhielt endlich eine Antwort auf meine Frage.
«Sie hat wieder mal genachtwandelt und ist dabei aus dem Dachfenster gestürzt», erklärte mein Vater tonlos. «Sie hätte nicht vom Rotwein trinken dürfen, wo sie das doch immer so unruhig macht. Aber sie war endlich wieder fröhlich, endlich wieder guter Dinge.» Und plötzlich begann er zu schreien: «Ich bin schuld! Ich hätte es wissen müssen!»
Das Herz krampfte sich mir zusammen, als ich nun neben ihrem leblosen Körper an die letzte Nacht, an die Verzweiflung meines Vaters dachte. Ich hielt mir die Ohren zu, schlug mir mit den flachen Händen ins Gesicht, hörte mich lauthals auf einmal schluchzen. Da spürte ich einen Arm um meine Schultern.
«Beruhige dich, Susanna», flüsterte Martin. Seine Stimme zitterte dabei.
«Ich verstehe es einfach nicht», stieß ich hervor. «Wie kann das sein? Wie kann ein Mensch im Schlaf auf eine Leiter steigen, auf eine wacklige Leiter, und dann aus dem Dachfenster stürzen?»
«Du weißt doch, dass unsere Mutter immer wieder geschlafwandelt hat. Erinnerst du dich, wie wir sie mal gesucht und schließlich schlafend im eiskalten Keller gefunden haben? Komm, lass uns beten.»
Er wirkte zwar gefasst, war aber noch bleicher als zuvor. Dunkel zeichneten sich die Bartstoppeln auf seinen Wangen ab, und der tiefschwarze Haarkranz auf dem ansonsten kahl geschorenen Schädel stach noch mehr hervor. So viel Martin innerlich von der Mutter hatte, seine Empfindsamkeit und Verletzlichkeit, so sehr glich er äußerlich dem Vater, der wie viele Menschen hier am Oberrhein fast wie ein Welscher aussah.
Mitten in unseren Gebeten hörten wir unten die Haustür aufspringen. Müde und mit tiefen Schatten unter den Augen betraten der Vater und Gregor die Stube. Sie warteten, bis das Amen unser Gebet beendet hatte, dann schlugen sie das Kreuzzeichen, und im nächsten Moment war der Vater schon wieder aus dem Raum geflüchtet. Gleich darauf drangen seine schweren Schritte aus der Schlafkammer herunter.
«Was ist los?», fragte Martin. «Wo bleibt der Pfarrer?»
Gregor schüttelte nur niedergeschlagen den Kopf und setzte sich auf jenen Stuhl an der Tür, auf dem ich zuvor gesessen hatte und der am weitesten vom Leichnam entfernt stand.
«So red schon, Gregor», flehte ich.
Mein großer, stämmiger, um fünf Jahre älterer Bruder wirkte plötzlich hilflos wie ein kleines Kind.
«Der Pfaffe kommt nicht.» Seine Unterlippe bebte. «Weil wir nämlich ein Haus der Schande sind.»
Wir starrten ihn an, als hätte ein Geist zu uns gesprochen. Da packte Martin ihn beim Arm.
«Was soll das? Was redest du da für einen Blödsinn?»
«Dann frag halt den Vater», brauste Gregor auf. «Einer unserer Nachbarn war beim Pfarrer und hat ihm brühwarm gesteckt, dass er genau gesehen hätte, wie die Mutter hellwach am Fenster stand. Plötzlich hätte sie ‹Verzeiht mir!› gerufen und sich heruntergestürzt. Versteht ihr? Sie hat gar nicht genachtwandelt. Sie hat ihrem Leben ein Ende gemacht!»
«Das … das glaube ich nicht», stieß ich hervor. In meinem Kopf begann es zu schwindeln, und ich musste mich an die Wand lehnen.
«Du glaubst es nicht?» Gregor ballte die Fäuste. «Wer müsste es besser wissen als du? Du hast dich doch immer um sie gekümmert, wenn sie mal wieder den ganzen Tag in der Schlafkammer geblieben ist, alles dunkel gemacht hat und nichts geredet und nichts gegessen hat! Nur deshalb bist du doch noch nicht mit dem Auberlin verheiratet – weil wir dich hier im Haus so nötig brauchen. Und hat sie dir nicht mehr als ein Mal gesagt, dass sie am liebsten gar nicht mehr sein möchte? Hast du das vergessen? Und jetzt hat sie’s endlich getan. Und damit Schande gebracht über uns alle! Im Henkerskarren wird man sie aus der Stadt schaffen und in der Ill versenken oder auf dem Schindanger verscharren.»
«Hör auf!», schrie ich und begann, mit den Fäusten auf ihn einzuschlagen.
Martin zog mich weg. Er schüttelte nachdrücklich den Kopf.
«Das ist böswilliges Geschwätz und gehört bei Gericht angezeigt. Wer soll dieser Nachbar überhaupt sein?»
Gregor war vom Stuhl aufgesprungen. «Geh doch selbst zum Pfarrer und frag ihn, wer der verfluchte Kerl ist. Ich sag nichts mehr. Und im Übrigen wird nachher nicht der Pfaffe bei uns aufkreuzen, sondern der Stadtarzt zur Beschau. Wie bei jedem Verbrechen, das in der Stadt geschieht.»
Dann stürzte er hinaus, und wir hörten ihn auf dem Holz der Außentreppe nach unten poltern.
Am Nachmittag beschloss ich, als verspätetes Mittagessen eine Gemüsesuppe aufzusetzen, obwohl ich wusste, dass keiner von uns etwas davon anrühren würde. Ich selbst am allerwenigsten, so aufgewühlt war ich noch immer. Martin war ins nahe Dominikanerkloster zurückgekehrt, Vater hatte die Schlafkammer nicht mehr verlassen, und Gregor hörte ich unter mir im Lager unseres Kramhandels hantieren.
Gleich nachdem Martin gegen Mittag gegangen war, hatte ich den Vater aufgesucht, der stumm auf seinem Bett lag und die Deckenbalken anstarrte. Ich fragte ihn, ob es stimme, was Gregor behauptet hatte. Da war er in die Höhe geschossen, hatte sich das ergraute Haar gerauft und verzweifelt ausgerufen: «Ich weiß es doch selbst nicht, was ich glauben soll!» Danach war er wieder in Tränen ausgebrochen. Seither hatte ich die Zeit in der Küche totgeschlagen und gedankenverloren ins Herdfeuer gestarrt. Noch einmal nach der Mutter zu sehen, hatte ich nicht über mich gebracht.
Zum Kochen brauchte ich frisches Wasser, und so griff ich nach dem Ledereimer. Ich stockte: Der Brunnen befand sich an der nächsten Straßenecke. Alle Leute aus der Nachbarschaft würden mich anstarren. Da kommt sie, die Tochter der Selbstmörderin, würden sie tuscheln.
Ich ließ den Eimer wieder sinken und setzte mich zurück an den Küchentisch. Die Reste aus dem Krautfass zusammen mit eingeweichtem Brot mussten genügen als Essen.
Vor meinem Blick begann die Holzmaserung der Tischplatte zu verschwimmen. Immer wieder hatte die Melancholie meine Mutter niedergeworfen, seit einigen Jahren schon. Dann war sie kaum ansprechbar gewesen, hatte nur regungslos und mit offenen Augen in ihrer Schlafkammer gelegen. Wir hatten einiges probiert, ihr etwa Granatsteine ins Bett gelegt und an den linken Arm gebunden, was gegen ihr schwarzgalliges Gemüt helfen sollte, aber es hatte nichts genutzt. Ebenso wenig wie der Aderlass durch den Bader, der ihre Zustände eher verschlimmert denn verbessert hatte.
Einmal, das war im letzten Herbst gewesen, hatte Vater viel Geld für die Frau des Henkers ausgegeben, die eine Zauberkundige war. Sie hatte ihn ausgefragt, wie und wann genau die Mutter zum ersten Mal in diese Zustände geraten war. Der Vater hatte sich erinnert, dass sie einige Wochen nach der Geburt unserer kleinen Schwester am Brunnen zusammengebrochen war und stundenlang geweint hatte. Da war die dünne Agnes – so nannte alle Welt die Henkersfrau – zu dem Schluss gekommen, die Krankheit der Mutter sei durch Schadenzauber über sie hereingebrochen. Wer aus ihrer Bekanntschaft ihr denn bös gesinnt sei, hatte sie uns alle gefragt. Vielleicht habe ja jemand damals am Brunnen gestanden? Doch uns war niemand eingefallen. Die Mutter war in ihrer stillen, fürsorglichen Art allseits beliebt gewesen, Mein Vater hatte aber einen Ratsherrn erwähnt, der ihr einst den Hof gemacht und ihr Jahre nach der Hochzeit einmal auf dem Kohlmarkt einen bösen Fluch entgegengeschleudert hatte – dass Margaretha bald keine gesunden Tage mehr erleben solle. Den Namen des Mannes hatte Vater jedoch nicht preisgeben wollen. Daraufhin hatte die Henkersfrau ein Wachsbild gefertigt, Kopf und Brust der Figur mit Öl gesalbt, dabei allerlei Bannsprüche gegen böse Geister vorgetragen und das Bildnis anschließend im Hof verbrannt. Zum Schutz unseres Hauses vor Dämonen hatte sie noch einen Drudenfuß auf die Türschwelle gemalt. Danach war es der Mutter tatsächlich eine Zeitlang besser ergangen.
Und jetzt das! Sich selbst zu töten, war ein schändliches, ganz und gar gottloses Verbrechen, das nur der Teufel selbst bewirken konnte. So jedenfalls predigten es die Pfaffen. Es hieß, die Seele sei nun für alle Zeit verflucht und dazu verdammt, umherzugehen und nie zur Ruhe zu kommen. Um die Wiederkehr zu erschweren, müsse der Leichnam mit dem Gesicht nach unten in die Grube gelegt und mit Dornengestrüpp bedeckt werden. Noch besser sei es, den Leichnam auf immer auszulöschen, mittels Feuer oder Wasser, da eine solch ungeheuerliche Tat großes Unheil nach sich ziehen könne.
Das laute Klopfen am Hoftor ließ mich zusammenzucken. Wenn das nun der Stadtarzt war? Für die Nachbarn musste seine Ankunft wie eine Bestätigung erscheinen, dass in unserem Hause ein Verbrechen geschehen war. Als es erneut und noch heftiger klopfte, schlich ich zur Außentreppe und spähte durch die kleine Luke der Holzverkleidung, konnte aber nicht erkennen, wer hinter dem Hoftor wartete.
Während ich die Stufen hinunterstieg, hatte ich Mühe, meine Beine zu bewegen. Ich fand Gregor im Lager, wo er im Schein der Tranlampe Ware einsortierte. Die beiden Läden zur Gasse hin waren geschlossen.
«Warum machst du nicht wenigstens den Laden auf?», flüsterte ich. «Dann sehen wir, wer’s ist.»
«Ich kann’s mir schon denken.» Mit versteinerter Miene hievte er eine kleine Kiste mit Gürtelschnallen auf den Verkaufstisch. «Soll doch der Vater den Stadtarzt einlassen.»
«Du weißt genau, dass er das nicht vermag. Er ist am Ende seiner Kraft.»
«Dann geh halt du! Oder der Medicus soll die Tür vom Büttel aufbrechen lassen. Das ist mir einerlei. Ich mache ihm jedenfalls nicht auf. Der hat hier nichts zu suchen.»
Notgedrungen ging ich in den Hof und entriegelte mit pochendem Herzen das Tor. Indes stand nicht der Stadtarzt vor mir, sondern ein kleiner, schmächtiger, ältlich aussehender Mann im schwarz-weißen Habit der Dominikaner.
Bass erstaunt sah ich ihn an. Was wollte dieser Predigermönch von uns? Hatte er etwas mit Martin zu tun? War etwa auch meinem Bruder etwas zugestoßen?
«Gelobt sei Jesus Christus», grüßte er, während er mich aus dunkelgrauen Augen musterte. Zumindest sah er nicht so aus, als wenn er grausame Nachrichten brächte.
«In Ewigkeit. Amen», gab ich verunsichert zurück.
«Weißt du denn nicht, wer ich bin, Susanna?»
Da erst erkannte ich in ihm den Prior der Dominikaner. Ich war ihm letztes Jahr zusammen mit der Mutter zufällig vor dem Kloster begegnet, an Martins Seite.
«Ihr seid der Vater Prior von den Predigern, nicht wahr?»
Er nickte. «Nenn mich schlichtweg Bruder Heinrich. Priester und Prior bin ich nur für meine Mitbrüder.» Dann fragte er mitfühlend: «Wie geht es dir, meine Tochter?»
Ich wusste nicht, was ich antworten sollte.
«Es ist … es ist alles so schrecklich», murmelte ich.
«Darf ich hineinkommen?»
Schweigend führte ich ihn die Treppe hinauf zur Küche, die das gesamte erste Stockwerk einnahm. Ich ging voraus, bat ihn, auf der Küchenbank Platz zu nehmen, und bot ihm etwas zu trinken an. Aber er lehnte ab und verharrte im Rundbogen der offenen Tür.
«Das tut mir sehr leid mit eurer Mutter», sagte er leise, murmelte etwas auf Lateinisch und schlug das Kreuz. «Der Herr sei ihrer Seele gnädig.»
Er trat auf mich zu, nahm meine beiden Hände und drückte sie fest.
«Ich möchte euch Trost spenden in dieser schweren Stunde. Die Wege des Herrn sind unergründlich, aber was ER tut, hat stets seinen Sinn. Zeigst du mir bitte, wo Margaretha aufgebahrt ist?»
Jetzt war ich noch mehr verunsichert. Wusste der Prior gar nicht, was für einen Frevel meine Mutter begangen haben sollte? Und warum nannte er sie, gerade so wie ein guter Bekannter, Margaretha?
«Oben in der Stube liegt sie», erwiderte ich.
«Dann bring mich zu ihr. Ist dein Vater auch da?»
«Ja, aber er hat sich in die Schlafkammer zurückgezogen. Es geht ihm sehr schlecht.»
Erneut betraten wir die Außentreppe. Wie alle Gebäude in dieser Gasse war unser Haus sehr schmal und sehr hoch, mit einem Laden oder einer Werkstatt zu ebener Erde. Eine überdachte, durch Bretterwände geschützte Außentreppe führte, wenn man von der Hofeinfahrt kam, direkt in den ersten Stock, zunächst in die Küche mit dem großen gemauerten Herd, dann weiter hinauf in die Stube, die feierlichen Anlässen vorbehalten war, und schließlich noch ein Stockwerk hinauf zu den beiden Schlafkammern. Auf den spitzgiebeligen Dachboden indessen gelangte man nur über eine Leiter aus dem Elternschlafzimmer – über jene alte Leiter, die meine Mutter im Stockfinstern emporgeklettert sein musste.
Oben angekommen, öffnete ich dem Prior die Tür zur Stube und ließ ihn eintreten. Ich selbst blieb stehen. Alles in mir sträubte sich, diese Schwelle zu überschreiten. Da die Fensterläden immer noch geschlossen waren, hatten die zahlreichen Kerzen die Luft verbraucht. In den würzigen Geruch des Weihrauchs hatte sich etwas Süßliches gemischt, das in mir einen Würgereiz auslöste. So riecht der Tod, schoss es mir durch den Kopf.
Bruder Heinrich schien der Geruch nichts auszumachen. Er hatte sich auf Höhe von Mutters Schultern dicht vor den Tisch gestellt, ihr das Kreuzzeichen auf die Stirn gemalt und dabei Worte auf Lateinisch gesprochen. Jetzt betrachtete er sie aufmerksam, ein stilles Lächeln lag auf dem hageren, bartlosen Gesicht. Ein Lächeln, bei dem sich seltsamerweise die Mundwinkel nach unten zogen. Mit einem Mal sah er aus wie ein verhärmter alter Mann.
Lange Zeit stand er nur da und betrachtete sie.
«Deine Mutter war eine ganz besondere Frau», sagte er endlich und drehte sich zu mir um. Das traurige Lächeln war verschwunden. «Ich werde alles dafür tun, dass sie christlich bestattet wird.»
«Dann wisst Ihr also …», stammelte ich, «dass sie …»
«Ja, ich weiß Bescheid. Mein Klosterbruder Martin hat mir in seiner Not alles berichtet. Und deshalb bin ich hier. Verlier also nicht den Mut, mein Kind. War der Stadtarzt schon da?»
«Nein, noch nicht.» Dann brach es aus mir heraus: «Niemals hätte sie uns so etwas angetan!»
«Ich weiß. Aber ich weiß auch, dass sie an der Melancholie litt, einer gefährlichen Krankheit des Geistes und der Seele.» Seine Miene wurde plötzlich streng. «Sie hätte sich rechtzeitig an ihren Seelsorger wenden sollen. Oder an mich. Mit Hilfe eines Exorzismus hätte man sie möglicherweise heilen können.»
«Aber wenn sie nun doch bloß genachtwandelt hat? Wenn dieser Nachbar böswillig gelogen hat?»
«Auch das mag sein. Aber was immer es gewesen ist: Wenn Arzt und Seelsorger nachweisen können, dass der Selbstmörder in geistiger Umnachtung gehandelt hat, können wir ihr die Gnade einer christlichen Bestattung erweisen. Ich will mit dem Medicus und Pfarrer Oberlin reden.»
Ich schöpfte zwar Hoffnung, fragte mich aber zugleich, warum der Prior all das mit mir besprach anstatt mit meinem Vater als Hausherrn und Ehemann der Toten. Die Anspannung der letzten Stunden presste mir die Brust zusammen, und ich spürte, wie mir schon wieder die Tränen in die Augen stiegen.
Er schien es zu bemerken. «Vertrau mir, Susanna. Und vertrau vor allem auf Gott. Jetzt führe mich bitte zu deinem Vater.»
Als ich die Tür hinter uns geschlossen hatte, atmete ich fast erleichtert auf.
«Darf ich Euch etwas fragen, Bruder Heinrich?»
«Nur zu, Susanna.»
«Stimmt es, dass der Leichnam von Selbstmördern großes Unheil auf die Menschen ziehen kann, wie zum Beispiel Kriege, Seuchen oder Unwetter?»
«Nun, das ist nur ein alter Aberglaube. Wahr ist aber, dass sich am nächtlichen Grab Unholde und Zauberer versammeln könnten, um sich mit Hilfe der von Dämonen vergifteten, ruhelosen Seele zauberische Kräfte zu verschaffen. Deshalb ist es tatsächlich das Beste, die sterblichen Überreste zu verbrennen. Aber wisse, deine Mutter hat sich nicht willentlich selbst gerichtet. So oder so war es ein Unfall, und dass alle sich dessen gewahr sind, dafür werde ich mich einsetzen.»
«Kanntet Ihr sie denn?»
Erstaunt sah er mich an.
«Hat sie euch Kindern nicht erzählt, dass wir zusammen aufgewachsen sind?»
Ich schüttelte den Kopf.
«Seltsam. Dabei waren unsere Familien Nachbarn, drüben in der Schustergasse.»
Da fiel mir ein, dass die Mutter nach Martins Ordensgelübde vor gut acht Jahren so etwas kurz erwähnt hatte. Und als Martin vor einiger Zeit einmal gesagt hatte, dass sein Prior ein gestrenger, etwas verbissener Mensch sei, wenn auch klüger und gebildeter als alle anderen im Kloster, da hatte die Mutter leise bemerkt, dass Heinrich bereits als Kind ein wenig seltsam gewesen sei. Aber Letzteres behielt ich besser für mich.
Unterm Dach angekommen, durchquerten wir das Kämmerchen, das ich allein bewohnte, seitdem Martin ins Kloster gegangen war und Gregor seine Schlafstatt unten im Laden hinter einer Bretterwand eingerichtet hatte. Es war mir mehr als unangenehm, als der Blick des Priors auf mein noch immer ungemachtes und zerwühltes Bett fiel. Auf der Schwelle zur Elternkammer hielt er noch einmal inne.
«Wann immer du etwas auf dem Herzen hast, kannst du zu mir kommen. Versprichst du mir das, Susanna?»
Ich brachte nur ein gestottertes «Danke» zustande. Dabei war es mir in diesem Moment ein unendlicher Trost, einen Mann Gottes an unserer Seite zu wissen.
Kapitel 2
Schlettstadt im Elsass, Frühjahr 1439
Dem neunjährigen Heinrich brannte die Maulschelle, die ihm die Muhme verabreicht hatte, wie Feuer auf der Wange. Aber er schaffte es, die aufsteigenden Tränen zu unterdrücken.
«Damit du dir ein für alle Mal merkst, dass du beim Abendläuten daheim zu sein hast und nicht erst, wenn’s dunkel wird!», zischte sie durch ihre Zahnlücken und zerrte ihn zur Haustür herein in die kleine, dunkle Werkstatt. «Und jetzt ab mit dir in die Küche!»
Trotzig presste er die Lippen zusammen. Und wenn ihm die Mutter obendrein noch eine Ohrfeige verpassen würde – das war ihm ganz gleich. Er fühlte sich wie ein tollkühner Ritter, der für seinen Herrn eine feindliche Burg erobert hatte.
Er sah über die Schulter, um noch einen Blick auf Margaretha zu erhaschen. Sie stand auf der Gasse und winkte ihm zu. Bevor er zurückwinken konnte, fiel die Tür schon ins Schloss.
«Kommst du endlich?»
Er stapfte hinter der Muhme die Holztreppe hinauf, die schmal und steil wie eine Leiter war. Bei jedem Schritt der schweren Frau ächzten die Stufen, als hätten sie Schmerzen. In der Küche stank es nach der ewigen Sauerkohlsuppe, die die Muhme fast täglich kochte. Seine Mutter, der Geselle Wölfli und sein um vier Jahre älterer Bruder Hannes saßen schon beim Essen.
«Wo warst du so lang?», fragte seine Mutter barsch.
«Auf der Baustelle vom neuen Badhaus», gab er wahrheitsgemäß zur Antwort.
«Dort hast du rein gar nichts verloren», schnauzte sie ihn an.
Er hätte ihr sagen können, dass es da wunderbare Sandhaufen zum Spielen gab und dass er seine Arbeit in der Werkstatt wie aufgetragen erledigt hatte, aber er schwieg. Er wollte sie nicht noch mehr gegen sich aufbringen.
Seitdem der Vater vor vier Jahren gestorben war und sie einen Gesellen eingestellt hatte, um die kleine Schusterwerkstatt weiterzuführen, war sie noch strenger geworden. Das heißt, eigentlich konnte er sich an seinen Vater gar nicht mehr richtig erinnern. Lange Zeit hatte er gehofft, dass er einen neuen Vater bekommen würde, aber inzwischen hatte er die Vermutung, dass die Mutter mit diesem ebenso dreisten wie verschlagenen Wölfli herumtändelte – eine mehr als widerwärtige Vorstellung!
«Das kann ja noch was werden mit diesem Jungen», hörte er sie in Richtung ihrer Schwester jammern. «Wenn der sich jetzt schon auf der Gasse rumtreibt wie ein Armenkind, statt sich im Haus nützlich zu machen. Dem fehlt einfach die harte Zucht des Vaters.»
«Mit der Tochter vom Flickschuster war er unterwegs», petzte die Muhme prompt.
«Was? Mit der kleinen Blattnerin treibst du dich rum?» Die Mutter fuhr mit rotem Kopf von der Küchenbank auf. Kurz glaubte Heinrich, nun würde er die nächste Ohrfeige einstecken müssen, doch sie besann sich anders.
«Du entschuldigst dich jetzt, und dann hockst du dich dort drüben in der Ecke auf den Boden, bis wir fertig sind mit Essen. Zur Strafe wirst du heut hungrig ins Bett gehen müssen.»
Er nickte.
«Entschuldigung, Mutter, Entschuldigung, Muhme, dass ich zu spät bin. Es tut mir leid.»
Der Geselle hob den Kopf und grinste frech.
«Und was ist mit mir?»
«Entschuldigung, Wölfli.»
Heinrich setzte ein trauriges Gesicht auf, als er sich auf dem harten Dielenboden niederließ. Innerlich aber strahlte er. So lange schon hatte er sich nichts sehnlicher gewünscht, als einmal mit Margaretha, dem blonden Nachbarsmädchen von gegenüber, zu spielen. Indessen hatte er sich nie getraut, sie anzusprechen, obwohl sie bestimmt drei Jahre jünger war. Heute aber hatte er allen Mut zusammengenommen. Hatte ihr gesagt, dass er ihr etwas Schönes zeigen wolle, und sie war tatsächlich mit ihm gegangen. Bis Einbruch der Dämmerung hatten die beiden an dem großen Sandhaufen beim Schlangbach gespielt, wo der Sand für das neue Badhaus gelagert wurde. Er hatte hierüber völlig die Zeit vergessen, bis am Ende seine wütende Muhme vor ihnen gestanden war.
Er schloss die Augen. Sein Magen knurrte zwar gewaltig, aber das war ihm herzlich gleichgültig. Morgen Nachmittag würde Margaretha wieder mit ihm spielen. Das hatte sie ihm hoch und heilig versprochen.
Kapitel 3
Schlettstadt, im Juni 1484
Die Luft auf dem Friedhof von Sankt Georg flirrte in der Hitze, und nach Westen hin hatten sich über den Vogesen dunkle Wolkenberge aufgetürmt. Mit halblauter Stimme sprach ich das Totengebet mit, strich mir dabei verstohlen über das Gesicht. Für die Trauergemeinde mochte es aussehen, als ob ich mir die Tränen abwischte, dabei war es nur der Schweiß. In den letzten beiden Tagen hatte ich lange und heftig genug geweint.
Ich folgte dem Beispiel meines Vaters und meiner Brüder und warf eine Schaufel Erde über den schlichten Holzsarg zu meinen Füßen, dann trat ich zur Seite, um die anderen Trauernden Abschied nehmen zu lassen. Nicht nur Vaters Zunftgenossen mit ihren Familien, sondern die halbe Stadt war zum Begräbnis gekommen, und ich entdeckte sogar manch vornehmen Herrn. Unsere Familie gehörte zwar nicht zu den reichen Geschlechtern von Schlettstadt, aber als Kleinkrämer war mein Vater Bertolt Mittnacht durchaus angesehen in der Stadt. Vielleicht hatte den einen oder andern aber auch nur die Neugier hergetrieben: Würde Pfarrer Oberlin die seltsamen Todesumstände erwähnen? Oder würde vielleicht gar ein Zeichen geschehen, mit dem sich das nicht verstummende Geschwätz bestätigte, dass die Mittnachtin sich selbst gerichtet habe? Immer wieder hatte ich während der Leichenpredigt besorgt zum Himmel geschaut, ob nicht doch ein Blitz herniederfahren würde, doch das Gewitter mit seinem fernen Grollen schien in den Bergen festzuhängen. Den jähen Tod der Mutter hatte Oberlin nur kurz erwähnt und von einem «tragischen Unglücksfall» gesprochen.
«Der Herr gibt, und der Herr nimmt», waren seine abschließenden Worte gewesen. «Nun liegt es an uns Lebenden, Margarethas Seele ein Weiterleben in Gnade zu ermöglichen bis zum Jüngsten Tag.»
Ich wusste, dass Vater für ihr Seelenheil alles getan hatte. Auch wenn die Krämerzunft ihr Scherflein beitrug, hatte er für diese große Bestattung und für die vierzigtägige Trauerzeit mit ihren Gedächtnisfeiern tief in die Taschen gegriffen. Ein jedes musste bezahlt werden: Glockengeläut, Kerzen und Ewiges Licht, die Vigilien, die Totenmessen, die Grabbesuche durch die Messdiener, die Jahrzeitstiftung bei den Dominikanern und nicht zuletzt die beiden Seelschwestern, die sieben Tage lang am Grab beten würden. Was aber, schoss es mir immer wieder durch den Kopf, wenn die Mutter sich nun doch umgebracht hatte? Dann wäre all das umsonst.
Unwillkürlich sah ich mich um. Tuschelten die alten Weiber dort hinten nicht schon über uns? Gerade so wie die drei Mägde aus unserer Gasse, die ununterbrochen zu mir herüberstarrten? Die alte Kräuterfrau Käthe, die meiner Mutter immer eng verbunden gewesen war, stand auffallend weit abseits und schlug unablässig das Kreuzzeichen. Schließlich entdeckte ich den Nagelschmied Auberlin, der unentwegt zu mir herüberstierte. Rasch schaute ich in die andere Richtung.
Mein verunsicherter Blick traf sich mit dem des Priors, der eben vom Grab zurücktrat. Aufmunternd nickte er mir zu, und ich schüttelte meine Zweifel ab. Nein, es hatte schon alles seine Richtigkeit – was meiner Mutter geschehen war, war ein Unfall, ein schreckliches Unglück. In all meiner Trauer und Benommenheit durchfuhr mich das Gefühl tiefer Dankbarkeit gegenüber Bruder Heinrich, der das schier Unmögliche erreicht hatte. Vor allem Gregor hatte bis zuletzt daran gezweifelt, dass unserer Mutter eine christliche Bestattung zuteilwerden würde. Doch der Prior hatte sein Versprechen gehalten: Er hatte bei seinem Besuch nicht nur auf den Stadtarzt gewartet, sondern anschließend auch noch Pfarrer Oberlin aufgesucht. Wie er es geschafft hatte, die beiden davon zu überzeugen, dass sich jener Nachbar, in dem wir den alten Trunkenbold Clewi vermuteten, geirrt hatte, wusste niemand von uns.
Zwei Tage und zwei Nächte lag das Furchtbare nun schon zurück, doch der Schmerz wollte einfach nicht nachlassen. Ohne unsere Mutter war das Haus wie ausgestorben, die Stille kaum noch zu ertragen. Mit diesem Grab hatte ich nun wenigstens einen Ort, an dem ich um sie trauern konnte.
Sosehr ich damit beschäftigt war, sie jetzt schon qualvoll zu vermissen, so ergriff doch an diesem Morgen eine düstere Ahnung mehr und mehr von mir Besitz: Mein Leben würde sich entscheidend verändern. Ich war längst in dem Alter, verheiratet zu werden – meine Freundin Elsbeth hatte ihren Ruprecht bereits vor einem Jahr geehelicht und war nun guter Hoffnung. Mir hatten die Eltern vor einiger Zeit schon den Nagelschmied Auberlin zugedacht. Mir grauste vor ihm. Dass es bislang noch zu keiner Heirat gekommen war, lag einzig daran, dass meine Mutter, die die Auftragsbücher geführt und sich auch sonst um vieles gekümmert hatte, was der Kramhandel mit sich brachte, in den letzten zwei Jahren immer häufiger ausgefallen war. So gehörte längst nicht mehr nur der Haushalt zu meinen Aufgaben. An ihren düsteren Tagen musste ich für sie einspringen, musste an ihrer Stelle mit Gregor den Markt beschicken oder im Lager die Bestände an Nadeln, Garnen, Spindeln, Spiegeln, Kämmen, Gürteln, Beuteln und sonstigem Kleinkram erfassen.
Das alles sollte nun bald vorbei sein. Vater hatte entschieden, eine Magd einzustellen. Meine Hilfe würde überflüssig werden. Er hatte sogar schon jemanden im Auge: die Witwe eines verstorbenen Zunftgenossen, die sich im Handel gut auskannte. «Damit wirst du endlich das tun, was eine junge Frau tun sollte – an der Seite eines rechtschaffenen Mannes Kinder großziehen und den Haushalt zusammenhalten.» Das waren beim Morgenessen seine Worte gewesen.
Ich konnte jedoch allein den Gedanken an Auberlin nur schwer ertragen. Ich fand ihn tumb und grobschlächtig, und schon seine äußere Erscheinung – diese fliehende Stirn, diese hervorstehenden Augen – widerte mich an.
Eine Hand legte sich mir auf die Schulter. Es war Bruder Heinrich, der sich neben mich gestellt hatte.
«Alles wird gut», sagte er leise. «Die Seele deiner Mutter ist nun auf dem Weg zu Gott. Und denke daran: Je mehr wir für sie beten, desto eher wird sie in Gottes Angesicht schauen dürfen.»
Kapitel 4
Tags darauf im Predigerkloster
Heinrich Kramer stand am Schreibpult der geräumigen, reich mit Handschriften und Druckwerken ausgestatteten Klosterbibliothek und versuchte, seine Gedanken zu Papier zu bringen. Der Sakristan hatte ihm eine neue Wachskerze gebracht, und bis zur Vesper blieb ihm noch ausreichend Zeit für seine Arbeit.
Eigentlich war er hochzufrieden mit dem bisherigen Resultat. Seine Streitschrift wider die unverzeihliche Nachgiebigkeit des Klerus gegenüber den Hussiten, Juden und jenen hinter übertriebener Frömmigkeit verborgenen Erzketzern, zu denen er auch die Beginen und all diese nicht regulierten Frauengemeinschaften zählte, schien ihm rhetorisch durchweg gelungen. Und er theoretisierte hierbei nicht etwa ins Blaue hinein – o nein! In allen Punkten konnte er mit eigenen Erfahrungen aufwarten: So hatte er sich in Böhmen an der Bekämpfung der Hussiten beteiligt, hatte entscheidend zu dem berühmten Ritualmordprozess gegen die Trienter Juden beigetragen und war vor nicht allzu langer Zeit in Augsburg gegen frömmlerische, verdächtige Weiber vorgegangen, auch wenn er sie nicht der Häresie überführen konnte. Nicht umsonst war er vor zehn Jahren von Papst Sixtus zum Inquisitor ernannt worden.
Jetzt, wo das Traktat fast fertig war – es fehlte ihm nur noch ein brillantes Schlusswort –, hatte er es niemand anderem als dem Heiligen Vater zugedacht. Aber er spürte, dass ihn diese Sache längst nicht mehr so bewegte wie noch vor Monaten.
Er kaute am Kiel seiner Schreibfeder. Da loderte etwas anderes in ihm, das förmlich darauf brannte, aus ihm emporzusteigen. Etwas ungleich Größeres wollte er schaffen als diese lächerlich kurze Abhandlung, mit der er höchstens die Konziliaristen treffen würde, diese heuchlerischen Papstkritiker. Etwas Allumfassendes im Kampf um den reinen Glauben und um die Vernichtung des Bösen im Menschen, danach drängte es ihn. Ein großes Werk schwebte ihm vor, von dem im ganzen christlichen Abendland die Rede sein sollte. Durch den neuen Buchdruck mit seinen beweglichen Lettern würde es sich rasch überall verbreiten. Sein Gelehrtenname, Doctor Henricus Institoris, würde in aller Munde sein.
Denn wenn er in den letzten Jahren eines erkannte hatte, kraft seines Amtes als päpstlicher Inquisitor per totam Alamaniam superiorem, für ganz Oberdeutschland also, dann war es dies: Die wahre Gefahr für die Christenheit drohte nicht etwa durch das Judentum oder das Treiben einiger versprengter Querköpfe, sondern durch jene neue Sekte, die sich wie ein tödliches Geschwür vom Alpenraum aus in alle Richtungen ausgebreitet hatte. Und so sah er es als sein nächstes Ziel an, vom Papst zum Generalinquisitor aller großen deutschen Kirchenprovinzen ernannt zu werden. Dafür sollte dieses Werk, das er schon als gedrucktes Buch vor sich sah, den Grundstein legen.
Ach, wäre der Tag doch zweimal so lang! Als Prior dieses Klosters, dem er seit zwei Jahren vorstand, als Inquisitor, als Mann der Wissenschaft, als Theologe und nicht zuletzt als Seelsorger blieb ihm viel zu wenig Zeit für all seine Aufgaben. Doch er hatte schon als junger Mensch gelernt, dass man Schritt für Schritt vorgehen musste, wollte man etwas erreichen. Heute noch würde er das Traktat beenden und morgen schon die Konzeption für sein neues Vorhaben entwerfen. Ihm war bewusst, dass hierzu umfangreiche Recherchen nötig waren – seine eigenen Erfahrungen sollten darin einfließen wie auch die Gedanken anderer großer Geister. Als Erstes würde er für seine Klosterbibliothek eine Ausgabe des Formicarius von Johannes Nider besorgen lassen, einem vor Jahrzehnten verstorbenen Ordensbruder. Dieses Buch schien ihm am geeignetsten für den Einstieg.
Er nahm einen tiefen Schluck von dem köstlichen Roten Traminer und setzte zur Schlussbemerkung des Traktats an. Als er merkte, wie seine Gedanken zum wiederholten Male abschweiften, ließ er fast ärgerlich die Feder sinken. Die Ereignisse im Hause des Krämers Bertolt Mittnacht beschäftigten ihn doch mehr, als ihm lieb war. Vor allem die junge Susanna ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Wie gelöst, wie erleichtert sie schließlich am Grab ihrer Mutter gestanden hatte! Dabei war es ihm dank seiner Eloquenz ein Leichtes gewesen, Pfarrer wie Stadtarzt davon zu überzeugen, dass Margaretha sich in einem Anflug von geistiger Umnachtung vom Dach gestürzt hatte. Nebenbei bemerkt auch dadurch, dass er jenen verleumderischen Nachbarn Clewi als notorischen Säufer darstellen konnte – ein kleines Detail, das er dem jungen Bruder Martin entlockt hatte. Und noch etwas Bedeutsames hatte er von ihm erfahren: dass ein Schlettstädter Ratsherr Margaretha aus enttäuschter Liebe einst verflucht haben sollte. Wenn dem so war, dann traf die Arme erst recht keine Schuld, dann entsprach das dem Tatbestand des Schadenzaubers, und der Ratsherr gehörte mit dem Tode bestraft! Für einen kurzen Augenblick hatte er in Erwägung gezogen herauszufinden, wer dieser Frevler war, aber einen Prozess gegen einen angesehenen Mann dieser Stadt anzustrengen, war etwas ganz anderes, als damals gegen die Konstanzer und Basler Hexen vorzugehen. Und so hatte er vor dem Pfarrer und dem Stadtarzt hierüber wohlweislich geschwiegen. Bei solcherlei Verdächtigungen gegen hohe Herren musste man sich in Zurückhaltung üben, wollte man keine Verleumdungsklage auf sich ziehen.
Wieder nahm er von dem Wein und empfand endlich die ersehnte Leichtigkeit in seinem Kopf. Was für ein schönes Gefühl war es doch gewesen, Susannas Dankbarkeit zu spüren. Viel zu rar waren solche Augenblicke in seinem Leben geworden. Man hatte sich vom einfachen Menschen schlichtweg zu weit entfernt.
Plötzlich verschmolz vor seinen Augen das Bild Susannas mit dem der jungen Margaretha. Es war unfassbar, wie ähnlich sich die beiden sahen. Susanna war ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten. Dieses goldblonde Haar mit dem leicht rötlichen Schimmer, diese grünen Augen … Nein, noch schöner, noch ebenmäßiger waren Susannas Züge, und erst ihre schlanke Gestalt! Als er ihr letzten Sommer einmal vor dem Kloster begegnet war, war ihm das erstmals aufgefallen, doch nun, da er ausreichend Gelegenheit gehabt hatte, sie zu betrachten, war die Ähnlichkeit noch viel deutlicher gewesen.
Er seufzte laut auf. Warum nur hatte Margaretha ihrer Familie gar nichts über ihn erzählt? Waren sie einstmals als Kinder nicht echte Freunde gewesen? Hatte er sich das alles nur eingebildet? Er merkte, wie ein leiser Grimm in ihm nagte. So wenig war er ihr also wert gewesen. Aber warum wunderte ihn das, schließlich hatte sie ihm das ja später deutlich zu verstehen gegeben.
Mit einem lauten Klatschen erschlug er eine fette Fliege, die sich auf seinem Schreibpult niedergelassen hatte. Was scherte ihn seine Jugendzeit in dieser ärmlichen Gasse? Viel mehr zählte doch, wo er heute im reifen Alter stand, und da gab es so einiges, worauf er stolz sein konnte. Hatte er nicht gestern beim Abschied auf dem Friedhof in Susannas Augen diese reine, kindliche Bewunderung für ihn und seinen Einsatz gelesen? Für diesen Blick hätte er alles getan, um Schande von ihr und ihrer Familie abzuwenden. Wenn es hätte sein müssen, hätte er sogar diesen böswilligen Ratsherrn ausfindig gemacht.
Kapitel 5
Ende Juni 1484
Die Frühsommerhitze hatte nur kurz gewährt. Seit Tagen schon war es viel zu kalt für die Jahreszeit, und heftige Sturmböen fegten immer wieder Regengüsse durch die engen Gassen.
Ich lehnte am offenen Küchenfenster, nachdem das Schlechtwetter endlich eine Pause eingelegt hatte. Nun schob sich sogar die Sonne durch die schweren, dunklen Wolken und schickte ihre Strahlen wie Fingerzeige zur Erde.
Ob es wohl wieder ein so nasses Jahr werden würde wie das vorletzte und das davor, als die Ernten überall fast leer ausfielen und in der Folge Hunger und Seuchen übers Land kamen? Bis jetzt war alles wohlgewachsen, auch in unserem kleinen Gartenstück vor der Stadtmauer, dennoch war die Teuerung kaum zurückgegangen. Ein Malter Roggen kostete noch immer drei Pfund Pfennige statt ein Pfund wie früher. Der Vater schimpfte gewaltig auf all die Geschäftemacher unter den reichen Kaufherren, die die Preise durch Zukäufe und Horten der Ware in die Höhe trieben. Erst neulich hatte ich ihn wieder gramerfüllt mit Gregor flüstern hören, dass er kaum noch wisse, wie wir über die Runden kommen sollten. Wenn unsere Schatulle so gut wie leer war, dann war das schlimm. Gleichzeitig konnte ich mich nicht gegen die freudige Hoffnung wehren, die immer stärker in mir aufstieg, nämlich dass der Vater nun wohl kaum eine Magd einstellen und mich verheiraten würde, wenn es so schlecht um unser Auskommen stand.
Von unten hörte ich das Hoftor ächzen, dann wurde unsere Karre hereingeschoben. Gregor und der Vater waren also vom wöchentlichen Krämermarkt auf dem Wafflerhof zurück, und ich hatte noch nicht einmal die Bratwürste in die Pfanne gelegt! Seit Mutters Tod vor knapp drei Wochen ging so manches drunter und drüber bei uns: Gregor fuhr wegen jedem Mäuseschiss aus der Haut, Vater marschierte versehentlich in Pantoffeln aus dem Haus oder vergaß, sich zu kämmen, und ich war fahrig, ungeschickt und vergesslich geworden wie ein altes Weib. Obendrein erschien mir immer wieder meine Mutter: Mal glaubte ich, ihre zierliche Gestalt über den Hof huschen zu sehen, mal fachte sie das Herdfeuer an und war doch sogleich verschwunden, sobald ich in die Küche trat. Wie schwer war doch der Abschied von einem geliebten Menschen!
Für mich war diese Trauerzeit eine ganz und gar unheimliche Zeit. Erst nach vierzig Tagen nämlich verließen die Seelen endgültig die irdische Welt und kamen im Fegefeuer an, dem Ort der Läuterung. Da sie davor als eine Art Seelentier oder ruheloser Windhauch in der Nähe des Grabes und des eigenen Hauses spukten, vor allem nach Einbruch der Dämmerung, waren wir Lebenden umso mehr dazu angehalten, für die Verstorbenen zu beten.
Wie oft hatte ich in diesen Wochen wach gelegen in meiner Dachkammer, hatte auf nächtliche Geräusche gelauscht, auf jedes Knacken im Holz, jedes Brausen im Dachstuhl, jedes Wimmern herumstreunender Tiere. Einmal war ich mitten in der Nacht nach unten zu Gregor getappt und hatte ihn gefragt, ob er die Mutter auch hören könne, aber er hatte mich nur böse angeschnauzt, ich solle ihn gefälligst in Ruhe schlafen lassen. Er hatte mich schon immer ausgelacht mit meiner Angst vor Geisterwesen.
Rasch schürte ich noch einmal das Herdfeuer, nahm die schwere Pfanne vom Haken und holte den Tiegel mit Schweineschmalz aus der Vorratskammer. Da hörte ich schwere Schritte auf der Treppe, bis die Tür aufsprang und mein Vater eintrat.
«Gregor ist gleich fertig mit dem Ausladen.» Er atmete schwer. «Aber ihr braucht mit dem Mittagessen nicht auf mich zu warten. Ich muss noch einmal fort.»
Wie er da so gebeugt und mit hängenden Schultern im Rundbogen der Tür stand, packte mich das schlechte Gewissen wegen meiner selbstsüchtigen Gedanken angesichts unserer misslichen Lage. Ich machte mir Sorgen um ihn: Er hatte in den letzten drei Wochen sichtlich abgenommen, und sein einst schwarzes, volles Haar und der Vollbart waren schütter und noch grauer geworden.
«Aber der Markt ist doch längst zu Ende», stellte ich fest.
Er schüttelte den Kopf. «Nicht zum Markt, nach Kestenholz will ich. Bin in zwei, drei Stunden zurück.»
Da begriff ich. «Zu diesem Jacob?»
Seitdem man vor einigen Jahren die Juden aus Schlettstadt vertrieben hatte, mussten die, die Geld brauchten, zu den Landjuden hinausfahren. Den christlichen Kaufleuten war es nämlich verboten, gegen Wucher Geld oder Saatgut zu verleihen.
Als der Vater nur die Schultern zuckte und sich schon abwenden wollte, hielt ich ihn am Arm fest.
«Dann steht es so schlimm um uns?», fragte ich ängstlich.
«So arg ist’s auch wieder nicht. Ein kleiner Engpass nur.»
Ich hatte das Gefühl, ihn trösten zu müssen. «Martin sagt, dass die Zeiten bald wieder besser sind. Dass dieses Jahr ein gutes Jahr wird.»
«So? Sagt er das? Dann ist mein Sohn also ein Prophet», brummte er unwillig und verschwand nach unten.
Verunsichert machte ich mich wieder an die Zubereitung des Mittagsessens. Martin, der sich im Kloster mit der Sterndeutung befasste, hatte mir erklärt, dass der Planet Saturn schon bald in das Zeichen des Löwen eintreten würde, und zwar in enger Verbindung mit Jupiter. Obwohl ich nicht einmal die Hälfte davon verstanden hatte, war mir immerhin so viel klar, dass ein warmes und eher trockenes Jahr sicher sei. Mit einem Mal musste ich lächeln, als ich an den Augenblick zurückdachte. Schon immer war Martin darum bemüht gewesen, mir die Welt zu erklären. In seinen Ausführungen war er dann so eifrig, dass er viel zu schnell redete, dabei mit den Händen fuchtelte oder eilig auf und ab ging.
Martin war uns allen ein großer Trost in diesen Tagen. So oft es ging, kam er zu uns und betete mit uns. Ich wusste, dass seine Besuche vor allem mir galten. Von klein auf war er an meiner Seite gewesen, hatte mich mehr behütet, als meine Mutter es mir gegenüber getan hatte. Auf der Gasse hatten sie ihn gehänselt, weil er lieber drinnen mit seiner kleinen Schwester spielte, als draußen herumzutoben. «Die sind mir zu grob», hatte er oft gesagt, «die wollen immer nur raufen und irgendwelchen Unfug anstellen. Genau wie Gregor.» Schon früh hatte er lesen gelernt und mir mit seiner sanften Stimme Geschichten aus dem Buch der Heiligenlegenden vorgetragen – dem einzigen Druckwerk, das wir besaßen und das der Vater auf Mutters Drängen hin damals in Straßburg für viel Geld angeschafft hatte. Als Martin, der lange Zeit zu klein und schmächtig gewesen war, dann plötzlich in die Höhe geschossen war, hatte der Vater, der mit Martins nachdenklicher Art nie viel anfangen konnte, ihn zu einem befreundeten Eisenkrämer in die Lehre geben wollen. Da hatte mein sonst so nachgiebiger Bruder sich lauthals gewehrt: Er wolle studieren und Ordenspriester werden, nichts anderes! Ich erinnerte mich noch gut, wie beim Essen tagelang eisiges Schweigen geherrscht hatte. Am Ende durfte er auf Mutters Fürsprache hin für drei Jahre in die Lateinschule, bevor er als Novize zu den Predigern ging, um an der dortigen Ordensschule sein Studium fortzuführen.
Wie konnte ein Mensch nur so lange studieren, fragte ich mich, während ich den Kessel mit dem viel zu weich gegarten Gemüse an der Kette nach oben zog und die Bratwürste in der Pfanne wendete. Irgendwann musste es doch genug sein mit der Lernerei. War der Kopf nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt voll? Nun ja, bald schon würden Martin andere Aufgaben erwarten. Zu Ostern nächsten Jahres nämlich sollte er zum Priester geweiht werden, obwohl er dafür eigentlich recht jung war. Der Prior hatte ihn jedoch hierzu wohl seit längerem immer wieder ermutigt.
Bruder Heinrich war übrigens schon dreimal mit Martin mitgekommen und hatte bei uns zu Mittag gegessen. Er hatte viel mit uns gebetet und vor allem dem Vater gut zugesprochen. Die Einladung, nach dem Essen noch einen Krug Wein mit uns zu trinken, hatte er jedes Mal gern angenommen. Dabei war mir nicht entgangen, dass er immer wieder die Gespräche auf unsere Mutter als junges Mädchen lenkte. Die beiden hatten sich als Kinder wohl doch recht nahegestanden.
Was ich zuvor auch nicht gewusst hatte: Bruder Heinrich war ein überaus bedeutender und weithin bekannter Mann. Er hatte in Rom die Theologie studiert und dort auch die Doktorwürde erworben. Obendrein hatte er vielerlei Traktate verfasst, die sogar gedruckt worden waren und die man daher überall in den deutschen Landen lesen konnte. Als Verfasser nannte er sich dann auf Lateinisch Doktor Henricus Institoris. Martin schwärmte regelrecht von ihm, wenn wir unter uns waren. Vor allem dessen Welterfahrenheit bewunderte er, wo er doch selbst nie weiter als bis Straßburg oder Basel gekommen war. «Wenn er mir von diesen fernen Ländern und seinen Menschen erzählt, kann ich das bildhaft vor mir sehen! Überhaupt: Er ist wie ein zweiter Vater für mich, hat mich von Anfang an gefördert – erst als mein Lektor, dann als Prior. Und er nimmt mich trotz des Altersunterschieds ganz und gar ernst!»
Auch ich war inzwischen fast ein wenig stolz, dass ein solch wichtiger Mann unser bescheidenes Bürgerhaus aufsuchte wie ein guter Freund der Familie. Was mich inzwischen am meisten fesselte, war, dass der Prior ein leibhaftiger päpstlicher Inquisitor sein sollte, der sich dem Kampf gegen Ketzer und Ungläubige verschrieben hatte und aus diesem Grund viel in der Welt unterwegs war. Ein wenig gruselte mir allerdings auch, wenn er auf unsere Fragen hin voller Inbrunst berichtete, wo überall er schon tätig geworden war gegen das mal offene, mal versteckte Übel der Ketzerei: bei uns im Elsass, rheinaufwärts im Basler Land oder am Bodensee ebenso wie im fernen Trient, das schon auf der anderen Seite des riesigen Alpengebirges lag, dazu in berühmten deutschen Städten wie Heidelberg oder Augsburg, von denen ich indessen noch nie gehört hatte. Seine sonst so ruhige, ein wenig heisere Stimme wurde schneidend, wenn er mit zusammengekniffenen Augen den Eifer verdammte, den jeder dem Aberglauben widmete, statt sich um die Gebote der wahren Religion zu scheren. Der Drudenfuß sei unter den Leuten schon ebenso verbreitet wie das Kreuzzeichen, hatte er am gestrigen Tag so laut gewettert, das ich zusammengezuckt war. Zum Glück war von dem Fünfeck, das die Henkersfrau einst auf die Schwelle unserer Haustür gemalt hatte, nichts mehr zu sehen.
«O dieser Aberglaube, dieser allseitige Aberglaube!», klagte er, während er sich vom Vater den Becher mit Wein auffüllen ließ. «Anstatt zu unserem Erlöser oder der Heiligen Jungfrau zu beten, ruft man Dämonen an! Eine unerträgliche Verwilderung des Glaubens breitet sich derzeit in unserem christlichen Abendland aus, und es ist an uns Inquisitoren, dies bereits im Keim zu ersticken. Erst recht dort, wo Zauberei und Magie im Verborgenen blühen.»
«Und woran wollt Ihr erkennen, ob einer nicht den rechten Glauben hat, wenn’s doch im Verborgenen blüht?», fragte Gregor mit einem leicht spöttischen Lächeln. Ich hatte mittlerweile den Eindruck, dass er den Prior nicht allzu sehr leiden mochte.
«Dies eben, mein Sohn, ist die wahre Kunst der Inquisition. Menschenkenntnis gehört ebenso dazu wie die durchdachte Methode der Befragung. Aber inzwischen wird ja sogar ganz offen gegen den Glauben verstoßen: Da suchen die Leute die Zukunft zu erfahren oder Heilung mittels irgendwelchem Hokuspokus, dabei werden sie von diesen selbst ernannten Zauberern nur aufs schändlichste betrogen.»
«Zurzeit wär mir viel dran gelegen, in die Zukunft zu sehen», warf der Vater seufzend ein.
«Das solltet Ihr strikt unterlassen, Meister Mittnacht. Der Allmächtige allein lenkt unsere Schicksale und weiß um jedes einzelne. Zu glauben, irgendwelche wirren Träume, irgendein Rabengekrächze oder gar ein Haufen Stallmist könnten uns Einblick in die Zukunft geben, ist nicht nur anmaßende Dummheit, sondern Gotteslästerung.»
Fast erschrocken sah mein Vater ihn an. Erst recht, als der Prior sich erhob und über unsere Köpfe hinweg sprach, als hätte er eine große Zuhörerschaft vor sich: «Wie steht in der Heiligen Schrift geschrieben? Ihr sollt euch nicht wenden zu den Wahrsagern, und forscht nicht von den Zeichendeutern, auf dass ihr nicht an ihnen verunreinigt werdet. Denn ich bin der HERR, euer Gott.»
Als er sich wieder setzte, herrschte für einen Moment Stille am Tisch. Ich war nicht weniger verunsichert als der Vater. Nutzte doch jeder, den ich kannte, die kleinen Zeichen des Alltags, um zu wissen, wie der Tag oder das Jahr werden würde. Beging Martin mit seiner Sterndeutung dann nicht sogar ein großes Unrecht? Bis dahin hatte ich schweigend zugehört, aber jetzt brannte mir etwas auf der Zunge.
«Darf ich Euch etwas fragen, Bruder Heinrich?»
Er lächelte. «Nur zu, Susanna.»
«Wenn mir nun des Morgens eine Spinne oder eine schwarze Katze über den Weg läuft und ich mich dann deshalb den Tag über vorsehe, dann will ich damit doch nicht gegen Gott lästern. Ist das dann trotzdem schon eine Sünde?»
«Ich glaube dir gern, dass du nicht abgöttisch handeln willst. Dennoch tust du es, wenn auch aus Gedankenlosigkeit. Aber dies ist ein minder schwerer Fall von falschem Glauben. Nehmen wir lieber den Schadenzauber: Sieht sich der gemeine Mann verhext, rennt er schnurstracks zu einem zauberischen alten Weiblein und fleht um Hilfe. Damit aber treibt man den Teufel mit dem Beelzebub aus. Einzig und allein ein Priester oder Exorzist kann dem Behexten wirklich helfen.»
«Exorzist? Dann glaubt Ihr als Geistlicher also gerade so an Hexerei wie die einfachen Leute?», fragte ich leise.
«Was für eine Frage! Solcherlei Übel ereignet sich schließlich jeden Tag. Ich selbst kenne einen braven Zunftmeister, der letzten Herbst mit einem adligen Herrn vor den Toren von Speyer spazieren ging. Als ihnen ein Kräuterweib entgegenkam, warnte sein Begleiter ihn, er solle sich mit dem Kreuzzeichen schützen, da das Weib den bösen Blick habe. Doch der Zunftmeister hatte darüber nur gelacht, als das Weib an ihnen vorbeiging. Da schmerzte ihm auch schon der linke Fuß so heftig, dass er nicht mehr laufen konnte. Und was tat der dumme Kerl? Er suchte eine dieser Zauberkundigen auf, die sich anmaßen, mächtiger als unser Herrgott zu sein. Zwar ging es ihm hernach ein wenig besser, doch heute noch humpelt der Mann. Was ich damit sagen will: Nicht nur Hexen und Unholde, auch diese selbsternannten Heilsbringer stehen mit Satanas im Bunde und lassen sich von ihm zum Werkzeug machen. Sie allesamt gehören unerbittlich verfolgt und bestraft, und zwar mit dem Feuertod. Steht doch schon im Buch Exodus geschrieben: Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen.»
Mir lief augenblicklich ein Schauer über den Rücken. Noch nie hatte ich länger über all diese Dinge nachgedacht.
«Wenn nun aber die Zauberer zum Werkzeug der Dämonen werden», brachte ich hervor, «und gar nicht mehr nach dem eigenen Willen handeln, so kann man sie doch eigentlich nicht bestrafen?»
«Von wegen. Sie bleiben trotz allem beseelte und frei handelnde Werkzeuge. Und nicht zuletzt haben sie sich durch ihren ersten Pakt freiwillig den Dämonen unterworfen.»
«Aber warum lässt Gott, der doch alles ordnet, überhaupt Dämonen zu?»
«Das indessen solltest du eigentlich wissen, Susanna. Gott selbst hat die Dämonen abgesandt, um uns Menschen heimzusuchen und die Verdammten zu strafen.»
Am Ende hatte ich so viele Fragen gestellt, dass der Vater mich heftig getadelt hatte, nachdem sich der Prior wieder auf den Heimweg gemacht hatte. Und überhaupt sei ihm der Prior diesmal zu weit gegangen mit seinen Predigten, sein Haus sei schließlich keine Kirche, sein Mittagstisch keine Kanzel.
Eine aufgebrachte Stimme ließ mich am Herdfeuer aus meinen Erinnerungen auffahren.
«Bist du noch bei Trost?» Es war Gregor, der sich vor mir in der Küche aufbaute. «Die Bratwürste sind ja halb verbrannt!»
«Dann schneid halt ab, was schwarz ist», blaffte ich zurück. Plötzlich sorgte ich mich darum, dass ich kurz vor dem Tod der Mutter die Henkersfrau aufgesucht hatte, damit sie mir aus der Hand lese. Ich hatte unbedingt wissen wollen, ob ich eines Tages mit diesem schrecklichen Auberlin verheiratet sein würde. Um sie zu entlohnen, hatte ich aus unserem Lager einen kleinen Holztiegel mit Deckel stibitzt, den sie gewiss gut würde brauchen können für ihre Heilsalben. Aber die dünne Agnes hatte nur gelacht und mich wieder nach Hause geschickt. Ich solle wiederkommen, wenn ich zwei Pfennige beisammenhätte. Klammheimlich hatte ich noch am selben Abend den Tiegel wieder zurück in die Kiste gesteckt.
Mit einem Mal war ich entsetzt über mein Tun: Nicht nur, dass ich drauf und dran gewesen war, etwas eindeutig Gotteslästerliches zu tun – um ein Haar hätte ich hierfür auch noch den Kramladen und damit meinen Vater bestohlen. Ich beschloss, baldmöglichst bei Pfarrer Oberlin zu beichten. Die dünne Agnes brauchte ich dabei ja nicht unbedingt erwähnen, auch wenn der Prior uns zu verstehen gegeben hatte, dass ein jeder von uns in der Pflicht stehe, Verdächtiges zu melden. Vielleicht hatte Bruder Heinrich ja gar nicht so unrecht: Überall dort, wo Hexen und Unholde ihr Unwesen trieben, mussten sie auch bekämpft werden. Sagte man der Henkersfrau nicht nach, sie stehe mit Dämonen im Bunde und könne die Toten auferstehen lassen? Bei Neumond berühre sie hierzu den Ring der Kirchentür und rufe: «Steht auf, ihr alten Brüder und Schwestern!», um dann im Stockdunkeln ärschlings dreimal um die Kirche zu gehen. Das mochte wahr sein oder nicht, aber eines wusste ich ganz sicher: Sie hatte noch niemals Schaden angerichtet, weder an Mensch noch an Vieh. Im Gegenteil: Sie half und heilte mit ihren Salben und Amuletten. Und das allein, fand ich, zählte am Ende.
Kapitel 6
Schlettstadt im Elsass, Hochsommer 1440
Mühsam unterdrückte Heinrich seinen Ärger. Er hatte Margaretha drei seiner schönsten Murmeln geschenkt, und nun wollte sie nicht mit ihm spielen! Wollte stattdessen mit den anderen Kindern zum Fluss, obwohl ihnen das verboten war. Außerdem war es viel zu heiß. Hier im Schatten der Hofeinfahrt spielte es sich viel angenehmer.
«Was ist?» Margaretha verschränkte die Arme. «Kommst du jetzt mit oder nicht?»
Sie legte den Kopf schief. Aus ihren goldblonden Zöpfen, die zu einem Haarkranz geflochten waren, hatte sich eine Strähne gelöst und hing ihr als Locke über die hohe, helle Stirn.
«Hab keine Lust», erwiderte er mürrisch.
Sie schob die Unterlippe vor. «Hast ja bloß Angst, dass es wieder Streit gibt mit den älteren Buben.»
«Das ist nicht wahr. Ich hab keine Angst vor denen. Mir ist bloß zu heiß.»
«Dann bleibst halt da.»
«Tu ich auch. Aber dann kannst mir grad so die Murmeln zurückgeben.»
Für einen Augenblick wirkte sie enttäuscht. Dann zuckte sie die Schultern, warf ihm die Murmeln vor die Füße und wandte sich ab.
Er sah ihr nach, wie sie in ihrem hellen, immer ein wenig fleckigen Leinenkleid der Kinderschar hinterherrannte. Mit einem hatte sie ins Schwarze getroffen: Wenn gar zu viele Kinder beieinander waren, machte ihn das unsicher. Was aber allein daran lag, dass er mit seinen zehn Jahren immer noch viel kleiner und schmächtiger war als die Gleichaltrigen aus ihrem Viertel. Und die nutzten das aus und foppten und hänselten ihn, vor allem, wenn dieses Großmaul Bertschi dabei war. Erst gestern hatten sie ihm eine Kelle Mehl über dem Kopf ausgeleert, das sie dem Weißbeck zuvor aus der Backstube stibitzt hatten. Alle hatten sie gelacht, wie er da weiß bepudert auf der Gasse stand. Alle, bis auf Margaretha, die mit den Fäusten auf Bertschi losgegangen war. Obwohl der so viel älter war und um einiges größer als sie.
Wütend schüttelte er den Kopf. Du brauchst mir gar nicht immer helfen, dachte er. Wenn ich erstmal in der Lateinschule bin, dann zeig ich’s euch allen. Und spielen will ich dann ohnehin nicht mehr mit euch. Der Herr Pfarrer nämlich, der hält große Stücke auf mich und begleicht mir sogar das Schulgeld. Jetzt muss es nur noch die Mutter erlauben.
Kapitel 7
Schlettstadt, Anfang Juli 1484
Schwungvoll glitt Heinrichs Feder über das gelbliche Papier. Johannes Niders Schrift Formicarius, zu Deutsch Ameisenhaufen, war genau der richtige Einstieg in sein großes Vorhaben. Es war in der Tat bemerkenswert, wie präzise sein Ordensbruder bereits knapp fünfzig Jahre zuvor all die Auswüchse der heutigen Zeit beschrieben hatte. Obendrein anschaulich zu lesen, in dieser klugen Dialogform zwischen einem Theologen und seinem einfältigen Schüler, wobei der Ameisenhaufen als Sinnbild für das menschliche Gemeinwesen stand. Letzterem mochte Heinrich nicht unbedingt zustimmen, aber darum ging es ihm auch gar nicht bei seinen Abschriften: Ihn interessierten die zahlreichen Beispiele im letzten Teil dieses Prediger- und Erbauungsbuchs, in denen es um die neue Sekte der Unholde und Zauberer ging und ausführlich über die Hexenverfolgungen des Berner Landvogts Peter von Greyerz im eidgenössischen Simmental berichtet wurde.
Zuvor hatte Heinrich bereits eingehend die Kirchenväter Augustinus und Thomas von Aquin studiert, doch erst in Johannes Nider hatte er einen Gesinnungsgenossen gefunden, der bereits Jahrzehnte zuvor erkannt hatte, wovor die allermeisten seiner Ordensbrüder noch immer die Augen verschlossen: dass diese neue Sekte weitaus verbreiteter und gefährlicher war als die der Hussiten oder Waldenser.
Als er zwölf Blätter in engen Zeilen befüllt hatte, beschloss er, sich eine Unterbrechung zu gönnen. Im Kreuzgang wollte er das Geschriebene noch einmal auf sich wirken lassen. Es war die Zeit der Non, und seine Mitbrüder hatten sich, wenn sie nicht gerade aushäusig waren, in der Klosterkirche zum Stundengebet versammelt. So würde er ungestört seinen Gedanken nachgehen können.
Er zog die Tür der Bibliothek hinter sich zu, die sich des besseren Lichts wegen im Südflügel der Klausur befand, und tappte die Treppe zum Kreuzgang hinunter. Vom Chor der Kirche drang der Gesang der Mönche herüber, ansonsten lagen Arkaden und Innenhof still und menschenleer vor ihm. So war ihm der Kreuzgang am liebsten.