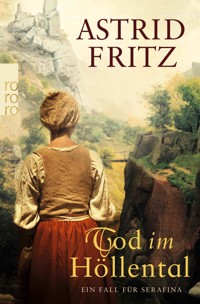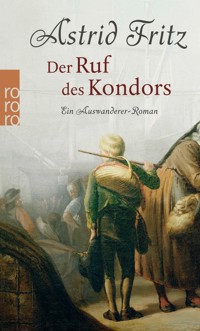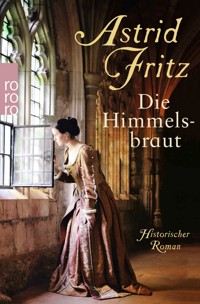9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau trotzt Pest, Tod und Teufel. Unaufhaltsam wälzt sich 1348 der Schwarze Tod in Richtung Freiburg. Die Schuld an der Seuche wird den Juden zugeschoben. Als Clara herausfindet, dass ihr Sohn das jüdische Nachbarsmädchen Esther liebt, versucht sie mit allen Mitteln, ihn von der gefährlichen Verbindung abzubringen. Unterdessen erkennt Claras Mann als einer der wenigen Wundärzte, dass sich die Pest in Wirklichkeit durch Ansteckung verbreitet. Gemeinsam mit ihm tritt Clara den Kampf gegen die Seuche an. Wagemutig lässt sie alle Vorurteile hinter sich und sagt nicht nur der Pest, sondern auch dem Hass gegen die Juden den Kampf an – denn sie hat eine quälende Schuld wiedergutzumachen … «Ein Plädoyer für die Menschlichkeit und ein historischer Roman, wie man ihn sich wünscht.» (Münchner Merkur)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Astrid Fritz
Der Pestengel von Freiburg
Historischer Roman
Über dieses Buch
Eine Frau trotzt Pest, Tod und Teufel.
Unaufhaltsam wälzt sich 1348 der Schwarze Tod in Richtung Freiburg. Die Schuld an der Seuche wird den Juden zugeschoben. Als Clara herausfindet, dass ihr Sohn das jüdische Nachbarsmädchen Esther liebt, versucht sie mit allen Mitteln, ihn von der gefährlichen Verbindung abzubringen.
Unterdessen erkennt Claras Mann als einer der wenigen Wundärzte, dass sich die Pest in Wirklichkeit durch Ansteckung verbreitet. Gemeinsam mit ihm tritt Clara den Kampf gegen die Seuche an. Wagemutig lässt sie alle Vorurteile hinter sich und sagt nicht nur der Pest, sondern auch dem Hass gegen die Juden den Kampf an – denn sie hat eine quälende Schuld wiedergutzumachen …
«Ein Plädoyer für die Menschlichkeit und ein historischer Roman, wie man ihn sich wünscht.» (Münchner Merkur)
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Juli 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildung masterfile
ISBN 978-3-644-30571-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Kapitel 1
Schwefelgelb türmten sich die Wolken gen Süden, als ein Donnerschlag die umliegenden Berghänge erzittern ließ. Die Bauersleute starrten fassungslos auf die Flamme, die dem Wolkengebirge entwich – eine Flamme von grellem, unwirklichem Blau, die allmählich größer wurde und auf die Menschen zuströmte. Eine Frauengestalt in weißem Gewand löste sich daraus, das offene Haar schimmerte silbern, die Augen glänzten, um die Stirn strahlte ein feuriger Kranz. Majestätisch hob sie die Hand und schwebte auf den Ersten zu, einen mageren Burschen, der aufschrie und doch keinen Laut herausbrachte. Schon schleuderte sie einen Pfeil aus bleicher Hand, schon ging der Junge in die Knie, bäumte sich auf und sackte leblos in sich zusammen. Der Altbauer war der Nächste in der Reihe, nach ihm seine beiden Knechte, die Mägde, seine Frau, die jüngsten Kinder – keinen verschonte die Todesbotin. Vom nahen Dorf her begannen die Hunde zu heulen, als sich der letzte der dreizehn Leiber in die Erde schmiegte und verstarb.
«Der Pestengel», entfuhr es Clara. Sie stellte den Milchkrug so heftig auf dem Tisch ab, dass er überschwappte, und bekreuzigte sich.
Ihr Mann zog die Augenbrauen zusammen. «Ein dummer Traum, nichts weiter.»
«Mag sein.» Benedikt wirkte noch immer verstört. «Aber ich bekomme das entsetzliche Bild nicht aus dem Kopf. Und dann – jedermann weiß doch, dass Träume in die Zukunft weisen können.»
Heinrich Grathwohl warf seiner Frau einen missbilligenden Blick zu. «Das hast du jetzt von deinem ewigen Gerede von Zeichen und Träumen. Schau dir nur mal die Johanna an – ganz verschreckt sieht sie aus.»
Eine Zeit lang war nur das Knacken des Herdfeuers zu vernehmen. Sein flackernder Schein spendete das einzige Licht an diesem dunklen Wintermorgen.
Clara gab sich einen Ruck.
«Euer Vater hat recht. Manchmal träumt man auch von Sachen, die einem nicht aus dem Sinn gehen.» Sie betrachtete Benedikt, ihren Ältesten, voller Zuneigung. Schon als Knabe war oft die Phantasie mit ihm durchgegangen, hatte er sich in Träumereien verloren, wo andre Kinder auf der Gasse sich um einen Ball gerauft hatten.
«Bei euch auf der Baustelle wird viel geschwatzt», fuhr sie fort. «Wahrscheinlich hast du da irgendwas aufgeschnappt.»
Das herrische Klopfen draußen an der Haustür unterbrach ihr Gespräch. Solcherart pflegte sich nur der Gerichtsbote anzukündigen.
Der Hausvater zog eine Grimasse und verließ die wohlig warme Küche Richtung Haustür. In der Regel hatte ein Besuch des Boten nichts Gutes zu bedeuten, schon gar nicht zu so früher Stunde. Clara hörte, wie der Riegel zurückgeschoben wurde, dann die knarzende Stimme des Büttels. Als ihr Mann mit einem Schwall kalter Luft zurückkehrte, zerrte er Hut und Umhang vom Wandhaken.
«Ich muss zur Gerichtsschau. Ein totes Neugeborenes, im Weinkeller vom Spital.»
«Heilige Elisabeth, wie furchtbar!» Clara bekreuzigte sich zum zweiten Mal an diesem Morgen. «Willst du nicht wenigstens noch fertig essen?»
Heinrich Grathwohl schüttelte den Kopf. «Behaimer wartet schon. Ach, das hätt ich beinah vergessen.»
Er zog einen verschlossenen Tiegel vom Küchenbord und reichte ihn Benedikt.
«Eine Paste aus Eibischwurzel. Bring sie rasch zu den Grünbaums, ich hab es bereits für gestern versprochen. – Ihr Arzt ist mal wieder krank», fügte er, in Claras Richtung, fast entschuldigend hinzu. Dann war er auch schon aus der Küche verschwunden.
Clara riss ihrem Sohn das Töpfchen aus der Hand.
«Lass nur, ich mach das. Ich muss ohnehin nachher zum Apotheker und zum Markt.» Sie tat, als bemerke sie die Enttäuschung in Benedikts Blick nicht. «Und du, Johanna, geh die Kleinen wecken. Es ist ja schon helllichter Tag. – Was glaubst du, Benedikt», sie versuchte, ihrer Stimme einen munteren Klang zu geben, «wirst du heut nach der Arbeit wieder mit Meister Johannes zu Tisch gehen?»
Benedikt zuckte die Schultern. «Ich weiß es nicht.»
«Ach, mein Junge. Ich bin so stolz auf dich. In so kurzer Zeit schon Meisterknecht.»
Sie strich ihm über das dichte, wellige Haar, das mit den Jahren immer dunkler wurde. Als kleiner Junge hatte er goldblonde Locken gehabt, die ihm bis über die Schulter fielen, und es hatte ihr im Herzen wehgetan, dass sie sie eines Tages abschneiden musste. Die Gassenbuben hatten ihn nämlich als «Mägdelein» zu hänseln begonnen.
«Mutter!» Benedikt entwand sich ihrer Zärtlichkeit. «Ich bin kein Kind mehr.»
Clara zog ihre Hand zurück. «Ich weiß. Viel zu schnell werdet ihr alle groß.»
Sie betrachtete Johanna, die in zwei Jahren, wenn sie sechzehn wurde, Benedikts Kinderfreund heiraten würde, den Tucher Meinwart. Mit dessen Eltern war bereits alles abgesprochen. Clara unterdrückte einen Seufzer.
«Und vergiss nicht wieder deine Handschuhe. Es ist bitterkalt draußen.»
Als sie ihren Sohn zur Haustür brachte, musste sie an sich halten, ihm keinen Kuss auf die Stirn zu drücken. Benedikt hatte recht – am liebsten würde sie ihn noch immer hätscheln und umsorgen wie ein Kleinkind. Aber vielleicht wollte sie auch nur die Strenge ihres Ehegefährten ein wenig ausgleichen. Heinrich nämlich hatte nie verwunden, dass sein Ältester nicht in seine Fußstapfen getreten war und sich stattdessen in ungeahnter Starrköpfigkeit für eine Lehre als Steinmetz entschieden hatte. Dass der Junge in nur vier Jahren seine Lehrzeit durchlaufen hatte und bereits jetzt, mit gerade einmal zwanzig, vom Gesellen zum Meisterknecht berufen worden war und für die hochangesehene Kirchenbauhütte arbeitete, schien seinen Vater nur wenig zu versöhnen. Nicht einmal, dass er dereinst als Steinmetzmeister zu den bestbezahlten Handwerkern gehören würde.
Keine halbe Stunde später öffnete Clara das Hoftor und trat hinaus auf die Webergasse. Von hier waren es nur ein paar Schritte hinüber zur Großen Gass, wo die hiesigen Marktleute ihre Erzeugnisse feilboten. Eisiger Wind blies ihr entgegen, und sie schlang sich ihr wollenes Tuch enger um den Kopf. Die Holztrippen unter den Schuhen hätte sie sich heute ersparen können, so festgefroren war der Boden.
Jemand hatte das Trittbrett, das hier wie überall von der Haustür zu den Bohlen in der Straßenmitte führte, zur Seite gezogen. Das war sicher einer der Juden gewesen, die sich fortwährend darüber beklagten, mit ihren Karren nicht mehr durchzukommen vor lauter Brettern. Aber wie sonst hätte man in diesem bislang ganz und gar verregneten Winter aus dem Haus gekonnt? Die Böden waren am Ende völlig aufgeweicht und von tiefen Fahrrinnen durchzogen gewesen, nur mehr ein einziger Matsch aus Morast, Schweine-, Hunde- und Hühnerkot, der die Abwassergräben auf der Gassenmitte verstopfte. Und wie die Menschen nun mal waren: Sobald die Gassenfeger nicht mehr nachkamen, den durchnässten Unflat wegzuschaffen, kippten sie trotz strenger Verbote erst recht ihre Brunzkacheln und Essensreste aus dem Fenster und lockten damit noch mehr Viehzeug und Gestank an.
Clara schnaubte. Wenigstens hierin erwies es sich als Vorteil, Tür an Tür mit den Juden zu leben. Bei ihnen war es um einiges sauberer als in den restlichen Gassen der Stadt, wo man sogar über tote Säue und Katzen stolperte und sich die Misthaufen bis zu den Gräben häuften.
Sie schickte sich eben an, in Richtung Marktgasse zu gehen, als Johannas Rufen sie innehalten ließ.
«Du hast was vergessen, Mutter.»
Das Mädchen stand in der Haustür und hielt ihr den tönernen Tiegel entgegen.
«Ach herrje, die Paste. Ich dank dir, meine Liebe. Vergiss nicht, das restliche Kraut einzusäuern. Und wenn du Kathrins Verband wechselst, lass den Arm ein Weilchen an der frischen Luft. Das tut der Wunde gut.» Sie machte sich immer noch Sorgen um ihre Kleinste, die sich beim Spielen am Herdfeuer verbrannt hatte.
Johanna lächelte ihr feines Lächeln. «Ich weiß schon, Mutter.»
Clara nickte. Ihre Älteste war so ganz anders als Benedikt. So verständig und umsichtig, dazu fleißiger als jede Magd. Bald schon ein wenig zu uneigennützig, befand Clara. Einem Weib konnte das zum Schaden werden – und sie dachte dabei unwillkürlich an den jungen Tucher. Johanna hatte damals in das Eheversprechen eingewilligt, obgleich dem Mädchen der stille, schüchterne Sohn des Wollschlägers weitaus besser gefallen hatte. Aber als fünftes Kind einer ärmlichen Familie würde der wohl kaum jemals seine eigene Familie angemessen ernähren können. Meinwarts Vater hingegen war ein erfolgreicher Kaufherr, der seinen Handel bis nach Savoyen und ins Burgund betrieb. Zudem kannte man sich gut, da die Tuchers im Haus gegenüber gewohnt hatten und die Kinder miteinander aufgewachsen waren. Inzwischen allerdings waren sie in ein weitaus prächtigeres Haus am Markt gezogen – auch weil sie nicht länger am Eingang zum Judenviertel wohnen wollten. Und aus dem aufgeweckten, etwas wilden Knaben Meinwart war ein eitler Nichtsnutz und Daumendreher geworden, der jedem Weiberrock nachlief. Es war zu befürchten, dass er Johannas Selbstlosigkeit gehörig ausnutzen würde.
Als Clara ihren Mann einmal darauf angesprochen hatte, ob Meinwart wirklich der Richtige sei für ihre Tochter, hatte Heinrich gelacht. «Der Junge ist halt im Alter, wo er sich die Hörner abstößt. Besser jetzt als im Stand der Ehe. Unser Benedikt dürfte sich da ruhig was abschauen – so wie der sich immer nur in seine Arbeit vergräbt.»
Während der kurzen Wegstrecke hinüber ins Haus Zum Grünen Baum verlangsamten sich Claras Schritte. Sie verspürte keinerlei Lust, bei den Grünbaums vorbeizuschauen – aber immer noch besser sie selbst als ihr Sohn. Warum nur musste Heinrich immer gleich so voreilig seine Hilfe anbieten? Was ging es ihn an, wenn die Juden einen Arzt hatten, der selbst ständig krank war? Sollten sich die Grünbaums doch anderweitig um ihre Heilmittel und Kräuter kümmern.
Sie setzte ihren Einkaufskorb ab und rammte den goldfarbenen Türklopfer gegen das Holz. Dabei bemühte sie sich, ihren Blick vom rechten Türpfosten fernzuhalten, an dem, wie an allen Türen der Juden, eine längliche Metallkapsel befestigt war. Ihr Mann hatte zwar behauptet, sie enthalte einen Pergamentstreifen mit dem jüdischen Glaubensbekenntnis, aber sie hielt es eher mit dem, was die Leute hier munkelten. Das geheimnisvolle Ding nämlich habe mit Zauberei zu tun, die die Hebräer heimlich ausübten. Die Flickschneiderin von der Oberen Linde behauptete gar, auf jenem Pergament sei der Pakt mit dem Leibhaftigen besiegelt, und zur Bekräftigung des Bundes küssten die Juden dieses Ding beim Übertreten der Schwelle, indem sie die Fingerspitzen der rechten Hand an die Metallkapsel und dann zum Mund führten.
Clara selbst hatte im letzten Jahr mit angehört, wie der alte Moische ben Chajm, nach seinem Haus allgemein Grünbaum genannt, beim Anbringen der Kapsel beschwörende Worte gesprochen hatte, die klangen wie: Bara Atah Adona. Das sei Hebräisch, hatte Heinrich ihr weismachen wollen, die Sprache ihrer Vorväter. Aber warum sollte sie das glauben, wo ihr Mann doch kein Wort Hebräisch verstand? Sie waren ums Haar in Streit geraten, wie schon häufiger, wenn es um die Grünbaums ging.
Sie klopfte erneut, als die Tür auch schon aufsprang.
«Guten Morgen, Frau Nachbarin.» Das Dienstmädchen knickste höflich. «Kommt nur herein.»
Clara folgte dem Mädchen durch die düstere Eingangshalle die Treppe hinauf in die Wohnstube, an deren Türrahmen ebenfalls einer dieser metallenen Behälter hing. Mit gesenktem Blick ging sie daran vorbei und betrat das geräumige, hellerleuchtete Zimmer. Stickige Wärme schlug ihr entgegen.
Als ihr Blick durch den Raum schweifte, staunte sie einmal mehr über die prächtige Ausstattung im Innern des Hauses, das sich äußerlich so gar nicht unterschied von den eher schmucklosen Häusern in dieser Ecke der Stadt. Flauschige, bunte Teppiche aus dem fernen Morgenland bedeckten den Dielenboden, die Wände waren mit bestickten Vorhängen bespannt, auf den Bänken entlang der Wand luden dickgepolsterte Sitzkissen aus dunkelrotem Samt zum Ausruhen ein. Alles, was bei ihnen drüben aus blankem, rohem Holz gezimmert war, sah man hier mit weichen, warmen Stoffen überzogen, und wo nicht, boten sich dem Auge kunstvolle Schnitzereien oder kostbare Eisenbeschläge, wie bei den Türen und Truhen. Auf der Anrichte blitzte das Silber und Kupfer von Leuchtern und Trinkgefäßen, dazwischen fanden sich Dosen, Kästchen und Täfelchen, in die fremdartige Schriftzeichen geritzt waren. Allein die vielen Wachskerzen in den Leuchtern, die jetzt im Winter, wo die Fensterläden geschlossen waren, allesamt angesteckt waren, mussten ein Vermögen gekostet haben!
Ein röhrender Hustenanfall ließ Clara zusammenzucken. Auf einem gepolsterten Lehnstuhl, dicht bei der Ofenwandung, die mit jenen neuartigen, grünglasierten Kacheln verkleidet war, sah sie die Hausherrin sitzen. Kopf und Hals hatte sie mit einem dicken Tuch umhüllt.
«Grüß dich Gott, Deborah. Das hört sich gar nicht gut an.»
«Friede sei mit dir», krächzte die Frau.
«Hier, das soll ich dir von meinem Heinrich geben. Eibischwurzel gegen den Husten. Soll er heut noch nach dir sehen?»
Deborah winkte ab. «Er hat die Paste doch wohl hoffentlich so zubereitet, wie Moische es ihm erklärt hat?»
«Das musst du ihn schon selbst fragen. Ich kenn mich mit euren Speisevorschriften nicht aus.»
Clara stellte den Tiegel auf der Tischplatte ab und blieb unschlüssig stehen.
«Sonst noch was?» Deborah kniff misslaunig die Augen zusammen.
«Wann ist euer Arzt eigentlich wieder gesund?»
«Willst du das wissen oder dein Mann?»
Clara schob verärgert die Unterlippe vor. «Kannst du mir nicht einfach eine Antwort geben?»
Stattdessen wurde Deborah von einem neuen Hustenanfall geschüttelt. Clara griff zu dem Wasserkrug, der in der Mauernische stand, goss den Becher daneben halb voll und drückte ihn Deborah in die Hand, nachdem sie wieder zu Atem gekommen war.
«Du musst viel trinken. Und frische Luft solltest auch mal reinlassen. Das ist ja zum Ersticken hier.»
Dann wandte sie sich ohne Gruß zur Tür, wo das Dienstmädchen wartete, um sie hinauszugeleiten. Unten in der Eingangsdiele begegnete sie Esther, die freundlich grüßte. Das Mädchen, die einzige Tochter der Grünbaums, war ausnehmend hübsch. Das schmale, ebenmäßig geschnittene Gesicht mit den vollen Lippen und den dunkelblauen Augen hatte selbst jetzt, in seiner winterlichen Blässe, einen zarten mattbraunen Schimmer. Es glich den Marienbildnissen, wie sie die Kirchenmaler darzustellen pflegten, und strahlte dieselbe Herzensgüte aus.
«Seit wann leidet deine Mutter unter diesem bellenden Husten?»
«Die zweite Woche nun schon.» Das Mädchen zog sich den Schleier von ihrem dunklen Haar. «Nachts ist es noch schlimmer.»
«Habt ihr Salbei im Haus?»
«Ich denke, ja.»
«Dann koch einen großen Kessel davon auf. Statt Wasser soll sie tagsüber von dem Sud trinken, mit viel Honig gesüßt.»
Ester nickte. «Das mach ich.» Sie senkte den Blick, und ein Hauch von Röte überzog ihre Wangen. «Mein Vater lässt fragen, ob Benedikt heute Abend nach unserem Herd in der Küche sehen kann. Er zieht nicht mehr richtig, und Aaron ist bis morgen in Straßburg. Außerdem», jetzt wirkte sie noch verlegener, «fängt doch nach Sonnenuntergang der Schabbat an.»
«Benedikt hat keine Zeit. Ich werde meinem Mann Bescheid geben.»
Clara war froh, als sie wieder draußen in der Winterkälte stand. Irgendwie empfand sie die Besuche bei ihren jüdischen Nachbarn immer wieder als beklemmend. Das lag nur zum Teil an dieser ganz unverhohlen ausgestellten Pracht und Eleganz, denn das Gefühl von Neid war Clara fremd. Eher schon hatte es mit der Hausherrin zu tun. Vor allem Clara gegenüber verhielt sich Deborah auf eine nahezu streitbare Weise herablassend, ja feindselig. Und seit jenem Vorfall vor einem Jahr, als Deborah behauptet hatte, Clara habe bei einem ihrer Besuche einen kostbaren Kelch mitgehen lassen, war ihr Verhältnis endgültig verdorben. Deborah hatte sich nicht einmal entschuldigt, nachdem herausgekommen war, dass ihr früheres Dienstmädchen den Diebstahl begangen hatte.
Nicht zuletzt waren da all diese fremdartigen Feierlichkeiten und Riten, diese Gebote und Vorschriften, denen sich die Hebräer unterwarfen und dabei doch angeblich an den Einen, denselben Gott glaubten wie die Christenmenschen. Allein diese unbegreiflichen Speisegesetze: Koscher und damit erlaubt war das Rind, weil es wiederkäute und gespaltene Hufe hatte, nicht indessen das Kamel, das zwar wiederkäute, aber keine gespaltenen Hufe hatte, oder gar das als höchst unrein verrufene Schwein, das zwar gespaltene Hufe aufwies, dafür nicht wiederkäute. Hering durfte gegessen werden, nicht aber Aal. Geflügel war erlaubt, Raubvögel hingegen nicht. Auch durfte Fleisch kein Quäntchen Blut mehr enthalten und nicht mit Milch in Berührung kommen, Fleischiges und Milchiges mussten somit in getrenntem Kochgeschirr zubereitet werden. Das sollte ein Mensch begreifen! Und an ihrem Schabbat, ihrem heiligen Ruhetag, durften sie nicht einmal eine Kerze entzünden oder eine Schreibfeder halten.
Kopfschüttelnd nahm Clara ihren Korb unter den Arm und bog in die Große Gass ein, die sich allmählich mit Dienstmägden, Hausfrauen und Kindern, mit frei laufenden Hunden und grunzenden Schweinen füllte. An Tagen, an denen die aufgesteckte rote Fahne auch fremdem Gewerbe und Handel Marktrecht verlieh, wenn obendrein noch der Vieh- und Rindermarkt abgehalten wurde, gab es hier, auf der Hauptstraße der Stadt, kein Durchkommen mehr. Dann überschrien die Ausrufer sich gegenseitig, um Kundschaft anzulocken, priesen Quacksalber ihre Wundermittel, Zahnbrecher ihre blutigen Dienste an, und nicht selten präsentierten Spielleute und Artisten ihre Künste. An gewöhnlichen Vormittagen wie heute war indessen nicht mal die Hälfte der Krambuden und Verkaufsstände geöffnet, die sich wie Perlen an einer Schnur auf der Straßenmitte aneinanderreihten. Es ging gemächlich zu, und an den friedlich plätschernden Brunnen trafen sich die Frauen zum Klatsch und Tratsch.
Auch wenn einem das Weibergeschwätz zu viel werden konnte, liebte Clara diesen Gang zum Markt, zumal an einem Morgen wie heute mit seiner frostklaren Luft. Den Nachmittag würde sie wieder Heinrich bei seinen Krankenbesuchen begleiten und Stunde um Stunde in stickigen Kammern verbringen. Doch auch das tat sie gern, seit einigen Jahren schon, denn sie gehörte nicht zu den Frauen, die ihr Regiment auf das Reich zwischen Küche, Gemüsegarten und Hühnerstall beschränken mochten. «An dir ist ein halber Wundarzt verlorengegangen, schade nur, dass du eine Frau bist», neckte ihr Mann sie manchmal und nahm doch gern ihren Rat bei der Krankenvisitation an. Schlimm an seinem Handwerk war nur, dass es ab und an so abscheuliche Vorkommnisse gab wie heute der tote Säugling.
Unwillkürlich schwenkte ihr Blick hinüber zum Heilig-Geist-Spital, das an der Großen Gass einen gesamten Straßenblock einnahm und von den Bürgern nur Reiches Spital genannt wurde, seiner zahlreichen Besitztümer und der prächtig ausgestalteten Fassade wegen. Dort im Gewölbekeller frönten nun ihr Mann und dieser fettleibige Filibertus Behaimer, seines Zeichens Stadtmedicus wie auch gräflicher Leibarzt, ihrer traurigen Aufgabe. Wie immer würde Heinrich die Schmutzarbeit machen. Er würde den kleinen Leichnam auf tödliche Wunden untersuchen, währenddessen der studierte Physicus in gehörigem Abstand die anwesenden Ratsherren mit seinen spitzfindigen Erörterungen überschüttete. Clara wusste jetzt schon: Für den Rest des Tages würde ihr Mann mürrisch und schweigsam bleiben.
Seitdem Heinrich im letzten Jahr vor dem Rat der Stadt zum geschworenen Wundarzt vereidigt worden war, musste er nicht nur regelmäßig zur Beschau der Aussätzigen ins Gutleuthaus, sondern auch, als Behaimers rechte Hand gewissermaßen, zu den gerichtlich angeordneten Wundbesichtigungen und Leichenschauen. Mal waren es arme Seelen, denen der Schädel zertrümmert, die Augen ausgestochen oder die Brust aufgeschlitzt worden war, dann wieder wurde er zu halbtoten Delinquenten in die Verliese der Stadt gerufen. Nach vollzogener Marter hatte er deren Wunden genauestens zu protokollieren, ohne sie behandeln zu dürfen. Letzteres nämlich war Sache des Scharfrichters.
Zwar bescherte ihnen dieses Amt ein stattliches Zubrot auf ihre Einkünfte, nämlich zweieinhalb Pfund Pfennige Freiburger Münze und ein Fuder Holz auf jede der vier Fronfasten, aber Clara hätte darauf gut und gerne verzichtet. Zu schwer lagen ihrem Mann diese Pflichten auf der Seele.
Während sie weiterging, grüßte sie geistesabwesend nach links und rechts, wich geschickt der Steirer Elsbeth aus, die einem mit ihren vielen Zipperlein die Ohren vollzujammern pflegte, und beeilte sich, ihre Einkäufe zu erledigen. Sie wollte noch zum Apotheker. Jetzt, am frühen Morgen, würde Christoffel Ceste noch die Zeit haben, eine neue Rezeptur zur Gichtbehandlung durchzusprechen. Sie mochte Meister Christoffel, der seine Kräuter selbst zog, in einem Apothekergärtchen vor der Stadtmauer. Und sie mochte die kleine, freundliche Apotheke in der Salzgasse, in der es immer so herrlich nach Gewürzen, Rauchwerk, Marzipan und Parfüm duftete. Ordentlich aufgereiht standen Heiltränke und Pulver, Pillen und Salben auf Regalen bis unter die Decke, verstaut in bunten Krügen oder in hübsch bemalten hölzernen Dosen und Kästchen.
Als Clara die Laube der Geldwechsler passierte, sah sie, wie Moische ben Chajm zusammen mit Eli und Jossele, seinen beiden Jüngsten, ein schadhaftes Brett an ihrer Schranne austauschte. Jemand musste es in übelster Weise mit einer Spitzhacke malträtiert haben, denn das Holz war an mehreren Stellen gespalten. Clara wollte schon vorbeieilen, als ihr erst die Knaben fröhlich zuwinkten, dann der Vater den Kopf hob.
«Clara!», rief er und richtete sich auf. An seinem abgewetzten dunklen Mantel, der viel zu weit war für den schmächtigen Körper, hingen Eiskristalle und Holzspäne. «Gut, dass ich dich treffe.»
Sie trat näher. «Was ist denn mit eurer Bank geschehen?»
«Ein dummer Bubenstreich, nichts weiter.» Moische verzog sein bärtiges Gesicht zu einem Lächeln und nahm drei Silberpfennige aus einer Schatulle. «Das schuld ich noch deinem lieben Mann für die Behandlung. Und grüß ihn recht herzlich von mir.»
Sie nickte. «Ich war eben bei Deborah. Ihr Husten gefällt mir gar nicht.»
Moische wiegte bekümmert den Kopf. «Nu ja, ich weiß. Aber mit unserem guten alten Nathan – das wird wohl nicht mehr. Nächsten Monat schickt uns die Straßburger Gemeinde einen neuen Arzt, ein junges Grünschnabele namens Schlomo ben Jacob, genannt Gutlieb. Weißt, Clara, am liebsten würd ich bei deinem Heinrich bleiben. Aber du kennst ja meine Deborah …»
Clara zuckte nur die Schultern. «Da misch ich mich nicht ein. Das Geld kannst du Heinrich übrigens heut Abend selbst geben. Er soll doch nach eurem Ofen schauen.»
«Ich dacht eigentlich eher an euren Benedikt, das gute Jungele – ich will doch deinen Mann nicht belästigen – nur weil der Schabbes beginnt …» Vor Verlegenheit war Moische ins Stottern geraten.
«Benedikt hat keine Zeit», sagte sie schärfer als beabsichtigt. «Alsdann – ich muss weiter. Einen schönen Tag noch.»
«Dir auch, Clara, dir auch. Und Friede sei mit dir und den Deinen.»
Jetzt tat es ihr leid, dass sie dem alten Moische so über den Mund gefahren war. Eigentlich hatte sie nichts gegen die Grünbaums – von der selbstgefälligen, hochnäsigen Deborah einmal abgesehen. Der alte Moische ben Chajm war ein durch und durch sanftmütiger Mensch, seine beiden älteren Söhne höflich und sehr klug. Aaron arbeitete als Schulmeister und Schreiber in der Synagoge, der sechzehnjährige Jochai studierte in der Talmudschule zu Speyer, einer der drei heiligen jüdischen Gemeinden, um später Rabbiner zu werden. Nein, eigentlich hatte sie überhaupt nichts gegen die Hebräer, solange sie ihren seltsamen Gebräuchen in den eigenen vier Wänden nachgingen.
Hier in Freiburg, wie allerorten entlang des Rheins, lebten sie friedlich mit den übrigen Bürgern zusammen, als unauffällige, freundliche und sehr reinliche Nachbarn, die dieselbe Sprache sprachen, wenngleich ihr Jüdischdeutsch manchmal etwas seltsam klang und in diesen verschnörkelten Buchstaben geschrieben wurde. Man begegnete ihnen auf dem Markt, am Brunnen oder ab und an beim Spaziergang im Stadtgraben; die Männer durften ihre Tracht selbst wählen und mussten sich nicht, wie anderswo, gelbe Ringe auf den Mantel nähen lassen und gelbe Spitzhüte tragen oder gar des Freitags die Türen und Fenster ihrer Häuser geschlossen halten. Lediglich einmal im Jahr, von Karfreitag bis Ostern, dem höchsten Fest der Christenheit, durften sie die Gassen nicht betreten.
Gut ein Dutzend Familien mitsamt ihren jüdischen Dienstboten wohnte hier in der Webergasse, gleich hinter ihrem Haus, sowie in der benachbarten Tromlosengasse. Dort befand sich auch ihr Gemeinde- und Gotteshaus, Synagoge oder Schul genannt. Es war eine eigene, fremdartige Welt, an dessen Rande Clara mit ihrer Familie lebte. Zwar war das jüdische Viertel nicht, wie in manch anderen Städten, ummauert, aber man hatte ein eigenes Backhaus, einen eigenen Schlachter, Schächter genannt, eine Elementarschule und eine eigene Badestätte. Das war eine Art Tauchbad, tief drunten in einem Schacht.
Die Hebräer genossen den persönlichen Schutz der Grafen von Freiburg oben auf der Burghalde und durften sogar Haus und Weinberg besitzen. Doch trotz dieses äußerlichen Friedens waren sie bei einem Teil der Bürgerschaft nicht sonderlich beliebt. Da sie nämlich keinem gewöhnlichen Gewerbe nachgehen durften, von Ämtern und Handwerk ausgeschlossen waren, hatten sich die meisten auf Geldgeschäfte spezialisiert. Und Clara wollte gar nicht wissen, wer alles von den Bürgern bei ihnen verschuldet war.
Letzten Endes kümmerte sie das keinen Deut, schließlich konnten die Juden nichts für diese althergebrachten Gesetze. Nur: Musste ausgerechnet ihr eigener Mann sich ihnen als Schabbesgoi andienen, als der freundliche nichtjüdische Nachbar, der am Schabbat den Juden das Essen aufwärmte und den Ofen nachfeuerte? Vor allem aber beunruhigte sie, dass die junge Esther, mit der ihr Ältester aufgewachsen war und auf der Gasse gespielt hatte, von Tag zu Tag schöner wurde. Clara würde mehr denn je ein Auge auf Benedikt haben müssen – wenn es denn schon die Grünbaums ganz offensichtlich nicht für nötig hielten. Denn eine Liebesverbindung zwischen Christen und Juden war bei Strafe der Exkommunizierung verboten.
Auf Höhe der Metzgerlauben kreuzte der Karrenbäcker mit seinem rauchenden Öfchen auf dem Handwagen ihren Weg. Der verführerische Duft frischer Spitzwecken stieg ihr in die Nase. Sie beschloss, sich und den Kindern etwas Gutes zu tun, und kramte eine Münze aus ihrer Geldkatze.
«Vier von den hellen, Karrenbeck.»
«Hat dir dein Alter wohl nichts vom Morgenessen gelassen?» Der Mann grinste und reichte ihr vier besonders große Wecken. «Sag, Clara, könnt heut noch einer von euch nach meiner alten Mutter sehen? Ihr ist wieder die Hex’ ins Kreuz gefahren.»
«Ja freilich, aber erst gegen Abend. Sie soll keinesfalls aufstehen, am besten die Beine hochlegen.»
«Sag ich ihr. Dabei hat die Arme eben erst ihren Winterkatarrh hinter sich. Na ja, wenn’s nur das ist – jetzt grad hustet und rotzt ja die halbe Stadt.» Er hielt Clara am Arm fest. «Hast du schon von dem Totenschiff von Sizilien gehört?»
Sie schüttelte unwillig den Kopf.
«Da soll eine Galeere im Hafen eingelaufen sein, nur mit Toten und Sterbenden zwischen den Ruderbänken. Alle voll eitriger, ekliger Beulen und schwarzer Flecken! Und wer noch nicht hinüber war, der hat gebrüllt vor Schmerz. Du bist doch die Frau vom Wundarzt – was kann das für eine Krankheit sein?»
«Wer erzählt so was?»
«Ich hab’s von Meisterin Margarete, der Siechenmutter im Spital.»
«Affengeschwätz!» Sie machte eine abwehrende Handbewegung. Immer wieder hörte man von tödlichen Pestilenzen in fernen Ländern, und die Leute schienen sich regelrecht zu ergötzen an dem Grauen.
«Außerdem ist dieses Sizilien weit weg von uns», fügte sie hinzu, ohne es selbst genau zu wissen. Jetzt bereute sie, bei dem schwatzhaften Karrenbäcker angehalten zu haben. Erst im letzten Sommer hatte er auf dem Markt verbreitet, dass es in einem Land namens China giftige Würmer und Eidechsen gehagelt habe und dass hernach Feuerbälle groß wie Menschenköpfe vom Himmel gefallen seien. Wer nicht gleich tot umfiel, habe tagelang Blut gespuckt, unter qualvollen Krämpfen. Und durch den Gestank der Leichen sei das gesamte Land mit giftigen Dämpfen überzogen worden. Sie hatte bislang immer die Ohren vor diesen Geschichten verschlossen, doch mit Benedikts Traum heute Morgen fühlte auch sie plötzlich so etwas wie Angst in sich aufsteigen.
Sie starrte auf die knusprigen Spitzwecken in ihrem Korb. Der Appetit war ihr jedenfalls gründlich vergangen.
Kapitel 2
Das Angelusläuten vom Hauptturm der Pfarrkirche Unserer Lieben Frau verkündete den Feierabend. Im letzten Tageslicht, das durch das offene Tor der Werkstatt drang, prüfte Benedikt noch einmal das Stück, das er heute, gerade noch rechtzeitig, fertiggestellt hatte. Mit dem Frosteinbruch nämlich würde die Arbeit auf der Baustelle ruhen, mindestens bis zum Lenzmonat, und viele der auswärtigen Handwerker würden nun zu ihren Familien heimkehren und sich dort ihr Brot verdienen.
Fast zärtlich strichen seine Finger über den kühlen Stein und zeichneten die geschwungenen Linien der eichenlaubförmigen Blattknospe nach. Jetzt musste nur noch ein Loch für den eisernen Bolzen in die Stoßfläche geschlagen werden, dann konnte das Stück in die Helmkante des Turms eingefügt werden.
Schon etliche dieser Krabben, die nun Portale, Gesimse und Kapitelle zierten, hatte er aus dem roten Sandstein gehauen. Dazu Maßwerk für die Spitzbogenfenster, Kreuzblumen und andere Schmuckelemente für die Erneuerung der Seitentürme, die den Chor der Pfarrkirche flankierten. Die beiden Türme sollten der Schönheit des Hauptturms angeglichen werden, der im Jahr von Benedikts Geburt zum Abschluss gebracht worden war, nach den Plänen des Erwin von Steinbach, dem Baumeister der berühmten Straßburger Kirche.
Benedikt war mit dabei gewesen, als man begonnen hatte, die uralten Chortürme aufzustocken. Als Hüttendiener, wie man hier den Lehrknaben nannte, hatte er einst den Staub gekehrt und Handlangerdienste geleistet. Hatte später dann die rohen Blöcke, die auf Ochsenkarren hergeschleppt wurden, mit der Spitzhacke grob zurechtgehauen oder mit dem Hundezahn die Bossen abgearbeitet. Bis man ihn endlich eigenständig die Werksteine bearbeiten ließ, zunächst als einfacher Steinmetz für Bauquader und Profilsteine, später dann als Laubwerkmacher.
Noch waren die beiden Seitentürme hinter Gerüsten, Leitern und Seilzügen verborgen, doch Benedikt schlug jetzt schon das Herz bei dem Gedanken an den Augenblick, wo sie sich als würdige Begleiter des wohl schönsten und bislang höchsten Kirchturms auf Erden offenbaren würden. Schwerelos und kühn ragte der Hauptturm, ein Wunder der Baukunst, über dem Eingangsportal himmelwärts. Sein Helm, diese einzigartig feingliedrige, vielfältig durchbrochene Pyramide aus Rippen und Maßwerk, ganz ohne Gewölbe und Innenverstrebung, schien sich vollends von der Erde loszulösen.
In ein, zwei Jahren würde das Gerüst an den Chortürmen als auch im Innern des Langhauses, wo man gerade die Lichtgadenfenster farbig verglaste, abgebaut werden. Dann würde das Gotteshaus, das bereits jetzt von manchen Bürgern Münster genannt wurde, in seiner ganzen Herrlichkeit vollendet sein – vergleichbar nur noch dem in Straßburg, das gleicherweise in jener verwegenen, neuartigen französischen Baukunst der Spitzbögen und Strebewerke errichtet war. Scheinbar schwerelos wagten sich Turm und Gewölbe in eine bis dahin unvorstellbare Höhe und waren durch ihre Bögen und Pfeiler doch fest im Boden verankert. Auch im Kircheninneren strebte alles himmelwärts: die Pfeiler und Säulenbündel, die Spitzbögen und kostbaren farbigen Fenster, die wie Edelsteine funkelten und das irdische Licht in himmlisches verwandelten.
Benedikt erfüllte eine Art demutsvoller Stolz darüber, dass er seinen Teil beitrug zu diesem Kirchenbau. Und dennoch brannte in ihm eine Sehnsucht, die bislang unerfüllt geblieben war. Einmal nur wollte er für dieses Freiburger Gotteshaus eine Skulptur schaffen. Etwas so Erhabenes wie die Mutter Maria am Pfeiler des Hauptportals, die liebevoll und mit geheimnisvollem Lächeln das Jesuskind in ihrem Arm betrachtete. Oder etwas so Geheimnisvolles wie die Wasserspeier, diese wundersamen Phantasiewesen halb Mensch, halb Vieh. Da gab es angsteinflößende Dämonen, gestaltgewordene Albträume, aber auch freche Wesen, wie etwa den Nasentrompeter oder die doppelköpfige Figur, die ihren nackten Hintern in die Luft streckte – eine Rache der Steinmetze, als sie einstmals monatelang keinen Lohn bekommen hatten.
So wahrhaftig und voller Leben, wie diese Skulpturen waren, würde auch er gestalten wollen. Doch dazu musste er erst Meister werden. Musste sich in den Entwurfstechniken vervollkommnen, den Goldenen Schnitt beherrschen mit seinen mathematischen Erscheinungen, dazu all die magisch zu nennenden Formeln zur Berechnung von Mauerdicke und Winkeln. All das lag ihm indessen weit weniger als das Gestalterische.
Mit einem wehmütigen Lächeln sammelte er sein Werkzeug ein, rieb es mit einem Lappen sorgfältig ab und verstaute es ordentlich in seiner Kiste. Währenddessen schweiften seine Gedanken ab zu Esther. Warum nur hatte sich seine Mutter heute Morgen erneut in seine Angelegenheiten eingemischt? Hatte Vater nicht ihn beauftragt, zu den Grünbaums zu gehen? Endlich hätte sich wieder einmal die Gelegenheit geboten, Esther zu sehen, vielleicht sogar ein paar Worte mit ihr zu wechseln. Aber nein – seine Mutter hatte ihn behandelt wie einen Schulknaben. Benedikt spürte, wie der Zorn, der ihm schon den ganzen Morgen verdorben und sogar diesen bedrohlichen Albtraum in Vergessenheit hatte geraten lassen, wieder in ihm aufflammte.
Als er sich umdrehte und die Werkstatt verlassen wollte, stand Meister Johannes vor ihm.
«In der Portalhalle ist eine der Figuren schadhaft. Ich möchte, dass du dir das im Frühjahr gleich als Erstes vornimmst. – Ich weiß, du kannst das», fügte er hinzu.
Benedikt errötete vor Freude und Verlegenheit. Er durfte sich tatsächlich als Bildhauer beweisen, dazu noch an einer der wertvollen Skulpturen des Kirchenportals! Augenblicklich war der Groll gegen seine Mutter verflogen.
«Morgen nach dem Gottesdienst wird dir der Parlier alles Weitere erklären.»
«Danke», stotterte Benedikt nur.
Er bewunderte Meister Johannes von Gmünd, der jener weitberühmten Baumeisterfamilie der Parler entstammte. Vor etlichen Jahren hatte man ihn geholt, damit er die alten Seitentürme erneuere und den Chor um eine Kapelle erweitere, und schon bald darauf hatte er Benedikt zu dessen unsagbarem Glück in die Lehre genommen. Den Moment, als der Meister ihn vier Jahre später feierlich in den Gesellenstand erhoben hatte, würde Benedikt nie vergessen. Vor dem Kirchenportal, in Anwesenheit aller Werkleute, hatte er sich mit dem Schwur auf die Hüttenordnung dazu verpflichtet, die Geheimnisse der Bräuche und der Baukunst stets zu wahren. Hatte sein Steinmetzzeichen erhalten und war damit in der Bruderschaft aufgenommen, jener stolzen, freien Handwerkerschaft der Steinmetze, die sogar ihre eigene Gerichtsbarkeit hatte.
Mit der Ledigsprechung war Benedikt auch das geheime Zureiseritual gelehrt worden, mit dem er sich auf allen Hütten, selbst in den Nachbarlanden, als zugehörig ausweisen konnte. Ihm war nun freigestellt, ob er wandern oder aber in seiner angestammten Hütte um Arbeit ersuchen wollte. Obschon ihm der Abschied von seiner Heimatstadt unsagbar schwergefallen war, hatte er sich für etliche Monate an die Straßburger Hütte verpflichtet und dort unschätzbare Einblicke in die Baukunst erhalten. Inzwischen konnte er sogar mit Zirkel und Winkel umgehen, vermochte damit Werkpläne auf den Reißboden zu übertragen, so sicher und akkurat, dass er in diesem Herbst zum Meisterknecht aufgestiegen war. Seinem Traum, als Steinbildhauer zu arbeiten, stand nun nicht mehr allzu viel im Wege.
Benedikt verließ die Werkstatt, diesen langgestreckten Holzbau, an dessen Südseite sich Fensteröffnung an Fensteröffnung reihte, um möglichst viel Licht hereinzulassen. Es dunkelte bereits. Morgen früh würden sie alle gemeinsam dem Herrgott danken, dass wieder ein Jahr ohne tödliche Unfälle vergangen war, und anschließend die Baustelle winterfest machen.
Obgleich es schneidend kalt war, durchquerte er ohne Eile den Werkplatz. Hinter dem Schlafhaus der Gesellen kam ihm der Parlier entgegen, vermummt bis auf Augen und Nasenspitze, und winkte ihn heran. «Ich nehm an, du machst dich mit unserm alten Daniel wieder an die Winterarbeit?»
Benedikt nickte. «Ja. So ist’s mit dem Meister abgemacht.»
Er und Daniel waren die einzigen aus dem guten Dutzend Steinmetze, die hier in der Stadt ansässig waren. So würden sie nun schon den dritten Winter die Aufsicht über die Steinvorfertigung für das Frühjahr übernehmen und auch selbst mit Hand anlegen, wenn es um die Rohlinge für feines Maßwerk ging. Dies alles aus freien Stücken, auch wenn es ein reichlich stumpfsinniges Tun war. Doch mit dem alten Gesellen, einem ruhigen, gutmütigen Menschen, den Benedikt sehr mochte, ließ es sich gut arbeiten, und der Winter ging so wesentlich rascher vorbei.
«Gebt bloß mit dem Ofen in der Werkstatt acht», mahnte der Parlier. «Es wäre nicht das erste Mal, dass eine Hüttenwerkstatt in Flammen aufgeht. Übrigens – habe gehört, dass dich der Meister an die Portalhalle lässt. Nun, ich denke, da wirst du dich beweisen können.»
«Ich werde alles daransetzen, dass der Meister mit mir zufrieden ist. Welche Figur ist es denn?»
«Die Synagoge. Die hat wohl einen rechten Hieb abgekriegt. Wir müssen den linken Arm erneuern, den mit dem Buch, und am Gesicht ist auch was abgeschlagen.»
Benedikt war zusammengezuckt. Ausgerechnet die Synagoge! Diese Figur sollte dem Betrachter verdeutlichen, wie unterlegen das Judentum der christlichen Ecclesia war. In der Rechten hielt die junge Frauengestalt einen gebrochenen Stab, von ihrer Linken hingen die Gesetzestafeln kraftlos herab, wie auch ihre ganze Körperhaltung schwach wirkte. Zudem waren ihr die Augen verbunden zum Zeichen der Blindheit gegenüber dem Erscheinen des Messias.
Für einen Augenblick war Benedikt versucht zu glauben, dass man ihn mit dieser Aufgabe schmähen wollte. Schließlich hatte man ihm schon als Kind auf der Gasse «Judenfreund» hinterhergebrüllt. Dann aber schalt er sich einen Narren. Meister Johannes war alles andre als ein Feind der Hebräer. Schließlich ließ er sich regelmäßig von Grünbaums Nachbarn Noah Liebekind das Eisen für seine Werkzeuge aus Straßburg mitbringen.
Der Parlier schlug ihm auf die Schulter. «Kannst dich ja in den nächsten Wochen schon ein bissel üben in der Bildhauerkunst.»
Benedikt nickte. Mit einem Mal wusste er, was er außer Steine vorfertigen den Winter über tun würde.
«Willst du mir etwa einreden, dass du als Meisterknecht von früh bis spät Steine klopfen musst?» Heinrich Grathwohl wurde ärgerlich. «Soll vielleicht Johanna das Brennholz hacken? Die Tür zum Hühnerstall hättest auch längst in Ordnung bringen sollen. Heut früh lag der halbe Stall voll Schnee. Und der Seilzug oben am Dach klemmt noch immer.»
«Ich kann doch das Holz machen.» Michel nahm der kleinen Kathrin den Löffel aus der Hand und kratzte den letzten Rest Milchbrei aus der Schüssel. «Bin grad so stark wie der Benedikt.»
Kathrin begann zu heulen, und Clara nahm sie auf den Arm. «Unsinn, Michel. Du sollst das Abc üben. Nächste Woche fängt die Schule wieder an. Und jetzt gib Kathrin den Löffel zurück.»
Der Junge legte den Kopf schief und sah seinen älteren Bruder herausfordernd an. «Dann will ich mit dir Schreiben üben. Du hast’s versprochen.»
«Siehst du?», wandte sich Heinrich an Clara. «Nicht mal gegenüber den eigenen Geschwistern hält er seine Versprechen ein.»
Benedikt biss sich auf die Lippe.
«Also, was soll ich nun?», fragte er schließlich trotzig. «Holzhacken oder Schulmeister spielen?»
«Erst das eine, dann das andre.» Heinrichs Stimme hatte nun diesen Tonfall, der keine Widerrede duldete. Er erhob sich. «Du solltest dir ein Beispiel an deiner Schwester nehmen. Johanna nimmt ihre Pflichten sehr viel ernster. Um die beiden Kleinen kümmert sie sich wie eine Mutter, und das neben der ganzen Haus- und Gartenarbeit.»
«Die ist ja auch nur ein Mädchen», kicherte Michel und erntete dafür von seiner älteren Schwester umgehend eine Kopfnuss. Ohne ein weiteres Wort zog Benedikt Handschuhe und Gugel über und verließ die Küche. Kurz darauf hörte man vom Hof her schnelle, kraftvolle Schläge.
Heinrich nahm seinen Umhang vom Haken.
«Ich muss nach dem alten Klingenschleifer sehen, er ist von der Bühne gestürzt. Und die Steirer Elsbeth will zur Ader gelassen werden. Die ist schon wieder verstopft. Begleitest du mich?», fragte er Clara. «Zuvor muss ich allerdings noch bei Behaimer vorbei, den neuen Aderlasskalender holen.»
Clara verzog das Gesicht. Sie konnte den Stadtphysicus nicht leiden. Bevor sie antwortete, bestürmte Michel seinen Vater: «Bitte, bitte, nimm mich mit! Du hast gesagt, wenn keine Schulstunden sind, darf ich mitkommen.»
Heinrichs grimmige Miene wurde sofort weich. «Ein andermal, mein Junge. Draußen stürmt und schneit es. Außerdem: Wer Wundarzt werden will, muss mühelos lesen und schreiben können.»
Clara drückte ihrer Ältesten Kathrin in den Arm und holte Kopftuch und Umhang. «Wenn du mich den Aderlass allein machen lässt und mir nicht fortwährend dreinredest, komm ich gern mit.»
«Ich versteh nicht, warum du immer so ungehalten bist mit Benedikt», sagte Clara, als sie hinaus in das Schneetreiben traten. «Dich bringt doch sonst nichts aus der Ruhe.»
«Er könnte wenigstens seinen Bruder beim Lernen unterstützen. Wofür habe ich ihn ein Jahr länger in die Knabenschule geschickt?»
Er schnaubte, und Clara unterdrückte ein Lachen. «Doch wohl, weil er in deine Fußstapfen treten sollte! Ich finde, du bist reichlich undankbar, lieber Mann. Als Meisterknecht hat Benedikt ein höheres Auskommen als jeder Geselle, und er gibt bis auf ein kleines Sackgeld jeden Pfennig ab.»
«Trotzdem. Jetzt in den Winterwochen könnte er uns hier im Haus zur Hand gehen. Ich frag mich, was er den ganzen Tag in der Werkstatt zu schaffen hat.»
«Du bist noch immer nicht drüber hinweg, dass der Junge kein Wundarzt werden wollte.»
«Wie sollte ich? Er hat geschicktere Hände als ich, die beste Grundlage für diesen Beruf. Stattdessen haut er damit Steine zurecht. Außerdem geht es um die Familienehre. Mein Großvater, der noch der Sohn eines armen Badknechts war, hat sich nicht nur die Gerechtigkeit für eine Badstube, sondern auch für die Kunst der Wundarzney teuer erkauft. Durch sein und meines Vaters Geschick haben wir uns den Übernamen Grathwohl verdient. Wie soll ich es da verwinden, wenn mein Ältester diese Tradition durchbricht?»
«Du vergisst, dass Michel dir nachfolgen will.»
«Der Junge ist erst acht. Und er besitzt nicht annähernd dieselbe Fingerfertigkeit wie sein Bruder.»
Sie hatten den Gewerbebach in der Schneckenvorstadt erreicht, wo Marx, der alte Klingenschleifer, seine Werkstatt betrieb. Kaum eine Stunde später hatten sie ihm einen Sud aus Weidenrinde und Mohn gegen die Schmerzen verabreicht, den gebrochenen Unterarm gerichtet und mit einem festen Verband gestützt. Im Gegenzug bekamen sie von Marxens Frau heißen Würzwein kredenzt. Nur unwillig machten sie sich danach auf den Weg zu Filibertus Behaimer, der das Haus Zum Roten Reh am Fischmarkt ganz für sich allein bewohnte. Der Stadtphysicus war ehe- und kinderlos, doch man munkelte, dass er gerne wohlfeile junge Weibsbilder empfing. Dabei war das weibliche Geschlecht für ihn nichts anderes als ein Fehlgriff des Herrgotts, gerade gut genug, um den Weiterbestand der Menschheit zu sichern oder eben dem Manne Erleichterung zu verschaffen. Zumindest Clara gegenüber pflegte er solcherlei Bemerkungen höchst gerne von sich zu geben.
Wie üblich, mussten sie mehrfach klopfen, bis der Knecht öffnete und sie in der Eingangshalle geraume Zeit warten ließ, ohne sie in eine der warmen Stuben zu bitten. Clara bereute schon, dass sie mitgekommen war.
Als der Hausherr endlich erschien, warf er Clara einen spöttischen Blick zu. Sein Aufzug – Morgenmantel und nackte Füße in feuerroten Filzpantoffeln – verriet, dass er zu dieser späten Stunde noch keinen Fuß vor die Haustür gesetzt hatte. Behaimer war klein und fast schon fett zu nennen. Mit seinem runden, nur von einem schmalen grauen Haarkranz umgebenen Schädel, der ohne Hals aus den Schultern zu wachsen schien, und dem bartlosen, breiten Gesicht, dessen Wangenfleisch schlaff nach unten zu einem ebenfalls kugelrunden Kinn sank, erinnerte er Clara immer an einen dieser Wasserspeier an der Pfarrkirche. Außerdem hatte er einige seltsame Angewohnheiten. So etwa schüttelte er, wenn er seinem Gegenüber zuhörte, sofern er das überhaupt länger als drei Atemzüge lang tat, ohne zu unterbrechen, immerfort den Kopf. Gleichsam als ob er das Gesagte von vornherein verneinen wollte.
«Also, mein braver Chirurgus – was gibt’s?» In Behaimers Mundwinkeln hingen Reste von gebratenem Ei.
«Der neue Aderlasskalender.»
«Reichlich spät kommst du, reichlich spät. Du weißt, dass du ohne das neue Kalendarium nicht zur Ader lassen darfst. Die livores venena können nur dann dem Körper vollständig entzogen werden, wenn der Zeitpunkt präzis getroffen ist.»
«Vor drei Tagen hattet Ihr ihn noch nicht fertig», erwiderte Heinrich ungerührt.
«So?» Behaimer hielt mit dem Kopfschütteln inne. «Wie dem auch sei – ich brauche dich morgen auf dem Schloss. Der alte Graf leidet an einem Abszessus an seinem gräflichen Hinterteil. Halt dich also bereit.»
Er verschwand hinter einer der Türen und kam mit einer Papierrolle zurück.
«Hier. Studier sie gut, die neuen Vorgaben.»
Mit einem Kopfnicken nahm Heinrich die Rolle entgegen und steckte sie in sein Lederetui. Clara wusste, dass Behaimer, der mit den artes liberales auch die Astrologie studiert hatte, großen Wert darauf legte, alljährlich die Mondphasen und den Lauf der Gestirne neu zu berechnen. Diese Berechnungen hatte Heinrich dann umgehend auf seine Tafel mit dem Aderlassmännchen zu übertragen, die zu Hause in der Wohnstube hing und nach der sich Bader und Wundärzte zu richten hatten. Für jede Krankheit gab es die richtige Ader, jeder Körperteil war einem Tierkreiszeichen zugeordnet, und so schrieb der astrologische Kalender die günstigsten oder ungünstigsten Zeitpunkte beim Venenschlagen vor. Heinrich allerdings gab keinen Pfifferling auf die «hochwissenschaftlichen» Berechnungen seines Vorgesetzten, sondern verließ sich lieber auf seinen eigenen Verstand und Erfahrungsschatz.
Clara bemerkte, wie Behaimer sie durchdringend musterte.
«Du begleitest also deinen Mann wieder mal bei den Krankenbesuchen?»
«Spricht was dagegen?», gab sie schnippisch zurück.
«Nun – ich meine, eine anständige Frau sollte bei ihrer Haushaltung bleiben.»
«Das lasst nur meine Sache sein.»
«Da geht es um mehr. Heinrich hat einen guten Ruf als Chirurgus.» Sein Schädel begann wieder zu pendeln. «Einen sehr guten. Gerade als Arzt indessen ist so eine Reputation eine äußerst fragile Sache.» Sein Blick wurde strenger. «Zwei, drei Behandlungsfehler – ein Verletzter, der krepiert, ein tödlicher Wundbrand –, und Heinrichs Ruf ist ruiniert. Und das nur, weil du deinem Mann oder gar mir in die Kur pfuschst. Auch auf dem Feld der Laienmedizin sollte sich nicht jeder tummeln dürfen.»
«Statt meine Frau zu schmähen», sagte Heinrich ruhig, «könntet Ihr lieber all diesen Winkel- und Stümperärzten auf die Finger sehen, die an den Markttagen in die Stadt strömen. Jeder Quacksalber, jeder fahrende Schwachkopf kriegt doch seine Lizenz, wenn es nur das Stadtkässlein füllt.»
«Ich warne dich, Heinrich. Gib acht, was du sagst. Sonst bist du längstens geschworener Wundarzt gewesen.»
Nur mit Mühe konnte Clara ihren Zorn unterdrücken, und sie war froh, dass Heinrich sie beim Arm nahm und nach einem knappen Gruß mit ihr das Haus verließ.
«Dieser Pissprophet, dieser Maularzt!», stieß sie hervor, als sie sich auf den Weg in die Hintere Wolfshöhle machten. «Außer Pulsmessung und Urinschau kann der doch rein gar nichts.»
«Dafür weiß er, was in den Büchern Galens und all dieser Astrologen steht. Das beeindruckt die hohen Herren weit mehr, als wenn er Eiterbeulen aufstechen würde.»
«Ich versteh nicht, wie du bei diesem Mannsbild immer so gleichmütig bleiben kannst. Das war doch eine blanke Drohung eben, das mit mir.»
Heinrich zuckte die Schultern. «Und wennschon – er weiß genau, dass er auf mich angewiesen ist. Diese Herren Doctores sind nur so gut wie der Wundarzt, der ihnen zur Hand geht.»
Nun, da sie die düstere Gasse am Fuße des Burgbergs erreichten, hatte wenigstens das Schneetreiben aufgehört. Heinrich blieb stehen und sah Clara an. Sein Blick war liebevoll und besorgt zugleich.
«Vielleicht ist es besser, wenn ich heute die Elsbeth zur Ader lasse. Du weißt ja, wie schwatzhaft die ist.»
«Nein, Heinrich! Jetzt erst recht.»
Wie ungewohnt still es in den Winterwochen war! Nur das Knirschen des festgefrorenen Schnees unter den Schuhen war zu hören, während Benedikt zwischen den verlassenen Stein- und Sandhaufen durch die Morgendämmerung schritt.
Vor vielen Jahrzehnten schon hatte man den Platz zwischen dem Chor der Pfarrkirche und den Häusern der Geistlichen mit Werkstätten, Häuschen und Schutzhütten überbaut, die zahllosen Menschen als Arbeits- und Lebensmittelpunkt dienten. Neben den Werkleuten der Steinmetzbruderschaft gab es da Maurer und Zimmerleute, Lastenträger und Mörtelmischer, Schmiede und Glaser, dazu Brotbäcker, Koch und Gesinde. Die Kirchenbauhütte bildete eine eigene Welt, in der nicht nur gearbeitet, sondern auch gegessen, geschlafen und gefeiert wurde. Jetzt lag diese Welt im Winterschlaf, die Kalkbrennöfen und Mörtelkästen waren verwaist, die Schmiedefeuer an der Kirchenmauer, wo sonst Werkzeuge, Beschläge und eiserne Verankerungen gefertigt wurden, erloschen.
Als Benedikt die Werkstatt betrat, hatte Daniel bereits ordentlich eingeheizt. Eine Handvoll Taglöhner scharten sich um ihn und nahmen seine Anweisungen entgegen. Bald hörte man nur noch die rhythmischen Schläge der Spitzeisen auf die rohen Quader und hin und wieder einen kräftigen Fluch, wenn ein Schlag danebenging.
Als Meisterknecht hätte Benedikt gar nicht selbst Hand anlegen müssen. Ihm oblag, die Taglöhner zu überwachen und hin und wieder zu prüfen, ob sie den Vorgaben gemäß arbeiteten. Doch den andern nur über die Schulter zu sehen lag Benedikt nicht. Genau wie Daniel bearbeitete er einen Rohling nach dem anderen.
Verstohlen blickte er auf den Stein neben seiner Werkzeugkiste. Es war ein im Ursprung annähernd würfelförmiges Stück, mit einer Kantenlänge von gut einer Spanne, dessen obere Fläche er bereits abgerundet hatte. Nach dem Feierabendläuten würden die Männer ihre Sachen aufräumen und heimgehen, sodass ihm dann noch eine Stunde bis zur Dunkelheit blieb, um ungestört an seinem Werk weiterzuarbeiten. Mit viel Phantasie ließ sich bereits jetzt der Umriss einer Büste erkennen, mit Kopf, Hals und Schultern. Vor seinem inneren Auge traten aus dem Sandstein die feinen Züge von Esthers Gesicht hervor. Er sah ihre leicht schräggestellten Augen unter den hohen Brauen, die schmale, lange Nase, darunter die geschwungenen Lippen, die, wenn sie zu lächeln begannen, ihre tiefblauen Augen zum Strahlen brachten und zwei kleine Grübchen in die Wangen zauberten – die linke ein wenig tiefer und runder als die rechte.
Als er vor zwei Wochen begonnen hatte, den Stein in Form zu hauen, war ihm mit einem Mal zu Bewusstsein gekommen, wie viel ihm Esther bedeutete. Oder anders ausgedrückt: dass sie ihm mehr war als nur die Freundin aus Kindertagen, mit der er durch die Gassen getobt war, Blindekuh, Plumpsack und Reifentreiben gespielt, Boote und Dämme gebaut hatte an den Bächlein der Stadt. Er erinnerte sich plötzlich an so viele vergessen gewähnte Bilder und Eindrücke.
So war sie von allen Gassenkindern die geschickteste im Kreiselschlagen, und ihr Kreisel, mit gelben und roten Blumen bemalt, war der schönste von allen. Wie stolz war er gewesen, wenn sie ihm als Einzigem diesen Kreisel überließ. Als er dann neun oder zehn Jahre alt gewesen war, hatten sie sich von den andern Kindern oft abgesondert und in den Gärten hinterm Haus gespielt. Dort erfanden sie sich Landschaften und fremde Länder, in denen sie mit ihren Tierfiguren furchterregende Abenteuer erlebten. Zu dieser Zeit ging Esther bei ihnen ein und aus, sie war ja noch ein kleines Mädchen mit fast schwarzen, glänzenden Zöpfen. Auch ihn selbst hieß man bei den Grünbaums jederzeit willkommen. Er kostete ihre koscheren Speisen, die nach unbekannten Gewürzen dufteten, ihre dünnen, ungesäuerten Brotfladen zur Pessachwoche, lernte ihre oft wundersamen Riten und Zeremonien kennen, ihre fröhlichen Lieder und ausgelassenen Tänze.
In jenen Tagen sahen die Erwachsenen noch keine Gefahr darin, wenn Esther und er zum Spiel zusammenfanden, hatten nichts dagegen einzuwenden, dass der Sohn des christlichen Wundarztes mit der zwei Jahre jüngeren Tochter des jüdischen Pfandleihers und Geldwechslers ein Herz und eine Seele war. Die Alten ahnten nicht, dass sie, die Kinder, längst heimliche Berührungen und kleine Zärtlichkeiten austauschten, die sich beim Fangen und Versteckspiel ergaben. Im Stillen nannte Benedikt jeden Tag, an dem sie nicht beieinander waren, einen verlorenen Tag.
Einmal – und bei dieser Erinnerung musste Benedikt so laut auflachen, dass Daniel ihn erschreckt ansah – hatte er vom Sohn des Karrenbecks erfahren, wie man Liebeszauber ausübte: einen Zauber, mit dem man die Angebetete auf immer an sich binden könne. Man müsse auf eine Haselnussrute nur die magischen Worte «pax + pix + abyra + synth + samasic» ritzen, dreimal der Begehrten damit auf den Kopf hauen, um sie in glühender Liebe entbrennen zu lassen! Schreiben hatte Benedikt damals längst gelernt, die Schwierigkeit lag eher darin, dass ein schlanker Haselstecken kaum Raum für so viele Buchstaben bot. So hatte er sich unten am Dreisamufer ein besonders kräftiges Exemplar gesucht, hatte stundenlang geritzt und geschnitten, bis er die Gelegenheit gekommen sah. Seine Mutter hatte ihn und Esther zum Eiersammeln in den Hühnerstall geschickt. Das Zauberwerkzeug hatte er neben dem Stall im Schuppen versteckt, und so bat er Esther, einen Augenblick zu warten, er habe eine Überraschung vorbereitet. Als er zurückkehrte und sie ihn erwartungsvoll anblickte, hatte er den Stecken hinter dem Rücken hervorgeholt und ihr damit drei Hiebe über den Kopf gezogen. Den entsetzten Blick aus ihren Augen würde er nie vergessen. Und auch nicht ihre klatschende Maulschelle, die ihm die Wange tiefrot anlaufen ließ. Danach hatte Esther wochenlang nicht mehr mit ihm gesprochen, und er war zu feige gewesen, ihr den Grund für seine Tat zu gestehen. Damals hatte er geglaubt, der Zauber sei nur deshalb missglückt, weil für die letzten drei Buchstaben kein Platz mehr gewesen war.
Ein andermal hatte er Esther überredet, nach einem heftigen Wolkenbruch mit ihm auf den Friedhof der Pfarrkirche zu gehen. Aus irgendeinem Grund hatte Benedikt ihren Mut auf die Probe stellen wollen, denn es dämmerte bereits an diesem kühlen Herbstabend, und mit der Nacht fanden sich Dämonen und Gespenster dort ein. Tagsüber war der Kirchacker durchaus ein Ort der Lebenden. Den Kindern war erlaubt, dort zu spielen, Handwerksgesellen trafen sich zu Versammlungen, Grempler boten ihren Kram an, Ziegen weideten zwischen den Grabstätten, und zu Festtagen wurden hier religiöse Schauspiele aufgeführt und hernach getanzt. Der ältere Teil des Friedhofs diente obendrein als Baustelle und Lagerstätte für den Kirchenneubau.
Das einzig Unheimliche zur hellen Stunde war der bucklige Totengräber, der auf dem Kirchhof seinen Verschlag hatte und der im Ruf stand, mit Geisterwesen umzugehen. Und dann war da noch das Beinhaus im Gewölbe der Andreaskapelle. Durch ein schmales Loch nahe am Boden konnte man die blanken Knochen und Schädel aus den alten Grablegen erkennen, allesamt sorgfältig aufeinandergeschichtet.
Zum Schutz gegen streunende Tiere war der neuere Teil des Friedhofs von einer mannshohen Bruchsteinmauer umgeben. Nächtliche Besucher indessen schien die Mauer nicht abhalten zu können. Jeder wusste, dass sich nach Einbruch der Dunkelheit zwielichtige Gestalten zu ebenso zwielichtigen Geschäften auf dem Friedhof trafen, Obdachlose ihr Lager aufschlugen, Dienstmägde zum heimlichen Stelldichein erschienen, Verschwörer und Verbrecher ihre finsteren Pläne schmiedeten. Und dazu kamen eben noch die Gespenster und Dämonen.
Auch Esther wusste von alledem, und ebenso wusste sie, dass Hebräer auf dem christlichen Gottesacker höchst ungern gesehen wurden.
«Hast du Angst?», hatte Benedikt sie gefragt, nachdem sie gezögert hatte.
«Nein.»
Das Tor war noch nicht verschlossen, als sie den Friedhof erreichten, und der volle Mond, der sich durch die Wolkenfetzen schob, tauchte die Gedenksteine in silbrigen Schein. Sie schlichen an der Kapelle vorbei zur Friedhofslinde, deren Zweige noch vom Regenguss glänzten, und lauschten auf verdächtige Geräusche. Benedikt spürte Esthers Schulter an seiner.
«Was ist das?», flüsterte sie. Jetzt hörte Benedikt es auch. Rundum schmatzte und seufzte es leise, es klang wie das unterdrückte Schluchzen eines Kindes. Plötzlich bekam er es selbst mit der Angst zu tun. Erst als er die Tropfen spürte, die aus dem nassen Geäst auf sie herabfielen, begriff er. «Das ist nur der Regen, den das Erdreich aufsaugt.»
Sein Blick schweifte über die Gräberfelder, und hie und da glaubte er etwas Weißliches schimmern zu sehen. Mit Schaudern erinnerte er sich daran, was sein Vater ihm einmal erklärt hatte. Da ein eigenes Grab nur den Vornehmen und Geistlichen zustehe, lege man in den Gruben Leichnam über Leichnam. Die Erdschicht darüber sei so dünn, dass hier und da eine Hand oder ein Fuß herausragen könnte. Nach heftigen Regenfällen würden dann die Schädel und Leichenteile schon einmal an die Oberfläche gespült.
«Lass uns wieder gehen», murmelte er. Plötzlich ertönte hinter ihrem Baum ein leises Knurren. Er fuhr herum. Keine zehn Schritte entfernt stand ein zotteliger Köter. Sein Blick funkelte, und zwischen seinen Lefzen hielt er – einen Totenschädel!
Esther unterdrückte einen Schrei. Im selben Moment ließ der Hund den Schädel fallen, senkte den Kopf und fuhr fort zu graben. Kleine und große Knochenstücke schleuderte er aus dem Erdreich unter sich, auch ein Kinderschädel war dabei, gerade so groß wie eine Faust.
Esther packte Benedikts Hand und zog ihn eilig in Richtung Tor. Doch das war nun mit einer Kette versperrt. Wehrhaft ragten seine Eisenspitzen in den nächtlichen Himmel.
«Wir müssen über die Mauer.» Benedikt faltete die Hände zu einer Räuberleiter. Er spürte ihren nackten, schmalen Fuß auf seinen Handflächen, roch für einen kurzen Moment ihren Duft nach frischer Milch und irgendwie auch nach Zimt, während sie sich dicht vor ihm auf die Mauerkrone schwang. Dann reichte sie ihm die Hand, und er zog sich hinauf.
«He! Lumpengesindel! Stehen geblieben!» Neben dem Ewigen Licht am Eingang zur Kapelle erschien der Bucklige.
Voller Schrecken klammerte sich Esther an Benedikt fest. Ihre Hand, die er immer noch in der seinen hielt, war eiskalt.
«Warte», flüsterte er. «Ich spring zuerst und fang dich dann auf.»
Geschickt ließ er sich auf der anderen Mauerseite zu Boden gleiten, rappelte sich auf und streckte ihr die Arme hin. Da fiel sie ihm auch schon entgegen, und beide stürzten unsanft auf die Erde.
Er half ihr wieder auf die Beine. «Hast du dir wehgetan?»
Sie schüttelte den Kopf. Dabei zeichnete sich auf ihrer Stirn eine blutige Schramme ab. Ihr Gesicht war so dicht vor seinem, dass er ihren Atem spürte. Ohne nachzudenken, küsste er sie auf den Mund, spürte für eine kleine Ewigkeit ihre weichen, warmen Lippen. Sie ließ es geschehen, und sein Herz pochte so heftig, dass sie es ganz gewiss hörte. Da begann das Friedhofstor in seinen Angeln zu quietschen. Sie ließen einander los und rannten auf dem kürzesten Weg nach Hause.
Dreizehn Jahre alt war er damals gewesen und hatte bald darauf seine Lehre begonnen. Damit und mit der ersten Beichte und Erstkommunion war seine Kindheit endgültig vorüber gewesen, jene unbeschwerte Zeit, wo sie sich zum Spielen und Schwatzen trafen. Über den Kuss hatten sie nie wieder gesprochen, und Benedikt ahnte, dass sich dieses süße Glück nicht wiederholen würde. All das war für immer vorbei.
Jetzt ließ er Eisen und Klöpfel sinken und starrte vor sich hin. Eigentlich gab es seitdem nur noch verlorene Tage für ihn. Einzig der Schabbat war ihm geblieben. Wenn Esther zu Mittag von der Synagoge kam, wo die Frauen die sogenannte Weiberschul besuchten und über Gucklöcher den Gottesdienst der Männer verfolgten, trachtete er danach, ihren Weg zu kreuzen. Oder er versuchte sein Glück am Nachmittag im Stadtgraben, wo die Bürger, Christen wie Juden, bei schönem Wetter durch das Grün der trockengelegten Gräben spazierten. Das Höchste war, mit ihr ein paar Worte zu wechseln, sofern sie allein ging. War sie in der Obhut ihrer Familie, musste er sich mit einem Blickwechsel, einem Lächeln begnügen.
Ihn durchfuhr ein wehmütiger Schmerz. All diese Erlebnisse aus Kindertagen gehörten endgültig der Vergangenheit an. An ihre Stelle war etwas Neues getreten, an dem er nicht mehr teilhaben durfte: Esther war eine junge Frau geworden. Plötzlich wusste er, dass er sie noch inniger liebte denn je.
Kapitel 3
Clara kehrte vom Einkauf zurück, durchgefroren und reichlich missgelaunt. Es war ein Freitag, der Tag, an dem Heinrich schon frühmorgens die Läden im Erdgeschoss öffnete und das Banner mit dem Becken herauszuhängen pflegte, zum Zeichen, dass er fürs Scheren und Balbieren bereit war. Einmal in der Woche ging er noch diesem Handwerk nach. Zu den Stammkunden, die dann sein Häuschen am Eingang der Webergasse aufsuchten, zählten etliche Ratsherren, die vor oder nach ihrer freitäglichen Sitzung hereinschneiten. Dank ihnen wusste Heinrich über die Belange der Stadt recht gut Bescheid. Zumeist waren es Handwerksmeister oder auch Zunftmeister der achtzehn Freiburger Zünfte, angesehene Bürger also, die auf ein Jahr in den Rat der Neuen Vierundzwanzig gewählt waren. Auch Behaimer gehörte seit Johanni letzten Jahres dazu, doch der zog es vor, sich von Meister Günther, dem Hofbarbier der Grafenfamilie, rasieren zu lassen. Das taten auch die meisten der Freiburger Patrizier, jene reichen Kaufherren, Ritter und Edelfreie, die fast ausnahmslos auf Lebenszeit zum Alten Rat gehörten und alle irgendwie miteinander verschwippt und verschwägert waren. Sie allerdings holten sich Meister Günther in ihre Trinkstube im Haus Zum Ritter, einem der prächtigsten Häuser der Stadt am Kirchhof. Ihre Eheweiber hatten dort keinen Zutritt, wohl aber hübsche junge Dinger, die ihnen den Schertag mit ihrer Offenherzigkeit versüßten.
Auch wenn Clara sich in ihrem Heim noch so wohlfühlte –