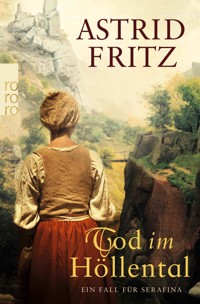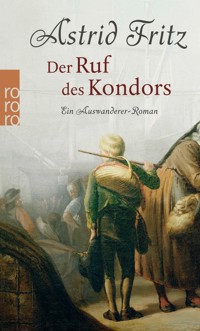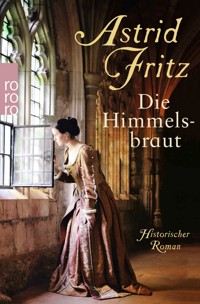9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das Leben an der Seite eines Räuberhauptmanns: dramatisch, romantisch und hochgefährlich Um 1800: Die achtzehnjährige Juliana zieht mit ihrem Vater und ihren Schwestern durch den Hunsrück. Eines Tages lernt sie den berühmtesten Räuberhauptmann der Gegend kennen. Der «Schinderhannes» umwirbt sie, liebt sie, nennt sie seine kleine Prinzessin und ist ihr sogar fast treu. Fortan streift sie mit ihm durch die Lande, bald heiraten sie. Doch kann das Glück an der Seite eines Räubers lange währen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Astrid Fritz
Die Räuberbraut
Historischer Roman
Über dieses Buch
Das Leben an der Seite eines Räuberhauptmanns:
dramatisch, romantisch und hochgefährlich
Um 1800: Die achtzehnjährige Juliana zieht mit ihrem Vater und ihren Schwestern durch den Hunsrück. Eines Tages lernt sie den berühmtesten Räuberhauptmann der Gegend kennen. Der «Schinderhannes» umwirbt sie, liebt sie, nennt sie seine kleine Prinzessin und ist ihr sogar fast treu. Fortan streift sie mit ihm durch die Lande, bald heiraten sie. Doch kann das Glück an der Seite eines Räubers lange währen?
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, August 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Umschlagabbildungen akg-images/Erich Lessing; Musée des Beaux-Arts, Valenciennes, France/Bridgeman Images; Lebrecht Music & Arts 2/Lebrecht; Stephen Mulcahey/Arcangel
ISBN 978-3-644-20010-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Zu Weyerbach bei Oberstein, Ende Mai 1844
Wieder einmal füllte sich die Schankstube zum Abend hin, bis jeder Platz besetzt war. Das milde, sonnige Wetter, das nun schon seit Ende April fortdauerte, bescherte Emil Fritsch einen steten Strom an Gästen, die auf dem Weg durchs Nahetal bei ihm das Mittagessen einnahmen oder des Abends zum Übernachten abstiegen. Erst recht, seitdem sich herumgesprochen hatte, dass hier die Witwe Blasius bediente, besser bekannt als die Braut des Schinderhannes. Da nahmen selbst die Vornehmeren unter den Reisenden hin, dass die Mahlzeiten eher fade als fett und schmackhaft daherkamen und die Schlafkammern mehr als einfach ausgestattet waren.
Trotz ihres stattlichen Alters von bald dreiundsechzig Jahren war Juliana Blasius noch immer eine rüstige, behände Person, die großen Wert auf reinliche Kleidung und Körperpflege legte. So hätte man bei ihr niemals schwarze Ränder unter den Fingernägeln entdeckt oder Flecken auf der Schürze. Das ergraute, noch immer dichte und wellige Haar wurde jeden Morgen sorgfältig gekämmt und hochgesteckt, außer Haus trug sie eine hübsche Haube, das bunte Band unter dem Kinn zu einer Schleife gebunden, und an Sonntagen legte sie sich ihre Smaragdkette um den Hals. Ihr schmales Gesicht war nahezu faltenlos, der Blick noch nicht vom Alter getrübt, und sie besaß fast noch all ihre Zähne. Nur unter ihren tiefgrünen Augen lagen zumeist dunkle Schatten.
Juliana sprach für gewöhnlich nicht viel. Im Dorf galt sie als eher wortkarg und ein wenig sonderbar. Aber waren die Gäste erst einmal versorgt, ließ sie sich gern ein Schnäpschen oder einen Becher süßen Rotweins spendieren, um sich dann an die Tische zu setzen und aus ihrer Jugendzeit an der Seite des legendären Räuberhauptmanns zu erzählen – der schönsten Zeit ihres Lebens, wie sie nicht müde wurde zu betonen.
«Wenn das so weitergeht mit dem Andrang», Emil reichte ihr vier gutgefüllte Henkelkrüge, «dann muss ich über dem Stall noch Schlafstuben einbauen lassen.»
Sie nickte. «Zuvor zahlst mir einen besseren Lohn aus. Zwanzig Kreuzer in der Woche mehr.»
«Du bist wohl nicht bei Trost! Sei froh, dass du bei mir arbeiten kannst. In deinem Alter findest nirgends nix mehr.»
«Ha! Drüben in Oberstein nehmen die mich mit Handkuss, da kommen noch viel mehr Reisende durch als in unserm armseligen Weyerbach. – Denk drüber nach, Emil. Ohne mich machst du auch kein Geschäft.»
Damit wandte sie dem jungen Wirt, dessen Vater sie schon gekannt hatte, den Rücken zu und brachte die Krüge zu dem vollbesetzten Tisch am Fenster.
«Wohl bekomm’s.»
«Die Runde geht an mich.» Der Dicke, seiner Kleidung nach ein Fuhrmann, lächelte sie erwartungsfroh an. «Und jetzt setzen Sie sich noch ein wenig zu uns, gute Frau, und erzählen Sie uns aus alten Zeiten.»
Er rutschte auf die Bank seines Sitznachbarn und klopfte auf den frei gewordenen Stuhl.
«Die Juliana redet nid mit trockener Kehle», grinste sein Nebensitzer, ein Korbflechter namens Herrmann. «Da musst schon noch mal was bestellen.»
«Alsdann, Frau Juliana – gönnen Sie sich einen guten Tropfen und schreiben’s auf meine Rechnung.»
Nachdem sie sich von Emil ein Krüglein seines teuren Selbstgebrannten hatte geben lassen, kehrte Juliana an den Tisch zurück. Nebenan, am kleinen Katzentisch bei der Tür, saß noch immer das junge Paar, das sich einen Teller Bratkartoffeln hatte bringen lassen und sogleich bezahlt hatte. Jetzt waren ihre Teller leer.
«Darf’s denn noch was sein?», fragte sie die beiden im Vorbeigehen.
Die junge Frau schüttelte den Kopf und wandte den Blick ab, während ihr Begleiter schützend den Arm um ihre Schulter legte.
«Danke, aber wir müssen noch nach Oberstein zurück.»
Schulterzuckend setzte sich Juliana zu den Männern zurück. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie das Paar miteinander flüsterte. Das Mädchen war dunkel wie Julianas Lieblingsschwester Margret in jungen Jahren, wenngleich um einiges zierlicher, und ebenso schön. Schon zuvor hatte sie sich bei der Arbeit von den beiden beobachtet gefühlt. Daran war sie zwar gewöhnt, indessen wurde sie in aller Regel von den Leuten binnen kurzem angesprochen. Diese zwei aber hatten bis auf die Bestellung kein einziges Wort mit ihr gewechselt.
«Nun, ihr Männer – was wollt ihr hören?», fragte sie in die Runde und nahm einen ersten tiefen Schluck. Der Branntwein rann warm ihre Kehle hinunter und gab ihr sofort ein wohliges Gefühl im Kopf und in der Magengegend.
Der dicke Fuhrmann rieb sich die Nase. «Wie war er denn so, dein Schinderhannes? Hat er dich gut behandelt, wo er doch so erbarmungslos gegen seine Opfer war?»
«Er war der beste Mann, den sich eine Frau wünschen kann.» Sie nahm einen zweiten und dritten Schluck. Damit kehrten die schönen Bilder zurück, die sie seit Jahrzehnten in ihrem Herzen bewahrte. Und die sie sich von niemandem würde nehmen lassen. «Er hatte mehr Achtung vor Frauen als die meisten von euch.»
Kaum hatte sie zu sprechen begonnen, spürte sie wieder die Blicke der jungen Frau. Juliana war nahe dran, das Paar zu sich an den Tisch zu bitten, doch etwas hielt sie zurück.
«Aber der Schinderhannes hatte Blut an den Händen», beharrte der Fuhrmann. «Wie erträgt man das tagein, tagaus als Weib?»
«Die Zeiten waren erbarmungslos nach den Franzosenkriegen. Der Schinderhannes hat die Armen und Wehrlosen immer geschont.»
Herrmann nickte ihr zu. «Erzähl mal die lustige Geschichte von der Bäuerin und ihrem Korb voll Eiern.»
Das tat Juliana nur allzu gerne. Allmählich kam sie in Fahrt, beantwortete bereitwillig die Fragen der Männer nach Raubzügen, nach Verstecken, nach Verfolgungen durch die Gendarmen. Nur auf eine Frage würde sie niemals Antwort geben: auf die Frage nach dem allzu jähen Ende ihrer großen Liebe.
Als sie erneut zum Nachbartisch blickte, war das junge Paar verschwunden.
Kapitel 1
(Zu Ostern im Jahre 1800)
«Kein Feuer, keine Kohle – kann brennen so heiß – als heimliche Liebe – von der niemand nichts weiß …», sangen die drei Schwestern lauthals, wobei Juliana wie immer im Ton etwas danebenlag.
«He, Hannikel!» Der Wirtssohn vom Wickenhof packte sie bei den Hüften und zog sie an sich. «Sag deinem Julchen, sie soll endlich ihr Maul halten und lieber mit mir tanzen!»
Juliana ließ ihre Fiedel sinken.
«Pfoten weg!»
Mit kräftigem Schwung trat sie dem Kerl auf den Fuß. Puterrot lief das Gesicht des Burschen an.
«Au! Du kleines Biest! Wart nur!»
Doch Juliana hatte sich längst seinem Griff entwunden und drehte ihm noch eine lange Nase, bevor sie sich sicherheitshalber in die Nähe ihres Vaters an den Nebentisch flüchtete. Johann Nikolaus Blasius, genannt Hannikel, warf ihr einen bösen Blick zu, während der halbe Tanzsaal schallend zu lachen begann. Noch lauter als zuvor setzte Juliana ihren Gesang fort: «Setze du mir einen Spiegel – ins Herze hinein – damit du kannst sehen – wie so treu ich es mein.»
Nach einer kurzen Atempause folgte ein derbes Trinklied, wobei die Gäste im Takt ihre Bierkrüge auf die Tischplatten krachen ließen, dann endlich gab der alte Pächter des Wickenhofs ihnen das Handzeichen, sich eine Pause zu gönnen. Sie verstauten Fiedeln und Tamburin in ihrem zerschlissenen Tragsack und gingen hinaus auf den Vorplatz.
Juliana streckte ihr Gesicht der Nachmittagssonne entgegen. Es war der erste milde Frühlingstag, den das heutige Osterfest ihnen beschert hatte, und aus den umliegenden Dörfern und Gehöften waren die Gäste nach dem Kirchgang in Scharen herbeigeströmt. Drinnen war es inzwischen brechend voll, wie immer, wenn es irgendwo etwas zu feiern gab, mit Tanz und ausgiebigem Besäufnis. Erst recht, wenn der Hannikel als Musikant und Bänkelsänger aufspielte, wurde er doch stets von zwei oder drei seiner Töchter begleitet.
Dass sie allesamt schmucke Mädchen darstellten, wurde ihnen immer wieder gesagt. Vor allem Margret, dunkel wie eine Welsche und nach Kathrin die zweitälteste der vier Blasius-Töchter, begeisterte die Mannsbilder in ihrer drallen Rundlichkeit und ihrer offenherzigen Art. Sich selbst fand Juliana nicht besonders hübsch, auch wenn ihr Vater ihr immer sagte, ihre allzu helle Haut schimmere wie Porzellan. Nase und Wangen waren mit Sommersprossen betupft, die in der warmen Jahreszeit deutlicher wurden. Und ihr langes, gewelltes Haar war von ärgerlichem Rotblond. Kathrin hingegen, die Älteste, hätte durchaus eine Schönheit sein können, würde sie nicht ewig diese sauertöpfische Miene vor sich hertragen und sich bewegen, als hätte sie die ganze Last der Welt zu schultern. Nun ja, dass sie nach nur knapp einjähriger Ehe mit dem alten Gemeindeförster von Sien schon wieder Witwe war, und das mit gerade einmal Mitte zwanzig, war kein schönes Los, aber es gab wahrhaftig Schlimmeres. Was Kathrin dabei wohl am allermeisten bedauerte, war, dass sie mit dem Tod des Försters auch das schöne Forsthaus hatte verlassen und nach Weyerbach zurückkehren müssen. Letzteres bedauerte allerdings auch Juliana, war doch Kathrin in ihrer Übellaunigkeit manchmal schier nicht zu ertragen.
Ein Stoß in die Seite ließ sie auffahren.
«Spinnst eigentlich, so pampig zu werden?» Die grauen Augen des Vaters blitzten sie zornig an. «Das is immerhin der Sohn vom Pächter, der mit dir tanzen wollt.»
«Stimmt.» Ihre Schwester Margret grinste breit. «Führst dich manchmal auf wie eine genierliche Jungfer aus feinem Hause.»
«Soll ich singen und Fiedel spielen oder mit den Kerlen herumpoussieren? Dann kann ich ja gleich als Dirne gehen», gab Juliana trotzig zurück und duckte sich unwillkürlich, als der Vater den Arm hob.
Doch er ließ die Hand wieder sinken und brummte nur noch unwillig vor sich hin, da die Magd ihm jetzt einen Krug Bier und eine Platte mit Bratwurstscheiben und Brot herausbrachte.
Eigentlich war ihr Vater ein stiller, verschlossener Mensch, regelrecht maulfaul sogar, indessen konnte er von jetzt auf gleich in Harnisch geraten. Die Schläge dieses kräftigen, untersetzten Mannes taten weh, das hatte Juliana mehr als einmal zu spüren bekommen. Einzig Marie, die Jüngste, verschonte er mit seinen Wutanfällen, war sie doch der auserkorene Liebling der Mutter.
«He, und was is mit uns?» Kathrin hielt die Magd, die sich bereits wieder abgewandt hatte, am Schürzenzipfel fest. «Kriegen wir etwa nix?»
«Die Wurst is für alle, und Bier könnt ihr euch gefälligst selber holen.»
«Da hört sich doch alles auf … Dumme Kuh!»
«Ich jedenfalls hab jetzt Durst.» Juliana nahm Margret beim Arm. «Komm!»
Zusammen eilten sie zurück in den Tanzsaal, der sich in einer umgebauten Scheune befand. Bis zum Ausschank war es ein rechter Spießrutenlauf durch die Menschenmenge und zwischen den vollbesetzten Bänken hindurch. Etliche Leute waren schon jetzt sturzbetrunken. Scherzhaft versperrte man ihnen den Weg, rief ihnen freche Komplimente zu, die eine oder andre Männerpratze landete an Hintern oder Busen. Juliana tat so, als bemerke sie es nicht. Sobald man nämlich einen von denen beachtete, wurde es nur noch schlimmer. Margret indessen, die vor ihr ging, wiegte sich kokett in der Hüfte, den Kopf stolz erhoben, ein Lächeln auf dem rosigen Gesicht. Dabei war ihr Blick stets in dieselbe Richtung gewandt. Dort am Tisch nahe dem Tanzboden saß ein schlanker, gutgewachsener junger Mann, den sie schon beim Musizieren immer wieder angelacht hatte.
Kein Wunder, befand Juliana. Bereits aus der Ferne wirkte er zwischen seinen grobschlächtigen Zechkumpanen wie ein edles Reitpferd unter Ackergäulen, was vor allem seiner aufrechten Haltung und seiner Kleidung geschuldet war, die nicht aus grobem Leinen wie bei seinen Tischgenossen, sondern aus feinem Tuch geschneidert war. Unter dem blauen zweireihigen Frack nach englischer Art, mit breitem, halboffenem Kragen und blitzblanken Knöpfen, trug er eine rote Weste, aus deren Ausschnitt sich ein schwarzes Seidenhalstuch mit roten Streifen bauschte. Schließlich war da noch der runde schwarze Hut, den vorn eine achteckige goldene Schnalle zierte. Was ihn indessen von einem bürgerlichen jungen Herrn unterschied, war seine Haartracht. Das dunkelbraune Haar war lang und nach hinten zu einem Zopf gekämmt. Dazu schmückte er sich wie ein Seemann oder Soldat mit kleinen goldenen Ohrringen.
Jetzt, wo sie näher kamen, lupfte er seinen Hut und grüßte mit unbefangenem Lächeln in ihre Richtung. Er war so um die zwanzig, in Margrets Alter also, und Juliana musste zugeben, dass er für ein Mannsbild ausnehmend gut aussah. Sein Gesicht war eher länglich – oder oval, wie die Franzosen sagten –, mit einer geraden, nicht zu großen Nase, vollen roten Lippen und gesunden Zähnen. Seine Augen waren von leuchtendem, tiefem Blau.
Viele hier kannte Juliana vom Sehen, ihn und seine Gefährten indessen nicht. Wer immer dieser Fremde sein mochte – ihre Schwester Margret schien hin und weg zu sein. Und das, wo sie daheim in Weyerbach ihren Joseph sitzen hatte, den Sohn des Dorfschmieds, der nur darauf wartete, endlich von Amts wegen seinen Heiratskonsens zu erhalten. Was Joseph nicht wusste, war, dass es Margret mit der Treue nicht allzu genau nahm.
Nachdem sie sich endlich bis zum Ausschank in der Scheune durchgekämpft hatten, zwickte Margret sie in die Seite: «Sag bloß – hätt dir denn der Jungwirt gar nid gefallen? Stell dir nur mal vor, der tät dich als Braut nehmen. So ’nen schönen Hof, wie der hat, mit Ausschank und Tanzsaal!»
«Bloß weil der mit mir tanzen wollt, will der mich noch lang nicht zur Frau. Außerdem, diesen Kamuffel tät ich eh nicht haben wollen.»
Margret lachte. «Bist halt gar zu wählerisch.»
«Was man von dir nid grad sagen kann», mischte sich Kathrin, die sie eingeholt hatte, missmutig ein. Den barfüßigen, schmutzigen Knaben, der beim Zapfen aushalf, herrschte sie an, er solle ihnen endlich drei Krüge Bier herüberschieben. «Aber blitzschnell und voll bis oben hin!»
Dann wandte sie sich an Juliana.
«Ich sag’s dir: Wenn’s wegen der Sach mit dem Jungwirt Ärger gibt, bist du dran.»
«Ach was.» Juliana nahm einen kräftigen Schluck. Das kühle Bier tat gut nach dem vielen Singen. «Bis heut Abend ist das eh vergessen.»
Noch vor wenigen Jahren hätte ihr die Drohung der Ältesten Angst gemacht, aber jetzt ließ sie sich nichts mehr sagen von ihr.
«Was ist?» Sie deutete auf Kathrins Bierkrug. «Willst nicht zum Vater zurück? Dann kannst mit ihm ungestört herziehen über mich und Margret. Ich bleib jedenfalls hier, bis wir weiterspielen.»
«Ich auch.» Margret kehrte ihnen den Rücken zu. Schnurstracks stolzierte sie auf den Tisch mit dem gutgekleideten Fremden zu, und Juliana folgte ihr. Prompt sprach der Bursche sie an.
«Ihr schönen Fräulein, setzt euch her zu uns, bis es mit der Musik weitergeht.» Er schenkte ihnen ein gewinnendes Lächeln.
«Warum sollten wir?», fragte Juliana schnippisch. «Woanders gibt’s auch nette Mannsbilder.»
«Sieh da! Auf den Mund gefallen bist du nicht.»
Margret warf ihr einen warnenden Blick zu. Was so viel heißen sollte wie: Der gehört mir! Dann setzte sie sich neben den Fremden, der bereitwillig zur Seite gerutscht war, auf die Bank. Mit großem Hallo wurde sie von den anderen am Tisch – dem Äußeren nach eher raubeinige Gesellen – begrüßt.
Keine allzu reizvolle Gesellschaft, befand Juliana. Doch um nichts in der Welt hätte sie sich jetzt von Margret wegschicken lassen. Sie war nämlich neugierig geworden auf den Kerl im blauen Frack.
«Wie heißt du?», fragte sie ihn ganz unverblümt.
«Wer will das wissen?», gab der mit einem Augenzwinkern zurück.
«Juliana Blasius, Sängerin und Fiedelspielerin.»
Da lachte der andere auf. «Die Fiedel spielst du wunderbar, aber das Singen solltest du lieber lassen. Da hat der Wirtssohn vorhin schon recht gehabt.»
Er hatte eine sanfte, leicht heisere Stimme.
«Trotzdem lass ich mich nicht von jedem anlangen», sagte Juliana trotzig
«Auch wahr. Hat mir gefallen, wie du dem den Marsch geblasen hast. Alsdann, ich bin der Hannes Bückler. Los, Seibert, mach Platz und lass das Julchen hersitzen.»
Bückler? Hannes Bückler? Irgendwo hatte sie den Namen schon mal gehört.
«Willst du Wurzeln schlagen?», fragte der, der Seibert hieß, und klopfte neben sich auf die Bank. In seinem schwarzen Backenbart glänzte noch das Bratwurstfett. «Oder willst doch lieber mit deinem Alten dein Bier trinken?»
Ohne ihm einen Blick zu gönnen, quetschte sie sich zwischen ihn und seine Kumpane. Damit saß sie Hannes und der Schwester genau gegenüber. Die strahlte in die Runde, nahm ihren Bierkrug und stieß mit Hannes an.
«Zum Wohlsein! Ich bin die Margret Blasius, die Schwester von dem Plagegeist da.»
«Zum Wohlsein! Auf diesen herrlichen Ostertag an eurer Seite. Und auf den Tag meiner Wiedergeburt.»
«Wieso Wiedergeburt?» Fragend starrte Juliana ihn an.
«Das erzähl ich dir vielleicht ein andermal.» Er stieß auch mit ihr auf Gesundheit, Wohlsein und Reichtum an.
Margret verzog das Gesicht. Dass Juliana mit am Tisch saß, ging ihr nun doch gegen den Strich, das war ihr deutlich anzusehen. Dabei wollte Juliana nur herausfinden, wer dieser Mensch war – danach würde sie ihrer Schwester schon das Feld überlassen.
«Der Name Hannes Bückler sagt mir was. Muss man dich kennen?», sagte sie, und die Bagage am Tisch begann schallend zu lachen.
«Ja, ja», spottete Seibert, «wer den ganzen Tag singt und die Fiedel kratzt, der bekommt auch nix mit von der Welt. Unser Freund Hannes ist nämlich berühmt in der Gegend. Nicht wahr, Dallheimer?»
Der vierschrötige blonde Kerl mit der großen Hakennase neben ihm nickte bedächtig. «Vielleicht ja besser bekannt unter dem Namen Johannes Durchdenwald. Oder auch Schinderhannes.»
«Ach herrje!», entfuhr es Margret, und sie starrte ihren Sitznachbarn mit weit aufgerissenen Augen an. «Ich hab’s gewusst, ich hab’s gewusst … Hab ich dich doch mal auf einer Kirchweih gesehn, in Schneppenbach oder Griebelschied war’s. Da ging’s rum wie ein Lauffeuer, dass das der Schinderhannes auf dem Tanzboden wär.»
Augenblicklich fuhr Juliana ein leichter Schauer über den Rücken. Sie erinnerte sich noch genau, wie es im Winter überall auf den Dörfern die Runde gemacht hatte, dass bei Waldböckelheim am helllichten Tage eine vornehme Reisekutsche überfallen worden sei, mit vier steinreichen Kaufleuten drin! Der junge Schinderhannes mit seinen Komplizen sei das gewesen und die Opfer hätten sich vor Angst in die Hosen gemacht. Die sagenhafte Summe von fünfhundert Gulden hätten die Räuber erbeutet und dazu wertvolle Ware zuhauf. Und im letzten Monat dann hatte man von weiteren Raubüberfällen gehört, alle nicht allzu weit von ihrem Heimatdorf entfernt.
Was man diesem Schinderhannes nicht alles nachsagte! Es hieß, er führe Krieg gegen Reiche, Juden und gegen die verhassten Franzosen – der gemeine Mann aber habe nichts von ihm zu befürchten. Obendrein sei er ein Zauberer, könne an zwei Orten gleichzeitig sein und sich dann wiederum unsichtbar machen, um den Gendarmen zu entkommen. Andere behaupteten, dass er seine Häscher zu bannen vermochte, sodass sie sich nicht mehr rühren noch auf ihn schießen konnten. Kein Verlies der Welt sei sicher genug, ihn zu halten, schneller als jeder Gaukler wechsle er die Kostümierung und halte damit seine Verfolger zum Narren.
Und jetzt sollte dieser sagenumwobene Räuber hier vor ihnen sitzen, in Fleisch und Blut? Ungerührt und ohne Furcht vor Entdeckung oder Verrat?
Nein, Juliana mochte es nicht glauben. Bestimmt trieben der Fremde und seine Gefährten nur einen Scherz mit ihnen. Andererseits – warum glotzte jetzt alle Welt zu ihnen herüber?
Derweil hatte sich Margret enger an den Hannes gedrückt, und schon legte er ihr den Arm um die Schultern. Nachdem sie ihm etwas ins Ohr geflüstert hatte, lachte er leise und zog sie an sich. Ja, so kannte Juliana es von ihrer Schwester: Sie schaffte es immer wieder, allen Männern den Kopf zu verdrehen. Doch im Gegensatz zu ihren sonstigen Kerlen hatte dieser hier nichts Grobes. Mit verschmitztem Lächeln ging er auf Margrets Tändeleien ein, scherzte und lachte mit ihr, vergaß aber auch nicht, immer wieder das Wort an Juliana zu richten. Im Übrigen sprach er eine weitaus feinere Sprache als seine Tischgenossen.
«Ist’s denn nicht unvorsichtig und gefährlich», fragte Juliana ihn schließlich, «sich mitten unters Volk zu mischen, wenn einen die Gendarmen suchen?»
Er lachte.
«Im Gegenteil. Hier bin ich so sicher wie in Abrahams Schoß.»
«Und warum haben wir vorhin auf den Tag deiner Wiedergeburt angestoßen?»
«Das hast dir also gemerkt?» Seine Augen blitzten auf.
«Ja. Warum also?»
«Weil ich gestern den Häschern grad noch so entkommen bin, deshalb. Nur leider …» Sein Blick wurde plötzlich düster, und er ließ Margret los. Auch Dallheimer und Seibert schwiegen jetzt.
«Was ist mit dir?», fragte Margret.
«Ein guter Freund, der Carl Benzel – ihn haben sie geschnappt. Gestern in aller Früh war’s, auf dem Eigner Hof, wo wir Nachtlager genommen hatten. Ich konnte mich losreißen von den Gendarmen und grad noch so entkommen, im letzten Augenblick. Hab ein Fenster zerschlagen und bin hinausgesprungen …»
Seibert nickte ihm aufmunternd zu. «Der Scheele-Carl is nid dumm, der wird schon noch die Fliege machen.»
«Und wenn nicht? Ein strenges Verhör übersteht der nicht, mit seinen ewigen Gewissensqualen … Den ganzen Tag hat der doch in seiner Bibel und im Gesangbuch gelesen, ist sonntags sogar zum Abendmahl in die Kirche. Er wollt eigentlich immer ein rechtschaffener Kerl bleiben», der Schinderhannes blickte in die Runde, «und ist doch immer wieder bei mir gestrandet. Da hätt es besser mich erwischt, ich wüsst mir wenigstens zu helfen …»
Seine Stimme erstarb, und seine Augen füllten sich wahrhaftig mit Tränen.
Margret nahm seine Hand und drückte sie fest, während Juliana hin- und hergerissen war zwischen Mitleid und Empörung: Wie konnte dieser Mensch hier fröhlich feiern, wo ihm gestern erst so schlimme Dinge widerfahren waren?
«Doch nid du hast ihn zum Klauen gebracht», polterte Dallheimer los, «sondern die Dirnen, die er fürstlich aushalten wollt!»
Mit einem tiefen Seufzer gab Hannes sich einen Ruck: «Genug davon. Habt ihr Hunger, ihr Fräulein?»
Entweder war er ein begnadeter Possenspieler, dachte sich Juliana, oder tatsächlich der berühmte Räuber.
Sie schüttelte den Kopf, während ihre Schwester nickte.
«Alsdann, Seibert – hol uns noch eine Platte mit Speck und Würsten. Und der Bauer soll endlich von seinem Selbstgebrannten rausrücken, sein verwässertes Bier ist schier ungenießbar.»
Im Gegensatz zu den anderen Gästen musste Seibert nicht lang anstehen und kehrte bald mit einer gut beladenen Wurstplatte und seiner gefüllten Feldflasche zurück. Hannes war mittlerweile wieder so fröhlich wie zuvor.
«Lasst’s euch schmecken!»
Er öffnete die Flasche und hielt sie Margret an die Lippen. Erwartungsvoll nahm sie einen tiefen Schluck, um sofort keuchend nach Luft zu schnappen.
«Sackerment! Das brennt ja wie Höllenfeuer.»
Alle lachten, auch Juliana. Als Hannes ihr die Flasche über den Tisch reichte, gab sie sie an ihre Sitznachbarn weiter und griff stattdessen nach einer knusprigen Specksaite.
«Schnaps macht dumm im Kopf.»
«Habt ihr gehört, ihr andern?», rief Hannes. «Recht hat sie, das Julchen. Ich hab schon manch guten Mann erlebt, der sich am Ende um den Verstand gesoffen hat.»
Jetzt erst fiel ihr auf, dass er sich im Gegensatz zu den anderen, die bereits mehrere Krüge Bier geleert hatten, mit dem Zechen zurückhielt. Überhaupt verhielt er sich viel besonnener als all die Schreihälse rundum, war liebenswürdig und höflich und wirkte blitzgescheit. Mit einem Mal wusste sie, an wen er sie erinnerte: an ihren großen Bruder Christian, der die Familie viel zu früh verlassen hatte.
Margret drückte sich an ihn. «Ein Schlückchen Schnaps darfst mir trotzdem noch mal geben.»
Juliana warf ihr einen mahnenden Blick zu. Immerhin mussten sie noch bis Sonnenuntergang musizieren und danach eine gute Stunde nach Hause marschieren. Da spürte sie eine Hand auf ihrem rechten Knie, die langsam den Oberschenkel hinaufwanderte. Seibert neben ihr kaute auf einem Wurstzipfel, grinste und stierte sie dabei frech aus seinen kleinen rabenschwarzen Äuglein an
«Lass das!», fauchte sie und schlug seine Hand weg.
Im nächsten Augenblick legte Dallheimer seinen Arm um sie: «Hast recht. Der Seibert hat nämlich die Krätze.»
«Und du stinkst aus dem Maul!»
«Sag bloß, Julchen», mischte sich Hannes ein. «Gefallen dir meine beiden Freunde etwa nicht?»
«Nein, keiner von beiden.»
Da schlug er mit der flachen Hand auf den Tisch. «So lasst sie gefälligst in Ruh!»
«Schon recht, Capitaine», murrte Dallheimer. «Dann gib wenigstens noch mal von dem Fusel her.»
Fordernd streckte er den Arm aus. In diesem Moment trat der Junge vom Ausschank zu Hannes und flüsterte ihm etwas zu. Hannes runzelte die Stirn und reichte ihm eine Münze.
«Schade, die Greiferei ist im Anmarsch.» Er zog seinen ledernen Ranzen unter der Bank hervor und erhob sich. «Nach dem, was gestern war, machen wir uns lieber aus dem Staub.»
«So ein Schund!» Auch Dallheimer war aufgesprungen. «Vielleicht hätt ich ja doch noch bei dir landen können.» Er verabreichte Julchen einen fast schon galanten Handkuss.
«So bleibt doch noch», protestierte ein feister Kerl, der sich immer wieder in die Gespräche gemischt hatte. «Mit denen werden wir schon fertig.»
«Nichts da – auf ein andermal.» Hannes schob ihm einige Silbermünzen zu. «Damit bezahlst unsere und eure Zeche.»
Dann gab er Margret einen Kuss, reichte Juliana quer über den Tisch die Hand – er hatte einen festen, warmen Händedruck – und verschwand mitsamt Dallheimer und Seibert in Richtung der kleinen Tür hinter dem Tanzboden.
Durch das weit geöffnete Scheunentor näherten sich nun auch schon zwei Mannsbilder, an ihren engen weißen Hosen und dem Zweispitz auf dem Kopf unschwer als Gendarmen zu erkennen. Der eine war hier aus der Gegend, wie schnell herauszuhören war, der andere ein Franzos – von den Welschen fanden sich jetzt immer häufiger welche in den Brigaden. Die beiden fragten rundum nach Name und Herkunft, den einen oder andern auch nach seinen Papieren. Dann ließen sie sich vom Wickenhof-Pächter einen Krug Bier spendieren. Kaum waren sie wieder ihrer Wege gegangen, ging rundum ein Raunen los: «Diese Armleuchter kriegen den Hannes doch nie!» – «Und wenn sie ihn mal erwischen, lacht der ihnen gradwegs ins Gesicht.» – «Genau! Lupft den Hut vor der Streife und grüßt freundlich. Weil er sich nämlich verwandelt hat und die Bleedköpp ihn gar nid erst erkennen tun.»
Spätestens jetzt hatte Juliana keine Zweifel mehr, dass sie wahrhaftig dem Schinderhannes und seinen Leuten begegnet war.
Kapitel 2
Auf dem nächtlichen Heimweg durch die Hügel und Täler des Nahelands schwiegen sie – Kathrin und der Vater, weil sie verärgert waren, Margret, weil sie mit beseligtem Lächeln vor sich hin träumte, und Juliana, weil sie wieder einmal Schuld an allem gewesen sein sollte.
Am Ende hatten sie nämlich tatsächlich weniger Lohn als vereinbart erhalten, weil sich der Wirtssohn, als es ans Zahlen ging, mit einer wahren Schimpftirade beschwert hatte.
«Das Luder hat mich attackiert! Mich zum Affen gemacht, das Luder …», hatte er gelallt und war dabei ins Schwanken geraten.
Immerhin hatte ihr Vater Juliana verteidigt, mit den Worten, dass seine Töchter anständige Mädchen seien, dann aber doch nur noch müde die Schultern gezuckt und die Handvoll Kreuzer entgegengenommen. Dafür hatte Kathrin, kaum lag der Wickenhof hinter ihnen, ein umso lauteres Donnerwetter auf sie niederprasseln lassen: «Wie strohdumm bist du eigentlich? Dir wird dein Hochmut schon noch vergehen …» und so fort, bis Juliana sich die Ohren zugehalten hatte.
Längst war die Nacht hereingebrochen, kalt, sternenklar und dunkel, da der Mond nur als hauchdünne Sichel am Himmel stand. Zum Glück kannte der Vater rechts und links der Nahe jede Wegkreuzung, jeden Bachlauf, jede Scheune. Seit Juliana sich erinnern konnte, zog sie mit ihm und ihren Schwestern als Bänkelsängerin und Geigenspielerin in der Heimatregion übers Land. Was bedeutete: Bei Wind und Wetter stundenlang marschieren, um auf einer Kirchweih, bei einem Bauernfest oder in einer Dorfschenke gegen kargen Lohn und Imbiss aufzuspielen, sich dabei von Männern begrabschen und deren Weibern angiften zu lassen, nur um hinterher dem Zorn der Mutter (manchmal auch des Vaters) ausgesetzt zu sein, wenn sie wieder einmal nicht genug Geld heimgebracht hatten.
Was den Zuhörern ein leichtes und lustiges Handwerk scheinen mochte – sie selbst fand es kein bisschen vergnüglich. Aber ihr Vater, der Hannikel aus Weyerbach, hatte nichts andres gelernt, und wenn er nicht musizierte, verdingte er sich als Taglöhner. Als sie und ihre vier Geschwister noch klein waren, waren sie oft genug auf Almosen angewiesen gewesen, doch inzwischen besaßen sie wenigstens eine Kuh und hatten ein Feldstück zum Gemüseanbau gepachtet. Trotzdem – es war ein elendes Leben, und was blieb ihnen als Mädchen anderes, als auf die Heirat zu hoffen, mit einem halbwegs anständigen Kerl? Ihr großer Bruder, der Christian, hatte recht daran getan, schon als junger Bursche abzuhauen und sich dem Militär anzudienen. Die Mutter war hierüber schier rasend geworden, hatte tage- und nächtelang geheult und gejammert: «Mein einziger Junge! Mein einziger Sohn!», inzwischen aber prahlte sie damit, dass er Offizier bei den Kaiserlichen sei – dabei hatten sie nie wieder von ihm gehört!
In dem schwarzen Waldstück vor ihnen raschelte es laut, und Juliana stolperte vor Schreck über eine Wurzel. Aber es war bloß ein Sprung Rehe, der ihren Weg kreuzte. Bislang war es nur selten wirklich gefährlich geworden auf den nächtlichen Wanderungen. Jeder von ihnen hatte einen Stock zur Hand, der Vater auch einen scharfgeschliffenen Dolch im Gürtel. Wer ihnen dumm kam – andere Nachtschwärmer oder Betrunkene auf dem Heimweg –, den hatten sie noch stets gemeinsam mit lauten Drohungen und Flüchen in die Flucht geschlagen. Doch heute beschlich Juliana erstmals ein mulmiges Gefühl. Sie malte sich aus, wie es sich anfühlen mochte, von bewaffneten Räubern überfallen und ausgeraubt zu werden und dabei um sein Leben zu fürchten. In der Einsamkeit des nächtlichen Waldes hätten sie keinerlei Hilfe zu erwarten. Nun, zumindest vom Schinderhannes hatten Leute wie sie nichts zu befürchten. Und jetzt schon gleich dreimal nicht, wo sie seine Bekanntschaft gemacht hatten.
«An was denkst du?», flüsterte Margret, die mittlerweile neben ihr ging.
«An nichts», flunkerte sie.
«Ich muss immerzu an den Schinderhannes denken», fuhr die Schwester fort. «Jeder kennt und fürchtet ihn, vom Hunsrück bis an die Nahe. Und uns lädt er an seinen Tisch und bewirtet uns – ist das nicht unglaublich?»
«Hör ich den Namen Schinderhannes?» Der Vater verpasste ihr eine Kopfnuss. «Nie wieder, verstanden? Schlimm genug, dass der euch törichte Mädchen an den Tisch gelockt hat. Einer wie der landet am Strick, da nutzt es ihm gar nix, dass er mit dem Teufel im Bunde is!»
Nach einer guten Stunde Fußmarsch hatten sie ihr Heimatdorf Weyerbach erreicht, das bis zum Einmarsch der Franzosen noch zur Markgrafschaft Baden gehört hatte. Eingebettet in einem bewaldeten Seitental der Nahe, reihten sich rechts und links des Schnorrenbachs zwei Dutzend einfacher Bauern- und Handwerkerhäuser. Wirtshaus, Kirche und Pfarrhaus lagen zu dieser späten Stunde dunkel und still, nur der trübe Lichtschein hinter einigen Fensterscheiben zeigte an, dass noch nicht alle Bewohner schliefen. Müde überquerten sie den Bach und stapften die von Schnee und Winterregen noch immer aufgeweichte Dorfstraße hinauf, hinter einem Bretterzaun schlug aufgeregt ein Hund an.
Dort, wo die armseligsten Häuschen standen – geduckte graue Katen mit Strohdächern, in denen die Leute zur Miete wohnten –, hatten sie ihr Domizil. Genau wie ihre Nachbarn hatten sie damals, als die Leibeigenschaft aufgehoben worden war, kein Geld gehabt, um Haus und Hof in Besitz zu nehmen.
Hinter dem winzigen Fenster zur Straße hinaus flackerte eine Kerze. Der Vater schob den Riegel zum Stall zurück, der ihren einzigen wertvollen Besitz, eine magere Milchkuh und eine Schar Hühner, beherbergte, und grummelte etwas vor sich hin. Wahrscheinlich hatte er genau wie Juliana gehofft, dass Mariechen und die Mutter schon zu Bett gegangen waren.
Sie klopften sich im Dunkeln den Dreck von den Schuhen, als die Tür ins Hausinnere auch schon aufgerissen wurde. Im schwachen Lichtschein des Durchgangs zur Stube, die Küche und Wohnraum zugleich war, stand Mariechen, die jüngste der Schwestern.
«Lasst ihr euch auch endlich blicken?» Sie stemmte die Arme in die Seite. «Der Mutter geht’s gar nicht gut.»
Ihrer Mutter ging es niemals gut. Ständig wurde sie von Zipperlein geplagt. Mal war es der Rücken, mal die steifen Gelenke, dann wieder konnte sie nächtelang nicht schlafen, weil ihr schwindelte oder der Kopf schmerzte.
Eilig streifte sich der Vater Rock und Schuhe ab und schlüpfte in seine löchrigen Filzpantoffel, um nur ja keinen Dreck hineinzutragen. Dabei war das vergebliche Liebesmüh, so verlottert und schmutzig, wie es überall war. Eigentlich oblag ja Marie die Haushaltung, und sie musste aus diesem Grund auch nur selten mit ihnen hinaus. Aber wenn sie mal nicht zwischendurch mehr recht als schlecht kochte oder die ewig leidende Mutter bediente, faulenzte sie nur den ganzen Tag. Mariechen mit ihrer blonden Lockenpracht und dem niedlichen Gesichtchen fühlte sich schlichtweg als was Bessres. Sie takelte sich auf wie eine aus der Stadt, wenn sie ins nahe Oberstein auf den Markt ging, und lamentierte genau wie die Mutter beständig darüber, wie übel sie es getroffen hätten mit ihrem kümmerlichen Dasein in diesem elenden Bauerndorf. Sie war zwar erst vierzehn, träumte aber jetzt schon von einem Leben an der Seite eines Amtmannes drüben in Oberstein oder Kirn.
Unter der niedrigen Decke hing noch der Geruch nach dem Sonntagsessen, Kohl mit gesottenen Schweinsfüßen, und so eilte Margret schnurstracks zur Feuerstelle unter dem offenen, rußgeschwärzten Kamin und kratzte die letzten Reste aus dem Topf. Unschlüssig blieb Juliana mitten im Raum stehen. Auf dem einzigen Lehnstuhl neben dem Tisch thronte die Mutter, dick und mit verquollenem Gesicht, in Nachtrock und Schlafhaube, über die ausgestreckten Beine eine Decke gebreitet. Ihre zusammengekniffenen Lippen verrieten nichts Gutes.
Nur mit viel Mühe vermochte sich Juliana vorzustellen, dass ihre Mutter einst eine sehr schöne Frau gewesen sein sollte, ganz ähnlich wie Marie mit goldblonden Locken, hellblauen Augen und rosigem Herzchenmund. Jetzt waren Leib und Gesicht aufgedunsen, das schüttere Haar hing ihr grau und strähnig aus der Haube heraus, und bei jeder schnelleren Bewegung ächzte sie auf, laut jammernd, dass der Gliederschwamm von Tag zu Tag schlimmer werde.
«Was ist mir dir, Katharina Luisa?», fragte der Vater und strich ihr über die Hand. Wie immer, wenn er unsicher war, nannte er sie bei ihrem vollen Namen.
«Das fragst du? Seit Tagen bin ich verstopft, und heut, am heiligen Ostersonntag, hab ich sogar den Bader kommen lassen müssen. Aber das Klistier hat rein gar nix geholfen, der Aderlass erst recht nix, und dann hab ich mich von dem Quacksalber auch noch anraunzen lassen müssen, weil ich ihm nicht genug Geld hab zahlen können. Ach, es ist alles so eine Last», sie fuhr sich über die Augen, und ihr Tonfall wechselte von lautem Schelten ins Weinerliche, «keiner kümmert sich um mich außer dem Mariechen. Manchmal denk ich, am liebsten tät ich sterben wollen.»
«Luise! Das darfst du nicht sagen!»
«Nein? Wer lässt mich denn tagaus, tagein allein? Hättest halt ein anständiges Handwerk gelernt und tätest im Dorf arbeiten, dann hättest auch einen Ruf, und wir wären wer hier im Flecken und hätten Geld für den Bader und was Gutes im Kochtopf und müssten nicht in halben Lumpen rumrennen …»
Unter ihrem Wortschwall zog der Vater sichtlich den Kopf ein. Julianas Blick fiel auf das Spinnrad in der Ecke: Würden Marie und ihre Mutter wie all die andern Frauen im Dorf nach der Hausarbeit spinnen oder weben, könnten sie sich allemal ein besseres Leben leisten!
«Aber ich racker mich doch ab für uns alle», verteidigte sich der Vater. «Siehst du das nicht?»
«Ach ja? Ihr tingelt mit eurer Katzenmusik über die Dörfer und schlagt euch dabei den Ranzen voll. Das nennst du Arbeit?» Ihre Stimme wurde schrill. «Wie viel hast denn heut heimgebracht? Oder habt ihr die Hälfte unterwegs versoffen?»
«Gar nichts haben wir versoffen.» Er band den Beutel von seinem Gürtel los und warf ihn, nur noch mühsam beherrscht, auf den Tisch. «Aber gar so großzügig hat sich der Pächter vom Wickenhof nicht gezeigt.»
«Wie viel?» Kurz und schneidend kam die Frage.
«Zwei Dutzend Kreuzer.»
«Das soll alles sein? Das reicht ja nicht mal für ein Sechspfünder Schwarzbrot oder ein Simri Grumbeeren!»
Kathrin, die im Türrahmen stehen geblieben war, zeigte auf Juliana.
«Die Juliana ist auf den Sohn vom Wickenhof-Pächter losgegangen. Deshalb gab’s so wenig.»
«Was redest du da für einen Mist!» Juliana wurde wütend. «Bin ihm nur auf den Fuß getreten, als er frech wurde.»
Ehe sie sich’s versah, war die Mutter aufgesprungen.
«Da hast du deinen Lohn!»
Sie holte aus und schlug Juliana mit ihrer fleischigen Hand mitten ins Gesicht. Dann noch einmal und ein drittes Mal.
Fassungslos starrte Juliana ihre Mutter an. So fest hatte sie schon lange nicht mehr zugeschlagen. Und Marie grinste auch noch dazu.
«Geschieht dir recht», murmelte Kathrin. «Ich geh jetzt jedenfalls schlafen.»
Damit verschwand sie in Richtung Stall, über dem sie ihre winzige Schlafkammer hatte. Auch Margret schickte sich an, die Stube zu verlassen.
«Wo willst du hin?»
«Zu Joseph.»
«Spinnst du? Noch seid ihr nicht verheiratet.»
«Das ist mir gleich. Außer dich und den Pfaffen stört das keinen hier im Dorf.»
Sie riss die Haustür zur Straße auf und ließ sie scheppernd hinter sich ins Schloss fallen.
«Womit hab ich das alles nur verdient, ich armes, krankes Weib?», keifte die Mutter, um sich dann schluchzend darüber auszulassen, wie schlecht sie es mit diesem Mann und diesen missratenen Kindern getroffen habe.
Stumm, mit gekrümmtem Rücken, ließ der Vater die Vorwürfe über sich ergehen. Im flackernden Licht der Kerze sah er plötzlich uralt aus.
Juliana ballte die Fäuste. Sie hatte es satt, so unendlich satt! Es musste doch noch ein anderes Leben geben, dort draußen in der Welt.
Kapitel 3
Dass sich Margret, wenn sie unterwegs waren, den Kerlen an den Hals warf, war für Juliana nichts Neues – ihr selbst waren diese plumpen Tändeleien meist zu dumm. Bloß dass sie in solchen Momenten ganz und gar Luft war für die Schwester, verletzte sie manchmal. Sie hing nämlich an Margret mehr als an jedem anderen Menschen.
Als sie noch Kinder waren, hatten sie gegen die Mutter und die nicht weniger tyrannische Kathrin zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Später dann, als sie ihre kleinen Streifzüge, wie sie es nannten, unternahmen, erst recht. So hatte Margret ihr beigebracht, wie man den Opferstock in der Kirche mittels einer Leimrute plünderte, indem man sie oben durch den Schlitz schob, bis ein oder zwei Münzen dran kleben blieben, und sie dann ganz, ganz vorsichtig wieder herauszog. Noch weitaus mehr zu holen gab es an hohen Feiertagen, wenn es gedrängt voll wurde beim Gottesdienst und die Menschen sich besonders festlich ausstaffierten. Sobald die Erwachsenen, ihre Hüte unterm Arm und die Hände gefaltet, sich in Andacht ihren Gebeten hingaben, war die Gelegenheit gekommen: Unbemerkt lösten sie im Halbdunkel des Kirchenschiffs bei den Männern die Schnallen von den Schuhen oder Hüten, bei den Weibern die silbernen Nadeln aus dem Haar oder zogen Schnupftücher aus Rocktaschen. Sie taten das so geschickt, dass niemand etwas bemerkte, und freuten sich hinterher tagelang über die Beute, die sie in ihrer Dachkammer unter einem Dielenbrett versteckt hielten. Heute wussten sie, dass das alles weitgehend wertloser Tand war, doch damals hatten sie sich unermesslich reich gefühlt. Einmal war es Margret sogar gelungen, einer wohlhabenden Bauersfrau das in Silber gefasste Holzkreuz vom Rosenkranz zu schneiden, den sie achtlos vom Arm hatte herabhängen lassen. Mit diesem Kreuz waren sie am nächsten Tag zum Kleinkrämer Ely nach Bärenbach gewandert. Auf dessen misstrauisches Nachfragen hin hatten sie, ohne rot zu werden, erklärt, das Kreuz sei im Staub vor dem Kirchenportal gelegen, und hierfür schließlich sagenhafte fünfzehn Kreuzer erlöst.
Ein böses Ende fanden diese Art Unternehmungen, nachdem sie im Kramladen der Witwe Pfeiffer in Oberstein erwischt worden waren. Das war kurz vor der Franzosenzeit gewesen, Juliana mochte damals etwa zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, ihre Schwester so um die dreizehn. An jenem Frühlingsnachmittag waren sie dem lautstarken Gezänk ihrer Eltern entflohen und die Nahe aufwärts bis nach Oberstein gewandert. Das Tal wurde hier schmal und felsig, regelrecht eingezwängt lag das Städtchen mit seinen spitzgiebeligen Häusern zwischen dem Fluss und den steilen Hängen, überragt von der Felsenkirche, dem Alten und dem Neuen Schloss.
Nachdem sie ein Weilchen die Hauptstraße auf und ab flaniert waren, hatte die Schwester den Einfall gehabt, den Kramladen hinter der Achatschleife aufzusuchen. Ein solches Geschäft gab es in ihrem Dorf selbstredend nicht, und so hatte Juliana sofort begeistert zugestimmt. Für ihre zwei Kreuzer in der Rocktasche mochte sie ein paar bunte Murmeln oder ein hübsches Haarband erstehen.
«Dein Geld lass stecken, Julchen. Du machst einfach, was ich dir sag. Verstanden?»
Da hatte sie nur noch aufgeregt nicken können.
Die Ladenglocke begann beim Öffnen der Tür zu schellen, und die alte, hagere Witwe sah von einem eng bedruckten Blatt Papier auf. Nur mit großer Mühe entzifferte Juliana, die nicht mal zwei Jahre lang die Pfarrschule besucht hatte, das in großen Lettern gesetzte Wort Anzeiger.
«Einen schönen Gruß von unserer Muhme, der Frau vom Forstgehilfen Hampit aus Nahbollenbach.» Margret deutete einen artigen Knicks an. «Wir sollen den Einkauf für sie machen.»
«Warum kommt die dann nid selber?»
«Weil sich die arme Frau den Fuß verstaucht hat und humpeln tut.»
«Aha.»
Neugierig blickte sich Juliana um. Was es hier nicht alles zu kaufen gab! Bis unter die Decke reichten die Regale mit den ausgelegten Waren, manches war auch in beschrifteten Schubladen verborgen. In hohen Gläsern gab es die von ihr begehrten Murmeln sowie glänzende Hut- und Gürtelschnallen, in offenen Säckchen allerlei Trockenfrüchte, dazu Ballen von Stoffen und breiten Spitzenbändern, Seile jeglicher Dicke und Stärke, Werkzeuge für Haus und Garten, bunt bemaltes Holzspielzeug, sogar Essgeschirr und wunderschöne Kaffeetassen aus emailliertem Blech. In einer flachen Holzkiste lagen in Fächern sortiert Knöpfe, Zwirne, Nadeln, kleine Schnallen, schmale Borten und Bänder.
Margret hatte derweil ihren Korb, ohne den sie nie das Haus verließ, auf der Theke abgestellt.
«Eine kleine Schere braucht die Muhme und zwei Ellen von den Spitzenbändern dort.»
«Die Schere für Papier oder Stoff?»
«Fürs Papier, bittschön!»
Hatte die Pfeiffer-Witwe beim Eintreten noch reichlich griesgrämig dreingeschaut, so wurde sie durch Margrets Höflichkeiten fast schon freundlich. Neben der Spitze und der Schere wanderten noch zwei Paar Wollsocken in den Einkaufskorb, ein Päckchen Zichorienkaffee, ein dünner Strick und zwei rote Haarbänder. Juliana hätte gerne von den Murmeln gehabt, hielt aber wohlweislich den Mund, da Hampits Weib wohl kaum Spielzeug gekauft hätte. Aber wenigstens ließ ihre Schwester sich noch getrocknete Apfelringe und Dörrpflaumen abwiegen. Wie sie mit all diesen Schätzen aus dem Laden verschwinden sollten, war Juliana allerdings ein Rätsel.
«Habt vielen Dank, Gevatterin», Margret nestelte in ihrer Rocktasche, «das wär’s schon.»
«Das macht dann …»
Die Pfeifferin kritzelte mit zusammengekniffenen Augen auf einer Schiefertafel herum.
«O verzeiht! Fast hätt ich’s vergessen. Eine gute Seife braucht die Muhme noch.»
Juliana starrte ihre Schwester verdutzt an. Dann aber verstand sie. Seifen und Laugen waren nämlich ganz oben gelagert, und so zog die Alte eine Leiter aus der Ecke und schob sie an besagte Stelle. Erstaunlich behände kletterte sie die Sprossen hinauf.
«Lauf!», zischte Margret.
Juliana war zuerst bei der Tür, riss sie auf – und prallte gegen eine Männerbrust.
«So eilig, ihr Mädchen?»
«Halt sie fest, Heinrich!», rief es von der Leiter herab.
Margret wollte sich mit ihrem Korb unterm Arm vorbeidrängeln, doch dieser Heinrich war nicht allein, sondern mit zwei kräftigen Kumpanen unterwegs.
Das Ende vom Lied: Unter dem Hohngelächter der Menschentraube, die sich vor dem Kramladen gebildet hatte, wurden sie dem Obersteiner Bettelvogt übergeben, der sie, mit leerem Korb und gebundenen Händen, die ganzen eineinhalb Stunden zurück nach Weyerbach brachte und dem Vater «zur gütigen Bestrafung» übergab. Die Prügel fielen denn auch so heftig aus, dass sie beide nur auf dem Bauch einschlafen konnten in jener Nacht.
«Hast gehört, was der Vater gesagt hat?», flüsterte Juliana so leise, dass es Kathrin, die mit ihnen das Bett teilte, nicht hören konnte. «Nicht für den Diebstahl wären die Schläge, sondern weil wir uns so kreuzdumm angestellt hätten und erwischt worden sind! Jetzt hätt er die Schande vor allen Leut.»
«Recht hat er – du hättest draußen Schmiere stehen sollen.» Margret unterdrückte ein schmerzvolles Stöhnen. «Stell dir bloß vor: Wenn wir Jungs wären, dann hätt man uns ausgepeitscht und ins Loch gesteckt. Eins schwör ich dir, Julchen: Ich heirate mal einen, der so reich ist, dass man erst gar nicht klauen muss, um was Schönes zu haben.»
An diese Geschichte musste Juliana so manches Mal denken, als sie die nächsten Tage unterwegs waren, um mit Fiedeln und Tamburin im Gepäck die Wirtshäuser zwischen Oberstein und Kirn abzuklappern.
Das mit dem Heiraten war leider gar nicht so einfach. Dazu brauchte es nämlich eine Genehmigung der Behörden, und hierfür musste der Bräutigam nachweisen, dass er in der Lage war, eine Familie zu versorgen. Zwar war Margret mit ihren zwanzig Jahren bereits mündig, doch ihr Joseph, immerhin Sohn des Dorfschmieds, musste erst sein fünfundzwanzigstes Jahr abwarten. Zudem war er noch immer Knecht seines Vaters und vermochte somit keinen «genügenden Nahrungsstand», wie es hieß, zu gewährleisten. Bei Leuten wie ihnen, besitzlosen Taglöhnern und übers Land ziehendem Volk, war die Gemeinde besonders streng, wollte man doch liederlichem Lebenswandel vorbeugen. Und so war jedes Heiratsgesuch ein demütigender Bittgang zur Bürgermeisterei im zwei Stunden entfernten Sien. Was zur Folge hatte, dass nicht nur in ihrem Dorf zahllose Winkelehen geführt und uneheliche Bälger geboren wurden. Für ihre älteste Schwester Kathrin schien es besonders bitter, dass sie nach dem Tod ihres angetrauten Försters keinen geeigneten Heiratskandidaten mehr fand.
Was Margret betraf, so hatte Juliana stets den Eindruck gehabt, dass sie auf etwas Besseres aus war als auf ihren zugegebenermaßen etwas tumben Bräutigam Joseph. Seit jenem Ostersonntag auf dem Wickenhof allerdings hielt sich ihre Schwester auffallend zurück mit ihrem leichtsinnigen Herumpoussieren – ja, sie verhielt sich geradezu barsch und abweisend, wenn sich ihr ein Mannsbild auch nur näherte. Stattdessen schweifte ihr Blick in jeder Schenke, bei jedem Familienfest unruhig über die anwesenden Gäste, und des Abends, wenn sie mal unter sich waren, fiel bei ihren Gesprächen nur noch ein einziger Name: Hannes Bückler.
«Hast gesehen, wie er mich immer angeguckt hat? Und zweimal hat er mich geküsst, einmal sogar mitten auf den Mund! Der Hannes ist so ganz anders als die andern Burschen …», ging es in einem fort.
Einmal, als sie bei einer Taufe in Hennweiler aufspielten, hatten sie beide geglaubt, ihn unter den Feiernden entdeckt zu haben, und Margret hatte beim Singen und Tamburinschlagen fürchterlich gepatzt. Bis sie ihr Lied zu Ende gebracht hatten, war der vermeintliche Schinderhannes indessen verschwunden gewesen. Auf dem endlos weiten Nachhauseweg dann hatte Juliana sie beiseitegenommen und gefragt:
«Bist du etwa verliebt in den Hannes?»
Da war sie rot geworden: «Ja, der tät mir schon gefallen.»
«Aber er ist ein Räuber!»
«Na und? Allemal besser als ein Steuereintreiber oder Gemeindediener, der uns arme Leut nur ausnimmt und piesackt.»
Hierüber dachte Juliana viel nach in diesen Tagen. Manch einer fürchtete den Schinderhannes, die meisten einfachen Leute aber bewunderten ihn – vor allem die Weibsbilder! Es hieß, in jedem Dorf hätte er eine sitzen.
Seit jener Begegnung zu Ostern nämlich hielt auch Juliana die Ohren weit offen, während sie übers Land zogen. Die ganze Gegend um Rhaunen, Kirn und Baumholder machte der Schinderhannes mit seinen Leuten unsicher und drehte dabei der französischen Obrigkeit eine lange Nase. So hörte Juliana von einem Raubüberfall am helllichten Tage auf der Landstraße nahe Lauterecken, von Schutzgelderpressung der jüdischen Gemeinde in Hundsbach und schließlich, Ende April, von einem Raubüberfall am Hachenfels, ganz nahe ihrem Heimatdorf. Dort seien der reiche Metzger Mathias und ein Jude aus Sobernheim von vier Räubern angegriffen und ihres ganzen Geldes beraubt worden, nachdem man des Metzgers Hund mit zwei Schüssen niedergestreckt hatte. Letzteres fand Juliana grausam, denn sie mochte Tiere gern.
Was die Überfälle selbst betraf, da war sie ganz ein Kind ihrer Zeit. Wie alle hier neidete sie den jüdischen Viehhändlern, Krämern und Geldverleihern, die es so zahlreich in der Gegend gab, ihren Wohlstand, und mit dem Hass auf die Franzosen war sie groß geworden. Nur vage konnte sie sich an die Zeit erinnern, als die Leute noch «Büttel» statt «Gendarm» oder «Schultheiß» statt «Maire» gesagt hatten, so lange währte die Franzosenzeit nun schon. Wohl aber hatte sie noch die Bilder vor Augen, wie sie sich voller Angst vor den Soldaten versteckt, sich in den Scheunen unterm Stroh vergraben oder sich in Kellerlöcher gezwängt hatten, wenn wieder einmal die Trommeln ertönten. Mal waren es die Kaiserlichen, mal die französischen Revolutionstruppen gewesen, die über ihre Dörfer herfielen wie eine Heuschreckenplage und Felder und Vorräte plünderten, Obstbäume und Weinstöcke zerschlugen, Häuser in Brand setzten. Ein Menschenleben galt den Soldaten beider Lager wenig, wer sich ihnen entgegenstellte, wurde gequält und gemeuchelt, junge wie alte Frauen wurden geschändet. Juliana vermutete, dass auch ihrer ältesten Schwester so etwas angetan worden war, gesprochen wurde indessen in ihrer Familie nie darüber.
So war die Gegend zwischen Mosel, Nahe und Saar über etliche Jahre in raschem Wechsel von französischem und deutschem Militär besetzt und wieder geräumt worden. Am Ende gingen die Revolutionstruppen des Frankenreichs als Sieger hervor: Die alten Feudalherren und ihre Verwalter waren zwar vertrieben, dafür weite Landstriche verwüstet, das Holz aus ihren schönen Wäldern geplündert, die öffentliche Ordnung zusammengebrochen. Die neuen Herren waren nicht in der Lage, Ruhe zu schaffen, und die große Zeit der Räuber, Gauner und Diebe ebenso wie die der marodierenden Söldner setzte ein.
Dass dieser Napoleon aus dem fernen Paris auch neue Gesetze proklamierte, dass fortan alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein sollten, dass Adel und Klerus entmachtet, Leibeigenschaft und Zehnt abgeschafft waren – all das hatte eher die Bürger in den Städten begeistert. Dem Landvolk klangen die schönen Worte «Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit» hohl in den Ohren angesichts ihrer zerstörten Dörfer und Felder. Denn noch immer hielt das Militär sich schadlos, indem es sich einquartierte und die Vorräte plünderte, Pferde, Fuhrwerke und Proviant mit sich nahm, auch noch beim ärmsten Bauern Tür- und Fenstersteuer einforderte und junge, kräftige Knechte und Bauernsöhne für den Kriegsdienst einzog, da sich die verheerenden Feldzüge des Erbfeinds rechtsrheinisch fortsetzten.
Kein Wunder, dass einer wie Schinderhannes als «Franzosenfresser» gefeiert wurde, als jemand, der es wagte, der neuen Obrigkeit die Stirn zu bieten. Jeder Pferdediebstahl beim Militär, jede Plünderung von französischen Proviantwagen wurde in den Wirtshäusern mit Beifall bedacht.
Was die Juden betraf, die bald schon die vollen Bürgerrechte zugesprochen bekamen und überall ihre Synagogen, jüdischen Schulen und Friedhöfe errichten durften, so wurde die Feindseligkeit gegen sie nur noch größer. Weil sie nämlich durch den Handel mit dem Militär zum einen nur noch reicher wurden, zum anderen nicht zum Kriegsdienst eingezogen werden durften. Und so war man sich unter dem Landvolk einig, dass es keine große Sünde sein konnte, einen reichen Juden zu verhöhnen oder zu misshandeln.
Dies alles wusste Juliana aus den Erzählungen der Alten. Inzwischen mühten sich die Besatzer, eine Verwaltung nach französischem Muster einzurichten, wurden Büttel und Gerichtsdiener von einer Bajonette schwingenden Gendarmerie abgelöst, war Französisch sogar Amtssprache geworden, was indessen unter den deutschen Amtsherren und Gendarmen kaum einer richtig verstand, geschweige denn zu sprechen vermochte. Und bald schon sollte nur noch in Franken und Centimen bezahlt werden dürfen statt in Gulden und Kreuzern. Denn sie waren nun Teil des Feindeslandes, Teil der Französischen Republik, ob sie wollten oder nicht.
Kapitel 4
Gut zwei Wochen nach Ostern waren Juliana und Margret vor einem heftigen Streit mit Kathrin und der Mutter ins Weyerbacher Wirtshaus geflohen. Die Reisezeit hatte begonnen, und die düstere, rauchgeschwängerte Schankstube füllte sich zu dieser frühen Abendstunde rasch.
«Mir steht’s bis oben hin», schimpfte Margret, nachdem ihnen das Schankmädchen einen Krug billigen Viez und zwei Becher hingestellt hatte. «Immer dieses Keifen und Jammern daheim.»
Juliana nickte und nahm einen tiefen Schluck von dem essigsauren Apfelwein. «Das Beste wär, wir täten weggehen. Weißt was? Wir suchen uns eine Anstellung als Magd in Oberstein oder Kreuznach.»
«Das ist viel zu nah an zu Haus. Nein, wir gehen in eine große Stadt wie Mainz oder Frankfurt.»
Juliana wusste nicht einmal, wo diese Städte lagen. Über den Hunsrück und das Nahetal hinaus war sie nie gekommen. Dennoch gefiel ihr diese Vorstellung: zusammen mit Margret irgendwo in der Ferne neu anfangen. Dann würden die Eltern schon sehen, was sie an ihnen gehabt hatten. Und Marie und Kathrin erst recht.
In diesem Augenblick trat Jakob Fritsch, der behäbige alte Wirt, mit einem Fremden im Schlepptau an ihren Tisch.
«Das sind die beiden – aber lass bloß die Finger von denen», sagte er dem Mann und zwinkerte dabei Juliana und Margret zu. «Die Mädels vom Hannikel stehn nämlich unter meinem Schutz.»
Dann wandte er sich um und kehrte zum Ausschank zurück.
Der Mann, der sie neugierig musterte, war einiges älter als sie, etwa um die dreißig, von großer, aufrechter Statur und im grünen Rock mit roten Aufschlägen wie ein Waldhüter gekleidet. Sein auffallend lockiges Haar hatte er aus der Stirn zurückgekämmt, die hellen Augen standen ein wenig froschartig hervor. Juliana war, als hätte sie ihn schon mal gesehen auf ihren Dorffesten und Kirchweihen.
So fragte denn auch Margret ohne Umschweife: «Ist Er nicht der Husaren-Philipp?»
«Ganz recht.» Er grinste. «Philipp Klein, Feldschütz aus Dickesbach. Du und ich, wir haben mal zusammen getanzt, bei einer Hochzeit in Bruschied.»
Margret lachte los. «Und du bist mir dabei ganz schön auf die Füß getreten, jetzt weiß ich’s wieder.»
Unwillkürlich rollte Juliana mit den Augen. Schon wieder suchte irgendein Mannsbild, dem Margret mal den Kopf verdreht hatte, sie in Weyerbach auf.
Hastig trank sie ihren Becher aus und erhob sich. «Dann lass ich euch mal allein.»
Der Feldschütz hielt sie am Arm fest. «Nein, warte. Du musst das Julchen sein, nicht wahr?»
«Warum willst du das wissen?»
«Ich sag’s euch draußen, hier sind zu viele Ohren. Kommt.»
Tatsächlich hatten sich ihnen schon etliche Gesichter neugierig zugewandt.
Fragend sah Juliana ihre Schwester an. Die nickte Philipp Klein zu: «Geh schon mal vor, will erst noch austrinken.»
Nachdem der Feldschütz verschwunden war, flüsterte Juliana ihr zu: «Was will der Kerl bloß von uns?»
«Lassen wir uns halt überraschen. Jedenfalls ist der Husaren-Philipp ganz in Ordnung, mein ich. Der führt nix Böses im Schilde.» Margret blickte an sich herab. «Hätt ich mich heut bloß ein bisschen netter angezogen.»
Genau wie Juliana trug sie ihr Arbeitskleid mit dem ausgeblichenen Rock, dem grün-schwarzen Mieder und der wollenen Weste darüber. Ihre helle Leinenschürze wies tatsächlich ein paar hässliche Flecken auf.
«Ist doch wurscht.» Juliana ging Richtung Tür und nahm ihre Mäntel vom Haken. «Jetzt trink aus und komm.»
Die Neugier war in ihr erwacht. Vielleicht suchte der Feldschütz ja für einen Hof in Dickesbach zwei Mägde? Sie hätte recht gern auf einem Hof mit viel Viehzeug gearbeitet, während es Margret eher in die Stadt zog.
«Warum heißt der eigentlich Husaren-Philipp?», fragte sie ihre Schwester beim Hinausgehen.
Die zuckte die Schultern. «Wahrscheinlich weil er mal bei den Husaren gedient hat. Jedenfalls haben seine Freunde ihn so genannt.»
Draußen begann es ganz allmählich zu dämmern, und sie hatten sich die Kapuzen ihrer Mäntel tief ins Gesicht gezogen, damit man sie nicht schon von weitem erkannte. Philipp Klein wartete auf sie am Hoftor zu den Stallungen, ein gedrungenes dunkles Pferd an der Hand.
«Ich dacht’ schon, ihr hättet euch hinterrücks aus dem Staub gemacht.»
«Sehen wir so aus?» Margret stemmte die Arme in die Hüften. «Also, was willst du von uns? Bist du auf Brautschau oder suchst eine Magd für deinen Haushalt?»
«Keins von beiden.» Er senkte die Stimme. «Im Waldstück am Dollberg, beim Reidenbacher Hof, ist jemand, der mit euch reden will, weil er euch als Musikantinnen will.»
«Jetzt zum Abend sollen wir noch fort?»
«Pst, nicht so laut. Kommt ihr also mit? Ja oder nein.»
«Ja», entschied Margret ohne Zögern.
«Aber es wird schon bald dunkel», wandte Juliana ein. Das Ganze wurde ihr ein wenig unheimlich.
«Ich bring euch hierher zurück, wann immer ihr wollt. Versprochen.»
Da nickte auch Juliana. Eigentlich hatte dieser Husaren-Philipp ein freundliches, offenes Gesicht, er würde schon nicht gleich über sie beide herfallen. Und zu wehren wussten sie sich notfalls auch, mit Schlägen gegen die Nase, mit Tritten ins männliche Geschlecht.
«Dann los!» Der Feldschütz sah sich um. «Wie kommen wir halbwegs unbesehen aus dem Dorf?»
«Durch Jakobs Hof und hinten wieder raus und dann den Weg über den Knappenberg.»
Keine halbe Stunde später hatten sie den Dickesbach überquert und tauchten in den finsteren Wald am Dollberg ein, weit abseits der Straße auf das Dorf Dickesbach zu. Hier unter den Bäumen war es schon so gut wie dunkel, und Juliana griff nach der Hand ihrer Schwester. Auf ihre Fragen, wer denn dort auf sie warte, hatte der Husaren-Philipp den ganzen Weg über hartnäckig geschwiegen, aber sie hatte längst einen ebenso ungeheuerlichen wie aufregenden Verdacht.
«Daheim wundern sie sich jetzt, dass wir nicht zum Abendessen kommen», kicherte Margret. «Grad recht.»
«Schau mal, da vorn.» Juliana ließ ihre Hand los. «Ein Lagerfeuer.»
Zwischen den Baumstämmen flackerten Lichtblitze, und gleich darauf roch und hörte man das Feuer auch schon. Juliana zuckte zusammen, als der Feldschütz plötzlich einen Eulenschrei ausstieß. Einen Atemzug später hallte der gleiche Ruf zurück.
«Wir werden erwartet», verkündete der Feldschütz fast feierlich, und Juliana schlug das Herz bis zum Hals.
Ihre Vorahnung hatte sie nicht getäuscht: Es war tatsächlich der Schinderhannes, der da auf der kleinen Lichtung im Schein des Lagerfeuers stand und in ihre Richtung blickte!
Heute sah er noch eleganter aus, gerade so wie ein vornehmer Herr aus der Stadt. Er trug einen nach oben schmaler werdenden Biberhut, einen zweireihigen Rock mit hohem Kragen und breitem Revers in hellem Braun, dazu enge, innen mit Leder besetzte weiße Hosen zu hohen Stulpenstiefeln. Und er strahlte, als sie jetzt auf ihn zuliefen.
«Willkommen bei Johannes Durchdenwald!», rief er. «Ziemlich mutig von euch herzukommen.»
«Willkommen beim Schinderhannes!», kam es nun auch aus den rauen Kehlen der anderen Männer. Sie hockten um das Feuer herum, auf dem ein Ferkel am Spieß briet. Die einzige Frau in der Runde schlug ein Tamburin und sang leise dazu.
Beherzt trat Margret auf Hannes Bückler zu: «Mut braucht’s zu anderen Sachen, nicht um einen Schinderhannes zu besuchen.»
Sprach’s und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Sofort klatschten dessen Gefährten johlend Beifall.
«So habt ihr’s also gewusst?», fragte Hannes belustigt.
«Aber ja. Hab schon drauf gewartet, dass wir uns wiedersehen.»
Da lachte er laut auf und winkte Juliana heran.
«Komm her, Julchen. Sollst auch einen Kuss haben.»
«Danke, aber das braucht es nicht. Du willst uns als Musikantinnen? Dann hätt ich gern meine Fiedel, aber die liegt zu Haus.»
Margret schüttelte den Kopf. «Nach Haus geh ich nimmer.»
«Müsst ihr auch nicht.» Er bückte sich und zog aus einem Schnappsack, der außen mit allerlei Gerätschaften behängt war, eine nagelneue Fiedel heraus. Das Holz glänzte golden im Feuerschein.
«Wie wär’s damit?»
Überrascht nahm Juliana Bogen und Instrument entgegen, strich vorsichtig über die Saiten, stimmte die Töne richtig ein und begann die ersten Takte eines Tanzlieds zu spielen, wobei Hannes sie aufmerksam beobachtete. Sie ließ Fiedel und Bogen wieder sinken. Ein solch schönes Instrument hatte sie wahrhaftig noch nie in den Händen gehalten.
«Schenkst du mir die Fiedel, wenn wir heut Abend für euch spielen?»
«Ich schenke sie dir, wenn ihr bei uns bleibt. Ich brauche gute Musikantinnen, und besser als in diesem Kaff Weyerbach habt ihr’s bei mir allemal.»
«Wie? Für immer?» Verdutzt starrte sie ihn an.
Wieder lachte er. «Für immer ist die Ewigkeit, und die gibt’s nur im Jenseits. Ich meine, solang es euch bei uns gefällt. Und ich hab noch was für euch.»
Er kramte wieder in dem Reisesack, holte zwei verschiedenfarbige Stoffbeutelchen hervor und reichte sie an Margret und Juliana weiter.
«Macht auf!»
Juliana stockte der Atem, als sie die Halskette herauszog. Sie schimmerte golden und besaß einen Anhänger, in den ein tropfenförmiger, leuchtend grüner Stein eingefasst war. Die von Margret war mit glitzernden roten Steinchen durchsetzt.
«Ist das … echtes Gold?», stieß Juliana hervor.
«Das will ich meinen. Und die roten Steine sind Rubine, der grüne ist ein Smaragd. Der hat genau die Farbe deiner Augen.»
Sie gab ihm die Kette zurück. «Ich lass mich nicht kaufen.»
«Wer spricht denn davon? Das ist euer Lohn fürs Musizieren.»