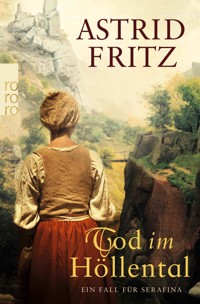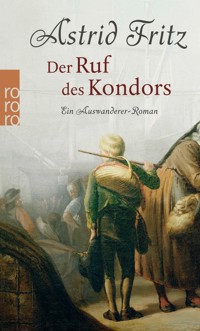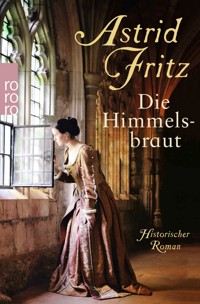Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hexe von Freiburg
- Sprache: Deutsch
Ein erschütterndes Frauenschicksal aus der Zeit der Hexenverfolgung Freiburg im 16. Jahrhundert: Der Hexenwahn fegt über Deutschland. Als in dem Universitätsstädtchen am Rande des Schwarzwalds zum ersten Mal die Flammen über einer Hexe zusammenschlagen, wird Catharina geboren. Ein schlechtes Omen? Das wissbegierige Mädchen wächst zu einer selbstbewussten jungen Frau heran, die ihr Leben lang gegen die Abhängigkeit von den Männern ankämpft. Am Ende droht sie deswegen alles zu verlieren – nur eines bleibt ihr: eine unendliche Liebe, vor der selbst der Tod seinen Schrecken verliert. «Ein absolut gelungenes Roman-Debüt von Astrid Fritz. Einfühlsam, spannend, traurig bis zur letzten Seite.» (Bayern 3) «Astrid Fritz hat in ihrem Roman Die Hexe von Freiburg – gestützt auf die historischen Fakten – ein typisches Hexenschicksal jener Zeit entstehen lassen und mit feinem Pinselstrich das Leben im ausgehenden Mittelalter gezeichnet, in dem magisches Denken und der Glaube an Zauberkräfte in allen Ständen verbreitet war.» (Badische Zeitung) «Der Roman zieht den Leser in längst vergangene Welten, die so eindrucksvoll beschrieben werden, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen mag.» (Märkische Allgemeine)
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Astrid Fritz
Die Hexe von Freiburg
Historischer Roman
Über dieses Buch
Ein erschütterndes Frauenschicksal aus der Zeit der Hexenverfolgung
Freiburg im 16. Jahrhundert: Der Hexenwahn fegt über Deutschland. Als in dem Universitätsstädtchen am Rande des Schwarzwalds zum ersten Mal die Flammen über einer Hexe zusammenschlagen, wird Catharina geboren. Ein schlechtes Omen? Das wissbegierige Mädchen wächst zu einer selbstbewussten jungen Frau heran, die ihr Leben lang gegen die Abhängigkeit von den Männern ankämpft. Am Ende droht sie deswegen alles zu verlieren – nur eines bleibt ihr: eine unendliche Liebe, vor der selbst der Tod seinen Schrecken verliert.
«Ein absolut gelungenes Roman-Debüt von Astrid Fritz. Einfühlsam, spannend, traurig bis zur letzten Seite.» (Bayern 3)
«Astrid Fritz hat in ihrem Roman Die Hexe von Freiburg – gestützt auf die historischen Fakten – ein typisches Hexenschicksal jener Zeit entstehen lassen und mit feinem Pinselstrich das Leben im ausgehenden Mittelalter gezeichnet, in dem magisches Denken und der Glaube an Zauberkräfte in allen Ständen verbreitet war.» (Badische Zeitung)
«Der Roman zieht den Leser in längst vergangene Welten, die so eindrucksvoll beschrieben werden, dass man das Buch nicht mehr aus der Hand legen mag.» (Märkische Allgemeine)
Vita
Astrid Fritz studierte Germanistik und Romanistik in München, Avignon und Freiburg. Mit ihrer Familie zog sie anschließend für mehrere Jahre nach Chile. Heute lebt sie in der Nähe von Stuttgart. Ihre historischen Romane sind große Erfolge.
Weitere Veröffentlichungen
Die Hexe von Freiburg
Die Tochter der Hexe
Die Gauklerin
Der Ruf des Kondors
Das Mädchen und die Herzogin
Die Vagabundin
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2009
Copyright © 2003 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Corbis; neuebildanstalt;Bridgeman Berlin
ISBN 978-3-644-40481-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Prolog
Die Frau schob sich eine weiße Strähne aus der Stirn und rückte den Stuhl näher ans Herdfeuer. Marthe-Marie blickte auf.
Lene betrachtete ihre Älteste liebevoll und wehmütig zugleich. Wie sehr sie Catharina doch glich. Mit ihrem schwarzen, glänzenden Haar und diesem dunklen Blick.
Es war an der Zeit. Sie musste die Wahrheit erfahren.
«Zünde das Licht an, Kind, und hol mir die Wolldecke. Im Alter kriecht einem die Kälte in alle Knochen.»
«Du bist nicht alt, Mutter.»
«Ach, Marthe-Marie, was weißt du schon. Du hast noch alles vor dir.» Sie wickelte sich in die Decke. «Ich will dir heute etwas zeigen. Dort im Schrank, unter der Wäsche, liegt ein Buch. Bring es mir bitte.»
Marthe-Marie erhob sich und ging zum Schrank. Als sie unter dem schweren Wäschestapel tatsächlich auf ein Buch stieß, hielt sie überrascht die Luft an.
«Was ist das?»
Lene nahm ihr den schweren Band ab.
«Hier, zwischen diesen Buchdeckeln, auf vielen hundert Seiten niedergeschrieben, steht die Lebensgeschichte meiner Base Catharina.»
«Hat sie selbst das alles aufgeschrieben?»
«O nein.» Lene lachte bitter auf. «Catharina konnte zwar schreiben wie ein gelehrter Mann, aber zu jener Zeit hätte sie nicht einmal mehr eine Feder zwischen den Fingern halten können. Ein gewisser Dr. Textor hat diese Zeilen verfasst. Ich selbst kenne ihn nicht, doch in Catharinas besseren Zeiten hat er zum Freundeskreis ihres Mannes gehört, und sie sagte einmal über ihn, dass er mehr Verstand besäße als der gesamte Magistrat zusammen. In den langen Wochen, als sie gefangen im Turm saß, kam dieser Mann oft zu ihr, gepeinigt von schlechtem Gewissen. Er war zu Anfang mit ihrer Verteidigung beauftragt gewesen, doch später hat man diese Aufgabe einem anderen Ratsherren übertragen. Als er Catharina fragte, ob er ihr irgendwie helfen könne, bat sie ihn, die Wahrheit aufzuschreiben, damit sie nicht verloren gehe. Und wenn alles vorbei sei, möge er den Bericht Lene Schillerin, ihrer Base in Konstanz, übergeben. So kam ich zu diesen Seiten.»
Lene zögerte und starrte in die Flammen. Das Mädchen hatte ein Recht darauf, alles zu erfahren. Müde richtete sie sich auf.
«Die Toten soll man ruhen lassen, dachte ich immer. Was hätte ich euch erzählen sollen? Aber jetzt fühle ich, dass ich dir die Wahrheit über Catharina schulde. Du musst wissen: Sie war keine Hexe. Ihr einziger Fehler mag gewesen sein, dass sie nicht in der Weise gelebt hat, wie es die Welt von einer Frau erwartet.»
1
So also sah eine leibhaftige Hexe aus! Festgekettet kauerte Anna Schweizerin mit gebrochenen Beinen auf dem Henkerskarren, kahl geschoren, den flackernden Blick zum Himmel gerichtet, mit einem losen Kittel über dem nackten Leib. Deutlich konnte die Menge die Brandmale auf ihren Armen und Schultern erkennen, zu denen jetzt neue Wunden hinzukamen: Alle zwanzig Schritte stieß der Henkersknecht ihr eine glühende Zange ins Fleisch.
Für die Zuschauer des Spektakels war die öffentliche Bestrafung von Mördern, Dieben und Betrügern so selbstverständlich wie der Wechsel von guten und schlechten Ernten, von fetten und mageren Jahren. Ob Auspeitschen oder Brandmarken, Abschneiden der Zunge oder der Gliedmaßen, Aufhängen, Rädern, Ertränken oder der mildtätige Hieb mit dem Richtschwert – niemandem wäre in den Sinn gekommen, dass an der Wiederherstellung des Rechts mittels körperlicher Züchtigung etwas unrecht sein mochte. Davon abgesehen, war jeder Schauprozess eine willkommene Unterbrechung des Alltagstrotts und der täglichen Mühsal.
Doch als am 20. März des Jahres 1546 das Hohe Gericht verkündet hatte, die Besenmacherin Anna Schweizerin sei wegen Hexerei bei lebendigem Leib zu verbrennen, ging ein ungläubiges Raunen durch die Bevölkerung von Freiburg. Dabei war es nicht die schreckliche Todesart, die die Gemüter erregte, sondern die Tatsache, dass mitten unter ihnen eine Hexe gelebt haben sollte, unbemerkt und unerkannt. Zwar hatte man von Ketzer- und Hexenverbrennungen gehört, aber das waren Nachrichten von weit her gewesen, aus anderen Teilen des Reiches, aus Frankreich, Oberitalien oder aus der welschen Schweiz. Auch der inquisitorische Eifer der beiden Dominikanermönche Jacob Sprenger und Heinrich Cramer war niemals bis Freiburg gelangt. Zauberei und Wahrsagerei, schwarze und weiße Magie – das waren Dinge, mit denen fast jeder einmal in Berührung gekommen war, doch Hexerei und Teufelspakt? Auf einmal wussten sich die Freiburger unglaubliche Dinge zu erzählen über diese Besenbinderin aus der Wolfshöhle, jenem düsteren Viertel unterhalb des Burgbergs, das man nach Einbruch der Dämmerung nur ungern durchquerte. Nun strömten die Menschen gaffend, mit offenen Mäulern zusammen, um die Verurteilte auf ihrem letzten Weg vom Kerker zum Richtplatz auf dem Schutzrain zu begleiten.
Gespannt warteten die Leute das Aufstöhnen der Gemarterten ab, um dann in lautes Grölen auszubrechen. Kaum einer der Zuschauer verspürte Mitleid, schließlich war diese Frau in einem ordentlichen Prozess überführt und verurteilt worden. Auf Geheiß ihres teuflischen Buhlen hatte sie auf der Gemarkung Kirchzarten in einem riesigen Kessel Hagel gesiedet und damit die frische Saat vernichtet, etliche Stück Vieh gelähmt und sich nächtens auf dem Kandel zum Sabbat eingefunden. Hinzu kam, dass sie eine Fremde war, eine ‹Reingeschmeckte› aus Basel. Hatte man sie dort nicht letztes Jahr wegen Zauberei aus der Stadt gejagt?
Die Hebamme schloss das Fenster, und das Geschrei des Pöbels wurde leiser. Im Hause des Marienmalers Hieronymus Stadellmen interessierte sich ohnehin niemand für dieses unerhörte Ereignis. Stadellmens junge Frau Anna lag in den Wehen, seit zwanzig Stunden schon, und verlor zusehends an Kraft. Das offene pechschwarze Haar klebte um ihr kalkweißes Gesicht, und die feinen wie von Künstlerhand modellierten Züge waren von Schmerz verzerrt. Es war ihre erste Geburt.
Verzweifelt ging Hieronymus neben dem Bett auf und ab, bis ihn seine Schwester Marthe hinausschickte.
«Du machst uns alle verrückt mit deiner Lauferei! Geh runter in deine Werkstatt und versuche zu arbeiten oder zu schlafen. Wir holen dich schon rechtzeitig.»
Die Hebamme warf ihr einen dankbaren Blick zu, als Stadellmen widerstrebend die kleine Kammer verließ, und massierte weiter mit der rechten Hand Annas riesigen gewölbten Bauch, während die linke vorsichtig zwischen den Schenkeln tastete.
«Der Kopf kommt. Ihr habt es gleich geschafft, Stadellmenin. Nehmt alle Kraft zusammen und presst!»
Im selben Moment, als draußen vor der Stadt über Anna Schweizerin die tödlichen Flammen zusammenschlugen, kam Catharina Stadellmenin endlich auf die Welt. Marthe kümmerte sich um ihre Schwägerin, die vor Schmerzen und Erschöpfung fast ohnmächtig war, während die Hebamme versuchte, dem veilchenfarbenen reglosen Säugling ein Lebenszeichen zu entlocken. Es war das längste Mädchen, das sie je auf die Welt gebracht hatte, dabei jedoch spindeldürr.
«Nun hol schon Luft», murmelte sie und klopfte mit der flachen Hand den verklebten Körper ab, mal stärker, mal schwächer. Schließlich hob sie das Kind an den Beinen in die Luft. Ein Krächzen entrang sich dem Neugeborenen, dann folgte ein markerschütternder Schrei, und die winzigen Fäuste ballten sich.
«Es atmet! Es lebt!» Marthe küsste ihre Schwägerin. Hieronymus stürzte herein und starrte erst den zappelnden Säugling, dann seine Frau an. Tränen der Erleichterung liefen über sein schmales, bartloses Gesicht.
«Es ist ein Mädchen, eine Catharina», flüsterte Anna und richtete sich vorsichtig ein wenig auf. Sie lächelte. «Hoffentlich bist du nicht enttäuscht.»
«Was für ein Unsinn», stammelte Hieronymus. «Mädchen oder Junge – das ist mir gleich. Außerdem werden wir noch viele Kinder haben. Sieh nur, es hat schon richtige Haare auf dem Kopf, so schwarz wie deine!»
Unterdessen hatte die Hebamme das Mädchen in ein wollenes Tuch gewickelt und seiner Mutter an die Brust gelegt. Sie bat Stadellmen, einen Bottich mit warmem Wasser aus der Küche zu holen. Aus Erfahrung wusste sie, dass Männer zwar die blutigsten Geburten durchhielten, beim Anblick der Nachgeburt jedoch die Fassung verloren. Ihrer Ansicht nach war die Geburt eines Kindes ohnehin Frauensache, Männer störten dabei nur. Während sie auf die Nachwehen wartete, sah sie wieder aus dem Fenster. Die Gassen der Schneckenvorstadt waren jetzt wie leer gefegt.
«Die Leute sind alle bei der Hinrichtung», sagte sie leise zu Marthe, die neben sie getreten war. «Ein solcher Geburtstag steht unter keinem guten Stern.»
«Seid still», fuhr Marthe sie an. «Wie könnt Ihr so etwas sagen!»
In den ersten Jahren ihres Lebens fehlte es Catharina an nichts, weder an Fürsorge noch an ausreichender Kost. Daran änderte zunächst auch die schreckliche Tatsache nichts, dass ihre Mutter zwei Jahre nach ihrer Geburt im Kindbett starb. Für ihren Vater bedeutete es einen Verlust, den er niemals überwand, doch Catharina war zu klein, um Trauer zu empfinden. Hinzu kam, dass sich Marthe ihrer annahm. Kaum, dass Catharina fünf Jahre alt war, machte sie sich allein auf den Weg zum Gasthof ihrer Tante, wann immer es ihr in den Kopf kam. Für Hieronymus Stadellmen, der tagsüber kaum Zeit für seine Tochter hatte, war es eine Beruhigung, sie in der Obhut seiner Schwester zu wissen.
Catharina liebte den weiten Weg hinaus zu ihrer Tante, besonders im Frühsommer. Durch die winkligen Gässchen und Gemüsegärten der Predigervorstadt, an der alten Peterskirche vorbei, in der ein Marienbild ihres Vaters hing, erreichte sie die Landstraße, die sich gemächlich durch Felder und Brachland nach Lehen schlängelte, einem kleinen Dorf von Viehzüchtern, Wein- und Obstbauern, auf das die Stadt Freiburg schon seit vielen Jahren ein Auge geworfen hatte. Oder sie nahm, wenn die Dreisam mit ihrem tosenden braunen Strom nicht gerade die Uferwiesen überschwemmt hatte, den schmalen Pfad am Fluss entlang, genoss den Blick auf die Berge, die im Morgenlicht ihre Düsternis verloren, und blickte den Flößern nach, die Tannen- und Fichtenholz vom Schwarzwald herunterbrachten. Sie kannte bald jeden Strauch und jede Wegbiegung und beobachtete gern das Spiel von Sonne und Wolken über der weiten Ebene. Die Stadt kam ihr dann jedes Mal noch schmutziger und düsterer vor. Sie fürchtete sich vor nichts und niemandem, weder vor Unwettern noch vor den Bauern und Händlern, denen sie unterwegs begegnete und die das Mädchen bald beim Namen kannten. Nur eine Stelle gab es, wo sich ihr Schritt verlangsamte und ihr Herz in einer Mischung aus Angst und gespannter Erwartung heftiger zu klopfen begann: das steinerne Kreuz unter der alten Linde.
Die Leute sagten, dass unter dem Kreuz ein Bischof begraben sei, der vor Jahrhunderten grausam hingemetzelt worden war. Zigmal sei das Kreuz auf den Kirchhof des Nachbardorfes Betzenhausen überführt worden, aber schon in der nächsten Nacht sei es wie auf Geisterbeinen wieder an seinen alten Platz zur Landstraße zurückgewandert. Catharina blieb jedes Mal eine Weile vor dem Bischofskreuz stehen und beobachtete mit leichtem Schaudern, ob es sich nicht bewegte. Einige Male war sie sich fast sicher. Oder waren es die Blätter der Linde, die im Wind rauschten und ihre Schatten auf den verwitterten Stein warfen?
Marthe Stadellmenin, genannt die Schillerin, hatte vier Kinder, zwei davon in Catharinas Alter. Nachdem ihr Mann vor einigen Jahren an Typhus gestorben war, führte sie den Gasthof in Lehen allein weiter, in der Hoffnung, ihr Ältester würde ihn eines Tages übernehmen. Catharina fühlte sich bei ihrer Tante jederzeit willkommen, sie wurde nicht anders behandelt als Marthes leibliche Kinder, was bedeutete, dass Catharina mit Hand anlegte, wo sie konnte, und sich ansonsten mit ihren Vettern, ihrer Base und den Nachbarskindern herumtrieb.
Als Kind erschien Catharina das Anwesen ihrer Tante riesig, herrschaftlich wie ein Schloss. Der mit Rheinkiesel gepflasterte Innenhof wurde an zwei Seiten vom Gasthaus begrenzt, an der dritten Seite von Stall und Scheune. Zur Straße hin stand eine mannshohe blendend weiß gekalkte Mauer, die einen im Sommer, wenn die Sonne hoch stand, blinzeln machte. Das Gasthaus selbst, das größte und stattlichste in der Gegend, war ganz aus Stein mit einem Dach aus verschiedenfarbig gebrannten Ziegeln. Alle Räume, selbst die winzigsten Kammern, hatten verglaste Fenster, die bei Sturm und Gewitter mit Holzläden verschlossen werden konnten. Im Frühjahr roch es nach frischem Gras und Blüten, im Spätsommer nach den Früchten des Obstgartens.
Wie düster und eng hingegen war das Haus ihres Vaters in der Stadt! Eingeklemmt zwischen zwei verwahrlosten Häusern stand es direkt am Gewerbekanal auf der Insel, einem kleinen Handwerkerviertel, wo sich auf engstem Raum Knochen- und Ölmühlen, Gerberhütten und die Schleifereien der Bohrer und Balierer drängten. Die baulichen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte schienen an diesem Viertel spurlos vorübergegangen zu sein. Die Fachwerkhäuschen mit ihren lehmgefüllten Flechtwänden, Schindel- oder Strohdächern stellten eine ständige Brandgefahr dar, und die offenen Herdstellen in den Wohnstuben, die oft der ganzen Familie samt Federvieh als Schlafstätte dienten, taten ihr Übriges. Geflieste Böden, Kachelöfen oder gar Badestuben waren hier unbekannt, statt der teuren Kerzen und Öllampen spendeten rußende Kienspäne im Winter ihr spärliches Licht.
So oft schon hatten die Winterstürme die Schindeln vom Dachstuhl gerissen, und gerade im obersten Stockwerk, wo Catharina ihre Kammer hatte, pfiff dann der Wind durch die Ritzen. Aber sie besaßen einen Aborterker! Wie ein dicker Käfer klebte er ganz oben an der Außenwand, mit einem Türchen zum Hausinneren. Die meisten Nachbarn hatten nur eine Grube im Hof. Im Sommer vermischte sich dann der Gestank der Fäkalien und der Küchenabfälle auf der Gasse mit dem der geschabten trocknenden Häute der Gerber. Als Catharina ihrer Tante einmal neidvoll gestand, wie viel schöner sie es bei ihr fand, lächelte Marthe: «Wir sind nur Pächter, während das Haus deines Vaters euer eigen Grund und Gut ist. Du wirst eines Tages froh darum sein.»
Sonntags, nach dem Kirchgang, nahm ihr Vater sie bei der Hand, und sie machten sich gemeinsam auf den Weg nach Lehen. An den Wochentagen führte Catharina ihrem Vater den Haushalt und setzte sich anschließend zu ihm in die Werkstatt, um ihn beim Malen zu beobachten. Die schönsten Momente kamen, wenn ihr Vater Pinsel und Spachtel beiseite legte und ihr Geschichten erzählte. Darüber vergaßen sie manchmal sogar das Nachtessen, und nicht selten musste Hieronymus seine Tochter ins Bett tragen, wenn sie an seiner Schulter eingeschlafen war.
Ihr Vater wusste über sämtliche Länder der Welt zu berichten. Lange Zeit hatte sie geglaubt, dass er all diese Länder bereist hatte, dabei war Hieronymus Stadellmen nie aus dem Breisgau herausgekommen. Am liebsten hörte Catharina von der Neuen Welt, wie die Spanier und Portugiesen auf diesen fremden Kontinent vorgedrungen waren, der durch einen unendlichen Ozean von ihrer Heimat getrennt war.
«Die Menschen dort», berichtete er, «leben ganz anders als wir. Sie sind von dunkler Hautfarbe, und es scheint immer die Sonne, sodass sie keine Kleidung tragen müssen. Du darfst sie dir nicht als wilde Tiere vorstellen, vielmehr sind sie sanft und friedlich und sehr religiös, denn sie haben gleich mehrere Götter, die sie anbeten.» Dass es dort auch Völker gab, die ihren Göttern Menschenopfer brachten, bestürzte Catharina, und sie war froh, in ihrem ruhigen Städtchen geboren zu sein.
Von ihrem Vater erfuhr sie auch, dass die Erde keine vom Ozean umspülte Scheibe sei, sondern rund. Schon vor vielen, vielen Jahren habe ein Nürnberger namens Behaim die Welt als eine Kugel nachgebildet, auf der er neben den Erdteilen Europa, Asien und Afrika auch die Neue Welt eingezeichnet hatte. Catharina hätte alles darum gegeben, solch eine Weltkugel einmal zu sehen.
«Wie kommt es, dass die Menschen auf der unteren Seite der Kugel nicht herunterfallen? Und außerdem leben sie ja dann mit dem Kopf nach unten?»
Hieronymus Stadellmen zögerte. «Es muss wohl daran liegen, dass der Erdball so riesig groß ist und die Menschen es gar nicht merken, dass sie auf der unteren Seite leben.» Aber so richtig befriedigt hatte diese Antwort Catharina nicht.
Nach ihrem Dafürhalten hätte das Leben an der Seite ihres Vaters immer so weitergehen können. Doch von einem Tag auf den anderen änderte sich alles. Ihr Vater heiratete Hiltrud Gellert, und am Hochzeitstag zog diese Frau bei ihnen ein. Hiltrud war die Tochter eines Steinmetzmeisters und somit wohl eine gute Partie. Sie war früh Witwe geworden. Der alte Steinmetz hatte sie und ihre beiden Söhne noch eine gute Weile unterstützen können, aber dann wurde er zu alt, und die Zunftversammlung drängte ihn, seine Tochter noch einmal zu verheiraten.
Ihr Vater hatte Catharina später erzählt, dass er lange Zeit geglaubt hatte, es sei Schicksal oder Vorbestimmung gewesen, weil er in jenen Wochen der jungen Witwe so häufig begegnet war. Doch habe der alte Steinmetz dahinter gesteckt, den Hieronymus von einem gemeinsamen Auftrag her kannte. Geschickt hatte er bis zum Hochzeitstag die Fäden in der Hand gehalten.
Catharina war überzeugt davon, dass ihr Vater mit dieser Frau betrogen worden war. Vielleicht war Hiltrud keine schlechte Ehefrau, ihr gegenüber jedoch zeigte sie sich kalt und gleichgültig. Hiltrud kümmerte sich keinen Deut um sie, übersah mitunter einfach, dass sie eine Stieftochter hatte, sodass es vorkommen konnte, dass beim Morgenmahl für Catharina kein Gedeck vorgesehen war.
Manchmal stritten Hiltrud und Hieronymus wegen Catharina.
«Du tust so, als sei das Mädchen etwas Besonderes», hörte Catharina sie keifen. «Sie soll lernen, den Haushalt zu führen und zu nähen und flicken, was weiß ich. Du aber bringst ihr Firlefanz wie Schreiben und Rechnen bei und stopfst ihr den Kopf voll mit Dingen, die ein kleines Mädchen nichts angehen!»
In solchen Momenten warf der Vater ihr ein verlegenes Lächeln zu, ohne diesen Vorwürfen etwas entgegenzusetzen.
«Hiltrud hat Recht», sagte er ihr eines Abends, als er sie zu Bett brachte. «Du bist etwas Besonderes.» Er seufzte. «Weißt du, dass du deiner Mutter immer mehr gleichst? Nicht nur äußerlich, auch im Wesen.»
Dass er die Nörgeleien seiner neuen Frau mit gesenktem Kopf über sich ergehen ließ, fand Catharina schlimm genug, doch weit heftiger traf es sie, dass er ihr immer weniger Zeit widmete. Er sprach nicht mehr mit ihr über ihre Mutter, und die abendliche Zeremonie der Gutenachtgeschichten fand ein Ende.
Dabei blieb es nicht. Das Bild der Mutter, das über dem Esstisch gehangen hatte, wanderte auf den Dachboden. In Catharinas kleines Zimmer, das sie wegen seiner Aussicht auf den sanft plätschernden Gewerbekanal so liebte, zogen die beiden Stiefbrüder Claudius und Johann, und sie musste auf eine alte Strohmatte im Wohnraum ausweichen.
Als Nächstes wurde Catharina der Unterricht bei Othilia Molerin gestrichen. Die Molerin war eine Schulmeisterswitwe, die Bürgerskindern in einer so genannten Winkelschule Rechnen, Schreiben und Lesen beibrachte. Ihr Vater hatte beobachtet, wie neugierig Catharina war und wie leicht ihr das Lernen fiel. Offiziell waren die Winkelschulen vom Rat der Stadt verboten, da sich die Schulmeister der städtischen Lateinschule immer wieder über diese lästige Konkurrenz beschwerten. Aber im Grunde drückte der Magistrat beide Augen zu, war es doch allgemein bekannt, dass die meisten Kaufleute und Handwerker das Studium von Latein und Rhetorik für ihre Kinder als Zeitverschwendung betrachteten und inzwischen mit Nachdruck eine Deutsche Schule forderten. Selbstredend waren die städtischen Schulen nur für Knaben vorgesehen, den Mädchen blieb also ohnehin nur der Unterricht bei den heimlichen Schulmeistern oder den Klosterfrauen der Beginen.
Catharina war völlig vor den Kopf geschlagen, als Hiltrud nur wenige Wochen nach ihrem Einzug eröffnete, für diesen Unfug, Mädchen zu unterrichten, sei ihr jeder Pfennig zu schade. Als sich Catharina von der dicken, gemütlichen Schulmeisterin verabschieden ging, konnte sie die Tränen nicht zurückhalten, und die Molerin schalt fürchterlich über die Borniertheit und Hartherzigkeit der Stiefmutter.
Hiltrud kümmerte sich ansonsten nicht weiter um Catharina. Dabei konnte man nicht behaupten, dass sie boshaft zu ihr war, auch wenn ihr Catharina gegenüber weitaus öfter die Hand ausrutschte als bei ihren eigenen Söhnen. Vielmehr sorgte sie dafür, dass Catharina angemessen gekleidet war, und wenn sie die Werkstatt aufräumte oder Besorgungen erledigte, steckte sie ihr auch mal einen Kuchenrest als Belohnung zu. Nur manchmal, wenn Hiltrud mit den Söhnen zu ihrer Verwandtschaft nach Emmendingen fuhr, war es fast wie früher.
Dann saß Catharina beim Vater in der Werkstatt, oder sie übten zusammen in der Küche Rechnen und Schreiben. Catharina schickte dann jedes Mal ein Stoßgebet zur Jungfrau Maria, damit das Wetter schlecht würde, denn dann kämen ihre Stiefmutter und die Stiefbrüder erst am nächsten Tag zurück.
Überhaupt die Stiefbrüder! Sie machten sich im ganzen Haus breit, benutzten ihre Sachen, lungerten in Vaters Werkstatt herum. Wobei Claudius, der Dreizehnjährige, noch erträglich war: Er neckte sie ständig, wusste aber, wann der Zeitpunkt gekommen war, sie in Ruhe zu lassen.
Johann hingegen, den Sechzehnjährigen mit seinem teigigen Gesicht und den großen Pratzen, fürchtete sie. Er war hochmütig. Er ließ sie bei jeder Gelegenheit spüren, dass er sie für ein dummes kleines Mädchen hielt. Und er beobachtete sie immerfort, schweigend und mit halb geschlossenen Augen. Wenn er in ihrer Nähe war, schauderte sie, doch hätte sie damals nicht genau sagen können, warum sie sich von ihm bedroht fühlte. Einmal hatte er ihr, grinsend und mit flackerndem Blick, auf ihre noch flache Brust gefasst, und sie bekam eine vage Ahnung, was hinter seinen ständigen Andeutungen stecken mochte.
Sie ging ihm aus dem Weg, und so wurde es ihr zur Gewohnheit, morgens das Haus zu verlassen, um erst zur Abenddämmerung heimzukehren.
Der Marsch von ihrem Elternhaus dauerte nach Lehen hinaus eine gute Stunde, vorausgesetzt, das Wetter spielte mit. An jenem Tag, Mitte März, eine Woche vor ihrem zwölften Geburtstag, hatte es jedoch in der Nacht noch einmal heftig zu schneien begonnen. Als ihr Vater sie bei Sonnenaufgang weckte und sagte, sie solle ein Bündel mit Wäsche zusammenpacken, sie müssten zu Tante Marthe, da erschrak sie. Was hatte das zu bedeuten? Was sollten sie bei diesem Hundewetter in Lehen? War ihre Tante krank? Hieronymus wich ihrem Blick und ihren Fragen aus und drängte sie zum Aufbruch.
Draußen wehte ihnen ein scharfer Wind die nassen Flocken in den Kragen. Catharina fror, und den ganzen Weg sprach der Vater kein Wort, was sonst nicht seine Art war. Verunsichert klammerte sie sich an seine Hand. Als sie nach fast zwei Stunden endlich ankamen, brannte im Nebenraum der Gaststube ein Feuer, und die Hausmagd stellte einen Topf heiße Suppe auf den Tisch. Bei der Ankunft hatte Marthe Stadellmenin sie herzlich in den Arm genommen. Jetzt, beim Essen, lächelte sie ihr zwar aufmunternd zu, blieb aber ansonsten ebenso schweigsam wie ihr Bruder. Die Stille wurde nur hin und wieder vom Kichern der beiden Jüngsten, der Zwillinge Wilhelm und Carl, unterbrochen. Lene, die in Catharinas Alter war, rutschte aufgeregt auf ihrem Stuhl hin und her, und Christoph, Tante Marthes ältester Sohn aus ihrer ersten Ehe, schaute sie mit seinen tiefblauen Augen neugierig an. Ihr fiel auf, dass er den gleichen sanften Blick wie ihre Tante hatte. Da räusperte sich der Vater und legte bedächtig den Löffel neben den Holzteller.
«Catharina, wie du weißt, hat Tante Marthe viel Arbeit, seitdem der Schillerwirt tot ist. Christoph muss den Hof versorgen, Lene den Haushalt und die Kleinen. Da braucht deine Tante noch eine Hilfe in der Gaststube, und du bist alt genug, um eine Stellung anzutreten.» Er nahm noch einen Löffel Suppe. Draußen rüttelte der Wind an den Fensterläden. «Nun ja, bei uns ist es inzwischen recht eng geworden, und da dachte ich mir, du wohnst sicher gern bei deiner Tante.»
Catharina starrte ihn an. Sie sollte abgeschoben werden. Jetzt verstand sie, was dieser unerwartete Ausflug zu bedeuten hatte. In diesem Moment hasste sie ihren Vater, hasste die neue Frau mit ihren ekelhaften Söhnen, die ohne Vorankündigung in ihr Leben eingedrungen waren und sie aus ihrem Elternhaus vertrieben. Sie stieß polternd den Stuhl zurück und stürzte hinaus. Ihr Vater lief ihr nach.
«Ich bin doch nicht aus der Welt. Du kannst mich jederzeit besuchen, und sonntags komme ich wie früher nach Lehen. Marthe braucht deine Hilfe, verstehst du das denn nicht?» Dann schwieg er. Sie drehte sich um und sah, dass er Tränen in den Augen hatte. Wie konnte er weinen und sie gleichzeitig wegschicken von zu Hause? Sie wollte ihn nie wieder sehen. Sie rannte los, hinein in den heulenden Sturm, doch jemand packte sie am Arm. Es war ihr Vetter Christoph.
«Komm jetzt ins Haus. Wir freuen uns alle auf dich.»
So ganz die Wahrheit war das nicht. Mochten Christoph und Mutter sich freuen – ich fand es zunächst schrecklich, mit welcher Selbstverständlichkeit sich Catharina in unserer Familie breit machte. Ich hatte Mutter versprechen müssen, meine Kammer mit ihr zu teilen und sie freundlich aufzunehmen. Weißt du, Marthe-Marie, was ich stattdessen getan habe? Jeden Abend, wenn sie zu mir ins Bett kam, nahm ich wortlos meine Decken und zog trotz der eisigen Kälte auf den Dachboden um. Ich strafte sie mit Missachtung, wo ich konnte, denn ich wollte nicht, dass sie bei uns blieb. Sie war anders, immer so nachdenklich und verschlossen. Ich war mir sicher, dass sie sich als etwas Besseres fühlte. Das glaubten wir damals von allen Kindern aus der Stadt. Und bei Catharina kam hinzu, dass sie das einzige Mädchen war, das ich kannte, das lesen und schreiben konnte.
Heute weiß ich, dass meine anfängliche Abneigung nichts als Eifersucht war, denn ich hatte Angst, Catharina könne meine Stellung als einzige Haustochter bedrohen. Zudem war mir nicht entgangen, mit welchen Blicken mein Bruder Catharina von Anfang an bedachte. So habe ich mich in den ersten Wochen wohl recht ekelhaft benommen. Mich wundert heute noch, wie schnell sich Catharina trotz allem bei uns einlebte. Sie teilte sich mit mir die Hausarbeit, und an den Tagen, an denen die Fuhrleute aus Breisach kamen oder die Gemeindeobrigkeit tagte, half sie in der Gaststube mit. Diese Arbeit schien ihr zu gefallen, denn sie stellte sich so geschickt an, dass sie oft gelobt wurde von den Gästen. Es machte mich wütend zu sehen, wie Christoph gleich zur Stelle war, wenn sie mit einer Arbeit Schwierigkeiten hatte, oder dass Mutter sie anfangs umsorgte wie eine Glucke. Wir müssen ihr die Familie ersetzen, waren ihre ständigen Worte. Ich hingegen sagte meiner Base, wie dankbar sie uns sein sollte:
«Du hast Glück, dass du nicht zu fremden Leuten geschickt worden bist. Oder dass dein Vater dich nicht im Wald ausgesetzt hat.»
Mein Gott, was schäme ich mich heute noch für diese Worte. Sie wehrte sich nie gegen meine Gemeinheiten, schaute mich immer nur erschrocken und traurig aus ihren dunklen Augen an, was mich nur noch mehr reizte. Bis ich eines Tages auf den Gedanken kam, meine Freunde gegen sie aufzustacheln.
Gelegentlich ließ ich es zu, dass Catharina mit mir und meinen Freunden nach der Arbeit durchs Dorf zog. Sie schien mich zu bewundern, vielleicht, weil ich unter den Kindern das Sagen hatte, vielleicht auch, weil ich schon ein wenig fraulich aussah, während sie so knochig und staksig wie ein Fohlen daherkam. Wären nicht das dichte schwarze Haar und das schmale Gesicht gewesen, hätte man sie damals für einen Jungen halten können.
Mit Unmut hatte ich bemerkt, wie die anderen begannen, Catharina nett zu finden. So versprach ich den beiden einzigen Jungen, die mit uns herumzogen, dass derjenige mich küssen dürfe, der es schaffe, Catharina der Länge nach in eine Pfütze zu werfen.
Wie sehr hatte ich meine Base unterschätzt. Im Handumdrehen hatte sie erst dem einen Burschen eine blutige Nase geschlagen, dann den anderen in den Schwitzkasten genommen, bis der nur noch jammerte und wimmerte.
An diesem Abend wanderte ich zum Schlafen nicht auf den Dachboden, denn ich wollte erfahren, wo Catharina das Raufen gelernt hatte. Bis spät in die Nacht hinein erzählte sie mir von früher, von ihren Kämpfen mit den Freiburger Gassenbuben, von ihrem Vater und seiner wunderbaren Werkstatt, und von dieser grässlichen Frau mit ihren beiden Söhnen, die Catharina alles, was ihr wichtig war, weggenommen hatte.
2
Schon bald galten die beiden Mädchen im Dorf als unzertrennlich. Catharina empfand längst keinen Neid mehr auf die bewundernden Blicke der Männerwelt, die Lene auf sich zog. Mit ihrem hübschen Gesicht, den braunen Augen und dunklen Brauen, die in reizvollem Kontrast zu den langen blonden Haaren standen, war ihre Base zweifellos das schönste Mädchen der Gegend. Lene selbst hatte für diese Gunst nur Spott übrig, und wenn die Burschen im Dorf ihnen gegenüber zu aufdringlich oder zu frech wurden, halfen sie sich nun gegenseitig. Wo Lene ein frecheres Mundwerk hatte, war Catharina die Stärkere von beiden.
Einmal, zweimal die Woche machte sich Catharina auf den Weg in ihr Elternhaus, aber es geschah immer widerwilliger. Sie wusste, wie wichtig ihrem Vater diese Besuche waren, doch sie spürte bei jedem Wiedersehen deutlicher, wie viel Argwohn, ja Feindseligkeit ihr seitens Hiltrud und ihrem ältesten Sohn entgegenschlug und, was noch viel schmerzhafter war, dass es zwischen ihrem Vater und ihr nie wieder so sein würde wie früher. Hinzu kam, dass sie jedes Mal, wenn sie die Schwelle des Hauses überschritt, ein Gefühl von Beklemmung ergriff, von unbestimmter Angst. Bis schließlich, an einem schwülen Morgen Anfang Juli, diese Vorahnung Wirklichkeit wurde.
Ausnahmsweise hatte Catharina bei ihrem Vater übernachtet. Die Nacht hatte die stickige Hitze und den Gestank, der seit Tagen über der Stadt lag, nicht vertreiben können, und die Menschen waren gereizt und fanden keinen Schlaf. Als Catharina im Morgengrauen schweißnass die Küche betrat, um sich einen Becher Wasser zu holen, prallte sie im Halbdunkel mit ihrem Stiefbruder zusammen. Sie unterdrückte einen Schrei.
«Nicht so schreckhaft, meine Hübsche.» Johann hielt sie am Arm fest. «Du kannst also auch nicht schlafen.»
Sie schüttelte ihn ab und trat ein paar Schritte zurück. «Lass mich in Ruhe.»
Seine aschblonden Haare standen wirr vom Kopf, auf seiner kurzen, stumpfen Nase glänzten Schweißtropfen. Plötzlich wurde ihr bewusst, dass sie nur ein kurzes Leibchen trug, und sie kam sich unter seinem stieren Blick ganz nackt vor.
In diesem Moment riss er sie an sich. «Führ dich bloß nicht so stolz auf, du – du Zigeunerbalg. Jeder hier weiß doch, dass deine Mutter eine Zigeunerin war. Du wirst schon sehen, wo du endest.»
Sein Atem ging schneller, wurde zu einem grunzenden Stöhnen. Wie ein Schraubstock hielt er sie umklammert und versuchte, sie auf den Mund zu küssen.
Catharina wusste nicht, woher sie auf einmal ihre Kraft nahm. Sie drehte und wand sich, bis sie seinen kräftigen Armen entkommen war, und schlug ihm dann mit voller Wucht ins Gesicht. Aus seiner Nase lief ein dünner Streifen Blut.
«Das wirst du mir büßen», brüllte er.
Catharina lief zur Kommode, riss hastig ihre Kleider heraus und zog sich an. Sie würde keinen Moment länger hier bleiben.
Der Vater stand hinter ihr, als sie fertig zum Gehen war. «Was war los?»
«Johann – dieser Hundsfott …» Unter Schluchzen berichtete sie, wie sich ihr Stiefbruder ihr genähert hatte.
«Ich will nie wieder hierher kommen – nie wieder.»
Das Gesicht ihres Vaters wirkte hilfloser denn je.
«Das darfst du nicht sagen, Cathi. Ich verspreche dir, ich rede mit Johann. Der Junge muss aus dem Haus, ich werde ihm einen Lehrherrn suchen.»
Hiltrud warf ihrer Stieftochter einen höhnischen Blick zu, als Catharina sich wortlos an ihr vorbeidrückte und die Haustür aufstieß.
«Stell dich nicht an wie ein adliges Fräulein», rief sie ihr nach. «Was hat er schon getan? Junger Most muss sausen und verbrausen.»
Catharina beruhigte sich erst, als sie die Landstraße erreichte. Wieso ließ ihr Vater das zu? Und wieso sagten die Leute, dass ihre Mutter eine Zigeunerin sei? Sie wusste, dass es hier am Oberrhein viele Leute gab, die so dunkel waren wie sie. Ihr Vater hatte das einmal damit erklärt, dass der Rhein ein uralter Handelsweg sei, auf dem bis heute Menschen aus den südlichen Ländern kamen, um Handel zu treiben oder im Norden ihr Glück zu versuchen, und manche hätten sich dann hier in der Gegend niedergelassen. Sie war sich nie fremd vorgekommen mit ihren glänzenden schwarzen Haaren und dunklen Augen, im Gegenteil, sie war stolz darauf, dass sie in dieser Hinsicht ihrer Mutter glich.
Jedes Mal, wenn ein Fuhrwerk den Weg entlangkam, wirbelte es Staub von der trockenen Straße, der sich auf ihre verschwitzte Haut legte. Es hatte seit Wochen nicht mehr geregnet, und heute schien es, als würde sich die Hitze aller vergangenen Tage zusammenballen. Der Himmel war wie Blei, Blätter und Grasspitzen regten sich nicht. Selbst die Vögel und Grillen blieben stumm.
Plötzlich raschelte es am Wegrand. Catharina glaubte, ihr Herz müsse aufhören zu schlagen: Unter der Linde, an das Bischofskreuz gelehnt, kauerte ein feuerroter Zwerg. Er streckte ihr eine zitternde knochige Hand entgegen. Sie wollte losrennen, aber wie unter einem Bann blieb sie vor dem winzigen Greis stehen. Er trug einen leuchtend roten Umhang mit Kapuze, seine schmutzigen Beine steckten in zerschlissenen Bundschuhen. Das Entsetzlichste aber war sein Gesicht: Über den blatternarbigen Wangen lagen leere Augenhöhlen, von faltigen Lidern verschlossen.
«Hab keine Angst, junges Ding, und gib mir ein Almosen.» Der Zwerg hatte eine Kinderstimme wie ihre kleinen Vettern.
Wieder wollte Catharina nichts lieber als weglaufen, fragte aber stattdessen fassungslos: «Woher wisst Ihr, dass ich jung bin?»
Der Zwerg wandte sein Gesicht von ihr ab. «Nur weil ich keine Augen mehr habe, heißt das nicht, dass ich nichts sehe.»
Sie schwiegen für einen Moment. Von Westen her hörte man dumpfes Grollen.
«Gib mir einen Pfennig oder eine Kleinigkeit zu essen, und du wirst mehr über dich erfahren, als deine Mutter und dein Vater über dich wissen können.»
Außer ihrem Wäschebündel hatte sie aber nichts dabei, und zudem wollte sie an diesem Tag nicht noch mehr schlimme Dinge zu hören bekommen. Trotzdem – vielleicht konnte ihr diese unheimliche Begegnung nützlich sein.
«Ist es wahr, dass meine Mutter eine Zigeunerin war?»
Der Alte lachte wie eine kranke Ziege. «Ich seh schon, du hast nichts, was du mir geben könntest. Das macht nichts, reich mir deine Hand, damit ich dich fühle. Ja, so ist es gut. Deine Mutter war eine Frau mit einem großen Herzen, die viel zu früh gestorben ist. Du wirst bald so schön sein wie sie. Dann aber wirst du langsam verwelken und vertrocknen an der Seite eines stattlichen Mannes.»
Der Alte ließ ihre Hand los und schwieg. Catharina bat ihn, weiterzusprechen, obwohl sie den Sinn seiner Worte nicht recht verstand. Der Zwerg zögerte.
«Es ist nicht immer gut, alles bis zum Ende zu wissen. Außerdem kann ich mich irren.»
Jetzt war sie erst recht neugierig geworden. Sie bedrängte ihn, bis er zu einer letzten Auskunft bereit war. Sie werde eines Tages neu erwachen und glücklich sein wie in ihren Kindertagen, aber dieses Glück sei bedroht wie trockenes Holz von einer Feuersbrunst.
«Hüte dich vor den Nachbarn», schloss er. Dann sprang er mit einer unerwarteten Behändigkeit auf und tippelte querfeldein davon. Bald sah sie nur noch einen roten Fleck, der hin und wieder einen Sprung nach links oder rechts machte.
An der Abzweigung nach Betzenhausen brach der Himmel mit einem Knall auseinander und vergoss Ströme von warmem Regen über dem ausgedörrten Land. Als Catharina am Gasthaus ankam, war sie nass bis auf die Haut.
Lene hielt ihr die Tür auf: «Komm schnell rein und zieh dich um, du kannst Hemd und Schürze von mir haben.»
Catharina zitterte am ganzen Körper, als sie sich mit dem Tuch, das ihr Lene reichte, trocken rieb.
«Hoffentlich hast du dich nicht erkältet.»
Sie erzählte ihr, was am Morgen geschehen war, das mit Johann und die Begegnung mit dem roten Zwerg.
«Deinen Stiefbruder soll doch der Teufel holen – wenn wir ihn nur mal zu zweit erwischen könnten.»
Doch Catharina war von den geheimnisvollen Worten des alten Mannes inzwischen fast beunruhigter. «Glaubst du an Weissagungen?»
Lene hängte die nassen Kleider über einen Stuhl und überlegte. «Kommt drauf an. Bei der letzten Kirchweih hat mir so eine alte Vettel aus der Hand gelesen. Sie hat viel geredet, auch grausige Dinge. Da hab ich mir einfach nur die schönen Sachen gemerkt.»
«Und was war das?»
Lene kicherte. «Dass sich einmal drei Männer um mich schlagen werden. Und dass ich in einem vornehmen Haus leben werde.»
An diesem Tag gab es viel zu tun. Da es bis zum späten Nachmittag wie aus Kübeln goss, kamen mehr Gäste als sonst, auch ärmere Leute, die sonst ihr Brot am Straßenrand zu sich nahmen und jetzt einen trockenen Ort suchten. Als der letzte Fuhrmann gegangen war, mussten die beiden Gaststuben von Grund auf geputzt werden, da die Dielen voller Schlamm standen. Catharina scheuchte die Hühner hinaus in den Hof und machte sich an die Arbeit.
Beim Abendessen war sie völlig erschöpft.
Marthe reichte ihr die Schüssel. «Nimm dir noch was von dem Hirsebrei, du hast heute viel gearbeitet.»
Aber sie hatte keinen Hunger.
Marthe schaute sie an. «Lene hat mir alles erzählt. Dein Vater wird Johann schon zurechtstutzen, zerbrich dir also nicht den Kopf. Und was den alten Bartholo betrifft, diesen blinden Narren: Der hat zwar keine Augen im Kopf, aber er beobachtet besser als unsereins. Der weiß doch längst, wohin du gehörst und wer du bist. Ein Wahrsager ist er deshalb noch lange nicht.»
Eine Jahreszeit löste die nächste ab. Catharina arbeitete immer häufiger in der Gaststube. Sie bediente nicht nur die Gäste und bekam dabei immer mal ein paar Münzen zugesteckt, sondern kassierte auch meist ab, da sie flink im Kopfrechnen war. Im Sommer half sie beim Garbenbinden und beim Sichelschnitt, bis ihr der Rücken steif wurde. Die Tante selbst besaß außer dem Obstgarten nur wenig Land, gerade so viel, wie sie für das Pferd und die paar Schweine brauchten. Aber hier auf dem Dorf war es üblich, dass man den Nachbarn aushalf.
Catharina wusste bald, wie man butterte und Schnaps brannte, wie man reife Früchte dörrte und Heringe pökelte. Zweimal in der Woche buk sie zusammen mit der Hausmagd Brot. Der alte Lehmofen stand am Rand des Hofes, wo es zu den Obstwiesen hinaus ging. Sie mochte diese Arbeit, denn ihr Vetter war für das Feuer und die richtige Temperatur verantwortlich. Ganz anders als die übrigen Burschen seines Alters sah er in Catharina nicht das Mädchen, mit dem man seine Scherze treiben konnte, sondern suchte in ihr eine Gesprächspartnerin in seiner fast schon besessen zu nennenden Neigung, die Welt zu hinterfragen und den Geheimnissen der Dinge auf den Grund zu gehen. Oft saßen sie mit dem Rücken an die warme Ofenwand gelehnt und sinnierten über die Unendlichkeit des Himmels über ihnen, über die Beschaffenheit der Sterne oder über die Lebenskraft, die in einem winzigen Samenkorn steckte, bis Marthe sie aufscheuchte.
«Ihr seid nicht die hohen Herrschaften vom Gutshof, also los. Der restliche Brotteig muss angesetzt werden, und das Pferd läuft auch nicht von allein zum Schmied.»
Als die Tage kürzer wurden und das Laub der Auwälder in Rot und Gold aufflammte, nahm Christoph sie zum Sammeln von Eicheln für die Schweinemast mit. Er führte sie in den Mooswald. Catharina wusste, dass dies als Auszeichnung anzusehen war, denn das Herumschleichen im Wald der Lehener Herrschaft galt unter den Buben als Mutprobe. Mehr als einmal mussten sie sich in letzter Minute vor den Steinwürfen des aufgebrachten Waldhüters in Sicherheit bringen, außer Atem, Hand in Hand, mit prall gefülltem Beutel.
Lene sah sie tagsüber selten, da ihre Base für die Hausarbeit zuständig war: Sie musste sich um die Zwillinge kümmern und erledigte die Putz- und Flickarbeit, die Catharina verabscheute. Gott sei Dank hatte sie damit nichts zu tun. Abends lagen sie dann im Bett und tratschten wie die Marktweiber. Beinahe über jeden Gast konnte Lene eine Geschichte erzählen, wobei sich Catharina manchmal fragte, ob ihre Base es mit der Wahrheit so genau nahm.
«Stimmt das mit dem Freiherrn von Lehen?», fragte Catharina und zog sich die Bettdecke über die Schultern, als ob sie fröstelte. Sie war dem Gutsherrn einige Male in seinem eleganten Zweispänner begegnet. Die Leute im Dorf fürchteten ihn: Er sei jähzornig und habe oft üble Einfälle, um zu seinem Recht zu kommen.
«Was meinst du?»
«Dass er Mädchen entführt.»
Lene lachte laut auf.
«Mir macht er keine Angst. Ich musste einmal hinübergehen, um ihm einen eingelegten Hasen zu bringen. Da hat er mir übers Haar gestrichen und gesagt, ich sei ein schönes Mädchen. Aber seine Hände haben so gezittert, dass er nicht einmal eine Maus hätte festhalten können. Er ist alt und faltig wie eine getrocknete Zwetschge. Weißt du, was ich glaube? Manche Mädchen gehen freiwillig zu ihm, weil sie denken, wenn er ihnen erst ein Kind gemacht hat, können sie es sich gut gehen lassen.»
Wenn Lene so daherredete, bewunderte Catharina sie und kam sich so viel jünger und einfältiger vor als ihre Base. Vielleicht lag es daran, dass sie keine Geschwister hatte und nur mit ihrem Vater aufgewachsen war, denn sie verstand so wenig von diesen Dingen. Bei ihren ersten Gesprächen tat sie so, als seien ihr Lenes Erklärungen vollkommen einsichtig. Mit wachsender Vertrautheit aber fragte sie nach: Wieso gehen manche Mädchen zum Gutsherrn? Was passiert dann? Wieso ist die Hausmagd neulich so erschrocken, als sie ihr abends im Stall begegnete? Was passiert da drüben beim Schmied, wenn nachts trunkenes Gelächter herüberschallt?
Und Catharina erfuhr nach und nach, dass sich die Vorgänge, die sie von klein auf bei Tieren beobachtet hatte, recht einfach auf die Menschen übertragen ließen. Ein wenig war sie darüber enttäuscht.
Einmal – Catharina war schon fast eingeschlafen – fragte Lene: «Sag mal, kennst du die Spinnstube?»
Catharina schüttelte den Kopf.
«Das ist die Stube beim dicken Müller. Immer von Erntedank an treffen sich dort die ledigen Frauen abends zum Arbeiten. Sie spinnen und stricken und nähen dort den Winter über, um bei sich zu Hause Holz und Licht zu sparen. Dem alten Müller geht es ganz gut dabei, denn Essen und Trinken lässt er sich bezahlen. Und hübsche Mädchen hat er auch um sich.»
«Woher haben die Mädchen das Geld, Essen und Trinken zu bezahlen?»
Lene lachte.
«Das bezahlen doch nicht die Mädchen. Am späten Abend kommen die Burschen aus dem Dorf und singen und trinken mit ihnen. Und nicht nur das. Komm, ich zeig’s dir.»
Catharina verspürte wenig Lust, aus dem warmen Bett aufzustehen, aber wie immer siegte ihre Neugier. Sie zogen sich schnell an. Da in der Küche Marthe und Christoph über den Haushaltsbüchern saßen, mussten sie aus dem Fenster steigen. Leise schlichen sie durch den Obstgarten, überquerten die Landstraße und gingen am Dorfbach entlang bis zum Müller’schen Hof. Im Erdgeschoss waren die Läden verschlossen.
«Wir müssen in den Hinterhof, da ist ein Fenster offen.»
Sie kletterten eine Mauer hoch. Unter ihnen funkelten die Augen eines zottigen Hundes, der sie anknurrte.
«Das ist Michel, der kennt mich», flüsterte Lene, sprang in den Hof und tätschelte dem Hund den Kopf.
Aus dem Fenster drang lautes Singen und Lachen. Sie blickten in einen großen Saal, von ein paar Öllampen eher spärlich erleuchtet. Auf den ersten Blick war kaum zu erkennen, wer die Burschen, wer die Mädchen waren, denn alle saßen oder standen dicht beieinander. Da begannen Fidel und Sackpfeife aufzuspielen, mehr laut als melodisch, und sofort hatten sich zahlreiche Paare gefunden und wirbelten in schnellem Rhythmus im Kreis, dass die Röcke nur so flogen.
Lene stieß sie an. «Schau mal, da in der Ecke, die dicke Ursel, die Tochter vom Sattler.»
Auf Ursels Schoß saß ein Mann, den Catharina nur vom Sehen kannte. Er hatte eine Hand in ihr offenes Leibchen geschoben, mit der anderen hielt er einen Krug Bier an ihre Lippen. Dann küsste er sie. Daneben hockte der Metzgerlehrling mit dem Kopf auf der Tischplatte, offensichtlich völlig betrunken, und ein Mädchen goss ihm Wasser oder Wein über den Kragen.
Catharina stand wie gebannt. Da schien das halbe Dorf zusammengekommen zu sein. Fast gleichzeitig entdeckten sie ihre Hausmagd. Laut singend saß sie auf einem Tisch, vor ihr kniete ein Mann, den sie nicht erkennen konnten, da er seinen Kopf unter ihren weiten Rock geschoben hatte, und neben ihr stand der älteste Sohn ihres Nachbarn und versuchte, ihr Ohr zu küssen. Nur wenige Mädchen hatten noch ihr Näh- und Flickzeug vor sich liegen. Hin und wieder kam der alte Müller, brachte frisches Bier und klatschte einem Mädchen auf den Hintern.
«Los, ich zeig dir noch was. Hinter der Mühle liegen die Paare nur so aufeinander herum.»
Aber Catharina hatte genug, sie fror und war müde. Auf dem Heimweg fragte sie, ob Christoph auch schon in der Spinnstube gewesen sei. Lene konnte das zwar nicht mit Sicherheit verneinen, aber sie glaubte es nicht. Ihr Bruder habe mit solchen Sachen wohl nicht viel im Sinn. Catharina freute sich über diese Antwort. Zu albern war ihr das Treiben im Müllerhaus vorgekommen.
Seit jenem Zusammenstoß mit ihrem Stiefbruder Johann hatte Catharina keine einzige Nacht mehr in ihrem Elternhaus verbracht. Ihre Besuche wurden noch seltener und kürzer. Zwar hatte ihr Vater, wie versprochen, am selben Abend mit Johann geredet, und Hiltrud und er waren übereingekommen, ihn auf die städtische Lateinschule zu schicken – Catharina wusste, dass Hiltrud ihren Ältesten für sehr begabt hielt und sich daher weigerte, ihn in die Lehre zu geben –, aber das war wohl gerade das Falsche gewesen. Johann kam nun nächtelang nicht heim, trieb sich, was für Schüler streng verboten war, in Schenken herum, und wenn er zu Hause war, sprach er mit niemandem ein Wort oder war betrunken. Catharina wurde zufällig Zeuge, als eines Tages der Schulmeister ins Haus ihres Vaters platzte und klagte, dass der Junge für seine Schule nicht mehr tragbar sei, er habe einen sehr schlechten Einfluss auf die anderen Schüler.
«Er hat keine Disziplin und keine Moral. Davon abgesehen ist er, verzeiht, wenn ich das so offen sage, auch nicht gerade der Hellste. Der gute alte Donatus, der einfachste aller Grammatiker, scheint ihm Chinesisch rückwärts zu sein. Ich verwette meinen Talar, dass Euer Sohn nicht einmal die Quarta schafft!»
Hiltrud verteidigte ihren Sohn und warf dem Schulmeister vor, dass er sich für das hohe Schulgeld, das sie bezahle, ganz offensichtlich nicht genug Mühe gebe. Sie einigten sich schließlich, nachdem ihm Hiltrud ein paar Gulden monatlich «ganz zu seiner eigenen Verfügung» versprochen hatte. An Johanns Verhalten änderte das selbstredend keinen Deut. Catharina war es vollkommen einerlei, was aus Johann wurde, ihr einziges Bestreben war, ihm aus dem Weg zu gehen. Fast hatte sie vergessen, dass er im Hause ihres Vaters wohnte, als er ihr an einem nebligen Herbstnachmittag auflauerte.
Sie war mit Lene in der Stadt gewesen, um Salz und Gewürze zu kaufen, und hatte anschließend noch bei ihrem Vater vorbeigesehen. Es war spät geworden, die Tore würden bald schließen, und Lene wartete sicher schon ungeduldig am Fischbrunnen auf sie. Eilig überquerte Catharina den Gewerbekanal vor ihrem Elternhaus, als sich aus dem düsteren Gemäuer des Augustinerklosters eine Gestalt löste und ihr den Weg versperrte.
«Aha, mein Schwesterchen hat uns wieder besucht. Wie schade, dass ich nicht zu Hause war.»
Ein Grinsen breitete sich auf Johanns Gesicht aus, als Catharina ängstlich zurückwich. Breitbeinig folgte er ihr, die Arme auf ihren Hüften, sein Atem stank nach Schnaps. Als eine Gruppe Mönche aus dem Tor trat, ließ er von ihr ab.
«Eines Tages packe ich dich, dass dir Hören und Sehen vergeht», zischte er und spuckte vor ihr aus. Dann ging er mit schwankenden Schritten nach Hause. Catharinas Knie zitterten. In diesem Moment hätte sie alles darum gegeben, Johann für immer aus ihrem Leben zu verbannen.
Natürlich stammte dieser dumme Einfall mit dem Verwünschen von mir, eine alberne Kinderei, von der ich nie gedacht hätte, dass Catharina sie ernst nehmen würde. Ich möchte schwören, dass sie sich vorher und nachher nie wieder mit schwarzer Magie beschäftigt hat, genauso wenig wie ich, doch ich suchte irgendetwas, um sie von ihren Ängsten abzulenken. Denn seit dieser Begegnung mit Johann schlief sie nachts schlecht, hatte Albträume, ihre ganze Fröhlichkeit und Neugier waren auf einmal verschwunden.
«Du musst deinen Stiefbruder verwünschen.»
Dieser Satz rutschte mir also eines Abends, nachdem wir das Licht gelöscht hatten, einfach so über die Lippen. Erst an ihrem stockenden Atem, daran, dass ihre Hand auf meinem Arm plötzlich eiskalt wurde, bemerkte ich, wie ernsthaft sie dieser Vorschlag traf.
«Was muss ich dafür tun?», flüsterte sie.
Ich hatte zwar von zahlreichen magischen Zaubern gehört, kannte zur Genüge die Prahlereien der Dorfjungen, wenn sie sich damit brüsteten, um Mitternacht unter dem Galgen nach den kostbaren Alraunwurzeln zu graben, diesen Wurzeln, die sich angeblich aus Schweiß, Urin und Samen der Gehenkten bildeten und ihrem Besitzer unermessliche Kräfte verhießen. Beim Ausreißen musste man mit List vorgehen, denn die Alraune schrie dabei wie ein Mensch vor Schmerz und konnte den Gräber damit in Wahnsinn und Tod treiben. Dieser Gefahr entging man am besten mit einem schwarzen Hund, dem man die freigelegte Wurzel an den Schwanz band und ihn dazu trieb, sie herauszuziehen. Anschließend musste dieser Hund zwar eines elenden Todes sterben, dafür blieb man selbst unversehrt.
Dies alles war mir zwar wohl vertraut, doch selber hatte ich solche Rituale noch nie angewandt – davon abgesehen, dass ich diese Dinge eher lächerlich fand. Doch ich wollte mir in diesem Moment keine Blöße geben, außerdem freute ich mich, dass Catharina meinen Rat brauchte, denn es kränkte mich, wie innig das Verhältnis zwischen ihr und Christoph geworden war – gerade so, als sei ich nicht mehr wichtig. Du musst wissen, Marthe-Marie, dass ich Christoph fast abgöttisch liebte, auch wenn er nur mein Halbbruder war, und ich konnte kaum mit ansehen, mit wie viel Aufmerksamkeit er Catharina bedachte.
Nun gut – ich holte tief Luft und sagte: «Es ist ganz einfach. Du denkst drei Abende hintereinander beim Einschlafen an nichts anderes, als dass Johann ersticken, ersaufen oder vom Blitz getroffen werden soll oder was weiß ich. Du musst es aber mit aller Inbrunst tun. Dann stehst du jedes Mal vor Sonnenaufgang auf und begräbst ein totes Tier. Ich verspreche dir, du siehst den Kerl danach nie wieder.»
Catharina wollte mit solcher Zauberei nichts zu tun haben. Doch sie kam nicht dagegen an, dass der Gedanke, es wenigstens zu versuchen, mehr und mehr von ihr Besitz ergriff. Ein unüberwindliches Hindernis schien ihr allerdings das Ritual mit den toten Tieren, denn sie konnte keiner Maus etwas zuleide tun. Am nächsten Tag klaubte sie eine der vielen Spinnen, die vor dem nasskalten Herbst in die Häuser flüchteten, aus ihrem Bett, setzte das Tier auf den Boden und zermalmte es mit großem Widerwillen mit ihrem Holzschuh. Anschließend machte sie sich auf die Suche nach zwei weiteren Opfern.
Als sie gerade die dritte Spinne in der Küche zertrat, wurde sie von Marthe überrascht.
«Was machst du da?»
Catharina bekam einen roten Kopf. Vor kurzem erst hatte ihre Tante erklärt, dass Spinnen nützliche Tiere seien und dass das Gerede, sie würden Unglück bringen, dummes Geschwätz sei.
Kopfschüttelnd kehrte Marthe das zerquetschte Tier in den Hof. Stunden später, als sich Catharina unbeobachtet fühlte, las sie es auf und legte es zu den beiden anderen in ein Kästchen. Für das weitere Vorgehen bot ihr Lene bereitwillig Hilfe an. Nachdem die anderen zu Bett gegangen waren, setzten sie sich auf den nackten Boden und entzündeten ein Talglicht. Sie kamen überein, dass Johann von Räubern entführt werden sollte. Lene flüsterte ein paar unverständliche, düster klingende Worte, die Catharina nachsprechen musste, dann schwenkte sie das Licht in die vier Himmelsrichtungen.
Vor Aufregung blieb Catharina wach, bis sich der Himmel im Osten grau verfärbte. Dann stand sie auf, nahm das Kästchen mit den toten Spinnen und schlich in den Obstgarten. Es war kalt, und ein stürmischer Wind riss das Laub von den Bäumen. Zitternd ging sie hinüber zum Kräuterbeet, wo die Erde am lockersten war. Nachdem sie die erste Spinne begraben hatte, bekreuzigte sie sich, obwohl sie nicht so recht wusste, ob das helfen oder schaden würde. In der folgenden Nacht tauchte eine Schwierigkeit auf, mit der sie nicht gerechnet hatte: Sie wachte erst am späten Morgen auf, als die Hausmagd an die Tür klopfte. Wenn sie auf irgendeinen Erfolg hoffen wollte, würde sie die nächsten beiden Nächte wach bleiben müssen.
Bis auf Lene wunderten sich alle, wie müde und unaufmerksam Catharina in den nächsten Tagen ihre Arbeit verrichtete. Catharina war heilfroh, als das Unternehmen vollbracht war. Außerdem glaubte sie gar nicht so recht an das Gelingen ihrer Verwünschung, da sie ja eine Nacht verschlafen hatte. Und es geschah auch erst einmal gar nichts. Wahrscheinlich hatte ihr Vater Recht, wenn er sämtliche Gerüchte über Magie mit der Bemerkung «Wunder verrichtet nur der liebe Gott» ins Reich der Lügen verwies.
Mittlerweile war es November geworden. Johann war nun endgültig aus der Lateinschule ausgeschlossen worden, da hatten Hiltruds sämtliche Überredungskünste nichts genutzt. Nun lungerte er von morgens bis abends in den Gassen herum, beleidigte ehrbare Bürger oder zettelte Raufereien mit anderen Burschen an. Catharina wagte sich ohne Lene nicht mehr in die Stadt.
Es war die Zeit des Schweineschlachtens. Die Freiburger Metzger machten ihre Runde durch die Dörfer und boten ihre blutigen Dienste an. An jenem Morgen erwachte Catharina von gellenden Schreien, die nicht enden wollten. Sie presste sich die Hände gegen die Ohren, zog die Decke über den Kopf, doch es war vergeblich. Widerstrebend stand sie auf und kleidete sich an. Es war sicher schon spät. Marthe hatte sie schlafen lassen, weil es gestern in der Gaststube spät geworden war. Und sicher auch, weil Catharina beim Schlachten nicht gern dabei war.
Die beiden Schweine hingen an den Hinterläufen vom Vordach des Stalls, mit heraushängender Zunge, den Bauch weit geöffnet. Christoph und der Lehrbub des Metzgers schütteten den Zuber mit dem heißen Wasser aus, während Marthe mit dem Meister die ausgenommenen Tiere begutachtete. Catharina betrat die Küche. Vor einem riesigen Kessel dampfender Blutsuppe stand Lene und rührte, damit das Blut nicht zu gerinnen begann.
«Na endlich. Mach mal weiter, mir fällt gleich der Arm ab.»
Catharina nahm den schweren Holzlöffel. Angewidert von dem süßlichen Geruch drehte sie den Kopf zur Seite. Lene richtete unterdessen kräftiges Graubrot, Speck und Käse als Morgenmahl her. Für die Männer füllte sie Bier in Krüge. Dabei trank sie selbst genüsslich ein paar Schlucke.
Marthes kräftige Gestalt erschien in der Küchentür.
«Ist alles gerichtet? Die Männer haben Hunger.» Ihr Blick fiel auf Catharina. «Ach, Cathi, weißt du übrigens, was mir der Metzger eben erzählt hat? Johann ist seit drei Tagen spurlos verschwunden.»
«Ist das wahr?» Catharina wurde bleich. Lene versetzte ihr einen Tritt gegen das Schienbein.
«Siehst du, was hab ich dir gesagt!», rief sie, als sie wieder allein waren. «Du hast es geschafft! Jetzt hockt dieses Scheusal hungernd und frierend in einer Höhle und wartet darauf, dass ihm die Räuber den Kopf abschlagen.»
«Hör auf, so zu reden.» Catharina umklammerte den Holzlöffel, als müsse sie sich daran festhalten. Ihr war alles andere als wohl bei dem Gedanken, dass Johann etwas zugestoßen sein könnte.
Sie versuchte, nicht mehr an ihren Stiefbruder zu denken. Doch als er nach zehn Tagen immer noch nicht aufgetaucht war, war sie sich seines Todes so gut wie sicher. Irgendwann würde seine Leiche gefunden werden – und was sollte sie dann dem Vater sagen? Dass sie schuld war an Johanns Tod? War das, was sie getan hatte, Mord?
Die Geschichte der Besenmacherin Anna Schweizerin aus der Wolfshöhle kam ihr in den Sinn. Sie sei dem Teufel verfallen gewesen, sagten die Leute, und habe mit ihrer Hexenkunst, Hagel zu sieden, etliche Bürger und Bauern geschädigt. So sei es nur rechtens gewesen, dass man sie bei lebendigem Leib verbrannt hatte.
Wieso bloß hatte sie auf Lene gehört?
Catharina hatte sich tatsächlich eingebildet, sie habe Johann mit ihren magischen Kräften umgebracht. Zwei Tage lag sie nervenkrank und mit hohem Fieber im Bett, von Albträumen geplagt, bis schließlich die Nachricht kam, Johann stecke in Straßburg.
Herr im Himmel, verzeih mir – aber wäre dieser Kerl nur schon damals verreckt. Das hätte Catharina und mir so vieles erspart.
3
Ganz plötzlich wurde es Winter. Eine Woche vor Weihnachten wachte Catharina auf und wusste sofort, dass es geschneit hatte. Es war, als ob sie den Schnee riechen konnte. Die Geräusche von draußen klangen gedämpft.
Sie sprang aus dem Bett und lief zum Fenster. Im Licht der Morgendämmerung schimmerte der Schnee violett.
«Lene, es hat geschneit!» Sie rüttelte Lene an der Schulter.
«Na und? Das kommt vor im Winter.» Unwillig verkroch sich Lene noch tiefer unter der Decke.
In der Küche saßen Marthe und Christoph beim Morgenmahl. Christoph füllte ihr einen Teller mit heißer Milchsuppe.
«Hilfst du mir beim Schneeschippen?»
«Gern.»
Die Wollmütze tief ins Gesicht gezogen, trat sie aus dem Haus. Es war eiskalt, und der Schnee knirschte trocken unter ihren Schritten. Wie konnte in einer Nacht nur so viel Schnee fallen!
Als die Sonne über den Schwarzwald stieg, wurde das fahle Blau des Himmels kräftiger, und die weiße Landschaft begann zu glitzern. Nachdem sie den Hof freigeschaufelt hatten, lachte Christoph sie an.
«Die roten Wangen stehen dir gut. Du siehst richtig hübsch aus.»
Sie wandte ihr Gesicht ab. Seit einiger Zeit machten seine Bemerkungen sie sofort verlegen.
Da trat eine vermummte Gestalt durch das Hoftor. Zu ihrem Erstaunen erkannte sie ihren Vater.
«Guten Morgen, ihr beiden.» Er klopfte sich den Schnee von den Stiefeln. «Kommt ihr mit hinein? Ich habe etwas zu besprechen.»
Gemeinsam gingen sie zu Marthe in die Küche. Hieronymus holte tief Luft.
«Hiltrud und ich sind übereingekommen, dass wir euch für Heiligabend einladen möchten.» Er warf einen Seitenblick auf Catharina. «Johann will in Straßburg bleiben, und so könnten wir gemütlich feiern und wären alle mal wieder beisammen.»
Catharina fragte sich, wie viel Überredungskunst ihn Hiltruds Einwilligung wohl gekostet haben mochte.
«Das ist schön, Hieronymus.» Marthe strich sich die Schürze glatt. «Aber ich muss die Wirtschaft führen, wir können es uns an so einem Tag nicht leisten, zu schließen.»
«Geh du nur, Mutter», sagte Christoph. «Ich übernehme das schon.»
Als Catharina ihren Vater zur Tür brachte, griff Hieronymus nach ihrer Hand und hielt sie so fest, dass es schmerzte.
«Cathi, glaub mir bitte, ich habe das so nicht gewollt. Du darfst nicht meinen, dass ich dich aus deinem Elternhaus verstoßen habe. Oft denke ich, dass deine Mutter traurig wäre, wenn sie das alles wüsste.»
Catharina nickte nur und gab ihm einen flüchtigen Kuss auf die Wange. Das hätte er sich früher überlegen können.
Sie hatten sich festlich herausgeputzt. Die Tante trug ein hochgeschlossenes Kleid aus grauem Tuch mit einer kleinen weißen Krause um den Hals, die Haare unter einer bestickten Haube verborgen, und die beiden Mädchen dunkelgrüne Kattunkleider und Kopftücher. Die Zwillinge Wilhelm und Carl hatten sich zu diesem Anlass sogar das struppige Haar schneiden lassen.
Zur Begrüßung schenkte ihnen der Vater heißen Rotwein ein. Nachdem Hiltrud endlich erschienen war – «Samt aus Flandern», erklärte sie, als sie ihr neues Kleid vorführte –, zogen sie bei einbrechender Dunkelheit zum Münsterplatz, um die Messe zu besuchen. Vor dem Hauptportal drängte sich im Schein der Pechfackeln eine dichte Menschenmenge.
Catharina entdeckte ihre alte Lehrerin, die sie herzlich begrüßte.