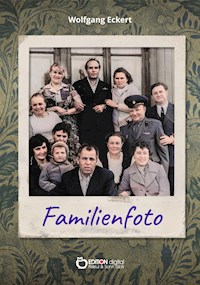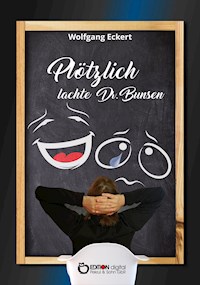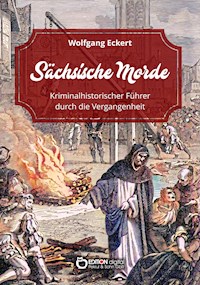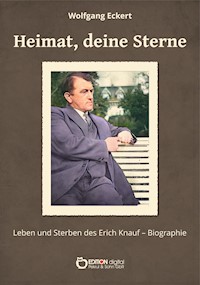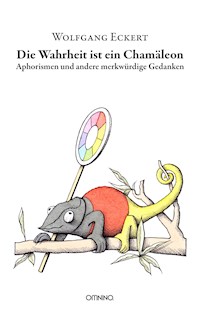7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Diesem Buch ist ein Zitat von Albert Einstein vorangestellt: Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Trotzdem aber erzählt der Autor von einem unglücklichen Kind. Sein Name ist Franz, Franz Weidauer. Und wer ein anderes Buch von Wolfgang Eckert kennt, der kennt auch diesen Familiennamen. Franz ist der Enkel von Matthias und Lu, die wir aus dem „Familienfoto“ kennen. Der Junge wusste nicht, dass er ein Junge ist. Er wusste überhaupt noch nichts. Vielleicht ist das die beste Zeit in einem Menschenleben: Noch nichts zu wissen. Er lag frisch gewindelt unter einer himmelblauen Zudecke. Nur sein kleiner rötlicher Kopf ragte daraus hervor. Ein paar verschwitzte schwarze Härchen standen davon ab wie der Flaum eines noch nicht flüggen Sperlings. An den Seiten liefen spitze Kotletten zu den Bäckchen, als hätte sich ein Friseur schon an ihm zu schaffen gemacht. Wenn er die noch ganz hellblauen Augen öffnete, war kein Glanz darin. Betrachter rätselten, ob sie schon von ihm gesehen werden, weil er manchmal lächelte. Experten behaupten, da bilde sich das Hirn. Aber seine Eltern dachten eitel, ihr Anblick rufe bereits Freude bei ihm hervor. Wenn er frei lag, zappelten seine Ärmchen und Beinchen ruckartig wie die Beine eines auf dem Rücken liegenden Käfers. Dann hörte er zum wiederholten Mal eine dunkle Stimme in seiner Nähe, spürte eine sanfte Berührung und hielt sofort auf zu zappeln. Er wurde hochgenommen, gegen etwas Weiches und doch zugleich Pralles gedrückt und seine Lippen begannen zu schmatzen. Er saugte eine warme süßliche Flüssigkeit in sich hinein ohne dabei jemals eine Anleitung bekommen zu haben. Er war unersättlich. Aber schließlich ließ er erschöpft davon ab. Jemand klopfte ihm behutsam auf dem Rücken herum, bis er ein lautes Prösterchen von sich gab, das ihm viel später in der Öffentlichkeit vorgetragen, als unhöflich ausgelegt werden wird. Am Ende lag er wieder unter der hellblauen Decke und schlief sich eine weitere Stunde seines noch sehr kurzen Lebens ab. Er hieß übrigens Franz. Aber selbst, wenn sein Name gerufen wurde, begriff er nicht, er sei gemeint. Wie gesagt, er wusste noch nichts und war deshalb in einem glücklichen Zustand. Jetzt aber ist der Fünfzehnjährige spurlos verschwunden. Eine Vermisstenanzeige wird aufgegeben. Sogar ein Polizeihubschrauber wird zur Suche eingesetzt. Was war passiert? Auf jeden Fall hat sein Verschwinden eine lange, traurige Vorgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 442
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Eckert
DER KINDERBAUM
Roman
ISBN 978-3-96521-810-9 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 2015 im Ingo Koch Verlag Rostock
2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt.
Albert Einstein
Prolog
In dieser Geschichte begegnen wir dem Jungen
bereits vor seiner Geburt.
Wir wissen von ihm schon eher.
Er weiß zum Glück
noch nichts von uns.
Er wird anfangs auftauchen
wie ein Blinkzeichen.
Wir alle sind nur Blinkzeichen
in dieser Welt.
Vielleicht war seine Seele schon immer da.
Und er kam zur Welt,
um sie zu finden.
Er kannte weder Schuld noch Unschuld.
Er war wie alle Kinder
auf uns Erwachsene angewiesen.
Was wir denken, glaubte er, sagen wir auch.
Er lachte ohne Absicht.
Dass es auch ein absichtliches Lachen gibt,
wusste er nicht.
Und so wuchs er ohne Argwohn in eine Welt
aus Wahrheit und Lügen
und wurde allmählich verkrümmt
durch eine Vorgehensweise,
die wir Erziehung nennen.
I. TEIL
1. Kapitel
Die Stadt hätte einen Wettbewerb um ein bemerkenswertes Denkmal mit Sicherheit verloren. Sie hieß Narem. Rückwärts gelesen wäre sie ein beliebtes italienisches Touristenziel geworden. Sie hatte zwar eine italienische Treppe. Doch das half ihr nichts. So kommt die Stadt Narem unter tausend anderen Städtenamen überhaupt nicht in Erwähnung. Sie lag flach und wie kraftlos zwischen einzelnen Waldungen, die als Anhöhen bezeichnet, hochstaplerisch gewesen wäre. Ab und zu verschwand ein Linienbus aus dem benachbarten Gluchow im Bauch der Stadt, und es stiegen ein paar Leute aus zum Einkauf oder sie kamen zurück, weil sie geglaubt hatten, in Gluchow kaufe es sich besser ein. Immer ist der Mensch sein Verfolger. Auf dem Wunderlich-Platz schoben andere aus dem Simmel-Markt Einkaufswagen zu ihren parkenden Autos und blickten so liebevoll in die aufgehäuften Waren, als fahren sie kleine Kinder aus. Auf dem Markt boten Händler in ihren Ständen Backwaren, Fisch, Gemüse, Ziegenkäse, Musikkassetten und Mützen an. Hüte schon gar keine. Obwohl es in dieser Zeit besser gewesen wäre, gut behütet zu sein. Im Zeitungsständer vor der Tabakbörse grellte auf einer bunten Zeitung werbeclever der Titel „LEICHE WAR NOCH GUT ERHALTEN!“ als gäbe das allen Grund, optimistisch über ihren Gesundheitszustand zu sein. An diesem Tag ähnelte Narem in der Gegend des Marktes einem Großstadtzentrum. Es gab kaum noch Parkplätze. Autos fuhren langsam an den die Straße überquerenden Passanten vorbei. Auffallend viele ältere Naremer bevölkerten die Straßen. Man hätte glauben können, es gibt hier gar keine Jugendlichen. Auf den Gesichtern war eine freudige Erregung. Die Falten schienen geglättet. Es war die geheime Macht des Geldes, die da leuchtete und ausnahmsweise auch einmal die kleinen Leute befallen hatte. In ihren Börsen war der Euro vorübergehend gestiegen. Die rechten Seiten ihrer Kontoauszüge wiesen nach einer unendlichen sich stetig steigenden Abzocke von Minuszeichen plötzlich wie ein Blitz in der Nacht ein Pluszeichen auf: Die Rentenauszahlung. Von Monatsanfang zu Monatsanfang verbrauchten die Renten sich immer schneller ohne dass die täglichen Käufe gestiegen waren. Leise schlich sich die Altersarmut durch die Hintertür ein, beinahe schmerzlos. Sie kam nicht wie ein Absturz, sondern wie ein sanfter Gleitflug.
Sonst hatte die Stadt nichts weiter Aufregendes zu bieten. Ein altes Rathaus mit kleinem Heimatmuseum, das mit der neu getünchten Hauswand so aussah, als wollte es sein Alter verheimlichen. Schräg gegenüber fielen die zwei metallischen Kunstwerke eines hier ansässigen Bildhauers auf. Eine schmale silbrig glänzende Säule, an deren Ende mit Fantasie eine Frau im wehenden Gewand zu sehen war. Aber die Naremer mit ihrem lokalen Humor nannten das Gebilde Spargelstecher. Dann die metallische Darstellung eines Leinwandgewebes wie schwebend und leicht fallend dem Betrachter zugewandt, als müsse den Stoff ein Warenschauer nach Fehlern begutachten. Die stählernen Fäden verflochten sich ineinander und sollten an die einstigen, hier bestanden habenden Webereien erinnern. Doch die Jugendlichen, welche es durchaus in der Stadt gab, hatten keinerlei Erinnerung daran. Viele der alten Werkruinen waren längst abgerissen und das rhythmische Schlagen ihrer Webstühle eine verklungene Melodie.
Dann gab es hier noch eine Stadtbibliothek, die sich rührig bemühte, die Naremer zu ermuntern, das Lesen nicht zu verlernen. Als Konkurrenz gegenüber eine Buchhandlung und ein Kunsthaus mit Galerie. In dem Kunsthaus wurde an die hier geborenen Stadtsöhne, den Schauspieler Ralph Arthur Roberts, den Komponisten Werner Bochmann und den Schriftsteller Erich Knauf in einer mäßig besuchten Dauerausstellung erinnert. Aber diese Persönlichkeiten hatten schon als Kind oder Jüngling die Stadt für immer verlassen und dienten ihr nur noch als schmückende Beigabe. Manch einer der Naremer wusste gar nichts von Bochmann und Roberts und schon gar nicht, was Knauf widerfahren war. Den hatten die Nazis 1944 hingerichtet. Aber das war ja schon unendlich lange her. An der Vorderfassade des Kunsthauses prangte warnend Schillers Ausspruch: Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit. Doch es lebten auch welche in der Stadt, die bei dem Namen Schiller eher an Schillerlocken dachten und welche, die es als eine Kunst ansahen, die so genannte überkommene Freiheit auch als eine solche zu empfinden. Viele leere Geschäfte gab es hier aus Mangel an Umsätzen, wegen zu hoher Ladenmiete oder weil die Kaufhausketten sie wie Staubsauger in sich hineingesogen hatten. In den ausgeräumten Schaufenstern boten sie sich zum Verkauf an. Das sinnlos gewordene Postgebäude blieb bisher vom Abriss unversehrt, dem Bahnhof drohte der Abriss im Schatten der stolzen Deutschen Bahn. Einige Apotheken machten Gewinn bringende Geschäfte an den Kranken. Kein Apotheker rief deshalb seinen Kunden nach: Bleiben Sie schön gesund! In einer Zeit, wo von Aufschwung und überwundener Krise gesprochen wurde, diagnostizierten Neurologen häufiger Depressionen und in Mode gekommene Burn-Outs, die sich wie Verkaufsknüller anhörten. Eine Kirche besaß die Stadt natürlich auch mit einem kaum über die Dächer ragenden Turm, so, dass man ihn nicht den Zeigefinger Gottes nennen konnte. Zur Wendezeit war die Kirche rappelvoll gewesen von plötzlich gläubig gewordenen Märtyrern. Jetzt versammelte der liebe Gott wieder seine Handvoll Schäfchen. Manchmal schlug bis zu Mittag einsam und wie verloren die Sterbeglocke zum nahen Friedhof hin, was aber die in der Stadt noch herum Laufenden nichts anging, sondern den, der auf seinem letzten Weg zur Grube begleitet wurde. Unterhalb der Kirche wellte die bereits schon erwähnte breite italienische Treppe zum Teichplatz hinunter, wo es statt einer italienischen eine deutsche Eisbar gab und wo einmal im Sommer zu später Stunde und zu gut Englisch ein Open-Air-Konzert stattfand, was einst zu gut deutsch Freiluftveranstaltung hieß. Einmal war der Teichplatz bis zur letzten Ecke mit Stühlen ausgefüllt. Und im Strahl der Scheinwerfer schwelgten die Naremer höchst großstädtisch geworden hinauf zu den Klängen des Orchesters, das auf der Treppe Melodien aus „My fair Lady“ spielte. „Ich hätt getanzt heut Nacht –“
Nein, es war nicht so, dass die Naremer fantasielos in ihren vier Wänden lebten. Aber über ihnen thronte eben kein fürstliches Schloss wie im nahen Gluchow oder Muldenburg, kein romantischer Fluss mit Gondolieres schlängelte sich durch die Stadt, sondern nur ein in Ziegelsteine eingefasstes Rinnsal namens Meerchen, stellenweise zum Glück unterirdisch, aber manchmal freigelegt mit dem Bemühen, das Gefühl für einen Lido zu erwecken. Hinter der Kirche stand als einziges Kleinod das Pfarrhaus mit Fachwerk. Hätte Narem noch hundert solche Häuser gehabt, es hätte sich mittelalterlich nennen können. Hätte, hätte, hätte– Man kann aus einem hundertsechzig Zentimeter kleinen braven Mädchen kein langbeiniges Model machen.
So ist die Stadt nur eine unter vielen ihrer Art mit etwa zwölftausend Seelen oder Unseelen und einem riesigen, den Stadtvätern das Steuersäckel gehörig füllenden und Arbeitsplätze bringenden Gewerbegebiet, das sich getrost Neu-Narem nennen könnte. Einst pflügten hier Bauern und lieferten zur Ernte Korn für das tägliche Brot. Nun brannte sommers die Sonne auf harten Beton und die Bauern saßen auf ihrer Entschädigung wie auf alten Schatztruhen. Neu-Narem klebte wie ein medizinisch verordneter Blutsauger an der Haut Alt-Narems und ödete es innerlich aus mit Werksgebäuden, Autohäusern, Supermärkten, Hotel, Gaststätte, Postannahme, Apotheke und anderen Serviceleistungen. Naremer, die im Crimmitschauer Viertel wohnten, verlernten den Weg in die Stadt. In anderen Stadtteilen wie der Crotenlaide, dem Böhmerviertel oder dem Schafshügel, einem Siedlungsgebiet ganz am Rande der Stadt, wo an jedem Fenster registriert wurde, wer da vorbeiging, entstand das trügerische Bild von Geruhsamkeit. Aber hinter den Hausmauern wurde geliebt, gehasst, geprügelt, jede Menge Porzellan zertrümmert und manchmal wieder geleimt, wurde gehofft und aufgegeben, Hirne durch die Mattscheibe des Glücksausstrahlers narkotisiert, alles eine Nummer kleiner und miefiger und weniger betäubt durch Ablenkungen als in einer großen Stadt. Doch die Menschen einer solchen hätten mit denen Narems ausgetauscht werden können und es wäre nicht aufgefallen.
2. Kapitel
Auf dem genannten Schafshügel von Narem saß eines späten Abends im März einer jener Austauschbaren namens Matthias Weidauer in seinem Häuschen behaglich im Sessel, um einen seit langem mit Spannung erwarteten Schwergewichtsboxkampf zur Profiweltmeisterschaft im Fernsehen zu erleben. Der Reporter sprach soeben von der ominösen siebenten Runde, in welcher der Herausforderer angekündigt hatte, den alles entscheidenden Knock-out zu landen. Da läutete die Vorsaalglocke oder besser, sie spielte. Matthias Weidauer seufzte etwas unwillig und murmelte ein paar verärgerte Worte, die vielleicht hätten ein Fluch sein können, wenn er dazu fähig gewesen wäre. Er ging eilig, um schnell wieder vor den Fernseher zu können, zur Haustür. Dann fiel ihm aber ein, wie spät es war, beinahe zwölf Uhr nachts, und dass man nicht mehr wie früher eine Tür ins Dunkle öffnen konnte ohne zu wissen, wer da draußen lauerte. Außerdem war er ein Mann in einem Alter, der wohl kaum noch reagieren konnte, hätte er das müssen. So stieg er leise die Treppe hinauf, um Lu, seine Frau nicht zu wecken und hielt im einstigen Zimmer seines Sohnes, welches sie aus Gewohnheit noch immer Kinderzimmer nannten, am Fenster Ausschau. Im schwachen Schein der Straßenlaterne sah er eine Gestalt an der Gartentür stehen, beim genaueren Hinsehen, dass es eine Frau war. Dann erkannte er sie und murmelte verblüfft „Na so was!“
Da unten stand Zoe. Er überlegte, wann er sie das letzte Mal gesehen hatte. Es mussten vier, vielleicht fünf Jahre sein. Ja, bestimmt fünf Jahre, in denen aus der Verwunderung Ärger und schließlich Traurigkeit entstanden waren wie eine langsam wachsende giftige Pflanze. Die Traurigkeit war in ihm haften geblieben und hatte ihn auf gläubige Gedanken gebracht. Er betete manchmal zu Gott, der möge eine höhere Gerechtigkeit bringen. Doch als hätte Gott mit anderem zu tun, war diese Gerechtigkeit in den fünf Jahren nicht eingetreten. Er stand zögernd hinter dem abgedunkelten Fenster und wusste nicht, was er nun tun sollte. Er sah, wie sie das hell erleuchtete Wohnzimmerfenster absuchte. Das flackernde Blaulicht des Fernsehers verriet ihr seine Anwesenheit. Er ärgerte sich, weil er vergessen hatte, das Rollo herunterzulassen. Schon klingelte sie ein zweites Mal, diesmal länger. Ihm war so, als spöttele die Klingelmelodie, denn sie spielte nun in der Abfolge einiger Liederanfänge „Horch, was kommt von draußen rein“, wie um dem seltsamen Ereignis eine Bedrohlichkeit zu geben. Und der neuerliche Klingelton schien ihm hastiger, fordernder. Er lief die Treppe hinab und dachte: Ruhig bleiben. Nichts sagen. Was will sie denn jetzt nach so vielen Jahren? Sie war damals ohne Abschied gegangen. Und so erinnerte das Ganze noch heute an eine Flucht. Lu und er, sie saßen damals in der kleinen Küche, bekümmert über das, was sie sich nicht erklären konnten oder wollten, und sie hofften, dass sie noch einmal wie in den vielen Jahren ans Fenster klopfen möge und sie wollten ihr trotz allem viel Glück wünschen. „Lass mich machen“, hatte Lu damals gesagt, weil sie befürchtete, er könnte Porzellan zerschlagen, „du brauchst nur zu lächeln. Wir haben ihr nie etwas getan, und vielleicht wird sich doch noch alles zum Guten richten. Eine Kurzschlusshandlung, mehr nicht.“ Aber sie saßen und saßen und merkten schließlich die Sinnlosigkeit ihres Wartens. Wo der Sohn Gernot zu diesem Zeitpunkt war, wussten sie nicht. Gern hätte ihn Lu beim Kopf genommen und ihm ein paar tröstende Worte gesagt. Unten auf der Forststraße ließ Zoe einige Sachen in den Möbelwagen packen. Es sah aus wie Raubgut. Und Franz freute sich mit seinen neun Jahren, weil er ganz oben in der Kabine neben dem Fahrer sitzen durfte. So glich die Aktion einer lustigen Ausfahrt.
Matthias ging zur Gartentür und hörte in Gedanken seine Frau: Du brauchst nur zu lächeln. Aber das Herz schlug ihm bis zum Hals, und er sagte mit einer Stimme, die ihm förmlich und wie von weit her vorkam: „Was willst du?“
Der Nachbarkater Don Carlos nutzte die seltene Gelegenheit zur Nacht und huschte durch die geöffnete Tür ins Haus.
Matthias sah in ihr Gesicht, ahnte in der Dunkelheit die Unnahbarkeit in ihren Augen, die ihn immer verunsichert hatte, schwanken ließ zwischen Sorgen und Fragen. Auch jetzt spürte er wieder diese Zweifel.
„Gib mir Franz raus! Aber sofort!“, sagte sie.
Als ginge es um einen Gegenstand. Um eine Ware. Etwas Gestohlenes. Ihre Worte klangen wie immer abgehackt, jeden Widerspruch erstickend. Es gibt Worte, die sind wie Schläge. Sie prügeln auf den anderen ein. So fühlte sich Matthias jetzt, noch bevor er antworten konnte. Schließlich sagte er betont ruhig: „Er ist nicht hier.“
Sie sah ihn unsicher geworden an. Zum ersten Mal hörte er in ihrer Stimme etwas, dass er noch nie bei ihr vernommen hatte: Angst. Sie trug eine blaue oder graue Küchenschürze, über die sie eine Strickjacke gezogen hatte. Die Füße steckten in Hausschuhen. Als wäre sie vom Weglaufen des Jungen überrumpelt worden.
„Bei seinem Vater ist er nicht“, sagte sie, „er kann nur hier sein.“
Matthias versuchte, seine aufkommende Bitterkeit zu unterdrücken. „Du hast immer behauptet, er will nicht mehr zu uns. Wenn er jetzt hier wäre, müsste das ja alles nicht stimmen.“
Ihr Kinn begann hastig hin und her zu zucken. So war es immer gewesen, wenn sie die Beherrschung verlor. Jedes Bemühen um Einsicht verschlimmerte die Sache noch. Matthias ärgerte sich, weil er Lu's Rat, immer zu lächeln, nicht eingehalten hatte. Es trennte sie nun viel mehr als die eiserne Gartentür zwischen ihnen. Ohne diese, glaubte Matthias, wäre sie jetzt auf ihn losgesprungen wie ein kleines Raubtier.
„Wenn er bei dir ist, dann verklage ich dich wegen Entführung eines Kindes“, sagte sie, „darauf kannst du dich verlassen!“
Sie drehte sich um, ging zu ihrem gegenüber parkenden Fiat und startete so heftig, dass die Reifen auf dem Asphalt durchdrehten und ein zischendes Geräusch zurückließen. Er hörte es noch, als er benommen ins Haus ging, zornig nun, dass in einem solchen Ton mit ihm geredet wurde, und erschrocken.
Im Fernseher brach die elfte Runde an. Der Herausforderer taumelte, durch eine Linke des Weltmeisters getroffen, im Ring. Die Stimme des Reporters überschlug sich fast, weil sich das vorzeitige Ende des langen Kampfes ankündigte. In der Halle brüllten die Zuschauer frenetisch. Wahrscheinlich hingen jetzt Millionen am Fernseher, und keine Macht der Welt hätte sie von dort weggebracht. Aber Matthias hatte kein Interesse mehr. Er schaltete ab und setzte sich auf das Sofa. Die plötzliche Stille wirkte wie ein Knall.
Was war geschehen? Warum mussten alle Gespräche so mit ihr enden? Was berechtigte sie, derart mit ihm zu reden? In jede Wärme kam ihre Kälte wie Raureif. Nie hatte es mit ihr längere Gespräche gegeben. Nie hatte sie gefragt: Wie geht es dir? Das hätte vielleicht die Eisschicht getaut. Er hatte immer gehofft, die Frau seines Sohnes könnte ihm auch ein bisschen Tochter werden. Auf jede solche Annäherung reagierte sie schroff. Wenn er Franz umarmte, hatte er immer das Gefühl, er müsse vorher seine Mutter darum bitten. Aber darüber nachzudenken, brachte keinen Sinn. Er bemerkte erst jetzt, dass Don Carlos auf seinen Beinen saß, die Pfoten ins Hemd krallte und den Kopf schnurrend auf seine Brust legte. Als wollte er ihn beruhigen. Doch Matthias schob ihn plötzlich weg, was den Kater irritierte. Er blieb eine Weile auf dem Teppich stehen und wusste nicht, wohin.
Franz war fort. Nachts! Matthias stand auf und löste damit seine Starre. Er stieg die Treppe hinauf und rüttelte Lu vorsichtig an der Schulter.
„Wer hat gewonnen?“, fragte sie schläfrig.
„Der Junge ist weg“ sagte er.
Sie richtete sich im Halbschlaf auf und begriff nicht gleich. „Welcher Junge?“
„Franz!“
„Woher weißt du das?“
„Sie war hier. Sie sucht ihn.“
„Dann habe ich doch die Klingel gehört. Ich dachte, ich träume.“
Matthias saß auf der Bettkante. Sie sahen sich ratlos an. „Wie kam sie darauf, er sei bei uns?“, fragte er.
„Vielleicht hat er das vor seinem Weglaufen geäußert.“
„Und weshalb ist er dann nicht gekommen?“
Darauf wusste sie keine Antwort. Sie saß im Bett. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Unten schlug die Uhr die erste Stunde des neuen Tages. Er kam ihnen zu plötzlich. In der Frühe spürten sie seine Ewigkeit. Was wussten sie an seinem Ende? Erwies sich alles als ein übler Scherz? Konnten sie abends beruhigt ins Bett gehen und darüber lachen, wie sie sich am Morgen benommen hatten? Der Gedanke löste sie aus ihrer Lähmung und machte sie sogar ein bisschen froh. Sie gingen hinunter und Lu zog sich eilig etwas drüber. Der verlassene Don Carlos zeigte sich erfreut bei ihrem Anblick. Er strich um ihre Beine, gab ihr sein Köpfchen. Sie hob ihn hoch und drückte ihn an sich, als hätte sie gefroren und die Wärme käme nun zurück wie auch das Denken. Sie streichelte eine Weile sein Fell, ließ ihn schließlich auf den Boden. Der Kater setzte sich aufrecht vor den Kühlschrank und sah zuerst Lu, dann Matthias mit seinen großen grünen Augen vorwurfsvoll an.
„Gib du ihm etwas“, sagte Lu.
Matthias nahm ein Stück Wurst aus dem Fach, schnitt es in kleine Brocken und legte sie auf einen Teller. Ohne seine Spender eines Blickes zu würdigen, nahm Don Carlos das Nachtmahl zu solch ungewöhnlicher Zeit ein. Sie sahen ihm zu, froh darüber, mit etwas ganz Praktischem beschäftigt zu sein. Dann stolzierte er zur Haustür, setzte sich ohne einen Laut von sich zu geben, hin und wandte so erneut seine Art Sprache an. Matthias ließ ihn hinaus. Die Märznacht war still und kühl. Man konnte schon ein bisschen die ersten Knospen erahnen. Er sah dem Kater nach, wie er unter den Büschen verschwand. Und plötzlich fröstelte ihm, weil er an Franz dachte, der, wenn er nun nicht bei ihnen war, sich vielleicht da draußen befinden musste. Und keiner öffnete ihm die Tür wie dem Kater.
„Und was nun?“, sagte er zu Lu.
Lu ging ins Wohnzimmer. Sie kam gleich darauf mit einem Karton und einem Fotoalbum zurück. Sie stülpte aus dem Karton einen Berg Fotos auf den Küchentisch. „Seit einem Jahr wollten wir die schon ordnen und einkleben“ sagte sie.
„Was! Jetzt?“, rief er.
„Ja, jetzt“, erwiderte sie bestimmt. „Wann denn sonst? Oder kannst du etwa schlafen gehen?“
Da sah er in ihrem Gesicht die Sorge, als hätte er sich erkannt.
„Hol den Leim“, entschied er. Und schweigend, fast verbissen begann er, die Urlaubsfotos nach ihrer zeitlichen Reihenfolge zu sortieren. Ja, es gelang ihm sogar, sich beim Anblick der Berge in die Vergangenheit zu versetzen, in das Jahr, als sie mit Franz in den Urlaub nach Tellerhäuser fuhren. Auf einem Bild war zu sehen, wie sie in der Gondel eines Riesenrades nach unten sausten. Lu hatte das Foto, ihnen gegenüber sitzend, geschossen. Sie hielten sich vor Grausen fest umschlungen, gewillt, das Abenteuer gemeinsam zu ertragen. An ihren weit geöffneten Mündern waren die Schreie zu sehen. Auf einem anderen Foto saßen sie ganz versunken auf einer Bank am Waldrand. Matthias hatte den Arm wie beschützend um Franz gelegt, froh über die Nähe des Jungen und diesen Urlaubstag.
Lu nahm das Fotoalbum und legte probeweise einige Fotos auf die Seiten. Wahrscheinlich hätten sie so ewig gesessen. Müde und zur Munterkeit verbannt, weit fort von hier auf einem Wanderpfad und in einer vergangenen Zeit. Aber plötzlich spielte die Klingel erneut eine Melodie. Sie sahen sich aufgeschreckt an. Kam sie erneut? So viele Jahre nicht mehr gesehen und nun solch unverhoffte beklemmende Nähe.
Es war Gernot, der draußen stand.
„Ich wollte den Bus holen, da sah ich bei euch Licht“, sagte er.
Dann erkannte er die Fotos auf dem Tisch und schien zu begreifen.
„War sie auch bei euch?“
Als das Matthias bestätigte, stieß sein Sohn ärgerlich die Luft aus, und die Sorge um die Eltern war in seiner Stimme zu hören.
Er stotterte. Das war im letzten Jahr seiner Ehe mit Zoe immer häufiger geschehen. Nach jedem Streit, in dem sie mit einem unerklärlichen Hass alle seine Bemühungen um Harmonie zerfauchte, brachte er keine geordneten Sätze heraus. Es musste also vorhin bei seinem Sohn noch heftiger zugegangen sein als bei ihm, dachte Matthias.
„Was willst du tun?“, fragte er.
„Ich werde die gesamte Stadt abfahren. Irgendwo muss er ja sein.“
„Vielleicht ist er zu Freunden“, überlegte Lu.
Gab es da überhaupt welche? Jahre hatten sie Franz nicht mehr gesehen oder nur einmal flüchtig, als er sich zu ihnen gestohlen hatte. Und es wurde ihnen traurig bewusst, in dieser Zeit waren auch die letzten Bindungen gerissen. Sie konnten sich nicht einmal vorstellen, wie er nun aussah. Mit neun Jahren war er für sie stehen geblieben. Jetzt zählte er fünfzehn. Aber sie sahen ihn immer noch, wie er im Garten Versteck spielte. „Zehn, elf, zwölf – ich komme!“ Sie sahen, wie er hinter Büschen und Bäumen suchte und freudig aufschrie, wenn er sie entdeckt hatte. Das Foto auf dem alten Sekretär im Vorsaal zeigte ihn als kleinen Indianer im Federschmuck und kriegsbemalt im kindlichen Gesicht. Auf einem Foto lehnte er, nun älter geworden, den Kopf an die Schulter seines Vaters. Wie Schutz suchend. Manchmal stand Matthias vor dem Foto. Und je länger er so stand, desto deutlicher erkannte er, es war ein guter Junge. Jetzt spürte er wieder diesen leisen Schmerz und die Erinnerung an Wunden, die er längst für Narben gehalten hatte. Franzi nannten sie ihn. Und sie ahnten, nun war er Franz. Gingen sie abends ins Bett, sahen sie ihn in seinem fernen liegen, auch wenn sie die neue Wohnung gar nicht kannten. Er lag für sie einfach dort und alles hatte seine Ordnung. Er lag dort in ihrem Gedächtnis. Ihn jetzt draußen in der Nacht zu wissen, war für sie undenkbar. Matthias spürte Zorn. Nichts war in Ordnung. Ständig webten sie sich Fäden und wollten nicht wahr haben, wie dünn die sein konnten. Die Wände ihres Häuschens umschlossen beide wie eine warme Haut. Aber sie hatten Fenster, und durch diese drang das andere Leben ein, ob sie wollten oder nicht.
Gernot stand mit seinen Einsneunzig gebückt unter der Tür. Das sah so aus, als wäre er auf Sprung oder als drücke ihn die Last, welche in den letzten Jahren immer schwerer geworden war.
„Ich fahre mit dir“, sagte Matthias entschlossen.
Das Auto, ein chromsilberner VW-Kleinbus mit abgedunkelten Fenstern im hinteren Teil stand halb unter dem Balkon. Gernot wohnte eine Minute entfernt in einem ähnlichen Siedlungshaus, das aber keine Abstellmöglichkeit für ein Auto besaß. Er baute seit Jahren nicht mehr an dem Haus herum. Als müsse er Stein für Stein belassen. Einst hatte er so viel vorgehabt. Nun beließ er es mit der Hoffnung, der Junge solle eines Tages, wenn er kommt, alles so wieder finden wie es war. Das Haus wurde zum Museum.
Franz
Der Junge wusste nicht, dass er ein Junge ist. Er wusste überhaupt noch nichts. Vielleicht ist das die beste Zeit in einem Menschenleben: Noch nichts zu wissen.
Er lag frisch gewindelt unter einer himmelblauen Zudecke. Nur sein kleiner rötlicher Kopf ragte daraus hervor. Ein paar verschwitzte schwarze Härchen standen davon ab wie der Flaum eines noch nicht flüggen Sperlings. An den Seiten liefen spitze Kotletten zu den Bäckchen als hätte sich ein Friseur schon an ihm zu schaffen gemacht. Wenn er die noch ganz hellblauen Augen öffnete, war kein Glanz darin. Betrachter rätselten, ob sie schon von ihm gesehen werden, weil er manchmal lächelte. Experten behaupten, da bilde sich das Hirn. Aber seine Eltern dachten eitel, ihr Anblick rufe bereits Freude bei ihm hervor.
Wenn er frei lag, zappelten seine Ärmchen und Beinchen ruckartig wie die Beine eines auf dem Rücken liegenden Käfers. Dann hörte er zum wiederholten Mal eine dunkle Stimme in seiner Nähe, spürte eine sanfte Berührung und hielt sofort auf zu zappeln. Er wurde hochgenommen, gegen etwas Weiches und doch zugleich Pralles gedrückt und seine Lippen begannen zu schmatzen. Er saugte eine warme süßliche Flüssigkeit in sich hinein ohne dabei jemals eine Anleitung bekommen zu haben. Er war unersättlich. Aber schließlich ließ er erschöpft davon ab. Jemand klopfte ihm behutsam auf dem Rücken herum, bis er ein lautes Prösterchen von sich gab, das ihm viel später in der Öffentlichkeit vorgetragen, als unhöflich ausgelegt werden wird. Am Ende lag er wieder unter der hellblauen Decke und schlief sich eine weitere Stunde seines noch sehr kurzen Lebens ab.
Er hieß übrigens Franz. Aber selbst, wenn sein Name gerufen wurde, begriff er nicht, er sei gemeint.
Wie gesagt, er wusste noch nichts und war deshalb in einem glücklichen Zustand.
3. Kapitel
Sie fuhren langsam kreuz und quer durch das nächtliche Narem. Häuserzeilen, mit einer Etage und in die Schrägdächer eingelassenen turmartigen Dachkammerfenstern, glitten im Halbdunkel an ihnen vorbei. In einem war noch Licht. Da kam einer nicht vom Fernseher los oder auch er konnte nicht schlafen. In den Straßen lief kein Mensch. Vor kurzem hatten Jünglinge in der Dunkelheit eine Rentnerin niedergeschlagen und sie ihres geringen Geldbetrages beraubt. Jüngelchen, die sich Schwächere aussuchten, weil sie selber feig und schwach waren. Nun gähnten die Straßen um diese Zeit noch leerer.
Am Annapark stiegen sie aus dem Auto und beschlossen, der eine links, der andere rechts, den Park abzusuchen. Früher war Franz öfters in diesem Park gewesen, und es konnte ja sein, er habe dort Zuflucht gesucht. Der Märzwind wehte über die freien Felder in den Park. Einzelne Äste knarrten in den Baumkronen.
Matthias begann am Sinn seiner Suche zu zweifeln. Vielleicht saß der Junge längst wieder zu Hause. Obwohl er auch dort von ihm fern war, machte Matthias diese Vorstellung fast froh. Er zog sich die Kapuze seines Anoraks über den Kopf und sah nun aus wie ein Vermummter. Einer, der in sich selber hineinkriechen wollte. Von der Bahnlinie im Tal kam der langgezogene Heulton eines Fernzuges zu ihm herauf. Es war ein Ruf, wie fremd und verständnislos in dieser dunklen Stadt. Am besten fuhr man schnell weiter in große Städte mit vierspurigen Straßen, Nachtbars und Reklamelichtern überall. Matthias fühlte Müdigkeit. Auf einmal hatte er das Verlangen, mit dem Zug in die Ferne zu fahren. Fahren ohne Ziel. Keine Ankunft. Einfach nur fahren, fahren. Aber die Gedanken fuhren ja trotzdem mit. Er konnte sie nicht zurück lassen. Franzi dachte er und dann Franz. Er wurde sich seiner fünfundsechzig Jahre bewusst, die plötzlich uralt an ihm hingen. Unser Leben währet siebzig Jahr, und wenn es hoch kommt – Ja, der Junge war ihm einer der Gründe zum Leben. Er sollte ihm seine eigene Kindheit ein bisschen wiederbringen. Nur fünfzehn Minuten Fußweg wohnte er von ihm entfernt und war doch in den letzten Jahren, so sehr er sich das auch jeden Tag wünschte, nicht gekommen. Was stehe ich hier, dachte er, schlaflos mitten in der Nacht, und fange an, mich selber zu betrachten? Ihm hatte die Arbeit als Handweber über das Geldverdienen hinaus Freude bereitet. Auch jetzt noch, wo sie längst zu seinem Hobby geworden war. Irgendetwas musste man tun. Er sträubte sich gegen die Vorstellung, eines Tages nichts weiter zu hinterlassen, als eine Delle in seinem Sofa. Aber in den letzten Jahren hatte er häufig vor dem Bild des Enkels gestanden und nicht bemerkt, wie ihn das unerfüllte Warten allmählich abstumpfte. Zu Hause saß jetzt Lu am Tisch und klebte Fotos in ein Album. Vergangenes Leben. Auf einem Bild kam der Junge die Oberwiesenthaler Sommerrodelbahn herabgesaust, bestrebt, seinem fotografierenden Opa zu zeigen, wie schnell er sein konnte. Auf einem anderen Foto fuhr er mit dem Schlitten zum Start hinauf. Er drehte sich mit dem Oberkörper halb um, lächelte und winkte, das Gesicht wurde kleiner, das Lächeln verschwand und er winkte und winkte und zog davon. Und auf einmal war es Matthias so, als sei das der Abschied gewesen. Aus dem Foto war ein Film geworden, ein Abspann. Er erschreckte über sein Selbstmitleid und lief zum Parkausgang.
Gernot stand schon am Auto. „Nichts?“, fragte er.
„Nichts“, erwiderte Matthias.
Sie fuhren ins Zentrum, am Wunderlich-Platz und Markt vorbei, wo der Junge mit seiner Mutter in einer Mansarde wohnte, dann über die Bahnbrücke ins Crimmitschauer Viertel, sogar ins Gewerbegebiet, das mit seinen menschenleeren nächtlichen Firmengebäuden noch einsamer als die Stadt wirkte. Zuletzt steuerten sie die Steile Wand hoch, einst Stätte eines großen Ereignisses, der Friedensfahrt mit solchen Radrennassen wie Täve Schur. Hier schob der Inder Dhana Singh im blauen Turban, verwundert über das schier unbezwingbare Kopfsteinpflaster des steilen Berges, sein Rad hoch. Über ihm brummte der Hubschrauber des Fernsehens, und hinter ihm, dem Letzten des Feldes, rollte ein riesiger Konvoi an Autos den Berg hoch. Die Luft hallte vom Geschrei der Zuschauer, die rechts und links dicht gedrängt den Berg säumten. Doch die Friedensfahrt gab es nicht mehr. Die Hymne, die an Völkerfreundschaft und Frieden erinnern sollte, war verklungen worden. Aber die steile Wand konnte keiner einebnen, kein Bagger konnte die Vergangenheit einreißen. Und so blieb Narem doch ein Denkmal, das es über seine Grenzen hinaus erwähnenswert machte.
Während Gernot die Steile Wand hinauf fuhr, hatte Matthias in einer Art Ablenkung an die Friedensfahrt gedacht. Nun verschwand jäh das Bild aus alten Tagen. Ihre vergebliche Suche ließ sie schweigend und enttäuscht wieder in Matthias' Grundstück einbiegen. Das Siedlungshaus lag im Morgendämmer. Es schmiegte sich in den Hang. In den letzten dreißig Jahren war es ihm immer vertrauter geworden. Aber jetzt war die Rückkehr anders, schwerer. Denn er wusste, er findet in ihm keine Ruhe, solange der Junge nicht gefunden war. Der Wind kam nun stärker aus Süden, wo die Autobahn an Narem vorbei führte. Das unaufhörliche Rauschen der Brummis, diesen Dinosauriern der Tag und Nacht rollenden Rendite, und der Pendler, die weit zur Arbeit in die alten Bundesländer fuhren und den Westen wieder zum Westen machten, wurde zu ihnen herübergetragen. In einer Stunde musste Gernot auf jener Autobahn nach Chemnitz zur Arbeit. Er sah müde aus. Es blieb keine Zeit mehr zum Schlafen. Matthias hätte ihm gern ein paar ermunternde Worte gesagt. Ihm fehlte jetzt die Kraft dazu. So gingen sie schweigend auseinander.
Lu stand am Herd und rührte Essen in einem Topf. Sie hieß eigentlich Luise. Aber als sie Matthias damals seinen Eltern vorstellte, bat sie gleich: „Sagen sie Lu zu mir. Ich möchte nicht wie eine Birnensorte Gute Luise heißen.“ Seine Eltern blickten sich überrascht an. Dann war Lu's Auftritt perfekt, als sie auch noch erfuhren, ihre zukünftige Schwiegertochter lenkte einen Linienbus zwischen Narem und Gluchow.
Nun stand seine ehemalige Busfahrerin zu früher Stunde am Herd und kochte Eintopf.
„Du brauchst mir gar nichts zu erzählen“, sagte sie, „ich sehe es auch so.“
„Du hättest schlafen sollen“, bemerkte er.
„Wir müssen etwas essen“, entschied sie.
Matthias setzte sich auf einen Stuhl und sah ihr müde zu. „Ich hab keinen Hunger.“
„Wir denken immer nur an Freunde“, sagte sie. „Vielleicht ist er zu einer Freundin.“
„Was! Mit Fünfzehn schon!“, rief er. „Mit Fünfzehn glaubte ich noch, die Mädchen bekommen durch Küsse Kinder.“
Sie legte belustigt den Kochlöffel aus der Hand, wischte sich die Finger an der Schürze ab, legte ihre Arme um seinen Hals und gab ihm einen Kuss.
„So“ sagte sie, „jetzt bekomme ich ein großes altes Kind“.
Einen Tag lang versuchte Gernot von seiner Arbeitsstelle aus, Zoe anzurufen. Vergebens. Er wusste vom Vor- und Nachteil der modernen Technik. Sie hatte ihn in ihr Telefon programmiert und konnte nun beim Klingeln auf der Anzeigetafel feststellen, wer da anrief. Er hatte keine Chance. Trotzdem versuchte er es am nächsten Tag wieder. Sie nahm den Hörer nicht ab. Die Lehrerin von Franz erklärte ihm, der fehle schon den zweiten Tag. Am Abend bog Gernot gleich von der Autobahn nach Gluchow ab und fuhr ins dortige Polizeirevier. Narem hatte keines mehr. Es war schutzlos sich selber überlassen. Polizisten hatten Seltenheitswert. Sie traten nur in Hundertschaften auf, wenn es galt, genehmigte Nazi-Demos zu gewährleisten oder mächtige Politiker in Sicherheit zu wiegen. Randalierer konnten deshalb in Narem ungestört durch die Stadt ziehen, Zäune eintreten, Verkehrsschilder abbrechen, Schaufensterscheiben einschlagen oder seelenruhig Kupfertafeln und Kupferdachrinnen von Häuserwänden abmontieren. Neulich waren Profis sogar mit dem Auto gleich in ein Schaufenster gefahren und hatten Getränke und Zigaretten exakt verladen. Sie mussten keine Angst haben, überrascht zu werden. Narem zahlte das meiste des entstandenen Schadens. Die kleine Stadt will schlafen geh'n, hatte einst ihr Komponist Werner Bochmann als Lied vertont. Es war längst zu einem Märchen aus alter Zeit geworden.
Der Polizist auf dem Revier wirkte abgespannt. Sein Dienst ging bald zu Ende. Und nun kam noch einer mit irgendwelchen Problemen. Er nahm einen Schluck Kaffee aus der Tasse vor ihm. Als hätte dieser ihn mobilisiert, richtete er sich etwas auf und gab sich Mühe, freundlich zu sein.
„Weidauer?“, fragte er, nachdem sich Gernot vorgestellt hatte. „Da war heute schon eine Frau Weidauer hier und hat eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Warum kommen Sie da noch?“
„Ich bin der Vater“, sagte Gernot und fügte auf den verwunderten Blick des Polizisten hinzu: „Der geschiedene.“
Der Polizist überlegte eine Weile. Er sortierte die Situation. „Wohnt Ihr Sohn bei Ihnen?“
„Nein, bei seiner Mutter.“
„Dann hat sie das Sorgerecht.“
„Ich habe es auch!“, rief Gernot gereizt. Zwei Nächte ohne Schlaf und dazu die Arbeit förderten seine Erregung.
„Na gut“, sagte der Polizist. Er suchte auf seinem Schreibtisch unter den Akten, fand ein Blatt Papier.
„Das haben wir heute durchgegeben: Vermisst wird der fünfzehnjährige Franz Weidauer aus Narem. Er verließ ohne Ziel die Wohnung. Wer kann Angaben zu seiner Person machen? Er ist ca. 1,80 m groß, hat kurzes dunkles Haar. Bekleidet ist er mit einer grauen Jacke, Aufschrift Jack Wolfskin, blauen Jeans, einer dunkelblauen Baseballmütze und weißen hohen Turnschuhen. Er trägt einen grünen Rucksack bei sich. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizeistelle entgegen.“
Der Polizist ließ das Blatt sinken und sah Gernot an.
Aber sein Haar ist doch lang, wollte Gernot verbessern. Dann fiel ihm ein, wie lange er seinen Sohn nicht mehr gesehen hatte. Und der Junge kam ihm plötzlich erwachsen vor und war doch noch ein Kind.
„Wir haben alle Reviere verständigt“, erklärte der Polizist. „Auch unser Polizeihubschrauber wird zum Einsatz kommen. Mehr können wir im Moment nicht tun.“ Als er Gernot unschlüssig stehen sah, fügte er hinzu: „Meistens geht alles gut aus. Ihr Sohn ist nicht der einzige Fall. Immer mehr hauen von zu Hause ab und melden sich dann wieder.“
Gernot ging zu seinem Auto. Warum hauen immer mehr von zu Hause ab? dachte er. Die Familie ist die kleinste Zelle der Gesellschaft, hatte er einst gelehrt bekommen. Wenn es in dieser Zelle keinen Frieden mehr gab, was war der Staat dann für eine Wohnung! Standen die Gerichtsvollzieher schon draußen vor der Tür, um diesen Staat zu pfänden? Stieg die Zahl derer, die ihre Probleme nicht mehr lösen konnten, weil sie keine Geduld dazu hatten? Er saß eine Weile ohne zu starten. Er suchte alle möglichen Erklärungen für seine aufkommende Unruhe. Nur nicht für die schlimmste. Der Weg zum Revier hatte etwas Entscheidendes. Als hätte er damit eine unheilvolle Richtung bestimmt.
Am Abend desselben Tages, als die Sterne wie kalt und unwahrscheinlich hell über dem Schafshügel aufgingen, hörten Matthias und Lu draußen ein Brummen in der Luft. Sie gingen vor das Haus und sahen, über den Baumspitzen des Mittelberges näherte sich das Blinken eines Hubschraubers. Langsam flog er in Richtung Narem, wo sich einst Fabrikschornsteine wie Finger in die Höhe gereckt hatten, und das nun platt in der Erde lag. Er drehte eine große Runde, kam dann zurück und begann über den Waldungen und nahen Feldern fast in der Luft zu stehen.
Da oben saßen sie an ihren hoch entwickelten technischen Geräten und suchten nach Bewegungen, nach Wärme, die sie in einem verlorenen Menschen zu finden hofften.
4. Kapitel
Sie sollte Zoe heißen. Basta! Vom ersten Tag der Geburt an hatte ihre Mutter das entschieden. Irgendeine Schauspielerin musste das Vorbild gewesen sein. Oder die Figur aus einem Roman. Während ihrer Schwangerschaft las die Mutter mehr als zuvor bunte glänzende Schwarten, auf deren Einband sich busenstarke langhaarige Frauen in den Armen von muskulösen Männern zurücklehnten. Die Schwarten waren auf abenteuerliche Weise versteckt zwischen getragenen Westklamotten an den unachtsamen Augen von DDR-Zollbeamten vorbeigeschlüpft wie kleine Fische durch Reusen. Seite für Seite las sie von Küssen, leidenschaftlichen Seufzern und Männern, welche schließlich tief in die Frauen eindrangen. Manchmal stand sogar in einer Art bäuerlichen Sex, sie pflügten diese. Dies alles wiederholte sich einem Gebet ähnelnd, und sie, die im letzten Monat ihrer Schwangerschaft gewissermaßen in Schonzeit lebte, las das alles ungerührt, als verfolge sie einen technischen Vorgang.
Zoe kam zur Welt und brachte den Verwandten und anderen Neugierigen, die sich über den Kinderwagen beugten, eine Lehrstunde. Denn sie sprachen den Namen aus wie Zoo. Ihre Mutter spitzte etwas eingeschnappt die Lippen beim richtigen Betonen.
„Nicht Zoo! Sondern Zo-eee!“
Und die Verwandtschaft wiederholte im Chor: „Zo- eee!“, was wie ein Schlachtruf klang.
Das Kind im Wagen fing an zu weinen.
So ist wohl sein anspruchsvoller Name gleich zu Anfang mit Missverständnissen verbunden. Denn er traf auf eine verhältnismäßig ebenso anspruchslose kleine Gesellschaft von Tanten und Nachbarinnen, die sich gegenseitig den Rang abliefen, wer einmal am Tag den Kinderwagen ausfahren durfte. Ihre Kinder hießen Elfriede, Annemarie oder Waltraud.
Als Zoe eigenfüßig zu laufen begann, zumindest mit trippelnden wackligen Schritten vom Arm einer Tante in die auffangbereiten einer anderen, bekam sie ein rosafarbenes seidenes Kleidchen, weiße Spangenschuhchen verpasst, ein Schleifchen ins Haar und erntete dafür begeisterte Ausrufe wie „Allerliebst!“ und „Niedlich!“ Sie begriff schnell, dass solche Prädikate ihr galten und die sie bestaunenden größeren Wesen einzig und allein nur eine Aufgabe hatten: Für sie da zu sein. Wenn sie dann einmal über andere wichtige Dinge zu reden hatten, bemerkte das Zoe, ließ sich fallen, als sei sie gestürzt, und schrie so durchdringend, dass die größeren Wesen erschrocken ihr Gespräch unterbrachen und ihrer Schuld bewusst das Kind aufhoben. Es war keiner unter ihnen mit einer gewissen pädagogischen Intelligenz, der hätte rufen können: Komm her, ich heb dich auf! Aber dann wäre Zoe wahrscheinlich aufgestanden, hergekommen und hätte sich schreiend wieder hingelegt. Hatte sie auf diese Weise keinen Erfolg, tanzte sie so lange zwischen den Erwachsenen herum, zog allerhand Grimassen, durchkreuzte ihre Blicke, bis die Debatten abbrachen und die Erwachsenen wieder in den Bann des Kindes gerieten.
Im ersten Schuljahr versuchte Zoe unter dreißig Gleichaltrigen ihre eigensinnigen Kapriolen fortzusetzen. Wenn sich die Lehrerin nicht um sie kümmerte, stürzte sie und schrie in gewohnter Weise. Diesmal aber erntete sie das Gelächter der gesamten Klasse. Da rannte sie einfach andere um in der Hoffnung, auch über diese werde dann gelacht. Aber sie erreichte nur, von der Klasse nicht mehr Zoe, sondern in der Unbarmherzigkeit von Kindern Zoo gerufen zu werden. Und sie riefen es mit Absicht derart, als hätten sie Ziege, Kamel oder Affe gerufen. Sie begriff nicht, weshalb die anderen so zu ihr waren. Während sich überall Freundinnen bildeten, wurde sie ihre eigene.
Sie konnte ganz allein trotzig mit einem Springseil zwischen den Tagebauhäusern hüpfen, schmucklosen grauen Bauten mit nur einer Etage, von denen es die Kumpels nicht weit bis zur Arbeit hatten. Die meisten kannten sich gut untereinander, wussten von ihrer beruflichen Rangordnung.
Zoe's Eltern lebten in einer dieser Wohnungen, von deren Fenstern aus man weit in das flache Land blicken konnte. Einst hatte es dort Auenwälder gegeben und verlorengegangene Orte, unter denen riesige Braunkohlevorkommen lagerten, die das Land dringend für seine Existenz brauchte. Doch die Kohle schaufelte sich wie ein gefräßiger Maulwurf ans Licht. In der Ferne stiegen aus dicken Schornsteinen gewaltige Rauchwolken zum Himmel. Dort wurde die Kohle zu Brikett gepresst. In der Luft war ein penetrant bleibender Gestank, an den sich die Bewohner der Landschaft gewöhnt hatten wie an das tägliche Brot, das sie von ihm verdienten. Der bräunlich-graue Boden glich bis in die Ferne der Haut eines geschorenen Schafes. Bagger mit Giraffenhälsen furchten tiefe breite Täler in die Fläche. In den trockenen Zeiten stiebten Kipper mit fast mannshoher Gummibereifung Staubschwaden in die Luft. Sie hüllten das Land in einen künstlichen Nebel. Dazu das Rauschen der Förderbänder, als sei hinter diesem gemachten Nebel ein ferner Wasserfall. Auf den Fensterstöcken der Häuser musste jeden Morgen feiner mattfarbiger Staub weggewischt werden. Vor einem Monat betrat ein Amerikaner namens Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Die Zeitungen, besonders die der westlichen Welt und die Fernsehsendungen, waren voller Jubel mit dem Unterton, damit wäre gegen die Russen ein Wettlauf gewonnen und es sei ein gigantischer Schritt für die Menschheit. Es gab Skeptiker, die das Ganze für eine gelungene Show hielten.
Für die Leute am Rand des Tagebaues kam beim Vergleichen der Fernsehbilder mit ihrer Landschaft vor der Haustür der Gedanke auf, sie lebten auf dem Mond. Wie dort fügte sich die Kahlheit des Bodens in nackte aufgerissene Krater. Aber sie lebten nun einmal gern hier, ohne Schwerelosigkeit, in Gestank und Flachheit mit kärglichen Möglichkeiten für Spaziergänge. Denn sie verdienten gut. Viel Geld kann wie eine Augenbinde sein.
Zoe's Vater hatte einen solchen giraffenhalsigen Bagger gefahren. Hatte. Er war ein mittelgroßer Mann, von breiter Gestalt. Ein massiger Bauch hing leicht über den eng geschnürten Gürtel. Er bewegte sich bedächtig und schien auch so zu denken. Sprach einer mit ihm, sah er den Frager lange an, als müsse er die Frage vor einer Antwort erst übersetzen. In der Regel aber redete er nicht viel. Von der Arbeit weg, kehrte er fast regelmäßig in eine am Weg liegende verrauchte Kumpelkneipe ein, die als zwei Hauptspeisen einmal Kartoffelsalat mit Bockwurst und ein andermal Bockwurst mit Kartoffelsalat anbot. Er aß aber kaum etwas. Dafür rauchte er mehr. Wenn ihm die F6 im Mundwinkel klemmte und der Rauch zum Gesicht hoch zog, verkniff er seine Augen und blinzelte die am Stammtisch sitzenden an, als fixiere er sie misstrauisch. Sein Brot war das Bier. Es konnten schon etliche Gläser werden bei seinem Zwischenaufenthalt. Kamen dann noch einige doppelte Harte zur Geschmacksbildung hinzu, wurde er noch wortkarger und mancher Fragende erhielt schon gar keine Antwort mehr. Durch die bedächtigen Bewegungen fiel seine Trunkenheit den wenigsten auf. Er lief steif nach Hause und fütterte, bevor er die Wohnung betrat, erst seine zehn Hühner. Als befürchte er, danach nicht mehr fähig zu sein. Bei seinem Anblick liefen die Hühner aufgeregt gackernd am Maschendraht zusammen. Spötter aus der Nachbarschaft behaupteten, der Empfang sei froher als der von seiner Frau. Wenn er besonders besoffen war, trat er auch manchmal nach einem Huhn, das ihm zwischen die torkelnden Beine lief.
Dann kam der Tag, als er durch eine Unachtsamkeit das Getriebe seines Baggers zuschanden fuhr. Die herbeigeeilten Mechaniker rochen die Ursache. Ein Alkoholtest war eindeutig. Es half auch keine Erklärung, die Hände hätten ihm beim Schalten gezittert, und nur ein Schluck aus der in der Arbeitstasche gefundenen Schnapsflasche hätte sie wieder ruhig gemacht. Seinen nächsten Arbeitstag begann er als Belader der Loren im Brikettwerk. Nun hätte er ja geläutert sein können. Aber er kam nicht darüber hinweg, ihm war die Verantwortung entzogen worden. Die Kneipe blieb seine Zwischenstation. Und wenn er dort wieder einmal besonders viel in sich hineingekippt hatte, tat er noch so, als sei er Baggerfahrer. Vielleicht glaubte er das dann sogar selber.
Die leichter gewordene Lohntüte nahm er hin. Es blieb ihm auch nichts anderes übrig. Die meisten Ausgaben tätigte er in der Kneipe, zum Kauf von Hühnern und Zigaretten. Eier mit der Registriernummer 13 versehen, verkaufte er an den Konsum. Dafür erhielt er Hühnerfutter. Kücken brachten ihm auch kleine Einnahmen, weil seine gute Aufzucht bekannt war. Das restliche Geld gab er seiner Frau und er verlangte von ihr, sie solle damit den Haushalt ordentlich führen. Darunter verstand er einen gedeckten Tisch mit guter Kost, frisch gewaschene und gebügelte Klamotten. Eine Urlaubsreise musste auch dabei herausspringen, in eine Gegend, die keiner Mondlandschaft glich. An die Ostsee, dazu fehlte ihm die Beziehung. Und sich um eine solche zu bemühen, dazu fehlte ihm die Lust. So blieben der Thüringer Wald oder der Harz. Manchmal hieb er sich abends ein paar Eier seiner Hühner in die Pfanne. Aber das war schon ein enormer Beitrag im Haushalt. Sich um Kinder zu kümmern, das gehörte zur Sache der Weiber, sie zu machen zur Sache der Männer. Wobei auch hier der Zufall entschied oder wie er es sah, ein Unfall. Zoe, das Unfallkind, ertrug er. Er hatte einen Jungen erwartet. Seine Enttäuschung darüber konnte er nicht abschütteln. Er behandelte seine Frau so, als hätte sie einen Fehler begangen. Sie hatte sich bei der Entwicklung ihres Kindes im Bauch keine Mühe gegeben. Sie rächte sich an ihm, indem sie Zoe vor seinen Augen mit ihren Armen umschloss und so intensiv auf das Kind einredete, als sei er gar nicht vorhanden. Verbot er dem Kind, drehte ihm Zoe eine Nase und erwiderte: „Aber Mama hat gesagt, ich darf es!“ Darauf schlug er sie, was eine heftige Streiterei über die gemeinsame Erziehung auf den Plan rief. Sie endete, indem er sich brummelnd zurück zog und sogar zu einigen tätschelnden Zärtlichkeiten für Zoe fähig wurde, die, wenn er schon allerhand Alkohol in sich hatte, wie Belästigungen aussahen. Zoe krümmte sich unter solchen Tätlichkeiten, wenn sich ihr sein Mund näherte. Der Geruch von Schnaps und kaltem Nikotinrauch verursachte bei ihr Erbrechen. Und als sie bemerkte, er ließ sie dadurch angeekelt los, konnte sie später bei ähnlichen Angriffen dieses Erbrechen künstlich erzeugen.
Ihre Mutter aber empfand es als einen Sieg, wenn er plötzlich reumütig geworden, gut zu ihrem Kind war. Denn es war ihr Kind. Kniete er vor dem Kind, kniete er eigentlich vor ihr. Dann ließ sie auch zu, wie er abends im Bett seine tätschelnden Handgriffe auf sie ausweitete. Er zog ihr das Nachthemd gerade nötig genug hoch, näherte sich ihr drängend mit seinem Bauch. Und sie, die noch eine schwache Erinnerung an die einstigen von ihr gelesenen bunten Schwarten hatte, hielt still. Ein technischer Vorgang. Dann wälzte er sich aus dem Bett, ging in die Küche und trank gierig in langen Zügen Bier aus einer Flasche. Er rülpste, und die Welt war wieder in Ordnung.
Nach solch einem Ablauf wurde Holm geboren. Zwei Jahre nach Zoe. Diesmal hatte seine Mutter sich Mühe gegeben. Holm war da! Kein Zufall, kein Unfall, nein, ein Volltreffer, wie er, der sonst Schweigsame, laut in der Kumpelkneipe verkündete und eine Runde ausgab. In der Kneipe glaubten sie, es sei sein erstes Kind.
5. Kapitel
Anders als Zoe tat Holm seine ersten Schritte an der Hand des Vaters. Sobald sein Vater von der Arbeit und Kneipe nach Hause kam, galt das ganze Interesse dem Sohn. Holm durfte auf seinen Beinen reiten und schrie dabei vor Lust. Er wurde hoch in die Luft geworfen und fiel zurück in starke Arme. Manchmal begann er vor Angst zu weinen. Aber sein Vater gab nicht nach. Er warf ihn nur umso höher. Auf die Klagen der Mutter erwiderte er, ein Junge müsse das ertragen, er müsse lernen, was Mut sei. Auch in das Gehege der Hühner durfte er. Sie waren fast so groß wie er. Der Hahn vermutete einen Konkurrenten. Er stellte sich drohend und gurrend vor seine Hühner. Da nahm Holm einen am Gatter lehnenden Stock und schlug auf die Hühner ein, bis sie samt Hahn mit gackerndem Gekreisch von einer Ecke zur anderen rannten. Obwohl ihm die Hühner das Liebste waren, rief sein Vater belustigt: „Ja, so ist's richtig! Keine Angst haben.“
Schließlich aber nahm er den Jungen aus der Kampfzone, trug ihn stolz auf dem Arm herum und rieb seinen Stoppelbart in dessen Gesicht und fand immer mehr Vergnügen daran, je heftiger sich Holm strampelnd dagegen wehrte.
Bei all diesen zärtlichen Neckereien stand Zoe stumm in der Nähe und sah zu. Sie wünschte sich, ebenso auf den Beinen zu reiten wie ihr Bruder. Oder in die Luft geworfen zu werden. Aber das Wissen vom Schnapsgeruch des Vaters und seinen unbeholfenen drängenden Händen hielt sie davon ab, sich zwischen die Blicke ihres Vaters und Bruders zu schieben oder schreiend auf dem Boden zu liegen wie einst. Sie hoffte, sie werde bemerkt. Aber der Vater setzte Holm auf den Kindersitz seines Fahrrades und fuhr mit ihm noch eine Runde in die abendliche Tagebaulandschaft. Zoe sah ihnen nach, und es war auf einmal sehr still um sie. Da ging sie ins Haus, suchte ihre Mutter und fand sie endlich im Waschhaus, wo sie die Arbeitshemden des Vaters im Kessel kochte und dann anschließend schwitzend durch die Wringmaschine drehte. In den Dampfschwaden des Waschhauses schmiegte sich Zoe an ihre Mutter. Die aber schob sie behutsam, dennoch ungehalten, zur Tür hinaus.
„Später“, sagte sie, „Geh spielen. Du siehst ja, dass ich jetzt keine Zeit habe.“
Und später gab es nicht.
War sie mit Holm allein in der Küche, nahm sie von einem Satz Essteller den oberen, schmiss ihn mit voller Wucht auf den Steinfußboden und rief, als die Eltern auf das Klirren der Scherben herbeigerannt kamen: „Das war Holm!“
Der kleine Bruder fand keine Worte. Er starrte auf seine Schwester und trommelte dann mit seinen kleinen Fäusten auf sie ein.
„Zoe gewesen! Zoe gewesen!“, schrie er.
Sie schlug zurück. Froh darüber. Jetzt hatte sie einen Grund. Der Vater trennte beide. Er nahm Holm in seine Arme und sagte: „Na und? Und wenn er es war! Ein Junge gehört nicht in die Küche.“
„Und jetzt vertragt ihr euch wieder“, entschied die Mutter. „Wir haben nicht nur den einen Teller.“
Da rannte Zoe in ihr Zimmer. Sie wusste nicht, was Hass ist. Aber sie empfand ein solches Gefühl gegen ihren Vater, die Mutter, den Bruder, ja, sogar gegen die Hühner hinter ihrem Gatter. Und es blieb ihr die böse Freude, für all das, was sie sich nicht erklären konnte, an ihrem Bruder gerächt zu haben. Sie öffnete die Tür, hörte hinunter ins Treppenhaus und begann, sich laut zu erbrechen.
Zoe's Vater sah manchmal seinen Bagger in der Ferne wie ein Symbol des Unrechts. Wie alle Trinker neigte er zum Bagatellisieren. Er hatte ein paar Schlucke genommen, na gut. Andere tranken auch, sogar ganz oben. Aber ihr Schreibtisch ging nicht zu Bruch. Seine Stunden in der Kneipe verlängerten sich. Er kam jetzt wieder später nach Hause. Die Hühner hungerten. Der Mist häufte sich im Gelände. Die Mutter wies Holm an, Körner in die Näpfe zu verteilen und brachte ihm bei, den Mist in eine Ecke zu gabeln. Zoe bekam den Auftrag, im Stall Ordnung zu halten und die gelegten Eier aus den Nestern zu nehmen. Die Geschwister kamen einander näher. Zumindest behinderten sie sich nicht mehr. Da der Vater Holm weniger hätschelte, fand Zoe, es erging ihr nicht schlechter als ihrem Bruder. Eine Verbesserung also.
Dem Vater merkten die Nachbarn seine Trunkenheit nicht an. Er lief langsam, als spaziere er. Nur wer sich auskannte, sah an der Steifheit seiner Bewegungen ein Bemühen um Beherrschung. Das Zittern seiner Finger nahm zu, je länger er nichts getrunken hatte. Sobald er sich ein Gläschen füllte und hastig in sich hineinschüttete wie eine Arznei, war das Zittern vorbei und er wurde ruhiger. Er konnte es nicht ersehen, wenn einer neben ihm trank. Sah er die braune Flüssigkeit im Glas, lief sie ihm schon vorher wie Wasser im Mund zusammen. „Ich bin nicht auf einem Bein gekommen“, sagte er und entschuldigte so das zweite Glas. Allmählich ähnelte er einem Tausendfüßler, der nicht wusste, wie viel Beine er hat. Dann war der Grat seiner Gesundheit erreicht. Jedenfalls fühlte er sich dann gesund. Als Baggerfahrer hatte er eine gewisse Intelligenz besessen. Aber Intelligenz ist nicht die Voraussetzung, bei Kenntnis der Folgen kein Trinker zu werden. Klugheit schützt nicht davor. Langsam stieg die Gereiztheit bei seiner Frau. Wie alle starken Trinker hatte er sich gut in der Gewalt. Er verursachte keine Schäden. Aber es kam zu Auseinandersetzungen, die lauter wurden. Und die Kinder in ihrem Zimmer wussten dann, es gibt kein Abendbrot. Die Mama war ins Bett gegangen und der Papa schlief auf dem Sofa seinen Rausch aus. Ihm genügten wenige Stunden, um ohne Brummschädel und Übelkeit wieder munter aufzuwachen. Vielleicht war dies die Tragödie. Es wurde ihm das Trinken nicht verleidet. Er kroch ernüchtert zu ihr ins Bett und beschimpfte sich klagend in ihrer Gegenwart, was sie wieder in die Hoffnung versetzte, nun geschähe eine Wende zum Guten. Dann ließ sie es zu, dass seine Hände auf ihrer Haut lasteten und schwer wie Bleigewichte zu suchen begannen. Die Gewissheit, er war nicht fähig, anderen Frauen nachzusteigen, versöhnte sie. Aber spüren konnte sie nichts, keine Erregung, keinen Höhepunkt. Sie ertrug ihn im wahrsten Sinne des Wortes und war froh, wenn seine Last schnaufend von ihr abfiel und er kurz vor dem Einschlafen brummelnd Besserung versprach.
Doch schon der abgestandene Biergeruch seiner kaltrauchigen Kneipe, das Zischen des Bierhahnes, der Anblick, wie der Wirt mit einem Holzspatel den Schaum solange vom Bierglas strich, bis eine wunderschöne Blume entstand, der würzige Geschmack des ersten Schnapses, der seinen Gaumen ölte und nach mehr verlangte, machten alle seine Vorsätze mit einem einzigen Schluck zunichte. Bei ihm war Hopfen und Malz willkommen und gleichzeitig verloren. Er umfasste das volle Bierglas als sei es seine Geliebte, von der er sich nicht trennen konnte und wollte.
Dass Brigitta, so hieß seine Frau, wahrscheinlich nie etwas bei einem Mann empfinden konnte, verdrängte sie. Zärtlichkeiten waren eine überflüssige Sache, und Kinder entstanden auch ohne solche.
So war die Geburt des dritten Kindes Marielle ein Produkt ohne Liebe und die Folge seiner lauten Selbstvorwürfe neben ihr im Bett. Diesmal verzieh er ihr sogar, dass es ein Mädchen war. Sie teilten einfach: Er Holm und sie Marielle.
Fast unbemerkt geriet Zoe in Verantwortung. Marielle, die bald Mareili genannt wurde, quäkte rund um die Uhr und schwieg nur, wenn sie gestillt wurde und nach einem Prösterchen einschlief.
„Du bist doch schon ein großes Mädchen“, sagte die Mutter teils vorwurfsvoll und lobend zur neunjährigen Zoe. Ihre flüchtigen Streicheleinheiten, mal kurz mit der Hand über den Kopf fahren, hatten einen Sinn. Der hieß Essen auf dem Gasherd umrühren, Kartoffeln schälen, die Wohnung auskehren, Staub wischen, Besorgungen machen mit einem Zettel in der Hand, worauf alles geschrieben war, was sie zu bringen hatte. Wenn Mareili hinter dem Haus unter einem schattigen Plätzchen in ihrem Kinderwagen schlief, musste sie immer wieder nachsehen, ob das Baby sich in die Decke gestrampelt hatte und zu ersticken drohte. Tanten und Nachbarinnen kamen wie üblich zur Besichtigung. Dann wurde Mareili aus dem Kinderwagen gehoben, vorsichtig abgedrückt und mit den üblichen Entzückungen bedacht „Ach, sieht die aber süß aus!“
Zoe hatte es sich längst abgewöhnt, durch einen vorgetäuschten Sturz und Schreie abzulenken. Wieder stand sie still daneben und verfolgte die Liebkosungen an ihren Geschwistern, als sei das eine Vorführung. Die Mutter mit Mareili, der Vater mit Holm. Sie war ja schon so ein großes Mädchen. Und die fröhlichen Blicke, die Kinder ihres Alters hatten, waren ihr aus dem Gesicht gefallen, so, wie man Murmeln verlor. Die Ernsthaftigkeit, mit der sie ihre Aufgaben erfüllte, machte sie älter. Aber auch trotziger. Sie ließ sich nicht hineinreden. Musste sie sich dennoch fügen, gab sie lange keine Antwort. Sie zog sich auf ihr Zimmer zurück, warf sich auf das Bett, presste eines ihrer Kuscheltiere ans Gesicht und fuhr ihm mit der Hand über den Kopf. Im Grunde streichelte sie sich selber. In der Schule kam sie leidlich voran. Es gab keinen Grund zu Befürchtungen. Zumindest wurde sie dort nicht mehr Zoo gerufen.
Franz
Die Welt war für ihn größer geworden, als er das Laufen lernte. Sie maß etwa zwanzig Schritte in den Garten hinein und zehn seitwärts. Die Schritte der Erwachsenen natürlich. Für seine eigenen brauchte er wesentlich mehr. Und länger. Wenn er die Gartenlaube am Ende erreicht hatte, sah er sich ängstlich um, so weit weg war er. Er hatte mindestens drei Stürze dabei hinter sich. Er lag eine Weile reglos, hob dann den Kopf und wunderte sich, wie die Bäume aus solcher Sicht ganz anders aussahen. Eine Pfütze vom letzten Regen wurde weniger, wenn er mit beiden Händchen hineinplatschte. Weshalb sie aber dann plötzlich in seinem Gesicht war, erregte seinen Eifer auf neue Pfützen. Seine Beinchen hörten durch die täglichen Exkursionen auf, solche zu sein und bekamen kleine runde Waden. Manchmal kamen drei größere Wesen nach ihm sehen. Das gab ihm ein beruhigendes Gefühl, nicht allein zu sein. Das eine Wesen erinnerte ihn an etwas Weiches und zugleich Pralles, an sanfte Berührungen, die er sich immer wieder holte, indem er seine Ärmchen um den Hals des Wesens schlang. Das andere viel größere Wesen konnte sich zu ihm ins Gras legen und mit ihm balgen. Er schrie dabei ein glucksendes Lachen, und das große Wesen tat alles, um es immer wieder zu hören. Und das dritte viel kleinere und ihm deshalb sehr nahe Wesen trug ihn herum und spielte, was er natürlich nicht wissen konnte, Mutter und Kind mit ihm. Die Stimme seiner wahren Mutter war ihm schon vertraut seit dem ersten Tag, da er ihr in die Arme gelegt wurde. Er hörte auf sie wie auf eine Melodie. Nun erlernte er eine eigene.
„Sag mal Mama – Ma-maa! Und Papa – Papaa!“, hieß seine erste Lehrstunde. Als er es brachte, bejubelte ihn die vertraute Stimme und belohnte ihn mit Liebkosungen. Bei „Papaa“ wurde er von diesem hoch gehoben und freudig in die Höhe geschwenkt. Er begriff, mit solchen Worten konnte er etwas erreichen. Als er zu dem dritten und kleineren Wesen Jeanette sagen sollte, gelang ihm das nicht. Aber bald hatte er ein eigenes Wort dafür gefunden. Er rief sie Nanni. Seine erste Erfindung! Aber er war noch weit davon entfernt, Worte zu erfinden, mit denen er bedrohen und belügen konnte.