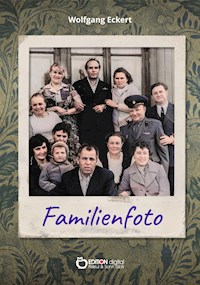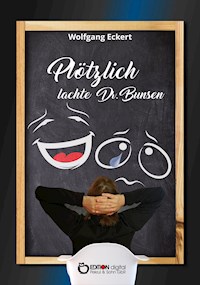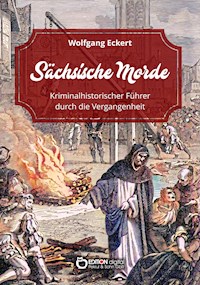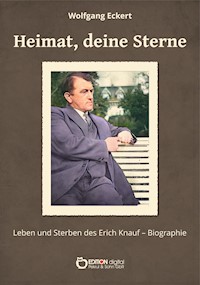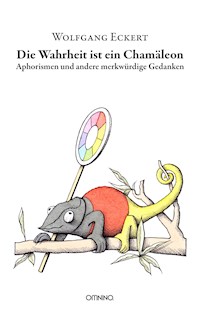6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Titel dieses Buches hat den Charakter eines Oxymorons – also eines Widerspruchs in sich wie etwa ein schwarzer Schimmel. Denn eigentlich ist ein Martinshorn dafür da, sich laut bemerkbar zu machen … In seinen 32 Randbemerkungen nimmt sich der Autor vieler verschiedener Dinge an, so zum Beispiel dem Recht auf Traurigkeit – wofür es nach der Wende den einen oder anderen Grund gibt -, den Vorstellungen der Deutschen vom Paradies und dem Beginn der Mode (Stichwort Evas Feigenblatt), den Ritualen am Nikolaustag, einer neuen Partykultur, dem Liebesleben ostdeutscher Frauen (sie kommen im Bett eher als westdeutsche) und der Vernunft im philosophischen Sinne, den Ossis und den Wessis, dem Wahlkampf, den Gewinnern und Verlierern, dem Lottoglück und einer ganz besonderen Art von massentauglicher Literatur, der bundesdeutschen Währungsunion sowie Staatsmännern und Rasierklingen, einem unechten Onkel Willy, der ein echter Gipfelstürmer ist, einem Besuch bei einer wirklich alten Dame (91) und einem Splitternacktschwimmer, dem richtigen Umgang mit Zorn und der Fantasie von Schriftstellern, Weihnachtsgedanken, nach der Wende verschwundenen Begriffen wie zum Beispiel Schichtzüge, Ereignissen der unmittelbaren Nachkriegszeit, der begeisterten Karl-May-Lektüre eines kleinen Jungen, dem Alltagsleben der Stare und dem Nachdenken über Narren, Märchen und Lügen, verschwundenen Hoffnungen aus DDR-Zeiten, Humor und Traurigkeit (wie beim Dichter Joachim Ringelnatz), deutschen Philosophen und deutschen Zuständen, dem Klicksern (falls Sie nicht wissen sollte, was das ist, lesen Sie Randbemerkung Nr. 26), seiner Heimatstadt Meerane und ihren Menschen sowie Schwierigkeiten mit der Bildung, der gesellschaftlichen Funktion der Dichtkunst und einem Amoklauf an einem Erfurter Gymnasium, einem Tag im Jahre 1918 und nicht zuletzt Lesungen im Stollberger Frauengefängnis „Hoheneck“ und Erfahrungen mit dem Arbeitsamt und dem Untergang eines Menschen. Und damit noch einmal zur Geschichte Nr. 26 und zu dem eingangs erwähnten Oxymoron. Denn diese Randbemerkung endet folgendermaßen: Wer sich über das Gedicht meines in Zöblitz lebenden Freundes Wolfgang Buschmann freuen kann, der hat noch jenen ungetrübten Rest an Kindheit, von dem ich anfangs schrieb, in sich. Es war einmal ein Martinshorn, das hatte einen Ton verlorn. Er fiel ins hohe Gras hinein und schlief nach fünf Minuten ein. Dort fand ihn die Kuh Liese und fraß ihn als Gemüse. Am nächsten Morgen muhte sie, und zwar: tatü, tata, tatü.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
Wolfgang Eckert
Leise tönt das Martinshorn
32 Randbemerkungen
ISBN 978-3-96521-802-4 (E-Book)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
Das Buch erschien 2004 im Ingo Koch Verlag Rostock.
© 2022 EDITION digital Pekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Flöhe im Teppich
Letzter Sommer
Das klingt ein bisschen elegisch. Ist es auch. Wenn wir nicht den Mut haben, manchmal ein wenig traurig zu sein, fehlt uns ein Farbtupfer in unserer Seele. Ich kenne Leute, die jagen von einem Besitz zum anderen. Das ist sogar verständlich in ihrer gegenwärtigen so plötzlichen Situation. Das macht sie atemlos. Das gibt ihnen ein Gefühl von Stärke. Was aber wird, wenn sich das Außergewöhnliche in Normalität wandelt? Bemerken sie das überhaupt oder bleiben sie weiter bei ihrer Flucht vor sich selber? Sie sind Flüchtlinge. Sie geben ihren Gefühlen niemals die Chance, sie einzuholen. Sie sind schwach, denn es fehlt ihnen die Kraft, traurig zu sein.
Ich floh aus meinem hässlich laut gewordenen Meerane nicht an die Riviera, nicht in die bayerischen Alpen oder in die Nobelhotels Mallorcas, nicht ins schweizerische Tessin oder in die stillen Wälder Südschwedens; ich floh drei Autostunden weit an einen See nahe Potsdams. Dort kenne ich seit einem Vierteljahrhundert drei Pappeln und zwei Birkenpaare, die so seltsam auseinander gewachsen sind, dass ich es nie vergesse. Man tritt auf die Terrasse, die Gäste schlafen noch, läuft die wenigen Meter über den Rasen zum See. In den Lindenbäumen der Ruf eines Pirols, aus dem Schilf die peitschende Antwort der Blesshühner. Der See ist ganz still und grau. Später wird ihn die Sonne blau schminken. Draußen auf der Boje sitzt wie immer ein Reiher und wartet. Dann das leichte Erschauern beim Eintauchen ins Wasser. Ich schließe die Augen und schwimme ganz langsam hinaus. Es ist, als fliegt man. Es ist wie Zeitlupe. Nein, es ist Zeitlupe. Ich betrachte die Zeit mit der Lupe. Drei Wochen versuche ich, in einer schönen Luftblase zu leben, unterhalte mich mit freundlichen Menschen ernsthaft über den Tagesablauf eines Hornissenvolkes, das in einer der drei Pappeln lebt, spiele mit der Hündin Elsa Stockwerfen, füttere nach dem Frühstück regelmäßig einen Schwan namens Gustav, den ich seit Jahren kenne und der mir nun endlich aus der Hand frisst und lese in Siegfried Lenz’ „Motivsuche“. Jenseits des Sees, hinter dem langgezogenen Waldgürtel, liegt für mich ein fernes Land: die bös gemachte DDR. Hier ist Unberührtheit. Sommer.
Nein, der letzte Sommer. Das Haus und der See, die den Schriftstellern Ermutigung gaben für ihre scheinbar hoffnungslose Tätigkeit, sie werden den Schriftstellern weggenommen. Die Vertreibung aus einem Paradies beginnt. Denn auch die Schriftsteller haben reichlich vom Apfel DDR gegessen und sind, wenn man einigen die Knute der Moral schwingenden westdeutschen Aposteln glauben will, durchweg Stasi-Leute gewesen, haben alle hohe Honorare bezogen. Also weg mit ihnen, bevor sie marktwirtschaftlich für die Konkurrenz gefährlich werden können. Was sie geschrieben, wovor sie durchaus, hiergeblieben, mit ihren Mitteln gewarnt, hinweg! Jetzt sind sie frei wie die Vögel über dem See. Vogelfrei.
Nein, es ist der letzte Sommer, der letzte Schwan, zum letzten Mal Kaffee und Kuchen auf der Terrasse. Unten im Keller wird die alte Heimbibliothek aufgelöst. Es ist reichlich sozialistischer Schund dabei für den Heizkessel. Aber auch viel Wertvolles von Autoren, mit denen ich hier gute Gespräche über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Lebens führte. Da hat man wohl ein bisschen Recht auf Traurigkeit. Die Luftblase platzt. Schwan Gustav ist allein, nicht, weil er es so will, sondern weil seine Lebenspartnerin etwas Giftiges gefressen hat. Jeden Tag schwemmt es tote Fische ins Schilf. Der See ist nicht blau, er ist grün. Die Motorschiffe und -boote sind nur über dem Wasser reizend anzusehen, aus Ostberlin und Westberlin treiben Industriedreck und Fäkalien mit der Havel in den See, und schon die Haushaltabwässer reichen aus. Die Zulässigkeit der Gewässerreinheit ist zwanzigfach überschritten. Baden ist gesundheitsschädigend und geschieht auf eigene Gefahr. Und trotzdem schwimme ich hinaus. Der Reiher streicht mit schweren Flügelschlägen tief über den See von der Boje ab, bekommt endlich Auftrieb und fliegt zu seinem Uferbaum. Sind wir alle auf der Flucht? Wenn nicht vor uns, dann vor wem? Warum begnügten wir uns damit, dass uns die Wellen trugen? Nun müssen wir tragen. Wir bezahlen für unsere Bequemlichkeit. Und die Natur stirbt vielleicht daran. Auch an unserer Uneinsichtigkeit. Nun verkaufen wir alles und uns.
Wenn er es gesagt hat, ist es ein bitteres Bonmot von unserem letzten Regierungschef Lothar de Maiziere: Menschen um die Fünfzig in diesem Land werden ewig DDR-Bürger bleiben. So schießt er diese Altersgruppe mit einer Schreckschusspistole aus dem Rennen in die Perspektivlosigkeit. Der Verkauf geht weiter. Dabei ist er wohl der größte Verkaufsstellenleiter und die Volkskammer die größte Verkaufshalle unseres Noch-Landes, ein gewaltiger Trödelmarkt. Es wird unordentlich Ordnung gemacht, bis der Laden dicht ist. Sommerschlussverkauf. Der letzte DDR-Sommer. Und jeder verbringt ihn auf seine Weise mit der verzweifelten Hoffnung auf Glück. Auch die Fünfzigjährigen. Denn sie haben mit das meiste geleistet im Glauben, dass es richtig war. Für sie kommt vieles zu spät und im Hinblick auf ihre ferne Rente zu früh. Bleiben sie laut Prognose DDR-Bürger, so bringen sie das mit ein, wenn der in vier Jahrzehnten trüb und stinkend gewordene See den Damm durchbricht und die schweigenden Fische zu reden beginnen.
Mein letzter Sommer am See gehört mir. Er ist unverkäuflich. Die Pappeln werden bleiben, die Birken, der Glaube an die Blauheit des Sees. So kehre ich nach Meerane zurück: Meine Traurigkeit ist eine heitere, unberührbare, und deshalb nicht kranke. Jetzt lebe ich mit Erich Kästners Gelassenheit: „Am letzten Tische streiten sich ein Heide und ein Frommer, ob’s Wunder oder keine gibt. Und nächstens wird es Sommer.“
Vertriebsgesellschaft Paradies
Fragt man einen Deutschen, wie er sich das Paradies vorstellt, so kommen bruchstückartig folgende Laute aus der Tiefe seines Bauches: Mallorca, Ballermann, Riviera, Gran Canaria, Thai-Mädchen, Griechischer Wein, Florida, Beachpartys. Die ganz Bescheidenen nennen eine Tagesfahrt mit dem Reisebus nach Wien oder München. Es soll aber auch noch Unbelehrbare geben, die sich zu einer Einkaufsfahrt überreden und von einer imitierten Kamelhaardecke einwickeln lassen, ohne jemals ein Kamel gesehen zu haben. Dabei brauchten sie sich bloß vor den Spiegel zu stellen. Das eigentliche Paradies, wie es nicht im Reisebüro, sondern in der Bibel angeboten wird, kennen sie nicht. Dabei ist es das Internationalste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Die Namen Adam und Eva sind in der gesamten Welt bekannt. Folglich ist auch der liebe Gott ein Internationalist. Somit wäre die Internationalität des Paradieses geklärt und die Illusion beseitigt, die DDR wäre das Paradies gewesen. Sie war eine Idylle. Eine Idylle ist kein Paradies, sondern nur das trügerische Schattenspiel eines solchen.
Unser Paradies ist die Sehnsucht der Menschheit mit unterschiedlichen Vorstellungen, ein schöner Kinderglaube, der Wunsch, wenigstens etwas soll unberührt bleiben. Deshalb kommen sogleich Bedenken auf, ob es dort wirklich so zugegangen ist, wie uns das die Geschichtsschreiber überlieferten. Denn betrachtet man sich den derzeitigen geistigen und vernunftsmäßigen Zustand der Welt, so fragt man sich, ob es eigentlich im Paradies einen Baum der Erkenntnis gab. Vermutlich war also der Ablauf der Vertreibung ganz anders: Adam lag in einer wunderschönen Wiese, das wollen wir zugeben, wo noch alle Kräuter und Blumen zu finden waren, an denen wir uns inzwischen erfolgreich vergriffen haben. Nachtigallen schlugen im Hain, Schmetterlinge gaukelten um seine unverdorbenen Lenden. Eva tänzelte vor ihm – live! – im Gras. Ihre kleinen Brüste wippten, der feste Po glich den Rundungen zweier aneinandergelegter Orangen. Das alles tat sie nur, damit Adam eine Veränderung an ihr feststellte. Aber alle Männer, die schon über ein Jahr mit einer Frau zusammenleben, leiden an einem Rückgang ihres Beobachtungsvermögens.
„Wie gefällt dir mein neues Feigenblatt?“, turtelte Eva.
„Du hattest doch gestern erst ein neues“, staunte Adam.
„Das war an den Rändern nicht gezackt und hatte eine Farbe, die nicht mehr in ist“, erwiderte Eva.
„Und was hast du mit dem gestrigen gemacht?“, wollte Adam wissen.
„Weggeworfen“.
Im Hain verstummten die Nachtigallen, und ein Kuckuck rief zwölfmal mahnend zur Zeit. Das war der Beginn der Mode und der Wegwerfgesellschaft. Am anderen Tag machte ihn Eva derart an mit ihrer neuen Kreation, dass er beim Anblick ihres durchlöcherten Feigenblattes fast den Verstand verlor. Was er bisher bei ihr sehen konnte, ward ihm nun in kleinen raffinierten Dosierungen gezeigt. Er brauchte ein riesiges Rhabarberblatt, um seine Erregung zu verbergen und begann unruhig auf der Wiese herumzulaufen. Eva versuchte indessen über das Paradiestor zu blicken, weil sie fremdartige Geräusche dort draußen neugierig gemacht hatten. Instinktiv ahnte sie, dass es noch andere Adams geben könnte, denen ihr durchbrochenes Feigenblatt möglicherweise sehr gefiel. Adam zertrat zähneknirschend und mutwillig einige Stauden. Abermals rief der Kuckuck mahnend, denn es waren einige wunderschöne Drogen für das Leben gemixt: Mode, Anschaffungsmanie, Verschwendungswahn, Strip, Sex, Eifersucht.
Im hochtragenden Baum der Erkenntnis, jaja, es gab ihn doch! saß der liebe Gott und rief beunruhigt: „Kauft einheimische Äpfel, Leute, kauft einheimische Äpfel!“
Nun wird es Zeit, dass wir uns den lieben Gott ein bisschen näher ansehen. Er gehörte zu jenen Männern, die in einem gewissen hohen Alter aufhören, alt zu werden. Liften kam für ihn nie in Frage. Um sein schmales Gesicht und die energischen Kinnbacken kräuselte sich ein grauer Vollbart, den er offensichtlich jeden Morgen pflegte. Er besaß einen etwas fülligen, Freundlichkeit ausstrahlenden Bauch. Seine blauen Augen leuchteten sanft-heiter. Es war ihm anzusehen, dass er jeden gütig und gerecht behandeln wollte. Allerdings verkniffen sich die Augen manchmal, wenn er kopfschüttelnd zu jenen von ihm geschaffenen Wesen hinunterblickte, die sich untereinander so gebärdeten, dass er an seiner Qualitätsarbeit zu zweifeln begann und sich eingestehen musste, öfters ganz schönen Pfusch gebastelt zu haben. Ein Anflug von Betrübnis war nicht zu vermeiden.
So waren Adam und Eva seine Lichtblicke. Er verheimlichte ihnen, draußen jenseits des Paradiestores Milliarden von Adams und Evas geschaffen zu haben, weil er zumindest hier im Paradies einen Original-Adam und eine Original-Eva behalten wollte. Jeder braucht ein bisschen Geselligkeit, und wenigstens der liebe Gott will sich noch auf Unverfälschtheit verlassen können. Nun sah er Eva am Paradiestor durchs Schlüsselloch schielen, und sein Ruf, sich auf den einheimischen Obstbau zu besinnen, schlug fehl.
Währenddessen hatte Eva langsam ihr durchbrochenes Feigenblatt ausgezogen und Adam dazu animiert, das Tor zu entriegeln. Geblendet traten beide hinaus in eine Fassade von Leuchtreklamen, Werbeplakaten, hupenden Autostaus, Achselschweiß, Deodorants und wurden böse von einigen Verkehrsteilnehmern angeschrien, weil sie bei Rot über die Straße gingen. Überall lagen Blechbüchsen, Bierdosen, Pappteller, weggeschmissener Hausrat und Kleiderlumpen herum. Auf riesigen Halden kippten lustig orangefarbene Autos bunte stinkende Haufen aus, die von Milliarden Adams und Evas stündlich produziert und wieder abgeworfen wurden. Adam nahm eine leere Bierdose und betrachtete sie nachdenklich. Dabei rutschte er auf einer anderen aus. Es war, als er am Boden lag, als entwickele sich sehr langsam noch in ihm eine Idee.
Hinter ihnen hatte der liebe Gott kopfschüttelnd und mit jenen schon bekannten verkniffenen Augen traurig das Paradiestor geschlossen. Es hat also gar keine Vertreibung stattgefunden. Adam und Eva vertrieben sich selber. Dafür wurde dann später von Ober-Adams der Begriff „Preis der Freiheit“ erfunden.
Seit dieser Zeit litt der liebe Gott an Vereinsamung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er eines schönen Herbsttages erfreut aufsprang, als draußen ans Tor geklopft wurde. Beim Öffnen wäre er beinahe von einem schwarzen Porsche überrollt worden, der die Blumenrabatten zerfetzte und mitten hinein in die riesige grüne Paradieswiese furchte. Heraus stiegen ein smarter Herr in einem schwarzen Anzug, weißen Hemd und dunklen Schlips, wie sie Manager tragen, um einen gequält edlen und seriösen Eindruck zu erwecken. Er zückte sofort ein Handy wie einen Colt, und die blonde coole Dame neben ihm einen Taschencomputer. Der Herr tippte schon mal eine gewünschte Nummer ein, die Dame begann einige notwendige Vorsätze auf den Monitor zu zaubern.
„Ausgezeichnetes Gelände!“, rief der Herr ins Handy. „Fällt nach Norden in gewaltiger Länge ab. Obere Beschaffenheit Wiese. Da ist viel einzubringen und zu verdienen. Das rechnet sich! Genauere Angaben liefert der Computer. Könnt aber schon kommen. Bringt eine Kettensäge mit!“
„Dürfte ich wissen, wer Sie sind?“, fragte der liebe Gott, und sein gekräuselter grauer Bart begann auf eine nicht für möglich gehaltene Weise zu zucken.
„E & A“, sagte der Herr und zeigte seine Karte. Darauf stand MANAGEMENT FÜR EINE SAUBERE WELT.
„Und was habe ich damit zu tun?“, rätselte der liebe Gott.
„Wir laden hier unseren Dreck ab. Draußen ist absolut kein Platz mehr. Sind Sie mit sechzig Millionen einverstanden?“
Der liebe Gott bekam zum ersten Mal eine Falte auf der Stirn.
„Ich verstehe nicht …“
„Mann, ganz schön clever, der Alte“, bemerkte die Dame. „Einhundert Millionen Dollar unser letztes Angebot!“
„Woher kenne ich Sie nur“, sinnierte der liebe Gott.
„Wir haben mal hier gewohnt“, erwiderte der Herr.
Durch das Paradiestor donnerte jetzt eine nicht enden wollende Kolonne orangefarbener Müllfahrzeuge und begann das Paradies zu verfällen. Zwei Männer setzten eine Motorsäge an den Baum der Erkenntnis.
Da war zu sehen, dass auch der liebe Gott erschrecken kann. Er kletterte bis in die Krone des Baumes hoch und fing an, mit Äpfeln zu schmeißen. Zuerst wahllos, dann sehr gezielt.
Er bombardiert noch immer.
Aber gleich sind die Äpfel verschossen.
Zeigt her eure Schuh‘ ...
Jeden Nikolaustag wiederholt sich dasselbe: Ich bin noch kindlich genug, sofort beim Aufstehen nach meinen Schuhen zu sehen. Natürlich hat meine Frau wieder daran gedacht. Ein paar Socken oder ein Schokoladenweihnachtsmann sind es allemal. Ich habe erneut vergessen, ihr etwas in die Schuhe zu schieben. So stehe ich da, ein verunglückter Nikolaus, und weil der Tag einmalig im Jahr ist, schwindet die Chance, alles wieder gutzumachen, unwiederbringlich dahin. Aber spielen wir nicht jeden Tag im Jahr Nikolaus? Wir kommen mit weißen Bärten der Unschuld verkleidet, Selbstlosigkeit vortäuschend, auf leisen Sohlen daher und schieben anderen etwas in die Schuhe. Die haben dann lange daran zu knabbern. Je sauberer die Schuhe, umso dreckiger der Inhalt. Und hat schon mal einer St. Nikolaus gesehen? Nie! Deshalb sind auch wir bei unserer Schieberei nicht zu ertappen. Wir waren es nie. Und wir sagen das bei jeder sich bietenden Gelegenheit ganz deutlich.
Schon zu meiner Schulzeit hatten wir in meiner Klasse einen Fall, der mir noch heute zu denken gibt: Ein Zettel mit einem Vierzeiler (nein, nein, ich war das nicht!) über einen unbeliebten, weil prügelnden Lehrer geriet in dessen Hände, und er stellte die drohende Frage: „Wer war das?“ Die Klasse schwieg. Er trat an die erste Bank und wiederholte die Frage schärfer. Seine ersten Opfer waren zufällig gleich die Urheber des Verses. Doch sie wiesen auf die Bank hinter ihnen, deuteten auf zwei andere und erklärten: „Der kam von dort.“
Die Nächsten zeigten auf die nächste Bank, und so ging das lustig weiter, bis der wutschnaubende Lehrer vor der letzten Bank angekommen war. Dieselbe, diesmal aber gefährlich zischende Frage. Die zwei Unglücklichen fanden nichts mehr hinter sich als die leere Klassenzimmerecke und stammelten wie alle ihre Vorgänger: „Der kam von dort.“
Da setzte es die gewohnten gefürchteten Prügel für zwei, die den Vierzeiler nicht einmal gelesen hatten.
Selbst wenn wir nur noch eine leere Ecke haben, in die wir getrieben wurden, deuten wir dorthin und sagen: „Der war es.“
Schon in der DDR spielten wir fleißig St. Nikolaus. Da hatten wir die Stiefel des Klassenfeindes parat, schöne geräumige Hochschäfter, in denen wir sogar unsere eigenen abgetragenen Filzlatschen verstecken konnten. Alles, was auf unsere Kappe ging: hinein! Zu den Betriebsversammlungen schwiegen wir, wo wir hätten reden müssen, wenn vom derartiger Blödsinn heruntergeleiert wurde, dass es uns beinahe die Nikolausschuhe auszog. Das waren doch die anderen, nicht wir. Wir waren nur das Volk. Wir planten, arbeiteten und regierten mit. Die anderen nannten sich „aus dem Volke hervorgegangen“. So richtig konnten wir mit denen nichts anfangen. Jetzt sind wir das Volk, und es gibt gar keine Frage, wer die anderen sind. Haben wir ein Glück. Die anderen brauchen jetzt nicht mehr wir zu sein. In den Bundestagsdebatten spielen die uns nun den Nikolaustag vor, während uns draußen die engen Hühneraugen drücken. Indessen geht drinnen der Reim um: „Zeigt her eure Füßchen, zeigt her eure Schuh’ ... Und dann wird tüchtig hineingeschoben. Da müssen sogar die feinsten Lackschuhe herhalten. Wir ziehen vorsorglich Sandalen an. Die sind nach allen Seiten offen. Da fällt alles wieder heraus, dieses Schuhgeschobene. Wir putzen die Stiefel der anderen, um uns ein paar Turnschuhe zu verdienen. Vielleicht ist das ein Grund dafür, weshalb wir nicht das Zeug zum Vorbild haben den Kindern gegenüber. Die beobachten uns immer misstrauischer, wenn wir ihre Stiefelchen bis zum Gehtnichtmehr vollstopfen. Wir erleichtern damit unsere Schuldgefühle. Ein kleiner Schokoladennikolaus hätte es auch getan. Aber die Stiefel werden immer größer. Und daran sind die anderen schuld. Am 6. Dezember knieen wir uns nieder und beten:
Lieber guter Nikolaus
zieh uns nicht die Schuhe aus.
Uns’re Socken, die sind rein.
Schuld können nur die andern sein.
Oh, heiliger Nikolaus, Schutzpatron der Kinder, sei auch unserer! Wir haben den Schutz bitter nötig vor uns selber. Denn wir weisen immer wieder in die Ecke und rufen: „Der war es!“ Der andere, der andere, der andere ... Wenn wir reihum sind, bleibt da keiner mehr übrig? Sind wir alle unschuldig? Oder gibt es auch welche, die ihre Last aufnehmen?
Indem wir verweisen, verdrängen wir. Unsere unselige Geschichte, die Gegenwart, ja, selbst die Zukunft. Dabei müssten wir auch in laienhafter physikalischer Kenntnis wissen, was eine Verdrängung Schreckliches bewirken kann. Wir aber schauen den Showmastem unserer modernen Welt geködert und auch noch genüsslich zu, die mit banalen Bemerkungen fragwürdige Intelligenztests an uns vornehmen. Wir waren es wieder einmal nicht, die sie unterstützten. Zum nächsten Nikolaustag packe ich aber ganz bestimmt, sollte keine leere Ecke mehr hinter mir sein, meine eigenen Sachen, meinen Geschichtsschrott, meine verrosteten Gedanken, meine Ideentrümmer, meine Schuldgefühle, Versäumnisse und Hoffnungsfunken in meine eigenen Schuhe. Vorausgesetzt, es sind keine anderen da. So weiß ich wenigstens, was ich drin habe. Nun packe ich alles sehr sorgsam aus und versuche mich trotzdem darüber zu freuen. Dann ziehe ich meine Schuhe an und lerne das Laufen.
„Schön, dass Sie da sind!“
Es ist nicht zu übersehen, wie bei uns in zunehmendem Maße Partys entstehen, denen ein geschäftliches Interesse zugrunde liegt. Man sieht das an den gepflegt harten Mienen der Gäste. Wie Pfadfinder schlängeln sich manche durch die herumstehenden Körper, über alle Gesichtszüge strahlend, auf vermeintliche Objekte zu, strecken die Arme aus und rufen: „Schön, dass Sie da sind!“
Solch ein Ruf verbreitet eine vernichtende Herzlichkeit. Häuft er sich auf jener Party wie Vivat-Schreie, so bekommt das Ganze den Charakter eines Kasperletheaters. Dort taucht Kasperle auch vor seinen verstaubten Pappkulissen auf und ruft: „Seid ihr alle da?“ Und alle freuen sich, dass sie da sind. Hauptsache, man wird gesehen und kann seine Federn plustern. Wie früher das Glück unverhofft über den Weg, kann einem ja ein Sponsor über den Weg laufen. Ein Sponsor ist ein wunderbarer Hahn, der Hühnchen sucht, damit sie ihm wieder goldene Eier legen. Nach einem Hahnentritt folgt glückliches Gegacker. Und der alte Hahn kräht dann sein werbendes Kikeriki in die Geschäftswelt. Wir sponsern uns gegenseitig an. Nie wurde mir so viel nachgerufen: „Einen schönen Tag noch!“ Nie fragte mich jemand so häufig besorgt: „Na, ist noch alles in Ordnung?“ Wir haben einen Grad des Miteinanders erreicht, der so anheimelnd ist wie die Atmosphäre beim Zahnarzt.
Neulich erhielt auch ich eine Einladung zu einer Party, weil sie dort zur Illustration einen Schriftsteller ausstellen wollten. Ich bekam ein Glas Sekt in die Hand gedrückt und wurde um die Einnahme von Leberwurstbrötchen mit halben gekochten Eiern gebeten. So stand ich malmend herum und suchte krampfhaft nach vertrauten Gesichtern. Ich fand niemand. Lediglich liefen einige gestresste Hühnchen herum auf der Suche nach geeigneten Hähnen, und sie hatten in ihren Augen jenen bittenden Ausdruck wie jene kleinen Beamten bei Gogol, die nicht genug wiederholen konnten „Wenn Sie in Petersburg sind, dann vergessen Sie bitte nicht, die Namen Bobschinsky und Dobschinsky zu erwähnen.“
Endlich eilten einige Fremde auf mich zu, die sich inzwischen über meinen Status informiert hatten, und riefen, ihre Literaturkenntnisse demonstrierend: „Schön, dass Sie da sind!“
Dies wiederum versetzte mich in den geschmeichelten Irrglauben, sie kennen mich vielleicht doch. Aber da liefen sie bereits auf andere Neuankömmlinge zu und riefen dasselbe.