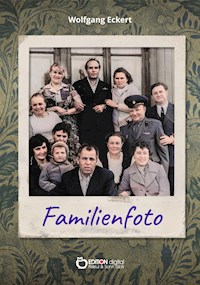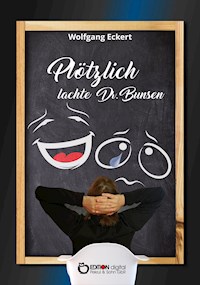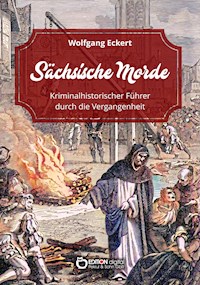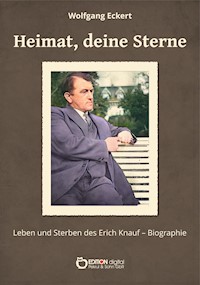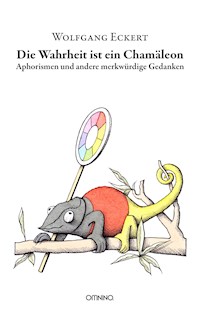12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Omnino Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kriminalkommissar Christian Gellert hat es gar nicht gern, wenn bei ihm eine Verwandtschaft zu dem deutschen Dichter Christian Fürchtegott Gellert vermutet wird. Denn er liest nicht. Höchstens Ermittlungsberichte. Auf Fragen, den Dichter betreffend, antwortet er trocken: „Ich bin sein Urgroßvater.“ Er besitzt eine Frau, die ihm als ehemalige Röntgenassistentin das Luftanhalten beibringt und außerdem ein Enkel Lottchen, das einfache Lottchen, welches ihm bei der Aufklärung des Mordes an Waltraud Balluschak gelegentlich von der Spur abbringt. Während seiner Ermittlungen in dem kleinen erzgebirgischen Dorf Siebenacht kommt er Land und Leuten näher. Aber scheinbar erfolglos irrt Gellert von einer Ermittlung zur anderen. Da kommt er auf eine Idee. Und sie wird ihn zum Mörder oder der Mörderin führen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN: 978-3-95894-146-5 (Print) / 978-3-95894-147-2 (E-Book)
© Copyright: Omnino Verlag, Berlin / 2020
Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen und digitalen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten.
E-Book-Herstellung: Open Publishing GmbH
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
1.
Kriminalkommissar Christian Gellert saß in seinem Dezernat, als das Telefon schrillte und er von seiner vorgesetzten Dienststelle informiert wurde, dass im erzgebirgischen Siebenacht oberhalb am Waldesrand eine Frauenleiche von Forstarbeitern gefunden worden war. Offenbar durch äußeren Einfluß zu Tode gekommen. Er solle sich umgehend in Bewegung setzen und ermitteln. Kollegen der Mordkommission seien schon unterwegs, um das Gelände abzusichern.
Gellert verstaute einige nun zweitrangig gewordene Akten in seinen Schreibtisch, schob eine Tüte mit Wurstbrötchen und eine Flasche Mineralwasser in seine Arbeitstasche. Dann ging er noch einmal auf die Toilette und betrachtete sich hinterher misstrauisch beim Händewaschen im Spiegel, ob er wirklich wie ein Kriminalkommissar aussieht, der noch einige Jahre bis zur Rente hat. Er ging ins Revier hinab, das zu ebener Erde lag, und verließ es mit der knappen Bemerkung, er sei im erzgebirgischen Siebenacht und käme heute nicht wieder zurück.
Auf dem Parkplatz vor dem unauffällig eingerichteten Morddezernat wartete sein grauer Ford, der ebenfalls so aussah, als hätte er es nicht mehr weit bis zur Verschrottung. Gellert empfand, dass sie beide gut zusammenpassten. Er gab Siebenacht in sein Navi ein, und kurze Zeit später begann die Dame im Navi ihm Vorhaltungen zu machen, wie er zu fahren hatte.
Natürlich sah Gellert nicht wie ein Kriminalkommissar aus. Keine breiten Schultern, keine imposante Körperlänge, kein energisches Kinn, kein scharfer, alles durchdringender Blick. Christian Gellert, dem es missfiel, wenn ihn andere mit dem deutschen Dichter Christian Fürchtegott Gellert verglichen, denn er las nicht, höchstens Ermittlungsberichte, sah wie der Finanzbuchhalter einer kleinen Bürstenfabrik aus: Er trug eine blassgraue Brille mit rechteckigen randlosen Gläsern, hinter denen die Augen etwas größer wirkten. Alles in allem war die Brille das Ergebnis einer schlechten Beratung durch den Optiker. Die Brille verfeinerte Gellert. Man konnte vermuten, dass er über jeden Mord heftig erschreckte. Ein Umstand, der ihn harmlos und unsicher erscheinen ließ, beinahe scheu, und Verbrecher arglos machte. Darauf beruhte sein Erfolg. Denn er hatte in seiner langen Laufbahn etliche Täter zur Strecke gebracht. Aber einige waren ihm auch entgangen. Er wusste, wie unterschiedlich die Gesichter Ermordeter aussehen konnten. In letzter Zeit befiel ihn Widerwillen, sobald er an diese Gesichter dachte. Er spürte Müdigkeit, wenn ihm die noch verbleibenden drei Jahre Fahndung auf einmal so lang vorkamen. Jahrzehnte war er Tätern auf der Spur und ihren Motiven, zu morden, so dass diese mühevolle Kleinarbeit ihn zu philosophischen Grübeleien brachte. Seine Arbeit als Berufung, Böses zu sühnen. Er tat das als notwendiges Muss.
Langsam begann das Gelände hügelig zu werden. Er wusste, dass er sich auf einer lang gestreckten Bundesstraße befand und irgendwo daran dieses Kaff Siebenacht auftauchen musste. Rechts und links abgeerntete Felder, Strohballen darauf verstreut wie riesige Klorollen. Hinter den Feldern begann der Fichtenwald zunächst noch lückenhaft, dann aber dichter werdend an die Straße heran zu rücken. Kleine Dörfer mit spitzen Kirchtürmen als einzige Erhebung darin tauchten auf. Die Dame im Navi hatte wenig Arbeit und schwieg meistens.
Dann kamen die ersten Berge. Die Wälder darauf wirkten wie grüner Samt. In der Ferne breit gezogen die Hänge zweier Berge, des Fichtelberges und des Keilberges im Böhmischen. Gellert dachte sich in die Ferne, in Urlaubsorte, mit Hirschbratengeruch in den Gaststätten, Läden mit bunten Kunstgewerbeartikeln, Weihnachtsstimmung, die Sessellifte, den Seilbahnbetrieb. Wie konnten Menschen in dieser sanften und harmonisch wirkenden Landschaft andere umbringen? Oder wartete ein Selbstmord auf ihn?
Wie um seine trüben Gedanken zu unterstützen, prasselte plötzlich ein kalter Novemberregen gegen die Frontscheibe des Fords. Gellert schaltete die Scheibenwischer ein, und sie rafelten mit einem quietschenden Geräusch über die Vorderfront. Graue Wolken hingen schwer und ausgetriefelt in die Berge. Die Straße glänzte wie nasse Seide, er ging mit dem Tempo etwas herunter. Kurze Zeit später erreichte er Siebenacht. Da er dort kein konkretes Ziel angeben konnte, hielt die Dame im Navi ihr Schlusswort. Das Dorf erstreckte sich links im Tal, rechts der Straße reihten sich einige Häuser wie verloren aneinander. Gellert fuhr langsam suchend an ihnen vorbei. Er überlegte schon, ob er ins Dorf hinunter müsse. Die Abfahrt hatte er übersehen. Bei dem Verkehr, der ihn von vorn und hinten umgab, war ein Wenden riskant. Aber da erkannte er vom Dorf entfernt oberhalb eines Waldstückes und auf einem der abgeernteten Felder einige Fahrzeuge. Beim näheren Heranfahren sah er, dass es Polizeiautos waren, ein Notarztwagen und ein silbernes Leichenauto mit milchig gefärbten Fenstern. Der Platz bis zum Waldrand war weiträumig mit rotweiß gestreiften Stoffbändern abgeschirmt. Leute bewegten sich darin wie Landvermesser. Gellert fuhr bis zum äußersten Rand der Straße, möglichst mit seinen Reifen den schlammigen Untergrund des Feldes vermeidend. Er stieg aus, der Regen empfing ihn eisig, und er ärgerte sich, dass er keinen Hut bei sich hatte. Am Eingang des umbänderten Geländes stand ein Polizist, wahrscheinlich aus dem hiesigen Revier, denn Gellert kannte ihn nicht. Der Polizist nahm eine sperrige Haltung ein, die Arme abgewinkelt, die Brust gespannt. Er sah dem Passanten entgegen und musterte seine des aufgekommenen Windes wegen nach vorn gebeugte schmale Gestalt und die vom Regen nass auf die Stirn geklebten Haarsträhnen. Er kannte solche Leute, die sich als Gaffer ansammelten und mit ihren Smartphons von allen Seiten abenteuerliche Aufnahmen schossen.
„Gehen Sie bitte zurück zu Ihrem Auto und fahren Sie weiter“, sagte er.
„Kriminalkommissar Gellert“, sagte Gellert und hielt dem Ordnungshüter seinen Ausweis hin.
Der Polizist prüfte tatsächlich und immer noch misstrauisch Gellerts Ausweis, erkannte schließlich die Wahrheit, trat zur Seite und entschuldigte sich, nur seinen Auftrag ausgeführt zu haben.
Der Mediziner Dr. Schmuck und Gellerts Mitarbeiter Papritz standen an einem Stapel aufgeschichteter Fichtenstämme, die bereits entästet zum Abtransport bereit lagen. Ein Fotograf war dabei, seine Kamera zu verstauen. Gellert zog den Duft frisch geschnittenen Holzes ein. Er gab Dr. Schmuck und Papritz die Hand. Dicht vor dem Holzstoß lag mit dunkelblauer Folie zugedeckt die Leiche. Ihre Umrisse waren zu sehen. Gellert beugte sich darüber und wickelte die Folie zurück. Die Frau lag auf der Seite, dem Holzstoß zugewandt. Ihr linker Arm klemmte unter dem Körper, der rechte zeigte in Richtung des Holzstoßes. Es sah so aus, als hätte sie jemand in stabile Seitenlage gebracht. Sie trug einen roten Anorak und hellblaue Jeans. Das dunkelblonde Haar war mittellang. Vom Schädel über die Stirn bis zur Nase war eine Spur getrockneten Blutes zu sehen. Im rechten Ohr, das Gellert nur sehen konnte, steckte ein muschelweiß schimmernder Ohrclip in Form eines Blattes. Der Regen tropfte auf ihr starres gelbliches Gesicht und schien es zu beleben. Die Haut war glatt, wie aus Stein, und Gellert dachte, dass solche Glätte jünger machte. Er schätzte die Frau auf Mitte Vierzig. Und wieder empfand er sein trauriges Geschäft. Er zog die Folie über die hingestreckte Frau und sah Dr. Schmuck fragend an. „Wann?“
„Etwa zwölf bis fünfzehn Stunden“, sagte Dr. Schmuck.
„Also gestern Abend“, stellte Gellert fest.
„Sie muß sich an dem Holzstoß hochgezogen haben und dann zurück gefallen sein. Wahrscheinlich trat unmittelbar danach der Tod ein“, erklärte Papritz.
In der Nähe warteten einige Polizisten mit Spürhunden an der Leine, die aber ruhig standen und nicht auf Suche gingen.
„Der Regen“, bemerkte Papritz. „Sie haben nichts gefunden in welche Richtung auch immer.“
„Brauchen Sie mich noch?“, fragte Dr. Schmuck und sah auf seine Armbanduhr. „Wir werden die Leiche sezieren. Möglicherweise kann ich Ihnen dann noch Genaueres berichten. Sie wissen ja, wo Sie mich erreichen.“
„Es kann durchaus so sein, dass Sie was finden,“ erwiderte Gellert. „Ich melde mich bei Ihnen.“
Sie sahen zu, wie Dr. Schmuck mit seinem Auto rangierte, das Warnlicht einschaltete und auf die Bundesstraße einlenkte. Der Regen hatte etwas nachgelassen und war in dichtes Nieseln übergegangen, was noch unangenehmer war. Die Polizisten mit den Spürhunden blickten fragend zu Gellert, und er gab ihnen ein Zeichen, dass sie nicht mehr benötigt wurden. Sie bauten ihre Umsperrung ab und verpackten alles in die Kofferräume ihrer Autos. Als sie davon fuhren, blieben nur noch Gellert, Papritz und die zwei Angestellten des Begräbnisunternehmens zurück. Gellert zog fröstelnd den Kragen seines Anoraks höher. Ein Gefühl der Verlassenheit überfiel ihn und erneut empfand er seinen Beruf als verdammt beschissen. Nur Papritz, treu und verlässlich wie immer, nahm ihm ein bisschen das Gefühl der Einsamkeit.
„Gibt es Spuren zur Straße?“, fragte er.
„Eben nicht“, erwiderte Papritz, „nirgendwo ist da was.“
„Und zum Wald?“
„Wir haben den Förster befragt. Die Spuren sind von Rehen, die hier abends auf der Lichtung stehen. Und weiter drin haben Wildschweine diese Nacht alles zerwühlt.“
„Das Blut auf der Stirn. Ist sie erschlagen worden?“
„Doktor Schmuck stellte fest, es wurde vielleicht zwei bis dreimal mit einem harten Gegenstand auf sie eingeschlagen. Der letzte Hieb kann tödlich gewesen sein.“
„Und? Etwas gefunden? Irgendein Knüppel oder ein Eisen?“
„Nichts. Der oder die Täter waren wachsam.“
„Hmmm“, machte Gellert. Er maß die Strecke zur Straße mit Blicken. Es war ein fester, von schweren Forstfahrzeugen hart gewalzter Weg. Ein Selbstmord kam also nicht infrage. In letzter Zeit hatten sich einige Mordverdachte als Selbstmorde heraus gestellt. In einer Gesellschaft, die immer so sehr von ihren Werten schwärmte und Comedians mit ihren billigen Späßen auch noch ganze Säle zu primitivem Lachen brachten, waren Selbstmorde nicht gesellschaftsfähig, ungebührliche Antworten. Für Gellert waren die meisten Selbstmorde Morde. Denn oft steckten unerkannte Schuldige dahinter, schuldig am Weg dorthin. Aber Gellert wusste auch, dass er statt Kriminalkommissar hätte besser Philosoph werden müssen, denn er dachte zu sehr über seine Täter nach. „Wenn die Mörder auf der Bundesstraße gekommen sind, gibt es einmal die Möglichkeit aus Aue, Schwarzenberg, da könnte die Grenze ins Böhmische mit ins Spiel kommen, oder sie kamen aus der anderen Richtung aus Zwickau. Da wäre noch die Autobahnauffahrt Meerane. So gesehen sind die Täter für uns in alle Winde verschwunden“, recherchierte Papritz. Er war fast einen Kopf größer als Gellert, viel breiter und sah einem Kriminalkommissar ähnlicher.
„Es kann ja auch eine Frau gewesen sein, eine Rivalin“, überlegte Gellert. Er seufzte. „Papritz, wir sehen alt aus.“
Dann pfiff er plötzlich durch die Zähne. „Fahren Sie nach Siebenacht und holen Sie eine amtliche Person, den Pfarrer oder besser den Bürgermeister. Zweihundert Seelen oder weniger werden es doch dort nur sein. Die müssen sich alle kennen.“
Papritz ging sofort zu seinem VW und preschte davon als ginge es hier nicht um den Tod, sondern das Leben.
Währenddessen begann Gellert ein Gespräch mit den Angestellten des Begräbnisunternehmens. Er verglich beide Berufe mit seinem und stellte fest, dass sie fast ausschließlich mit Todesfällen zu tun hatten. Ob ihnen dies nahe gehe, wollte er wissen. Er bekam zur Antwort, sie hielten sich im Beisein der Angehörigen der Toten dezent und ernst im Hintergrund. Wenn sie sich jedesmal davon tief betroffen fühlten, könnten sie ihre Arbeit nicht mehr durchführen. Sie müssten das alles als eine notwendige Entsorgung sehen. Zu Hause wäre dann zu Hause, und diese Teilung wäre für sie lebensnotwendig. Der eigenen Frau immer die tägliche Traurigkeit, die sie erlebten, vorzuführen, käme dem Ende ihrer Ehe gleich. Gellert dachte an seine Frau und empfand das ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass er sie manchmal um Rat fragte, weil eine Frau oft besser als ein Mann über ihr Gefühl zur Wahrheit fand. Er hatte nicht nur mit Toten zu tun, sondern mit denen, die den Tod verursachten. Und alle diese Überlegungen fanden in der Nähe einer Toten statt, die davon unberührt und weit fort neben ihnen unter einer Plane lag.
Von der Bundesstraße bog Papritz ab und rollte über den festen Feldweg näher. Aus der Beifahrertür stieg ein verschwitzt aussehenden korpulenter Mann. Er ging mit hastigen Schritten, als wollte er die Sache schnell hinter sich bringen, auf Gellert zu, der gleich darauf seine Hand klein in der großen und harten des Bürgermeisters fühlte. Der sah sich unruhig um, bis er die Konturen unter der Plane am Holzstoß erkannte. Es war ihm anzumerken, wie unangenehm ihm die Situation berührte. Während sie auf die Plane zugingen, hielt er sich dicht hinter Gellert. Papritz war ihnen vorausgegangen und zog nun den oberen Teil der Plane zurück. Das harte gelbliche Gesicht der Toten war zu sehen. Der Bürgermeister vermied es, sich näher vorzubeugen. Er starrte lange und beunruhigt auf die Frau. Dann sagte er leise, als könne sie es hören: „Ja, ich kenne die Frau. Ihr Name fällt mir jetzt nicht ein. Aber sie wohnt – sie wohnte – in der Schulgasse gegenüber der ehemaligen Schule.“
Die Angestellten des Begräbnisunternehmens hoben die Leiche mitsamt der Plane auf und verstauten sie im Wagen. Dann fuhren sie nach kurzem Gruß langsam davon.
Die Langsamkeit gab etwas Feierliches. Gellert. Papritz und der Bürgermeister sahen deshalb dem Gefährt nach, als verabschiedeten sie eine nahe Angehörige.
2.
Der Bürgermeister von Siebenacht hatte bald alle Informationen parat. Als ihn Gellert anrief, konnte er berichten, die Tote hieß Waltraud Balluschak, die erst seit einer kurzen Zeit in Siebenacht, Schulgasse 3 gewohnt hatte.
Gellert ließ sofort die Wohnung versiegeln. In der Innentasche der Toten hatten Mitarbeiter der Mordkommission ein Schlüsselbund gefunden. Noch an dem Tag, als Gellert die Wohnungsschlüssel erhalten hatte, fuhr er nach Siebenacht. Er entsiegelte die Tür und sah sich in der Wohnung um. Sie war klein. Wohnstube, Schlafzimmer, Küche, ein enger Flur. Sechs Stufen tiefer im Haus befand sich eine zum Spülklosett umgebaute ehemalige Trockentoilette. Das Mobiliar der Wohnung war nicht das modernste. Die Küche stammte aus DDR-Zeiten. Ein Gaskocher, Scharfensteiner Kühlschrank, Anrichte, Kaffeemaschine, ein Vertiko, in dem sich Teller, Tassen, Schüsseln, Bestecke, Eierbecher und Töpfe befanden. Auf dem Vorbrett des Vertikos stand eine angerissene Tüte mit Kaffeepulver. In einem Fach fand Gellert Brot, Semmeln, Salz, Zucker, Teebeutel, Senfdose. Das Einzelbett im Schlafzimmer war mit einer Zierdecke bezogen. Waltraud Balluschak hatte es am Abend ihres Todes wohl nicht benutzt. Sie war vorher weggegangen. Die Möbel im Wohnzimmer wirkten wie wild zusammengewürfelt. Es fand nicht zueinander. Die Couchgarnitur sah anders aus als die der Sessel. Der Tisch war beigefarben, der Schrank, ebenfalls altes Semester, im dunklen Eichenholz. Einen Teppich gab es nicht. Aber der Holzboden war sauber braun lackiert. Waltraud Balluschak schien nicht reich gewesen zu sein. Ein Auto hatte sie wahrscheinlich auch nicht besessen. Am Schlüsselbund fehlte der dazu passende Zündschlüssel. Ein kleiner Schlüssel entpuppte sich als zum Briefkasten gehörig. Gellert fand vom Tag der Ermordung an zwei Ausgaben der regionalen Presse und eine Pizzeria-Werbung. Sie hatte also am Tag ihrer Ermordung den Briefkasten gar nicht geöffnet entweder, weil sie abgelenkt oder da schon nicht mehr im Haus gewesen war. Wo aber hielt sie sich dann auf? Gellert trat ans Fenster und sah hinüber zur Fassade der Dorfschule, deren Fenster leer zu ihm herüber starrten. Der Beruf des Dorfschullehrers gehörte in vergangene Zeiten. Unter dem nicht großen und unmodernen Fernseher in der Wohnstube lag die aufgeschlagene Fernsehzeitung mit dem Programm vom Vortag ihrer Ermordung. Gellert fand nichts, was ihn hätte auf eine Spur bringen können. Die Wohnung sah aus, als sei sie für eine Durchreise gedacht, wie für einen kurzen Aufenthalt. Gegenüber von ihr die Wohnung war leer. Die Tür stand offen und kahle Wände mit zum Teil abgerissener Tapete waren zu sehen. Es wohnte offenbar niemand mehr in dem stillosen Haus, das wie aus Versehen in die Dorfidylle gebaut war. Gellert versiegelte die Wohnung erneut, obwohl er sich die Frage stellte, wer noch Interesse an dieser armseligen Behausung haben konnte, um dort etwas zu finden. Er beschloss, sich das Dorf anzusehen. Er ließ seinen bejahrten Ford auf dem verlassenen Schulhof stehen. Immer wenn er ihn sah, hörte er Heinz Erhardt singen: Fährt der alte Lord fort, fährt er in einem Ford fort. Oder: Sie sündigten in einem fort. Alte Lieder, die keiner mehr kannte.
Das Dorf hatte nur eine Straße, die vom tiefsten Punkt, der gotischen Kirche, bis hinauf zu einem der Waldesränder führte. Zwei Häuserblöcke, die nicht ins Dorfbild passten, erinnerten an die einstigen LPG-Zeiten der DDR, in denen, wie es damals hieß, Beschäftigte der Landwirtschaft wohnten. Wege führten von der Dorfstraße in Dreiseithöfe, dazwischen standen Bauernkaten. In einem Gehöft bellte hinter dem Zaun ein Schäferhund und meldete nach drinnen, dass draußen ein Fremder vorbei ging. Etwa zwanzig Meter vor Gellert an der Straße hob ein Bauer Milchkannen auf eine Rampe. Er trug eine graue Wattejacke und eine altmodische schwarze Schirmmütze. Als er Gellert näher kommen sah, hantierte er umständlich mit den Kannen, drehte an den Kappen, rückte sie hin und her, solange, bis Gellert auf gleicher Höhe war. Dann musterte er diesen von oben bis unten, kam offensichtlich zu keinem befriedigenden Ergebnis und sagte deshalb ziemlich kurz angebunden „Tag“.
Gellert erwiderte ebenso, und der Bauer verschwand im Eingangstor seines Dreiseithofes. Weiter oben kamen Gellert zwei junge Frauen mit ihren Kinderwagen entgegen. Ihre Kinder saßen mit abgespreizten Armen dick eingemummelt und starr wie Puppen in Wärmesäcken. Die Blicke der Frauen ähnelten dem des Bauern. Aber sie grüßten nicht und sahen beinahe furchtsam an Gellert vorbei. Auf einer großen mit Elektrozäunen umdrahteten Wiese stand eine Herde schwarzer Büffel mit ihren Jungtieren. Gellert bestaunte die mächtigen geschwungenen Hörner. Der Anblick der Büffel wirkte fremd auf ihn, der hier eher weißbraun gefleckte Kühe erwartet hatte. Am Ende der Dorfstraße, fast in der Nähe des Waldrandes, saß ein Mann auf der Bank vor seinem Siedlungshaus und dengelte eine Sense. Am Gartentor neben dem Briefkasten stand ein verschiebbares Schild mit der Aufschrift ZIMMER FREI. Das gleichmäßige Klopfen des Hammers auf die Sensenschneide war das einzige Geräusch in der abendlichen Stille.
Gellert blieb am Zaun stehen und sah dem Mann bei seiner Arbeit zu. Der mochte etwa um die Siebzig sein. Als er sein Dengeln unterbrach und vorsichtig mit dem Zeigefinger über die Schneide strich, bemerkte er Gellert und lächelte ihm zu. Der Erste, welcher nicht misstrauisch ist, dachte Gellert.
„Wollen Sie zu mir?“, fragte der Mann.
„Eigentlich nicht“, erwiderte Gellert, und mit einem Kopfnicken in Richtung Sense: „Ich glaube, das kann nicht jeder.“
„Naja“, sagte der Mann, „vom Metall muss man was verstehen. Das braucht schon Jahre.“