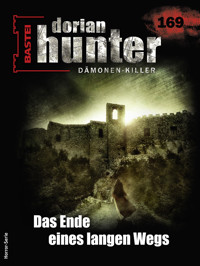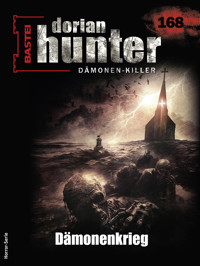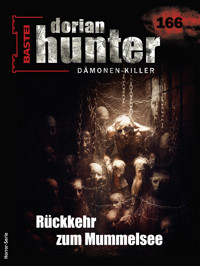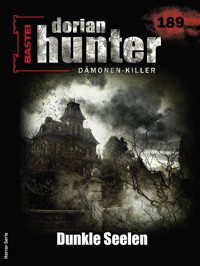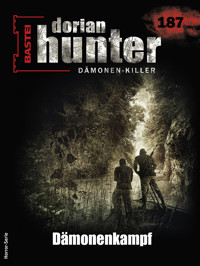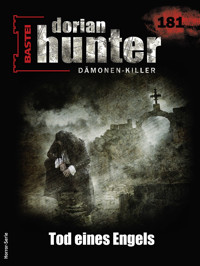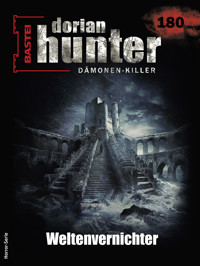
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Haben Sie Angst vor dem Ende, Dorian Hunter?«, fragte Nathaniel. »Ist es das, wovor Sie sich fürchten, obwohl ihr Menschen eure Welt doch schon zugrunde gerichtet habt?« »Wir haben immer unser Schicksal gemeistert, und es wird ein Tag der Wende kommen«, erwiderte Dorian. »Sie können nicht einfach daherkommen und behaupten, dieser Planet würde in einigen Jahren eh zugrunde gehen. Dann warten Sie doch ab! Für Sie macht es doch keinen Unterschied, ob Sie diese Welt jetzt auslöschen oder in aller Seelenruhe darauf warten, dass sie es selbst tut!« Nathaniel sah zum Meer hinaus. »Interessanter Aspekt. Und dennoch werden Sie mich nicht umstimmen können.« »Dann haben wir alles verloren«, raunte Dorian ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Was bisher geschah
WELTENVERNICHTER
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
mystery-press
Vorschau
Hat Ihnen diese Ausgabe gefallen?
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Der ehemalige Reporter Dorian Hunter hat sein Leben dem Kampf gegen die Schwarze Familie der Dämonen gewidmet, seit seine Frau Lilian durch eine Begegnung mit ihnen den Verstand verlor. Seine Gegner leben als ehrbare Bürger über den Erdball verteilt. Nur vereinzelt gelingt es dem »Dämonenkiller«, ihnen die Maske herunterzureißen.
Bald kommt Dorian seiner eigentlichen Bestimmung auf die Spur: In einem früheren Leben schloss er als Baron Nicolas de Conde einen Pakt mit dem Teufel, der ihm die Unsterblichkeit sicherte. Um für seine Sünden zu büßen, verfasste de Conde den »Hexenhammer« – jenes Buch, das im 16. Jahrhundert zur Grundlage für die Hexenverfolgung wurde. Doch der Inquisition fielen meist Unschuldige zum Opfer; die Dämonen blieben ungeschoren. Als de Conde selbst der Ketzerei angeklagt und verbrannt wurde, ging seine Seele in den nächsten Körper über. So ging es fort bis in die Gegenwart. Dorian Hunter begreift, dass es seine Aufgabe ist, de Condes Verfehlungen zu sühnen und die Dämonen zu vernichten.
In seinem Kampf findet Dorian mächtige Verbündete – die Freimaurerloge der Magischen Bruderschaft; den Hermaphroditen Phillip, der stets in fremden Sphären zu leben scheint; den Steinzeitmenschen Unga, der einst dem legendären Weißmagier Hermes Trismegistos diente; den früheren Secret-Service-Agenten Donald Chapman, der von einem Dämon auf Puppengröße geschrumpft wurde; vor allem aber die ehemalige Hexe Coco Zamis, die aus Liebe zu Dorian die Seiten gewechselt hat und ihm einen Sohn, Martin, geboren hat. Aber die Dämonen bleiben nicht untätig: Es gelingt ihnen, mit dem Castillo Basajaun einen wichtigen Stützpunkt der Magischen Bruderschaft in Andorra zu zerstören. Damit bleibt Dorian als Rückzugsort nur noch die Jugendstilvilla in der Londoner Baring Road.
Bei Ausgrabungen in Israel wird ein geheimnisvoller Kokon entdeckt, dem der Angisus Nathaniel – ein »Engel« – entsteigt. Dieser ist schockiert über den Zustand der Erde. Nathaniel plant den Untergang der Dämonen und Menschen, um der Welt einen kompletten Neubeginn zu ermöglichen. Er entführt den Hermaphroditen Phillip aus der Jugendstilvilla, nimmt Abi Flindt den magischen Bumerang ab und verschwindet mit Helena Riedberg.
Luguri, der Fürst der Finsternis, wird von der Vampirin Rebecca, die dank Baphomets Erbe überragende Fähigkeiten erlangt hatte, besiegt. Aber Rebecca wird das magische Band zum Hexer Nevermann zum Verhängnis. Die Schwarze Familie eignet sich mit juristischen Tricksereien die Jugendstilvilla an. Da dort aber nach dem Kampf Nathaniels mit seiner abtrünnigen Artgenossin Alannah ein magieloser Zustand herrscht, ist die Villa für die Dämonen wertlos. – Der dämonische Archivar Zakum fordert auf einem Sabbat potenzielle Kandidaten dazu auf, sich als neuer Fürst zu bewerben. Die Teufelin Angelina will sich qualifizieren, indem sie Dorian Hunter erledigt. Auf der Flucht gerät Dorian in die Gewalt Nathaniels.
WELTENVERNICHTER
von Martin Kay
Das Kreischen von exotischen Vögeln, das ferne Knurren von wilden Tieren und das Rauschen der Meeresbrandung waren überall gegenwärtig auf der kleinen Insel, irgendwo in der Südsee.
Fernab jeglicher Zivilisation lag dieses Eiland, und es war das wahre Paradies für einen Aussteiger wie Jesus Emilio Gonzalves. Keine Umweltverschmutzung, sauberes Trinkwasser in den Bergquellen und reichlich Nahrung in jeglicher Form.
Was wollte jemand, der von allem, was der routinierte Alltag mit sich brachte, die Schnauze gestrichen voll hatte, mehr?
Keine Kriege, kein Verbrechen, nur Leben pur!
Das war es, was Emilio – er hasste seinen ersten Vornamen – seit Langem ersehnte. Fort von México City, fort von über acht Millionen Menschen, von denen über die Hälfte am Hungertuch nagte und in der Gosse lebte.
Schon lange hatte er einfach alles hinwerfen wollen, seinen Job, seine Familie, doch immer wieder hatte er sich ins Gewissen reden lassen.
1. Kapitel
Nun nicht mehr! Er hatte all seine Ersparnisse in eine Überlebensausrüstung investiert, dann auf einem Frachtschiff in die Südsee angeheuert und war letztendlich mit einem kleinen, gekauften Motorboot hier gelandet – einer Insel, die zu klein war, um auf irgendeiner Karte verzeichnet zu sein. Weit weg von jeglicher Fluglinie, ein zu unbedeutendes Fleckchen, als dass es von Spionagesatelliten beobachtet werden könnte. Das war die Freiheit!
Er hatte seiner Familie – Frau und zwei Kinder hinterließ er – einen Abschiedsbrief und ein wenig Geld dagelassen. Wohin er gegangen war, wusste niemand. Schon längst hatte er gespürt, dass er nicht mehr ins Familienleben, nicht mehr in den Alltag passte. Die Flucht in die Einsamkeit war das Einzige, was ihn vor einem geistigen Kollaps bewahren konnte. Wahrscheinlich würden Psychiater das genaue Gegenteil behaupten, nämlich dass er schon längst durchgeknallt war, wenn er für das Leben auf einer Insel seine Familie im Stich ließ und seinen Beruf als leitender Angestellter einer Lebensmittelkette einfach wegwarf für ... ja, für was eigentlich?
Ein Leben in Freiheit!, sagte sich Emilio Gonzalves selbst.
Er war vor vier Tagen hier eingetroffen und hatte sich schon bestens mit seiner neuen Heimat vertraut gemacht. Es gab alles, was er zum Leben brauchte im Überfluss, und er hatte alle Zeit der Welt, sich die Umgebung anzusehen. Natürlich konnte er in den ersten Tagen nicht auf einige Errungenschaften der Menschheit verzichten, wenn er in der Wildnis überleben wollte. So hatte er sich ausreichend mit Medikamenten eingedeckt, die die ärgsten Krankheiten bekämpfen konnten. Auch ein Einmannzelt hatte er mitgenommen, das ihm bei Regenfall Unterschlupf gewähren sollte, zumindest so lange, bis er sich selbst eine Hütte gebaut hatte. Er war nicht unbedingt ein Naturfetischist und musste sich selbst beweisen, zu welchen Taten er fähig war – er dachte eher in praktischen Bahnen, und es war für ihn kein Problem, Bäume mit einer dieselbetriebenen Kettensäge zu fällen, um eine Unterkunft zu errichten.
Aber das alles hatte noch Zeit. Zuerst wollte er seine Freiheit genießen, so als mache er einen ausgedehnten Urlaub. Dafür würde auch das Zelt erst einmal genügen. Gonzalves machte sich auch nichts vor, was die Beschaffung von fleischlicher Nahrung anbetraf. Er traute sich nicht zu, Wild mit Speer oder Pfeil und Bogen zu erlegen – so hatte er sich ein Präzisionsgewehr mit mehreren Tausend Schuss Munition besorgt und ein ausreichendes Übungstraining absolviert, ehe er hierher aufgebrochen war. In den letzten Tagen war er nicht unbedingt erpicht darauf gewesen, seine erworbenen Zielkünste an lebenden Tieren auszuprobieren, und hatte sich mit auf den Bäumen und in Sträuchern wachsenden Beeren und Zitrusfrüchten begnügt.
Vitaminreich und gesund, hatte er sich dabei eingeredet.
Doch Ananas und Beeren hingen ihm bald schon zum Hals heraus, und das hartnäckige Knurren in seinem Magen erinnerte ihn daran, dass heute Fleisch auf dem Speiseplan stand. Bevor er sein Wild jagte, richtete Emilio Gonzalves eine Feuerstelle nahe dem Zelt her. Auch hierbei griff er auf gekaufte Dinge wie Anzünder und Grillgestell zurück. Man gönnte sich ja sonst nichts.
Als er endlich alles erledigt hatte, war es bereits Mittag. Gonzalves griff nach dem Gewehr und lud das Magazin. Er verließ den Strand, an dem er das Zelt errichtet hatte, und marschierte landeinwärts. Sein Weg führte über eine Düne direkt in den dschungelähnlichen Wald hinein. Mit einer Machete bahnte er sich einen Pfad durch das Gestrüpp und die unzähligen Farne. Natürliche Wege schien der Regenwald nicht zu haben.
Emilio sah sich aufmerksam um, doch die Pflanzen wuchsen teilweise so dicht beieinander, dass er kaum mehr als ein paar Meter weit schauen konnte. So würde er nie Tiere ausmachen – er musste sich irgendwo auf die Lauer legen. Aber vielleicht gab es von weiter oben eher die Möglichkeit, seine Beute zu beobachten. So stieg er weiter auf und kämpfte sich mühselig durch den Urwald. Schweißgebadet erreichte er schließlich eine Lichtung, von der aus tatsächlich ein Pfad zu den Bergen hinauf führte. Überrascht und neugierig geworden folgte Emilio dem Weg. Unterwegs hielt er mehrmals an und trank fast die Hälfte seines Wasservorrats aus. Er hoffte, dass er auch hier im Gebirge auf eine Süßwasserquelle stieß.
Der Weg schlängelte sich noch eine geraume Zeit durch den Dschungel und mündete schließlich vor einer Bergwand. Emilio konnte sich nicht des Gedankens erwehren, dass der Pfad künstlich angelegt worden war.
Vielleicht bin ich doch nicht der Erste, der diese Insel betreten hat, sinnierte er und entschloss sich, falls er tatsächlich auf Spuren anderer Menschen stoßen sollte, und seien es nur Eingeborene, sofort kehrtzumachen und sich eine andere Insel zu suchen.
Neben dem Bergmassiv reichte der Pfad weiter hinauf und bog dann links ab. Emilio verzog den Mund, gab sich aber einen Ruck und wollte zumindest noch herausfinden, was hinter dieser Biegung lag. Er legte die letzten zwanzig Meter zurück und war überrascht, auf den Eingang zu einer Höhle zu stoßen. Interessiert ging er näher heran und nahm die mitgebrachte Taschenlampe vom Gürtel. Als er die ersten Schritte in die Höhle gesetzt hatte, stellte er fest, dass das künstliche Licht gar nicht notwendig war, da irgendeine fluoreszierende Substanz von den Wänden strahlte und ausreichend Licht spendete, um zumindest den Weg zu sehen. Die stickige und feuchte Luft wollte Emilio zuerst veranlassen, wieder zurückzugehen, doch die Neugierde obsiegte. Der niedrige Gang wand sich tiefer in den Fels hinein und mündete in eine größere Grotte. Auch hier war es seltsam hell, sodass Emilio sofort erkennen konnte, in eine Sackgasse geraten zu sein. Doch er erkannte noch mehr ...
Die Frau war in schwarzes, enges Leder gekleidet, das bei der kleinsten Bewegung knirschte. Sie hockte in der Mitte der Grotte auf dem Boden und betrachtete nachdenklich ein Häufchen Asche, wie es fein durch ihre behandschuhten Finger zu Boden rieselte. Als die letzte Flocke ihre Hand verlassen hatte, zog eine leichte Brise auf. Irritiert schaute sich Gonzalves um, konnte aber keinen Auslöser für den aufkeimenden Wind ausmachen. Der Aschestaub wehre in alle Richtungen davon.
Emilio interessierte in diesem Moment aber gar nicht mehr, woher die Böe kam oder was die Frau allein auf einer so verlassenen Insel zu suchen hatte. Alles, was seinen Blick ausfüllte, war das weibliche Wesen selbst. Mit seinen Augen zog er ihre hinreißenden Formen nach. Ihre Haut war tiefbraun, dunkler noch als seine. Und die langen, schwarzen Haare fielen lockig bis weit auf ihren Rücken. Als sie ihren Kopf zu ihm wandte, erkannte er, dass sie negrider Abstammung war, wenn auch ihre Nase schmaler und zierlicher war, als man es sonst bei diesem Typ vermutete. Als sich ihre Blicke trafen, fühlte Emilio ein schwaches Prickeln in seinen Augen. Dann war ihm, als tauche etwas von außen durch seine Pupillen in seinen Körper, seine Gedanken.
Das war der Augenblick, an dem Jesus Emilio Gonzalves zu einem reinen Beobachter wurde. Er konnte nichts von dem, was um ihn und mit ihm geschah, noch steuern. Wie eine willenlose Marionette stand er am Eingang der kleinen Grotte, unfähig, sich auch nur in irgendeiner Weise zu bewegen. Emilio wusste selbst nicht, wie ihm geschah – aber noch gab es keinen Grund zur Beunruhigung.
Die farbige Frau erhob sich und stolzierte hüftschwingend auf den mexikanischen Aussteiger zu. Ihr Blick wich dabei für keine Sekunde von seinen Augen, und je näher sie kam, desto unwohler fühlte sich Emilio plötzlich. Von der Frau ging eine unbekannte Ausstrahlung aus, etwas, das Gonzalves nie zuvor in seinem Leben gespürt hatte. Und jetzt war es einfach da. Unerklärlich!
Das Kribbeln in seinen Augen nahm zu, und mit einem Mal verschleierte sich seine Sicht. Nebelgespinste huschten vor seinen Augen her, bläuliche und violette Fäden tanzten auf und ab und schienen zu der Fremden hinüberzugleiten. Fasziniert beobachtete Emilio für eine kurze Weile das Spektakel.
Dann kam der Schmerz!
Aus dem leichten Kribbeln wurde ein glühendes Stechen. Er versuchte zu blinzeln, die Lider ganz zu schließen, aber die Motorik seines Körpers ließ dies nicht zu. Er war in den Bann der Fremden geraten, und nur sie konnte für all dies verantwortlich sein. Alles in Emilio schrie danach, sich abzuwenden und davonzulaufen, aber sein Leib gehorchte einfach nicht mehr. So musste er untätig mit ansehen, wie die Frau ihn erreichte. Das Brennen in den Augen trieb ihm die Tränen ins Gesicht. Nur noch verschwommen nahm er sein Gegenüber wahr.
Gran dios, ayuda!, dachte Emilio und wurde sich mit einem Mal bewusst, dass er sich besser eine andere Insel ausgesucht hätte.
Die Fremde legte ihre Hände auf seine Schultern und zog ihn zu sich heran. Gonzalves hatte das Gefühl, als würden ihm die Augen platzen, dann nahm die Hitze, die sich bis in sein Hirn fortgepflanzt hatte, plötzlich ab. Die Schlieren zogen an seinen Augen vorbei, und sein Blick klärte sich wieder. Er sah das Lächeln der Frau, wollte es instinktiv erwidern, aber sein Körper gehorchte noch immer nicht seinen gedanklichen Wünschen.
Die Frau zog ihn noch näher und beugte sich gleichzeitig vor. Ihre Nasenspitzen berührten sich fast. Emilio hatte nicht den blassesten Schimmer, auf was sie hinaus wollte, noch konnte er sich erklären, woher das Brennen in seinen Augen rührte, oder ob er sich dies alles nur eingebildet hatte. Überrascht sah er, wie die Fremde ihren Kopf schräg legte, und schon fanden ihre Lippen die seinen. Emilio fühlte kaltes Fleisch an seinem Mund. Das Prickeln, das zuvor seine Augen malträtiert hatte, fuhr nun über seine Lippen. Sein Mund zuckte. Für einen Moment spürte er, wie seine Knie nachgaben, doch bevor er fallen konnte, hielt ihn die Frau und löste sich schmatzend von ihm. Ihre dunklen, geheimnisvollen Augen sahen ihn durchdringend an.
»Qué me está sucediendo?«, fragte er in seiner Heimatsprache. Was geschieht mit mir?
Er konnte sich nicht vorstellen, dass diese exotische Schönheit Spanisch sprach, aber mit anderen Mitteln konnte er sich nicht ausdrücken. Zu seinem Erstaunen antwortete sie ihm in seiner Muttersprache!
»Su vida para el míos!« Dein Leben für meines ...
Emilio runzelte die Stirn. Zuerst verstand er nicht, was sie damit ausdrücken wollte und glaubte, sie habe das Spanisch falsch angewandt, doch der Moment der Erkenntnis folgte unmittelbar darauf. Die Fremde presste abermals ihre Lippen auf die seinen, diesmal ungestümer, verlangender, fordernder. Das Kribbeln setzte sofort ein. Emilio schwindelte, wurde schwächer, und als er den Sog spürte, mit dem all seine Lebenskraft samt dem, was die Menschen als Geist oder Seele betrachteten, aus seinem Leib gespült wurde, erkannte er den Sinn der Worte.
Dein Leben für meines.
Der erschlaffte Körper des Mexikaners fiel schwerfällig zu Boden. Er wirkte ausgemergelt, und seine vorher noch gesunde, braune Haut, hatte sich in einen aschfahlen Teint gewandelt, geradezu als hätte dieser Leib nie zuvor Leben in sich beherbergt, als würde selbst das Fleisch mit seinen Millionen von biologischen Zellen, lebendig gewesen sein.
Alannah schenkte dem Toten nicht einen Blick. Er hatte seinen Zweck erfüllt und ihr das gegeben, wozu die beiden Aschedämonen nicht in der Lage gewesen waren: Lebensenergie!
Nachdem ihr Auftrag für den selbst ernannten Fürsten der Finsternis beendet war, hatte Luguri sie wieder zu der Gefängnisinsel bringen lassen und ihr die beiden Aschedämonen als Bewacher auf den Hals gehetzt. Der Fürst der Finsternis ging davon aus, dass sie noch immer des Lebens müde war und lieber sterben wollte, doch er hatte die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Alannah war auf jemanden getroffen, der wie sie war. Damit war sie nicht mehr das einzige Wesen ihrer Art auf dieser weiten Welt. Das Zusammentreffen mit Nathaniel hatte neue Lebensgeister in ihr geweckt. Jahrtausende hatte sie allein und von ihrem Volk verlassen auf der Erde gelebt, war melancholisch geworden und hatte das Leben selbst bedauert. Aber Nathaniels Erscheinen hatte alles verändert, dem Trübsal ein Ende bereitet. Nun waren sie zu zweit, konnten wieder etwas bewegen – die Einsamkeit war zu Ende!
O Nathaniel, ich dachte, du wärst bei dem Angriff auf Sodom und Gomorrha umgekommen. Hätte ich nur geahnt, dass du weiterlebst, ich hätte alles versucht, um dir zu helfen!
Freundschaft war es, die sie verband, eine Freundschaft, die alle, die wie sie waren, miteinander teilten. So war es gleichgültig, wen sie wiedergefunden hatte. Allein die Tatsache, dass noch jemand anderes von ihrem Volk unter den Menschen weilte, war ausschlaggebend. Zusammen fanden sie vielleicht einen Weg, in ihre Heimat zurückzukehren, die Pforten zu anderen Welten erneut aufzustoßen ...
Alannah streckte sich und verließ die Grotte durch den einzigen Zugang. Draußen auf dem Felsplateau schaute sie sich um und sog gierig die frische Meeresbrise ein, die vom nahen Ufer bis hierhin hinüberwehte.
»Ja«, sagte sie laut, »zusammen kehren wir heim!«
So erfreulich der Gedanke auch war, er stimmte sie traurig, denn durch Luguri hatte Alannah erfahren, was Nathaniel mit der Welt plante. Er wollte die Erde auslöschen und neu erschaffen, nach dem Bildnis des Paradieses, das in den Köpfen der Angisi herumspukte, einem Zustand, den sie in ihrer Heimat herbeigeführt hatten. Früher hätte Alannah Nathaniel dafür verurteilt, überhaupt an solch eine Möglichkeit zu denken. Aber die Jahrtausende der Einsamkeit und die Gegenwart des finsteren Luguri hatten ihr neue Wege aufgezeigt. Gut und Böse, das waren Werte, die jeder selbst für sich festlegte, so wie es auch die Angisi getan hatten. Was zählte davon noch, hier und jetzt?
Sie schlenderte den steinernen Weg nach unten, nahm jedoch eine andere Abzweigung als die, über die Emilio Gonzalves hergekommen war, und erreichte so nach wenig Zeit den Strand, ohne den Umweg durch den Dschungel gehen zu müssen. Im feinen, fast schneeweißen Sand blieb sie stehen und schürzte die Lippen.
So friedlich ... doch der Schein trügt. Du bist eine verkommene und verdorbene Welt.
Sie wusste nicht, woher die feindseligen Gedanken kamen. Das Einzige, das sie mit Sicherheit sagen konnte, war, dass sie von nun an leben wollte. Die Resignation, die noch vor wenigen Tagen ihr Bewusstsein ausgefüllt hatte, war wie fortgeblasen. Jahrtausende der Einsamkeit waren vorbei. Es war an der Zeit, zu neuen Taten aufzubrechen und das Heft über die Geschicke dieser Welt an sich zu reißen.
Zusammen mit Nathaniel, sagte sich Alannah. Wir werden den Laden übernehmen.
Sie schlug sich mit der Faust in die geöffnete Linke und presste die Lippen grimmig aufeinander. Der Thron des Fürsten der Finsternis lag quasi in greifbarer Nähe. Luguri war zu schwach, um der geballten Macht zweier Angisi etwas entgegensetzen zu können. Alannah erschrak über sich selbst und brachte ihre Eroberungsgedanken zum Schweigen. Zuerst einmal musste sie Nathaniel finden und ihn von seinem wahnwitzigen Plan, den Planeten zu vernichten, abbringen, ihm zeigen, dass sie noch auf seiner Seite stand und seine Freundin war.
»Bei Khartu'un!«, rief sie aus und verschwand in einer gleißenden Lichterscheinung.
2. Kapitel
Das zischende Geräusch war kaum wahrnehmbar, und auch der begleitende Geruch verflog rasch im beständig dahinwehenden Wind. Der Nieselregen hatte aufgehört, doch dafür war der Ackerboden um so schlammiger und rutschig. Wie aus dem sprichwörtlichen Nichts trat eine Frau auf das Feld hinaus. Einem heimlichen Beobachter wäre dies äußerst seltsam vorgekommen, denn es gab im Umkreis von hundert Metern nicht das geringste Versteck, hinter dem sie sich hätte verbergen können. Sie war einfach da, wie aus einer fremden Dimension in die Wirklichkeit materialisiert. Aber es gab diesen heimlichen Beobachter nicht, sodass es die Frau auch nicht kümmern musste, ob jemand ihre Ankunft bemerkt hatte, oder nicht.
Wie so oft hatte sich Angelina einen beigefarbenen Trenchcoat übergeworfen, um ihre bevorzugte sexy Kleidung darunter zu verbergen. Sie hatte nie viel Aufhebens um Mode gemacht, sondern trug gemeinhin das, was ihr am besten gefiel und ihrem Naturell entsprach. Ihre weißen Stiefel waren rasch verschmutzt, als sie die ersten Schritte durch den Matsch angetreten hatte. Es hätte sie kaum Mühe gekostet, mittels Magie über dem Boden zu schweben und sich auf diese Art fortzubewegen, aber genauso wenig Aufwand war nötig, um die Stiefel später zu reinigen. So stiefelte sie einige Minuten durch den vom Regen aufgeweichten Schlamm der abgeernteten Felder, bis sie auf einem Hügelkamm eine einzelne Gestalt ausmachte. Ein Lächeln huschte über ihre Züge. Angelina nickte sich kurz selbst zu und beeilte sich, den Hügel hinaufzugehen. Oben angekommen stand sie ihrer Schwester Chiara gegenüber, wie immer äußerlich verschlossen.
»Warum machst du so ein Geheimnis um unser Treffen?«, fragte Angelina geradewegs heraus.