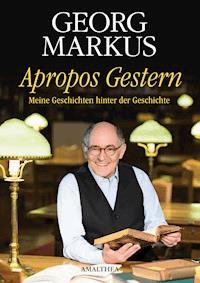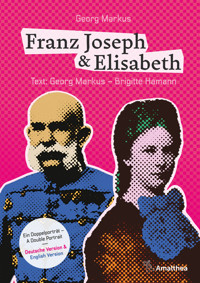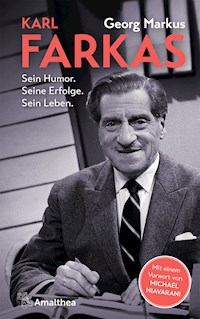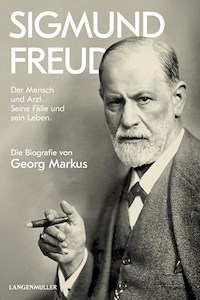Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Georg Markus erzählt die 400 besten Anekdoten aus der Welt des Films und des Theaters, aus dem Kaiserhaus und aus der Politik, von Dichtern, Malern, Ärzten, Dirigenten, Komponisten. Ein Buch, bei dessen Lektüre auf jeder einzelnen Seite herzhaft gelacht werden kann. Kaiser Franz Josephs erste Autofahrt, wie Johann Strauß einem Duell entging, als Hans Moser nicht nuscheln konnte, Wie ein Erzbischof zu sechs Kindern kam, Einbrecher in Karajans Villa, von einem Bettler, der sich Verdis Schüler nannte, wofür Karl Kraus Ohrfeigen bekam, weshalb Billy Wilder aus Freuds Ordination flog, wer der echte "Herr Karl" war u.v.m.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GeorgMarkus
Es hat uns sehrgefreut
Die besten Anekdotenaus Österreich
1. Auflage September 19962. Auflage Januar 1997
© 1996 by Amaltheain der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,Wien • MünchenAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Bernd und Christel Kaselow, MünchenUmschlagillustration: Bruno HaberzettlHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 12/15 Punkt Simoncini GaramondDruck und Bindung: Wiener Verlag, HimbergPrinted in AustriaISBN 3-85002-383-4eISBN 978-3-902998-46-0
Inhalt
»Aus drei Anekdoten das Bild eines Menschen«
Vorwort
Für dreißig Jahre unsterblich
Komponisten sind auch nur Menschen
»Sie werden noch an einem Druckfehler sterben!«
Von den Göttern in Weiß
»Um elf war’s erst halb zehn«
Dichter und ihre Freiheiten
Wo Kaiser unter ihresgleichen sind
Und andere Geschichten aus dem Hause Habsburg
Ihr Auftritt, bitte!
Schauspieler und ihre Rollen
»Sehn S’, das is’ Wien . . .«
Von Hofräten, Kutschern und anderen Originalen
Irrtümlich ein Selbstporträt gemalt
Maler und ihre Modelle
»Mir san vom k. u. k . . .«
Die Offiziere Seiner Majestät
»Wenn der mein hohes C hätte . . .«
Von den kleinen Sorgen großer Sänger
»Sie werden lachen, ich heiß’ auch Pollak!«
Adel verpflichtet
»Ich kann ja Noten lesen«
Dirigenten und ihre Schwächen
»Und ich muß eine neue Rolle lernen«
Geschichten vom Theater
Erzbischof mit sechs Kindern
Von mehr (oder weniger) heiligen Kirchenmännern
Ein Butler geht auf Zehenspitzen
Skurriles aus der Welt des Films
Recht muß Recht bleiben
Von echten Mördern und falschen Komtessen
»Der Farkas? Hut auf!«
Und andere Gemeinheiten aus dem Kabarett
Bundeskanzler für einen Tag
Politiker haben’s schwer
»Du wirst doch nicht auf mich hereinfallen«
Stars und ihre Allüren
Quellenverzeichnis
»Aus drei Anekdotendas Bild eines Menschen«
Vorwort
Sicher, man könnte über jeden einzelnen von ihnen eine ganze Biographie schreiben (und bei dem einen oder anderen habe ich das auch getan). Aber man kann Persönlichkeiten mitunter durch eine kleine pointierte Geschichte treffender charakterisieren als durch lange – allzu lange – Abhandlungen. Dabei darf ich mich auf einen Großen (der selbst »Stoff« für so manche Geschichte in diesem Buch liefert) berufen: »Aus drei Anekdoten«, sagte Egon Friedell, »ist es möglich, das Bild eines Menschen zu geben.«
Bei vielen Denkmälern der österreichischen Geschichte – und sie stehen im Mittelpunkt dieses Buches – ist das möglich. Daß Kaiser Franz Joseph ein extremer Frühaufsteher und Hans Moser sehr sparsam war, hat sich mittlerweile ebenso herumgesprochen wie die Tatsache, daß Helmut Qualtinger dem Alkoholgenuß nicht abgeneigt war. Also können wir uns hier auf eher unbekannte, meist heitere Episoden aus deren Leben konzentrieren.
Die »Bilder«, die laut Friedell durch Anekdoten »gegeben« werden, zeigen ganz unterschiedliche Persönlichkeiten. Herrscher wie Maria Theresia, Josef II. und Franz Joseph. Ärzte wie Billroth und Freud. Schauspieler wie Kainz, Girardi, Oskar Werner, Moser, Hörbiger und die Wessely. Dirigenten wie Karajan. Feldherrn wie Prinz Eugen und Radetzky. Politiker wie Figl und Kreisky. Maler wie Makart und Kokoschka. Geistliche wie Abraham a Sancta Clara und Kardinal Innitzer. Komponisten wie Mozart, Beethoven, Strauß, Lehár. Dichter wie Nestroy, Schnitzler und Karl Kraus. Sie zeigen auch einige namentlich nicht bekannte Hofräte, Fiaker und den einen oder anderen Angehörigen der Unterwelt.
Und unvergessene Kabarett-Legenden. Den Qualtinger, den Grünbaum, den Farkas. Der die heitere Episode österreichischer Provenienz so definierte: »Die Anekdote ist ein Witz, der im Burgtheater aufgetreten ist.«
Georg MarkusWien, im Juli 1996
Für dreißig Jahre unsterblich
Komponisten sind auch nurMenschen
»Was ein richtiger Musiker sein will, der mußauch eine Speisekarte komponieren können.«
RICHARD STRAUSS
Franz Liszt dreht das Licht ab
Franz Liszt war auch als Pianist ein Liebling des Publikums in den noblen Salons zwischen Wien, Paris und Budapest. In jungen Jahren ein Freund des damals noch ziemlich unbekannten Frédéric Chopin, war der aus Raiding im Burgenland stammende Komponist sehr darum bemüht, seinem genialen Kollegen behilflich zu sein, in der Öffentlichkeit bekannt zu werden.
Und er wandte dabei einen einzigartigen, höchst erfolgreichen Trick an: Liszt nahm Chopin eines Abends in eine elegante Gesellschaft mit, in der er selbst gelegentlich – jedesmal umjubelt – zu spielen pflegte.
Wie so oft schon in diesem Salon wurde Liszt gebeten, sich an den Flügel zu setzen. Kaum hatte er Platz genommen, äußerte er den Wunsch, in absoluter Dunkelheit zu spielen, um sich besser konzentrieren zu können. Die Kerzen wurden gelöscht, und es folgte eine lange, glänzende Improvisation, die die erlauchten Besucher vollkommen in ihren Bann zog. Als das Ende gekommen war, gab es ebenso stürmischen wie lang anhaltenden Beifall, und aus den Reihen der Zuhörer drangen die begeisterten Rufe: »So kann nur Liszt spielen!«
Da ließ dieser die Lichter wieder entzünden, und er rief aus einer ganz anderen Ecke des Saales: »Sie irren, meine Damen und Herren!«
Und am Flügel saß ein junger Mann, den bis dahin kaum jemand gekannt hatte. Es war der Abend, an dem der Stern des jungen Frédéric Chopin zu leuchten begann. Sein einzigartiges Spiel sprach sich schnell herum, und der junge Pianist ward bald ein berühmter Mann.
Beethoven und der Kaiser
Ludwig van Beethoven wirkte in Gesellschaft oft »abwesend«, weil er sich voll und ganz in seine Musik vertiefte. Das ging so weit, daß er bei einem Diner in der Wiener Hofburg dem neben ihm sitzenden Kaiser Josef II. den Takt auf den Rücken schlug. So sehr der Meister von eifrigen Hofbeamten mit Blicken gemaßregelt wurde – der gütige Monarch lächelte nur und sagte: »Ein Untertan hat mich geschlagen, und ich habe ihn nicht bestraft.«
Kaiser Josef regierte gerade in den Jahren, da die beiden größten Musikgenies in seinem Reich tätig waren. Neben Beethoven lebte auch Mozart in Wien. Wolfgang Amadeus, stets in Geldnöten, bezog ein vom Hof ausbezahltes fixes Gehalt von achthundert Gulden als Kammerkomponist, erhielt aber keinen einzigen Kompositionsauftrag. Befragt nach der Höhe seines Entgelts, sagte Mozart: »Zuviel für das, was ich leiste, aber zuwenig für das, was ich leisten könnte.«
Eine Symphonie als Lebensretter
Was Musik in unserem Inneren zu bewirken vermag, hat jeder schon erfahren: Momente des Glücks, der Erbauung, des Entschwebens in eine andere Welt. Eine ganz andere Dimension von Glück hatte Ende des 19. Jahrhunderts ein Konzert zur Folge, das Joseph Haydn in London gab.
Als er am Ende einer Symphonie den Taktstock aus der Hand legte und sich verbeugte, erhoben sich die begeisterten Besucher von ihren Sesseln und strömten vor zum Orchester, um den genialen Musiker aus der Nähe sehen und bejubeln zu können.
Kaum waren die Sitze in der Mitte des Parketts infolge der Ovationen geleert, löste sich der riesige Kronleuchter aus der Verankerung, stürzte zu Boden und zertrümmerte Teile des Konzertsaales. Abgesehen von wenigen Besuchern, die durch Kristallsplitter leichte Verletzungen erlitten, kam niemand zu Schaden.
Als sich die erste Aufregung gelegt hatte, riefen zahlreiche Menschen das Wort »Mirakel« aus. Haydn war gerührt und dankte der Vorsehung, daß durch ein gütiges Geschick mindestens dreißig Menschen das Leben gerettet worden war. Die Symphonie aber wurde lange mit dem Beinamen Mirakel aufgeführt.
»Da haben’s den Haydn derschossen!«
Zu Joseph Haydn noch eine sehr wienerische Geschichte: Ein amerikanischer Tourist fragte, als er sich durch die Wiener City kutschieren ließ, seinen Fiaker, warum denn der Heidenschuß Heidenschuß hieße. Der Kutscher dachte kurz nach und sagte dann: »Weil’s da den Haydn derschossen haben!«
Nun, Haydn starb am 31. Mai 1809 eines natürlichen Todes, selbstverständlich ohne jede Gewalteinwirkung. »Papa« Haydn, wie der schon zu Lebzeiten populäre Komponist allseits genannt wurde, stand im 78. Lebensjahr, als ihn der Tod in seinem Wohnhaus Windmühle 73 – in der heutigen Haydngasse – ereilte.
Der Heidenschuß aber (die Verbindung zwischen dem Platz Am Hof und der Freyung) in der Wiener Innenstadt wurde nach einer im 14. Jahrhundert erstmals erwähnten Kaufmannsfamilie namens Heiden benannt. 1547 tauchte die Bezeichnung »Do der Heide schußt« auf und später ein Hausschild, das einen türkischen Bogenschützen darstellt. Ein Bäckermeister, Mitglied jener Familie Heiden, dürfte sich also, einer Sage zufolge, bei der ersten Wiener Türkenbelagerung heldenhaft hervorgetan haben.
Dabei wären dem rührigen Fiaker auf seiner Wien-Tour mit dem Amerikaner genügend Schauplätze zur Verfügung gestanden, die tatsächlich an Joseph Haydn erinnern: In Haydns Sterbehaus in der Haydngasse befindet sich das Haydn-Museum, es gibt ein Haydn-Denkmal (vor der Mariahilfer Kirche), einen Haydn-Hof, einen Haydn-Park und neben der Haydngasse auch noch die Joseph-Haydn-Straße (im 14. Bezirk).
Für den Touristen aus den USA bleibt Joseph Haydn freilich das Opfer eines finsteren Mordanschlages.
Richard Wagner in Wien
Richard Wagner gastierte des öfteren in Wien. Zunächst freilich behielt man ihn hier nicht so sehr als großen Künstler denn als wenig kreditwürdigen Schuldner in Erinnerung. Schon als neunzehnjähriger Kapellmeister mußte Wagner die österreichische Metropole fluchtartig verlassen, weil er seine hiesigen Außenstände nicht zu begleichen in der Lage war. Jahrzehnte danach, bereits ein berühmter Mann, war er in Wien wieder einmal vollkommen pleite – und so hinterließ er hier einen Kontorückstand von 30 000 Gulden.
Eine vom Meister persönlich, wie immer äußerst impulsiv geleitete Aufführung beschrieb ein Kritiker mit den Worten: »Wagner dirigierte, nachdem er drei Taktstöcke zerdroschen hatte, mit einem aus dem Orchestergraben herausgerissenen Stuhlbein.«
Als der König von Siam in Wien weilte, wurde er, wie in solchen Fällen üblich, von Kaiser Franz Joseph zu einer Vorstellung in die Hofoper geladen, in der man Wagners Lohengrin gab. Nach mehr als vierstündigem Kunstgenuß auf allerhöchstem Niveau wurde der orientalische Potentat gefragt, welcher Moment dieses Abends für ihn der faszinierendste gewesen sei. Da antwortete der König: »Am besten hat mir gefallen, wie die Musiker, noch ehe der Vorhang sich erhoben hatte, ihre Instrumente stimmten.«
Freilich irrte auch Grillparzer, als er nach einem Konzert über die Tannhäuser-Ouvertüre schrieb: »Ich bin entzückt. Das heißt: gegenwärtig. Denn während des Anhörens taten mir ziemlich die Ohren weh.«
Schüler von Giuseppe Verdi
Giuseppe Verdi war von Musikexperten lange verkannt worden. Österreichs Erzherzogin Marie Louise – die Tochter Kaiser Franz’ I. und Witwe Napoleons – hatte ein Stipendium für den jungen Musikus befürwortet, mit dem er am Konservatorium in Mailand studieren sollte. Doch der achtzehnjährige Giuseppe fiel bei der Aufnahmsprüfung mit Bomben und Granaten durch. Hatten die Professoren doch »völlige Talentlosigkeit und eine schlechte Handhaltung beim Klavierspiel« festgestellt.
Verdi hat seine Wien-Besuche nicht unbedingt in bester Erinnerung behalten. 1852 wurde an der k. k. Hofoper erstmals Rigoletto aufgeführt, etwas später Troubadour und La Traviata – alle in Anwesenheit des Meisters. Wiens Kritikerpapst Eduard Hanslick bezeichnete Verdis Musik als »Mißgeburt«, und mehrere Aufführungen wurden sogar von der Sittenpolizei überprüft. Aida war für Hanslick »weder die Tat eines schöpferischen Genies noch die Arbeit eines fertigen Meisters«.
Die Wiener freilich liebten ihren Verdi vom ersten Moment an. Auf der Kärntner Straße stand ein Werkelmann und leierte die populäre Arie La donna e mobile aus Rigoletto herunter. Verdi war verzweifelt, als er vorbeiging, denn der Bettler war alles andere als musikalisch. Der Meister warf ihm eine Münze in den Hut und forderte ihn auf, das Stück wenigstens nicht so schnell zu spielen. Als er am nächsten Tag wieder vorbeikam, hatte der Mann ein Schild mit der Aufschrift um den Hals hängen: »Schüler von Giuseppe Verdi«.
Verdi selbst, der fast neunzig Jahre alt wurde, blieb sein Leben lang ein bescheidener Mann. Als er gefragt wurde, welches seiner Werke er für sein bedeutendstes halte, antwortete er: »Mein Altersheim in Mailand«. – Der Meister hatte es aus eigenen Mitteln für bedürftige Musiker errichten lassen.
Der falsche Richard Strauss
Richard Strauss, Schöpfer genialer Opern wie Die Frau ohne Schatten und Electra, war von 1919 bis 1924 Direktor der Wiener Staatsoper, und gleichzeitig wurde er auch als Dirigent gefeiert. 1923 unternahm er mit den Wiener Philharmonikern eine Südamerikatournee, in deren Verlauf er über dreißig Konzerte und Opernaufführungen dirigierte. Die letzte Veranstaltung sollte in der brasilianischen Stadt Bahia stattfinden, doch gerade als er im Hafen das Schiff verlassen wollte, erhielt Strauss ein Telegramm, in dem er gebeten wurde, sich möglichst schnell in der Staatsoper einzufinden.
Ehe er die damals drei Wochen dauernde Reise nach Wien antrat, übertrug er dem Oboisten Alexander Wunderer (der Strauss überdies ähnlich sah) die Leitung des Konzerts in der brasilianischen Stadt. Kein Mensch in Bahia merkte, daß der berühmte Komponist nicht am Pult stand, und die Philharmoniker freuten sich über den Jubel im ausverkauften Saal. Nur der wahre Dirigent des Abends kränkte sich ein wenig, daß nicht er, sondern »der große Ricardo Strauss« anderntags von der Presse gefeiert wurde.
Meister Brahms’ letztes Gulasch
Wenn es hier jemanden gibt, den ich noch nicht beleidigt habe«, sagte der als Zyniker bekannte Johannes Brahms einmal, »dann bitte ich um Entschuldigung.«
Die Wiener Familie Eibenschütz führte dereinst ein großes Haus. Tochter Ilona galt zu ihrer Zeit als Wunderkind und reiste – als Lieblingsschülerin Clara Schumanns – von einem Klavierkonzert zum anderen. Und der Schwiegersohn Robert Schiff zählte zu den bevorzugten Porträtisten Kaiser Franz Josephs – sein berühmtestes Bild des Monarchen hängt in der Ischler Lehár-Villa.
Zum Mittagessen im Salon besagter Familie Eibenschütz kam jeden Sonntag kein Geringerer als Johannes Brahms. Nicht nur der erlesenen Gesellschaft wegen, die ihn dort erwartete, sondern auch, weil hier ein Gulasch von unerreichter Qualität serviert wurde.
Als man Brahms eines Sonntags fragte, warum er gar so deprimiert wirke, erzählte er, sein Arzt hätte ihm gerade mitgeteilt, daß er an einem unheilbaren Leberleiden laboriere. Das Bedauern aller Anwesenden war ihm sicher, und als man zum traditionellen Mittagstisch schritt, meinte Frau Eibenschütz: »Aber nach dieser Diagnose dürfen Sie unser Gulasch nicht mehr nehmen, Meister, das wäre zu schwer für Sie!«
»Ach was«, wehrte Johannes Brahms ab, »stellen wir uns vor, ich wäre erst übermorgen zur Untersuchung gegangen.«
Sprach’s und ließ sich sein Gulasch einmal noch schmecken.
Befragt, was er von der Unsterblichkeit halte, meinte Brahms: »Wenn sie heutzutage dreißig Jahre dauert, dann ist das schon sehr viel.«
Ein Posten bei der Königin von Saba
Ein moderner Komponist will von einem Kollegen wissen, was er von seiner neuen Oper halte.
»Die wird vielleicht noch gespielt werden, wenn alle großen Meister vergessen sind!«
»Wirklich?«
»Ja, aber nur dann!«
Josef Hellmesberger, legendärer Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, wird darauf angesprochen, daß sich sein komponierender Sohn in einem seiner Bühnenwerke stark an Mozart anlehne.
»Na und«, sagt er, »wissen Sie mir vielleicht einen Besseren zum Anlehnen?«
Apropos »Anlehnen«: Vom Komponisten Karl Goldmark wird berichtet, er habe für sein Werk Merlin fünf Jahre gebraucht. »Ha«, lachte Hellmesberger, »sowas stiehlt mein Sohn in drei Monaten zusammen!«
Goldmark war mächtig stolz darauf, daß mehrere seiner Werke an der Wiener Hofoper aufgeführt wurden. Besondere Triumphe feierte er mit seiner Oper Die Königin von Saba, die sowohl vom Publikum als auch von der Presse umjubelt wurde. In seinem Stolz versäumte er keine Gelegenheit, auch ihm persönlich nicht bekannten Menschen von seinen großen Erfolgen zu berichten. Einer fremden Dame stellte er sich vor: »Erlauben Sie, Gnädigste, mein Name ist Goldmark, ich bin der Komponist der Königin von Saba.«
»Sehr erfreut«, reagierte die Angesprochene, »ich bin die Vorleserin der Erzherzogin Sophie.«
Auch während einer Bahnfahrt gab er sich einer Sitznachbarin gegenüber als »Komponist der Königin von Saba« zu erkennen.
Worauf die Dame meinte: »Ach, das ist aber sicher ein guter Posten.«
Kein Duell mit dem Walzerkönig
Johann Strauß Sohn galt als bescheidener Mann. Als der Pianist Alfred Grünfeld seinen Frühlingsstimmenwalzer spielte, sagte der Walzerkönig: »So schön wie du ihn spielst, ist er gar nicht.«
Und über seinen Bruder Josef: »Ich bin populärer, er ist begabter.«
Selten haben sich Kritiker so sehr geirrt wie bei den »Sträussen«. Eduard Hanslick nannte Johann »ziemlich erfindungsschwach«. Demselben Irrtum erlag auch Strauß Vater, der seinen Söhnen einmal schrieb: »Das habe ich schon herausgekriegt, ihr habt alle keine Spur von Talent.«
Wie dem Talentiertesten der »Talentlosen« die Noten zuflogen, hinterließ uns ein Komitee-Mitglied des Technikerballs. Der Mann trat kurz vor der Eröffnung in einem Restaurant an Johann jun. heran, um ihn zu fragen, wie weit die Komposition eines vor Wochen in Auftrag gegebenen Musikstückes gediehen sei. »Ich habe noch keine Note«, gestand Strauß, nahm die Speisekarte zur Hand und ließ innerhalb von dreißig Minuten den seither oft gespielten Accelerationenwalzer entstehen.
Öffentliche Auftritte haßte er. »Lieber zehn Walzer komponieren«, meinte Strauß, »als eine einzige Rede halten.«
Jean« oder »Schani«, wie die Wiener ihn nannten, war der große Frauenliebling seiner Zeit. Ein Offizier forderte ihn zum Duell auf, weil seine Frau dem Walzerkönig Rosen geschickt hatte. Johann nahm das Duell an, unter der Bedingung allerdings, daß der Eifersüchtige vorher sein Hotelzimmer besichtige. In dem mit Blumenbouquets unzähliger Verehrerinnen übersäten Appartement sagte Strauß dann: »Bitte, suchen Sie die Rosen Ihrer Gattin heraus.«
Das Duell fand nicht statt.
Die Schwestern der Strauß-Brüder
Gemeinsam mit ihrem Vater bilden die drei »Sträusse« Johann, Josef, Eduard eine Musikerdynastie, wie es sie nie wieder geben sollte. Daß die berühmten Brüder auch zwei Schwestern hatten, ist weitestgehend unbekannt.
Insgesamt hatte Johann Strauß Vater sechs Kinder. Neben den drei komponierenden Söhnen gab es noch Anna und Therese. Und den kleinen Ferdinand, der im Alter von zwei Jahren »am hitzigen Wasserkopf« starb. Die Eltern wechselten so oft die Wohnungen, daß beinahe jedes ihrer Kinder in einer anderen geboren wurde.
Nach dem Willen ihrer drei Brüder sollten auch Anna, genannt »Netti«, und Therese Dirigenten werden. Der Name Strauß war in Wien so populär, daß es weit mehr Angebote gab, als die Brüder annehmen konnten. Die Schwestern sollten das Straußorchester ab 1862 leiten, als sich Johann nach seiner Heirat mit der Sängerin Henriette »Jetty« Treffz weitestgehend zurückziehen wollte. Ihr Einsatzgebiet wäre der Volksgarten gewesen.
Es wurde nichts daraus, und die Schwestern blieben ohne Beruf. Sie haben auch nie geheiratet. »Der Johann«, schrieb Therese Strauß nach dessen Tod im Illustrierten Wiener Extrablatt, »der hat ein Herz wie Gold gehabt. Wie er ein berühmter Mann geworden ist, da hab’ ich müssen jeden Freitag bei ihm speisen.«
Anna, die andere Schwester, sollte eine delikate Rolle in Johanns Leben spielen. Kam ihr doch im Herbst 1881 die undankbare Aufgabe zu, ihn darüber zu informieren, daß seine zweite Frau Lily ein Verhältnis mit Franz Steiner, dem Direktor des Theaters an der Wien, hatte, »was ganz Wien eh schon lange gewußt hat«.
Als wenige Tage nach Bekanntwerden der Affäre just im Theater an der Wien die neue Strauß-Operette Der lustige Krieg Premiere hatte, kursierte der Witz: »Der häusliche Krieg« mit Lily –, Der lustige Krieg mit Girardi.
Strauß jedenfalls zog die Konsequenzen, nachdem Anna ihn informiert hatte. Er trennte sich von seiner Frau und heiratete ein drittes Mal. In Adele fand er nun die Partnerin für den Rest seines Lebens.
Ihr widmete er mit dem Adelenwalzer eines seiner Meisterwerke. Doch auch seine Schwestern gingen – wie die meisten Familienmitglieder – durch ihn in die Musikgeschichte ein. Traumbilder nannte er die Kompositionen, über die er 1895 an seinen jüngsten Bruder Eduard schrieb: »Du kommst auch dran, niemand ist vor meiner Grausamkeit gefeit. Denke an das Portrait der Netti und der Therese . . .«
Anna starb 1903 im Alter von 74 Jahren, Therese 1915 mit 84. Sie waren nie aus dem Schatten ihrer Brüder getreten.
Wie Kálmán seine Vera kennenlernte
Emmerich Kálmán zählt zu den großen Vertretern der »Silbernen« Operettenära. Seine Csárdásfürstin, Gräfin Mariza und Die Zirkusprinzessin gingen als unsterbliche Musikwerke um die Welt.
Es war im März 1928, als Kálmán im Café Sacher auf der Ringstraße – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Hotel – sein Frühstück einnahm. Das Sacher-Café war täglicher Treffpunkt der Wiener Operettenprominenz, hier verkehrten auch Franz Lehár, Oscar Straus, Robert Stolz und Ralph Benatzky. Paula, Kálmáns langjährige Lebenspartnerin, war wenige Wochen vorher an den Folgen einer heimtückischen Krankheit verstorben, und der 46jährige Meister sah sich außerstande, auch nur kurze Zeit allein zu leben. Im März 1928 also nimmt ein ausnehmend hübsches Mädchen an einem nahen Tisch im Sacher Platz. Kálmán fragt den Kellner, wer die junge Dame sei, der erklärt mit einer geringschätzigen Handbewegung, daß es sich um eine arbeitslose Schauspielerin handle, die bereits des öfteren ihren Kaffee nicht bezahlt habe. So seien auch ihre letzten Konsumationen in der Höhe von 11,82 Schilling noch offen.
Kálmán übernimmt die Rechnung, sieht das Mädchen anderntags im selben Kaffeehaus, spricht es an, vereinbart weitere Rendezvous, stellt die junge Dame Hubert Marischka vor, dem Direktor des Theaters an der Wien, der ihr auch prompt eine kleine Rolle in der gerade in Vorbereitung befindlichen Kálmán-Operette Die Herzogin von Chicago anvertraut.
Einige Monate später sind Emmerich »Imre« Kálmán und die fast dreißig Jahre jüngere Vera Makinskaja, Tochter weißrussischer Flüchtlinge, verheiratet. Nach zwanzigjähriger Ehe, der drei Kinder entsprangen, ließen sich die Kálmáns in New York scheiden. Um kurz danach ein zweites Mal zu heiraten. Und diesmal hielt die Verbindung bis zum Tod des Komponisten im Jahre 1953.
Gershwins Kugelschreiber in Wien
1928, in dem Jahr, da Kálmán seine Vera kennenlernte, kam Amerikas Musikgenie George Gershwin nach Wien. Der Komponist war damals in den USA überaus populär, vor allem durch seine Rhapsodie in Blue, in Europa hingegen war sein Name noch weitestgehend unbekannt.
Da Gershwin ein großer Operettenfan war, schrieb er – ehe er die Europareise antrat – einen Brief an Emmerich Kálmán, dessen Gräfin Mariza er liebte.
Kálmán kannte und schätzte Gershwins Musik und lud den Kollegen aus Amerika zu einem Diner in seine Wiener Wohnung ein. Anwesend waren an diesem Abend die Librettisten Alfred Grünwald und Julius Brammer, die den Text zur Gräfin Mariza geschrieben hatten, sowie Kálmáns junge Frau Vera.
Die erinnerte sich später: »Grünwald hatte eine Idee, wie man Gershwin, der mit Bruder Ira – seinem kongenialen Librettisten – in Wien war, eine Freude bereiten könnte. Man würde nach dem Essen ins Café Westminster auf der Mariahilfer Straße fahren, wo damals jeden Abend Dolfi Dauber mit seinem Vierzig-Mann-Orchester aufspielte. Während Gershwin unterwegs nach Wien war, wurden die Noten seiner bekanntesten Werke beschafft und in die Mariahilfer Straße verfrachtet. Die Dauber-Kapelle übte tagelang den für sie ungewohnten amerikanischen Sound.
Diner also bei Kálmáns. Nach dem Essen sagt Gershwin, er würde gerne in eine Bar gehen, in der man Operettenmelodien, vor allem von Kálmán, spielt. Die Wiener in der Runde warfen einander vielsagende Blicke zu, denn das war der richtige Moment, um den Überraschungscoup zu landen.
Man fuhr ins Café Westminster, wo George Gershwin Operettenmelodien zu hören hoffte. »Die Herren saßen noch nicht an ihrem Tisch«, erzählte Vera Kálmán, »da intonierte die Kapelle auch schon die Rhapsodie in Blue. Gershwin hatte Tränen in den Augen, er dachte ja, daß hier kein Mensch seine Musik kennt.«
Und dann eine schöne Geste: Gershwin nimmt einen Stift aus der Sakkotasche. Es war ein Stift, der die kleine Künstlerrunde in großes Erstaunen versetzte, denn ein solches Ding kannte man in Europa noch gar nicht. »Das ist ein Kugelschreiber«, erklärte George Gershwin, »ein neues Schreibgerät aus den USA. Mit diesem Stift habe ich die Rhapsodie in Blue geschrieben. Und ich schenke ihn Emmerich Kálmán.«
So war der erste Kugelschreiber nach Wien gelangt.
Ein Astaire-Film ohne Fred Astaire
Jahrzehnte später, im Sommer 1995, gastierte der Broadway mit dem Musical My One and Only, einer Zusammenstellung aus Gershwin-Melodien, im Wiener Ronacher. Die Aufführung hatte Schwung, war professionell inszeniert und choreografiert, doch war, wie so oft in solchen Fällen, nicht die allererste Garnitur nach Europa gekommen. Bei der anschließenden Premierenfeier flüsterte Marcel Prawy: »Es war wie ein Film mit Ginger Rogers und Fred Astaire. Nur ohne Ginger Rogers und Fred Astaire.«
Robert Stolz und der Gerichtsvollzieher
Robert Stolz litt in den zwanziger Jahren unter akuter Geldnot, war er doch mit seinem Operettentheater in der Wiener Annagasse pleite gegangen. Das einzige, das er noch besaß, war eine goldene Taschenuhr, und um wenigstens die zu retten, wandte er den folgenden – uns von Marcel Prawy überlieferten – Trick an: Wann immer der Gerichtsvollzieher Navratil kam, und das war in diesen Tagen oft der Fall, wanderte die goldene Uhr vom Nachtkastl des Komponisten auf das seines besten Freundes Otto Hein, mit dem er ein schäbiges Untermietzimmer teilte.
Das Ritual war immer dasselbe: Navratil läutete, Stolz wußte, daß der »Kuckuck« drohte, und die Uhr wurde auf Ottos Nachttisch plaziert. Der Gerichtsvollzieher betrat das Zimmer, lächelte wohlwollend und sagte: »Ich seh’ schon, Herr Stolz, Ihr Nachtkastl is’ leer, bei Ihnen is’ nix zu pfänden.« Und ging wieder.
Eines Tages war Navratil wieder da. Die Uhr wanderte, Robert Stolz schaute unschuldig – doch der Herr Gerichtsvollzieher ging diesmal schnurstracks auf Otto Heins Nachtkastl zu. Und nahm die Uhr an sich.
»Was ist los, um Gottes Willen?« protestierte der fassungslose Robert Stolz.
»Regen S’ Ihna net auf«, sagte Herr Navratil, »heut’ pfänd’ ich den Hein!«
Sprach’s, steckte die Uhr ein und ging. Stolz war um seinen letzten Wertgegenstand gekommen.
Bald übrigens nicht nur um diesen. Freund Hein nahm ihm noch etwas ab: Seine damalige (zweite) Ehefrau Franzi Ressel ging mit dem Zimmergenossen des Komponisten auf und davon.
»Wenn ich die Einzi zur Witwe hätt’«
Nach Verlust von Uhr (und Frau) ließ Robert Stolz seinen damaligen Spitzbart abrasieren, um von den zahlreichen Gläubigern nicht erkannt zu werden. Daß er selbst in dieser Situation seinen Humor behielt, bestätigte mir eine alte Dame – ihr Name ist Friedl Weiss, und sie war zwischen den beiden Weltkriegen eine beliebte Soubrette an Wiener Bühnen und Kabaretts. Frau Weiss, die im August 1996 in bewundernswerter Frische ihren hundertsten Geburtstag feierte und die seinerzeit noch alle Berühmtheiten persönlich gekannt hatte, verkehrte einst im legendären Künstlercafé Dobner am Naschmarkt, zu dessen Gästen – neben Lehár, Kálmán und vielen anderen – auch Robert Stolz zählte. Als er dort aus obigem Grund erstmals ohne Bart erschien, gingen selbst seine besten Freunde grußlos an ihm vorbei, weil sie Stolz mit blankem Gesicht nicht erkannten. Eines Tages erblickte der frischrasierte »Unbekannte« im Dobner die fesche Friedl Weiss. Er kam an ihren Tisch und fragte: »Sagen Sie Fräulein, kennen Sie den Robert Stolz?«
»Ja, natürlich«, antwortete die Angesprochene.
»Ist das nicht ein unsympathischer Kerl?«
»Nein, ganz im Gegenteil, das ist ein überaus feiner Mann.«
Da lachte Robert Stolz und gab sich zu erkennen: »Friedl, ich dank’ dir, du bist die erste, die nicht über mich schimpft!«
Sein wahres Glück hatte Stolz dann erst mit Ehefrau Nummer fünf, mit seiner »Einzi«, gefunden, die sich auch als perfekte Managerin (und später dann als Nachlaßverwalterin) des Komponisten erwies. Ernst Haeusserman sagte nach dem Tod von Robert Stolz: »Ja, wenn ich die Einzi zur Witwe hätt’, könnt ich auch beruhigt sterben.«
»Der größte Blödsinn,der je geschrieben wurde«
Karl Farkas, der 1930 gemeinsam mit dem Komponisten Robert Katscher das musikalische Lustspiel Die Wunder-Bar verfaßt hatte, erzählte einmal, wie der populärste Schlager dieser Revue entstanden ist: »Der Katscher und ich hatten die Ambition, literarisch und niveauvoll zu sein, und wir haben feine Texte ziseliert, da kam der Direktor der Wiener Kammerspiele und sagte zu uns: ›Das ist zu schwach, man muß da noch einen Schlager hineintun, irgend etwas Derbes‹.«
Farkas und der Komponist waren bitterböse. »Der Katscher setzt sich zum Klavier«, berichtete Farkas weiter, »haut lieblos in die Tasten, singt aus Zorn dazu: Bibibibibibi.« Und das war auch schon die Melodie eines späteren Welterfolgs.
Die beiden lachten und Farkas sagte: »Paß auf, dem Direktor werden wir’s zeigen, wir machen einen Schlager, der ganz unmöglich ist, ein Lied, das morgen wieder abgesetzt wird, weil es so schlecht ist. Du nimm ruhig dieses