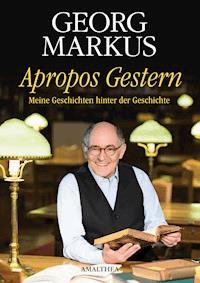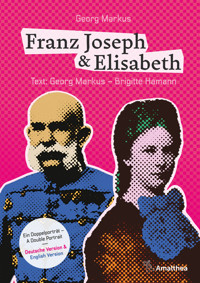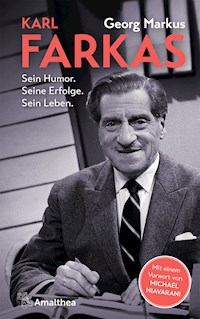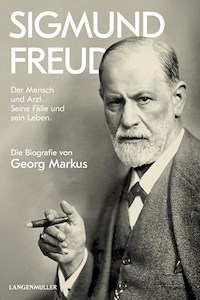Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit mehr als dreißig Jahren einer der führenden Chronisten Österreichs, schildert Georg Markus zum ersten Mal seine spannenden und amüsanten Begegnungen mit Zeitzeugen von Bruno Kreisky über Helmut Qualtinger bis Josef Holaubek. Er traf die Nachfahren von Schnitzler, Freud, Klimt und Kronprinz Rudolf, die ihm sehr Persönliches von ihren berühmten Ahnen erzählten. Der Bestsellerautor verfolgte aber auch die österreichischen Wurzeln von Fred Astaire, der eigentlich Austerlitz hieß, und erfuhr durch Hans Mosers Tochter von einem Erbschaftsstreit, der die Familie entzweite. Markus' Begegnungen mit Karl Farkas und Gerhard Bronner geben Einblick in die Welt des Kabaretts. Hugo Portisch schreibt im Vorwort zu diesem Buch: »Ich las Kapitel um Kapitel, was Georg Markus erfahren hat. Erstaunlich, außergewöhnlich, ja unglaublich so manches und alles faszinierend. Aber es sind nicht nur die Aussagen der Gesprächspartner, von denen diese Faszination ausgeht, sondern vor allem, was Markus von und über diese Zeitzeugen zu berichten weiß.« So gelang es dem Autor, von der Familie Sacher das seit 175 Jahren streng geheim gehaltene Rezept der Sachertorte zu erhalten, das hier zum ersten Mal in einem Buch veröffentlicht wird. Wiens legendären Polizeipräsidenten Josef Holaubek bat er gemeinsam mit jenem Gefängnisausbrecher, den dieser einst mit den Worten »I bin's, der Präsident« festnahm, an einen Kaffeehaustisch. Und einen Mann, der sich als Urenkel Kaiser Franz Josephs auswies, schickte er zum DNA-Test - und dieser brachte ein erstaunliches Ergebnis... Dem Leser öffnet sich in diesem Buch ein tiefer Einblick in die Seele berühmter Österreicher.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GEORG MARKUS
Unter uns gesagt
Begegnungen mit Zeitzeugen
Mit einem Vorwort vonHugo Portisch
Besuchen Sie uns im Internet unter:www.amalthea.at
1. Auflage September 20082. Auflage Oktober 20083. Auflage Dezember 20084. Auflage Jänner 2009
© 2008 by Amalthea Signum Verlag, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Kurt Hamtil, verlagsbüro wienUmschlagfoto: © IMAGNO/Franz HubmannHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 12/15 Punkt BerkeleyDruck und Binden: CPI Moravia Books GmbHPrinted in the EUISBN 978-3-85002-648-2eISBN 978-3-902998-58-3
INHALT
EINE VERGNÜGLICHE ZEITREISE
Vorwort von Hugo Portisch
»EIN EHER DÜSTERER MENSCH«
Meine Begegnung mit Schnitzlers Schwiegertochter
MIT DEM AUSBRECHER IM KAFFEEHAUS
Der Wiener Polizeipräsident Josef Holaubek
EIN BLICK IN DEN PANZERSCHRANK
Wie ich das Geheimrezept der Sachertorte fand
»BUAM, DES IS GAR KA REVOLUTION«
Begegnungen mit Bruno Kreisky
»MAYERLING WAR NIE EIN THEMA«
Zum Tee bei Kronprinz Rudolfs Urenkel
DIE LETZTEN ZEITZEUGEN …
… im Spionagefall Redl
»WEIL AUSTERLITZ WIE EINE SCHLACHT KLINGT«
Fred Astaires österreichische Wurzeln
DIE FÜRSTIN UND DAS GIFT
Das aufregende Leben der Elisabeth Thury
»DER MANN, DER MEIN LEBEN RETTETE«
Mit Professor Hacker in Ray Charles’ Garderobe
DES KAISERS NEUE KINDER
Herr Pointinger geht zum DNA-Test
DER GELIEBTE VATER, DIE VERHASSTE MUTTER
Hans Mosers Familientragödie
JOHANN STRAUSS ENTSCHULDIGT SICH
oder Wie ich den Donauwalzer rettete
EINE REDE, DIE NICHT GEHALTEN WURDE
Leopold Figls legendäre Weihnachtsbotschaft
WIE ICH STIFT MELK ZU EINER STANDUHR VERHALF
oder Das Wunder im Benediktinerkloster
DER MANN, DER SICH HARRY BRAUN NANNTE
Erinnerungen an Gerhard Bronner
»MIR WÄR’S LIEBER, KEIN ENKEL DES KAISERS ZU SEIN«
Weitere Nachfahren
BERUF WITWE
Die fünfte und doch einzige Frau des Robert Stolz
»MEIN OPA GUSTAV KLIMT«
Von den vielen Frauen und Kindern eines Genies
HITLER RETTET EINE SYNAGOGE
oder Der »Führer« irrt sich
DAS BILDNIS EINER SCHAUSPIELERIN
Gusti Wolfs Porträt in der Burgtheatergalerie
DER GROSSVATER DER PSYCHOANALYSE
Sigmund Freuds Enkel erzählt
BRAHMS LAG IM PAPIERKORB
Professor Marcus macht eine Entdeckung
DER MANN AUS SCHINDLERS LISTE
Ein Zeitzeuge erinnert sich
»ALLE TAGEBÜCHER VERNICHTEN!«
Die unbekannten Seiten des Willi Forst
NACH SARAJEWO
Die Familie des Thronfolgers
WAR DAS DER ECHTE ONASSIS?
Ein Doppelgänger in Graz
DER FALSCHE FRANZ OLAH
Hans Weigel hätt seine Freud gehabt
ZWISCHEN WATCHLIST UND GRÄFIN MARIZA
Grünwald & Grunwald
WARUM GERADE DIE SCHRATT?
Die Nichte erzählt vom Kaiser und noch mehr
»ICH MÖCHT NOCH EINMAL DIE MATURA MACHEN«
Marcel Prawy – das letzte Gespräch
»DA HÄTTE ICH EXZELLENZ ZU IHM SAGEN MÜSSEN«
Zeitzeuge Otto von Habsburg
EIN BISSERL WIE DER »FÜHRER«
Das Phantombild des Herrn Karl
DER MANN, DEN EINSTEIN VEREHRTE
Ein Leben zwischen Genie und Wahnsinn
ANHANG
Danksagung
Quellenverzeichnis
EINE VERGNÜGLICHE ZEITREISE
Vorwort von Hugo Portisch
Die Geschichtswissenschaft hat lange gebraucht, ehe sie bereit war, die Erlebnisse und Eindrücke von Zeitzeugen als Quellen zur Erforschung dessen, was einmal war, wahrzunehmen. Und manche Historiker stehen auch heute noch der oral history, der erlebten und erzählten Geschichte, mit Skepsis gegenüber. Menschen können sich irren oder falsch erinnern. Gewiss. Aber ebenso können sich Menschen irren, die Papiere schreiben, seien es Protokolle, Memoranden oder amtliche Berichte. Und sie können auch manches anders darstellen, als es war. Dennoch gelten diese Papiere als Dokumente, werden sorgfältig registriert und archiviert und von der Geschichtswissenschaft als gültige Zeugnisse zur Entschlüsselung dessen angesehen, was damals geschah.
Und doch können diese amtlichen Dokumente kaum je eine Zeit, Lebensumstände, gesellschaftliche Entwicklungen, die Menschen und deren Empfindungen späteren Generationen so lebensnah begreiflich machen wie die Erzählungen jener, die diese Zeit selbst erlebt haben: Das Schreckliche, das Unglaubliche, das Absurde und Groteske, aber auch das Heitere, das Amüsante.
Für die Fernsehdokumentationen Österreich I und Österreich II haben wir viele hundert Zeitzeugen gesucht, gefunden und befragt. Ihre Aussagen haben wesentlich dazu beigetragen, einem großen Publikum Ereignisse und Handlungen auch emotional nahe zu bringen und damit verständlicher zu machen. Als Georg Markus mich gerade auf Grund dieser Erfahrungen ersuchte, ein Vorwort zu diesem Buch zu schreiben, meinte er, es handle sich dabei um die Wiedergabe der Erzählungen von Zeitzeugen, die er oft mit viel Akribie aufgespürt und dazu gebracht hatte, ihm aus ihrem Leben zu berichten. So las ich nun, Kapitel um Kapitel, was Georg Markus da erfahren hat. Erstaunlich, außergewöhnlich, ja unglaublich so manches und alles faszinierend. Aber es sind nicht nur die Aussagen der Gesprächspartner, von denen diese Faszination ausgeht, sondern vor allem, was Markus von und über diese Zeitzeugen zu berichten weiß.
So ist der interessanteste Zeitzeuge, der in diesem Buch zu Wort kommt, Georg Markus selbst. Es sind seine Recherchen, seine Begegnungen, seine Gespräche mit und seine Eindrücke von den Menschen, über die er hier berichtet. Ihre eigenen Aussagen sind oft nur die – allerdings stets treffenden und amüsanten – Pointen der Markus’schen Berichte. Dass Bruno Kreisky im Alter von fünf Jahren bereits den bevorstehenden Untergang der Monarchie geahnt hatte, als der Sarg mit der Leiche Franz Josephs auf der Ringstraße an ihm vorüberzog, das hatte der Altkanzler öfter erzählt, eine Episode, die ihn als frühreifes politisches Talent auswies. Über die Zeit sagte sie nichts aus. Bei Georg Markus aber schildert Kreisky, wie er als Siebenjähriger nach dem Zusammenbruch der Monarchie auf dem Rasen des öffentlichen Parks plötzlich Fußball spielen durfte, nur um kurz darauf von der republikanischen Polizei wieder vertrieben zu werden. »Buam«, sagte er zu seinen Spielkameraden, »des is gar ka Revolution.« Eine Bemerkung, die einiges über die Zeit aussagt.
Markus spricht mit Menschen, die den alten Kaiser selbst oder dessen unmittelbare Nachfahren gekannt haben. Aber auch mit einem Mann, der ein ganzes Buch darüber geschrieben hat, in dem er sich als ein direkter Nachfahre Kaiser Franz Josephs zu erkennen gibt. Den allerdings schickt Markus zum DNA-Test.
In anderen Fällen gibt es solche Zweifel nicht. Der Urenkel des Kronprinzen Rudolf hat über die Tragödie von Mayerling erst in der Schule erfahren. Und das, obwohl Otto Windisch-Graetz auf den Knien der Witwe des Kronprinzen gesessen ist und auch dessen Tochter, die »rote Erzherzogin«, noch gekannt hat. Niemand innerhalb der Familie hat je die peinlichen Seiten ihrer Geschichte erwähnt. Offensichtlich, so meint Markus, macht das Phänomen des Verdrängens auch vor den Mitgliedern des ehemaligen Kaiserhauses nicht Halt. Andere Geschichten, in denen bei Markus die kaiserliche Familie eine Rolle spielt, handeln von Franz Ferdinand bis Otto Habsburg.
So geht es weiter in diesem Buch, Begegnung um Begegnung. Zu den Nachfahren, die Markus aus dem Leben bedeutender Persönlichkeiten berichten, zählen auch die Enkel von Sigmund Freud und Gustav Klimt. Man fasst es kaum, dass Markus im Frühjahr 2008, mehr als ein Dreivierteljahrhundert nach Arthur Schnitzlers Tod, dessen Schwiegertochter traf. Lilly Schnitzler schildert den Dichter, wie man ihn kaum kennt: seinen Alltag, wie er wohnte, seine Schwermut, und sie erinnert sich, wie der Tod seiner Tochter ihm die Lebenskraft der letzten Jahre nahm. Eine Beschreibung aus einer verklungenen Welt, in der Namen wie Hofmannsthal und Felix Salten eine Rolle spielen, ganz so als wär’s gestern erst gewesen.
Ein Stück österreichischer Musikgeschichte erleben wir in Markus’ Bericht über seine Zusammenarbeit mit Marcel Prawy, Hans Weigel und Henry Grunwald, dem damaligen amerikanischen Botschafter in Wien. Heinz Grünwald hieß er ursprünglich, als er mit seiner Familie 1938 Österreich verlassen musste. Sein Vater Alfred Grünwald schrieb Libretti zu den bekanntesten Wiener Operetten von Lehár, Kálmán, Robert Stolz und anderen Musikgrößen. Sohn Heinz machte in den USA große Karriere, bis er an der Spitze des gewaltigen TIME-Medienkonzerns stand. US-Präsident Ronald Reagan bat Grunwald als Botschafter nach Österreich zu gehen, um in der Zeit der Watchlist-Affäre um Kurt Waldheim dennoch für ein erträgliches Verhältnis zu Österreich zu sorgen. Aber Grunwald nahm dies auch zum Anlass, seinem Vater ein Denkmal zu setzen, tatsächlich und in Form einer Biografie, an der die oben genannten vier Herren mitwirkten.
Seine Begegnungen mit Karl Farkas und Gerhard Bronner gewähren Markus Einblicke in die Welt des Kabaretts der Nachkriegszeit und so manchen Blick hinter die Kulissen. Dabei erfährt er auch, dass der Herr Karl ein Vorbild hatte. Helmut Qualtinger und Carl Merz hatten von einem tatsächlich existierenden Geschäftsdiener gehört, der sich »seine« Geschichte auf ähnliche Weise zurechtgezimmert hatte, wie es die spätere Bühnenfigur tat. Der letzte Augenzeuge fertigte auf Ersuchen von Georg Markus ein »Phantombild« dieses echten Herrn Karl an, wodurch wir heute erfahren, wie das Original aussah.
Ich kenne Georg Markus seit den frühen Siebzigerjahren. Er berichtete damals als Nachwuchsreporter im Kurier darüber, wie die Polizei drei Ausbrecher aus der Strafanstalt Stein quer durch Wien verfolgte, ehe der legendäre Polizeipräsident Josef Holaubek einen von ihnen mit den nicht minder legendären Worten: »I bin’s, der Präsident« festnahm.
Das war eine Aufsehen erregende, aber eher lokale Begebenheit, doch Markus sorgt für eine amüsante Nachgeschichte, indem er zwei der Hauptdarsteller des glücklicherweise unblutig verlaufenen Krimis viele Jahre später gemeinsam an einen Kaffeehaustisch bat: Den Polizeipräsidenten und einen der Ausbrecher. Was sie einander zu sagen hatten, ist jetzt bei Markus nachzulesen – neben vielen weiteren spannenden Berichten.
Es ist erstaunlich, dass Georg Markus immer wieder neue und spannende Facetten der Geschichte zutage fördert, vor allem aber, wie er es tut: Einerseits mit der dafür nötigen Ernsthaftigkeit, andererseits aber auch so, dass seine Bücher zur vergnüglichen Zeitreise werden.
Wien, im Juli 2008
»EIN EHER DÜSTERER MENSCH«
Meine Begegnung mit Schnitzlers Schwiegertochter
Wer hätte das gedacht! In der Sternwartestraße, am Stadtrand von Wien, lebt Schnitzlers Schwiegertochter. »Jetzt bin ich bald hundert«, sagt die rüstige Dame, die mehr als 75 Jahre nach dem Tod des Dichters noch so viel zu erzählen vermag. Ich traf sie im Juni 2008 in ihrer Villa, die dem Wohnhaus ihres berühmten Schwiegervaters gegenüber liegt. Eine beeindruckende und eloquente Zeitzeugin, die mit manch überraschender Erinnerung aufzuwarten hat.
»Ich war elf Jahre alt, als ich Arthur Schnitzler zum ersten Mal sah«, weiß Lilly Schnitzler geborene Strakosch, als wär’s gestern gewesen. »Er wohnte im Haus Sternwartestraße 71 und ich mit meinen Eltern und Geschwistern hier, wo ich heute noch lebe, auf Nummer 56.« Das »Währinger Cottage«, in dem sich die beiden Familien, nur ein paar Schritte voneinander entfernt, niedergelassen hatten, war in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, als im Zuge der Stadterweiterung die Gartengründe der inneren Bezirke abgetragen wurden. Künstler, Kaufleute und Industrielle errichteten repräsentative Einfamilienhäuser, in denen sie gutnachbarliche Kontakte pflegten. So auch die Familien Schnitzler und Strakosch.
Aus der Nachbarschaft wurde Freundschaft, verrät Lilly Schnitzler. »Mein Vater besaß die Hohenauer Zuckerfabrik und war ein kunstsinniger Mann. Arthur Schnitzler war – in Begleitung verschiedener Frauen – oft bei uns zu Gast, und wir waren mehrmals bei ihm. Ich sah ihn auch, wenn er zu seinen Spaziergängen aufbrach, meist in einen grünen Regenmantel gehüllt, die Hände am Rücken verschränkt, mit seinen Freunden Hofmannsthal, Richard Beer-Hofmann oder Felix Salten unterwegs.«
Lilly Schnitzler, Jahrgang 1911, hat ihren späteren Schwiegervater »als einen eher düsteren Menschen in Erinnerung behalten. Er war nicht sehr groß und immer in Gedanken versunken. Ich hatte großen Respekt vor ihm, da er ja damals schon eine Berühmtheit war.«
Nie und nimmer hätte Lilly Strakosch es für möglich gehalten, eines Tages die Schwiegertochter dieses Mannes zu sein. »Es war am Neujahrstag 1932, da nahmen mich meine Eltern zu einer Feier im Hause Felix Saltens mit, der in der Weimarer Straße wohnte, ebenfalls ganz in unserer Nähe. Dort lernte ich Schnitzlers Sohn Heinrich kennen, der den ganzen Abend mit mir ins Gespräch kommen wollte, was nicht wirklich gelang, weil ich damals noch entsetzlich schüchtern war. Außerdem hatte ich ein grünes Kleid an, das warf mir Heini noch viele Jahre später vor, denn er hasste grün. Als wir uns einige Tage später zufällig bei sehr starkem Schneefall vor meinem Elternhaus wiedersahen, plauderten wir doch sehr angeregt miteinander. Er war ein wunderbarer Pianist, und ich spielte Geige, und so lud er mich ein, zum Musizieren zu ihm zu kommen. So fing es an.«
Arthur Schnitzler war wenige Wochen davor, am 21. Oktober 1931, gestorben. Lillys Erinnerungen an den Dichter stammen »teils aus den vorangegangenen Begegnungen in meinem Elternhaus, teils aus den Erzählungen meines Mannes«.
Im Juni 1934, gleich nach ihrer Hochzeit, zog sie in die Villa ihres Schwiegervaters in der Sternwartestraße 71, »wir richteten den ersten Stock neu ein, da ich als junge Frau nicht in einem Museum leben wollte.« Und doch hat sie das Haus noch so in Erinnerung, wie Arthur Schnitzler es bewohnt hat: »Die Villa liegt in einem sehr schönen Garten, im Erdgeschoss waren zwei Biedermeiersalons und das Esszimmer, an den Wänden hingen zwei Bilder von Carl Moll. Es gab einen Bösendorfer-Flügel, an dem Schnitzler täglich mit meinem Mann vierhändig spielte.« Als besonders imposant wird des Dichters Bibliothek beschrieben, bestehend aus vielen tausend Bänden, die sich heute zum Teil noch in Lillys Besitz befinden, »den anderen Teil hat mein Mann der Nationalbibliothek geschenkt.«
Frau Schnitzler führt mich durch ihr Haus und zeigt die eindrucksvollen Reste der Schnitzler’schen Bibliothek, ehe wir bei einem wahren Schatzkästchen Halt machen. »Das sind die Gegenstände, die am Tag, an dem Schnitzler starb, auf seinem Schreibtisch lagen«, sagt die alte Dame und öffnet die kleine Schatulle. »Seine goldene Uhr und ein Ring sind verschwunden, wir wissen nicht, was damit geschehen ist, alles andere liegt genauso vor uns, wie er es im Oktober 1931 hinterlassen hat.«
Lilly Schnitzler entnimmt der Kassette einen Reisepass, ausgestellt auf »Dr. Arthur Schnitzler, Beruf Arzt und Schriftsteller, Ort und Datum der Geburt 15. V. 1862 Wien, Wohnort Wien XVIII., Sternwartestr. 71, Gesicht oval, Farbe der Augen grau, Farbe der Haare braun«.
Sie legt den Pass beiseite und zeigt Schnitzlers Geldbörse mit den Initialen »A. S.«, seine Brille – so rund, als hätte Sigmund Freud sie getragen –, zwei Haarlocken, »von denen niemand weiß, wem sie eigentlich gehörten«. Weiters finden sich zwei Theaterkarten, die Schnitzler nicht mehr benützen konnte, und ein Notizblock mit seinen letzten Aufzeichnungen. Sie sind kaum zu entziffern, war der Dichter doch bekannt dafür, unleserlich, wie bei Medizinern oft üblich, gekritzelt zu haben.
Und dann holt Frau Schnitzler noch das handgeschriebene private Telefonbuch ihres Schwiegervaters hervor.
Ich darf ein bisschen darin blättern. Da sind alle Rufnummern vermerkt, die er mit einem dünnen Bleistift notiert hatte: vom Gaswerk über das Hotel Sacher bis zu denen von Hofmannsthal (Tel.-Nr. 21-46-218) und Felix Salten (A-10-3-11).
»Salten«, erzählt Lilly Schnitzler weiter, »war ein intimer Freund sowohl Schnitzlers als auch meiner Eltern. Wir haben mehrere Urlaube mit ihm und seiner Familie verbracht, zwei Sommer hatten wir gemeinsam ein Haus in Unterach am Attersee gemietet.«
An diesem Punkt angelangt, konnte ich nicht anders als der Zeitzeugin eine Frage zu stellen, mit deren Beantwortung sie ein populäres Rätsel der Literaturgeschichte lösen würde: »Haben Sie, gnädige Frau, Salten je gefragt, ob er der Autor der Lebenserinnerungen der Josefine Mutzenbacher ist?«
Frau Schnitzler muss keinen Augenblick nachdenken. »Ja, natürlich hab ich ihn das gefragt, es hat mich ja selber interessiert«, erklärt sie, »und er hat ›Ja‹ gesagt. Ja, er hat das Buch geschrieben, vertraute er mir an, er hätte das aber öffentlich nie zugeben können, weil das in der damaligen Zeit einen großen Skandal hervorgerufen und seiner Reputation als Schriftsteller geschadet hätte. Einmal habe ich auch mit Saltens Tochter Anna, die eine meiner engsten Freundinnen war, darüber gesprochen, und auch sie bestätigte, dass er es geschrieben hat.« Und dann fügt sie noch lächelnd hinzu: »Schnitzler, der auch ›im Verdacht‹ stand, war’s jedenfalls nicht.«
Arthur Schnitzler und Felix Salten waren auf ganz andere, eher skurrile Weise miteinander verbunden. Lillys Gedanken und Erinnerungen schweifen in diesem Moment noch ein Stückchen weiter zurück: »Als nach dem Ersten Weltkrieg die Armut in Wien ganz schlimm war, wurde in unserer Gegend viel eingebrochen, da gründeten die Hausbesitzer eine so genannte Cottage-Garde, der Schnitzler, Salten, Beer-Hofmann und mein Vater angehörten. Sie versammelten sich jeden Abend bei uns zu Hause, jeder bekam ein Gewehr in die Hand gedrückt, und damit wanderten sie dann im 18. Bezirk herum. Geschossen wurde nie. Ich weiß auch nicht, ob die Herren besonders befähigt gewesen wären, für die Sicherheit im Bezirk zu sorgen.«
Lilly Schnitzler kann sich nicht erinnern, ihren späteren Schwiegervater jemals gut gelaunt oder gar lachend gesehen zu haben. »Schnitzlers ganze Persönlichkeit war geprägt vom tragischen Tod seiner Tochter Lili, die er über alles geliebt hat. Von dieser Katastrophe hat er sich nie mehr erholt, konnte er sich nicht erholen, diese Tragödie hat auch großen Einfluss auf das weitere Zusammenleben der Familie gehabt.«
Arthur Schnitzlers Ehe mit seiner Frau Olga war bereits 1921, sieben Jahre vor dem Selbstmord der gemeinsamen Tochter, geschieden worden. »Mein Mann liebte seinen Vater sehr, aber zu seiner Mutter hatte er keine besondere Beziehung. Der Umstand, dass sie trotz eines Hilferufs ihrer Tochter nicht nach Venedig* gereist war, stand immer im Raum. Es gab in der Familie den Vorwurf, Olga hätte die Tragödie möglicherweise verhindern können, wäre sie nicht so egozentrisch gewesen.«
Fragt man Lilly Schnitzler nach ihrer Schwiegermutter Olga, hält sie kurz inne. »Na ja, also bitte, sie ist jetzt schon so lange nicht mehr da, dass ich ganz ehrlich sein kann. Ich hab sie nicht ausstehen können! Sie war eine vollkommen unnatürliche Person. So hat sie, als meine Kinder noch klein waren, bei uns ›Großmutter gespielt‹, obwohl sie das in Wirklichkeit überhaupt nicht interessierte, so etwas spürt man ja. Olgas Beziehung zu Arthur Schnitzler war so, wie geschiedene Leute eben miteinander auskommen müssen, die gemeinsam Kinder haben. Sie kam vor allem dann zu ihm, wenn sie noch mehr Geld brauchte, damit ist sie ihm schrecklich auf die Nerven gegangen.« Schnitzler, sagt die Schwiegertochter, sei durch seine Tantiemen zwar »wohlhabend gewesen, aber nicht reich, es ist nicht viel übrig geblieben nach seinem Tod«.
Allein blieb Arthur Schnitzler auch nach seiner Scheidung nicht. »Die Frauen sind auf ihn geflogen«, weiß Lilly, »auch Minna, seine Köchin – die mein Mann und ich später übernommen haben –, hat ihn angehimmelt. Zuletzt stand er der Schriftstellerin Clara Katharina Pollaczek und seiner Sekretärin und Übersetzerin Suzanne Clauser nahe.«
Lilly Schnitzlers Ehe mit dem 1982 verstorbenen Regisseur Heinrich Schnitzler entsprangen zwei Söhne:
Peter Schnitzler, Jahrgang 1937, lebt als Filmemacher, Regisseur und Maler in den USA.
Michael Schnitzler, Jahrgang 1944, war als Geiger lange Konzertmeister der Wiener Symphoniker und Musikprofessor an der Universität Wien. Bekannt ist er auch als Obmann des Vereins Regenwald der Österreicher, der in Costa Rica 38 Quadratkilometer Regenwald freikaufte.
Michael, der im Nebenhaus seiner Mutter wohnt, ist mittlerweile zu uns gestoßen und hat seiner Mutter interessiert zugehört. »Mein Bruder und ich«, sagt er, »haben leider viel zu wenig über unseren Großvater erfahren. Das lag daran, dass uns mein Vater nur wenig über Arthur Schnitzler mitteilte. Er dachte, wir würden uns nicht für ihn interessieren, weil wir in den USA aufgewachsen sind. Mein Bruder und ich wiederum dachten, dass unser Vater nicht gerne über Arthur reden würde. Durch dieses Missverständnis wurde in der Familie leider viel zu wenig über unseren Großvater gesprochen.«
Michael Schnitzler empfindet es als interessant, »dass Schnitzler für die Bühne ganz anders schrieb, als er lebte. Er hat in seinen Beziehungen dieselben Fehler begangen, wie sie die Männer in seinen Stücken begehen. Arthur Schnitzler hat im Theater das kritisiert, was er selbst getan hat. Im Übrigen neigte er zu Schwermut, und er war ein großer Hypochonder – was mein Vater übrigens von ihm übernommen hatte.«
An seine Großmutter Olga, die 1971 starb, kann sich Michael gut erinnern. »Sie gab sich sehr intellektuell und war stolz darauf, Schnitzlers Witwe zu sein, obwohl sie vor dessen Tod längst geschieden waren.«
Heinrich Schnitzler, in den dreißiger Jahren bereits ein bekannter Regisseur, drehte an dem Tag, an dem Hitlers Truppen in Österreich einmarschierten, in Belgien einen Film, erzählt Lilly noch: »Das hat unser Leben gerettet. Da seit längerem geplant war, dass ich am 13. März zu meinem Mann nach Brüssel reisen würde, hatte ich bereits Visum und Bahnkarte und konnte problemlos über die Grenze fahren. Mein Sohn Peter folgte mir später in Begleitung einer Freundin.«
Dass auch Arthur Schnitzlers künstlerischer Nachlass gerettet wurde, ist einem weiteren Zufall zu danken: »Im März ’38 arbeitete ein Engländer an der Aufarbeitung der Schriften meines Schwiegervaters. Der junge Mann ließ nun einen Raum im Haus meiner Eltern durch die englische Botschaft versiegeln, dadurch hatten die Nationalsozialisten keinen Zutritt.« Schnitzlers Nachlass befindet sich heute an der Universität Cambridge.
Lilly Schnitzler und ihr Mann Heinrich konnten von Belgien über die Schweiz und gemeinsam mit ihrem Sohn Peter in die USA flüchten, wo dann Michael zur Welt kam. Arthur Schnitzlers Villa in der Sternwartestraße war zu diesem Zeitpunkt bereits »arisiert«, sein Werk in Berlin und anderen Städten öffentlich verbrannt worden. »Der Schreibtisch und das Stehpult, an dem seine Stücke entstanden, sind leider verschwunden, diese Einrichtungsgegenstände tauchten bedauerlicherweise auch nach der Nazizeit nicht mehr auf.«
Lilly Schnitzler hat ein wichtiges Kapitel österreichischer Kulturgeschichte miterlebt. Eine alte Dame mit einem phänomenalen Gedächtnis und einer großen Begabung, ihre Erinnerungen auch nach so langer Zeit noch zu schildern.
Eine Zeitzeugin, wie man sich’s nur wünschen kann.
* Schnitzlers Tochter Lili erschoss sich am 26. Juli 1928 in ihrem Hotelzimmer in Venedig.
MIT DEM AUSBRECHER IM KAFFEEHAUS
Der Wiener Polizeipräsident Josef Holaubek
Als junger Journalist gehörte es zu meinen Aufgaben, in der Redaktion den »Polizeifunk« abzuhören, wie das am Beginn einer solchen Berufslaufbahn durchaus üblich war. »Zentrale an Bertha 1«, vernahm man da in äußerst mangelhafter Tonqualität, »fahren Sie Zentralsparkasse, Filiale Praterstraße, Bankraub gemeldet.« Im Falle einer solchen Durchsage raste man mit einem Fotografen zum Tatort. Auf diese Weise erfuhren wir von Mord, Raub und Eifersuchtsattentaten, über die wir dann, meist in Ein-, Zwei- oder Dreispaltern, berichteten.
Ich versah auch am Nachmittag des 4. November 1971, einem Donnerstag, meinen Dienst am Funkgerät, als es aus diesem in geschraubtem Amtsdeutsch tönte: »Ausbruch dreier Insassen aus Strafanstalt Stein. Die Täter auf dem Wege nach Wien befindlich. Achtung: Machen von Schusswaffe Gebrauch!«
Die Ausbrecher hießen Alfred Nejedly, Adolf Schandl und Walter Schubirsch und erlangten in jenen Tagen eine geradezu sagenhafte Berühmtheit, die bis heute anhält. Sie befanden sich wegen diverser Delikte im Gefängnis, ehe es ihnen damals in der Haftanstalt Stein gelang, zwei Wachebeamten die Pistolen abzunehmen und sie zu fesseln. Wie das Leben so spielt, sollte ich einem der Ausbrecher Jahre danach auf kuriose Weise wieder begegnen.
Vorerst befanden sich die drei Männer auf dem Weg nach Wien, wo sie in den nächsten Tagen – mit insgesamt 13 Geiseln – mehr oder weniger planlos herumfuhren. Und hinter ihnen her ein riesiger Pulk von Schaulustigen, Polizisten, Kameraleuten, Fotografen und Journalisten. Einer dieser Begleiter war ich, als Nachwuchsreporter des Kurier. Ich beobachtete, wie sie die Geiseln und Autos wechselten, vom Westbahnhof über die alte Polizeidirektion am Parkring in den siebenten Bezirk fuhren. Und wann immer sich die Möglichkeit ergab, eilte ich zum nächsten Telefonhüttel, um meine Berichte an die Redaktion durchzugeben.
Wie spannend die ganz Österreich in ihren Bann ziehende Geschichte war, zeigt die Tatsache, dass in diesen Tagen an unserem Funkgerät zeitweise kein Geringerer als Hugo Portisch saß, der legendäre Chefredakteur des Kurier, der es sich nicht nehmen ließ, den spannenden Krimi live mitzuerleben. Damals erfuhr ich, was es heißt, Journalist mit Leib und Seele zu sein.
Die Ausbrecher waren mit wechselnden Geiseln vierzig Stunden unterwegs, ehe sie vor einem schmucklosen Siedlungshaus in der Siebenbürgerstraße in Kagran anhielten. Dort wohnte einer ihrer Spezis aus der Justizanstalt Stein, dessen Frau samt acht Kindern gerade zu Hause war. Während Schandl einen anderen Fluchtweg eingeschlagen hatte, zogen sich Schubirsch und Nejedly in das Haus zurück, um sich von den Strapazen ihrer bisherigen Tour zu erholen. Die Reporter und Fotografen standen in einiger Entfernung zu den mit schusssicheren Westen geschützten Polizisten und beobachteten die Lage.
Da treffen am frühen Nachmittag mehrere Limousinen in der Siebenbürgerstraße ein. Aus einer steigt Josef Holaubek, damals schon so beliebt, dass er von Nachbarn mit Bravorufen empfangen wird. Der Polizeipräsident geht auf das Reihenhaus zu und ruft durch die Tür, dass er unbewaffnet sei. Und dann noch: »Macht’s auf, ihr zwa! Was hat denn das Ganze no für an Sinn?« Nach einer kurzen Pause folgt ein Appell, der Josef Holaubek zu einer Popularität verhilft, wie sie kein anderer Polizeichef je erlangen sollte – und zwar in diesem Wortlaut: »I bin’s, der Präsident, der Holaubek – i mach kane Schmäh. Schaut’s nach, schaut’s durchs Guckerl! Da könnt’s sehn, dass i die Wahrheit sag!«
In diesem Moment wird das Haustor von innen geöffnet und Walter Schubirsch erscheint.
»Jetzt kummt’s mit und schlaft’s euch einmal richtig aus«, sagt Holaubek ganz ruhig. »Morgen werma weitersehn.«
Übermüdet und von zweitägiger Flucht zermürbt, nicht zuletzt aber auch der jovialen Art des Polizeipräsidenten vertrauend, verlässt Walter Schubirsch das Haus und geht mit erhobenen Händen auf Holaubek zu, der ihn danach der Obhut wartender Polizisten übergibt.
Minuten später lässt sich auch Nejedly widerstandslos festnehmen.
Josef Holaubek wurde in den Tagen danach wie ein Held gefeiert, dem es gelungen war, eine äußerst bedrohliche Situation unblutig zu Ende zu bringen.
Die Aufregung freilich war noch nicht ganz gebannt, da der dritte Ausbrecher, Adolf Schandl, nach wie vor auf der Flucht war. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, wo er sich aufhielt. In diesem gefährlichen Moment wurde Nejedly aufgefordert, seinen flüchtigen Kumpel zur Aufgabe zu überreden. Und so sprach er auf Drängen der Polizei die folgenden Worte in ein ORF-Mikrofon:
»Schandl, falls du zufällig zuhörst, möcht i da ins Gewissen reden. Es hat kan Sinn mehr. Adi, stö di, leg die Puffn hin und sag, du bist do. Angst brauchst kane haben. Die Behandlung is in Urdnung, da gib i da mei Wurt drauf. Und der Häfen is gar net so schlecht. Des kummt von mir, von innen. Do möcht i liaba zwanzig Joa no dazua, bevur i an Unschuldigen auf die Nasn leg. Also, i geb da no amoi den Rat, Adi: Gib die Puffn o und hör auf mit dem Ganzen.«
Nejedlys Aufruf wird stündlich in den Radionachrichten gesendet. Aber es sollte zweieinhalb Wochen dauern, ehe Schandl gefasst werden konnte.
Nun waren alle drei hinter Gitter. Der »Ausflug« kam sie teuer zu stehen: Schandl und Nejedly wurden zu je sechzehn Jahren schwerem Kerker verurteilt, Schubirsch zu zwölf Jahren – vermutlich, weil er sich als Erster widerstandslos verhaften ließ.