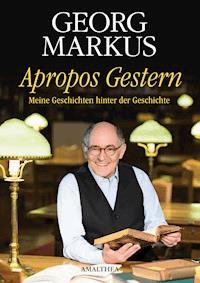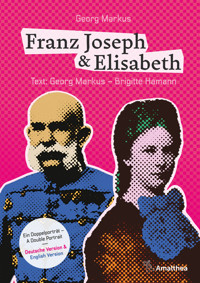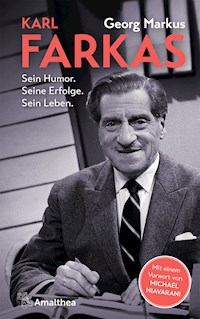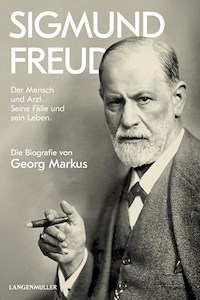Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Satire vom Feinsten - ein Geschichtsbuch, bei dessen Lektüre herzhaft gelacht werden darf. Auf seiner Reise in die Vergangenheit begegnet Georg Markus den Großen aus 1000 Jahren Österreich: Kaiser Franz Joseph, "Sissi" und Maria Theresia, Mozart und Johann Strauß, Nestroy und dem Lieben Augustin, Figl und Kreisky. Messerscharf pointierte Visionen zeigen, wie nahe Wahrheit und Satire einander sind. Komische Situationen mit Walther von der Vogelweide, Kronprinz Rudolf, Radetzky, Freud u. v. a. Georg Markus beweist mit diesem Buch seine Meisterschaft in der Satire.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Georg Markus
Tausend Jahre Kaiserschmarrn
Eine satirische Geschichte Österreichs
Der Abdruck der Texte von Karl Kraus aus »Die Fackel« I/1919 innerhalb des Kapitels »Ein Tag wie jeder andere« erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlags, Frankfurt am Main.
1. Auflage August 19952. Auflage Oktober 19953. Auflage Dezember 1995
© 1995 by Amaltheain der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,Wien · München · BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Marianne Hartkopf, München,mit Illustrationen von Martin »emil« Menzl, WienHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 12/14,5 Punkt Simoncini GaramondDruck und Bindung: Wiener Verlag, HimbergPrinted in Austria 1995ISBN 3-85002-373-7eISBN 978-3-902998-40-8
Inhalt
»Sie leben doch im falschen Zeitalter«
Meine Reise ins Jahr 996
Mit der Kaiserin im Kino
Elisabeth schaut sich einen Sissi-Film an
Walther von der Vogelweide macht Karriere
Aus den unveröffentlichten Memoiren eines Minnesängers
»Jetzt sans wirklich waach«
Ein bisher geheimgehaltenes Staatsvertrags-Protokoll
Gar nix is’ hin!
Der Liebe Augustin lebt
Mata Hari an Oberst Redl
Geheimtreffen der Meisterspione
Bilanz eines modernen Regenten
Kurzes Gespräch mit Kaiser Josef II.
Graugans Martina protestiert
Konrad Lorenz muß den Nobelpreis teilen
Aerarisches Essen Ist Oft Ungenießbar
oder Was AEIOU wirklich bedeutet
Radetzky ist pleite
Herr Pargfrieder besiegt den Kaiser
Walzerkönig trifft Opernführer
Johann Strauß lädt Marcel Prawy auf eine Tasse Kaffee ein
»Um meine Hand haben genügend Prinzen angehalten!«
Ehekrach bei Maria Theresia
Casanova und die Keuschheitskommission
Der Frauenheld am Telefon
Sarajewo bleibt ohne Folgen
Kaiser Franz Ferdinand I., eine Fiktion
»Lumpazi hat keine Schangse!«
Wenn Nestroy heute lebte
»Meine geliebte Anna!«
Aus den (nie geschriebenen) Liebesbriefen des Erzherzogs Johann an die Postmeisterstochter Anna Plochl. Und deren Antworten
Marcus vs. Markus
Exklusivgespräch mit dem Erfinder des Automobils
»Zur Sache« mit Napoleon
Frankreichs Kaiser in Wien
Der Kongreß pflanzt …
… seine Teilnehmer
»Bis meine Knochen zerquetscht waren…«
Brief einer Hexe
Mozart stört Amadeus
oder Wolferl wird’s nie lernen
Eine Fälschungsaffäre im Hause Habsburg
Rudolf der Fälscher, auch der Stifter genannt
Strafanzeige …
gegen Herrn Georg Franz Kolschitzky, Cafétier
»Wir sind der Meinung«
Die (ganz) große Koalition
König Ottokars Glück und kein Ende
oder Wie uns die Habsburger wirklich eroberten
Von der Hofoper in die Großfeldsiedlung
Ein Architekt bereut
»Mundl« beim Kaiser
Ein Wiener Original verirrt sich ins Spanische Hofzeremoniell
Ein Tag wie jeder andere
Der 12. November 1918 im Café Central
»Ich brauche viel Platz für meine Menagerie«
Prinz Eugen läßt das Belvedere bauen
Freud kann Hitler nicht heilen
Eine Therapie, die die Welt hätte verändern können
»In meinem Reich geht die Sonne nicht unter«
Gespräch bei Sonnenuntergang
Einer wird verlieren!
Der gütige Kaiser in »Kulis« Fernsehquiz
Aufregung in der Kapuzinergruft
Nach dem Grabraub der Mary Vetsera
»Mir blieb doch was erspart«
Ein Besuch beim alten Kaiser
Die Österreich-Operette
Die Zweite Republik ist kein Operettenstaat. Oder doch?
Anhang
Kurzbiographien
Quellenverzeichnis
»Sie leben doch im falschen Zeitalter«
Meine Reise ins Jahr 996
Was tragen Sie denn für eigenartige Kleidung?« fragte der Herr, der mir an einem Sonntag vor wenigen Monaten in einem Landgasthof im Herzen der Wachau in die Arme lief.
»Was soll denn an meinem Gewand eigenartig sein?« wunderte ich mich und sah auf meinen einwandfreien Zweireiher hinunter, auf meine Seidenkrawatte und das lederne Schuhwerk. Innerlich mußte ich lachen, denn der Fremde hatte naturfarbene, bis zu den Waden reichende Wollhosen an, einen knielangen Leibrock und Stiefel ohne Absätze. Wenn hier jemand eigenartig gekleidet war, dann war er es, nicht ich. Noch konnte ich nicht ahnen, daß mich die seltsame Begegnung veranlassen würde, eine Zeitreise durch Österreichs tausendjährige Geschichte zu unternehmen.
Ein Blick auf meine Uhr informierte mich, daß es fünf vor zwölf war. Schön und gut, aber welcher Tag, welcher Monat, welches Jahr?
»Heute ist der 1. November«, erriet der Herr in Wollhosen meine Gedanken, »der 1. November 996.«
»Sagten Sie 1996?«
»Machen Sie keine dummen Witze«, maßregelte er mich. Jetzt erst bemerkte ich, daß ich ins falsche Jahrtausend geraten war. Ich sah mich in der düsteren, notdürftig mit Kienspan beleuchteten Stube um, in der tatsächlich nichts zu mir paßte. Ein paar Tische standen da und primitive Holzschemel, aber keine einzige Espressomaschine.
Die hübsche Wirtstochter, die herbeieilte, um meine Bestellung aufzunehmen, trug ein ausgeschnittenes grobes Leinenkleid, das um die Taille mit einer Schnur zusammengehalten wurde. Und ihr langes, dunkles Haar war altmodisch geflochten.
Ich befand mich in der Geburtsstunde Österreichs, man schrieb den 1. November 996. So also sah es damals aus, dachte ich und versuchte die Kluft eines Jahrtausends durch ein paar launige Worte zu überbrücken: »Heut’ ist ein bedeutender Tag für Österreich«, sagte ich.
»Österreich?« Der Fremde starrte mich mit großen Augen an.
»Herr Luitpold, ich glaub’, der Gast im Zweireiher ist nicht ganz normal«, flüsterte die Wirtstochter meinem Gegenüber zu.
»Wart’s ab, Hemma«, nahm mich Luitpold fairerweise in Schutz, weil er mir noch eine Chance geben wollte.
»Sie meinen wohl Ostarrichi?«
»Ach, richtig«, bat ich um Verzeihung, »ich bin ja um tausend Jahre jünger als Sie. Ich habe mich in Ihre Zeit verirrt.«
»Sie sind ein Mensch aus 1996?« Luitpold blieb vor Staunen der Mund offen, und er betrachtete mich fortan als Weltwunder (das ich ja tatsächlich war). Dennoch hätte er mich möglicherweise nicht für verrückt gehalten, wäre nicht just in diesem Augenblick der schrille Pfeifton meines Handys losgegangen. Ich zog es aus der Sakkotasche und sagte »Hallo«.
»Der ist mit dem Teufel im Bunde«, murmelte die in den Minuten seit meiner Ankunft schreckensbleich gewordene Wirtstochter. Sie wich, während es klingelte, einen Schritt zurück und bekreuzigte sich.
Mein Chefredakteur war am Apparat. Auf seine Frage, wann er endlich mit meiner nächsten Kolumne rechnen könnte, antwortete ich, daß sie bereits im Computer sei, jedoch nicht auf Hardware, sondern digital auf Diskette. »Okay?« Als er wissen wollte, wie lang die Story sei, antwortete ich: »Sechstausend Bites.« – »Nehmen Sie Fotos?« – »Ja, vierfarbig.« Dann sagte ich »Good bye« und legte auf.
»Was ist das?« Fassungslos sah Luitpold, dessen Lippen sich noch immer nicht geschlossen hatten, mein Telefon an.
»Ein Handy«, sagte ich, »das gehört zu den Segnungen unseres technischen Zeitalters.«
»Und in welcher Sprache haben Sie gesprochen?«
»Deutsch.«
»Mittelhoch-«
»Nein, EDV-«
»Was werden der Herr speisen?« fragte Hemma das anwesende Weltwunder.
Es hatte Lust auf Lachssandwich und Cola, wagte aber nicht, den Wunsch bekanntzugeben. Also sagte ich:
»Geben Sie mir die Speisenkarte.«
»Speisenkarte?« Wieder sah Hemma irritiert zu ihrem Zeitgenossen. »Wir haben Speck, Käse, Brot und Wein. Auch wenn uns das schon zum Hals heraushängt – viel mehr gibt es nicht in unserer Zeit.«
»Gut, bringen Sie mir eine Portion.«
Während sich das Mädchen noch im Abgehen kaum von mir und meinem Handy abwenden konnte, ergriff Luitpold das Wort: »Warum nennt ihr Ostarrichi jetzt Österreich?«
»Weil Ostarrichi nicht in unser modernes Vokabular paßt. Wir fahren zum Airport, trinken Milkshake und tragen Moonboots. Und unser Popsender heißt Ö 3.«
»Was so viel wie Ostarrichi drei bedeutet?«
»So ungefähr. Jedenfalls feiern wir demnächst Österreichs tausendsten Geburtstag.«
»Das versteh’ ich nicht. Ostarrichi gibt’s ja nicht erst seit heuer, es existiert doch schon viel länger. Es müßte also 1996 um einiges älter sein als tausend Jahre.«
»Seien Sie nicht so kleinlich«, ermahnte ich das mittelalterliche Fossil. »Wir Österreicher feiern eben gern. Und so haben wir mit Freuden entdeckt, daß der Name Ostarrichi am 1. November 996 erstmals in einer Urkunde Ihres Kaisers Otto III. erwähnt wurde. Da haben wir endlich einen Grund, wieder einmal unseren tausendsten Geburtstag zu feiern.«
»Wieder einmal?«
»Ja, wir haben ihn schon 1976 gefeiert. Damals beging man die Übernahme der Herrschaft durch Markgraf Leopold I. am 21. Juli 976 – also tausend Jahre Babenberger.«
»Sie feiern gern in Österreich?«
»Was heißt! Ostarrichi ist das Land der Geiger und Tänzer, es hält einen weltweiten Feiertagsrekord und dokumentiert die permanente Festtagslaune in seinen Lieblingsliedern: Heut kommen d’Engerln auf Urlaub nach Wean, Schrammeln, spielt’s mir no an Tanz, Im Salzkammergut, da kann ma gut lustig sein …
»Die spielen sie auf Ostarrichi drei?«
»Eher auf Regional.«
»Interessant«, vermerkte Luitpold. »Sagen Sie, welcher Babenberger herrscht denn 1996 in Ostarrichi?«
»Gar keiner, das Geschlecht ist mit Herzog Friedrich dem Streitbaren im Jahre 1246 ausgestorben. Danach regierten die Habsburger, deren Motto lautete: Andere mögen Kriege führen, du, glückliches Österreich, heirate! Durch diese glückhafte Ehepolitik wurde das Land im Lauf der Jahrhunderte immer mächtiger. Unser heutiges Staatsoberhaupt ist aber ein Präsident. Und der heißt Thomas.«
»Der setzt wahrscheinlich die glückhafte Ehepolitik der Habsburger fort.«
»Er tut, was er kann.«
Hemma stellte Speis und Trank in Tongefäßen auf den Tisch. Das von mir gereichte Trinkgeld nahm sie, als wäre sie aus unserer Zeit.
»Sie sagen, das Land wurde im Lauf der Jahrhunderte immer mächtiger«, bohrte Luitpold weiter. »Ist Österreich größer als Ostarrichi?«
Wieder mußte ich lachen. Der Landstrich, der 996 erstmals auf einer Pergamentrolle erwähnt wurde, war ein Lehen des Herzogtums Bayern und maß dreißig Königshufe*, bestehend aus ein paar Häusern, Weiden, Wäldern und Gewässern. Das Gebiet lag bei Neuhofen an der Ybbs, sozusagen in Niederostarrichi, ganz in der Nähe des Gasthofs, in dem wir uns jetzt aufhielten. »Später war Österreich eine Weltmacht«, trumpfte ich auf, »so groß, daß in ihr die Sonne nicht unterging.« Dann fügte ich etwas leiser an: »Inzwischen haben wir uns wieder in der Mitte eingependelt, so bei 240 000 Königshufen.«
Als Luitpold aufgrund meiner Erzählungen mutmaßte, daß »aus Ostarrichi ein ziemlich komisches Land geworden sein muß«, reifte in mir der Plan, ein satirisches Buch über unsere tausendjährige Geschichte zu schreiben. Nach ersten Hinweisen, die Vorzüge des Buchdrucks betreffend, weihte ich meinen Gesprächspartner in Details des Projektes ein: »Man müßte mit der Kaiserin Elisabeth ins Kino gehen und sie fragen, was sie von Romy Schneiders Sissi-Filmen hält, man müßte Mozart in ein Tonstudio schicken. Man müßte den Lieben Augustin interviewen und Hitler auf Sigmund Freuds Couch legen.« Luitpold verstand zwar kein Wort, zeigte aber Interesse, als ich ihm weitere Ideen vortrug: »Ich würde Napoleon zu einer Talkshow ins Fernsehen bitten und beim letzten Rendezvous Kaiser Franz Josephs mit der Schratt dabei sein. Und ich möchte beobachten, wie Maria Theresia es fertig brachte, ein ganzes Reich und nebenbei auch noch einen riesigen Haushalt zu regieren.«
»Wenn Sie das alles schaffen, wird Ihr Buch ein bestseller«, zeigte Luitpold, daß er sehr schnell begriffen hatte, worauf es im 20. Jahrhundert ankam. »Aber ich fürchte, Sie haben sich ein bißchen viel vorgenommen. Sie können gar nicht mit der Kaiserin Elisabeth ins Kino gehen. – Sie leben doch im falschen Zeitalter.«
»Wenn’s weiter nichts ist«, zeigte ich die Überlegenheit meiner Generation. »Ich habe es geschafft, mit Ihnen in Kontakt zu treten, Herr Luitpold, also wird das bei den anderen auch zu machen sein. Die sind doch wesentlich jünger als Sie.«
»Haben Sie schon einen Titel für Ihr Buch?« fragte Luitpold.
»Mir gefiele Tausend Jahre Kaiserschmarrn«, sagte ich.
»Was ist ein Schmarrn?«
»Einerseits wertloses Zeug, andererseits aber – als Mehlspeis’ zubereitet – eine Delikatesse.«
»Ein gewisser Widerspruch«, fand Luitpold.
»Das ist ja das typisch Österreichische. Wir warten nicht darauf, bis andere uns widersprechen, wir widersprechen uns selber.«
Luitpold wirkte ob der vielen neuen Eindrücke, die auf ihn eingeströmt waren, einigermaßen ratlos, erklärte sich aber schließlich mit dem Titel einverstanden. Ich verabschiedete mich und machte mich auf den Weg zur Kaiserin Elisabeth …
* entspricht ca. 10 km2
Mit der Kaiserin im Kino
Elisabeth schaut sich einen Sissi-Film an
In einem Wiener Kino spielen sie immer wieder diese herrlichen alten Filme mit dem Moser, dem Hörbiger und der Romy Schneider. Als ich mich letzthin an der Kinokasse um Karten für eine Vorstellung zweier Sissi-Filme anstellte, stand vor mir eine sehr elegante, auffallend schlanke Dame, die sich außerstande sah, die Eintrittsgebühr in Höhe von öS 85,– für einen Platz in der zwölften Reihe fußfrei zu bezahlen. Sie hätte mit barem Geld nie zu tun gehabt, erklärte sie der verdutzten Kassierin. Durch Zufall Zeuge der kleinen Szene geworden, erwies ich mich als perfekter Gentleman und lud die Fremde spontan ein, sich mit mir Sissi, die junge Kaiserin und danach Sissi, Schicksalsjahre einer Kaiserin anzuschauen.
Werbung und Vorankündigung Demnächst in diesem Kino nahm die langhaarige Schönheit noch kommentarlos hin, doch kaum hatte der Hauptfilm begonnen, beugte sich meine Sitznachbarin zu mir und fragte mich: »Das soll ich sein?«
Während Kamera 1 das kaiserliche Schloß Schönbrunn in seiner ganzen Pracht in die Totale nimmt, warf ich einen Blick nach rechts und entdeckte im Halbdunkel tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Hauptdarstellerin und der Dame an meiner Seite: »Sie wollen mir doch nicht weismachen, daß Sie die Kaiserin Elisabeth sind?« sagte ich ungläubig.
»Natürlich«, flüsterte sie mir zu, »ich habe schon so viel von diesen Sissi-Filmen gehört, jetzt will ich mir endlich selbst einmal ein Urteil bilden.«
Schnitt/Kamera 2: Die blutjunge Sissi fegt in einem atemberaubenden Kostüm von Lambert Hofer die Feststiege des Schlosses hinauf. Pikiert fragte mich die Kaiserin im Kinosessel: »Warum hat man denn diese kleine Schauspielerin genommen, ich bin doch mindestens einen halben Kopf größer als sie.«
»Majestät«, wandte ich ein, »Romy Schneider war wohl die beste und prominenteste Besetzung, die der österreichische Film für Ihre Rolle zu bieten hatte.«
»Sie ist ja ganz herzig«, gab Elisabeth zu, »aber gerade herzig wollte ich nie sein. Ich bin eine moderne, emanzipierte Frau.«
»Ruhe«, herrschte eine ältere Dame aus einer der vorderen Sitzreihen die Kaiserin an, »man versteht ja kein Wort von dem, was die Kaiserin sagt.«
In diesem Moment erscheint auf der Leinwand Vilma Degischer als Sissis böse Schwiegermutter Erzherzogin Sophie und zeigt einer Gräfin Esterházy, wie’s bei Hof zugeht: »Ich habe Sie zur Obersthofmeisterin Ihrer Majestät gemacht, weil ich Vertrauen zu Ihnen habe. Ich wünsche über alles, was Ihre Majestät tut, genauestens informiert zu werden.«
»Diese Schlange«, zischte mir Elisabeth gar nicht majestätisch zu, »diese Schlange hat mir eine Spionin an den Hals gehetzt. Nach hundertfünfzig Jahren muß ich im Kino erfahren, daß die Esterházy von Sophie bestochen war.« Nachträglich war der Kaiserin zu meiner Rechten der Schreck in die Glieder gefahren.
Nun erweist sich die Esterházy als Sophies würdige Agentin: »Ihre Majestät hat sich über die primitiven Badegelegenheiten im Schloß beklagt«, meldet sie der Erzherzogin. »Hier hat eine Maria Theresia gebadet«, stellt die Mutter des Kaisers ihren wahren Charakter unter Beweis, »es wird auch für eine kleine bayerische Prinzessin, die zufällig Kaiserin geworden ist, gut genug sein.«
»Sophie hat mir in Schönbrunn nicht einmal einen Waschtisch genehmigt«, machte Elisabeth ihrem Ärger Luft.
»Schweigen Sie!« meldete sich die Dame aus der vorderen Reihe noch einmal zu Wort und rief der Kaiserin zu: »Woher wollen denn Sie wissen, wie’s bei Hof zuging?«
Überblendung/Kamera 3. Karlheinz Böhm taucht als junger Kaiser auf und eröffnet einen tiefschürfenden Dialog.
Franz Joseph: »Sissi, ich hab’ so Sehnsucht nach dir gehabt.«
Elisabeth: »Immer sitzt du an deinem Schreibtisch und regierst. Ich bin schon ganz eifersüchtig auf deinen Schreibtisch.«
»Ein fürchterlicher Kitsch«, wisperte mir die Kaiserin ins Ohr. »Andererseits muß ich zugeben, daß es genauso gewesen ist. Hätte der Kaiser damals auf mich gehört, wäre unsere Ehe noch zu retten gewesen.«
»Pssst« machte ein linksaußen in unserer Reihe sitzender Herr, »Sie stören die Vorstellung!« Gleichzeitig raschelte er so laut mit einer Tüte Popcorn, daß ich das nun folgende Gespräch, in dem Sissi dem Kaiser ihr Heimweh nach Bayern klagt, nur bruchstückhaft verfolgen konnte.
Franz Joseph: »Ich tu’ doch alles, um dich in deiner neuen Heimat« – Krrrrr – »glücklich zu ma« – Raschel – »Das bist du doch?«
Elisabeth: »Nur wenn du bei mir …« Der Rest ging in einer dröhnenden Popcornorgie unter.
Ein Lakai Seiner Majestät tritt unangemeldet ins Arbeitszimmer und überrascht das sich innig küssende kaiserliche Paar in flagranti.
»Unerhört«, erregte sich die hohe Dame neben mir über die Indiskretion.
Leinwandfüllend tauchen erste Wolken auf – sowohl über der Residenzstadt Wien als auch am Ehehorizont. Regisseur Ernst Marischka versteht es in unnachahmlicher Weise, Bild (Kamera 1/Totale) und Ton aufeinander abzustimmen. Kaum ist Sissis erstes Kind bei anhaltendem Schlechtwetter geboren, entführt Schwiegermama Sophie das Neugeborene auch schon in ihre Gemächer. Und sagt, sie selbst werde die Erziehung des Mädchens in die Hand nehmen. Da es Franz Joseph verabsäumt, sich für die Rechte seiner Frau als Kindesmutter einzusetzen, verläßt Elisabeth fluchtartig Wien und die Monarchie.
Kamera 2/Staatskrise. Die Kaiserin ist weg, streift durch ihre geliebten bayerischen Wälder. Ihr Papa – Herzog Max – nimmt sein überraschend heimgekehrtes Kind in die Arme: dem Schauspieler Gustav Knuth steigen Tränen des Glücks in die Augen.
Elisabeths Mutter Maria Ludovika tritt auf. »Die sieht mir aber sehr ähnlich«, zeigte sich die Kaiserin neben mir beeindruckt. »Jedenfalls im Film.«
»Kein Wunder«, erklärte ich, »Magda Schneider ist Romys echte Mutter.«
Wieder Schönbrunn. Kamera 3 fährt aus der Halbtotalen auf Erzherzogin Sophie zu, die ihrem Sohn erklärt, sie habe ihn »immer schon vor dieser Heirat gewarnt«.
Dazu Elisabeths Kommentar im Kino: »Frechheit!«
Schnitt/Kamera 2/Tiroler Berge. Franzl hat Sissi aus Possenhofen geholt, jetzt machen sie Urlaub. Inkognito. Hugo Gottschlich, der zünftige Hüttenwirt, erkennt seinen Kaiser weder en face noch im Profil und ruft dem jungen Paar in alpenländischer Mundart zu: »Wenn’s wollt’s, könnt’s a paar Tag’ bleiben, aber die Stub’n müßt’s selber saubermachen!«
Während sich die p. t. Kaiserin auf der Leinwand zur Reinigung des primitiven Schlafgemachs anschickt, war die neben mir sitzende einer Ohnmacht nahe: »Ich und eine Stube putzen?« Bei Kaisers Abreise von der Alm verabschiedet sich der nach wie vor ahnungslose Wirt dann von Franzl und Sissi mit einem herzhaften »Pfüat euch Gott!«
Kamera 1. Man schreibt das Jahr 1867, Kaiserin und Kaiser reisen in einer prachtvollen Kutsche zur ungarischen Königskrönung nach Budapest. Sissi, auf dem Weg dorthin, in der Pußta: »Wie unendlich weit dieses Land ist, als reichte es bis zum Himmel, bis zum lieben Gott!«
»Das ist zuviel!« Die Frau neben mir sprang auf, um protestierend das Kino zu verlassen. »Wer verlangt denn, daß ich so geschwollen daherrede?«
»Der Verleih«, sagte ich und hielt sie am Rockzipfel fest. In den Dörfern brüllen Tausende Bauern ihrer künftigen Königin ein herzhaftes »Eljen« zu, und die in ihren Kinositz zurückgesunkene Elisabeth wunderte sich, daß eine österreichische Filmfirma so viel Geld für Statisten aufbringen konnte. Kaum hatten wir Teil eins überstanden, legte der Operateur ohne weitere Vorwarnung die Schicksalsjahre einer Kaiserin ein.
Im Anschluß an das imposante Eröffnungsbild – ungarische Krönung in der Matthiaskirche zu Budapest – lädt der fesche Graf Andrássy alias Walther Reyer zu einem Fest auf sein Schloß. Der einst zum Tod verurteilte Revolutionär gesteht Sissi via Kamera 3 tränenreich: »Ich bin unsterblich verliebt in meine Königin, ich liebe Eure Majestät.«
Die ob dieser Szene neben mir zusehends nervöser werdende Kaiserin kramte in ihrer Handtasche, der sie einen kleinen Fächer entnahm, um damit für etwas Frischluft zu sorgen.
»Majestät«, sagte ich, »es wurde viel gemunkelt, daß Sie und Andrássy … Was ist wahr an diesen Gerüchten?«
»Kann ich mich darauf verlassen, daß Sie unser Gespräch vertraulich behandeln und es nicht irgendwo veröffentlicht wird?« fragte mich die Kaiserin.
»Natürlich«, beruhigte ich sie und fertigte im Dunkeln ein paar Notizen für diesen Bericht an.
»Also gut, ich habe den Grafen Andrássy wirklich geliebt«, flüsterte mir die Kaiserin zu, »aber ich bin meinem Mann …«
»… treu geblieben?« mischte sich just in diesem Augenblick ein hinter uns sitzender Herr, der uns schon längere Zeit belauscht haben mußte, ins vertrauliche Gespräch ein. Elisabeth begann noch wilder mit ihrem Fächer zu wacheln und verweigerte jede weitere Auskunft zum Thema Andrássy. Womit diese Frage von eminenter Tragweite nie mehr beantwortet werden dürfte.
Romy Schneider zeigt nun in der epischen Darstellung der lungenkranken Kaiserin eine geradezu Oscar-reife Leistung. Sissi wird zu guter Letzt wie durch ein Wunder geheilt, womit – unter den Klängen der Kaiserhymne und dem Wort
ENDE
im Nachspann – das Finale geschafft ist.
»Das ist das Ende?« fragte mich die Kaiserin, während wir uns von den Kinositzen erhoben.
Auf dem Weg Richtung Kapuzinergruft forschte ich, wie ihr die beiden Filme gefallen hätten.
»Es überrascht mich,« antwortete Elisabeth, »daß dieser Ernst Marischka gerade die wichtigsten Stationen meines Lebens einfach weggelassen hat.«
»Welche Stationen?« stellte ich mich naiv.
»Also, meine kleine Sophie, unser erstes Kind, das im Film des langen und breiten als entzückendes Mäderl gezeigt wird, ist im Alter von zwei Jahren gestorben. Davon erfährt man im Kino ebensowenig wie von der Tatsache, daß ich noch drei weitere Kinder hatte: Gisela, Marie Valerie und Rudolf wurden dem Publikum von Herrn Marischka glatt verschwiegen. Dadurch hat auch der schlimmste Schicksalsschlag meines Lebens gar nicht stattgefunden – Mayerling gibt’s nicht im Film.«
Während wir die Opernkreuzung überquerten, fielen Elisabeth weitere filmische Unterlassungssünden ein. »Was ist mit meinem Lieblingscousin«, sagte sie, »dem König Ludwig von Bayern, der 1886 im Starnberger See ertrank? Und wieso wird meine Trauer um meine verstorbenen Schwestern Helene und Sophie nicht gezeigt? Auch die Hinrichtung meines Schwagers, Kaiser Maximilian von Mexiko, findet keine Erwähnung. Und, glauben Sie wirklich, daß die Damen Anna Nahowski – die meinem Mann immerhin zwei Kinder schenkte – und Katharina Schratt mit meiner Biographie rein gar nichts zu tun haben? Wieso ist von der nervösen Magersucht, die mich so viele Jahre plagte, keine Rede? Und von den ständigen Todesahnungen, die mich in den letzten Jahren befielen? Auch meine Ermordung in Genf hat laut Film nicht stattgefunden!«
Da ich keinen ihrer Einwände seriös entkräften konnte, zuckte ich nur stumm mit den Schultern und hörte der kompetenten Filmkritikerin weiter zu: »Ich kann mir nicht helfen«, sagte sie, »diese Sissi-Filme haben mit mir sehr wenig zu tun. Ich war ganz anders.«
»Gewiß, Majestät«, sagte ich jetzt, »aber die Filmleute müssen ans Geschäft denken und können auf unwichtige Kleinigkeiten wie Wahrheit und Ähnlichkeit keine Rücksicht nehmen.«
Kaiserin Elisabeth hielt einen Augenblick inne, ehe sie zum Schluß kam: »Das bedeutet wohl, daß mich die Menschen in Ihrem Jahrhundert als zuckersüße, kleingewachsene, recht glückliche Kaiserin sehen, die keine Tragödien erlebte, so gut wie keine Eheprobleme hatte und nicht ermordet wurde!«
»Majestät haben recht«, mußte ich zugeben. »Zumindest bis der nächste Sissi-Film gedreht wird.«
Walther von der Vogelweide macht Karriere
Aus den unveröffentlichten Memoiren eines Minnesängers
Der prominenteste Austropop-Star des Mittelalters sitzt – in langem, fließendem Gewand und ledernen Schnabelschuhen an den Füßen – in den Zinnen einer Ritterburg. Er begleitet seinen Gesang mit der Leier.
Ich heiße von der Vogelweide, Walther,
Unbekannt blieb mein genaues Alter.
Man weiß nur ganz ungefähr,
Wo ging ich hin, wo kam ich her.
Um 1170 ward’ ich geboren,
Anno 1230 hat die Welt mich wieder verloren.
Dazwischen sang ich von Rittern und von der Liebe,
Ich besang ihre Kriege, ich besang ihre Triebe.
Politische Kommentare hinterließ ich für Generationen,
Selbst meine eigenen Herren wollt’ ich nicht schonen.
So konnt’ meine Dichtkunst am Hofe zu Wien
Bei den Babenbergern nicht lange erblüh’n.
So manchem Fürsten dient’ ich als Sänger der Minne,
Der Papst freilich dachte eher, ich spinne!
Denn im Streit zwischen Kaiser und Heiligem Stuhl
Dient’ ich eher dem Reich als dem römischen Pfuhl.
Sie werden mich fragen, wie die Zeiten damals so waren,
Na bitte, Sie sollen es hier gleich erfahren:
In dem Jahr, als ich vermutlich geboren,
Hat man St. Veit zur Hauptstadt von Kärnten erkoren.
Österreichs Herzog hieß Jasomirgott, Heinrich,
Wie er gestorben, das war eher peinlich:
Im Krieg gegen Böhmen verließ ihn das Glücke –
Als er stürzte vom Pferd auf einer sehr morschen Brücke
In einer Gegend, wo die Donau sehr steil war,
Brach er sich ein Bein (was damals unheilbar).
Während ich auf Burgen gesungen, gedichtet,
Wurde im Stil der Romanik sehr viel errichtet.
Doch damit ich mich dabei nicht unnötig verzettel,
Nenn’ ich nur wenige Bauten: den Dom zu Gurk, das Stift von Zwettl,
Den Dom auch in Salzburg und den Verduner Altar (in Klosterneuburg, wie jedermann klar).
Ich war schon zu Lebzeiten sehr populär,
Fuhr im Wagen von Auftritt zu Auftritt umher,
Meine Lyrik fand damals immense Verbreitung:
Ich ersetzte – könnte man sagen – im Mittelalter die Kronen Zeitung.
Meine Zeit, die war ganz besonders bestimmt
Vom Heere der Kreuzritter, was viele ergrimmt.
Sie zogen per Flotte ins Heilige Land
Mit Kaiser Friedrich Barbarossa als Kommandant.
Doch jener ertrank im Schatten edler Magnolien,
Beim Baden im Flusse Saleph in West-Anatolien.
Eine Todesart, schlimm und abscheulich –
Und nicht nur für Rittersleut’ sehr unerfreulich.
Nach drei Jahren Kreuzzug mit solchen Problemen
Gelang es Österreich, die Stadt Akkon zu nehmen.
Herzog Leopold hieß unser Held,
Doch die Heldentat ward’ ihm gar schrecklich vergällt,
Denn auf wen trifft er dort, an Jerusalems Pforten?
Auf Richard Löwenherz mit seinen Kohorten!
Der englische König ward’ sehr erbittert,
Weil er es gewohnt’, daß man vor ihm zittert.
Drum riß er die Fahne des Herzogs vom Schloß
Und setzte sich wieder auf sein hohes Roß.
Der Herzog, der kämpfte, so sagen’s Legenden,
Um seine Flagge mit Füßen und Händen.
Er wurde verwundet, er war zwar nicht tot,
Doch ward’ seine Fahne durch’s Blut rot-weiß-rot.
So schlimm hat man’s mit unsrem Herzog getrieben.
Die Fahne jedoch ist bis heut’ so geblieben.
Der Herzog hat Richard das niemals vergessen.
Und kaum ein Jahr später ist der schon gesessen.
Der Österreicher hielt ihn in Dürnstein gefangen,
Wo dem König leider nicht meine Gesänge erklangen,
Denn da war ja Kollege Blondel in Lionhearts Diensten,
Wodurch sich nicht meine, sondern dessen Gelder verzinsten.
Bei Lionheart traf es bekanntlich kan’ Armen,
Es hält sich in Grenzen daher mein Erbarmen –
Allein mit dem Lösegeld, das man für ihn genommen,
Hat Wiener Neustadt seine Stadtmauer bekommen.
Bei so vielen Rittern und Helden im Heer
War’s – ich sag’s ganz ehrlich – gar nicht so schwer,
(ich nehme fast an, Sie werden jetzt lachen):
Als Minnesänger Karriere zu machen!
»Jetzt sans wirklich waach«
Ein bisher geheimgehaltenes Staatsvertrags-Protokoll
DIE PERSONEN:
Dwight D. Eisenhower, 34. Präsident der Vereinigten
Staaten von Amerika
Nikita Chruschtschow, Vorsitzender der KPdSU
Am Schreibtisch des US-Präsidenten im Oval Office des Weißen Hauses läutete in den Morgenstunden des 16. April 1955 das »rote Telefon«, jener Apparat, der die direkte Verbindung zwischen den beiden mächtigsten Männern der Welt herstellte. General Eisenhower hob ab.
»Ike?« fragte ein Herr mit russischem Akzent.
»Yes!«
»Hier Nikita!«
»Hallo, Niki, how are you?«
»Charascho.«
»And how is Nina?«
»Otschen Charascho. Sie hat nur gerade so viel zu tun. Wir haben Gäste hier im Kreml.«
»Gäste? Von wo?«
»Awstria, aus Wien.«
»Oh, Vienna, I know. Die waren auch schon bei mir im Weißen Haus. Der Figl Poldl und der Raab Julius, very funny guys, reden immer nur über ihren … how do they say? – Staatsvertrag. And they drink wine like water.«
»Wino, na sdrowje! Ich kann kaum schauen aus Augen von Verhandlungen letzte Nacht. Irgendwann, nach die achte Viertel Brünnerstraßler, den sie haben mitgebracht, flüsterte der Poldl dem Julius ganz leise in Ohr: ›Und jetzt, Raab – jetzt noch d’Reblaus, dann sans waach.‹«
»Woher weißt du Wortlaut so genau, wenn Figl hat ganz leise geflüstert in Ohr von Raab?«
»Du kennst doch unseren KGB. Alles verwanzt!«
»Auch der Rote Salon von Kreml ist verwanzt?«
»Woher weißt du, daß Verhandlung war in Rote Salon von Kreml?«
»Du kennst doch unseren CIA …!«
»Ike, du bist ein Schlawiner!«
»What is a Schlawiner?«
»Ich kann nicht übersetzen. Wort haben mir Gäste aus Wien letzte Nacht beigebracht.«
»Tell me, Niki, why do you call me?«
»Awstriski wollen haben Staatsvertrag, wollen Unabhängigkeit, Souveränität, Neutralität. Was sollen wir machen?«
»Well, wir geben ihnen alles, was sie wollen, it’s okay!«
»Das ist verdächtig, Towarisch, wenn du sagst it’s okay. Dann muß sein Haken daran.«
»Oh, no, kein Haken, you can sign this statescontract, no problem, believe me!«
»Wenn du das sagen, Ike, kann doch nur bedeuten, daß dieser Staatssekretär Kreisky Bruno dir hat erklärt, Österreich will Annäherung an Amerika!«
»That’s right!«
»Ich nix verstehen, nitschewo. Denn mir hat Kreisky Bruno erklärt, Österreich will Annäherung an UdSSR!«
»Das hat er dir erklärt? I can’t understand!«
»Jetzt du weißt, was ist Schlawiner?«
»Yes, now I know! Trotzdem, I am absolutely für neutrality von Austria. Vor allem wegen die Militär!«
»Wegen die Militär?«
»Yes, Austria möchte haben eigene Armee. I spoke to my Generals, die zittern jetzt schon. Stell dir vor, Nikita, Österreich greift einen von uns beiden mit seinem gefährlichen Bundesheer an, unvorstellbar! Darum wir müssen ihnen geben die Neutralität.«
»Wäre Awstriski Bundesheer wirklich so gefährlich?«
»Ja, schrecklich!«
»Wer sagt?«
»Auch Kreisky Bruno!«
»Towarisch Figl fordert, daß wir sollen abziehen unsere Besatzungssoldaten!«
»Er fordert?«
»Ja.«
»How is that possible?« Eisenhower, ansonsten die Ruhe in Person, schien erregt. »Wie kann Mr. Figl von uns etwas fordern? Die haben doch den Krieg verloren, they’ve lost the war!«
»Towarisch Raab sagt, sie können nix dafür, Awstriski sind unschuldig. Hitler war Deutscher, Beethoven Österreicher, Gershwin hat das Fiakerlied komponiert, Tschaikowski die Bundeshymne, und Udo Proksch ist noch gar nicht auf der Welt … oder so ähnlich.«
»Laß dir doch von diesen Wienern nicht auf der Nase herumtanzen, they dance on your nose. Das sind …, how did you say –?«
»Schlawiner!«
»That’s right! Also, wenn sie unverschämte Forderungen stellen, dann wir müssen ablehnen! Dulles, mein Außenminister, said to me, wir haben mit Marshallplan so many millions in austrian industry gebuttert. Ein Staatsvertrag würde american economy keinen Dollar bringen.«