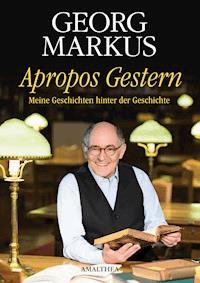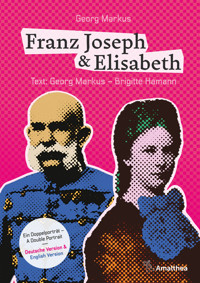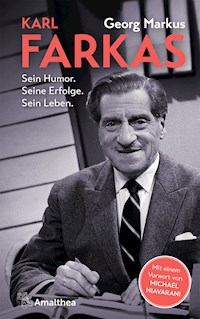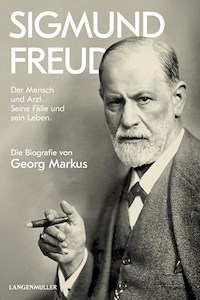Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wenn Georg Markus in die Vergangenheit reist, bringt er viele faszinierende Geschichten mit: Seine Reisen führten ihn zu berühmten Leuten, in die Welt der Liebe, des Theaters und der Musik, an den Hof des Kaisers und zu den großen Schauplätzen der Weltgeschichte. Markus gewährt seinen Lesern aber auch zum ersten Mal Einblick in die Geheimnisse seiner historischen Berichte. Und er setzt mit dem Fortsetzungskapitel seines Bestsellers "Die Enkel der Tante Jolesch" einen amüsanten Abschluss für dieses Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GEORGMARKUS
Meine Reisen indie Vergangenheit
1. Auflage September 20022. Auflage Oktober 2002
Besuchen Sie uns im Internet unter:http://www.amalthea.at/
© 2002 by Amalthea Signum Verlag GmbH, WienAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel, MünchenUmschlagillustration: Paul FassoldHerstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger& Karl Schaumann GmbH, HeimstettenGesetzt aus der 12,5/17 Punkt GoudyDruck: Jos. C. Huber, DießenBinden: Leipziger GroßbuchbindereiPrinted in GermanyISBN 3-85002-483-0eISBN 978-3-902998-53-8
Für Mathiasund Moritz
INHALT
»ES IST SCHRECKLICH, EIN ZEITZEUGE ZU SEIN!«
Vorwort
Meine Reisenin die Welt der Musik
»WIE EINST, LILI MARLEEN«
Ein Jahrhundert-Schlager entsteht
BRAHMS LAG IM PAPIERKORB
Professor Marcus macht eine Entdeckung
DAS »WEISSE RÖSSL« IST NICHT AM WOLFGANGSEE
Die wahre Lovestory hinter der Operette
DIE FRAUEN DES WALZERKÖNIGS …
… und ihr Einfluss auf seine Musik
»VOLK DER FREIHEIT, VOLK DER BRÜDER«
Die andere Bundeshymne
»DER FÜR DAS HOHE C GEBORNE«
Das Wunder Caruso
Meine Reisenzu den Schauplätzender Weltgeschichte
TOD IM HOTEL
Mein Besuch im Genfer Beau-Rivage
OBERST REDL AUF DER SPUR
Österreichs größter Spionagefall
»ALLES GERETTET!«
Der Brand des Wiener Ringtheaters
Meine Reisenin die Welt der Liebe
»ICH SCHAU DIR IN DIE AUGEN, KLEINES!«
»Casablanca« allzu wörtlich genommen
DER JUNGE MANN UND DIE AFFÄR’
Hemingways Doppelleben im Montafon
SO LIEBTE CASANOVA
Aus dem Leben eines Frauenhelden
DIE SITTENWÄCHTER DER KAISERIN
Maria Theresias Keuschheitskommission
Meine Reisenzu berühmten Leuten
AUF FREUDS COUCH
Zeitzeugen und Patienten
HERR VON KNIGGE BENIMMT SICH SCHLECHT
Der Ahnherr der feinen Sitten war nicht immer fein
»MEIN GOTT, ES SPRICHT«
Wie Mr. Bell das Telefon erfand
»ICH FREU MICH SCHON AUFS HIMMELREICH«
Ein Gespräch mit der 105-jährigen Schauspielerin Liane Haid
Meine Reisennach Mayerling
»DAS GRAB IST LEER!«
Wie ich Mary Vetseras Gebeine fand
Meine Reisenzu Typen und Originalen
BERUF: RIESE
Die Lebensgeschichte des Franz Winkelmeier
DER ECHTE »HAUPTMANN VON KÖPENICK«
Die Geschichte des Schusters Wilhelm Voigt
»SCHNORRER BRAUCHT MAN ÜBERALL«
Wie berühmte Leute wohlhabend wurden (und blieben)
Meine Reisenin die Geschichte der Medizin
DER GRUND FÜR BEETHOVENS TAUBHEIT
Ein medizinischer Kriminalfall
DER LIEBE GOTT UNTER DEN CHIRURGEN
Theodor Billroth
DIE ERSTE FRAU DOKTOR
Gabriele Possanner setzt sich durch
ER IST IMMER AUF DER FLUCHT
Ein Besuch beim Sohn von Karl Farkas
Meine Reisenin die Welt des Theaters
VOM SKLAVEN ZUM THEATERSTAR
oder Warum das Publikum schuld ist
Meine Reisenan den Hof des Kaisers
»HILFE, MÖRDER! EIN ATTENTAT!«
Wie Kaiser Franz Joseph einen Mordanschlag überlebte
»ERWARTEN SIE MICH IM BETT«
Intime Tagebücher
DIE GEHEIMEHE
Kaiser Franz Joseph und die Schratt
DIE NACKTE KAISERIN
oder Franz Joseph wird erpresst
Meine Reisenin andere Zeiten
»MEINE SCHWESTER MERCEDES«
Ein Mädchenname wird berühmt
DUELL
Der Zweikampf und die Ehre
»EIN GEMÜTLICHER SPEZI«
Aus dem Leben des k. k. Scharfrichters Josef Lang
Meine Reisenin eine wundersame Welt
EIN KREUZ AUF DEM KALENDERBLATT
Was Nostradamus wirklich prophezeite
»HANUSSEN LEBT« …
… behauptet seine Tochter
DIE WELT STEHT AUF KEIN FALL MEHR LANG
oder Der Komet kommt!
Meine Reisenzu den Enkeln der Tante Jolesch
»GUTE ERNTE, SCHLECHTE SAAD«
Ein Nachtrag
Quellenverzeichnis
»ES IST SCHRECKLICH,EIN ZEITZEUGE ZU SEIN!«
Vorwort
Reisen ist eigentlich eine Frage der Geografie. Reisen kann man nach New York, Paris, Rom, Mistelbach oder Honolulu. Aber in die Vergangenheit?
Man kann. Ich reise seit gut drei Jahrzehnten dorthin. Und das mit ungebrochener Reiselust.
Denn nichts erscheint mir spannender als Ereignissen auf die Spur zu kommen, die sich vor fünfzig, siebzig, hundert und mehr Jahren zutrugen und deren Hintergründe immer noch Rätsel aufgeben. Das können historisch bedeutsame Geschehnisse sein oder auch kleinere menschliche Begebenheiten, die ein wenig Licht auf vergangene Zeiten werfen. Wie war das, als ein Spielzeughändler aus Amsterdam den österreichischen Kaiser Franz Joseph zu erpressen versuchte? – ja, ein solch wahnwitziges Unterfangen hat es tatsächlich gegeben. Wie konnte es geschehen, dass der Spion Alfred Redl durch seinen Verrat die k. u. k. Monarchie an den Rand des Abgrunds drängte? Wer waren die Patienten, die sich auf Freuds Couch legten?
Meine Reisen in die Vergangenheit begeisterten mich vor allem dann, wenn sich aus ihnen neue Schlüsse ziehen ließen. Ich nahm daher Einblick in den Polizeiakt, der den Versuch, den Kaiser zu erpressen, dokumentiert. Und ich durchforstete in- und ausländische Archive, um herauszufinden, was Oberst Redl wirklich verraten hat. Und ich machte mich auch auf den Weg, die Krankengeschichten der Freud-Patienten zu studieren.
Archive und Polizeiakte neigen dazu, verstaubt zu sein. Deshalb suche ich, wann immer ich in die Vergangenheit reise, die Begegnung mit Zeitzeugen. »Hör mir auf mit Zeitzeugen«, pflegt mein Freund Marcel Prawy zu sagen, »es ist schrecklich, ein Zeitzeuge zu sein! Zuerst wird man geboren, dann ist man klein, dann wächst man heran, dann ist man erwachsen, dann ist man ein alter Kracher und dann kommt das Letzte und Ärgste, was einem passieren kann: man ist Zeitzeuge.«
Und doch kenne ich (und kennt wohl auch er) keinen besseren Weg, Geschichte lebendig und authentisch zu vermitteln, als durch das Gespräch mit jenen Menschen, die damals dabei waren. Wer sonst als die in Wien lebende Schwester hätte mir erklären können, wie es dazu kam, dass im Jahre 1900 eine bis heute überaus populäre Automobilmarke nach einem Mädchen, das Mercedes Jellinek hieß, benannt wurde? Wer sonst als dessen Tochter hätte mir die Irrwege des weltberühmten Hellsehers Hanussen aufzeigen können? Und wer sonst hätte mir den Menschen hinter der Ikone Sigmund Freud näher bringen können als sein letzter lebender Schüler, den ich 1989 in den USA traf?
Meine Reisen in die Vergangenheit führten mich auch in die Welt des Theaters und des Films, ins Reich der Liebe, der Medizin und der Musik. Bei Beethoven Station machend, erfuhr ich, auf welch abenteuerliche Weise es zwei Wiener Ärzten gelungen war, eineinhalb Jahrhunderte nach dem Tod des Musikgenies den Grund seiner Taubheit herauszufinden. Ein andermal traf ich einen Musikforscher, der verloren geglaubte Kompositionen von Johannes Brahms entdeckte, die dessen Haushälterin aus dem Papierkorb gefischt und damit für alle Zeiten gerettet hatte. Und der Komponist Norbert Schultze erzählte mir, welch weltpolitischer Tragödie es bedurfte, um sein Lied Wie einst, Lili Marleen zu einem der meistgesungenen Schlager des 20. Jahrhunderts zu machen.
Meine Reisen in die Vergangenheit führten mich auch in ganz andere Zeiten und Regionen. Hat Nostradamus vor fünfhundert Jahren wirklich Einsteins Relativitätstheorie, das Attentat auf John F. Kennedy und die Landung auf dem Mond vorhergesagt, wie dies von seinen Jüngern behauptet wird? Welche Folgen hatte es, wenn man von Maria Theresias Keuschheitskommission beim außerehelichen Tête-à-Tête erwischt wurde? Und wer, bitte sehr, war der echte Hauptmann von Köpenick?
Ich erzähle in diesem Buch nicht nur diese und etliche andere Geschichten, sondern möchte meinen Lesern auch Einblick geben, auf welche Weise meine Reisen in die Vergangenheit zustande kamen. Wie ich etwa Ernest Hemingways Doppelleben auf die Spur kam, der in jungen Jahren im Vorarlberger Montafon Urlaub machte – und zwar pikanterweise gleichzeitig mit Gattin und Geliebter. Oder wie es mir gelang, den Raub der Gebeine Mary Vetseras aus ihrem Grab aufzuklären. Und wie die damals noch lebende Kaiserin Zita reagierte, als ich über die Hintergründe einer zwischen Kaiser Franz Joseph und der Schauspielerin Katharina Schratt geschlossenen Geheimehe schrieb.
In meinem Bestreben, Geschichte – dort, wo es möglich und angebracht ist – auch ein wenig von ihrer heiteren Seite zu betrachten, schließe ich dieses Buch mit dem Kapitel Meine Reisen zu den Enkeln der Tante Jolesch. Und dies hat eine Vorgeschichte: Das Buch, das ich vor diesem schrieb, trägt den Titel Die Enkel der Tante Jolesch und war als Fortsetzung der Schilderungen gedacht, die der unvergessene Friedrich Torberg jenen Typen und Originalen gewidmet hatte, die ihm in den Jahren 1918 bis ’38 (um die Zeit ganz grob zu umreißen) begegnet waren. In meinem im Herbst 2001 erschienenen Buch von den Enkeln der Tante Jolesch hielt ich Aussprüche und Anekdoten jener beiden Generationen fest, die der Torbergschen Original-Tante Jolesch folgten. Da finden sich Geschichten berühmter Menschen wie Billy Wilder und Marlene Dietrich, Karl Farkas und Helmut Qualtinger, Leopold Figl und Bruno Kreisky, aber auch vieler unbekannter Käuze.
Als das Buch von den Enkeln der Tante Jolesch fertig war, erging es mir ähnlich, wie es einst Torberg ergangen. Mir selbst fielen weitere Geschichten ein, andere wurden mir von Freunden und Bekannten hinterbracht oder aus dem erfreulich großen Leserkreis herangetragen. Jemand riet mir sogar, ich möge noch ein Buch zum Thema, diesmal mit dem Titel Die Urenkel der Tante Jolesch, schreiben, doch das wäre wohl zu viel gewesen. Ein Fortsetzungskapitel in diesem Buch schien mir der richtigere Weg.
Wenn Sie mich auf den nun folgenden dreihundert Seiten begleiten, wünsche ich Ihnen eine ebenso spannungs- und unterhaltungsreiche Zeit, wie ich selbst sie auf meinen Reisen in die Vergangenheit erleben durfte.
GEORG MARKUSWien, im Juli 2002
MEINE REISENIN DIE WELT DER MUSIK
»WIE EINST, LILI MARLEEN«
Ein Jahrhundert-Schlager entsteht
Mein auf Mallorca lebender Freund Ferry Hirschmann rief mich eines Tages aus Salzburg an, wo er gerade Urlaub machte. Als wir einen Termin zum Abendessen in Hallein vereinbarten, fügte er noch an: »Du wirst meinen Nachbarn aus Mallorca kennen lernen, der ist auch da.«
»Deinen Nachbarn aus Mallorca?«, fragte ich ein wenig überrascht.
»Ja, er heißt Norbert Schultze und ist der Komponist von Lili Marleen.«
Von da an ging mir die Melodie nicht mehr aus dem Kopf. Lili Marleen, das ist eines der meistgespielten Lieder aller Zeiten. Ein Lied, das wie kein anderes die Sehnsucht von Millionen jungen Männern ausdrückte, die Tag für Tag an der Front ihr Leben aufs Spiel setzten. Es war die Sehnsucht dieser in den Krieg getriebenen Soldaten, endlich wieder zu Hause, endlich wieder bei ihrem Mädchen sein zu können.
Ich hatte es nicht zu bereuen, Herrn Schultze getroffen zu haben. Erzählte er mir doch, während des gemeinsamen Abendessens in Hallein, die unglaubliche Geschichte seines weltberühmten Liedes. Und welcher weltpolitischen Tragödie es bedurfte, um es so erfolgreich werden zu lassen.
»Die paar Noten hatte ich in wenigen Minuten niedergeschrieben, das ganze Lied war in einer Viertelstunde fertig«, schilderte er die Entstehung des Schlagers. Gerade neunzig Jahre alt und von erstaunlicher Frische, legte der Komponist gleich los: »Den Text zu Lili Marleen gab es schon seit 1915. Ein junger Schriftsteller namens Hans Leip hatte damals unter dem Titel Kleine Hafenorgel mehrere Gedichte geschrieben, von denen eines Lili Marleen hieß. Das lag dann mehr als zwanzig Jahre lang herum, ohne dass sich ein Mensch darum gekümmert hätte.«
Zufällig fielen dem aus Braunschweig stammenden Norbert Schultze 1938 in einer kleinen Bar in Berlin-Charlottenburg die Zeilen in die Hände:
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor,
Stand eine Laterne, und steht sie noch davor,
So wolln wir uns da wiedersehn,
Vor der Laterne wolln wir stehn
Wie einst, Lili Marleen …
»Mir gefiel der Text so gut, dass ich mich noch in der Bar ans Klavier setzte und sofort die passende Melodie fand«, sagte Schultze. »Dann spielte ich das Lied mehreren Sängern, Musikverlegern und Plattenproduzenten vor. Doch keiner mochte es.«
Nur Schultze selbst glaubte daran. »Das Chanson war ja für einen Mann geschrieben, als Liebeserklärung an ein Mädchen namens Lili Marleen. Da sich nun aber kein Sänger fand, der es aufnehmen wollte, schickte ich die Noten meiner Freundin Lale Andersen.«
Norbert Schultze lächelte verschmitzt. »Ich hatte einige Jahre davor eine Liaison mit Lale, die damals noch Liselotte Wilke hieß. Sie war ein nettes Mädchen, nein, die große Liebe war’s nicht.« Doch das spielte keine Rolle, als die junge Sängerin das Chanson unter dem etwas sperrigen Titel Lied eines jungen Wachtpostens aufnahm.
»Die Platte war ein totaler Flop, ganze siebenhundert Stück wurden verkauft«, erinnerte sich Norbert Schultze, und er wunderte sich auch gar nicht darüber: »Der Textdichter Hans Leip hatte die Worte im Ersten Weltkrieg geschrieben. 1938 war Frieden, da konnte das Lied eines Mädchens, das vor dem Kasernentor auf seinen Liebsten wartet, nicht unter die Haut gehen.«
Wieder vergingen Jahre. Und die Lili-Marleen-Platten verstaubten in den Archiven.
Doch inzwischen tobte der Zweite Weltkrieg.
Was nun folgte, war weniger der preußischen Präzision, als einem zutiefst österreichischen Wesenszug zu danken. »Einige junge Soldaten gründeten 1941 im Auftrag der Deutschen Wehrmacht in Belgrad einen Soldatensender. Da sie nicht wussten, woher sie die Musik für ihre Sendungen nehmen sollten, wurde ein Bote zum nächstgelegenen Reichssender nach Wien geschickt. Der Mann sollte Platten aus dem Funkhaus in der Argentinier Straße, dem Gebäude der ehemaligen RAVAG, mitbringen.«
Wie’s so ist in Wien, erhielt der Bote »unter der Hand« einen Koffer voll verbotener Schellacks – darunter fanden sich Operettenmelodien von Emmerich Kálmán und Paul Abraham, Lieder, die von Richard Tauber und Joseph Schmidt gesungen wurden, amerikanische Tanzmusik, aber auch alte, ausrangierte Platten, die nie gespielt wurden. Eine davon war Lili Marleen.
Am 26. April 1941, kurz vor 22 Uhr, ging das Lied via Belgrad auf Welle 437,5 zum ersten Mal über den Äther. Und nun geschah das Unglaubliche: In den Tagen danach langten in der Redaktion des Soldatensenders Tausende Briefe aus Griechenland, Dalmatien, Kroatien, Kreta und sogar von der Afrika-Front ein, wo der Sender über Kurzwelle mit Richtstrahl zu empfangen war. Und wo immer das Lied zu hören war, gab es nur den einen Wunsch: »Wir wollen Lili Marleen wieder hören!«
»Das Lied traf die armen Frontsoldaten im dritten Kriegsjahr ins Herz«, erkannte Schultze. »Der Text war ihr Schicksal, jeder hatte die gleiche Sehnsucht, die gleiche Sorge: ob er je wieder seine Frau, seine Eltern, seine Kinder sehen würde.« Oder seine Braut … wie einst, Lili Marleen.
Das Echo war so gewaltig, dass Lili Marleen zur Kennmelodie einer täglichen Sendung wurde, in der ein Sprecher die Briefe von zu Hause an die Front und von der Front in die Heimat verlas. In einer Zeit, da man von den Ehemännern und Söhnen oft nur die Feldpostnummer kannte, war diese Verbindung die schnellste und sicherste, um persönliche Grüße und Nachrichten zu übermitteln. Oder, um zu erfahren, dass der Geliebte überhaupt noch am Leben ist.
Dass man das Lied, das so lange keiner hören wollte, jetzt an allen deutschen Fronten spielte, lag nahe. Dass es aber auch von den Truppen der Alliierten geliebt wurde, grenzt an ein Wunder. Es wurde, in alle Sprachen übersetzt, von Franzosen ebenso gesungen wie von Engländern und Amerikanern. »Denen war es ganz egal, dass das Lied aus einem feindlichen Land kam«, meinte Schultze. »Als es dann von Marlene Dietrich aufgenommen wurde, war’s über Nacht ein Welterfolg …«
»… der Sie wohl sehr reich gemacht hat?«, vermutete ich.
»Das glauben alle«, entgegnete der Komponist. »Aber so war’s nicht. Das Copyright wurde als Kriegsbeute beschlagnahmt, und nach dem Krieg gingen die Einnahmen an Hilflose und Veteranen. Erst seit 1963 erhalte ich die Tantiemen, aber sie sind natürlich lange nicht mehr so hoch, wie sie es früher gewesen wären.«
Norbert Schultze erzählte seine Geschichte ruhig und uneitel. Und meinte dann noch: »Ich möchte Ihnen aber sagen, dass ich froh bin, durch das Lied nicht reich geworden zu sein. Denn Lili Marleen konnte nur infolge dieses schrecklichen Krieges ein so großer Erfolg werden. Und ich möchte nicht an diesem Krieg Geld verdient haben.«
Das hatte er auch gar nicht nötig. Norbert Schultze hat die Musik zu mehreren Opern – Schwarzer Peter heißt die bekannteste – und zu siebzig Filmen geschrieben, darunter auch mehrere Lili-Marleen-Verfilmungen. Ein anderer seiner populären Schlager wurde durch die Interpretation von Hans Albers zum Welthit: Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise.
Im Vollererhof bei Hallein, in dem Norbert Schultze seinen Sommerurlaub verbrachte, steht ein altes Pianino. Ehe ich mich von ihm verabschiedete, setzte er sich noch ans Klavier und spielte ein paar Takte seiner Lili Marleen.
»Nach dem Krieg hat man mir vorgeworfen, dass dies ein ›Durchhaltelied‹ gewesen sei. Doch das stimmt nicht«, meinte er. »Das kleine Lied kann nichts dafür, dass es in einer schrecklichen Zeit zum Symbol für Heimweh, Trennung und Sehnsucht wurde. Und doch möchte ich sagen: Darauf stolz zu sein, wäre töricht.«
BRAHMS LAG IM PAPIERKORB
Professor Marcus macht eine Entdeckung
Es zählt ja nicht unbedingt zu den nobelsten Eigenschaften einer Hausangestellten, den Mistkübel ihrer Herrschaft zu durchwühlen. In diesem besonderen Fall hätte man der Arbeitskraft jedoch gerade dafür einen Orden überreichen sollen. Denn sie war im Haushalt des großen Johannes Brahms beschäftigt, der jedes Notenblatt jener Kompositionen, die ihm nicht wichtig erschienen, in den Papierkorb warf.
Durch Zufall lernte ich als junger Journalist den Wiener Musikwissenschafter Professor Gottfried Marcus kennen. Nachdem wir geklärt hatten, dass wir trotz fast identischer Namen weder verwandt noch verschwägert waren, konnten wir uns einem anderen Thema zuwenden, das naheliegenderweise Johannes Brahms hieß. Waren doch Leben und Werk des »Vollenders der Wiener Klassik«, wie man den Komponisten nannte, das Spezialgebiet des Musikprofessors Marcus. Er forschte, musizierte, lehrte und lebte für Johannes Brahms.
In Brahms-Biografien war dem Professor immer wieder der Name Cölestine Truxa aufgefallen. Diese hatte während der letzten zehn Lebensjahre von Johannes Brahms als dessen Wirtschafterin gearbeitet und gemeinsam mit ihren beiden Söhnen in seiner Wohnung gelebt: in der Karlsgasse 4 auf der Wieden in Wien.
»Wer weiß«, kam es Herrn Marcus am Beginn der siebziger Jahren in den Sinn, »vielleicht lebt noch irgendein Verwandter dieser Frau Truxa.«
Er nahm ein sehr unwissenschaftliches Buch zur Hand, das Amtliche Wiener Telefonbuch, schaute unter »Truxa« nach, rief ein paar Leute besagten Namens an, entschuldigte sich für die Fehlverbindung, wählte die nächste Nummer – bis er auf den Eintrag »Truxa Leo, Ing. Hofrat i. R., 6., Köstlergasse 5« stieß.
Wieder sagte der Professor sein Sprücherl auf: »Verzeihen Sie die Störung, Herr Hofrat, ich wollte Sie fragen, ob Sie mit Frau Cölestine Truxa verwandt sind.«
»Ja«, antwortete die Stimme eines alten Herrn, »das war meine Mutter.«
»Dann haben Sie Johannes Brahms persönlich gekannt?«
»Natürlich, wir lebten ja mit ihm in einer Wohnung.«
Marcus bohrte weiter: »Na und, haben Sie noch irgendwelche Erinnerungsstücke an Brahms?«
Jetzt lachte der fast neunzigjährige Herr Hofrat: »Die ganze Wohnung ist voll davon.« Und er erzählte die Geschichte vom Papierkorb: »Meine Mutter hob zehn Jahre lang alles auf, was Brahms wegwarf, und sie klebte sogar die von ihm zerrissenen Blätter wieder zusammen. Aber leider«, bedauerte er, »hat meine Nichte, die meine Wohnung erben wird, gesagt, dass sie einmal alles wegwerfen will, weil das Zeug heutzutage keinen Menschen mehr interessiert.«
Gottfried Marcus musste tief Luft holen, ehe er weitersprach. Nach einer Schrecksekunde rief er ins Telefon: »Um Gottes willen! Lassen Sie bitte alles, wie es ist. Dürfte ich morgen vorbeikommen und mir das äh … das Zeug, wie Ihre Nichte sagt, anschauen?«
»Ja, ja, kommen S’ nur.«
Anderntags schwang sich der Herr Professor auf seinen Motorroller und fuhr zum Hofrat Truxa in die Köstlergasse.
»Ich bin fast umgefallen«, erzählte mir Gottfried Marcus, »es war einfach sensationell.« Neben bislang unbekannten Brahms-Kompositionen lagen Briefe des Meisters, die er nie abgeschickt hatte. Weiters Privatfotos und unzählige persönliche Gegenstände des Komponisten. Marcus erkannte, dass er in diesem Augenblick auf den wesentlichsten Fund seiner jahrzehntelangen Forschertätigkeit gestoßen war.
Frau Truxa, die 1897 die Augenlider des Komponisten auf seinem Totenbett schloss, hatte nicht nur die Papierkorb-Funde aufbewahrt, sie war von Brahms, der sie sehr schätzte, auch zur Erbin seiner persönlichen Habseligkeiten eingesetzt worden. »Außerdem gehören Cölestine Truxa 10 000 Gulden«, steht in seinem Testament, »alles, was ich an Möbeln, Kleidern, Wäsche besitze und auch die Bilder, die an den Wänden hängen, Teppiche, Decken, Kissen, Uhren …« Das alles hatte Marcus jetzt vor sich. Ihr größtes Verdienst aber war: Cölestine Truxa hatte schon zu Lebzeiten das Genie des Komponisten erkannt und buchstäblich alles, was Brahms in den Papierkorb geworfen hatte, wieder herausgefischt und aufgehoben. »Jedes einzelne Stück ist für die Brahmsforschung hochinteressant.«
Drei Jahre verbrachte Gottfried Marcus jede freie Minute, die ihm neben seiner Professur am Konservatorium der Stadt Wien blieb, in der Wohnung Leo Truxas, er untersuchte, reinigte, ordnete den für die Musikwelt einzigartigen Schatz. Und er vervollständigte sein auf knapp 30 000 Karteiblättern minuziös aufgelistetes Vokalarchiv der Brahmsschen Symphonien, Klavierkonzerte, Quartette, Quintette, Sextette um die bislang unbekannten Werke. Experten verkündeten damals: »Was der Köchel für Mozart, das ist der Marcus für Brahms.«
Die kolossale Arbeit, sagte mir der Professor, hätte er sich nicht nur aus historischen Gründen aufgebürdet, sondern vor allem aus Liebe. Der Wissenschafter hatte dem Komponisten sein Leben gewidmet.
Gottfried Marcus, der einst als »Wunderkind« galt, hatte in den dreißiger Jahren gemeinsam mit seinen beiden Geschwistern viele Konzerte gegeben. Als bei der Familie Marcus eines Tages der Besuch von Wiens führendem Musikkritiker Dr. Robert Konter angesagt war, wurden die beiden Buben und das Mädchen gebeten, dem Kritikerpapst Brahms’ H-Dur-Trio opus 8 vorzuspielen. Als sie fertig waren, wurde der sachkundige Mann gefragt, wie ihm die Brahms-Interpretation der Kinder gefallen hätte. Worauf Konter konterte: »Es war fast ein Vergnügen.«
»Der Kritiker«, gab Marcus zu, »hatte recht, das Trio war weit über die technischen Möglichkeiten dreier Kinder hinausgegangen.«
Jahrzehnte später sollte Gottfried Marcus den schönsten Tag seines Lebens feiern, wie er selbst sagte: als er unter den aufgefundenen Noten in Leo Truxas Wohnung auch die Brahmssche Originalbearbeitung eben jenes H-Dur-Trios opus 8 entdeckte. Er war seiner ersten Begegnung mit Brahms als alter Mann wieder begegnet. Frau Truxa hatte auch diese Noten aus dem Papierkorb gefischt.
Sowohl Hofrat Truxa wie Professor Marcus sind mittlerweile nicht mehr am Leben. Aber sämtliche dem Papierkorb entnommenen Brahms-Noten sind für alle Zeiten gerettet. Die beiden Herren haben sie geschlossen dem Musikarchiv der Stadt Wien übergeben.
DAS »WEISSE RÖSSL« IST NICHTAM WOLFGANGSEE
Die wahre Lovestory hinter der Operette
Operetten sind im Allgemeinen frei erfunden. Kein Mensch wird ernsthaft annehmen, dass der Zigeunerbaron oder die Lustige Witwe tatsächlich gelebt haben. Ganz anders verhält es sich im Fall der Rössl-Wirtin Josepha Vogelhuber. Die hat es ebenso gegeben wie den Oberkellner Leopold. Und auch die Lovestory der beiden ist kein Operettenschmäh. Was ist wahr am erfolgreichsten Singspiel seiner Zeit und was ist frei erfunden?
Ich fuhr, um dies zu ergründen, an den Wolfgangsee und dort, kaum angekommen, natürlich ins Hotel Im Weißen Rössl. Das müsste, war meine nahe liegende Überlegung, der richtige Ort für derartige Recherchen sein.
Begeben wir uns aber vorerst zu den Wurzeln einer kleinen Episode, die – wie durch ein Wunder – weltweite Beachtung finden sollte: Es war gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als sich der Zahlkellner des Gasthofs Im Weißen Rössl in seine Chefin, eine fesche und lebenslustige Witwe, verliebte. Just als dieses Tête-à-Tête begann, verbrachten zwei Lustspielautoren ihren Urlaub in ebendiesem Gasthof. Einen Sommer lang beobachteten sie mit großem Vergnügen das Werben des Oberkellners, und sie waren überglücklich, als dieser – noch vor ihrer Abreise – bei ihr »landen« konnte.
Soweit die Fakten. Die romantische Story hatte die beiden Urlaubsgäste Dr. Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg, zwei Schriftsteller aus Berlin, dermaßen amüsiert, dass sie daraus ein Lustspiel fabrizierten. Die Romanze ist also echt. Falsch ist der Wolfgangsee. Denn das Weiße Rössl war in Wirklichkeit ein gutbürgerlicher Gasthof in der kleinen Ortschaft Lauffen bei Bad Ischl – vom Wolfgangsee mehr als zwanzig Kilometer entfernt. In St. Wolfgang, direkt am See, gab’s zu diesem Zeitpunkt freilich ein Hotel mit dem sehr ähnlichen Namen Zum weißen Ross, das der Wirtin Antonia Drassl, einer äußerst geschäftstüchtigen Person, gehörte. Sie war 46 Jahre alt, von einem Zahlkellner jedoch, der sie verehrt hätte, war weit und breit keine Rede.
Da der Wolfgangsee auch im deutschen Kaiserreich sehr bekannt war, verlegten die beiden cleveren Lustspielautoren ihr Stück publikumswirksam ins andere Ross. Und damit wird’s spannend, denn Antonia Drassl, die Gastronomin vom Wolfgangsee, die überhaupt nicht gemeint war, erkannte den hervorragenden Werbeeffekt für ihr Hotel und reiste, nachdem das Stück sofort ein Erfolg war, als »Original-Rössl-Wirtin« durch die Lande. Zwischen Hamburg und Budapest ließ sie sich keck als solche feiern und erzählte überall bereitwilligst von ihren »Abenteuern« mit dem feschen Leopold. Um die echte Rössl-Wirtin aus Lauffen kümmerte sich indes kein Mensch, doch das Haus am See – bald von Ross auf Rössl umbenannt – erlebte eine ungeheure Konjunktur.
Noch war Das Weiße Rössl ein Sprechstück, und daher geriet es – wie so viele Boulevardkomödien – nach kurzer Zeit in Vergessenheit. Erst drei Jahrzehnte später wurde es durch einen Zufall wieder entdeckt, mit zündenden Melodien garniert – und nun erst begann sein Siegeszug um die Welt.
Und das kam so: Der berühmte Schauspieler Emil Jannings saß im Sommer 1929 gemeinsam mit dem Berliner Theaterdirektor Eric Charell auf der Terrasse des – sozusagen irrtümlich – berühmt gewordenen Hotels Im weißen Rössl am Wolfgangsee. Im Scherz bestellte Jannings sein Mittagessen ebenso »piefkinesisch« wie der deutsche Urlaubsgast Wilhelm Giesecke in dem kurz zuvor in Berlin wieder ausgegrabenen Bühnenstück von Blumenthal und Kadelburg: »Wenn ick Dampfer fahre, will ick Aal jrün essen, det jehört zusammen. Aber so was kennen die Brüder hier natürlich nich’!« Charell lachte Tränen, und da er für sein Großes Schauspielhaus im damals gerade »revueverrückten« Berlin dringend eine zugkräftige Ausstattungsrevue suchte, ließ er sich alles Nähere von Jannings erzählen, der sich an den Inhalt des Lustspiels noch genau erinnern konnte, in dem er vor vielen Jahren, 16-jährig, in Görlitz am Theater debütiert hatte.
Nach Berlin zurückgekehrt, beauftragte Charell den Komponisten Ralph Benatzky, das Stück zu vertonen. Der sofort Ohrwürmer wie den Titelsong Im Weißen Rössl am Wolfgangsee und Im Salzkammergut, da kann ma gut lustig sein schuf. Als Benatzky jedoch mitten in der Arbeit ausstieg, weil er plötzlich die Idee hatte, eine Oper schreiben zu müssen, sah sich Charell gezwungen, über Nacht einzelne Lieder von anderen Komponisten dazuzukaufen. Er wandte sich an Bruno Granichstaedten, der die Liedeinlage Zuschau’n kann i net beisteuerte, und an Robert Stolz, der für die Evergreens Die ganze Welt ist himmelblau und Mein Liebeslied muss ein Walzer sein sorgte.
Schon die Berliner Uraufführung des Singspiels am 8. November 1930 brachte einen Sensationserfolg. Publikumsliebling Max Hansen spielte den Leopold, Camilla Spira die Rössl-Wirtin Josepha Vogelhuber, Siegfried Arno den Sigismund, Paul Hörbiger den schnell noch in die Handlung eingebauten Kaiser Franz Joseph. Dreihundert Komparsen bevölkerten die für eine halbe Million Mark ausgestattete Bühne. Im allgemeinen Premierentrubel war auch niemandem aufgefallen, dass das Liebespaar in modernen Kostümen der verrückten zwanziger Jahre über die Bühne fegte, obwohl der daneben stehende kaiserliche »Kurgast« bereits 1916 verstorben war. Und zum Fünfuhrtee spielte man Charleston!
Für die Wiener Erstaufführung musste das Singspiel daher stark verändert werden – unter anderem auch das Bühnenbild, denn der Hintergrund des hochsommerlichen Wolfgangsees war in Berlin irrtümlich mit schneebedeckten Bergen bemalt worden. Hubert Marischka spielte am Wiener Stadttheater den Leopold, Paula Brosig die Wirtin, Fritz Imhoff den Giesecke, und als Sigismund, der nichts dafür kann, dass er »so schön ist«, trat der junge Karl Farkas auf.
Innerhalb weniger Monate war das Rössl ein Welterfolg. Es wurde in Kairo gespielt, lief als Al Cavallino Bianco in Rom, als White Horse Inn in London und New York. Und im Laufe eines halben Jahrhunderts wurde es mehrmals verfilmt.
Das Weiße Rössl am Wolfgangsee ist heute, nicht zuletzt dank dieser gigantischen Publicity, ein florierendes Hotel mit internationalem Standard.
Das echte Rössl in Lauffen bei Bad Ischl, dem es den ganzen Rummel zu verdanken hat, musste wenige Jahre nach der Uraufführung des Theaterstücks zusperren. Weil zu wenig Gäste gekommen waren.
DIE FRAUEN DES WALZERKÖNIGS …
… und ihr Einfluss auf seine Musik
Du bist das von Gott für mich bestimmte Wesen … Ohne Dich kann ich nicht leben … Mein Alles, mein geliebter Engel … « Zeilen wie diese verfasste Wiens populärster Komponist in Hülle und Fülle. Und sie waren nicht bloß an eine Frau gerichtet. Sondern an Dutzende. Es ist an der Zeit, darüber zu berichten, welche Rolle das weibliche Geschlecht im Leben des Strauß-Schani gespielt hat. Vor allem in Hinblick auf seine Kompositionen.
Die k. k. Polizeidirektion bezeichnete den Lebenswandel des 37-jährigen Johann Strauß Sohn in einem dicken Akt als »unsittlich und leichtsinnig«. Der Kaiser weigerte sich daraufhin, den nach ihm populärsten Österreicher in den Adelsstand zu erheben. Das hatte der Musikant wohl auch dem Umstand zuzuschreiben, dass er im 48er-Jahr einen »Revolutionsmarsch« komponiert hatte und im Dezember desselben Jahres wegen öffentlichen Spielens der »Marseillaise« angeklagt wurde. Doch auch der Wiener Bürgermeister Lueger war nicht bereit, Strauß die Ehrenbürger-Würde der Stadt, deren Name er durch seine Musik in alle Welt getragen hatte, zu überreichen. Neben den drei Ehefrauen förderte man beim Maestro nicht weniger als 13 Verlobte zu Tage, von zahlreichen anderen Amouren ganz zu schweigen.
Als »schwarzer Tag im Kalender der Damen Wiens« wird der 27. August 1862 bezeichnet. Denn an diesem Sommermorgen heiratete der eingefleischteste aller Junggesellen zum ersten Mal. Henriette Treffz, genannt Jetty, war die Auserwählte des feschesten Frackträgers der Donaumetropole. Jetty hatte ihrem Schani in punkto Vorleben nichts vorzuwerfen: Die ehemalige Opernsängerin, Tochter eines Arbeiters aus Wien-Gumpendorf, brachte sieben uneheliche Kinder mit in die Ehe. Zwei davon stammten aus der Verbindung mit Moritz Baron Todesco, den sie verließ, um bei Strauß einzuziehen. Der Bankier adoptierte seine beiden Kinder später.
Die Verbindung mit Jetty sollte sich für Johann Strauß als künstlerisch äußerst fruchtbar erweisen. Die um mindestens sieben Jahre ältere Frau – ihre Geburtsangaben schwanken – wurde zur wichtigsten Muse des Walzerkönigs, der übrigens nicht tanzen konnte. Schani ließ sich seinen berühmten Schnauzbart wachsen, um neben Jetty reifer zu wirken. Doch der Rastlose fand an ihrer Seite erstmals Ruhe und Geborgenheit. Strauß, der früher pro Abend auf bis zu sechs Bällen dirigiert hatte, überließ die Kapelle nun seinen Brüdern Josef und Eduard und konzentrierte sich aufs Komponieren. In seiner ersten Ehe entstand nicht nur der Donauwalzer, sondern auch Die Fledermaus, die er in 42 Tagen und Nächten niedergeschrieben hatte. Jettys Anteil am Zustandekommen dieser Operette ist gewichtig, war sie es doch, die heimlich Notenblätter aus dem Pult ihres Mannes stahl und dem Direktor des Theaters an der Wien überreichte. Strauß selbst wollte Die Fledermaus nicht aufführen lassen.
Ein Jahr nach der Hochzeit wurde er – aller politischen »Verirrungen« seiner Jugendtage zum Trotz – mit dem Titel Hofballmusikdirektor ausgezeichnet, eine Ehrung, die bereits seinem Vater zuteil geworden war.
Jetty war Geliebte, Freundin, Mutter, Hausfrau, Krankenschwester, sie hielt alles von ihm fern, was den sensiblen König der Wiener Musik hätte deprimieren können. So wurden ihm nur jene Zeitungsausschnitte vorgelegt, in denen er mit Lob bedacht wurde. Das nach außen hin stets »lachende Genie« neigte zu Depressionen und lebte in panischer Angst vor Gewittern und hohen Bergen. In Gegenwart des Hypochonders durfte das Wort »sterben« nicht einmal ausgesprochen werden.
Zwar unterhielt Johann Strauß auch während seiner ersten Ehe zahlreiche Liebschaften, doch als Henriette nach 16-jährigem Zusammenleben völlig überraschend an den Folgen eines Schlaganfalls starb, war der Musiker zutiefst getroffen. Strauß floh aus Wien und weigerte sich, an der Beerdigung teilzunehmen.
Er, der nicht eine Minute seines Lebens allein sein konnte, führte seine nächste Frau bereits sechs Wochen nach Jettys Tod zum Standesamt: Ehefrau Nummer zwei hieß Lily, war Gesangsstudentin, um 25 Jahre jünger als der Komponist und das, was man heutzutage ein »Luder« nennen würde. Kaum waren die Flitterwochen vorüber, ging sie mit dem Direktor des Theaters an der Wien durch. »Jean«, der mittlerweile in Ehren ergraute – aber schwarz gefärbte – Lockenkopf, steckte nach Lilys Abgang in einer tiefen seelischen Krise. Erfolglos hat er um sie gekämpft, sie mit allen Mitteln zurückzuhalten versucht. Strauß rührte seine Geige nicht mehr an und schien beruflich am Ende. Während seine Konkurrenten Suppé und Millöcker gerade jetzt einen Erfolg nach dem anderen feierten, wurde seine Nacht in Venedig in Berlin ausgebuht.
Erst Ehefrau Nummer drei befreite ihn aus der schlimmsten Krise seines Lebens: Adele Strauß war gleich um 31 Jahre jünger als der Walzerkönig, doch wie einst Jetty erwies auch sie sich als Segen für seinen weiteren Werdegang. Sie gab ihm Kraft und verhalf ihm zu neuen künstlerischen Höhen. Zunächst holte sie Die Nacht in Venedig zurück nach Wien, wo die in Berlin nicht verstandene Operette zum gigantischen Erfolg wurde. Versehen mit der für ihn so wichtigen Portion Selbstvertrauen, entstand dann auch noch der Zigeunerbaron.
Strauß liebte seine dritte Frau so sehr, dass er sich ihretwegen sogar der Bigamie bezichtigen ließ. Da es eine Scheidung im heutigen Sinne nicht gab, konnte er Adele nur auf Umwegen heiraten. Er wurde Staatsbürger des Herzogtums Sachsen-Coburg-Gotha und wechselte zum protestantischen Glauben über. Der Vorgang dauerte Jahre, doch konnte Strauß seine Geliebte in dieser Zeit guten Gewissens bei gesellschaftlichen Anlässen als »Frau Strauß« vorstellen, da sie – durch eine frühere Ehe – zufällig ebenso hieß.
Neben Jetty, Lily, Adele und den 13 anderen Bräuten fehlte es nicht an weiteren Gspusis. Da tauchte etwa »Comtesse Olga« auf, die Tochter eines russischen Aristokraten, der Schani viele Liebesbriefe sandte, die pikanterweise Strauß-Witwe Adele ein Vierteljahrhundert nach seinem Tod veröffentlichen ließ. Dann gab’s noch eine Elise, die Sängerin Marie Geistinger und viele andere.
Seiner Stammtischrunde soll Strauß einmal anvertraut haben: »In jungen Jahren, da habe ich’s so toll getrieben, dass man’s nicht drucken lassen könnt. In Petersburg (wo er zahlreiche Gastspiele absolvierte, Anm.), da habe ich mich so genial aufgeführt, dass die Polizei mich ausweisen wollte und nur hohe Protektion diesen Befehl annullierte.«
Sei’s drum. Wir verdanken Schanis Eroberungen einige seiner schönsten Melodien. Er hinterließ uns den Adelen-Walzer ebenso wie die Annika-Quadrille, die Josefinen-Tänze, den Fanny-Marsch, die Olga-, Cäcilien-, Elisen- und Helenen-Polka.
Und bei jeder Note dachte er an ein süßes Abenteuer mit der betreffenden Dame.
»VOLK DER FREIHEIT, VOLK DER BRÜDER«
Die andere Bundeshymne
Um ein Haar hätten die ersten Worte unserer Bundeshymne nicht Land der Berge, Land am Strome gelautet. Sondern Volk der Freiheit, Volk der Brüder. Oder gar Teurer Boden, blutbefleckter. In verstaubten Kisten stießen Beamte des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs im Frühjahr 1995 auf Unterlagen, die ein Stück österreichischer Geschichte dokumentieren. Es geht um die Entstehung unserer Hymne.
Die Kisten lagen, jahrzehntelang unbeachtet, im Heizkeller des Unterrichtsministeriums auf dem Wiener Minoritenplatz. Archivare, die mit der Vorbereitung einer Ausstellung über die Zweite Republik befasst waren, gingen auf Spurensuche und entdeckten die vier großen Schachteln. Versehen mit der Signatur »24 A«, schlummerte in ihnen ein Akt mit der Aufschrift »Volkshymne«. Man lud mich ein, in den eben aufgetauchten Schatz Einblick zu nehmen.
Ich sah unbekannte, bisher nie veröffentlichte Beiträge namhafter Autoren, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Vorschläge für den Text einer neuen österreichischen Bundeshymne eingereicht hatten.
Unter den 1800 Teilnehmern eines öffentlichen Preisausschreibens befanden sich – neben der späteren Siegerin Paula von Preradovic – die Schriftsteller Alexander Lernet-Holenia, Rudolf Henz und Franz Theodor Czokor. Sie haben ihre Texte zu eben jener (mit großer Wahrscheinlichkeit von Mozart stammenden) Melodie der heutigen Bundeshymne geschrieben.
Greifen wir also hinein in eine der Kisten, und holen wir zunächst den – von einer Jury auf Platz drei gereihten – Hymnenvorschlag des Dichters Alexander Lernet-Holenia hervor:
Volk der Freiheit, Volk der Brüder,
Land der Liebe und der Lieder!
Recht und Frieden, Heil und Glück,
Freude ohne Ende schenke,
Alle Deine Wege lenke
Das allmächtige Geschick!
Segnet Zeit und Zeitenwende,
Werk der Geister und der Hände,
Engel unsres Vaterlands!
Heiligt Künste und Gesänge,
Wald und Strom und Rebenhänge,
Felderfrucht und Erntetanz!
Keines Menschen Herrn noch Knechte,
Von Geschlechte zu Geschlechte,
Brüderlich und frei und gleich,
Seid vom schönsten Band umschlungen!
Ungebeugt und unbezwungen,
Gott mit dir, mein Österreich!
Der Wettbewerb für eine neue Hymne war am 12. März 1946 von der Regierung unter Bundeskanzler Leopold Figl ausgeschrieben worden. Wie den nun aufgefundenen Unterlagen zu entnehmen ist, sollten die Schöpfer der besten Hymne 10 000 Schilling erhalten, aufgeteilt je zur Hälfte auf den Textdichter und den Komponisten. Wortwörtlich wurde im Akt nach Feststehen des »Siegerteams« vermerkt: »Da der mit der höchsten Punkteanzahl bewertete Hymnenvorschlag zwei Autoren hat (Mozart und Preradovic) wäre der ausgesetzte Preis von 10 000 Schilling zu teilen: 5000 Schilling entfallen auf Punktesieger Preradovic, 5000 Schilling für Musik stehen theoretisch Mozart zu.«
Messerscharf kombinierten die Ministerialbeamten, dass es Probleme mit der Überweisung des Honorars an den Komponisten geben könnte. Also beschloss man, die verbliebenen 5000 Schilling unter jenen zeitgenössischen Musikern aufzuteilen, deren Kompositionen von der Jury gleich hinter Mozart gereiht wurden. Dies waren die Herren Robert Fanta, Hermann Schmeidel, der damalige Operndirektor Franz Salmhofer und Alois Melichar.