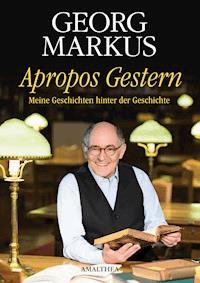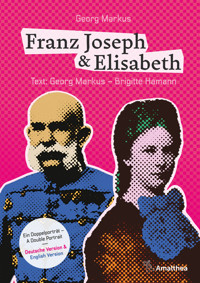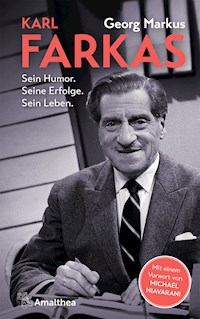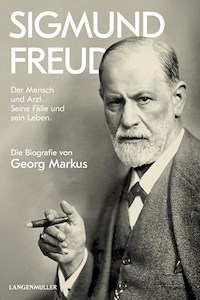
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Langen-Müller
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wer war Sigmund Freud wirklich? Wie war der Mann, der in seiner Ordination in der Wiener Berggasse der Seele des Menschen auf die Spur kam? Und welche Rolle spielte dabei die weltberühmte Couch? Georg Markus traf die letzten Zeitzeugen und schuf mit diesem Buch die erste große, populär geschriebene Biografie über den "Vater der Psychoanalyse". Der Autor versteht es, die faszinierenden Stationen im Leben des genialen Arztes aufzuzeichnen und beschreibt in klaren Worten die Bedeutung seines Werkes für die Menschheit. Mit einem Vorwort von Univ. Prof. Dr. Alfred Pritz, Rektor der Sigmund Freud Privatuniversität Wien.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Bildnachweis
Bildteil: Sigmund-Freud-Copyrights Ltd., London: 1–6, 9, 16, 18–40,42, 53–55, 58.
Freud Museum Publications Ltd. (Photograph by Nick Bagguley): 57.
Institut für Geschichte der Medizin der Univ. Wien: 7, Repro F. Schuster: 8, 10.
Privatarchiv des Autors: 11, 12, 14, 43, 45, 47, 49, 56, 59.
Sigmund Freud Privatstiftung, Wien: 13, 15, 44.
Österreichische Nationalbibliothek: 17, 52.
Foto Klomfar: 41.
Galerie Faber: 48.
Tele-Winkler+Bunk: 50.
ORF: 51.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.langen-mueller-verlag.de
Erstmals erschienen 1989 bei LangenMüller unter dem Titel »Sigmund Freud und das Geheimnis der Seele. Die Biographie«
© für die Originalausgabe: 2006 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
© für das eBook: 2019 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: STUDIO LZ, Stuttgart
Umschlagfoto: picture alliance
eBook-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7844-8348-1
Meiner Familie in Liebe gewidmet
Inhalt
Freud als Mensch und als Visionär
Vorwort von Alfred Pritz
»Ein aufregendes Erlebnis«
Dr. Menninger erinnert sich an seinen Besuch bei Freud
»Aus dir wird nie etwas werden«
Kindheit und Jugend
Schuld war Goethe, doch der konnte nichts dafür
Medizinstudium als Folge eines Irrtums
»Anstatt Deine süßen Lippen küssen zu dürfen«
Freud verliebt sich
»Über Coca«
Freuds Kokain-Episode
Der General als Papagei
Freud, das Militär und die Ehe
Der Fall Anna O.
Auf dem Weg zur Psychoanalyse
Wien IX., Berggasse
Eine Adresse macht Weltgeschichte
»Deinem Rauchverbot folge ich nicht«
Freund Fließ und die ständige Todesangst
»Der Hauptpatient, der bin ich selbst«
Die Couch
Irma
Freud träumt
Der Fall Otto Weininger
Freud im Mittelpunkt eines Skandals
»Ich gedenke reich zu werden«
Zwei teure Leidenschaften: Reisen und Sammeln
Freud ist zu ehrlich
Die Sexualität
»Ganz famillionär«
Sigmund Freud lacht
»Der einzig außerordentliche«
17 Jahre Warten auf einen Titel
»An keinem anderen Orte«
Freuds Haßliebe zu Wien – Religion –Antisemitismus
»Damit die Damen den Saal verlassen können«
Der »Rattenmann« und andere Patienten
»Die Psychoanalyse hört an der Tür des Kinderzimmers auf«
Familienmensch Freud
Der Doppelgänger
Schnitzler, Freud und die Literatur
»… hat mich seine Freundschaft gekostet«
Freud verliert Freunde, Lehrer, Mitstreiter
»Ich bin ganz Leonardo«
… und ein Tag mit Gustav Mahler
»Endesgefertigter bestätigt …«
Wieviel verdiente Freud?
»Meine ganze Libido gehört Österreich-Ungarn«
Das Ende der Donaumonarchie
Und noch ein »Krieg«
Freud gegen Wagner-Jauregg
»Ich habe nie etwas Schwereres erlebt«
Schicksalsschläge
Ein Zwerg als Lebensretter
Diagnose: Kieferkrebs
»Was an mir erfreulich ist, heißt Anna«
Frauen um Freud
Psychoanalyse auf chinesisch
Der »Wolfsmann« meldet sich
»Lieber Herr Freud!« – »Lieber Herr Einstein«
Zwei Genies finden keine Antwort
»Ich kann die Gestapo jedermann empfehlen«
Wie Freud den »Anschluß« erlebte
»Mein letzter Krieg«
Emigration und Tod
»Aber wird es möglich sein?«
Familiärer Nachklang
Was blieb von Freud?
Zwei Generationen danach
Bildteil
Zeittafel
Quellenverzeichnis
Personenregister
Freud als Mensch und als Visionär
Vorwort von Alfred Pritz[1]
Sigmund Freud lebte von 1856 bis 1939, er ist in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts weltweit zu einem »Klassiker« geworden, d. h. räumlich und zeitlich bedeutsam, mit einem kontinuierlichen Einfluss auf die Populär- und Wissenskultur. Freuds Entdeckungen haben in der Psychologie und Psychotherapie zu einem Paradigmenwechsel geführt. Es gehört zur interessanten Dynamik in diesem Wissensfeld, dass die psychoanalytischen Konzepte und Entdeckungen Freuds Widerstände hervorrufen, weil sie an gesellschaftliche Tabus rühren: Mechanismen des individuellen und gesellschaftlichen Unbewussten, infantile Sexualität, Bedeutung des Traumes, Dynamik von Übertragung, Gegenübertragung und Widerstand etc. In Vergessenheit geraten und der Verdrängung unterworfen, müssen sie also immer wieder neu entdeckt und generiert werden.
Auch die Person Freuds belebt nach wie vor die Freud-Biographik. Freud wird immer wieder neu entdeckt und geschrieben. Sein Lebenslauf ist, wie Sie auch der vorliegenden Biografie entnehmen können, sehr dynamisch und interessant verlaufen. Aufgrund der Jugend des Fachs »Psychoanalyse« hatte Freud nicht nur die Möglichkeit, Neues zu entdecken. Er hatte auch die Begabung, dieses Neue in eine besondere literarische Form zu gießen, sodass Freud selbst ein umfangreiches wissenschaftliches, aber auch literarisch wertvolles Werk hinterließ. Doch neben dem beruflichen Werk verlief auch sein privates Leben turbulent bis dahin, dass er 1938 kurz vor seinem Tod noch Österreich im Zuge der Nazidiktatur Richtung England verlassen musste, wo er 1939 in London verstarb.
Seit 2017 ist übrigens die »Sigmund Freud Collection« an der Library of Congress in Washington, das umfangreichste Archiv zu Sigmund Freud und seinem Werk und Kreis, online zugänglich und eine fast unerschöpfliche Quelle für die Freud-Biographik und die Forschung zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung.
Seit 2015 erscheint eine auf 23 Bände angelegte »Sigmund Freud Gesamtausgabe«, die die »Gesammelten Werke« als Standardquelle für das Freud’sche Oeuvre ablösen wird. Bis 2018 wurden zwölf Bände ediert.
»Freud« und »Psychoanalyse« gehören nach wie vor zusammen. Sowohl innerhalb der Psychoanalyse als auch im Austausch mit anderen Wissenschaftsdisziplinen und bei ihrer Verbreitung, z. B. in China oder in islamischen Ländern, hat sich die Psychoanalyse verändert und sich neue Aufgaben- und Anwendungsgebiete erschlossen.
Der von Freud begonnene Dialog mit Nachbarwissenschaften hat sich auf weitere Disziplinen ausgedehnt: Philosophie, Kulturwissenschaft, Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Sozial- und Kulturanthropologie, Sprachwissenschaft, Kunst, Literatur, Theater, Musik, Film, Neurowissenschaft, Biologie, Religion, Ethik, Recht, Ökonomie, Politik, Sport, Technik, Architektur.
Die Universität ist der Ort des Wissensaustausches und der Wissensgewinnung sui generis, Ausbildung und Forschung sind Teile davon. Freud musste die Disziplinbildung der Psychoanalyse außerhalb der etablierten akademischen Institutionen durchführen, das Ziel blieb immer das Modell einer psychoanalytischen Hochschule.
Die erfolgreiche Professionalisierung der Psychotherapie bedarf der universitären Verankerung der Disziplin Psychotherapiewissenschaft. Mit der Gründung der Sigmund Freud PrivatUniversität hat die Psychoanalyse die Möglichkeit erhalten, ihr Paradigma im Rahmen der Psychotherapiewissenschaft zu erproben und im Austausch und Wettstreit mit verschiedenen Verfahren deutlich zu machen. Innerhalb der universitären Community finden sich verschiedene Ansätze dazu, auch fakultätsübergreifend z. B. psychoanalytische Sozialpsychologie und Tiefenhermeneutik bei den Psychologen, psychoanalytische Psychosomatik in der Psychotherapiewissenschaft und Medizin, Ethnopsychoanalyse in Forschung und Lehre, ethnopsychoanalytische Deutungswerkstatt in der Psychotherapiewissenschaft. Die Diskussionen in Deutschland im Zusammenhang mit dem kommenden Bundesgesetz von 2019 zur Verankerung der akademischen Direktausbildung in Psychotherapie an deutschen Universitäten lassen erkennen, dass die fünfzehnjährigen Erfahrungen mit der akademischen psychotherapeutischen Direktausbildung an der Sigmund Freud PrivatUniversität eingeflossen sind, womit sich auch das tradierte Spannungsverhältnis von Psychoanalyse und Universität ändert, und die Psychoanalyse im Rahmen der Universitäten jenen Platz einnimmt, der ihr auch gebührt, nämlich als einer Wissenschaft vom Subjektiven und damit ein ergänzendes Gegenstück zu den objektivierenden Naturwissenschaften.
Die vorliegende Biografie, verfasst von Georg Markus, liegt nun in dritter Auflage und in vielen Ländern übersetzt vor, so auf Französisch, Spanisch, Russisch, Polnisch, Tschechisch, Chinesisch. Dies zeigt, dass das Interesse an Freud und seinem Werk nicht abflaut, sondern weltweit vielmehr zunimmt, nicht zuletzt, weil Sigmund Freuds Philosophie auch dem Zeitgeist des 21. Jahrhunderts entspricht und viele Klärungen zur Conditio Humana herbeiführt.
Georg Markus bietet mit der vorliegenden Biografie ein Werk, das eine ganz besondere Qualität hat: Freuds Leben, sein wissenschaftliches Wirken und seine Verdienste in der Entwicklung der Psychoanalyse erschließen sich in dieser Biografie nicht nur einer versierten Fachleserschaft. Das Buch vermag durch seine klare, den Denk- und Lesefluss unterstützende Sprache eine deutlich breitere Leserschaft zu gewinnen als viele bisher erschienene Freud Biografien das vermochten. In diesem Sinne ist das Werk ein Beitrag dazu, Freud aus der Perspektive der Gegenwart einem größeren Leserkreis sowohl als Mensch als auch als Visionär im Bereich der menschlichen Psyche zugänglich zu machen.
Wien, im März 2019
Anmerkung
[1] Univ. Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Alfred Pritz ist Rektor der Sigmund Freud PrivatUniversität Wien, Berlin, Paris, Milano, Ljubljana und Linz
»Ein aufregendes Erlebnis«
Dr. Menninger erinnert sich an seinen Besuch bei Freud
Die Berggasse liegt inmitten des grauen Häusermeeres von Wien. Sobald die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings die Kälte des Winters vertrieben hatten, zog es Freud hinaus an den Stadtrand, der den Duft des Wienerwalds in sich aufnimmt. Von Mai bis September bewohnte er eine alte Villa, »schön wie ein Märchen«, sagte er, mit prachtvollem Garten im noblen Bezirk Grinzing. Es war ein politisch »heißes Jahr«, als sich Freud über die Sommermonate 1934 in Wiens vielbesungenem Wein- und Heurigenort niederließ. Im Februar war Österreich Schauplatz eines blutigen Bürgerkriegs gewesen, im Juli fiel der Bundeskanzler einem von Nationalsozialisten organisierten Mordanschlag zum Opfer. Nicht nur Freud sah der Zukunft seiner Heimat mit tiefem Pessimismus entgegen.
Das ist die Situation, in der sich der 41jährige amerikanische Psychiater Dr. Karl Menninger in ein Propellerflugzeug setzt und die weite Reise von Kansas nach Österreich antritt, um dem 78jährigen Freud einen Besuch abzustatten. Per Taxi fährt er am zweiten Tag seines Aufenthalts von einem Hotel in der Wiener Innenstadt zu dem von Freud gemieteten Sommerhaus in der Grinzinger Strassergasse. Anna Freud öffnet die Tür, führt den Gast vorerst in ein düsteres Zimmer und dann, nach längerer Wartezeit, in den Garten der Villa, wo ihr Vater unter dem Schutz eines schattenspendenden großen Baumes sitzt. Hier kommt es zum Treffen der beiden Ärzte.
Sigmund Freud wurde vor 150 Jahren geboren. Es gibt keinen Menschen mehr, der ihm persönlich begegnet ist und darüber berichten könnte. Als ich im Frühjahr 1989 nach Topeka, der Hauptstadt des amerikanischen Bundesstaates Kansas kam, gab es noch einen. Er hieß Dr. Karl Menninger, und er war es auch, der Freud im August 1934 in Wien besucht hatte. Dr. Menninger war 96 Jahre alt, als ich vor ihm stand. Ein Mann von unglaublicher Energie und imponierender Leistungsfähigkeit. Er war nicht nur Gründer, sondern auch der überaus aktive Präsident der Menninger Foundation, einer der größten privaten Psychiatrischen Kliniken der Welt. Der agile und temperamentvolle Psychiater führte mich während meines zweitägigen Besuchs in Topeka durch fünf Kliniken und Institute, an denen er auch damals noch tagtäglich seiner Arbeit nachging.
»Sie kommen wegen Freud«, setzte Karl Menninger an, »ja, ich flog damals zu ihm nach Wien, und es war ein unvergeßliches Erlebnis. Nicht mein schönstes vielleicht, aber sicher eines der aufregendsten, die ich hatte.« Bald stellte ich die Frage, die sich aufdrängt, wenn man als Autor einer Freud-Biographie einen der letzten lebenden Freud-Zeugen vor sich hat. Es war die Frage nach Persönlichkeit und Charisma des vielleicht bedeutendsten Mannes des 20. Jahrhunderts.
»Well, äußerlich war Freud so, wie man sich einen Gelehrten vorstellt, und er war ein typical Viennese Gentleman«, erzählte Dr. Menninger. »Professor Freud war freundlich und überaus höflich, er war vornehm, wußte aber eine gewisse Distanz zu wahren. Es war nicht so, daß man ihm die Hand schüttelte und gleich an ihn ›herankam‹. Er war damals schon eine Legende, und er war sich dessen bewußt.«
Es war ein intensives Gespräch, das Freud und Menninger an diesem strahlenden Sommertag führten. Und es waren keineswegs nur leere Floskeln, die ein weltbekannter Mann mit seinem Besucher – der sein Sohn hätte sein können – wechselte. Auch Menninger war damals schon eine Berühmtheit. Sein Buch The Human Mind zählte zu den erfolgreichsten Büchern der USA – mit weit höherer Auflage als Freuds Werk – und hatte ungeheuer viel zur Popularisierung der Psychoanalyse in Amerika und damit in der ganzen Welt beigetragen. Und er war damals schon Leiter der Menninger Clinic, einem der wenigen Psychiatrischen Krankenhäuser, in denen die Patienten durch Psychoanalyse behandelt wurden.
Nun, worüber spricht einer der ersten Psychoanalytiker der Vereinigten Staaten, wenn er zum Vater der Psychoanalyse nach Wien pilgert?
»Zuerst einmal habe ich Freud von einem Paprikahuhn vorgeschwärmt. Ich hatte so etwas gerade zum ersten Mal in meinem Leben gegessen, in einem Heurigengarten. Und wir sprachen von der Musik, die man dort spielte.«
»Das wird doch nicht der Grund Ihrer Reise gewesen sein?«
»Oh no«, lachte Menninger, »we spoke about the death-instinct – How do you say in German? Oh yes: Todestrieb.« Karl Menninger zählte zur nicht allzu großen Schar jener Freud-Jünger, die der Ansicht ihres Idols zustimmten, daß sich der Keim des Todes von der ersten Stunde an im menschlichen Organismus befinde.
Freud führte das Gespräch in »exzellentem Englisch, wenn auch mit stark österreichischem Akzent«. Trotz seiner schweren Krankheit war er voll konzentriert, reagierte auf jeden Einwand und jede noch so komplizierte Frage. Sigmund Freud litt zum Zeitpunkt des Menninger-Besuchs seit mehr als zehn Jahren an Kieferkrebs, hatte oft unerträgliche Schmerzen und war bereits mehrmals operiert worden. »Aber er hatte eine eiserne Disziplin, ließ sich von all dem nichts anmerken.«
Ich spürte bei meinem Gespräch mit Karl Menninger die Faszination, die der große alte Mann auf ihn hinterlassen hatte. Und doch war der Besuch in gewissem Sinn eine Enttäuschung. »Sie müssen sich vorstellen, ich war mit ungeheuren Erwartungen nach Wien gekommen. Immerhin hatte ich viel zur Verbreitung der Psychoanalyse in Amerika beigetragen, ich war hier zu einer Zeit, da viele nichts davon wissen wollten, so etwas wie ein Advokat seiner Lehre gewesen, ein Missionar. Aber was war geschehen? Freud ließ mich nach meiner langen, mühsamen Reise von Amerika nach Europa eine Stunde in einem finsteren Vorraum warten, ehe er mich empfing. Das wäre noch nicht so schlimm gewesen. Aber ich hatte dann auch während unseres Gesprächs den Eindruck, daß er überhaupt keine besondere Freude daran hatte, mit einem Amerikaner zusammenzuarbeiten. Was man für ihn und seine Arbeit tat, hat er als selbstverständlich hingenommen, und er war nicht bereit, irgendetwas dazu beizutragen, um unsere Bemühungen für die Psychoanalyse in den USA zu unterstützen. Das war sicherlich keine Frage persönlicher Sympathien oder Antipathien. Der Ursprung lag vielmehr einige Jahre zurück: Freud war ja einmal, 1909, in Amerika gewesen, und obwohl man ihm damals einen glänzenden Empfang bereitet hatte, empfand er seither eine gewisse Aversion gegen das Land. Das ist eigenartig, denn während man ihm in Europa noch sehr lange Zeit Steine in den Weg legte, ging seine Lehre gerade von hier, von den Vereinigten Staaten aus, um die Welt. Ich habe später oft darüber nachgedacht, was er gegen uns Amerikaner hatte.«
Freud selbst hat seine Abneigung gegen die Neue Welt, die ihm so viele Sympathien entgegenbrachte, mit einer langwierigen Darmstörung erklärt, an der – wie er glaubte – die amerikanische Küche schuld gewesen wäre. Auch hatte er während seines zweiwöchigen Aufenthalts in den USA für das unkonventionelle Benehmen der Amerikaner wenig Begeisterung gefunden.
Auf dem Gelände der Menninger Foundation befindet sich das imposante Menninger Archive, dem eine der weltweit größten Bibliotheken für Psychiatrische Literatur angeschlossen ist. Im Archiv gewährte man mir – versehen mit Dr. Menningers ausdrücklicher Bewilligung – Einblick in die seinem Besuch folgende Korrespondenz mit Freud. Menninger berichtet darin über seine psychoanalytische Praxis in Amerika, und die aus Wien eingelangten Briefe sind ebenso höflich und kühl wie das geschilderte Zusammentreffen. Und doch kommen in den Antworten Freuds – der jeden Kult um seine Person ablehnte – einige typische Charakterzüge zum Ausdruck. Wenn er etwa am 4. Januar 1937 nach Topeka schreibt: »Geehrter Herr Kollege. Ich danke Ihnen sehr für Ihren freundlichen Brief und den ausführlichen Bericht über Ihre Thätigkeit. Auch für die Nummern des ›Clinic Bulletin‹, die Sie mir zugeschickt haben. Ihre Absicht, mir die Mai-Ausgabe dieser Zeitschrift zu widmen, musste mich erfreuen, doch ist es mein Grundsatz, an Veranstaltungen so persönlicher Art selbst keinen Anteil zu nehmen. In vorzüglicher Hochachtung Ihr Freud.«
Brief Freuds an Dr. Karl Menninger vom 4.1.1937
© Menninger-Archive, Topeka/USA (Copyright Sigmund-Freud-Archives, Washington)
»Er war, wie er mir schon in Wien gesagt hatte, sehr angetan von unserer Arbeit, die ganz in seinem Sinn verlief. Aber er war nicht bereit, für unsere Zeitschrift ein Vorwort zu schreiben, worum ich ihn gebeten hatte.«
Karl Menninger behielt einen genialen Mann voller Widersprüche in Erinnerung. Und überliefert uns damit kein untypisches Bild aus dem Leben dieses bedeutenden Wissenschaftlers: Freud konnte freundlich und gleichzeitig abweisend sein. Er hatte schon als relativ junger Mann schreckliche Todesängste und war gerade in dieser Zeit besonders schöpferisch. Den Wunsch vieler Verleger, seine Biographie zu veröffentlichen, lehnte er brüsk ab und hinterließ uns doch mehr biographisches Material als die meisten anderen Großen der Weltgeschichte. Er verließ seine besten und treuesten Freunde und litt unter einer Isolation, in die er sich zum Teil selbst begeben hatte.
Freud war ein Fall für Freud. Im besten Sinn des Wortes. Denn gerade seine nicht unkomplizierte Persönlichkeit, das Genie voller Widersprüche, schaffte die Grundlagen zum Studium komplexer Vorgänge in der menschlichen Seele. Wie er selbst es einmal ausdrückte: »Der Hauptpatient, der bin ich selbst.«
Erinnerte sich Menninger[2] an einen zwar charmanten, aber doch sehr kühlen Freud, so fiel mir in Wien die Korrespondenz eines ehemaligen Freud-Patienten in die Hände, der einen ganz anderen Freud beschreibt. Der Patient hieß Bruno Goetz und war im Jahre 1902 kurze Zeit in Freuds Behandlung. Mit seltener Offenheit geht der damalige Student Goetz vor allem auf Freuds faszinierende, geradezu magische Erscheinung ein.
Knapp 20 Jahre alt, begab sich Goetz, den heftige Gesichtsneuralgien plagten, »mit sehr gemischten Gefühlen« in die Berggasse: »Freud kam auf mich zu, schüttelte mir die Hand, bat mich, Platz zu nehmen und musterte mich aufmerksam. Ich blickte in seine wunderbar gütigen, warmen schwermütig-wissenden Augen. Zugleich war mir, als fahre eine Hand flüchtig über meine Stirn.« Schon durch die Begegnung wären die Schmerzen »wie weggewischt« gewesen, erinnert sich Goetz dieser Situation, die er in Briefen an einen Jugendfreund schildert. Die Persönlichkeit des Arztes hatte den neuen Patienten sofort in seinen Bann gezogen.
Goetz – später Übersetzer der Werke Tolstojs und Gogols – verfaßte in seiner Freizeit Gedichte. Freud saß zunächst ein paar Sekunden schweigend da und lächelte vor sich hin. Dann sagte er freundlich: »Lassen Sie mich Sie ein wenig kennenlernen. Ich habe hier ein paar Gedichte von Ihnen. Sehr schön – aber verkapselt. Sie verstecken sich ja hinter Ihren Worten, anstatt sich von ihnen tragen zu lassen. Kopf hoch! Sie haben es gar nicht nötig, sich vor sich selbst zu fürchten … Und jetzt erzählen Sie mir etwas von sich. In Ihren Versen kommt immer wieder das Meer vor. Wollen Sie damit symbolisch auf irgend etwas hinweisen? Oder haben Sie wirklich etwas mit dem Meere zu tun gehabt? Woher stammen Sie eigentlich?«
Bruno Goetz, als Sohn eines Seemannes in der russischen Hafenstadt Riga aufgewachsen, war von Freuds treffsicherem Instinkt erstaunt. »Mir war, als wäre eine Schleuse in mir geöffnet worden. Und ehe ich mich dessen versah, erzählte ich ihm mein ganzes Leben, erzählte ihm ohne jede Zurückhaltung Dinge. über die ich noch niemals mit jemand gesprochen hatte. Was hätte es auch für einen Sinn gehabt, etwas vor ihm zu verbergen? Es war ihm ja doch schon alles im voraus bekannt.
Beinahe eine ganze Stunde hörte er mir zu, ohne mich zu unterbrechen und ohne mich anzusehen. Manchmal lachte er leise auf.« Endlich kam Freud auf den Vater des Patienten zu sprechen. »War Ihr Vater denn nicht streng zu Ihnen?«, wollte er wissen.
»›Er war mein bester Freund, wir verstanden uns bei den leisesten Andeutungen. Nur von meinen lächerlichen und unglücklichen Liebesgeschichten mit einem Mädchen und einer älteren Dame hatte ich ihm nichts gesagt, und auch davon nichts, daß ich zuweilen ganz verrückt in ein paar Matrosen verliebt war, die ich am liebsten abgeküßt hätte.‹ Ich hatte Angst, er würde das vielleicht nicht ernst nehmen und verstohlen über mich lachen. Vorwürfe hätte er mir bestimmt keine gemacht. Ich hatte mir selbst ja auch gar nichts vorzuwerfen – nur daß ich mich nicht getraut hatte, und dann später, wenn ich in meinem Bett lag … ›Sie verstehen doch … ‹«
»Gewiß, gewiß«, brummte Freud. »Und die Sache mit den Matrosen hat Sie nicht weiter beunruhigt?«
»Niemals!« sagte der Patient. »Ich war ja bis über beide Ohren verliebt. Und wenn man verliebt ist, dann ist alles in Ordnung. Oder nicht?«
»Bei Ihnen sicherlich!« meinte Freud und mußte plötzlich laut lachen. »Sie haben ein beneidenswert gutes Gewissen. Das verdanken Sie Ihrem Vater. Und Ihre Mutter? …«
Da Freud seinem Patienten eine medikamentöse Behandlung empfahl, kam es nur zu wenigen Begegnungen. »Mein lieber Studiosus Goetz«, sagte er, »ich werde Sie nicht analysieren, Sie können mit Ihren Komplexen selig werden. Doch was Ihre Neuralgien anlangt, so werde ich Ihnen ein richtiggehendes Rezept verschreiben.«
Das von Freud verordnete Medikament wirkte innerhalb kürzester Zeit, sodaß die Neuralgien des Patienten bald verflogen waren. Bruno Goetz behielt Freud als großen, warmherzigen Mann in Erinnerung.
Dem Arzt Dr. Menninger und dem Patienten Bruno Goetz steht Sigmund Freuds Enkel gegenüber, der sich eines »Großpapas« entsann, wie man ihn sich wünschen würde: Ernest Freud, eines der wenigen lebenden Familienmitglieder, die den sechsfachen Vater und »gottähnlichen Patriarchen« noch in plastischer Erinnerung haben. Ernest war 25, als sein Großvater starb, lebte teils in Hamburg, teils in Wien. Aus der Berggasse ist ihm eine Wiener Großfamilie im Gedächtnis geblieben, »mit ihrer eigenen Kultur, mit eigenen Werten, eine jüdische Familie, aber in keiner Weise orthodox; eine intellektuelle, gutbürgerliche Familie mit einem hohen Standard von Anständigkeit und Ehrlichkeit. Sie bestand aus Großvater, um den sich in Wirklichkeit alles drehte, und dessen jüngster Tochter Anna, die ihm zur Seite stand. Dann gab es Großmama, Tante Minna, Paula – eine Kombination von Haushälterin und Dienstmädchen – und eine Köchin. Da waren auch noch die fünf alten Tanten (Freuds Schwestern), alles nette Leute, warm und hilfreich. Großvater erschien äußerst menschlich, obgleich er als unfehlbar galt. Das nahmen alle als selbstverständlich hin. Er brauchte seine Wünsche nicht zu äußern, alles funktionierte.«
In Ernest Freuds Erinnerung war Freud »gewöhnlich mit Schreiben, Lesen oder Denken beschäftigt, und man konnte ihn häufig beim Aufschneiden noch ungelesener Seiten von neuen Büchern sehen, wozu er einen großen Brieföffner benutzte. Immer freundlich, offen und aufrichtig. Er sprach langsam und mit Überlegung und was er zu sagen hatte, gab einem schon zu denken. Ich kann mich nicht erinnern, ihn je ungehalten oder wütend gesehen zu haben. Es herrschte immer Frieden und Ruhe und das emotionelle Klima schien spannungsfrei. Es war selbstverständlich, daß man bemüht war, einer Meinung zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, daß ein Familienmitglied je laut sprach, daß man sich anschrie, mit der Faust auf den Tisch schlug, vor Wut auf den Boden stampfte, die Tür zuknallte oder fluchte. All dies war undenkbar, dazu war die Familie viel zu gutmütig, stolz und kontrolliert.«
Vom Enkel noch einmal zurück nach Topeka, zu Dr. Menninger. Nachdem er Freud sein zweites großes Werk, Man Against Himself, geschickt hatte, bedankte sich dieser am 14. Februar 1938, »umso bereitwilliger, da der Todestrieb bei den Analytikern nicht sehr beliebt geworden ist«. Es war der letzte Brief, den Freud an Menninger richten sollte, und er zeigte sich glücklich darüber, daß der amerikanische Kollege dem Todestrieb, der ihm besonders am Herzen lag, einmal mehr seine Aufmerksamkeit geschenkt hatte.
Gerade die beiden menschlichen Triebe sind es, die im Zentrum von Freuds Psychoanalyse stehen: Der auf Zerstörung des eigenen oder auch fremden Daseins gerichtete Todestrieb ist der eine. Und der auf Lust und Fortpflanzung gerichtete Lebenstrieb (»Libido«) der andere. Dieser steht am Beginn jedes Lebens und führt uns damit nahtlos in Freuds erstes Lebenskapitel, in seine Kindheit, über.
Anmerkung
[2] Dr. Karl Menninger starb 1990 in seinem 98. Lebensjahr
»Aus dir wird nie etwas werden«
Kindheit und Jugend
Fast alles, was Sigmund Freud betrifft, wurde von seinen Zeitgenossen in Frage gestellt. Den Rest zerpflückte die Nachwelt. Warum sollte es sich mit Freuds Geburt anders verhalten. Und so herrschte selbst über den Tag seines Eintritts in diese Welt, die er so nachhaltig verändern sollte, Uneinigkeit.
Der Zwist entstand, als Freuds Geburtshaus, im mährischen Städtchen Freiberg bei Ostrau gelegen, 1931 mit einer Erinnerungstafel geschmückt werden sollte. Den »6. Mai 1856« planten die stolzen Gemeindeväter damals als Geburtstag des berühmtesten Sohnes ihrer Stadt in Marmor zu meißeln. Doch nach einem Blick ins örtliche Standesamtsregister standen plötzlich Tag und Stunde der Geburt nicht mehr in der Form fest, wie sie von Freud selbst seit eh und je gefeiert wurden. Denn vom Stadtschreiber war klar und deutlich der 6. März und nicht der 6. Mai als Geburtstag vermerkt worden.
Das ist einmal die vereinfachte Version. In Wahrheit ist’s – auch wieder wie so vieles bei Freud – etwas komplizierter. Er hieß gar nicht »Sigmund«, sondern amtlich »Sigismund«, und auch das ist nicht ganz korrekt, denn sein Vater hatte in der Familienbibel den Vornamen seines Sohnes mit »Schlomo« vermerkt.
Und weil wir uns im kleinbürgerlich-jüdischen Milieu einer mährischen Stadt zur Mitte des 19. Jahrhunderts bewegen, war da weder der 6. März noch der 6. Mai eingetragen. Sondern Dienstag, im Rosch Hodesch Iyar 5616 des jüdischen Kalenders. Vielleicht stimmt der Hinweis von Freuds Vater, wonach Sigmund-Sigismund-Schlomo am 6. Mai zur Welt kam, und der Stadtschreiber hat sich nur verschrieben. Diese Version wäre nur allzu verständlich, bei der äußerst komplizierten Umrechnung der Daten vom jüdischen zum Gregorianischen Kalender.
Es gibt aber noch eine Möglichkeit: Sigmunds Mutter, Amalie Nathanson, war die dritte Frau des Jakob Freud. Die beiden hatten am 29. Juli 1855 in Wien geheiratet. Im darauffolgenden Jahr kam also Sigmund zur Welt. Vielleicht wählte Jakob Freud den 6. Mai als dessen Geburtstag, weil im anderen Fall zwischen Verehelichung und Geburt seines Sohnes keine neun Monate lagen. Oder hat sich Vater Freud einfach geirrt? Dann wäre im Zusammenhang mit Sigmunds Geburt wohl schon die erste der späterhin klassisch gewordenen »Freud’schen Fehlleistungen« begangen worden.
Lassen wir die Spekulationen. Der 6. Mai gilt heute als Sigmund Freuds Geburtstag.
Bleibt noch zu erklären, warum er sich weder Schlomo noch Sigismund nannte – das waren ja seine eigentlichen Namen. »Schlomo« war wohl auszuschließen, da Freud in seiner doch sehr bürgerlichen Lebensweise zu den assimilierten Juden gehörte. Daß er auch nicht als »Sigismund Freud« Berühmtheit erlangte, liegt an der Existenz eines Verwandten namens Sigismund Freud – die beiden Freuds wollten wohl der Gefahr entgehen, verwechselt zu werden, und so änderte der Jüngere noch als Student seinen Namen auf Sigmund.
Freiberg war in jenen Tagen eine Kleinstadt mit rund fünftausend Einwohnern, in der die deutschsprachig-jüdische Gemeinde gegenüber den Tschechen eine verschwindende Minderheit bildete. Heute heißt das Städtchen längst nicht mehr Freiberg, sondern Přibor. In der Traumdeutung, seinem ersten Hauptwerk, schreibt Freud über den Eintritt in diese Welt: »Da fällt mir ein, was ich so oft in der Kindheit erzählen gehört habe, daß bei meiner Geburt eine alte Bäuerin der über den Erstgeborenen glücklichen Mutter prophezeit, daß sie der Welt einen großen Mann geschenkt habe. Solche Prophezeiungen müssen sehr häufig vorfallen; es gibt so viel erwartungsfrohe Mütter und so viel alte Bäuerinnen oder andere alte Weiber, deren Macht auf Erden vergangen ist und die sich wiederum der Zukunft zugewendet haben.«
Im Haus Nr. 117 der staubigen Schlossergasse – heute heißt sie dem großen Sohn zu Ehren Freudova ulice – verbrachte Sigmund die ersten drei Jahre seiner Kindheit. Ebenerdig lag die Schlosserwerkstatt des Hausherrn Zajic, dessen Frau Monica sich um die Kinder des Untermieters Jakob Freud im ersten Stock kümmerte. In der Traumdeutung beschreibt er sie als »alt und häßlich, aber sehr klug und tüchtig; nach den Schlüssen, die ich aus meinen Träumen ziehen darf, hat sie mir nicht immer die liebevollste Behandlung angedeihen und mich harte Worte hören lassen, wenn ich der Erziehung zur Reinlichkeit kein genügendes Verständnis entgegenbrachte«. Das plötzliche Fernbleiben der Kinderfrau war eines seiner ersten einschneidenden Erlebnisse: Sie war als Diebin entlarvt und verhaftet worden.
Eine Tochter der Familie Zajic erzählte später einmal vom kleinen Sigmund, »einem lebhaften Jungen, der gern in Vaters Werkstatt spielte und aus Metallabfällen kleine Spielzeuge machte«. Freud selbst erinnerte sich jedenfalls immer gern an seinen Heimatort, wie er – bereits als berühmter Mann – dem Bürgermeister von Přibor brieflich mitteilte: »Tief in mir lebt noch immer fort das glückliche Freiberger Kind, der erstgeborene Sohn einer jugendlichen Mutter, der aus dieser Luft, aus diesem Boden die ersten unauslöschlichen Eindrücke empfangen hat.«
Jakob Freud, der Vater, stammte aus dem galizischen Dorf Tys´mienica, von wo er 1844 nach Mähren gekommen war. In Freiberg gehörte er der Gruppe sogenannter »Wanderjuden« an; er handelte vornehmlich mit Wolle und war jeweils eine Hälfte des Jahres seßhaft, die andere Hälfte bereiste er Galizien, Ungarn, Sachsen und Österreich, um seine Ware feilzubieten. Jakob beherrschte die hebräische Sprache und war 41, als Sigmund geboren wurde.
Seine erste Frau Sally hatte ihm zwei Söhne geschenkt – Emanuel und Philipp – die, als Sigmund zur Welt kam, bereits 21 und 16 Jahre alt waren. Die erste Frau war früh verstorben, Jakob Freud heiratete wieder, doch auch Rebekka, die zweite Frau, lebte nur kurze Zeit.
Amalie Freud, geborene Nathanson, schließlich – Jakobs dritte Frau und Sigmunds Mutter –, 20 Jahre jünger als ihr Mann, wird als autoritäre Persönlichkeit und Schönheit von anmutiger Grazie beschrieben, die ihrem erstgeborenen Sohn Sigmund Liebe und Geborgenheit im Überfluß geben konnte. Und sie war es wohl, die ihm jenen Ehrgeiz vermittelte, der ihn später zu großen Werken beflügeln sollte, wie er selbst einmal feststellte: »Wenn man der unbestrittene Liebling der Mutter gewesen ist, so behält man fürs Leben jenes Eroberergefühl, jene Zuversicht des Erfolges, welche nicht selten wirklich den Erfolg nach sich zieht.« In einem Brief an seine Schwägerin Minna Bernays beschreibt Freud seine Mutter als uneigennützige Frau, von der er nicht eine Handlung wüßte, »mit der sie über das Interesse oder das Glück eines ihrer Kinder hinweg ihre Launen oder ihre Interessen verfolgt hätte«.
Von der Mutter, so ist überliefert, hätte Sigmund seine kühle Distanziertheit, vom Vater die leichtherzige Natur und einen Sinn für Humor geerbt. Die Familienverhältnisse sind in der Tat als außergewöhnlich zu bezeichnen, gehörte doch seine Mutter der Generation seines Halbbruders Emanuel an. Und Freuds Vater war bereits Großvater, als Sigmund zur Welt kam: Emanuel hatte einen Sohn namens John, der um ein Jahr älter war als »Onkel Sigi«, und sie waren unzertrennliche Freunde.
Nicht nur die Kinderfrau, sondern auch Josef Freud, ein Bruder seines Vaters, war mit dem Gesetz in Konflikt geraten, als er sich »in gewinnsüchtiger Absicht zu einer Handlung verleiten ließ, welche das Gesetz schwer bestraft«. Vater Jakobs Haare waren, als der Fall bekannt wurde, innerhalb weniger Tage grau geworden, und er pflegte später zu sagen, Onkel Josef sei »nie ein schlechter Mensch gewesen, wohl aber ein Schwachkopf«.
Der Traum spielt, wie wir wissen, in der Welt des Sigmund Freud eine bedeutende Rolle, und hier wiederum sind es sehr oft Eindrücke aus der Kindheit, die uns später dann im Schlaf überraschen. Natürlich träumte Freud, als er erwachsen war, von seiner Kindheit. Einmal, so schreibt er, entdeckte er im Traum den Arzt seiner Geburtsstadt Freiberg. Das Gesicht ähnelte jedoch eher dem seines Wiener Geschichtsprofessors. »Welche Beziehung die beiden Personen verknüpfte, konnte ich dann im Wachen nicht ausfindig machen. Als ich aber meine Mutter nach dem Arzt dieser meiner ersten Kinderjahre fragte, erfuhr ich, daß er einäugig gewesen war, und einäugig ist auch der Gymnasiallehrer, dessen Person die des Arztes im Traum gedeckt hatte.« – Freud sollte dieses Phänomen später »Verschiebung« nennen.
Er war gerade zwei Jahre alt, da mußte auch schon der einäugige Arzt konsultiert werden, nachdem »Sigi« (der diese Koseform seines Namens besonders haßte) zum Opfer seines ersten Streichs geworden war: »Ich stieg in der Speisekammer auf einen Schemel, um mir etwas Gutes zu holen, was auf einem Kasten oder Tisch lag. Der Schemel kippte um und traf mich mit seiner Kante hinter dem Unterkiefer.« Die Verletzung hinterließ eine tiefe Narbe, die er nie mehr los wurde. Er verbarg sie fortan hinter einem dichten Bart.
In seiner Abhandlung Über Deckerinnerungen faßte Freud – im Rahmen der Selbstanalyse, die er als etwa 40Jähriger durchführte – die Tage der Kindheit so zusammen: »Ich bin das Kind von ursprünglich wohlhabenden Leuten, die, wie ich glaube, in jenem kleinen Provinznest behaglich genug gelebt hatten. Als ich ungefähr drei Jahre alt war, trat eine Katastrophe in dem Industriezweig ein, mit dem sich der Vater beschäftigte. Er verlor sein Vermögen, und wir verließen den Ort notgedrungen, um in eine große Stadt zu übersiedeln. Dann kamen lange, harte Jahre; ich glaube, sie waren nicht wert, sich etwas daraus zu merken. In der Stadt fühlte ich mich nie recht behaglich. Die Sehnsucht nach den schönen Wäldern der Heimat, in denen ich schon, kaum daß ich gehen konnte, dem Vater zu entlaufen pflegte, hat mich nie verlassen.«
Erstaunlich ist wohl, daß ausgerechnet jener Mann, der in den Kindheitserinnerungen die Voraussetzungen für unser weiteres Leben fand, bestimmte Jahre als nicht wert, sich etwas daraus zumerken, erachtete. »Verdrängt« hat er in dieser kurzen Erinnerung offenbar auch, daß er mit den Eltern nach dem Auszug aus Freiberg ein Jahr lang in Leipzig lebte, ehe man für immer »in eine große Stadt« übersiedelte. Freud war zu diesem Zeitpunkt knapp vier Jahre alt und stand damit am Beginn jener Lebensphase, die er später als die »ödipale« bezeichnen sollte.
Wien im Jahre 1860, das war die Residenzstadt eines großen Reiches. Die Freuds waren eine von tausenden jüdischen Familien, die es aus allen Teilen der Monarchie hierherzog. Zu Recht konnten sie mit einer Liberalisierung als Folge der Revolution und auf die längst versprochene politische Gleichberechtigung mit den Nichtjuden rechnen. Während man in anderen Teilen der Monarchie noch im Ghetto oder zumindest in der gesellschaftlichen Isolation lebte, zeigte sich die Hauptstadt fortschrittlich, versuchte sich mit den Juden zu arrangieren. Wien war von einer nie dagewesenen Aufbruchstimmung beherrscht, lebte in der Phase eines gigantischen Wirtschaftsaufschwungs, an dem die finanzkräftigen jüdischen Geschäftsleute einen nicht unwesentlichen Anteil hatten.
Und die bisher aus allen Nähten platzende Stadt an der Donau glich einer einzigen Baustelle, denn just im Jahr, da die Freuds Wien zu ihrem neuen Wohnsitz bestimmt hatten, entstanden die ersten Prachtbauten auf der neu angelegten Ringstraße, nachdem man Wälle und Gräben – volkstümlich Basteien und Glacis genannt – abgetragen hatte. Mit dem Entstehen der Ringstraße und der darauf folgenden Eingemeindung der Vororte wurde die bisher mittelalterlich dimensionierte Stadt zur modernen Metropole.
Kaiser Franz Joseph, der Wien mit dem Einsetzen der »Gründerzeit« ein neues Profil verleihen sollte, regierte, als sich die Familie Freud hier ansiedelte, seit zwölf Jahren. Nur allmählich war es ihm gelungen, als Monarch Anerkennung zu finden. Nach den Hinrichtungen etlicher Achtundvierziger-Revolutionäre hatte ihn der Volksmund als »blutjungen« Kaiser bezeichnet, doch als er auf der Bastei ein Messerattentat durch den Schneider János Libenyi mit leichten Verletzungen überstand, begann ihm das Mitleid seiner Völker entgegenzuschlagen, aus dem bald Sympathie und Liebe wurde. Als er 1854 Prinzessin Elisabeth von Bayern heiratete, begann sein Aufstieg zum populärsten Monarchen des Kontinents.
Freud sollte nie zu den Verfechtern der Habsburger zählen. Als 18jähriger Medizinstudent schickte er einen Brief an seinen Schulfreund Eduard Silberstein, in dem er diesen wissen ließ, was seiner Meinung nach »die nutzlosesten Dinge von der Welt wären: Hemdkrägen, Philosophen und Monarchen«.
Mit Ausnahme seines letzten Jahres verbrachte Freud von jetzt an das ganze Leben in Wien. Ausgerechnet in jener Stadt, in der er sich »nie recht behaglich fühlte«, mit der ihn eine Art Haßliebe verband. Hier wurden die Freuds zur Großfamilie, denn Amalie schenkte Jakob nach Sigmund sieben weitere Kinder, nämlich Julius, Anna, Rosa, Marie, Adolfine, Paula und Alexander.
Sigmund wuchs mit fünf Schwestern und seinem zehn Jahre jüngeren Bruder Alexander auf. Die beiden wesentlich älteren Halbbrüder wanderten, als der Rest der Familie nach Wien übersiedelte, nach England aus, und das Leben des Bruders Julius währte nur sehr kurz. Freud kam später zu dem Schluß, »daß ich meinen 1 Jahr jüngeren Bruder (der mit wenigen Monaten gestorben) mit bösen Wünschen und echter Kindereifersucht begrüßt hatte und daß von seinem Tode der Keim zu Vorwürfen in mir geblieben ist«.
Freud war in dem Wiener Haushalt das älteste Kind, dem die Geschwister »zu gehorchen hatten«. Die zweieinhalb Jahre jüngere Schwester Anna beschrieb Sigmund später als privilegierten ältesten Sohn der Familie, der ihr verbot, Balzac und Dumas zu lesen, und der als einziger ein eigenes Zimmer und eine Öllampe für sich in Anspruch nahm. Das Klavierspiel störte ihn, was dazu führte, daß der Flügel verkauft wurde und daß seine Schwestern die musikalische Ausbildung beenden mußten.
In den ersten Jahren ihres Wien-Aufenthaltes bewohnte die immer größer werdende Familie Freud mehrere Wohnungen im damals vornehmlich jüdischen Bezirk Leopoldstadt, ehe sie sich im Hause Pfeffergasse Nr. l niederließ. Zu Sigmunds frühkindlichen Erinnerungen zählten zwei Begebenheiten, die er notierte. Als er fünf war, schenkte ihm der Vater einige Bücher, die er zerreißen durfte, was – laut Freud – »erzieherisch kaum zu rechtfertigen war«, doch auf seine spätere Liebe zu Büchern entscheidenden Einfluß haben sollte: »Das Bild, wie wir Kinder dieses Buch zerpflücken (wie eine Artischocke, Blatt für Blatt, muß ich sagen), ist nahezu das einzige, was mir aus dieser Lebenszeit in plastischer Erinnerung geblieben ist. Als ich dann Student wurde, entwickelte sich bei mir eine ausgeprägte Vorliebe, Bücher zu sammeln und zu besitzen, ich wurde ein Bücherwurm. Ich habe diese erste Leidenschaft meines Lebens, seitdem ich über mich nachdenke, immer auf diesen Kindheitseindruck zurückgeführt, oder vielmehr, ich habe erkannt, daß diese Kinderszene eine ›Deckerinnerung‹ für meine spätere Bibliophilie ist.«
In dieser Zeit ereignete sich auch Begebenheit Nummer zwei, als Sigmund in das Schlafzimmer seiner Eltern urinierte, was Vater Jakob Anlaß zur Prophezeiung gab: »Aus dir wird nie etwas werden.« Freud stellte später eine gewisse Rivalität zwischen ihm und seinem Vater um die Liebe der jungen, schönen Mutter fest: »Ich habe die Verliebtheit in die Mutter und die Eifersucht gegen den Vater auch bei mir gefunden und halte sie jetzt für ein allgemeines Ereignis früher Kindheit.« Gerade durch die Analyse seiner eigenen Kindheit entdeckte er den Ödipuskomplex, also »die Fixierung an den entgegengesetzt geschlechtlichen Elternteil«.
Sigmund erhielt den ersten Elementarunterricht durch seine Eltern. Ab 1865 besuchte er die Leopoldstädter Communalmittelschule in der Taborstraße, die später als Sperlgymnasium bekannt wurde. Diesen Namen erhielt die angesehene Ausbildungsstätte, weil auf dem Platz des neuen, erst nach Freuds Matura errichteten Gymnasialgebäudes der berühmte Tanzsaal ZumSperl etabliert war, in dem einst Johann Strauß und Joseph Lanner aufgespielt hatten.
Ein Jahr nachdem Freud ins Gymnasium eintrat, wurde die Monarchie durch die Tragödie von Königgrätz erschüttert. Obwohl gerade erst zehn Jahre alt geworden, war Sigmund von dem Geschehen tief beeindruckt, beschreibt seine Schwester Anna. »Der Anblick der Verwundeten des preußisch-österreichischen Krieges, die am Wiener Nordbahnhof ankamen, hat Freud so gerührt, daß er seine Klasse veranlaßte, Verbandszeug herzustellen.«
Freud war Vorzugsschüler und von der ersten bis zur achten Schulstufe Klassenbester, seine Stellung war dermaßen gefestigt, daß er, wie er einmal sagte, »kaum je geprüft wurde«. In der vierten Gymnasialklasse wurde sein Jahreszeugnis freilich durch einen dunklen Punkt belastet, der sein Sittliches Betragen vom bisherigen »musterhaft« um zwei Noten auf »entsprechend« herabsenkte. Der Grund für diese ungewöhnliche Maßnahme war ein Sittenskandal in seiner Klasse, der die angesehene Schule in ihren Grundfesten zu erschüttern drohte. In den Klassenbüchern und Konferenzprotokollen des Gymnasiums sind Details nachzulesen.
Direktor Dr. Alois Pokorny war ein überaus angesehener Botaniker und Pädagoge, dem das österreichische Schulwesen die Schaffung des »Realgymnasiums« zu verdanken hat. Pokorny hatte mehrfach darüber geklagt, daß sich Kinder – oder für sie deren Eltern – bereits vor dem Eintritt ins Gymnasium, also im Alter von kaum zehn Jahren, für einen bestimmten Schultyp entscheiden mußten. Da diese Entscheidung für die gesamte Studien- und Berufslaufbahn eines Menschen von größter Bedeutung ist, forderte Professor Pokorny eine Generalreform des Mittelschulwesens. Und setzte sich durch. Mit Pokornys Idee vom »Realgymnasium« mußte die Entscheidung zwischen humanistischer und naturwissenschaftlicher Studienrichtung erst im Alter von 14 Jahren getroffen werden – in den ersten Klassen bleibt der Unterrichtsstoff identisch. Sigmund Freud sollte später die humanistische Studienrichtung wählen.
Bis zu dieser Entscheidung lag noch ein Schuljahr, als Direktor Pokorny am 1. Juli 1869 eine dringende Sonderkonferenz einberief. Besagter »Sittenskandal« schien in höchstem Maße aufklärungsbedürftig.
Was hatte sich ereignet? Mehrere Mitschüler waren schon seit längerem durch »sittenwidriges Betragen, Verlogenheit, besondere Disziplinlosigkeit sowie oftmaliges Fernbleiben vom Unterricht« aufgefallen, sodaß der Klassenvorstand und Geschichtsprofessor Dr. Emanuel Hannak sich veranlaßt sah, eine Untersuchung einzuleiten. Dabei kam – wenn man bedenkt, daß es sich um 14jährige Untermittelschüler handelte – in der Tat Außergewöhnliches zutage: Freuds Klassenkameraden Otto Drobil und Richard Olt hatten seit Monaten »verdächtige Lokale besucht« und dort mit Prostituierten verkehrt.
Schon bei den Voruntersuchungen war bekanntgeworden, daß die beiden Übeltäter »Schänken in der Leopoldstadt sowie auf der Wieden besuchten, daselbst Billard spielten, sich mit der Cassierin abgaben und mit liederlichen Dirnen Umgang pflegten«. Drobil stand überdies »mit der Fleischerstochter Wisgrill in Beziehung«, von Professoren befragte Mitschüler belasteten ihn darüber hinaus im Zusammenhang mit »einem Fräulein in einer Seitengasse des Grabens«.
Auch Sigmund Freud wurde als Zeuge einvernommen, wobei er lediglich von einem »verrufenen Lokal in der Nähe der Rotenthurmstraße, das die beiden besuchten«, zu berichten wußte. Seine Sittennote wurde daraufhin – wie die fast aller Mitschüler – herabgesetzt, da er von den Vorgängen seit längerem schon gewußt hatte, ohne Direktion oder Klassenvorstand davon in Kenntnis gesetzt zu haben. Bei der Strenge dieser Maßnahme muß bedacht werden, daß es Gymnasiasten damals nicht einmal gestattet war, ohne Begleitung ihrer Eltern ein Kaffeehaus zu betreten, geschweige denn in der Öffentlichkeit »mit fremden Frauenzimmern« zu verkehren.
Die beiden betroffenen Knaben wurden aus der Schule gewiesen, »da ihr weiterer Verbleib an der Anstalt von der größten Gefahr für die übrigen Schüler begleitet wäre«. Freud blieb trotz der erheblichen Verschlechterung seiner Sittennote Vorzugsschüler. Im kommenden Semester war sein Betragen »lobenswert«, ein Jahr nach dem Vorfall wieder »musterhaft«. Der große »Sexualforscher« des 20. Jahrhunderts war durch diese Episode wohl zum ersten Mal in seinem Leben mit »moralischen Verfehlungen« seiner Mitmenschen konfrontiert worden.
Insgesamt war Freuds Klasse mit Beendigung der Untermittelschule von 40 auf 16 Schüler geschrumpft, wobei der »Sittenskandal« vermutlich mehr Opfer als die beiden Hauptdelinquenten gefordert hatte. Andere Klassenkameraden schieden infolge mangelnder schulischer Leistungen aus, so auch Freuds bester Freund Heinrich Braun, der spätere Schwager Viktor Adlers. Braun, zweifellos einer der begabtesten Schüler des Freud-Jahrgangs, mußte die Anstalt verlassen, weil er während des deutsch-französischen Krieges von 1870/1871 seine Zeit in Kaffeehäusern verbrachte, um – statt Latein, Griechisch und Mathematik – ausländische Zeitungen zu studieren. »Wir waren unzertrennliche Freunde«, schrieb Freud Jahrzehnte später an Brauns Witwe, und »unter seinem Einfluß war ich auch damals entschlossen, an der Universität Jus zu studieren.« Für die Medizin interessierte sich Freud kaum, hielt er in seiner kurzen Selbstdarstellung fest: »Eine besondere Vorliebe für die Stellung und Tätigkeit des Arztes habe ich in jenen Jugendtagen nicht verspürt, übrigens auch später nicht. Eher bewegte mich eine Art von Wißbegierde, die sich aber mehr auf menschliche Verhältnisse als auf natürliche Objekte bezog.« Anderswo gesteht Freud sogar, »niemals Arzt im wahrsten Sinne des Wortes gewesen zu sein«.
Schulfreund Heinrich Braun holte die Matura durch Privatunterricht nach und studierte dann Staatswissenschaften. So trafen einander Freud und Braun, nachdem sie sich für Jahre aus den Augen verloren hatten, an der Universität wieder. Braun war später – gemeinsam mit Wilhelm Liebknecht – Gründer der Neuen Zeit, des Zentralorgans der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Durch den Schulfreund sollte Freud Viktor Adler, den Gründer der österreichischen Sozialdemokratie, kennenlernen.
Während Biographen meist von den ärmlichen Verhältnissen berichten, in denen Freud aufwuchs, fällt auf, daß er in keinem einzigen Jahr seiner Mittelschulzeit vom Schulgeld befreit oder gar durch ein Stipendium unterstützt worden wäre – obwohl er durch seine glänzenden Leistungen jede Berechtigung dafür erhalten hätte. Vater Jakob Freud – der als Beruf in der Gymnasialdirektion »Wollhändler« angab – zahlte pünktlich pro Semester 9 Gulden 45 Kreuzer[3] Schulgeld für seinen Sohn.
Eine weitere Episode aus der Mittelschulzeit erwähnt Freud in seiner Traumdeutung: In der fünften Klasse hätten die Mitschüler beschlossen, gegen einen ebenso dummen wie tyrannischen Lehrer zu revoltieren, »eine Diskussion über die Bedeutung der Donau für Österreich war der Anlaß, bei dem es zur offenen Empörung kam«. Freud selbst sei von seinen Kameraden als Sprecher der Protestgruppe gewählt worden. Indirekt berichtet Freud von diesem Zwischenfall 16 Jahre später auch in einem Brief an seine Braut: »Man wird es mir kaum ansehen, und doch war ich schon in der Schule ein kühner Oppositionsmann, war immer dort, wo es ein Extrem zu bekennen und in der Regel dafür zu büßen galt. Als ich dann eine bevorzugte Stellung als langjähriger Primus bekam, als man mir allgemein Vertrauen schenkte, hatte man sich auch nicht mehr über mich zu beklagen.«
In seinem Aufsatz Zur Psychologie des Gymnasiasten bezeichnet er viele Jahre später die Pubertät als die wichtige Zeit des Abnabelns vom Vater, was er mit eigenen Erinnerungen an die Mittelschulzeit einleitet: »Ich weiß nicht, was uns stärker in Anspruch nahm und bedeutsamer für uns wurde, die Beschäftigung mit den uns vorgetragenen Wissenschaften oder die mit den Persönlichkeiten unserer Lehrer. Wir warben um sie oder wandten uns von ihnen ab, imaginierten bei ihnen Sympathien oder Antipathien, die wahrscheinlich nicht bestanden, studierten ihre Charaktere und bildeten oder verbildeten an ihnen unsere eigenen. Sie riefen unsere stärksten Auflehnungen hervor und zwangen uns zur vollständigen Unterwerfung; wir spähten nach ihren kleinen Schwächen und waren stolz auf ihre großen Vorzüge.«
Um dann zur allgemeinen Erkenntnis zu gelangen: »In der zweiten Hälfte der Kindheit bereitet sich eine Veränderung dieses Verhältnisses zum Vater vor, deren Bedeutung man sich nicht großartig genug vorstellen kann. Der Knabe beginnt in der Kinderstube in die reale Welt draußen zu schauen, und nun muß er die Entdeckungen machen, welche seine ursprüngliche Hochschätzung des Vaters untergraben und seine Ablösung von diesem ersten Ideal befördern. Er findet, daß der Vater nicht mehr der Mächtigste, der Weiseste, Reichste ist, er wird mit ihm unzufrieden, lernt ihn kritisieren und sozial einordnen. Alles Hoffnungsvolle, aber auch das Anstößige, was die neue Generation auszeichnet, hat diese Ablösung vom Vater zur Bedingung. In diese Phase der Entwicklung des jungen Menschen fällt sein Zusammentreffen mit den Lehrern. Wir verstehen jetzt unser Verhältnis zu unseren Gymnasialprofessoren. Diese Männer, die nicht einmal alle selbst Väter waren, wurden uns zum Vaterersatz.«
Sein Lieblingsprofessor war der jüdische Religionslehrer Dr. Samuel Hammerschlag, mit dem er bis zu dessen Tod im Jahre 1904 in freundschaftlicher Verbindung blieb. Obwohl Freud in einer assimiliert-jüdischen Umgebung aufwuchs, also keineswegs »orthodox« erzogen wurde, bekannte er sich sein Leben lang zum Judentum. Zu Hause sprach man Hochdeutsch, Sigmund beherrschte weder Hebräisch noch Jiddisch, doch der Religionsunterricht war obligatorisch, irgendeiner Religionsgemeinschaft mußte man angehören. Wie sehr er seinen ehemaligen Religionslehrer und dessen Frau Betty verehrte, belegt ein Brief des jungen Dr. Freud aus dem Jahre 1884: »Ich kenne keine besseren, humaneren, allen unedlen Motiven ferneren Menschen als die sind, abgesehen von der tiefgewurzelten Sympathie, die seit den Gymnasialjahren zwischen dem braven jüdischen Lehrer und mir besteht.«
Und noch etwas: Seine jüngste Tochter Anna sollte Freud nicht etwa nach seiner Schwester gleichen Namens benennen. Sondern nach Anna Hammerschlag, der Tochter seines Lehrers.
Anmerkung
[3] Entspricht lt. Statistik Austria im Jahre 2019 einem Betrag von ca. 65 Euro
Schuld war Goethe – doch der konnte nichts dafür
Medizinstudium als Folge eines Irrtums
1873, das Jahr, in dem Sigmund Freud seine Reifeprüfung am Gymnasium ablegte, sollte sich für Österreich-Ungarn besonders glanzvoll gestalten. Doch es war dann eines der düstersten in der Geschichte der Donaumonarchie. Wien war als strahlender Mittelpunkt einer gigantischen Weltausstellung ausersehen, aber die internationale Veranstaltung stand unter keinem guten Stern. Zwei Ereignisse machten den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Es waren dies der Börsenkrach und eine verheerende Choleraepidemie.
Nur eine Woche nach der Eröffnung der Weltausstellung im Mai war an der Wiener Börse der Schwarze Freitag ausgebrochen, mit dem die gewaltige Konjunkturwelle der Gründerzeit ihr abruptes Ende fand. Die Entwicklung der Wirtschaft wurde auf Jahre gehemmt, zahllose Unternehmer verloren ihr Hab und Gut, verzweifelten, und so mancher nahm sich das Leben.
Und zwischen Juli und Ende Oktober desselben Jahres starb fast eine halbe Million Menschen an den Folgen der letzten großen Choleraepidemie, allein in Wien gab es rund 3000 Tote. Wer irgendwie konnte, verließ die Stadt auf schnellstem Wege.
Nachdem er das Weltausstellungsgelände auf der Rotunde im Wiener Prater zweimal besucht hatte, schreibt Freud an seinen Freund Emil Fluß, daß ihn die internationalen Objekte »nicht betäubt und entzückt« hätten. »Vieles, das anderen gefallen muß, findet in meinen Augen keine Gnade. Es fesseln mich bloß Kunstgegenstände und allgemeine Effekte. Es ist im ganzen ein Schaustück für die geistreiche, schönselige und gnadenlose Welt, die sie auch zumeist besucht.«
Die Familie Freud war nicht wohlhabend genug, die Flucht vor der Cholera antreten zu können. Jakob Freuds Geschäfte gingen recht und schlecht, und wir können annehmen, daß die große Wirtschaftskrise indirekt auch seinen Kleinhandel negativ beeinflußt hat.
Unabhängig davon sollte Sigmund Freud am Sperlgymnasium »mit Auszeichnung« maturieren und mit Beginn des Wintersemesters – im Katastrophenjahr 1873 – an der Universität Wien für sein medizinisches Studium inskribieren.
War der Antisemitismus in den ersten Jahren, da Freud hier lebte, in Wien kaum spürbar gewesen, so zeigten sich als Folge des Börsenkrachs erste Ansätze, denn irgend jemand mußte an der Katastrophe »schuld« sein. In der Traumdeutung berichtet Freud, daß ihm der Begriff Judenhaß in der früheren Kindheit nur aus einer Erzählung des Vaters bekannt war: Als er zehn oder zwölf Jahre alt war, berichtete ihm dieser, wie ihm einmal, als er auf der Straße ging, ein Mann begegnet sei, die Mütze des jungen Jakob in den Dreck geworfen und dabei gesagt habe: »Jud’ herunter vom Trottoir!« Als Sigmund den Vater fragte, wie er darauf reagiert habe, antwortete Jakob: »Ich bin auf den Fahrweg gegangen und habe die Mütze aufgehoben.« Sigmund war empört und empfand die mangelnde Bereitschaft des Vaters, sich zur Wehr zu setzen, als Feigheit. Die Episode zeigt nicht nur eine Kluft zwischen Vater und Sohn, sondern auch das gänzliche Unverständnis der Generation Sigmunds, mit dem Antisemitismus leben zu müssen.
Freud hätte sich wohl nicht träumen lassen, daß er noch erleben sollte, wie weit rassistische Verblendung – in Verbindung mit einem verbrecherischen Regime – führen kann. Um so sensibler reagierte er in späteren Jahren auf jegliche Form des Antisemitismus.
Doch vorerst schienen sich die Lebensbedingungen der rund 70 000 Wiener Juden recht günstig zu entwickeln. Freud zeigte, ehe er sein Universitätsstudium antrat, ein besonderes Interesse für die damals gerade populäre Lehre Charles Darwins »weil sie eine außerordentliche Förderung des Weltverständnisses versprach«. Den Ausschlag für den Entschluß, Medizin zu inskribieren, gab aber der aphoristische Aufsatz Die Natur – von Johann Wolfgang von Goethe, wie Freud selbst berichtete.
Woraus eine kuriose Situation entstand: Die Tatsache nämlich, daß einer der bedeutendsten Ärzte aller Zeiten Medizin studierte, ist die Folge eines Irrtums. Ja, Freud unterlag einer Fehlinformation, als er die Entscheidung traf, Arzt zu werden. Die Natur ist nämlich gar nicht von Goethe. Der Gymnasiast Freud war kurz vor seiner Matura, als er einen populärwissenschaftlichen Vortrag des Zoologen Carl Brühl besuchte, auf die ihn faszinierenden Zeilen aufmerksam geworden, und diese hatten, eigenen Angaben zufolge, sein Interesse an den Naturwissenschaften im allgemeinen und an der Medizin im besonderen geweckt.
Nun, Die Natur war in Goethes Gesammelte Werke aufgenommen worden, da man den Aufsatz für ein unveröffentlichtes Jugendwerk des Dichters hielt. Doch in Wahrheit stammt er, wie man heute weiß, von dem Schweizer Autor Georg Christoph Tobler, der ihn an den von ihm verehrten Goethe geschickt hatte. Nachdem man die Zeilen in dessen Nachlaß fand, wurden sie diesem – fälschlich – zugeschrieben.
Jedenfalls gaben sie – auch wenn der Autor ein anderer war, als Freud dachte – den Anlaß, sich für das Studium der Heilkunde zu entscheiden. »Natur. Wir sind von ihr umgeben und umschlungen«, heißt es hier, »wir leben mitten in ihr und sind ihr fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht. Es ist ein ewiges Leben, Werden und Bewegen in ihr … Alles ist ihre Schuld, alles ist ihr Verdienst.«
Das Thema zur schriftlichen Deutschmatura konnten die Schüler selbst wählen, Freud schrieb Über die Rücksichten bei der Wahl des Berufes. Sein Klassenkamerad Wilhelm Knoepfmacher erzählte einmal, er und Sigmund hätten viele Nächte in der Wohnung der Familie Freud verbracht und sich »mit schwarzem Kaffee und Weintrauben wachgehalten, um sich auf die kommenden Prüfungen vorzubereiten«. Freuds Maturaaufsatz wurde 70 Jahre später von den Nazis entdeckt und vernichtet.
Noch vor der Erlangung seiner akademischen Reife hatte Freud seine erste Romanze, eine für ihn einprägsame Begegnung mit dem anderen Geschlecht. Die Eltern hatten ihn in den letzten Schulferien in die Geburtsstadt Freiberg zur Erholung geschickt, und dort lernte er Gisela Fluß kennen –, die Schwester seines Freundes Emil Fluß – worüber Freud später schreibt: »Ich war siebzehn Jahre alt, und in der gastlichen Familie war eine fünfzehnjährige Tochter, in die ich mich sofort verliebte. Es war meine erste Schwärmerei, intensiv genug, aber vollkommen geheimgehalten. Das Mädchen reiste nach wenigen Tagen ab in das Erziehungsinstitut, aus dem sie gleichfalls auf Ferien gekommen war, und diese Trennung nach so kurzer Bekanntschaft brachte die Sehnsucht erst recht in die Höhe. Ich erging mich viele Stunden lang in einsamen Spaziergängen durch die wiedergefundenen herrlichen Wälder, mit dem Aufbau von Luftschlössern beschäftigt.«
Freud wundert sich in seiner Abhandlung Über Deckerinnerungen darüber, daß seine damaligen Gedanken nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit gerichtet waren: »Wenn der Zusammenbruch (der väterlichen Firma) damals nicht eingetreten wäre, wenn ich in der Heimat geblieben wäre, auf dem Lande aufgewachsen, so kräftig geworden wie die jungen Männer des Hauses, die Brüder der Geliebten, und wenn ich dann den Beruf des Vaters fortgesetzt hätte und endlich das Mädchen geheiratet, das ja all die Jahre über mir hätte vertraut werden müssen! Ich zweifelte natürlich keinen Augenblick, daß ich sie unter den Umständen, welche die Phantasie schuf, ebenso heiß geliebt hätte, wie ich es damals wirklich empfand.«
Unglücklich über die nicht erfüllbare erste »große Liebe« seines Lebens kehrte Freud zurück nach Wien, um sich auf die Matura vorzubereiten. Als er sie mit Auszeichnung bestand, schenkte ihm der Vater eine Reise zum Besuch seiner Halbbrüder in England. – Ein weiterer Beweis dafür, daß Freuds Lebensverhältnisse nicht ganz so ärmlich waren, wie sie oft dargestellt werden, denn eine solche Exkursion war für Kleinbürger geradezu unerschwinglich.