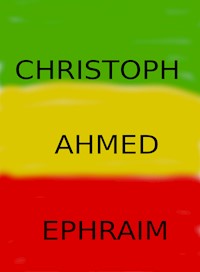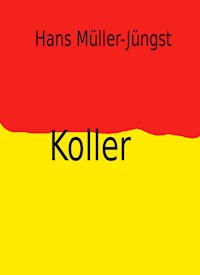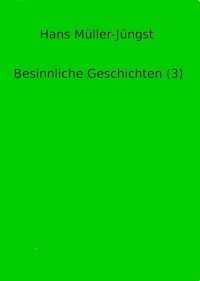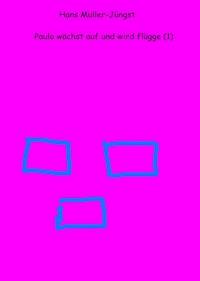Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im vorliegenden Roman geht es darum, Normengefüge, die auf der Erde gelten, in eine fiktive Welt auf einem Exoplaneten zu übertragen, daher auch der Titel. Vorgestellt werden zu Anfang drei Familien, deren Kinder und Kindeskinder, die von einem Abgesandten dieses Planeten ausgesucht worden sind, ihn in seine ferne Heimat zu begleiten. Die Familien finden sich im Nu in der für sie vollkommen fremden Welt wieder und fühlen sich dort wohl, sie sind als Alte verjüngt bis auf das Alter ihrer Kinder, ihr Gewicht beträgt nur etwa ein Drittel ihre Gewichtes auf der Erde. Wenn da nicht der Alleinherrscher Aatu wäre, der seine Stellung der Tatsache verdankt, dass sein Volk, die Tolaner, einst ein anderes Volk, die Nigren, in einem brutalen Eroberungskrieg geschlagen und sich dessen Land angeeignet hat. In der Folge dieses Krieges unterdrücken die Tolaner die Nigren und lassen sie für sich arbeiten, sie halten sie eingesperrt an einem ghettoähnlichen Ort, und nur, weil die Nigren so überaus friedfertig sind, kommt es nicht zu einem erneuten Krieg. Die Sympathien der Erdenbürger liegen von Anfang an auf Seiten der Nigren und obwohl jeglicher Umgang mit ihnen strikt untersagt ist, fahren Paul, Tommy und Bernd an einem Abend heimlich zu ihnen, um zu sehen, wie sie leben. Sie wohnen eine Zeit lang bei einer sehr netten Nigren-Familie in einer Zeitblase, in der die Zeit für sie nicht vergeht und das Erlebte sich nicht im Gedächtnis verfestigt. Paul lernt in dieser Zeitblase Teagan kennen und verliebt sich in sie, er durchlebt die Liebeswirren seiner Jugendzeit noch einmal und ist sehr angenehm berührt, weil sein Bewusstsein das alte geblieben ist. Die Nigren fördern für die Tolaner Gold und Diamanten und verhelfen ihnen damit zu einem luxuriösen Leben. Eines Morgen ereignet sich bei den Nigren ein schweres Erdbeben, in dessen Folge Teagan umkommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans Müller-Jüngst
EXO
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Gerda und Jakob Brenker
Ute und Paul Kamphusen
Rosi und Berthold Klausner
Nora
Lydia
Bärbel und Pascal
Damit Max nicht eifersüchtig wurde, wenn er sehen musste, wie seine Schwester mit Geschenken überhäuft wurde, schenkten Oma und Opa ihm Spielsachen wie ein Piratenschiff, einen Modell-LKW und andere Sachen. Bärbels Kinder waren wie alle scharf auf ein Handy, aber da trauten sich Ute und Paul nicht heran, und damit standen sie beide auch auf Kriegsfuß, denn sie sahen nicht ein, warum ein Kleinkind ein Handy haben musste und überließen die Entscheidung darüber den Eltern. Bärbel hatte schon im Vorfeld beinahe stundenlange Gespräche mit anderen Müttern über das Thema Computer und Handys geführt und war zwiespältiger Ansicht, einerseits sah sie darin eine Überfremdung für die Kinder, weil ihnen ein großer Teil selbst zu machender Erfahrungen durch das Hocken vor dem Computer abgenommen würde, andererseits war ein Handy natürlich eine gute Sache, wenn man einmal schnell mit seinem Kind sprechen wollte. Ein Computer war eine große Hilfe beim Wissenserwerb und in Zeiten der Informationstechnologie unabdingbar. Bärbel entschied sich am Ende für ein Handy und für einen Computer. Pascal hatte ihre Skrupel nicht und hatte immer schon für den Kauf beider Dinge votiert, Inga sollte schließlich nicht hinter dem Mond leben wie er sich auszudrücken pflegte.
Jennifer und Benny
Jasmin und Bernd
Agnes und Tommy
Silberhochzeit in Saelhuysen
Pauls 65. Geburtstag
Fotoabend in Bremen
Brenkers große Fahrt
Familie Brenker fieberte dem Tag entgegen, an dem es endlich zu dem Treffpunkt mit dem ursprünglichen Besitzer des schwarzen Kästchens gehen sollte, und niemand von ihnen hatte auch nur einen Schimmer, wo das denn wohl sein könnte, und sie müssten sich ganz auf das Navigationssystem verlassen. Auch wusste niemand, wie weit sie fahren müssten, weshalb Jakob volltanken wollte, alles lag im Dunkeln und Gerda würde vorsichtshalber für Proviant sorgen. Es wurde lange darüber diskutiert, was mit Dave und Siggi wäre und ob die beiden mitfahren sollten. Zuerst hieß es, dass die beiden nicht zur Familie gehörten und deshalb nach Hause fahren müssten. Nora und Lydia machten sich aber dafür stark, sie mitzunehmen, denn schließlich wären sie ihre Freunde und damit Quasi-Familienmitglieder.
Kamphusens fahren los
Klausners brechen auf
Der Zerberus
Auf Tolan
Die Tour ins Gebirge
Die Fahrt nach Nuville
Die Waldwanderung
Besuch bei den Nigren
In der Zeitblase
Zurück zur Siedlung
Der Wiederaufbau von Gudon
Die Fete bei Shirin und Brando
Nachwuchs bei Neea und Nuron
Stadtfest in Gudon
Grübeln über die Republik
Fete bei Trisa und Palo
Der Abschied
Wieder zu Hause
Impressum neobooks
Gerda und Jakob Brenker
Jakob Brenker war Landwirt am linken Niederrhein, er war ein stiller, in sich ruhender Zeitgenosse, der sich aber, wenn es darauf ankam, Gehör zu verschaffen wusste, und gelegentlich kam es im Haus seiner Familie zu lauten Ausbrüchen, wenn ihm seine Frau Gerda zu zickig kam oder seine Kinder über die Stränge schlugen. Familie Brenker hatte bei Schaephuysen, einem Dorf westlich von Moers, wo die Welt noch in Ordnung schien und alles seinen geregelten Gang ging, einen Hof. Das galt für eigentlich alle Ortschaften, die diesseits der Schaephuysener Höhen lagen. Jenseits dieser Höhen gab es Richtung Moers und noch weiter über den Rhein nur noch großstädtisches Wirrwarr, in dem der einzelne nicht wusste, wohin er gehörte.
Der Schaephuysener Höhenzug war insofern auch eine kulturelle Scheidelinie, beinahe noch mehr als der Rhein, und er war Teil des Niederrheinischen Höhenzuges, der sich in einem weiten Bogen durch das Rheintal von Krefeld bis nach Nimwegen zog und während der vorletzten Eiszeit geformt worden war. Genau gesagt befand sich der Hof der Brenkers in Saelhuysen, einer winzigen Bauernschaft, die von Schaephuysen aus direkt hinter dem Höhenzug lag und eigentlich mehr zu Schaephysen als zu Rheurdt gehörte. Aber das war Jakob Brenker egal, für ihn war wichtig, dass seine Kühe ordentlich Milch gaben, und dazu musste er ihnen gutes Futter geben, es spielte keine Rolle, ob das Futter auf Schaephuysener oder auf Rheurdter Boden wuchs. Sein Vieh gedieh prächtig auf den Weiden, und Jakob wurde schon einmal wegen seiner drallen Kühe bewundert, das ließ ihn immer stolz dreinschauen. Gerda Brenker war Hausfrau und kochte für ihr Leben gern, sie war nicht gerade eine Schwatztante, liebte es aber, mit ihrer Nachbarin vom Grefenhof über dieses und jenes zu plaudern, wenn sich die Gelegenheit bot, und sie bot sich so oft nicht. Denn das Leben auf dem Brenkerhof war ein einsames Leben, es spielte sich fernab von allen wichtigen Geschehnissen ab, die das Schaephuysener Geschehen bestimmten und wenn Jakob nicht ab und zu zu Bodden in die Gaststätte an der großen Kreuzung ging, dort im Thekengespräch die wichtigen Nachrichten hörte und seiner Frau übermittelte, bekäme sie kaum etwas von der sie umgebenden Welt mit.
Die beiden hatten zwei halbwüchsige Töchter im Alter von 16 und 17 Jahren, die das Julius-Stursberg-Gymnasium in Neukirchen-Vluyn besuchten und jeden Morgen mit ihren Rädern nach Schaephuysen fuhren, um von dort mit dem Bus zur Schule zu gelangen. Nora und Lydia hassten das Nest, in dem sie leben mussten, nicht gerade, aber sie würden lieber in einem belebteren Ort wohnen. Sie sehnten beide den Tag herbei, an dem sie mit der Schule fertig wären und sich von zu Hause verabschieden konnten. Sie gerieten sich regelmäßig mit ihren Eltern über diesen Punkt in die Haare, und alles, was ihrem Vater dazu einfiel, war zu sagen, dass sie doch erst mal Abitur machen sollten, danach sähe man schon weiter. Ihre Mutter hielt sich immer bedeckt und bedauerte im Grunde die starke Abneigung ihrer Töchter gegen ihren Heimatort. Aber wenn sie ehrlich war, musste sie gestehen, dass er für junge Mädchen wirklich nicht viel bot. Nora und Lydia hatten Freunde, die beide schon über 18 waren und jeder ein Auto hatten. Wenn sie die Mädchen besuchen kamen, fuhren sie anschließend meistens in die Disco, entweder ins E-Dry nach Geldern oder ins PM nach Moers. Dann waren Gerda und Jakob allein zu Hause, wie sie das in ein paar Jahren immer sein würden. Aber das machte ihnen nichts aus, sie fühlten sich miteinander wohl, es reichte ihnen, wenn sie zusammen saßen, sie mussten nicht groß miteinander reden.
Jakob las oder löste Sudokus und Gerda strickte oder stand in der Küche. Öfter sahen sie zusammen fern, sie schimpften über das schlechte Programm, das ihnen geboten wurde. Lediglich der Tatort am Sonntagabend war eine Sendung, die sie beide regelmäßig gern sahen. Dabei wurden sie nur ungern gestört und wenn Nora und Lydia dabei saßen, mussten sie ganz still sein oder rausgehen.
„Was schaut Ihr Euch bloß für einen Mist an?“, fragten sie manchmal im Hinausgehen, und die Alten ließen ihre vorwurfsvolle Frage im Raum stehen. Die Mädchen konnten nicht verstehen, dass es ihren Eltern nicht in erster Linie um den Film ging, sondern dass es für sie ein Ritus war, sonntagabends den Tatort zu sehen, dabei Knabbereien zu naschen und ein Bier oder ein Glas Wein vor sich stehen zu haben und diesem Ritus immer nachzugehen, egal was kam. Manchmal rief Jakob ihnen hinterher:
„Ihr braucht Euch den Film ja nicht anzusehen, aber lasst uns doch bitte in Ruhe schauen!“ Damit war die Sache dann meistens geklärt, die Mädchen gingen auf ihre Zimmer, hörten Musik oder kontaktierten ihre Facebook-Bekanntschaften, bevor sie aber oft um 23.00 h ins Bett gingen und schliefen. Der Nachbarort von Saelhuysen war Finkenberg und er war noch kleiner als Saelhuysen. Er bestand nur aus wenigen Höfen und niemand hätte dieser Bauernschaft eine Bedeutung zukommen gelassen, wenn es dort nicht die Quirinus-Kapelle gegeben hätte, die 1714 wiedererrichtet worden war und in diesem Jahr ihr 300-jähriges Bestehen feiern würde.
Diese kleine Kapelle war wie ein Leuchtturm inmitten des Nichts, sie wurde von allen hochgeschätzt und einmal im Jahr nahmen sich die Frauen aus Kengen, Finkenberg und Saelhuysen die Zeit und unterzogen die Kapelle einer Grundreinigung. Sie rückten die Bänke nach draußen und wienerten den Boden, anschließend schmückten sie den Altar mit Blumen. Und so fieberten sie alle der Jubiläumsfeier entgegen. Gerda fragte ihre Töchter, als sie mit ihnen beim Essen in der Küche saß:
„Kommt Ihr eigentlich mit Norbert und Rene auch zum Qurinus-Fest?“ Die beiden Mädchen hielten sich zunächst zurück, wie sie überhaupt immer sehr schweigsam waren, wenn sie aus der Schule nach Hause gekommen waren. Danach tauten sie aber auf und Nora antwortete:
„Ich muss zuerst noch mit Norbert über das Fest sprechen, ich glaube aber, dass wir beide hingehen werden. Lydia sagte:
„Auch Rene und ich werden an den Feierlichkeiten wohl teilnehmen, wir haben zwar noch nicht darüber geredet, aber ich denke schon, dass wir mitmachen!“ Die Quirinus-Kapelle galt als Kleinod am gesamten Niederrhein, besonders seit sie nach ihrer Renovierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts im neuen Glanz erstrahlte. Das Weihnachtssingen erfreute sich bei Katholiken und Protestanten gleichermaßen immer großer Beliebtheit. Die Festvorbereitungen waren in vollem Gange, es wurden im gesamten Umkreis Plakate aufgehängt und die Kapelle wurde mit Zweigen geschmückt. Der Weg zur Eingangstür wurde von einem langen Spalier aus Birkenzweigen gesäumt.
Das Schild beim Landhandel Pegels, das darauf hinwies, dass der Landhandel bis 1924 Baeshof hieß, war mit einem Plakat überklebt, das auf die 300-Jahr-Feier aufmerksam machte. An der Gaststätte Bodden an der großen Kreuzung und natürlich in Schaephuysen und in Rheurdt waren Plakate aufgehängt. In der Zeit vor dem Fest herrschten Aufmerksamkeit und Stille in den Gemeinden, wie man sie sonst nur selten dort antraf. Jakob Brenker zum Beispiel führte seine Kühe an die Melkmaschine, als gingen sie zu einem Gottesdienst, während er das sonst immer in großer Eile und Umtriebigkeit tat. Gerda putzte zwar zu Hause wie an jedem Tag, sie war dabei aber von einer Art inniger Sanftmut befallen und überaus glücklich.
„Wenn am Freitag Norbert und Rene bei uns sind, leihen wir uns noch zwei Räder und radeln alle zusammen nach Finkenberg!“, schlug Gerda ihren Töchtern vor und Nora und Lydia waren einverstanden. Alle machten sie sich für das Fest schön und die Frauen standen stundenlang vor dem Spiegel. Sie gingen zum Frisör und ließen sich für viel Geld die Haare richten.
Den Männern reichte es, gründlich zu duschen, ein Deo aufzulegen und gute Sachen anzuziehen. Gerda hatte festes und leicht angegrautes Haar, in das sie immer eine Tönung geben ließ. Sie ließ es im Abstand von sechs Wochen schneiden und tönen und ging dazu in die alte Molkerei nach Schaephuysen, die ein Kulturladen mit Frisör geworden war. Gerda war immer auf ein gepflegtes Äußeres bedacht, obwohl es bei ihrem bäuerlichen Leben nicht ganz einfach war, diesem Anspruch Genüge zu leisten. Sie lief alltags in Jeans herum, trug dazu aber gepflegte Oberteile, die sie elegant erscheinen ließen und ihrem Äußeren einen gewissen Pfiff gaben. Die beiden Mädchen kleideten sich stets nach dem, was gerade so angesagt war. Sie bestellten sich Sachen aus dem Internet oder sie fuhren mit Norbert und Rene sogar bis zum Centro nach Oberhausen. Beide hatten sie das feste Haar ihrer Mutter geerbt und trugen es kurz, sie waren groß, schlank und von besonderer Schönheit. Beide wollten in ihrer Anmut so gar nicht in ihr bäuerliches Umfeld passen. Sie schämten sich aber nicht etwa ihrer Herkunft oder zogen gar über Saelhuysen her, nein, sie waren in gewisser Weise sogar stolz darauf, aus einer Bauernschaft zu stammen und sich so von den anderen abgrenzen zu können.
„Wisst Ihr schon, was Ihr zu dem Fest anziehen werdet?“, fragte Gerda die beiden. Sie antworteten, dass sie um ihre Kleidung nicht so viel Aufhebens machen und das anziehen wollten, was sie auch immer in der Schule trügen.
„Ich werde mein dunkelblaues Kostüm und meine weiße Bluse dazu anziehen, die Sachen, die ich sonst immer nur an Weihnachten trage!“, verkündete Gerda. Jakob war ein stattlicher Mann, was sowohl seine Körpergröße als auch seinen Körperumfang anbelangte. Er war knapp 1.90 Meter groß und trug einen mächtigen Bauch vor sich her, der sich mit seiner Größe aber vereinbaren ließ, jedenfalls nach landläufiger Ansicht, und der deshalb nicht so sehr ins Auge stach. Am Tag des Festes stand er in seinem guten Anzug im Wohnzimmer und duftete sehr stark nach seinem Deo, sodass Lydia ihm sagte:
„Wenn Du so in den Stall gehst, werden sich die Kühe angewidert von Dir abwenden!“ Aber der Kommentar seiner Tochter ließ Jakob kalt, er hatte mit seiner Kleidung und dem Deo für das Fest seiner Meinung nach alles getan, was ihm möglich war. Er betrachtete sich in der Diele im Spiegel und war zufrieden mit sich. Norbert und Rene erschienen und waren ganz gewöhnlich gekleidet. Sie begrüßten Herrn Brenker und ihre Freundinnen, und alle stellten sich gemeinsam auf und warteten auf Gerda. Und als Gerda endlich auf der Bildfläche erschien, schauten sie alle ehrfürchtig auf die elegante Dame, die da zu ihnen kam und Nora stieß aus:
„Wow Mama, Du siehst ja umwerfend aus!“ und das dachten sie wohl alle. Gerda hängte sich bei Jakob ein und sie verließen das Haus, um auf die bereitstehenden Räder zu steigen.
Schon weit vor Finkenberg parkten die Autos derjenigen am Rand des schmalen Weges, die eine weitere Anreise hinter sich hatten und Jakob brachte seinen Unmut darüber zum Ausdruck.
„Sie hätten sich doch zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen können, statt alle mit dem eigenen Wagen anzureisen!“, meinte er. Vor der Quirinus-Kapelle standen an die hundert Personen, die natürlich nicht alle in das kleine Gotteshaus passten. Man hatte deshalb eine Lautsprecheranlage nach draußen legen lassen, und jeder konnte dort den Gottesdienst verfolgen. Es war eine Unzahl von Biertischen und Bänken aufgestellt worden und Familie Brenker setzte sich mit Norbert und Rene an einen freien Tisch nicht weit vom Grillstand entfernt. Sie grüßten nach überall hin, Gerda und Jakob kannten fast alle, die sich neben sie an die Biertische gesetzt hatten, und plötzlich wurde es still unter den Festgästen, und man hörte den Pfarrer in der Kapelle über die Lautsprecher reden. Er hatte sich wegen des ökumenischen Gehaltes, den die Feier trug, neutral, das hieß humanistisch ausgerichtet, und so konnte sich jeder angesprochen fühlen. Die Lieder, die gesungen wurden, waren Sommerlieder, deren Texte jedem noch aus der Schule geläufig waren wie zum Beispiel „Geh aus mein Herz und suche Freud“, und die alle aus Leibeskräften sangen.
Dann war der Gottesdienst zu Ende und die Menschen, die in der Kapelle einen Platz gefunden hatten, strömten nun nach draußen und gesellten sich zu den draußen Sitzenden.
„Können wir uns schon etwas zu essen holen?“, fragte Nora ihre Mutter und Gerda blickte in die Runde und hatte keine Einwände:
„Geht nur und holt Euch etwas vom Grill!“, sagte sie und gab ihrer Tochter 10 Euro. Am Bierstand hatte sich eine mächtige Schlange gebildet, Jakob stellte sich zusammen mit den beiden Jungen an und als er dran war, orderte er für alle Bier und trug die Getränke mit den Jungen zu ihrem Platz. Die Frauen waren auch Biertrinkerinnen, Nora und Lydia natürlich noch nicht so ausgeprägt, aber ein oder zwei Bier tranken auch die Mädchen. Inzwischen waren die Bierbänke bis auf den letzten Platz belegt, alle waren guter Dinge und aßen und tranken, und als später auch Schnaps auf den Biertischen stand, und die Männer miteinander anstießen, immer wieder, bis sie auch mit dem letzten Bekannten angestoßen hatten, machten sich bei ihnen doch erste Ermüdungserscheinungen breit. Die Frauen hielten sich bei dem Schnaps zurück, und es waren nur die Männer, die sich bald bis zur Bewusstlosigkeit besoffen und von denen manche aggressiv wurden. Das hatte Jakob schon bei Bodden erlebt, dass sich manche so besoffen, dass sie sich miteinander schlugen. Der Grund war gar nicht immer nachvollziehbar, aber immer war Schnaps im Spiel.
Jakob war am Ende beinahe der einzige, der von den Männern noch ansprechbar war, und bevor die Situation vor der Kapelle völlig eskalierte, radelte Familie Brenker mit Norbert und Rene nach Hause. Der Pfarrer, der es lange bei den Festgästen ausgehalten hatte, war schon längst gegangen. Am nächsten Morgen saßen bei Brenkers alle beim Frühstück und unterhielten sich über den Vorabend, Norbert meinte:
„Da haben einige ganz schön getankt und sind aggressiv geworden, wir haben so etwas schon in den Discos erlebt, das Beste, das man als Außenstehender dann tun kann, ist zu gehen.“
„Genau so sehe ich das auch“, sagte Jakob, „ich habe so etwas auch schon bei uns in der Gaststätte erlebt und bin einfach abgehauen, genau wie wir das gestern getan haben.“
„Ich verstehe die Männer auch nicht, die sich so besaufen wie die gestern Abend“, sagte Gerda, „habt Ihr den Verkäufer von Pegels gesehen, der war mit der Erste, der sich völlig daneben benommen hat, als wir gingen, habe ich ihn in seinem Erbrochenen liegen gesehen.“ Die Kapellenfeier zog sich über insgesamt drei Tage hin und Gerda und Jakob würden am Abend noch einmal nach Finkenberg fahren und feiern. Die jungen Leute lehnten es aber ab, noch einmal nach Finkenberg zu fahren, sie wollten am Abend lieber ins PM nach Moers. Jakob ging mit Gerda in den Stall zu den Kühen, um sie an die Melkmaschine anzuschließen und weil die jungen Leute noch da waren und einmal schauen wollten, gingen sie mit in den Stall.
Norbert und Rene kamen beide aus Neukirchen-Vluyn und waren deshalb mit der Landwirtschaft nicht so vertraut. Nora und Lydia waren beide auf dem elterlichen Hof aufgewachsen und kannten deshalb natürlich die Tiere. Jakob hatte 60 Kühe im Stall stehen, von denen aber nur ein Teil mit der Melkpumpe gemolken wurde, während die anderen Tiere fraßen, bis auch sie mit Melken dran waren. Danach wurde die Tiere auf die Weide geführt und die nächsten 60 Kühe kamen an die Reihe. So ging es reihum, bis alle 204 Kühe von Bauer Jakob gemolken waren. Die Jungen schauten interessiert zu und Rene fragte:
„Wurden etwa früher alle Kühe von Hand gemolken?“ und Jakob antwortete:
„Eine andere Möglichkeit gab es nicht, die Bauern hielten sich deshalb viel weniger Kühe als wir heute, damit sie mit dem Melken überhaupt nachkamen.“ Gerda nahm die jungen Leute beiseite und ging mit ihnen zu einer einzeln stehenden Kuh, nahm einen Melkeimer und einen Melkschemel, auf den sie sich neben das Euter der Kuh setzte und fing an, mit der Hand zu melken. Nora und Lydia hatten das früher schon einmal probiert und waren dabei kläglich gescheitert. Denn man konnte nicht einfach an der Zitze ziehen, sondern man musste sie in einer speziellen Art greifen und nach unten abstreifen. Das erforderte einige Übung, konnte aber schnell gelernt werden.
„Darf ich das einmal ausprobieren?“, fragte Norbert Noras Mutter. Sie bot ihm den Platz auf dem Melkschemel an und Norbert setzte sich neben die Kuh und griff nach ihren Zitzen. Als ihm aber plötzlich der Schwanz der Kuh ins Gesicht gewedelt wurde, und die Kuh ordentlich Fladen abließ, hatte Norbert schnell genug und stand unverrichteter Dinge wieder auf. Die jungen Leute verließen den Stall wieder und gingen ins Haus zurück, Jakob und Gerda blieben allein bei den Kühen. Beide schoben sie mit Gabeln frisches Gras zusammen, das Jakob seinen Tieren vor ihre Boxen gelegt hatte. Als Gerda mit ihrer Gabel an einer Bohle oder etwas Ähnlichem auf dem Stallboden hängenblieb und nachschauen wollte, was da los war, kam Jakob zu ihr und sagte:
„Lass nur, ich mache hier weiter, geh Du nur darüber!“ und er blickte seine Frau dabei nicht an, sondern richtete seine Augen auf das Hindernis auf dem Stallboden, das Gerdas Gabel festgehalten hatte. Am frühen Nachmittag kehrten auch die beiden ins Haus zurück und Gerda stellte einen großen Topf mit Erbsensuppe und Speck mit Würstchen auf den Tisch, und sie rief die jungen Leute zum Essen. Gerda hatte die Erbsensuppe schon vorbereitet, es gab samstags bei Brenkers oft einen Eintopf, und den mochten in der Regel auch alle gern.
Am Abend fuhren Gerda und Jakob noch einmal mit ihren Rädern nach Finkenberg und setzten sich dort vor der Kapelle wieder an einen Biertisch. Es war an diesem Abend bei Weitem nicht mehr so viel los wie am Vorabend, und es ging auch insgesamt gesitteter zu. Zwar wurde wieder viel getrunken, auch Schnaps, aber es kam nicht zu diesen besinnungslosen Ausfällen wie am Vorabend, und niemand wurde aggressiv.
Sie sangen wieder alle Sommerlieder und waren vergnügt, an Gerdas und Jakobs Tisch saßen ihre Nachbarn vom Kloutenhof, und sie hatten Spaß zusammen und unterhielten sich. Die beiden hatten auch zwei Töchter, die in etwa das Alter von Nora und Lydia hatten, aber die vier hatten nie zusammengefunden, niemand wusste, warum das so gekommen war, aber als Erwachsener konnte man sich in solche Beziehungsgeschichten bei den jungen Leuten ohnehin nicht einmischen. Sie saßen wieder bei dem Gegrillten und aßen nach Herzenslust, und als der Pfarrer gegen 22.00 h das Fest verließ, machten Brenkers auch nicht mehr allzu lange. Jakob holte noch einmal Bier und fuhr gegen 23.00 h mit seiner Gerda nach Hause.
„Das war aber heute Abend bedeutend erträglicher als gestern“, sagte Gerda und Jakob stimmte ihr zu:
„Das lag daran, dass nicht so viel Schnaps getrunken wurde, der eben viele aggressiv macht, und die großen Schnapstrinker fehlten heute Abend.“ Eigentlich fand am Sonntag die letzte Feier an der Kapelle statt, aber Gerda und Jakob verzichteten auf den Besuch und blieben zu Hause. Als in der Folgewoche Lydia mit einer verhauenen Klausur nach Hause kam, und Gerda sie in Schutz nahm mit den Worten:
„Es gibt Schlimmeres, davon geht die Welt nicht unter!“, Jakob gerade in der Küche saß und Zeuge der schlechten Nachricht wurde, konnte man Jakob mit einem Mal erleben wie sonst nur ausgesprochen selten.
„Wie kannst Du es wagen, mit so einer schlechten Klausur nach Hause zu kommen!“, schrie er Lydia an, dabei schwollen seine Halsschlagadern an und sein Gesicht verfärbte sich rot.
„Und Du spielst das auch noch herunter!“, bölkte er seine Frau an, und seine Stimme überschlug sich fast. Sein Gegröle erreichte eine Lautstärke, dass man ihn noch draußen hätte hören können, wenn da jemand gewesen wäre. Aber Brenkers wohnten weitab vom Schuss, und so verhallte Jakobs Geschrei über den Wiesen. Lydia war ganz in sich gesunken und hatte zu weinen angefangen, ihre Mutter nahm sie in ihre Arme und tröstete sie. Jakob, der sich immer noch nicht ganz beruhigt hatte, stand auf und verließ unter lautem Poltern die Küche. Das war ein Ausbruch bei Jakob gewesen, der so gar nicht zu dem Gemütsmenschen passen wollte, aber wenn es ihn einmal packte, konnte er eben auch so ein Ekelpaket sein. Nach ein paar Stunden hatten sich die Wogen aber wieder geglättet, und auch Lydia hatte sich wieder beruhigt. Sie war auch weniger wegen ihrer schlechten Klausur ins Weinen verfallen als vielmehr wegen des Ausrastens ihres Vaters, der sie erschrocken hatte, so wie er da quasi neben sich gestanden war.
Gerda fuhr für ihre Einkäufe immer zu Edeka nach Aldekerk und freute sich darauf, einmal in der Woche dorthin zu kommen und die Frauen von den Nachbarhöfen zu treffen, mit denen sie sich vorher verabredete. Sie kauften alle die Dinge des täglichen Bedarfs und zog den Einkauf bewusst in die Länge, was in dem riesigen Laden, den Edeka da vor das Dorf gesetzt hatte, auch kein Problem war. Im Anschluss gingen die Bauersfrauen immer noch Kaffee trinken und ein Stück Kuchen essen, und dabei wurde unendlich viel erzählt. Sie redeten vor allem über das vergangene Kapellenfest und die vielen Schnapsleichen, die dort zu verzeichnen gewesen waren.
„Habt Ihr auch den Verkäufer von Pegels in seinem Erbrochenen liegen gesehen?“, fragte Gerda ihre Freundinnen, und jede brachte ihren Abscheu vor dieser Unbeherrschtheit zum Ausdruck. Sie kamen am Ende auf ihre Kinder zu sprechen und Gerdas Nachbarinnen erzählten, dass ihre Kinder ganz gut auf den Schulen zurecht kämen bzw. erfolgreich ihre Ausbildung absolvierten. Ein Junge lernte bei Trox in Vluyn Industriekaufmann, er hatte vorher die Realschule besucht und war glücklich mit seiner Ausbildung. Sein Vorteil war, dass er gleich über Geld verfügte und sich ein Auto leisten konnte. Der andere Junge lernte Außenhandelskaufmann bei De Beukelaar in Kempen und war ebenfalls sehr zufrieden mit seinem Werdegang. Die anderen Kinder besuchten Schulen wie Nora und Lydia, manche in Geldern und andere in Neukirchen-Vluyn.
„Was unsere Nora und unsere Lydia einmal werden wollen, steht noch völlig in den Sternen“, sagte Gerda, „so viel Zeit haben sie schließlich nicht mehr, aber ich denke, dass sie beide von zu Hause ausziehen und studieren werden.“
„Da geht es ihnen wie unseren, bei denen auch alles noch unsicher ist, aber das wird sich schon einrenken und sie werden einen Studiengang ergreifen, der sie zufriedenstellt.“ Solche Zusammenkünfte wie die im Cafe in Aldekerk erfüllten die Bauersfrauen immer mit großer Zufriedenheit, und sie gaben ihnen Energie, von der sie zehren konnten, wenn sie wieder zu Hause waren. Jakob merkte diesen Energieschub seiner Frau immer an und er freute sich für sie. Es war ihm schon klar, dass der Hof allein Gerda nicht ihr Lebensglück bescheren konnte, von dem sie träumte, aber es gab ja auch noch ihre Kinder und deren schulischen Erfolg, über den sie sich freuen konnte, wenn es auch gelegentlich einige Rückschläge gab, aber die konnte Gerda ohne Probleme verschmerzen, und auch Jakob würde noch damit umzugehen wissen.
Ute und Paul Kamphusen
„Paul, beeil Dich mal ein bisschen, wir fahren in zwei Minuten runter!“, riefen Paul seine Arbeitskollegen in der Kaue zu und Paul hängte seine Sachen an den Haken, der an einer Kette befestigt war, und den er bis oben an die Decke hochzog. Daraufhin nahm er seinen Grubenhelm mit der an ihm fixierten Grubenlampe, richtete seine Bergmannszunft und lief zum Förderkorb, wo schon seine Arbeitskollegen auf ihn warteten, um mit ihm nach unten auf 1000 Meter zu fahren und ihre Mittagsschicht zu beginnen. Paul Kamphusen war Bergmann auf der Zeche Zollverein in Essen-Katernberg und fuhr täglich mit seinen Kumpels unter Tage, um dort Kohle zu machen. Sein Job war sehr anstrengend und Außenstehende können sich kaum vorstellen, was es bedeutete, in 1000 Meter Tiefe in großer Hitze und bei sehr viel Staub schwere körperliche Arbeit verrichten zu müssen. Paul war 43 Jahre alt und wohnte mit seiner Familie in einem Zechenhäuschen in Katernberg, es war ein kleines Häuschen und seine beiden Kinder Pascal und Jennifer, die 16 und 17 Jahre alt waren und das Leibniz-Gymnasium besuchten, hatten unter dem Dach jeweils ein Minizimmer, in das ein Bett, ein Schrank und mit viel Mühe auch noch ein kleiner Schreibtisch passten. Paul und seine Frau Ute mussten sich im Erdgeschoss mit einem überschaubar großen Wohnzimmer und einem Schlafraum begnügen. Paul Kamphusen war Bergarbeiter und sein Körper war von den Strapazen während seiner Arbeit gezeichnet. Er hatte einen Haltungsschaden, den er nur mit viel Geschick kaschieren konnte, wenn er ging und sich in die Vertikale zwang.
In unbeobachteten Momenten sackte er aber mit schmerzverzerrtem Gesicht in sich zusammen und klagte über Rückenschmerzen. Vor drei Jahren war er Opfer eines Grubenunglücks, das sich auf Zollverein zugetragen hatte, und bei dem ihm ein großes Stück Fels auf den Körper geschleudert worden war. Er hatte aber Glück und wurde von den Rettungsmannschaften, die schnell vor Ort gewesen waren, nach oben und ins Krankenhaus gebracht, wo man sich gleich um ihn kümmerte. Eigentlich hätte er in den Vorruhestand geschickt werden müssen, es gelang ihm aber unter Aufbietung aller ihm zur Verfügung stehenden Kräfte, den Eindruck vor dem Belegschaftsarzt zu erwecken, dass es nicht so schlimm um ihn bestellt war, wie alle zunächst dachten, und sein Beschäftigungsverhältnis wurde aufrechterhalten. Denn mit 43 in den Vorruhestand zu gehen, das war für Paul eine Vorstellung, mit der er sich überhaupt nicht anfreunden konnte, und alle Arbeitskollegen freuten sich, ihn nach seiner Genesung wieder in ihrer Runde begrüßen zu können. Denn Paul war ein von allen geachteter und guter Bergmann, der zwar ein wenig spröde und manchmal auch ernst war, auf den man sich aber hundertprozentig verlassen konnte, und der ein gutes Herz hatte. Die Zeche Zollverein war in dem Zeitraum ihrer Kohleproduktion eine der modernsten Steinkohlezechen Europas und sie hatte eine Förderleistung von 3 Millionen Tonnen jährlich. Ihr war eine Kokerei angeschlossen, die ebenfalls als eine der modernsten Anlagen Europas galt, und in der täglich 10000 Tonen Steinkohle zu 8600 Tonnen Koks veredelt wurden.
Koks war der Brennstoff für die Hüttenwerke der Umgebung im näheren und weiteren Ruhrgebiet. Aufgrund der Stahlkrise und der fallenden Koksnachfrage wurde der Kokereibetrieb später eingestellt. Die Zeche lief auf Hochtouren und die Kumpels hatten unter Tage zu tun und überboten sich täglich in der Tagesfördermenge. Auch Paul war immer daran interessiert, ein gutes bis sehr gutes Tagesergebnis abzuliefern, und er befand sich dabei in Konkurrenz zu seinen Arbeitskollegen, die diese Konkurrenz aber nie negativ auffassten, sondern als gesunden Ansporn ansahen. Immer wenn Paul nach der Frühschicht mit dem Förderkorb hochfuhr und sich in der Kaue den Schmutz abgeduscht hatte, fuhr er danach mit seinem Fahrrad nach Hause, wo Ute mit dem Essen auf ihn wartete. Manchmal saßen Jennifer und Pascal mit am Tisch, es kam aber nie vor, dass sie ihren Vater nach seiner Arbeit fragten. Umgekehrt interessierte es Paul aber schon, zu wissen, wie die Leistungen seiner Kinder auf dem Gymnasium waren. Er konnte aber nur die Noten der beiden zur Kenntnis nehmen, inhaltlich sich mit Jennifer und Pascal über die Schule auseinanderzusetzen, dazu sah er sich nicht in der Lage, und das wussten die beiden natürlich. Sie schwammen im Mittelfeld mit und hatten keine Bedenken, das Abitur zu schaffen. Ihre Mutter war für sie schon eher eine Ansprechpartnerin im Hinblick auf das Gymnasium, wenngleich auch sie nicht verstand, worum es bei ihren Kindern in den einzelnen Unterrichtsstunden überhaupt ging.
Aber darauf kam es Jennifer und Pascal gar nicht an, für sie war es wichtig zu wissen, dass es jemanden gab, dem sie sich anvertrauen konnten, und dazu war Ute immer bereit. Wenn Paul Mittagsschicht hatte, musste er um 14.00 h auf der Zeche anfangen und arbeitete bis 22.00 h, hatte er Nachtschicht, dauerte sie von 22.00 h abends bis 6.00 h morgens. Der Schichtdienst hatte längst seinen Biorhythmus völlig durcheinandergewirbelt, und auch das ging auf seine Gesundheit. Er hatte ganz ungewöhnliche Schlafenszeiten, so ging er nach seiner Nachtschicht am frühen Morgen, wenn seine Kinder zur Schule aufbrachen, ins Bett und wenn er Nachtschicht hatte, ging er zur Arbeit, wenn Jennifer und Pascal kurze Zeit später schlafen gingen. Er war aber bei guter körperlicher Konstitution, wenn man einmal von seinen Rückenbeschwerden wegen des Arbeitsunfalls absah. Ute half an jedem zweiten Tag in einem Altenheim, das sich zwei Straßen weiter von ihrem Zuhause befand, und obwohl sie keine ausgebildete Pflegekraft war, verstand sie es, sich liebevoll um die alten Menschen zu kümmern, und ihr Dienst wurde von ihnen dankbar angenommen. Alle mochten Ute und Ute hatte eine Engelsgeduld, wenn sie mit ihnen Mensch-ärgere-Dich-nicht spielte.
Sie empfand Erfüllung dabei in ihrem ansonsten nicht sehr ausgefüllten Alltag. Die Tätigkeit im Altenheim war genau das, worin Ute den Sinn ihres Lebens sah. Es erfüllte sie mit großer Freude zu sehen, wie die Alten aufblühten, wenn sie sich ihnen widmete. Ute kam selbst wie gelöst vom Altenheim nach Hause und hatte positive Energie getankt, die sie allen zuteil werden lassen konnte, und Jennifer und Pascal, aber auch Paul registrierten ihre gewonnene Stärke mit Zufriedenheit. In ihrer Freizeit unternahmen Ute und Paul nie etwas Besonderes, danach stand den beiden nicht so sehr der Sinn. Höchstens, dass sie mal in ihre Kneipe um die Ecke gingen, dort zwei Stauder tranken und sich mit Bekannten unterhielten, meistens über Rot-Weiß-Essen. Paul war früher öfter im Georg-Melches-Stadion gewesen und hatte sich die Spiele seines Vereins angesehen, manchmal war Ute mitgegangen. Er hatte seine Stadionbesuche aber völlig eingestellt erstens, weil sein Verein abgestiegen war und nur noch in der vierten Liga spielte und zweitens, weil er sich zu müde fühlte, um geschlagene zweieinhalb Stunden auf der Tribüne zu stehen, und ein Sitzplatz war ihm zu teuer. Die Kinder waren nie mit ins Stadion gegangen, sie interessierten sich nicht für Fußball, ihre Interessen im Sport lagen bei Reiten und Basketball, und ansonsten saßen sie vor ihren Computern. Das einzige, das Paul neben seinem Beruf noch ernsthaft betrieb, war seine Gewerkschaftsarbeit, er war als Funktionär der IGBE Betriebsrat auf der Zeche Zollverein und als solcher Ansprechpartner aller dort Beschäftigten, wenn es um Konflikte mit der Betriebsleitung ging.
Paul nahm diese Funktion sehr ernst, und er arbeitete gewissenhaft an der Erfüllung seiner Aufgaben. Einmal im Monat ging er auf einen Gewerkschaftsabend oder zu Schulungen. Er hielt auf Zollverein Sprechstunden ab, in denen seine Arbeitskollegen zu ihm kommen und ihr Leid klagen konnten. Paul war stolz, als Gewerkschafter Ansprechpartner für seine Kollegen sein zu dürfen, und auch Ute sah es gern, wenn er dieses Amt wahrnahm. Die Zukunft der Zeche Zollverein sah nicht sehr rosig aus, wie allgemein bekannt war. Es gab ausländische Kohle auf dem Markt, die zum Beispiel aus Australien kam und trotz des Seeweges um die halbe Erde und trotz ihres Transportes von Rotterdam nach Duisburg-Ruhrort billiger zu haben war als die heimische Kohle. Das lag im Falle der australischen Kohle daran, dass sie im Tagebau gefördert wurde, was die Förderkosten auf ein Minimum reduzierte. Andere Herkunftsländer der Kohle verzichteten auf Sicherheitsvorkehrungen, die in Deutschland unter Tage getroffen werden mussten. Das machte die Kohleförderung natürlich auch billiger, war aber für die Kumpels vor Ort weitaus gefährlicher. Dieses Weltmarktungleichgewicht bedrohte mittelfristig die deutsche Kohleförderung und machte den Kumpels Angst, denn sie drohten arbeitslos zu werden.
Auch Paul sah selbstverständlich die nicht sehr guten Zukunftsaussichten für seine Zeche, meinte aber, dass man nicht so sehr an die Zukunft denken, sondern lieber seine Tagesarbeit abliefern sollte, und das sagte er auch allen Kumpels in seiner Sprechstunde. Denn warum sollten sie Trübsal blasen mit der Arbeit vor ihrer Brust, der Tag des Produktionsstillstandes käme für sie noch früh genug. Auch Ute war gelegentlich besorgt, wenn sie in die Zukunft blickte, aber Paul wusste sie immer zu beruhigen und verwies darauf, dass er notfalls in den Vorruhestand gehen würde, wenn er vernünftig abgefunden werden würde. Eines Tages geschah etwas in seiner Sprechstunde, das er so schnell nicht vergessen würde. Ein junger Auszubildender kam zu ihm, Dieter Siemkes war sein Name und klagte ihm sein Leid, er wäre unter Tage beim Rauchen erwischt und sofort entlassen worden. Für Paul war die Sache eigentlich sofort klar und er wusste, dass er Dieter nicht würde helfen können, denn Rauchen unter Tag war das Schlimmste, was man sich zu Schulden kommen lassen konnte, und das wusste jeder, der unter Tage arbeitete. Es war nicht nur so, dass überall auf Schildern ein Rauchverbot ausgesprochen wurde, besonders die Auszubildenden wurden beinahe täglich darauf aufmerksam gemacht, wie gefährlich es war, unter Tage zu rauchen.
Denn dort kam es in regelmäßigen Abständen zu Methangaskonzentrationen, und wenn das der Fall war, musste der Schacht sofort gut gelüftet werden, und alle Arbeit musste in der Zeit ruhen. Das Tückische am Methangas war, dass es unsichtbar, geruchlos, giftig und hochexplosiv war. Es reichte ein nur kleiner Funke, und man hatte eine Schlagwetterexplosion, wie man eine Explosion von Methangas auch nannte, der schon viele Kumpels zum Opfer gefallen waren. Dass unter diesen Umständen absolutes Rauchverbot unter Tage herrschte, war jedem unmittelbar einsichtig und musste eigentlich nicht noch gesondert hervorgehoben werden. Dennoch predigten die Ausbilder den Auszubildenden mehrmals täglich, dass sie unter Tage nicht rauchen durften. Aber die Auszubildenden waren jung und hielten sich nicht gern an Verbote, noch dazu übten Verbote einen ganz besonderen Reiz aus, sie zu übertreten. Dieter Siemkes war 18 Jahre alt und im dritten Lehrjahr als Anlagenmechatroniker, er hätte noch ein halbes Jahr bis zu seiner Gesellenprüfung gehabt und ihn traf seine Entlassung deshalb besonders hart. Natürlich würde Paul sich für Dieter verwenden und alles in Bewegung setzen, um die Entlassung wieder rückgängig zu machen. Er sagte Dieter aber gleichzeitig, dass er sich keine übertriebenen Hoffnungen machen dürfte, er hätte so ziemlich das Schlimmste getan, was man unter Tage hätte tun können. Dieter hörte sich an, was Paul ihm sagte und ließ den Kopf hängen.
„Dann werde ich meine Sachen packen und gehen!“, sagte er zu Paul.
Aber Paul wollte nicht so leicht aufgeben und sagte zu Dieter:
„Warte ab, ich will noch ein Gespräch mit dem Reviersteiger führen, und erst wen der sagt, dass Deine Entlassung unumstößlich ist, wirst Du wohl gehen müssen!“
Paul rief den Reviersteiger an und verabredete sich mit ihm zu einem Gespräch unter vier Augen, das am nächsten Tag stattfinden sollte. Dieter ging betrübt nach Hause und würde abwarten müssen, was das Gespräch zwischen dem Steiger und Paul am nächsten Tag bringen würde. Paul erzählte Ute von Dieters Vergehen unter Tage und Ute hatte kein Verständnis für den Auszubildenden:
„Selbst schuld, kann ich da nur sagen, den Auszubildenden wird doch quasi permanent gesagt, dass sie unter Tage nicht rauchen dürfen, Dieter hat sich seine Entlassung selbst zuzuschreiben!“ Aber Paul ließ sich von seinem Vorsatz, in dem Gespräch mit dem Steiger alles zu versuchen, um die Entlassung noch abzuwenden, nicht abbringen. Am nächsten Tag traf er mit dem Reviersteiger Lezek Nizkowski zusammen, einem Polen, der in Deutschland geboren war und eine Bergbaukarriere hingelegt hatte, die ihresgleichen suchte: in zwölf Jahren vom Auszubildenden zum Reviersteiger und das bei den anfänglichen Sprachschwierigkeiten, mit denen er zu tun hatte. Lezek wohnte nicht weit von Paul entfernt, die beiden hatten privat aber kaum einmal etwas miteinander zu tun.
„Ich habe schon gehört, warum Du zu mir gekommen bist, lass es Dir gleich zu Anfang sagen: von meinem Entschluss, den Auszubildenden zu entlassen, lasse ich mich von Dir nicht abbringen“, sagte Lezek zur Eröffnung des Gesprächs.
„Du warst selbst einmal Opfer einer Schlagwetterexplosion und müsstest mir Recht geben!“
„Lezek, lass mich erklären, Du hast natürlich Recht, der Junge hat den größten Fehler gemacht, den man unter Tage nur machen kann, aber sieh doch, wir können ihm doch nicht seine Zukunft verbauen, er würde in einem halben Jahr seine Gesellenprüfung ablegen und wäre fertig, glaub mir, er würde sich am liebsten selbst in den Arsch beißen, weil er so ein Hammel gewesen ist!“, entgegnete Paul. Lezek ging in seinem Büro auf und ab, es arbeitete in ihm, das konnte man sehen und nur dem Umstand, dass er selbst Kinder in Dieters Alter hatte und sich in etwa in deren Wahrnehmungsweise hineinversetzen konnte, war es zu verdanken, dass er schließlich klein beigab und sagte:
„Sag Deinem Azubi, dass er bei der geringsten Kleinigkeit, die er sich in Zukunft erlaubt, fliegt, ansonsten soll er seine Ausbildung fortsetzen!“ und Lezek stürmte aus seinem Büro. Paul fiel ein Stein vom Herzen, er wusste, dass Lezek nicht so hartherzig sein und Dieter einfach davonjagen konnte, und er hatte sich in ihm nicht getäuscht.
Er bestellte Dieter am Nachmittag zu sich und setzte die ernsteste Miene auf, die er nur aufsetzen konnte, und als er Dieter Lezeks Entschluss verkündete, kam Dieter auf ihn zu und fiel ihm um den Hals.
„Ich werde der beste Azubi sein, den Sie sich nur wünschen können!“, versprach er und war aus ganzem Herzen glücklich.
„Dann geh mal wieder an Deine Arbeit!“, sagte ihm Paul, und Dieter stürmte gleich los zur Kaue, zog sich um und fuhr unter Tage. Paul war zufrieden mit dem Ausgang des Konflikts um die drohende Entlassung von Dieter, und als er zu Hause Ute davon erzählte, sagte sie:
„Hoffentlich enttäuscht Euch der Junge nicht!“ Aber Paul war fest davon überzeugt, dass Dieter in dem verbleibenden halben Jahr seiner Ausbildung alles geben würde. In letzter Zeit machte ihm sein altes Rückenleiden doch sehr zu schaffen und Paul war bei seinem Orthopäden in Therapie, der sich Röntgenbilder von seinem Rücken ansah und ihm sagte:
„Sie haben bei der Schlagwetterexplosion vor drei Jahren eine leichte Fraktur der Wirbelsäule davongetragen, an der Bruchstelle haben sich Knorpel gebildet, die den Wirbelkanal verengen und den Nerv reizen, dadurch entstehen ihre Schmerzen.
„Was kann ich dagegen tun?“, fragte Paul den Orthopäden und der antwortete ihm klipp und klar:
„Da hilft nur eine Operation, bei der der Knorpel weg gefräst und vielleicht zur Stabilisierung eine kurze Schiene an die Wirbelsäule angebracht wird, lassen Sie sich die Sache durch den Kopf gehen, der operative Eingriff dauert nur zwei Stunden, danach werden Sie für zwei Wochen stationär aufgenommen und fahren anschließend für drei Wochen in die Reha, voll belastbar sind Sie dann erst wieder nach einem Vierteljahr, ich rate Ihnen, warten Sie mit der Operation nicht zu lange!“ Paul war dem Orthopäden für seine klaren Worte dankbar und besprach zu Hause mit Ute, was er denn tun sollte. Ute sagte ihm sofort, dass er sich operieren lassen und sich schon am nächsten Tag einen Einweisungsschein beim Orthopäden holen sollte. Bevor sich Paul für zwei Wochen ins Krankenhaus verabschiedete, nahm er in seinem Büro ein Päckchen aus seiner Schreibtischschublade und versteckte es zu Hause in seinem Gartenschuppen. Die Operation verlief vollkommen komplikationslos und Paul genoss die zwei Wochen, in denen er nach der Operation im Krankenhaus umsorgt wurde. Ute besuchte ihn jeden zweiten Tag und auch seine Arbeitskollegen schauten bei ihm vorbei und brachte ihm eine Kleinigkeit mit, eine Tafel Schokolade oder eine Flasche Wein. Einmal klopfte es an seine Zimmertür, und nachdem er zweimal „Herein!“ gerufen hatte und sich immer noch nichts tat, stand er auf und spürte zum ersten Mal seit Langem keine Schmerzen in seinem Rücken. Er freute sich und öffnete die Zimmertür von innen, und da stand Dieter Siemkes mit einem Blumenstrauß und wusste nicht, was er sagen sollte.
„Das ist ja schön, dass Du mich mal besuchen kommst, komm mit rein und setz Dich neben mein Bett!“, sagte Paul zu Dieter und nahm ihm die Blumen ab.
„Wie läuft es denn so auf Zollverein?“, fragte er den Azubi und Dieter antwortete:
„Ich gehe jetzt nochmal so gern zur Arbeit, und das habe ich nur Ihnen zu verdanken!“
„Na lass mal gut sein“, entgegnete Paul, „erzähl mir doch mal, was Ihr gerade in der Berufsschule durchnehmt!“
„Wir sprechen gerade über Geothermie und ihre Nutzung durch die Privathaushalte“, antwortete Dieter, „und wenn man sich einmal überlegt, bei welchen Temperaturen wir auf 1000 Meter arbeiten, fragt man sich schon, warum nicht schon früher jemand auf den Trichter gekommen ist, die Wärme nach oben zu leiten!“ Paul und Dieter unterhielten sich lange über diesen Punkt, und Paul dachte nur, dass er schon lange nicht mehr über Geothermie geredet hatte, eigentlich seit seiner eigenen Ausbildung nicht mehr. Nach eineinhalb Stunden verließ Dieter ihn wieder mit den besten Genesungswünschen und Paul verbrachte noch drei Tage in dem Krankenhaus, die ihm nicht langweilig vorkamen, er hatte sich mit Lesestoff eingedeckt und wusste sich auch mit seinem Zimmernachbarn zu unterhalten, abends sahen sie immer fern. Nach seiner Entlassung stand eine Reha-Kur an, die die Knappschaft bezahlen würde.
Er sprach mit dem Orthopäden darüber, dass die Kur auf Borkum stattfinden sollte, Ute käme mit und hätte drei Wochen Urlaub. Die Kinder waren alt genug, dass man sie in der Zeit allein lassen konnte, Ute kochte für sie vor und fror das Essen ein, das Jennifer und Pascal sich nur in der Mikrowelle erhitzen mussten. Es war Spätsommer geworden und Ute und Paul ließen es sich auf Borkum gut gehen, sie machten lange Strandspaziergänge und fühlten sich rundum wohl. Es kam die Sprache darauf, was mit Paul geschähe, wenn auf Zollverein die Kohleförderung eingestellt werden würde, und Ute fragte ihn direkt:
„Hast Du Dir schon einmal Gedanken über die Zeit nach Zollverein gemacht?“ Paul hatte es bis dahin immer vermieden, darüber zu sprechen, er schob seine Entscheidung, die unabdingbar bevorstand, vor sich her, er wollte einfach nicht wahrhaben, dass die Zeit des Kohleabbaus bald beendet sein sollte. Er war 43 Jahre alt und damit eigentlich viel zu jung, sich aufs Altenteil zu setzen, aber er wusste selbst nicht, wie die Zechenleitung mit den Kumpels in seinem Alter zu verfahren gedachte, er wollte den Tag X auf sich zukommen lassen. Die drei Wochen auf Borkum waren sehr schnell um, zu schnell wie Ute und Paul fanden, und sie beschlossen, im nächsten Sommer einmal Urlaub auf Borkum zu machen.
Als sie wieder zu Hause waren, nahm Paul seine Arbeit wieder auf, er achtete darauf, dass er dabei mit reduzierter Kraft vorging, wie ihm das der Orthopäde gesagt hatte. Man nahm auf der Zeche Rücksicht auf ihn und setzte ihn für leichte Tätigkeiten ein, er verbrachte auch schon einmal eine Schicht über Tage. Und dann kam im Frühjahr 1986 der Tag, an dem allen Kumpels auf Zollverein mitgeteilt wurde, dass der Betrieb zum Jahresende auslaufen würde, und jeder sich mit dem Gedanken vertraut machen sollte, seinen Arbeitsplatz zu verlieren. Was mit jedem einzelnen geschehen würde, sollten alle beim Betriebsrat in Erfahrung bringen. Die Betriebsräte, also auch Paul, wurden in gesonderten Veranstaltungen darauf vorbereitet, ihre Kollegen kompetent zu beraten, was sie tun sollten, wenn ihre Arbeit auf Zollverein beendet wäre. Für die meisten käme eine Arbeit auf einer anderen Zeche in Frage und das waren Niederberg in Neukirchen-Vluyn, Friedrich-Heinrich in Kamp Lintfort und Prosper-Haniel in Bottrop, bis auch diese Zechen schließen würden, aber dazu konnte man im Moment noch nichts Konkretes sagen. Als die Zeche Zollverein im Dezember 1986 geschlossen wurde, wurde die gesamte Zechenanlage vom Land NRW übernommen und unter Denkmalschutz gestellt. Paul ging für 10 Jahre zu Prosper-Haniel und fuhr mit Kollegen aus der Nachbarschaft gegen Beteiligung am Spritgeld mit, er selbst hatte noch nie ein Auto und wollte sich auch keins anschaffen.
Ute und er waren Mitte Fünfzig, als ihre Kinder längst aus dem Haus waren, beide ein Studium abgeschlossen hatten und Pascal Architekt und Jennifer Gymnasiallehrerin für Englisch und Mathematik geworden waren. Beide hatten sie auch schon Familie und kamen mit ihren Kindern regelmäßig nach Katernberg zu Besuch, worüber sich Oma Ute und Opa Paul immer sehr freuten. Eines Tages kam Paul zu Ohren, dass für Führungen über die inzwischen renovierte und in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommene Zeche qualifiziertes Personal gesucht wurde. Paul fühlte sich angesprochen und bewarb sich bei der Stiftung Zollverein auf die ausgeschriebene Stelle. Schon nach dem ersten Gespräch war klar, dass es einen qualifizierteren Menschen als ihn für die Stelle gar nicht geben konnte, und er bekam den Posten. Damit war für Paul seine Zeit als Bergmann endgültig vorbei, und er übernahm es, Besuchern etwas von dem Gefühl und dem Empfinden, das die Bergleute damals gespürt hatten, zu vermitteln. Als er seine alte Arbeitsstätte wiedersah, traute er seinen Augen kaum, so sehr hatte sich alles verändert. Der Doppelförderturm an Schacht 12 war zum weltweit bekannt gewordenen Symbol des Weltkulturerbes geworden und Paul empfand Stolz dabei, in einer Einrichtung mit Weltgeltung arbeiten zu dürfen. Seine Aufgabe bestand darin, Besucher zu den Schnittstellen der ehemaligen Kohleförderung zu führen und Besucher gab es reichlich auf Zollverein. Auch ausländische Besucher gab es in Massen, und Paul sah sich mit einem Mal vor das Problem gestellt, japanischen Besuchern auf Englisch erzählen zu müssen, was sie jeweils zu sehen bekamen.
Aber man hatte ihm schon bei der Bewerbung auf diese Stelle nahegelegt, sein Englisch aufzufrischen und Kurse bei der VHS zu belegen, und das hatte Paul dann auch getan. Er fühlte sich am Ende sogar ziemlich sicher, wenn er von ausländischen Besuchern um Auskünfte gebeten wurde. Der neue Job erfüllte ihn voll und ganz, und er ging in ihm auf. Ute bekam mit, wie er immer frohen Mutes von Zollverein nach Hause kam und guter Dinge war. Das war schon etwas anderes, als seine Beschäftigung unter Tage und seit sein Rücken wieder in Ordnung war, konnte er sich bewegen wie ein junger Mann. Ute und Paul führten ein glückliches Leben als Großeltern und Paul ging mit 65 Jahren in Rente, wenngleich es ihm sehr schwerfiel, seiner alten Wirkungsstätte den Rücken zu kehren. Aber irgendwann musste auch für Paul das Arbeitsverhältnis beendet werden, das für ihn entbehrungsreich genug gewesen war. Jennifer und Pascal waren sogar beide ein bisschen stolz auf ihren Vater, dass er nun Guide auf Zollverein geworden war, und sie besuchten ihn auf Zollverein regelmäßig mit ihren Kindern. Sie setzten sich dann vor dem Museumseingang vor das Cafe und ihre Kinder genossen es, wenn sie ein Eis schlecken durften.
Rosi und Berthold Klausner
„Hört auf, auf dem Schulhof zu rennen!“, schallte die Stimme von Oberstudienrat Klausner über den Hof des Gymnasiums an der Hamburger Straße. Er hatte Pausenaufsicht und versah seinen Aufsichtsdienst immer mit großer Obacht, damit den Schülern auch ja nichts geschah. Denn wenn sie so draufgängerisch über den Schulhof liefen, bestand immer die Gefahr, dass jemand von ihnen stürzte und sich dabei verletzte. Immer wieder erwischte er auch Schüler dabei, wie sie ohne Erlaubnis rauchten, denn das Rauchen war im gesamten Schulgebäude und auch auf dem Hof verboten. Die Schulleitung hatte darum gebeten, besonders bei den Pausenaufsichten darauf zu achten. Und so warf Oberstudienrat Klausner einen Blick in die versteckten Ecken des Schulhofes, wo sich immer Schüler zum Rauchen verborgen halten konnten, und er ertappte regelmäßig welche. Die brachte er zum Schulleiter, der dann eine Klassenkonferenz einberief, und das war in den Augen der meisten Kollegen das Schlimmste daran, dass sie ihren Nachmittag opfern mussten, nur weil ein Schüler beim Rauchen erwischt worden war. Der betroffene Schüler kam in den allermeisten Fällen mit einem Verweis davon. Berthold Klausner war seit 20 Jahren Lehrer am Gymnasium an der Hamburger Straße, er unterrichtete die Fächer Sozialwissenschaften und Geschichte und hatte sich nach seiner Referendarzeit in Kleve-Kellen nach Bremen beworben und wurde eingestellt.
Er war verheiratet und hatte zwei Kinder im Alter von 16 und 17 Jahren, die beide auf seine Schule gingen und tunlichst darauf achteten , dort nicht auf ihn zu treffen. Er hatte sie so gut wie nie im Unterricht, drängte bei der Stundenplanung immer darauf, und sein Wunsch wurde in der Regel berücksichtigt. Als Berthold Klausner im Bremen anfing, hatte er zusammen mit seiner Frau Rosi ein Haus in der Wielandstraße mitten im Viertel gekauft, weil sie beide fanden, dass das Viertel etwas hatte, in ihm pulsierte das Leben, in ihm hatten junge Leute Spaß, und in ihm schienen eigene Gesetze zu gelten. Mittlerweile hatte sich Rosis und sein Blick auf das Viertel ein wenig geändert, sie waren beide reifer geworden und brauchten den Trubel und die Hektik um sich herum nicht mehr. Sie genossen es, wenn Stille herrschte, die sie von ihrem Schulalltag abschalten ließ, denn auch Rosi war Lehrerin. Sie war allerdings am Hermann-Böse-Gymnasium tätig, das am Südwest-Rand des Bürgerparks lag und eine weitaus unproblematischere Schülerschaft hatte, als das Gymnasium von Berthold. Problematisch sollte in diesem Zusammenhang verhaltensauffällig heißen, und da gab es einige besonders herausragende Schüler am Gymnasium an der Hamburger Straße, es sind sogar Rauschgiftdelikte vorgekommen. Aber Berthold war sehr gerne Lehrer an seiner Schule, ihn reizte es geradezu, auch mit unangepassten Schülern umzugehen, die sein ganzes pädagogisches Geschick herausforderten, und die zu nehmen nicht ganz leicht war.
Agnes und Bernd, die beiden Kinder von Rosi und Berthold, waren mittelmäßig begabte Kinder und kamen überall so mit. Agnes wollte nach dem Abitur Jura studieren und Bernd wollte wie sein Vater Gymnasiallehrer werden, er wollte die Fächer Physik und Sport belegen. Beide wollten sie von Bremen weg, was ein völlig normaler Vorgang wäre, denn dass die Kinder in ihrem Heimatort studierten, war eher die Ausnahme. Weder Agnes noch Bernd fühlten sich dem Viertel sehr verbunden, sie gehörten nicht zu denen, die gern in Kneipen herumhingen oder Rauschgift zu sich nahmen. Sie orientierten sich mehr in die Innenstadt und gingen, wenn sie ausgingen, zur Schlachte oder ins Alex, dorthin eben, wo sich die Normalbürger vergnügten, und nicht die in ihren Augen abgehalfterten Typen herumlungerten. Sie hatten zu ihren Eltern ein gutes Verhältnis und erörterten mit ihnen auch durchaus Probleme, die ihnen auf den Nägeln brannten. Besonders Rosi war für Agnes eine Ansprechpartnerin, wenn es um ihre Freunde ging und Agnes einen mütterlichen Ratschlag brauchte. Bernd hielt sich da sehr zurück, aber auch er wandte sich mit Dingen, die ihn beschäftigten, an seine Eltern, besonders an Berthold. Einmal kam Agnes zu ihrer Mutter und war sichtlich mitgenommen, sie hatte gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht, und Rosi sagte zu Agnes:
„Agnes, ich sehe Dir ganz genau an, dass Dich etwas tief bewegt, hast Du mit Deinem Freund Schluss?“, Agnes glaubte beinahe, eine Hellseherin vor sich zu sehen und antwortete ihrer Mutter in aller Kürze:
„Ja“.
„Komm, setz Dich und trink eine Tasse Kaffee mit mir!“, sagte Rosi zu ihr, „wer hat denn Schluss gemacht, Du oder er?“
„Er“, antwortete Agnes wieder kurz, und Rosi nahm ihre Tochter in ihre Arme und drückte sie. Agnes liefen einige Tränen ihre Wangen hinunter, und Rosi nahm ein Tempotuch und wischte sie ab.
„Manchmal hat so eine Trennung auch etwas Befreiendes“, sagte sie zu Agnes, „wenn nämlich schon vorher in der Beziehung etwas im Argen gelegen hatte, und sich die beiden nur nicht getraut hatten, sie zu beenden!“ Agnes schluchzte ein wenig und fand, dass ihre Mutter ihr aus der Seele gesprochen hatte, und Rosi merkte, dass sie mit all dem, was sie sagte, bei ihrer Tochter ankam und sie fuhr fort:
„Ich weiß, dass es im Moment der Trennung immer sehr hart für den Betreffenden ist, aber das dauert in der Regel nicht sehr lange, und man atmet wieder durch.“ Sie wusste, dass es Allgemeinplätze waren, die sie von sich gab, sie wusste aber auch, dass sie ihrer Tochter helfen würden, über ihren Trennungsschmerz hinwegzukommen, und kurze Zeit später fühlte sich Agnes auch wieder gut und dankte ihrer Mutter für die Anteilnahme, die sie ihr zuteil werden ließ. Das war eine Spezialität von Rosi, sich in die Notlagen anderer hineinzuversetzen und ihnen Trost zusprechen zu können.
Das konnte sie auch in ihrer Schule gut, wenn sie sah, dass Schüler durchhingen und es ihnen nicht so gut ging. Dann nahm sie sie in den Arm und gab ihnen ein paar warme Worte mit auf den Weg, und schon ging es den Schülern wieder besser. Auch Berthold war jemand, der sich den jungen Menschen anvertrauen und ihnen Mut zusprechen konnte, wenn sie sich in Notsituationen befanden. Er war an seinem Gymnasium seit Jahren Verbindungslehrer, und das kam nicht von ungefähr, denn die Schüler wussten von seiner Fähigkeit, ein Ohr für sie zu haben und Partei für sie zu ergreifen, auch gegen die Schulleitung. Wenn allerdings eklatante Verstöße gegen die Schulordnung vorlagen, waren auch ihm die Hände gebunden und er konnte dem Delinquenten nicht helfen, aber das wussten die Schüler natürlich auch. So war es im Fall Manfred Seier, als der „Vor dem Steintor“ von der Polizei mit Rauschgift aufgegriffen worden war, und die Polizei in das Gymnasium kam, um ein Gespräch mit der Schulleitung zu führen, bei dem Berthold als SV-Lehrer zugegen war. Manfred war zu diesem Zeitpunkt bei einer Vernehmung auf dem Präsidium und völlig in sich versunken. Die Polizei brachte keinen Ton aus ihm heraus, als sie in der Schule anrief und dort um Hilfe bat. Berthold wurde von der Schulleitung zum Präsidium geschickt, um Manfred zum Reden zu bringen, und als Berthold dort eintraf, fand er einen apathischen Jungen dort sitzen, der dem Heulen sehr nahe war.
Als er Berthold erscheinen sah, hellten seine Gesichtszüge kurzzeitig auf, um sich aber im selben Augenblick wieder zu verfinstern. Als Berthold sich neben ihn setzte und ihn bat, die Fragen der Beamten zu beantworten, fragte Manfred:
„Was wollen die denn von mir wissen?“, und der Vernehmungsbeamte setzte sofort nach und fragte Manfred:
„Woher hast Du das Heroin, das wir bei Dir gefunden haben, bekommen?“ Manfred überlegte kurz und antwortete dann:
„Das hat mir ein Dealer gegeben, damit ich es in der Schule für ihn verkaufe, ich bekomme 30% des Verkaufserlöses von ihm.“
„Wo finde ich den Dealer, und wie heißt er?“, fragte der Beamte weiter. Aber da blockte Manfred ab und hüllte sich in Schweigen, und erst als Berthold ihn aufmunterte, doch weiter zu erzählen, nannte der den Namen des Dealers, der bei der Polizei hinlänglich bekannt war, und er nannte den Ort, an dem die Rauschgiftübergabe stattgefunden hatte:
„Ich stand vor dem „Piano“ gegenüber der Sparkasse Ecke „Fehrfeld/Vor dem Steintor“, als mich der Dealer ansprach und mir ein Geschäft vorschlug, es standen noch viele andere Leute vor dem „Piano“, er kam aber gezielt auf mich zu, als wüsste er, wer ich war.“ Der Vernehmungsbeamte zeigte Manfred daraufhin eine Fülle von Fotos, aus denen er den Dealer heraussuchen sollte, um sicher zu gehen, dass Manfred auf den zeigte, der bei der Polizei bekannt war.
Als der Beamte die Bilder auf seinem Monitor durchscrollte, sagte Manfred bei dem entsprechenden Bild „Stopp!“, und es war tatsächlich Sven Bormann, der schon sehr oft wegen kleinerer Rauschgiftvergehen auffällig geworden war, dieses Mal käme er aber wegen Dealerei für lange Zeit ins Gefängnis. Was aber würde mit Manfred werden, wie würde die Schule auf sein Fehlverhalten reagieren? Für Berthold war Manfred ein ganz lieber Schüler gewesen, den er über die Jahre seiner Gymnasialzeit bis zur Jahrgangsstufe 13 immer begleitet hatte, und der nie negativ aufgefallen war, er hatte ihn auch einige Male im Unterricht und war mit seinen Leistungen insgesamt zufrieden. Berthold begleitete Manfred zu ihm nach Hause und traf dort auf seine Mutter, die völlig ahnungslos und davon ausgegangen war, das ihr Sohn sich in der Schule aufhielt. Als Berthold berichtete, was vorgefallen war, ließ sie sich auf einen Stuhl niedersinken und fing an zu weinen.
„Frau Seier, die Sache ist schlimm, sicher, aber ich werde für Manfred in der Schule rausholen, was ich kann, das verspreche ich Ihnen!“, sicherte Berthold zu und Frau Seier hörte auf zu weinen.
„Manfred, Du bist bis auf Weiteres vom Unterricht suspendiert und hörst von mir, wenn die Schule sich um Deinen Fall kümmert!“, sagte Berthold und fuhr wieder zum Gymnasium.
Sofort kam der Schulleiter zu ihm uns war vollkommen außer sich, ihm war daran gelegen, dass der Fall nicht an die große Glocke gehängt und ein schlechtes Licht auf die Schule werfen würde.
„Wegen der Schwere des Falles werde ich eine Lehrerkonferenz einberufen, die entscheiden soll, wie mit dem Schüler Seier verfahren werden wird!“, sagte er zu Berthold, und Berthold nahm den Entschluss seines Schulleiters zur Kenntnis. Es dauerte nicht lange, und der Fall Manfred Seier war bei der Presse gelandet, was sich auch nicht verhindern ließ. Aber als Journalisten der Regenbogenpresse das Schulgelände zu bevölkern begannen und Mitschüler zu Manfred ausquetschen wollten, ging Berthold dazwischen und verwies sie im Auftrag der Schulleitung vom Gelände. Danach stand in jeder Tageszeitung Bremens ein großer Artikel über den Rauschgiftfall Manfred Seier. Die Polizei verstärkte die Gruppe von Zivilbeamten, die sich an der Ecke „Fehrfeld/Vor dem Steintor“ aufhalten und versuchen sollten, Sven Bormann aufzugreifen und zu verhaften. Als der Tag der Lehrerkonferenz in der Schule gekommen war, zu der alle Lehrer erscheinen und ihren freien Nachmittag opfern mussten, hatte sich Berthold vorgenommen, für Manfred Partei zu ergreifen, ohne das Vergehen, dessen er sich schuldig gemacht hatte, in irgendeiner Weise abzumildern. Sein Ziel war es, dem Schüler nicht seine Schulkarriere zu verbauen, obwohl die Schwere seines Deliktes eigentlich dazu ausgereicht hätte, ihn der Schule zu verweisen.
Aber er kannte Manfred ja und wusste, dass es nicht seinem Charakter entsprach, mit Rauschgift zu dealen. Das sagte er auch auf der Lehrerkonferenz, als ihm das Wort erteilt worden war und er sagte weiter:
„Wir alle tun uns leicht damit, den Stab über einen Schüler zu brechen und ihn von der Schule zu weisen, ich möchte aber in speziell diesem Fall darauf hinweisen, dass ich den Jungen gut kenne und meine Hände für ihn ins Feuer legen würde!“ Er wusste, dass er damit sehr dick aufgetragen hatte, aber er wollte bei seinen Kollegen Wirkung erzielen und das gelang ihm letztendlich auch. Manfred Seier bekam ein umfangreiches Maßnahmebündel auferlegt, das umfasste insbesondere Nachmittagsarbeiten in der Schule und Nachhilfestunden für die jüngeren Jahrgänge, von einem Schulverweis blieb er aber verschont. Das Ergebnis der Gerichtsverhandlung, die seinetwegen anberaumt worden war, war, dass er zu 200 Sozialstunden verurteilt wurde. Die Richterin hatte ein Einsehen in die Situation des Schülers Manfred Seier und blieb in ihrem Urteil recht mild. Der Fall Manfred Seier war für Berthold ein Fall mit ganz besonderer Tragweite, wie man ihn im Leben nur äußerst selten erlebt, und er beobachtete Manfred während seiner gesamten restlichen Schulzeit, die er mit einem mittelprächtigen Abitur abschloss. Manfred kam unmittelbar nach der Lehrerkonferenz zu Berthold und dankte ihm über alle Maßen für seinen Einsatz, er bekam sich kaum noch ein, und auch Manfreds Eltern wollten sich erkenntlich zeigen. Aber Berthold wies sie ab und sagte: