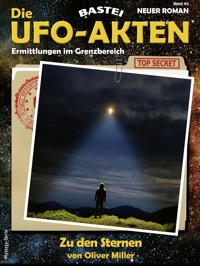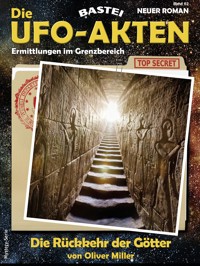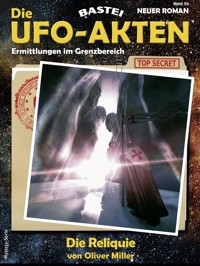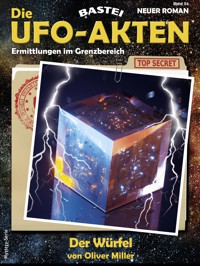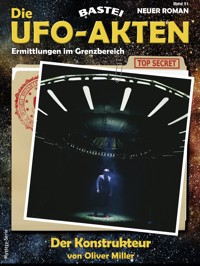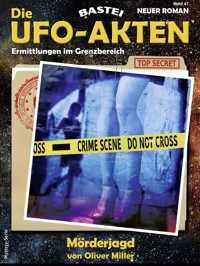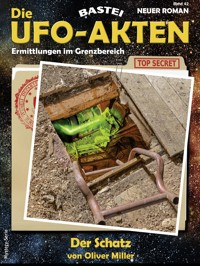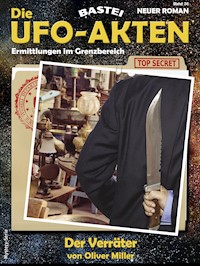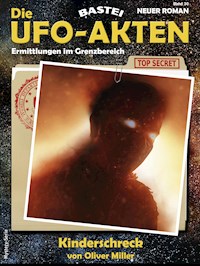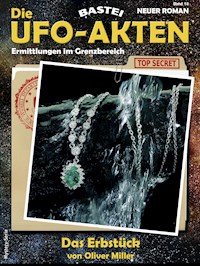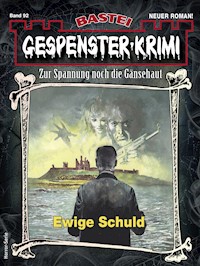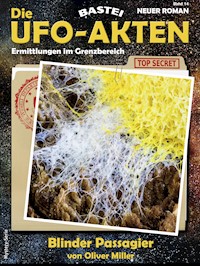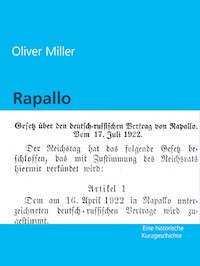Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
Krise und Untergang der Römischen Republik bildeten schon früh einen den Hauptschwerpunkte der Antikenforschung. Wenige Personen prägten diese späten Jahre der republikanischen Ordnung so wie Gaius Marius. Der Emporkömmling aus Arpinum rettete das Imperium Romanum als Feldherr vor den einfallenden Germanen und führte es als Konsul. Dabei verwob er als einer der ersten auf damals einzigartige Weise militärischen Ruhm und politische Macht, nicht zuletzt durch das Auflösen bisheriger republikanischer Regeln, etwa der Ämterwiederholung. Die schwelende Agrar- und Heereskrise löste er durch Reformen der Militärstruktur, die nicht zuletzt ihm als Person nützen sollten - dabei schuf durch das entstehende Heeresklientelwesen die Grundlage für folgende Bürgerkriege und schlussendlich auch für das spätere Kaiserreich. Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Person des Gaius Marius - die Motivation hinter seinem Handeln, sowohl politischer als auch persönlicher Natur. Dabei kann er nicht allein separiert betrachtet werden, sondern ist stets vor dem Hintergrund der Krise der Römischen Republik und deren Symptome zu sehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das vorliegende Werk wurde 2006 als Arbeit zum Ersten Staatsexamen im Bereich Alter Geschichte eingereicht.
Eine Überarbeitung erfolgte für die 2. Auflage 2019.
Dr. Oliver Miller (geb. in Augsburg) studierte nach seinem Abitur in Celle die Fächer Latein und Geschichte auf (Gymnasial-)Lehramt an den Universitäten Freiburg und Göttingen. Dort legte er 2007 sein erstes Staatsexamen ab. Seit dem Ende seines Referendariats 2009 unterrichtet er an der St. Ursula-Schule Hannover. Seine Promotion zum Dr. phil. schloss er 2019 ab. Parallel hierzu lehrt er an der Universität Hannover im Bereich Sonderpädagogik / Historische Perspektive des Sachunterrichtes.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Einleitung
1.1 Quellenlage
1.1.1 Plutarch
1.1.2 Sallust
1.1.3 Livius
1.1.4 Cicero
1.1.5 Andere Quelle in lateinischer Sprache
1.1.6 Andere Quellen in griechischer Sprache
1.1.7 Moderne Literatur
Hauptteil
Leben des Marius bis zum ersten Konsulat
1.1 Geburt und Herkunft
1.2 Jugend
1.3 Erster Militärdienst
1.4 Ämterlaufbahn bis zum ersten Konsulat
1.5 Marius als Legat im Jugurthinischen Krieg
Außenpolitische Entwicklung Roms im 2. Jhd. v. Chr. bis zum ersten Konsulat des Marius
2.1 Der Zweite Makedonische Krieg
2.2 Krieg Roms gegen Antiochos III.
2.3 Der Dritte Makedonische Krieg
2.4 Rom und das Spanien-Problem
2.5 Konflikte in Griechenland
2.6 Das Ende Karthagos
2.7 Politische Selbstaufgabe des griechischen Ostens
2.8 Sklavenaufstände
2.9 Gallien
Die Heimat der Kimbern und Teutonen
3. 1 Die Nordgrenze des Römischen Reiches
3.2 Eine quellenanalytische Annäherung an die Heimat der Kimbern und Teutonen
Das erste Konsulat des Marius
4.1 Der numidische Krieg
4.2 Der Zug der Kimbern und Teutonen bis 104 v. Chr.
Das zweite Konsulat des Marius
5.1 Die Heeresreform des Marius
Das dritte Konsulat des Marius
Das vierte und fünfte Konsulat des Marius
7.1 Von Aquae Sextiae nach Vercellae
Leben des Marius nach 101 v. Chr.
8.1 Das sechste Konsulat
8. 2 Von Saturnius zum Bundesgenossenkrieg
8. 3 Der Bundesgenossenkrieg
8.4 Sullas Marsch auf Rom
8.5 Cinnas Herrschaft und das 7. Konsulat
Fazit
Anhang
Rezeptionen
1.1 Marius – ein Feldherr im Internet
1.2 Sulla gegen Marius – Der Kampf im historischen Roman
1.3 Total War – Marius zum Selbstspielen
1.4 Kimbern und Teutonen – Eine Dokumentation
Karten
Literaturverzeichnis
3.1. Monographien
3.2. Aufsätze
3.3 Quellen
3.4 Inschriften
3.5 Populärwissenschaftliche Artikel
3.6 Internetadressen
3.7 Rezeptionswerke
3.8 Film-Dokumentationen
3.9 Handbücher
3.10 Abbildungsverzeichnis
Vorwort zur 2. Auflage
Da die vorliegende Arbeit ursprünglich aus dem Jahr 2006 stammte, wurden für eine Neuauflage 2019 einige Modifikationen nötig.
Um den Lesefluss zu erleichtern wurde die Fußnotensetzung am Seitenende zu Gunsten einer direkten im Text befindlichen Zitierweise ersetzt. Ebenfalls wurden einige grammatikalische oder orthographische Fehler ausgemerzt.
Darüber hinaus erfolgten eine Aktualisierung des Literaturverzeichnisses und die Überarbeitung, bzw. Modernisierung einiger Kapitel auf inhaltlicher Ebene.
Zuletzt wurde zur besseren Visualisierung Kartenmaterial hinzugefügt.
Hannover, Juni 2019
I. Einleitung
„Marius gehört zusammen mit seinem zeitlebens größten Gegenspieler L. Cornelius Sulla und den zeitlich vorausgehenden Brüdern Tiberius und Gaius Gracchus fraglos zu den bedeutendsten historischen Persönlichkeiten der ersten Hälfte des römischen Revolutionszeitalters“ (Werner 1995: 1), so eröffnet Werner Volker sein Werk über das Mariusbild der Antike. Er reiht jenen Feldherrn in die Reihe der großen antiken Persönlichkeiten ein, stellt in gar auf eine Stufe mit den Gracchenbrüdern.
Doch woraus zieht er diesen Schluss? Wer ist diese historische Figur Marius? Welche Karriere schuf er? Womit nahm er seinen Aufstieg, was waren die Gründe für seinen Fall? Und auch – wer ist der Mensch hinter dem antiken Feldherrn?
Zweifellos lässt sich die Figur des Marius als Einzelperson nicht leicht fassen. Zu verwoben ist seine Geschichte mit anderen großen Gestalten und Geschehnissen. Diese Arbeit nun unternimmt den Versuch, die Geschichte des Marius genauer zu untersuchen. Ziel dabei ist keine Biographie auch kein Psychogramm, sondern vielmehr eine Analyse der Karriere des Marius. Als besonderen Schwerpunkt in dieser Untersuchung soll sein Aufstieg als Feldherr im Kampf gegen die Kimbern und Teutonen behandelt werden.
Zur Einteilung der Arbeit lässt sich sagen, dass eine Drittelung des Stoffes vorgenommen wurde. Der erste Block beschäftigt sich mit dem Leben des Marius bis zu seinem ersten Konsulat, der zweite Block, der eigentliche inhaltliche Schwerpunkt, untersucht seinen Aufstieg durch den Kampf gegen die Kimbern und Teutonen. Der letzte, abschließende Teil analysiert die letzten beiden Konsulate des Marius bis zu dessen Tod.
Im Einzelnen bedeutet dies, dass zunächst eine kurze Übersicht über die Literatur und Quellenlage gegeben wird. Hierbei soll dem Leser vermittelt werden, welche antiken Zeugnisse uns zur Verfügung stehen und wie sie als Bezugstext zu bewerten sind. Darüber hinaus soll ein kleiner Einblick in die Welt der Sekundärliteratur zu diesem Thema gegeben werden, die, soviel vorneweg, auf der einen Seite schier unerschöpflich ist, auf der anderen Seite jedoch recht dürftig erscheint.
Nach diesen einleitenden Kapiteln kommt, im Zuge des oben erwähnten ersten Teils, die Untersuchung der Vita des Marius bis zum ersten Konsulat. Ziel eben dieser ist, klar herauszuarbeiten, aus welchem Umfeld er stammt. Dazu gehört natürlich zunächst seine Herkunft selbst, also Elternhaus, Familie, auch bereits erste Verbindungen zu anderen Familien. Sein Werdegang ist dabei genauso von Interesse: Fragen nach der Ausbildung etwa, oder seinem ersten Militärdienst. Diese Betrachtung der frühen Jahre des Marius ist unerlässlich möchte man spätere Handlungsweisen verstehen. Inwiefern hat ihn seine Herkunft, seine Jugend für spätere Aufgaben geprägt? War seine unglaubliche Karriere bereits damals abzusehen?
Mit dem Eintritt in die Armee beginnt gleichsam sein Leben in der Öffentlichkeit. Seine ersten erfolglosen Versuche in der Ämterlaufbahn sind ebenso von Bedeutung wie später sein Dienst unter Metellus im Jugurthinischen Krieg. Interessant hierbei sind nicht nur seine ersten innenpolitischen Gehversuche, sondern auch wie er sich einem anderen Feldherrn unterordnete, welche militärischen Verdienste er erlangte oder dann schließlich, mit welchen Mitteln er das Konsulat erwarb.
Der zweite Block, der Hauptteil, kann sich dann nicht nur mit Marius selbst beschäftigen, sondern muss weiter gefasst werden. Um die wirkliche Bedeutung der Kimbern und Teutonengefahr zu fassen, ist ein Blick auf die Außenpolitik Roms seit dem Jahre 200 v. Chr. unerlässlich. Wegen der Fülle an bereits erschienener Literatur zu diesem Thema fällt dieser Überblick möglichst kurz aus. Innenpolitische Probleme, dies sei bereits hier betont, werden nur in soweit behandelt, wie sie Marius selbst betreffen. Auf größere innenpolitische Ausführungen und Exkurse, wie etwa die Reformpolitik der Gracchen, wurde aus inhaltlichen Gründen verzichtet, im Übrigen hätten sich auch den Rahmen für diese Arbeit gesprengt.
Um den Aufstieg des Marius durch die Germanengefahr zu verstehen, ist es natürlich nötig, genauer auf die herannahenden Gegner einzugehen. Hierzu wurde ein quellenanalytisches Kapitel zur Herkunft der Kimbern und Teutonen eingefügt.
Der weitere Aufstieg des Marius über sein erstes Konsulat, den Krieg gegen Jugurtha, ist im weiteren Thema der Untersuchung. Die Arbeit wurde so unterteilt, dass im Folgenden chronologisch nach den Konsulaten des Marius vorgegangen wird. Dabei wird ebenso auf den Zug der Germanen auf der einen, wie die Maßnahmen Marius, etwa der Heeresreform, auf der anderen Seite eingegangen. Leitfragen sind in diesem Teil der Arbeit vor allem, wie Marius die Germanengefahr für seinen Aufstieg ausnutzte, welche Maßnahmen er ergriff und wie er sich dabei versuchte, sich innenpolitisch abzusichern.
Die beiden Schlachten von Aquae Sextiae und Vercellae bilden dann den Abschluss dieses Teils. Dabei soll auch die Interaktion zwischen Marius und seinen Mitfeldherrn und Tribunen, Catullus und Sulla, Thema der Untersuchung sein.
Der letzte Teil schließlich soll die Untersuchung der Vita des Marius bis zu seinem Tod 86 v. Chr. vervollständigen. Im Zentrum des Interesses ist hierbei, wie Marius versucht, seinen nun militärisch erworbenen Ruhm in innenpolitischen Einfluss umzumünzen und diesen zu erhalten. Dabei ist jenes schicksalhafte Jahr 100 v. Chr. mit der Verbindung zwischen Saturnius, Glaucia und Marius von großer Bedeutung. Auch der letzte gemeinsam gefochtene Kampf an der Seite Sulla, der Bundesgenossenkrieg, ist Untersuchungsgegenstand. Im Folgenden die Verschlechterung der Verhältnisse Sulla – Marius bis zur Todfeindschaft und Sullas Marsch auf Rom. Hierbei wird interessant sein zu sehen, inwiefern Marius dadurch geprägt wurde, wie er mit den Demütigungen und Rückschlägen, etwa seiner spektakulären Flucht nach Afrika, umgehen konnte. Und zuletzt, welche Gründe die Grausamkeiten und Gräuel am Ende seines Lebens, im siebten Konsulat mit Cinna, hatten. Damit ist die Vorgabe für diese Arbeit grob umrissen.
1.1 Quellenlage
Die Quellenlage zu Marius gestaltet sich schwierig. Vor allem über seine Jugend ist fast nichts überliefert. Als Hauptinformationsquelle kann Plutarchs Biographie gelten, ebenso Sallust und Cicero. Im Folgenden werden die in dieser Arbeit hauptsächlich verwendeten Quellenautoren kurz vorgestellt, auch ein Blick auf die moderne Literaturlage zu Marius wird geworfen.
1.1.1 Plutarch
Von Plutarch liegt eine Biographie des Marius vor, parallel mit Pyrrhos gesetzt (Plutarch s.a. Jones 1971; Swain 1991: 318-330). Sie ergibt dank ihrer Ausführlichkeit ein abgerundetes Bild und nennt als Quellen Poseidonios, Sulla, Rutilius Rufus und Gaius Piso in einer Form, dass man nicht annehmen darf, er habe ihre Angaben nur Kompendien der ersten Kaiserzeit entnommen. Plutarch bemüht sich, Marius gegenüber möglichst objektiv zu sein und erkennt sein militärisches Talent und seine soldatische Tatkraft an. Sein teilweise hemmungsloses Benehmen, vor allem zum Ende seines Lebens hin, jedoch lehnt der Autor rigoros ab. Bemerkenswert ist, dass Plutarch eine Büste des Marius in Ravenna gesehen haben will und sie mit den ihm zur Verfügung stehenden Informationen über Marius‘ Charakter in Parallele setzt (Parallelbiographien s.a. Duff 1999; Scardigli 1979; Plutarch; Marius 2,1).
1.1.2 Sallust
Als ein Parteigänger Caesars und der populares stand Sallust (Sallust s.a. Syme 1964) Marius zeitlich und auch politisch am nächsten. Daher ist bei ihm eher eine gewisse Einfühlungsfähigkeit zu erkennen als ein kühles Urteil. Sein Leben, am Anfang geprägt von Sullas Diktatur, am Ende vom Triumvirat, war „reich an politischen Hoffnungen.“(Albrecht 2003: 347)
Für sein Werk Bellum Iugurthinum orientierte er sich am Stil eines Thukydides und stützte sich auf mündliche Überlieferungen. So ist zu mutmaßen, dass er für den ersten Teil des Feldzuges die Berichte von Scaurus, für den Metellusabschnitt Rutilius Rufus gelesen hat, da dieser an jenem Feldzug teilnahm. Da der restliche Teil vor allem zu Sulla sehr ausführlich ist, ist anzunehmen, dass er dessen Erinnerungen als Quelle herangezogen hatte. Auch möglich ist, dass er eine ältere Darstellung des Krieges benutzt hat.
Sallust wollte vor allem zeigen, wie Marius seine Ämterlaufbahn betrat, in der er als homo novus den Staat aus der Krise rettete, in welche ihn ausgerechnet die Nobilität hineinmanövriert hatte und wie eben jener Marius einer der mächtigsten und schicksalsbestimmendsten Bürger Roms wurde. Trotz dieser Tendenzen ist es doch bemerkenswert, mit welcher Unparteiligkeit er diesen und auch seinen Gegenspieler Metellus bewertet. Angesichts seines vorwiegend politischen und personalen Interesses scheinen ihm chronologische Probleme und geographische Gegebenheiten weniger wichtig gewesen zu sein, sodass er sie meist nur am Rande behandelte.
1.1.3 Livius
Dieser Autor (s.a. Burck 1964) hat die Zeit des Marius in den Büchern 62 – 80 in seinem Werk ab urbe condita libri erfasst, die in den Periochae vorliegen. Unter den von Livius abhängigen Schriftstellern ist Orosius (s.a. Koch-Peters 1984) besonders zu beachten. Nachrichten über Marius geben ferner Aennaeius Florus und Festus.
Livius Haltung bezüglich Marius kann als streng gelten. Jedoch wird vor allem in der neueren Forschung häufig bemängelt, dass er sich nicht ernsthaft bemüht habe, die ihm zugänglichen Quellen zu sichten, sondern „übernahm, was er vorfand.“ (Furhmann 2005: 347ff.) Doch kann man ihm, bei aller Kritik, eine Zuverlässigkeit in der Darstellung nicht absprechen.
1.1.4 Cicero
Über das Leben (s.a. von Albrecht 2003: 414ff.) und das umfassende Werk des berühmten Autors soll hier nicht ausführlich berichtet werden (vgl. Fuhrmann 1997). Eine besondere Verbindung zu Marius besteht bei ihm durch die gemeinsame Heimat Arpinum und einen gewissen Verwandtschaftsgrad.
Gerade er jedoch ist wichtig als Quelle. Sein Epos über Marius, das er wohl etwa um 60 v. Chr. geschrieben haben soll, ist verloren. Auch das Bruchstück de divin. 1, 106 ist historisch weniger bedeutend. Aber an vielen Stellen seiner anderen Schriften gibt es wertvolle Nachrichten über Marius (vgl. Schütz 1913). Aus jenen Stücken ist durchaus ein komplettes und einzigartiges Bild des Marius bei Cicero entstanden (s. Diehl 1988: 122ff.), besonders wegen seiner Genauigkeit und auch seiner Bewunderung.
1.1.5 Andere Quelle in lateinischer Sprache
Velleius Paterculus (s.a. Lana 1952), Verfasser des einzigen erhaltenen lateinischen Geschichtswerks aus der Zeit des Tiberius, gilt dank vieler Beschönigungen und Schmeicheleinen als einseitig höfisch gesinnter Historiograph (vgl. Fuhrmann 2005). Als Quellen für sein Werk, dessen genauer Titel unbekannt ist, gelten die Chronica von Nepos, ebenso dessen de viris illustribus, ferner auch Sallust und Livius.
Trotz der oben erwähnten Kritik führt er einige wichtige Daten zu Marius` Biographie an, die keinen Grund zum Zweifeln geben.
Valerius Maximus (vgl. Comes 1950), der ebenfalls zur Zeit des Tiberius lebte, bringt in seinem einzigen Werk facta ac dicta memorabilia Beispiele für moralische oder historische Argumentationen. Seine Quellen sind Nepos (vgl. Geiger 1951) sowie ein gewisser Pomponius Rufus.
Er erwähnt Marius in einigen exempla, die trotz mancherlei historischer Fehler durchaus wichtig sind (vgl. Fuhrmann 2005).
1.1.6 Andere Quellen in griechischer Sprache
Hier sind vor allem Appians (s.a. Gowing 1992) Werke zu nennen, denen man zwar einige Flüchtigkeitsfehler nachsagen kann, jedoch gerade das erste der fünf Bücher ist in Bezug auf Marius besonders wichtig. Seine Quellen sind dabei nicht genau bestimmt, allerdings ist Livius dazuzuzählen.
1.1.7 Moderne Literatur
Zu Marius selbst ist in der modernen Forschung nur sehr wenig erschienen. Allenfalls zu Teilbereichen seiner Vita, etwa der Heeresreform, findet sich Literatur.
Diese Arbeit verwendet die, zumindest in der aktuellen Diskussion, beiden wichtigsten Biographien, einmal die von Carney und die von Evans.
Vieles aus dem Leben des Marius muss durch die Biographien anderer wichtiger Persönlichkeiten dieser Zeit rekonstruiert werden. Vor allem zu nennen sind hierbei die Biographien zu Sulla von Christ und Keveany, aber auch die von Letzner.
Ferner bieten vor allem Überblickswerke zur späten Republik ausreichend Literatur zu Marius. Hier seien besonders die klassischen Werke von Christ, Mommsen oder König zu erwähnen, aber auch ganz neue Erzeugnisse, wie das von Linke oder Baltrusch.
In den letzten Jahren kamen hierzu auch die Werke von Michael Sommer (2016), aber auch von Greg Woolf (2017).
II. Hauptteil
1. Leben des Marius bis zum ersten Konsulat
1.1 Geburt und Herkunft
Dieser Teil der Arbeit wird sich nun mit dem Leben des Marius bis zu seinem ersten Konsulat im Jahre 107 vor Christus beschäftigen. So soll gleichsam eine Verständnisgrundlage für die folgenden, in dieser Arbeit eingehender behandelten Ereignisse gelegt werden, indem nicht nur die reinen Lebensdaten des Marius rezitiert, sondern auch soweit möglich der Charakter dieser Persönlichkeit beleuchtet werden.
Eine erste Auffälligkeit, wenn auch nichts Ungewöhnliches, ist das Fehlen eines Cognomens bei Gaius Marius (Plutarch äußert sich hierzu auf Poseidonios gestützt ausführlich in Marius 1). Schon sein exaktes Geburtsdatum ist umstritten und nicht überliefert. Es kann lediglich anhand seines Sterbedatums (13. Januar 86 v. Chr.) und seiner ungefähren Lebenszeit errechnet werden. So beziffert Plutarch dessen Lebensspanne auf 70 Jahre (vgl. Plut. Mar. 45,12), dabei ist zu bemerken, dass es durchaus üblich war, Ziffern auf durch zehn Teilbare abzurunden. Dies wird unterstützt durch die Tatsache, dass Plutarch selbst Marius bereits bei seiner Verbindung mit Cinna im Jahr 87 vor Chr. als 70- jährig bezeichnet (Plut. Mar. 41,6). Auch die Überlieferung von Velleius widerspricht der 70-Jahre-Theorie, da er Marius bei der Übertragung des Kommandos zum Krieg gegen Mithridates im Jahr 88 vor Chr. bereits als über 70-jährig bezeichnet. Moderne Biographen gehen daher nicht von einer Geburt im Jahre 156 vor Chr. aus, sondern tendieren zu 157 vor Chr., wenn nicht sogar früher (vgl. Carney 1961: 8).
Der Geburtsort wird von vielen Schriftstellern recht ungenau als „bei Arpinum“ angegeben (u.a. Sallust; Bell. lug 63,3). Plutarch präzisiert dies etwas, indem er die Stadt Cereatae angibt (vgl. Plut. Mar. 3,1,), was auch verschiedene Inschriften unterstützen (vgl. CIL X p. 564). Das heutige Casamare (ital. sinngemäß für ‚Heimat des Marius‘) liegt in der Nähe der Stadt Arpino im heutigen Lazio (vgl. Martin 2003: 294f.). Die dort heute noch existierende Abtei S. Giovanni e Paolo di Casamare bewahrt das Andenken an sein Geburtshaus.
Ebenso ist die Herkunft des Marius fast vollständig im Dunkeln. Plutarch nennt nur den gleichnamigen Vater und seine Mutter Fulcinia (vgl. Plut. Mar. 3, 1. und auch CIL X 5782). Zu seinen Wurzeln gibt es zwei Theorien: Die des „working-class“ (Carney 1961: 8) Marius und die des Ritters Marius.
Diese Differenz entstand durch unterschiedliche Quellenüberlieferung. So spricht Velleius von „equestri“ (Vell. II 11, 1), Tacitus hingegen von „e plebe infima“( Tac. hist. II 38). Anhänger finden sich für beide Seiten. Mommsen bezeichnet ihn als Sohn eines „Tagelöhners“(Mommsen 2006b: 188), Christ lässt ihn aus „einfachen, ländlichen Verhältnissen“ (Christ 2003: 59) stammen, rechnet ihn aber zum Ritterstand. Ein nicht zu lösendes Rätsel seine Herkunft betreffend gibt Plutarch auf (Plut. Mar. 5). Er erwähnt, dass Marius, als er gerade Prätor geworden war, de ambitu angeklagt wird. Ein ansonsten unbekannter C. Herennius wird als Belastungszeuge vernommen und verweigert die Aussage, weil es in Rom nicht üblich sei, dass ein Patron gegen seinen Klienten zeuge. Die Eltern des Marius seien somit Klienten der gens Herennia