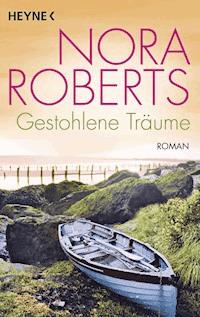
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tia Marshs Leben gehört der Wissenschaft. Dass ihr Interesse für die griechische Mythologie ihr einmal zum Verhängnis werden soll, ahnt sie nicht - bis sie Malachi Sullivan begegnet. Der attraktive Ire ist dem Geheimnis dreier silberner Schicksalsgöttinnen auf der Spur, das eng mit Tias Familie verknüpft zu sein scheint. Eine atemlose Jagd nach den wertvollen Statuen beginnt, denn nicht nur Malachi will die Göttinnen um jeden Preis besitzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 766
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Tia Marsh, eine junge Wissenschaftlerin und Expertin für griechische Mythologie, wird bei einer Lesung von dem gut aussehenden Iren Malachi Sullivan angesprochen. Zunächst fühlt sie sich von dem ungewohnten Interesse an ihr und ihrer Arbeit geschmeichelt. Doch ist Malachi wirklich an ihr interessiert? Schnell findet Tia heraus, dass er auf der Suche nach drei wertvollen Götterstatuen ist, die schon lange als verschollen gelten. Eine der Statuen befand sich einst im Besitz von Tias Ururgroßvater, dem Antiquitätenhändler Henry W. Wyley. Doch nicht nur Tias Familie scheint mit dem Geheimnis um die silbernen Göttinnen verwoben zu sein, auch Malachis Vorfahren stehen in Verbindung mit den geheimnisumwitterten Statuen. Die beiden machen sich gemeinsam auf die Suche nach den Parzen, doch stehen sie dabei auf einer Seite? Eine spannende Jagd beginnt, und schnell stellt sich heraus, dass Tia und Malachi nicht die einzigen Schatzjäger sind …
Die Autorin
Nora Roberts wurde 1950 in Maryland geboren und gehört heute zu den meistgelesenen Autorinnen der Welt. Auch in Deutschland erobert sie mit ihren Romanen regelmäßig die Bestsellerlisten. Im Diana Verlag sind zuletzt erschienen: Lockruf der Gefahr, Die Tochter des Magiers,Sommerflammen sowie Die falsche Tochter. Nora Roberts hat zwei erwachsene Söhne und lebt mit ihrem Ehemann in Maryland.
NORA
ROBERTS
Gestohlene Träume
ROMAN
Aus dem Amerikanischen
von Margarethe van Pée
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe THREE FATES erschien 2002 bei G. P. Putnam’s Sons, New York
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Vollständige Taschenbuchausgabe 02/2018
Copyright © 2002 by Nora Roberts
Published by Arrangement with Eleanor Wilder
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2003 by Ullstein Heyne List GmbH & Co. KG/Marion von Schröder Verlag
Copyright © für die deutschsprachige Ausgabe 2011 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Copyright © dieser Ausgabe 2018 by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik-Design, München, nach einer Vorlage von T. Mutzenbach Design unter Verwendung von © Gettyimages (Farell Grehan, Richard Cummings)
Satz: Leingärtner, Nabburg
e-ISBN: 978-3-641-22263-5V002
www.heyne.de
Für Dan und Stacie
Möge der Teppich eures Lebens
mit den rosigen Fäden der Liebe,
dem dunklen Rot der Leidenschaft,
dem ruhigen Blau des
Verständnisses und der Zufriedenheit,
und dem hellen, hellen
Silber des Humors gewoben sein.
TEIL I
Spinnen
Oh, welch fein gesponnenes Netz
Wir weben
Wenn wir betrügen
Das erste Mal im Leben
SIR WALTER SCOTT
1
7. Mai 1915
Da er glücklicherweise nicht ahnte, dass er dreiundzwanzig Minuten später tot sein würde, stellte sich Henry W. Wyley gerade vor, wie er der jungen Blondine, die in seinem Blickfeld aufgetaucht war, in den hübsch gerundeten Hintern kneifen würde. Es war eine vollkommen harmlose Fantasie, die weder der Blondine noch Henrys Frau schadete, Henry jedoch in außerordentlich gute Laune versetzte.
Eine Serviette über den runden Knien, den dicken Bauch angenehm gefüllt von einem späten, üppigen Mittagessen, saß er mit seiner Frau Edith – deren Hintern so beklagenswert flach wie ein Pfannkuchen war – in der milden Seeluft und genoss den Anblick der Blondine sowie eine gute Tasse Earl Grey.
Henry, ein stattlicher Mann mit herzhaftem Lachen und einem Auge für die Damen, hatte keine Lust, sich zu den anderen Passagieren zu gesellen, die an der Reling standen, um einen Blick auf die sonnenbeschienene irische Küste zu erhaschen. Er kannte sie schon. Und außerdem würde es wahrscheinlich noch zahlreiche Gelegenheiten geben, sie wieder einmal zu sehen.
Was die Leute an Klippen und Gras so faszinierte, verstand er sowieso nicht. Henry war durch und durch ein Städter, der soliden Stahl und Beton schätzte. Und in diesem Moment war er zudem viel mehr an den köstlichen Schokoladenplätzchen interessiert, die zum Tee gereicht wurden, vor allem, weil die Blondine inzwischen weitergegangen war.
Gut gelaunt verschlang er ein Plätzchen nach dem anderen, wobei Edith die ganze Zeit an ihm herummäkelte, er solle nicht so krümeln. Es war schade, dass sie sich solch kleine Vergnügen in den letzten Jahren ihres Lebens versagte. Sie würde sterben, wie sie gelebt hatte – voller Sorge um das Gewicht ihres Ehemanns und an den Krümeln herumbürstend, die von seinem Hemd zu Boden fielen.
Henry war dagegen ein Genießer. Was hatte es denn für einen Sinn, reich zu sein, wenn man sich dann nicht auch die guten Dinge des Lebens gönnte? Früher war er arm und hungrig gewesen. Reich und wohlgenährt zu sein war besser.
Er hatte nie gut ausgesehen, aber wenn ein Mann Geld hat, wird er eher stattlich als fett genannt, eher interessant als eigenwillig. Henry gefiel die Absurdität solcher Unterschiede.
Es war kurz vor drei an diesem strahlenden Mainachmittag, und der Wind strich über sein dunkles Toupet und rötete seine schwammigen Wangen. Henry trug eine goldene Uhr in der Tasche und in seiner Krawatte steckte eine mit Rubinen besetzte Nadel. Seine Frau Edith, dürr wie ein Hühnchen, trug feinste Pariser Couture. Er besaß fast drei Millionen. Zwar nicht ganz so viel wie Alfred Vanderbilt, der auch gerade den Atlantik überquerte, aber genug, um damit zufrieden zu sein. Genug, um eine Erste-Klasse-Passage auf diesem schwimmenden Palast bezahlen zu können, dachte Henry voller Stolz, während er überlegte, ob er noch ein viertes Plätzchen essen sollte. Genug, um seinen Kindern und später seinen Enkelkindern eine erstklassige Ausbildung zu ermöglichen.
Erste Klasse reisen zu können ist mir wahrscheinlich wichtiger als Alfred Vanderbilt, überlegte er. Schließlich hatte Alfred sich nie mit der Zweiten Klasse begnügen müssen.
Mit halbem Ohr lauschte Henry dem Geschnatter seiner Frau, die ihm erzählte, was sie alles unternehmen würden, wenn sie erst einmal in England wären. Sie würden Besuche machen und auch selbst Gäste einladen. Henry wolle doch sicher auf keinen Fall die ganze Zeit mit seinen Geschäftspartnern verbringen oder irgendwelche Abschlüsse tätigen.
Er stimmte ihr mit der ihm eigenen Liebenswürdigkeit zu. In fast vierzig Jahren Ehe hatte er seine Frau aufrichtig schätzen gelernt, und er würde ganz bestimmt dafür sorgen, dass sie sich während ihres Aufenthaltes in England gut unterhielt.
Aber Henry hatte seine eigenen Pläne, und nur aus diesem Grund machte er die Überfahrt.
Wenn seine Informationen richtig waren, dann würde er die zweite Parze erwerben können. Den Wunsch, die kleine Silberstatue zu besitzen, hegte er, seitdem es ihm gelungen war, die erste der drei Schicksalsgöttinnen zu kaufen.
Henry wollte unbedingt alle drei sein Eigen nennen und sich um den Erwerb der dritten Statue kümmern, sobald die zweite in seinem Besitz wäre. Wenn er erst einmal das komplette Set besäße … nun, das konnte man dann bestimmt Erste Klasse nennen.
Wyley’s Antiquitäten würde damit alle Konkurrenten übertrumpfen.
Persönliche und berufliche Befriedigung – und alles wegen drei kleinen Silberstatuen, die allerdings ziemlich viel wert waren. Zusammen waren sie sogar ungeheuer viel wert. Vielleicht würde er sie eine Zeit lang ans Metropolitan Museum ausleihen. Ja, die Vorstellung gefiel ihm.
DIE DREI PARZEN
LEIHGABE AUS DER PRIVATSAMMLUNG
VON HENRY W. WYLEY
Edith würde ihre neuen Hüte bekommen, ihre Abendgesellschaften und ihre Spaziergänge. Und er hätte sich den Traum seines Lebens erfüllt.
Befriedigt seufzend lehnte Henry sich zurück, um eine letzte Tasse Earl Grey zu genießen.
Felix Greenfield war ein Dieb. Doch weder schämte er sich dieser Tatsache noch war er stolz darauf. Er hatte noch nie etwas anderes gemacht als stehlen. Und so wie Henry Wyley annahm, er werde noch öfter die Gelegenheit haben, auf die irische Küste zu blicken, ging Felix davon aus, dass er noch viele Jahre lang ein Dieb bleiben würde.
Er war geschickt in seiner Arbeit – zwar nicht brillant, wie er gern bereit war zuzugeben, aber gut genug, um davon leben zu können. Gut genug, um genügend Mittel für die Dritte-Klasse-Passage zurück nach England zu besitzen, während er in seiner gestohlenen Stewarduniform durch die Korridore der Ersten Klasse eilte.
In New York war ihm der Boden etwas zu heiß unter den Füßen geworden, weil ihm die Polizei wegen eines verpfuschten Diebstahls dicht auf den Fersen war. Und dabei lag es noch nicht einmal an ihm, jedenfalls nicht allein. Er hatte lediglich den Fehler gemacht, zum ersten Mal eines seiner ungeschriebenen Gesetze zu brechen und den Diebstahl gemeinsam mit einem Partner zu begehen.
Es war die falsche Entscheidung gewesen, denn sein Partner hatte eine weitere Regel gebrochen: Stiehl niemals, wenn es nicht leicht und diskret zu erledigen ist. Die Gier hat den alten Two-Pint Monk blind gemacht, dachte Felix seufzend, als er in die Suite der Wyleys schlüpfte. Was hatte sich der Mann bloß dabei gedacht, als er unbedingt dieses Collier aus Diamanten und Saphiren mitgehen lassen wollte? Und dann hatte er sich auch noch wie ein Amateur aufgeführt und – von seinen üblichen zwei Pint Lagerbier betrunken wie ein Seemann – mit dem Diebstahl geprahlt.
Nun ja, Two-Pint konnte jetzt im Gefängnis weiterprahlen, allerdings gab es da kein Lager, das ihm seine blöde Zunge lösen konnte. Aber leider hatte der Bastard gesungen und den Bullen Felix’ Namen genannt.
Da war es wohl das Beste gewesen, eine nette Seereise anzutreten – und wo konnte man sich schon besser verstecken als auf einem Schiff, das so groß war wie eine Stadt?
Ein wenig Sorge hatte Felix allerdings der Krieg in Europa bereitet und das Gerede, dass die Deutschen auch Schiffe auf dem Meer angriffen. Aber das waren schließlich nur vage, abstrakte Warnungen. Die New Yorker Polizei und die Aussicht auf einen langen Aufenthalt hinter Gittern waren viel unmittelbarere und persönlichere Bedrohungen.
Felix konnte sich auf jeden Fall nicht vorstellen, dass ein so prächtiges Schiff wie die Lusitania den Atlantik überqueren würde, wenn wirklich Gefahr drohte. Nicht mit all diesen reichen Leuten an Bord. Schließlich war es ein ziviles Schiff, und die Deutschen hatten sicher Besseres zu tun, als einen Luxusliner anzugreifen, auf dem sich so viele amerikanische Bürger befanden.
Zum Glück hatte Felix ein Ticket ergattern und in der Menge der Passagiere untertauchen können.
Es hatte jedoch alles sehr schnell gehen müssen, und die Überfahrt hatte ihn all seine Ersparnisse gekostet.
Aber auf solch einem vornehmen, luxuriösen Schiff voller vornehmer, luxuriöser Menschen gab es sicher ein paar Gelegenheiten, um die Kasse wieder aufzufüllen.
Am besten war natürlich Bargeld. Bargeld hatte nie die falsche Größe oder Farbe.
Felix sah sich in der Suite um und pfiff leise durch die Zähne. Stell dir nur mal vor, du könntest so stilvoll reisen, dachte er und gestattete sich einen kleinen Moment der Träumerei.
Er verstand zwar weniger von der Architektur und dem Stil, der ihn umgab, als ein Floh von der Rasse des Hundes, den er beißt, aber dass die Einrichtung gediegen war, erkannte Felix auf den ersten Blick.
Der Salon war größer als seine ganze Dritte-Klasse-Kabine, und auch das Schlafzimmer war riesig.
Die Passagiere, die hier schliefen, wussten nichts von der drangvollen Enge, den dunklen Ecken und üblen Gerüchen in der Dritten Klasse. Felix neidete ihnen ihre Privilegien jedoch nicht. Schließlich könnte er niemanden bestehlen, wenn es diese reichen Menschen nicht gäbe.
Aber jetzt durfte er nicht noch mehr Zeit mit Träumereien verschwenden. Es war schon kurz vor drei, und wenn die Wyleys sich an ihren üblichen Tagesablauf hielten, würde die Frau noch vor vier herunterkommen, um ihr Mittagsschläfchen zu halten.
Felix hatte geschickte Hände, und während er nach Bargeld suchte, bemühte er sich, möglichst wenig Unordnung zu machen. Große Scheine hatten die Wyleys wahrscheinlich in der Obhut des Chefstewards gelassen. Aber solch vornehme Herrschaften hatten gern stets ein bisschen Geld zur Hand.
Er entdeckte einen Umschlag, auf dem das Wort STEWARD stand, und als er ihn grinsend öffnete, fand er ein reichliches Trinkgeld darin, das er in die Hosentasche seiner geliehenen Uniform gleiten ließ.
Innerhalb von zehn Minuten hatte er fast hundertfünfzig Dollar gefunden und eingesteckt, und dazu noch ein paar hübsche Granatohrringe, die die Frau sorglos in einer Handtasche aufbewahrte.
Die Schmuckkoffer fasste er nicht an – weder den des Mannes noch den der Frau. Damit würde er nur Probleme heraufbeschwören. Doch als er vorsichtig die Wäscheschubladen durchwühlte, ertasteten seine Finger einen in Samt eingeschlagenen, harten Gegenstand.
Neugierig schlug Felix das Tuch auf.
Er verstand nichts von Kunst, aber reines Silber erkannte er auf den ersten Blick. Die Dame – es war nämlich eine Frau – war so klein, dass sie in seine Faust passte. Sie hielt eine Art Spindel in der Hand und trug ein fließendes Gewand.
Sie sah hübsch aus. Anziehend, konnte man fast sagen, wenn auch für seinen Geschmack ein bisschen zu kühl und berechnend.
Er bevorzugte Frauen, die ein bisschen dumm, dafür aber von heiterem Gemüt waren.
Bei der Statue lag ein Zettel mit einem Namen und einer Adresse sowie der gekritzelten Notiz Kontakt für die zweite Parze.
Felix betrachtete den Zettel und prägte sich die Adresse aus Gewohnheit ein. Möglicherweise war das ein weiteres Opfer, das er ausnehmen konnte, wenn er in London war.
Er begann, die kleine Statue wieder einzuschlagen, um sie an ihren Platz zurückzulegen, wickelte sie dann aber noch einmal aus. In seiner langen Karriere als Dieb hatte er noch nie einem persönlichen Begehren nachgegeben, dem Wunsch, einen Gegenstand zu behalten.
Diebesgut war für ihn stets nicht mehr als ein Mittel zum Zweck gewesen. Aber jetzt stand Felix Greenfield in der luxuriösen Kabine auf dem prächtigen Schiff, das gerade an der irischen Küste vorbeiglitt, und spürte das Verlangen, die kleine Silberstatue zu besitzen.
Sie war so … hübsch! Und sie schmiegte sich so gut in seine Hand. So ein kleines Ding. Wer würde sie schon vermissen?
»Sei nicht dumm«, murmelte er und wickelte die Statue wieder in den Samtlappen. »Nimm das Geld, Kumpel, und sieh zu, dass du wegkommst.«
Als er sie gerade wieder in die Schublade zurücklegen wollte, vernahm Felix ein Donnergrollen. Der Boden unter seinen Füßen bebte. Felix verlor beinahe das Gleichgewicht und taumelte auf die Tür zu, die Statue immer noch in der Hand.
Ohne nachzudenken stopfte er sie in die Hosentasche und trat in den Korridor, als sich plötzlich der Boden unter ihm hob.
Wieder ertönte ein Geräusch, dieses Mal jedoch kein Donnern, sondern eher ein Dröhnen, als ob ein großer Hammer auf das Schiff einschlüge.
Felix rannte um sein Leben.
Und lief mitten ins Chaos hinein.
Das Schiff neigte sich mit einem Ruck zur Seite, sodass Felix stürzte und hilflos den Flur entlangrollte. Überall ertönten Schreie und hastige Schritte. Die Lichter gingen aus, und er schmeckte Blut in seinem Mund.
Sein erster panischer Gedanke war, dass das Schiff einen Eisberg gerammt haben könnte, so wie es der Titanic passiert war. Aber an diesem warmen Frühlingstag, so nahe der irischen Küste, konnte es doch wohl kaum Eisberge geben.
An die Deutschen dachte er nicht. Auch nicht an den Krieg.
Felix rappelte sich hoch, rannte in dem stockdunklen Flur gegen Wände, stolperte, als er die Treppe hinaufstürzte, über seine eigenen Füße und fand sich plötzlich an Deck wieder, wo es vor Menschen nur so wimmelte. Die Rettungsboote wurden bereits hinuntergelassen, und überall waren Entsetzensschreie zu hören, während Frauen und Kinder angewiesen wurden, in die Boote zu klettern.
Das kann doch nicht wahr sein, dachte Felix voller Panik, wo doch die grüne Küstenlinie bereits deutlich zu erkennen ist! In diesem Moment neigte sich das Schiff erneut zur Seite, und eines der Rettungsboote, das gerade hinuntergelassen wurde, kippte um. Die Passagiere stürzten schreiend ins Meer.
Felix war umgeben von entsetzten Gesichtern. Überall auf dem Deck lagen Trümmer, die stöhnende, blutende Passagiere unter sich begraben hatten. Manche bewegten sich schon nicht mehr.
Und Felix roch, was er schon oft in seinem Leben gerochen hatte.
Er roch den Tod.
Frauen umklammerten ihre Kinder und weinten oder beteten. Männer rannten voller Panik umher oder versuchten hektisch, die Verwundeten unter den Trümmern hervorzuziehen.
Durch das Chaos eilten Stewards und verteilten Schwimmwesten. Sie wirken so ruhig, als ob sie Tee servierten, dachte Felix, als einer der Männer an ihm vorbeikam.
»Na los, Mann, tu deine Pflicht! Kümmere dich um die Passagiere!«
Es dauerte einen Augenblick, bis Felix einfiel, dass er ja immer noch die gestohlene Stewarduniform trug. Und einen weiteren Moment, bis er begriff, wirklich begriff, dass das Schiff unterging.
Verflucht, wir sterben!, dachte er inmitten der Schreie und Gebete.
Vom Wasser her waren verzweifelte Hilferufe zu hören. Felix drängte sich bis an die Reling durch, sah Menschen im Wasser treiben. Sah Menschen ertrinken.
Als ein weiteres Rettungsboot hinabgelassen wurde, fragte er sich, ob er eine Chance hätte, hineinzuspringen und sich zu retten. Er versuchte, an eine höher gelegene Stelle des Decks zu gelangen, um festen Boden unter die Füße zu bekommen. Er konnte an nichts anderes denken als daran, wie er es schaffen konnte zu überleben.
Das Deck neigte sich noch weiter zur Seite, und er rutschte mit zahllosen anderen Menschen auf das Wasser zu. Es gelang ihm, sich mit einer Hand an der Reling festzuklammern und gleichzeitig wie durch ein Wunder mit der anderen eine Schwimmweste aufzufangen, die an ihm vorbeirutschte.
Dankesgebete murmelnd begann er, sie sich umzulegen. Das ist ein Zeichen, dachte er, ein Zeichen Gottes, dass ich überleben soll.
Während er noch mit zitternden Fingern an der Schwimmweste herumfummelte, entdeckte er eine Frau, die zwischen ein paar umgestürzten Deckstühlen eingeklemmt war. Ein kleines Kind mit engelhaftem Gesichtchen klammerte sich an sie. Die Frau weinte nicht. Sie schrie auch nicht. Sie wiegte einfach nur den kleinen Jungen in ihren Armen.
»Heilige Maria, Mutter Gottes …« Felix kroch über das Deck auf die Frau zu und zerrte an den Stühlen, die auf ihr lagen.
»Ich habe mir das Bein verletzt.« Sie strich ihrem Kind über das Haar, und die Ringe an ihren Fingern funkelten in der Frühlingssonne. Ihre Stimme klang zwar ruhig, aber ihre Augen waren weit aufgerissen, glasig vor Schock und Schmerzen und dem gleichen Entsetzen, das auch Felix das Herz bis zum Halse schlagen ließ.
»Ich glaube nicht, dass ich laufen kann. Können Sie meinen kleinen Jungen nehmen? Bitte, bringen Sie ihn zu einem Rettungsboot. Bringen Sie ihn in Sicherheit.«
Felix überlegte nur einen Herzschlag lang. Und dann lächelte das Kind.
»Legen Sie die Schwimmweste an, Missus, und halten Sie den Jungen fest.«
»Wir ziehen sie besser meinem Sohn an.«
»Sie ist ihm zu groß. Sie würde ihm nichts nutzen.«
»Ich habe meinen Mann verloren.« Ihre Aussprache war deutlich und kultiviert, und sie blickte ihn aus ihren glasigen Augen unverwandt an, während Felix ihr die Schwimmweste überstreifte. »Er ist über die Reling gestürzt. Ich fürchte, er ist tot.«
»Aber Sie nicht, nicht wahr? Und der Junge auch nicht.« Durch den beißenden Gestank von Panik und Tod konnte er das Kind riechen – Puder, Jugend, Unschuld. »Wie heißt er?«
»Steven. Steven Edward Cunningham der Dritte.«
»Dann werde ich jetzt Sie und Steven Edward Cunningham den Dritten zu einem Rettungsboot bringen.«
»Wir sinken.«
Felix zog die Frau hoch und versuchte abermals, auf einen höher liegenden Teil des Decks zu gelangen.
Auf allen vieren kroch er über die nassen, steil ansteigenden Planken.
»Halt dich gut an Mama fest, Steven«, hörte er die Frau sagen, die hinter ihm herkroch.
»Hab keine Angst«, keuchte sie. Ihre schweren Röcke schleiften im Wasser, und Blut verschmierte die glitzernden Steine an ihren Fingern. »Du musst tapfer sein. Lass Mama auf keinen Fall los.«
Wie ein Äffchen klammerte sich der kleine Junge, der höchstens drei Jahre alt sein konnte, an den Hals der Mutter.
Deckstühle, Tische, alle möglichen Gegenstände polterten das schräg stehende Deck hinunter. Stück für Stück zog Felix die Frau mühsam weiter. »Gleich haben wir es geschafft«, keuchte er, ohne zu wissen, ob das überhaupt stimmte.
Etwas schlug ihm hart auf den Rücken, und die Hand der Frau entglitt der seinen.
»Missus!«, schrie er und versuchte verzweifelt, sie wieder zu ergreifen. Er erwischte jedoch nur die glatte Seide ihres Kleiderärmels, die sofort riss. Hilflos starrte er auf das Stück Stoff in seiner Hand.
»Gott segne Sie!«, stieß die Frau noch hervor, dann rutschte sie, die Arme fest um ihren Sohn geschlungen, über die Kante ins Wasser.
Felix hatte kaum Zeit, einen Fluch zu murmeln, als das Deck sich ein weiteres Stück hob und er ebenfalls in die Tiefe gerissen wurde.
Die Kälte raubte ihm den Atem. Halb gelähmt vor Schock trat er wild um sich. Als er auftauchte und gierig nach Luft schnappte, musste er feststellen, dass er sich in einer Hölle befand, die schlimmer war, als er sie sich je hätte vorstellen können.
Überall um ihn herum schwammen Leichen. Er befand sich in einem Meer voller Toter und Ertrinkender. Seine Gliedmaßen wurden schon steif von der Kälte, als es ihm schließlich gelang, sich auf eine Holzkiste zu ziehen, die auf den Wellen tanzte.
Von dort aus war der Anblick noch schlimmer. Hunderte von Leichen trieben im Meer, das noch immer von der Sonne beschienen wurde. Felix drehte sich der Magen um und er erbrach sich ins Wasser. Mit Schwimmbewegungen versuchte er, ein gekentertes Rettungsboot zu erreichen.
Aber die Strömung zog ihn gnadenlos immer weiter fort.
Das prächtige Schiff, der schwimmende Palast, sank vor seinen Augen. Rettungsboote, nutzlos wie Spielzeuge, baumelten an den Seiten. Es erstaunte ihn, dass immer noch so viele Menschen an Deck waren. Manche knieten ganz ruhig da, andere rannten panisch umher und versuchten, ihrem Schicksal zu entkommen.
Voller Entsetzen musste er zusehen, wie immer mehr Passagiere über Bord gingen. Und dann neigten sich die großen schwarzen Schornsteine dem Wasser entgegen, genau zu der Stelle, wo er mit seiner Kiste trieb.
Als sie auf der Meeresoberfläche aufschlugen, strömten die Wassermassen hinein und rissen durch die Sogwirkung auch Menschen mit sich.
So will ich nicht sterben, dachte Felix und strampelte hektisch mit den Beinen. Auf diese Art sollte kein Mensch sterben müssen. Aber der Sog zog ihn in die Tiefe, und das Wasser um ihn herum schien zu brodeln. Er würgte, schmeckte Salz, Öl und Rauch. Dann stieß sein Körper an eine Wand, und er war in einem der Schornsteine gefangen. Er hatte keine Chance, sich zu befreien. Er würde ertrinken.
Als seine Lungen zu bersten drohten, dachte er an die Frau und den kleinen Jungen. Da er es für sinnlos hielt, für sich selbst zu beten, betete er zu Gott, dass wenigstens sie überleben würden.
Wenn Felix später an diesen Moment zurückdachte, kam es ihm immer so vor, als hätten ihn Hände gepackt und aus dem Schornstein herausgezerrt. Doch in Wahrheit wurde er mit einem Schwall von Ruß hinausgeschleudert, als der Schornstein unter der Wasseroberfläche verschwand.
Er griff nach einer Planke, die im Wasser trieb, und hievte seinen schmerzenden Körper hinauf. Dann legte er die Wange auf das Holz und begann leise zu weinen.
Die Lusitania war verschwunden.
Noch während er voller Entsetzen sah, wie die versunkenen Schornsteine Unmengen rußiger Leichen ausspuckten, wurde die Wasseroberfläche auf einmal ganz ruhig. Nur noch das Kreischen der Möwen und das Schluchzen und die Schreie derjenigen, die mit ihm im Wasser trieben, waren zu hören.
Wahrscheinlich werde ich erfrieren, dachte er, während er halb bewusstlos dahintrieb. Aber immer noch besser, als zu ertrinken.
Die Kälte weckte Felix aus seiner Ohnmacht auf. Sein ganzer Körper schmerzte, und die kleinste Brise brachte neue Qualen. Er wagte kaum, sich zu bewegen, und zupfte an seinem durchnässten Stewardjackett. Ein scharfer Schmerz schoss durch seinen Körper, und ihm wurde erneut übel. Unsicher fuhr er sich mit der Hand durch das Gesicht. Sie war rot von Blut.
Hysterisch lachte er auf. Würde er nun erfrieren oder verbluten? Vielleicht wäre er doch besser ertrunken! Dann wäre es jetzt wenigstens vorbei. Langsam wischte er sich mit dem Ärmel des Jacketts das Blut vom Gesicht. Irgendetwas stimmt mit meiner Schulter nicht, stellte er fest.
Um ihn herum war es still geworden. Vereinzelt hörte er noch Schreie, Stöhnen und Gebete, aber die meisten der Passagiere waren wohl mittlerweile tot.
Eine Leiche trieb vorbei. Es dauerte einen Moment, bis Felix das totenblasse Gesicht mit den tiefen Wunden erkannte.
Wyley. Gütiger Himmel!
Zum ersten Mal, seit der Albtraum begonnen hatte, tastete Felix nach dem Gegenstand in seiner Tasche. Die Statue, die er dem Mann gestohlen hatte, der jetzt blicklos im Wasser an ihm vorbeitrieb.
»Du brauchst sie nicht mehr«, murmelte er zähneklappernd, »aber ich schwöre bei Gott, wenn ich geahnt hätte, was passiert, hätte ich sie dir nicht gestohlen. Das ist ja fast wie Grabschändung.«
Und er faltete die Hände zum Gebet, wie er es als Kind gelernt hatte. »Wenn ich heute sterbe, werde ich mich persönlich bei dir entschuldigen, falls wir auf derselben Seite des großen Tores landen. Und wenn ich überlebe, so gelobe ich, dass ich versuchen werde, alles wieder gutzumachen.«
Felix verlor erneut das Bewusstsein. Als er erwachte, hörte er das Stampfen eines Motors. Benommen hob er die Hand. Er sah ein Boot und hörte über dem Dröhnen in seinen Ohren die Schreie und Stimmen von Männern.
Er versuchte zu rufen, brachte aber nur ein heiseres Husten hervor.
»Ich lebe …« Seine Stimme war nur ein Krächzen, das der Wind davontrug. »Ich lebe noch!«
Er spürte nicht mehr, dass ihn kräftige Hände auf den Fischkutter Dan O’Connell hievten. Kälte und Schmerzen trübten sein Bewusstsein, während man ihn in eine Decke wickelte und ihm heißen Tee einflößte. An seine eigentliche Rettung würde er sich später nicht mehr erinnern können, ebenso wenig an die Namen der Männer, die ihn in Sicherheit gebracht hatten. Er bekam nichts von den Geschehnissen mit, bis er in einem schmalen Bett in einem kleinen, sonnigen Zimmer erwachte, fast vierundzwanzig Stunden, nachdem der Torpedo das Passagierschiff getroffen hatte.
Nie würde Felix jedoch den Anblick vergessen, der ihn begrüßte, als sein Blick wieder klar wurde.
Sie war jung und hübsch, hatte blaue Augen und goldene Sommersprossen auf ihrer kleinen Nase und den runden Wangen. Ihr blondes Haar war zu einem Knoten aufgesteckt, aus dem sich einzelne Strähnen gelöst hatten. Lächelnd blickte sie Felix an und erhob sich rasch von dem Stuhl, auf dem sie gesessen und Socken gestopft hatte.
»Da sind Sie ja! Ich habe mich schon gefragt, ob Sie überhaupt jemals aufwachen würden.«
Er erkannte den irischen Akzent in ihrer Stimme, spürte, wie sie mit starker Hand sein Kinn hob. Und er roch einen Hauch von Lavendel.
»Was …« Seine krächzende Stimme erschreckte ihn. Seine Kehle war wie ausgetrocknet, und sein Kopf fühlte sich an, als sei er mit schmutzigen Lumpen ausgestopft.
»Nehmen Sie zuerst diese Medizin, die der Arzt für Sie hier gelassen hat. Sie haben eine Lungenentzündung und eine tiefe Schnittwunde am Kopf, die genäht werden musste. Außerdem haben Sie sich anscheinend die Schulter gezerrt. Aber das Schlimmste haben Sie überstanden, Sir, und jetzt ruhen Sie sich einfach aus. Wir kümmern uns um Sie.«
»Was … ist geschehen? Das Schiff …«
Sie kniff die hübschen Lippen zusammen. »Die verdammten Deutschen! Ein U-Boot hat das Schiff torpediert. Dafür, dass sie so viele Menschen getötet haben, werden sie in der Hölle schmoren.«
Eine Träne rann ihr über die Wange, aber sie achtete nicht darauf und flößte ihm geschickt die Medizin ein. »Sie müssen sich ausruhen. Es ist ein Wunder, dass Sie überlebt haben, denn mehr als tausend Menschen sind umgekommen.«
»Tau...« Entsetzt packte er sie am Handgelenk. »Tausend?«
»Mehr als tausend. Aber Sie sind hier in Queenstown, und es kann Ihnen nichts geschehen.« Sie legte den Kopf schräg. »Sie sind Amerikaner, nicht wahr?«
Eigentlich ja, dachte er. Schließlich hatte er sein Heimatland England seit mehr als zwölf Jahren nicht mehr gesehen. »Ja. Ich brauche …«
»Tee«, unterbrach sie ihn. »Und Brühe.« Sie trat an die Tür und rief: »Ma! Er ist wach und scheint es auch bleiben zu wollen.« Sie warf ihm einen Blick zu. »Ich komme gleich wieder und bringe Ihnen etwas Warmes zu essen.«
»Danke. Wer sind Sie?«
»Ich?« Sie lächelte wieder. Es war, als ob die Sonne über ihr Gesicht glitte. »Ich bin Meg. Meg O’Reiley, und dies ist das Haus meiner Eltern, Pat und Mary O’Reiley, wo Sie uns willkommen sind, bis Sie wieder gesund sind. Und Ihr Name, Sir?«
»Greenfield. Felix Greenfield.«
»Gott schütze Sie, Mr Greenfield.«
»Warten Sie … auf dem Schiff waren eine Frau und ein kleiner Junge … Cunningham.«
Mitleidig blickte sie ihn an. »Die Listen mit den Namen der Toten werden gerade geschrieben. Ich schaue für Sie nach, sobald ich kann. Aber jetzt müssen Sie sich ausruhen. Ich hole Ihnen einen Tee.«
Als sie hinausgegangen war, drehte Felix sein Gesicht zum Fenster, der Sonne entgegen. Auf dem Tisch sah er das Geld und die Granatohrringe liegen, die in seiner Tasche gesteckt hatten. Und daneben lag die kleine silberne Statue und funkelte im Sonnenlicht.
Ein wehmütiges Lächeln huschte über sein Gesicht.
Er erfuhr, dass die O’Reileys vom Meer lebten. Pat und seine beiden Söhne waren bei der Rettungsmannschaft gewesen. Er lernte sie alle kennen und ihre jüngere Schwester auch. Am ersten Tag war er jedoch noch nicht in der Lage, sich die Gesichter einzuprägen. Bis auf Megs.
Um nicht wieder in die Dunkelheit zurückzugleiten, klammerte er sich an die junge Frau, wie er sich im Wasser an die Planke geklammert hatte.
»Erzählen Sie mir, was Sie wissen«, bat er sie.
»Die Wahrheit ist schwer zu ertragen. Und mir fällt es schwer, darüber zu sprechen.« Meg trat ans Fenster und blickte über das Dorf, in dem sie seit ihrer Geburt vor achtzehn Jahren lebte. In Hotelzimmern oder den Häusern von Nachbarn wurden andere Überlebende des Schiffsunglücks gepflegt. Die Toten hatte man in behelfsmäßigen Leichenhallen aufgebahrt. Einige sollten hier beerdigt, andere nach Hause überführt werden. Und wieder andere würden für immer in den Tiefen des Meeres liegen.
»Als ich von dem Unglück hörte«, begann sie, »konnte ich es fast nicht glauben. Wie sollte so etwas möglich sein? Ein paar Fischkutter waren draußen, die den Überlebenden direkt zu Hilfe geeilt sind. Und von hier sind noch mehr Boote ausgelaufen. Die meisten kamen jedoch zu spät und konnten nur noch die Toten bergen. Oh, mein Gott, ich habe selbst einige von den Leuten gesehen, die an Land gebracht wurden. Frauen mit Säuglingen, Männer, die kaum laufen konnten und halb nackt waren. Manche haben geweint, andere starrten nur vor sich hin. Es heißt, das Schiff sei in weniger als zwanzig Minuten gesunken. Kann das denn sein?«
»Ich weiß es nicht«, murmelte Felix und schloss die Augen.
Sie blickte ihn an und hoffte, dass er stark genug war, ihren Bericht weiter zu ertragen. »Hier an Land sind noch weitere Passagiere gestorben. Ihre Verletzungen waren zu schwer, und manche hatten stundenlang im Wasser gelegen. Die Listen mit den Namen der Toten werden von Minute zu Minute länger. Ich wage mir gar nicht vorzustellen, wie angstvoll die Familien auf Nachricht warten. Oder wie tief die Trauer bei denen ist, die wissen, auf welch schreckliche Art und Weise ihre Lieben umgekommen sind. Sie haben gesagt, dass es niemanden gibt, der auf eine Nachricht von Ihnen wartet?«
»Nein. Niemanden.«
Meg trat zu ihm. Sie hatte seine Wunden versorgt, hatte während des Deliriums bei ihm gewacht. Er war erst seit drei Tagen in ihrer Obhut, aber ihnen beiden kam es schon vor wie eine Ewigkeit.
»Es ist keine Schande, wenn Sie hier bleiben«, sagte sie leise. »Und es ist auch keine Schande, wenn Sie heute nicht an der Beerdigung teilnehmen. Sie sind noch viel zu schwach dazu.«
»Ich muss hingehen.« Er blickte an seiner geborgten Kleidung hinunter, in der er sich dünn und zerbrechlich vorkam. Aber er lebte.
Die Stille war fast überirdisch. Alle Läden in Queenstown hatten an diesem Tag geschlossen. Es liefen keine Kinder durch die Straßen, und niemand blieb stehen, um mit dem Nachbarn ein Schwätzchen zu halten. Durch die Stille drangen der hohle Klang der Kirchenglocken von St. Colman’s auf dem Hügel und die klagenden Töne des Trauermarsches.
Und wenn er noch hundert Jahre lebte, nie mehr würde Felix die Trauermusik, das leise, stete Dröhnen der Trommeln vergessen. Er sah die Blechinstrumente in der Sonne glänzen und dachte an das Funkeln der Antriebsschrauben der Lusitania, kurz bevor sie im Meer versunken waren.
Ich lebe, dachte er wieder. Aber an Stelle von Erleichterung und Dankbarkeit empfand er nur Schuld und Verzweiflung.
Mit gesenktem Kopf trottete er durch die stillen Straßen im Trauerzug mit. Es dauerte mehr als eine Stunde, bis sie den Friedhof erreichten, und Felix war ganz schwindlig. Als er die drei Massengräber sah, die unter den großen Ulmen ausgehoben worden waren, musste er sich schwer auf Meg stützen.
Angesichts der winzigen Särge, in denen die toten Kinder lagen, traten ihm die Tränen in die Augen.
Er lauschte dem leisen Weinen ringsum und den Worten des katholischen Priesters und dann denen des Pfarrers der Kirche von Irland. Doch nichts von dem Gesagten erreichte ihn wirklich. In seinem Innern hörte er immer noch, wie die Menschen Gott angerufen hatten, bevor sie ertranken. Aber Gott hatte sie nicht erhört und sie einen furchtbaren Tod sterben lassen.
Als Felix den Kopf hob, erblickte er die Frau und den kleinen Jungen vom Schiff.
Und auf einmal strömten seine Tränen, rannen wie Regentropfen über seine Wangen, während er sich durch die Menge drängte. Als er bei ihr angelangt war, erklangen die ersten Töne von »O bleibe, Herr«. Felix sank vor dem Rollstuhl der Frau auf die Knie.
»Ich hatte befürchtet, Sie seien tot!« Sie streckte die Hand nach seinem Gesicht aus. Um den anderen Arm trug sie einen Gips. »Ich wusste Ihren Namen nicht, deshalb konnte ich ihn auf den Listen nicht suchen.«
»Sie leben!« Sie hatte Schnittwunden im Gesicht, und ihre Wangen waren gerötet, als habe sie Fieber. Auch ihr Bein war eingegipst. »Und der Junge auch.«
Das Kind schlief in den Armen einer anderen Frau. Wie ein Engel, dachte Felix. Friedlich und unversehrt.
Die Verzweiflung, die ihn mit eiserner Faust umklammert hatte, ließ nach. Ein Gebet, wenigstens ein einziges Gebet, war erhört worden.
»Er hat mich die ganze Zeit über nicht losgelassen.« Die Frau begann leise zu weinen. »Er ist so ein guter Junge. Er hat mich nicht losgelassen. Ich habe mir bei dem Sturz ins Wasser den Arm gebrochen. Wenn Sie mir nicht Ihre Schwimmweste gegeben hätten, wären wir ertrunken. Mein Mann …« Ihre Stimme versagte, als sie über die Gräber blickte. »Sie haben ihn nicht gefunden.«
»Das tut mir Leid.«
»Er hätte Ihnen gedankt.« Sie streichelte mit ihrer gesunden Hand über das Bein des Jungen. »Er hat seinen Sohn sehr geliebt.« Sie holte tief Luft. »An seiner statt danke ich Ihnen für das Leben meines Sohnes und mein eigenes. Bitte sagen Sie mir Ihren Namen.«
»Felix Greenfield, Ma’am.«
»Mr Greenfield.« Sie beugte sich vor und streifte mit ihren Lippen Felix’ Wange. »Ich werde Sie nie vergessen. Und mein Sohn auch nicht.«
Als man sie in ihrem Rollstuhl fortbrachte, hielt sie die Schultern ganz gerade, mit einer stillen Würde, die Felix die Schamröte ins Gesicht steigen ließ.
»Sie sind ein Held«, sagte Meg zu ihm.
Kopfschüttelnd strebte er, so rasch er konnte, dem Ausgang zu. »Nein. Die Heldin ist sie. Ich bin ein Nichts.«
»Wie können Sie das sagen? Ich habe gehört, was sie zu Ihnen gesagt hat. Sie haben ihr und dem kleinen Jungen das Leben gerettet.« Besorgt eilte Meg an seine Seite und ergriff seinen Arm, um ihn zu stützen.
Wenn er die Kraft besessen hätte, hätte er Meg abgeschüttelt, aber so ließ er sich einfach in das hohe, wilde Gras auf dem Friedhof sinken und vergrub sein Gesicht in den Händen.
»Na, na.« Voller Mitgefühl hockte sie sich neben ihn und nahm ihn in die Arme. »Ist ja schon gut, Felix.«
Er konnte an nichts anderes denken als an den tapferen Gesichtsausdruck der jungen Witwe, an die Unschuld auf dem Gesicht des kleinen Jungen. »Sie war verletzt, deshalb hat sie mich gebeten, den Jungen mitzunehmen und ihn zu retten.«
»Und Sie haben sie beide gerettet.«
»Ich weiß nicht, warum. Ich habe doch nur an meine eigene Rettung gedacht. Ich bin ein Dieb. Die Sachen, die Sie aus meiner Tasche genommen haben, habe ich gestohlen. Ich habe sie in dem Moment gestohlen, als das Schiff getroffen wurde. Und ich habe nur daran gedacht, lebend herauszukommen.«
Meg faltete die Hände. »Aber Sie haben ihr doch Ihre Schwimmweste gegeben!«
»Es war gar nicht meine. Ich weiß nicht, warum ich sie ihr gegeben habe. Die Frau lag unter ein paar umgestürzten Deckstühlen und hielt den Jungen im Arm. Und sie war so tapfer.«
»Sie hätten sich ohne weiteres abwenden und sie sich selbst überlassen können.«
Er rieb sich die Augen. »Das wollte ich zunächst auch.«
»Aber Sie haben es nicht getan.«
»Ich weiß nicht, warum.« Er wusste nur, dass sich etwas in ihm verändert hatte, seit er die Frau lebend wiedergesehen hatte. »Aber vor allem geht es darum, dass ich nur auf dem Schiff war, weil ich vor der Polizei geflohen bin. Ich habe einen Mann bestohlen, wenige Minuten, bevor er starb. Und nun sind mehr als eintausend Menschen tot. Ich habe viele von ihnen sterben sehen. Ich aber lebe. Was ist das für eine Welt, in der ein Dieb gerettet wird und Kinder sterben müssen?«
»Wer weiß darauf die Antwort? Aber da ist ein Kind, das lebt, weil Sie da waren. Wären Sie denn zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen, wenn Sie nicht vorher etwas gestohlen hätten?«
Er stieß ein verächtliches Lachen aus. »Meinesgleichen kommt unter normalen Umständen niemals in die Erste Klasse.«
»Na, sehen Sie.« Meg zog ein Taschentuch aus der Tasche und trocknete ihm die Tränen, als sei er ein Kind. »Zu stehlen ist falsch. Es ist eine Sünde, das ist gar keine Frage. Aber wenn Sie sich nur um sich selbst gekümmert hätten, wären diese Frau und ihr Sohn jetzt tot. Wenn eine Sünde unschuldige Leben rettet, dann ist es, glaube ich, keine besonders große Sünde. Und so viel haben Sie schließlich auch nicht gestohlen, es sind ja nur ein Paar Ohrringe, eine kleine Statue und ein paar amerikanische Dollar.«
Felix musste unwillkürlich lächeln. »Nun, ich hatte ja auch gerade erst angefangen.«
Liebevoll erwiderte sie sein Lächeln. »Ja. Ich würde auch sagen, dass Sie gerade erst angefangen haben.«
2
Helsinki, 2002
Sie war nicht so, wie er erwartet hatte. Er hatte ihr Foto auf der Rückseite ihres Buches und auf dem Programmheft für die Lesung – würde die denn nie aufhören? – betrachtet, aber in Wirklichkeit sah sie anders aus.
Zunächst einmal war sie kleiner, als er es sich vorgestellt hatte. Fast zierlich in ihrem grauen Kostüm, dessen Rock seiner Meinung nach ein gutes Stück kürzer hätte sein können. Soweit er es beurteilen konnte, waren ihre Beine nicht übel.
In der Realität wirkte sie nicht annähernd so kompetent und einschüchternd wie auf dem Schutzumschlag. Lediglich die kleine Silberrandbrille, die sie beim Lesen trug, verlieh ihr eine gewisse intellektuelle Note.
Sie hatte eine gute Stimme. Trotzdem wirkte sie beinahe einschläfernd auf ihn. Allerdings lag das wohl eher am Thema. Er war zwar durchaus an griechischer Mythologie interessiert – an einem bestimmten griechischen Mythos –, aber eine stundenlange Vorlesung über sämtliche Götter über sich ergehen lassen zu müssen, war ziemlich langweilig.
Er richtete sich auf und versuchte sich zu konzentrieren. Nicht auf die Wörter. Er scherte sich nicht im Geringsten darum, ob nun Artemis irgendeinen armen Kerl in einen Hirsch verwandelte, weil er sie nackt gesehen hatte. Das bewies nur, dass Frauen, ob sie nun Göttinnen waren oder nicht, sonderbare Geschöpfe waren.
Seiner Meinung nach war auch Dr. Tia Marsh äußerst sonderbar. Sie stammte aus einer Familie mit viel Geld. Sehr viel Geld. Doch statt sich zurückzulehnen und es zu genießen, widmete sie sich den griechischen Göttern. Schrieb über sie, hielt Vorlesungen. Unermüdlich.
Sie stammte aus einer alten Familie. Generationen von Blut so blau wie die Seen in Kerry. Und jetzt saß sie hier in Finnland und hielt ihren Vortrag, genauso, wie sie es vorher vermutlich in Schweden und Norwegen getan hatte. In ganz Europa warb sie für ihr Buch.
Es kann ihr doch dabei unmöglich ums Geld gehen, überlegte er. Vielleicht hört sie sich ja nur gern selbst reden. Das geht schließlich vielen Leuten so.
Seinen Informationen nach war sie neunundzwanzig, alleinstehend, das einzige Kind der Marshs in New York und, was am wichtigsten war, die Ururenkelin von Henry W. Wyley.
Wyley’s Antiquitäten war, wie auch schon fast hundert Jahre zuvor, eines der angesehensten Antiquitäten- und Auktionshäuser in New York.
Es war kein Zufall, dass Wyleys Nachkommen solches Interesse an griechischen Gottheiten hatten. Und seine Aufgabe war es, herauszufinden, was Dr. Marsh über die drei Parzen wusste.
Wenn sie, nun ja, sanfter gewesen wäre, dann hätte er vermutlich versucht, sie zu verführen. Es war faszinierend, was Menschen einander erzählten, wenn Sex im Spiel war. Attraktiv war sie ja, aber er war sich nicht ganz sicher, welche Knöpfe man in romantischer Hinsicht bei einer Intellektuellen drücken musste, wenn man etwas bei ihr erreichen wollte.
Stirnrunzelnd drehte er das Buch um und betrachtete noch einmal ihr Foto. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem Knoten geschlungen. Sie lächelte, ziemlich gezwungen, wie er fand. Das Lächeln erreichte jedenfalls nicht ihre Augen – sehr nüchterne und ernst blickende blaue Augen, die zu dem nüchternen und ernsten Schwung ihrer Lippen passten.
Ihr Gesicht lief spitz zu, und er hätte es elfenhaft genannt, wenn nicht ihre Frisur so züchtig und ihr Blick so finster gewesen wären.
Sie sieht aus wie eine Frau, die lange nicht zum Lachen gebracht wurde … oder flachgelegt, dachte er. Seine Mutter und seine Schwester hätten ihn für solche Gedankengänge bestimmt zurechtgewiesen. Aber was ein Mann denkt, geht nur ihn allein etwas an.
Er sollte auf die spröde Dr. Marsh wohl sehr höflich und geschäftsmäßig zugehen.
Als der Applaus einsetzte, wesentlich enthusiastischer, als er erwartet hatte, hätte er beinahe erleichtert aufgeseufzt. Aber kaum wollte er sich erheben, schossen schon die ersten Hände in die Höhe.
Er verdrehte die Augen, schaute verärgert auf die Uhr und stellte sich auf die Fragestunde ein. Da Dr. Marsh mit einer Dolmetscherin arbeitete, würde es wahrscheinlich ewig dauern.
Er stellte fest, dass sie für diesen Teil der Veranstaltung die Brille absetzte. Sie blinzelte wie eine Eule im Sonnenlicht und holte tief Luft, so wie ein Taucher, bevor er ins Wasser springt.
Plötzlich fiel ihm etwas ein, und er hob die Hand. Es war immer am besten, erst einmal höflich an einer Tür anzuklopfen, um zu sehen, ob sie geöffnet wurde, bevor man sie eintrat.
Als sie auf ihn wies, stand er auf und bedachte sie mit einem seiner strahlendsten Lächeln. »Dr. Marsh, zunächst einmal möchte ich Ihnen für Ihren faszinierenden Vortrag danken.«
»Oh.«
Sie blinzelte, und er sah, dass sie über seinen irischen Tonfall verblüfft war. Gut, noch ein Mittel, das er einsetzen konnte. Aus Gründen, die er nicht nachzuvollziehen vermochte, waren Amerikaner oft hingerissen von einem Akzent.
»Nichts zu danken«, erwiderte sie.
»Ich habe mich immer schon für die Parzen interessiert, und ich frage mich, ob sie Ihrer Meinung nach ihre Macht einzeln oder nur als Gruppe besitzen.«
»Die Moiren oder die Parzen waren eine Triade«, begann Dr. Marsh, »jede mit einer speziellen Aufgabe. Klotho, die den Faden des Lebens spinnt, Lachesis, die ihn abmisst, also das Los zuteilt, und Atropos, die den Lebensfaden zerschneidet und damit das Leben beendet. Keine von ihnen kann ihre Aufgabe allein erfüllen. Ein Faden könnte vielleicht gesponnen werden, aber wenn er endlos lang wird, erfüllt er keinen Zweck. Und wenn er nicht gesponnen wird, kann er auch nicht abgemessen werden, und es gibt nichts zu zerschneiden. Drei Teile«, fuhr sie fort und legte die Finger zusammen, »ein Zweck. Jede für sich wäre nur eine normale, wenn auch interessante Frau. Zusammen sind sie die sehr mächtige und hoch geehrte Göttin.«
Genau, dachte er, während er sich wieder hinsetzte. Ganz genau.
Tia war hundemüde. Als die Diskussion vorbei war und sie ihre Bücher signierte, wunderte sie sich, wie sie sich überhaupt noch auf den Beinen halten konnte. Trotz des Melatonins, der Diät, der Aromatherapie und der Entspannungsübungen war ihre innere Uhr völlig durcheinander geraten.
Aber immerhin war sie in Helsinki. Und das allein war schon etwas wert. Die Menschen hier waren so nett und interessierten sich für ihre Arbeit. Genauso wie an all den anderen Orten, an denen sie gewesen war, seitdem sie New York verlassen hatte.
Wie lange ist das jetzt schon her?, überlegte Tia, während sie sich hinsetzte, den Kugelschreiber ergriff und ihr professionelles Lächeln aufsetzte. Zweiundzwanzig Tage. Sie ließ die vergangenen Tage kurz Revue passieren und machte sich klar, dass sie bereits mehr als drei Viertel dieser selbstauferlegten Tortur überstanden hatte.
»Wie überwindet man eine Phobie?«, hatte Dr. Lowenstein gefragt. »Indem man sich ihr stellt. Sie sind chronisch schüchtern mit Anflügen von Paranoia? Gehen Sie hinaus und reden Sie vor Publikum!« Sie fragte sich, ob Dr. Lowenstein einer Patientin mit Höhenangst wohl auch empfahl, von der Brooklyn Bridge zu springen.
Hatte er ihr überhaupt zugehört, als sie ihm versichert hatte, sie wisse ganz genau, dass sie unter einer sozialen Angststörung litte? Vielleicht auch unter einer Agoraphobie in Verbindung mit Klaustrophobie?
Nein, er hatte ihr nicht zugehört. Er hatte darauf bestanden, sie sei einfach nur schüchtern, und ihr erklärt, sie überließe die psychiatrischen Diagnosen besser ihm.
Als jetzt die ersten Leute aus dem Publikum auf sie zutraten, um sich ihr Buch signieren zu lassen, drehte sich Tia beinahe der Magen um. Sie wünschte, Dr. Lowenstein hätte diesen Moment miterlebt, dann hätte sie ihm nur zu gern einen Fausthieb versetzt.
Allerdings musste sie zugeben, dass es ihr insgesamt schon besser ging. Immerhin hatte sie den Vortrag dieses Mal ganz ohne Beruhigungstabletten oder einen heimlichen, von schlechtem Gewissen begleiteten Schluck Whiskey überstanden.
Aber den Vortrag halten zu müssen war auch nicht so schlimm wie das Signieren. Während der Lesung hatte sie genug Abstand von den Leuten. Und sie hatte ihre Notizen, an denen sie sich orientieren konnte.
Wenn jedoch die Leute an ihren Tisch traten, um sich ihr Buch signieren zu lassen, dann erwarteten sie, dass sie ein paar nette Worte sagte und, o Gott, Charme zeigte.
Doch ihre Hand zitterte nicht, als sie ihren Namen in das erste Buch schrieb. Und als sie seinem Besitzer antwortete, blieb auch ihre Stimme fest. Das war doch schon ein Fortschritt. In London war sie am Ende des Programms beinahe kataton gewesen. Als sie ins Hotel zurückgekehrt war, hatte sie am ganzen Leib gezittert und eine Hand voll Beruhigungspillen schlucken müssen, um in die Sicherheit des Schlafs entfliehen zu können.
Gott, wie gern wäre sie sofort wieder nach Hause geflogen. Am liebsten hätte sie sich in ihren eigenen vier Wänden verkrochen, wie ein verschrecktes Kaninchen in seinem Bau. Aber es gab Verträge, an die sie sich halten musste.
Und eine Marsh hielt immer Wort.
Jetzt konnte sie froh, sogar stolz sein, dass sie die Zähne zusammengebissen und durchgehalten hatte. Mittlerweile war sie bei der Aussicht, vor Fremden sprechen zu müssen, kaum noch nervös – vielleicht lag es ja daran, dass sie von der anstrengenden Reise schon zu erschöpft war.
Ihr Gesicht fühlte sich vom vielen Lächeln bereits taub an, als endlich das Ende der Schlange in Sicht kam. Als Tia den Kopf hob, blickte sie in die strahlend grünen Augen des Iren, der sie nach den Schicksalsgöttinnen gefragt hatte.
»Ein faszinierender Vortrag, Dr. Marsh«, sagte er mit seinem sympathischen Akzent.
»Danke. Es freut mich, dass er Ihnen gefallen hat.« Sie wollte gerade nach seinem Buch greifen, als sie merkte, dass er ihr die Hand entgegenstreckte. Verlegen legte sie den Kugelschreiber ab und schüttelte sie.
Dabei fragte sie sich, was die Leute bloß am Händeschütteln fanden. Offenbar wussten sie nicht, wie viele Keime dadurch übertragen wurden.
Seine Hand war warm und fest, und er hielt die ihre so lange, dass sie vor Verlegenheit errötete.
»Da wir gerade von Schicksal sprechen«, sagte er und lächelte sie strahlend an, »ich halte es für eine äußerst glückliche Fügung, dass Sie während meines geschäftlichen Aufenthaltes ebenfalls hier in Helsinki sind. Ich bewundere Ihre Arbeit schon seit langem.« Er log, ohne mit der Wimper zu zucken.
»Danke. Sie sind aus Irland?«
»Ja. County Cork. Aber im Moment auf Reisen, genau wie Sie.«
»Aha.«
»Reisen ist aufregend, nicht wahr?«
Aufregend?, dachte sie. »Ja, sehr.« Jetzt log sie.
»Nun, ich möchte Sie nicht länger aufhalten.« Er reichte ihr das Buch. »Mein Name ist Malachi. Malachi Sullivan.«
»Freut mich, Sie kennen zu lernen.« Sie signierte sein Buch, wobei sie krampfhaft überlegte, wie sie ihrer Unterhaltung und damit auch der Signierstunde ein Ende setzen konnte. »Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind, Mr Sullivan.« Sie stand auf. »Ich hoffe, Ihre Geschäfte in Finnland verlaufen erfolgreich.«
»Das hoffe ich auch, Dr. Marsh.«
Nein, sie war wirklich nicht so, wie er erwartet hatte, und deshalb musste Malachi sein Vorgehen neu überdenken. Man hätte Dr. Marsh für oberflächlich, kühl und ein bisschen versnobt halten können, aber er hatte gesehen, wie ihr die Röte in die Wangen gestiegen und Panik in ihrem Blick aufgeglommen war. Bestimmt ist sie schüchtern, dachte er, während er sich hinter einem Mauervorsprung versteckte, um den Hoteleingang zu beobachten.
Warum eine Frau, die geradezu im Geld schwamm und durch ihren Status jede Menge Privilegien genoss, schüchtern war, vermochte er nicht zu sagen. Aber die Menschen waren eben verschieden.
Man konnte sich allerdings ebenso gut fragen, warum ein geistig gesunder Mann, der ein einigermaßen zufriedenes Leben führte und ein gutes Einkommen hatte, nach Helsinki reiste, auf die vage Hoffnung hin, dass eine Frau, die er nicht einmal persönlich kannte, ihn zu einem Schatz führte, den es vielleicht gar nicht gab.
Aber diese Frage war vermutlich zu vielschichtig für eine einzige Antwort. Wenn er sie jedoch mit einem einzigen Wort hätte beantworten müssen, dann hätte es ›Familienehre‹ gelautet.
Und doch traf es das eben nicht ganz. Tia Marsh war nun einmal mit seiner Vergangenheit verbunden und damit auch mit seiner Zukunft. Malachi blickte auf die Armbanduhr. Er hoffte, dass Tia und er sich schon bald näher kommen würden.
Er war erleichtert, dass er richtig getippt hatte. Sie war tatsächlich von der Universität direkt ins Hotel gefahren und stieg in diesem Moment aus dem Taxi. Und sie war allein.
Langsam schlenderte er über den Bürgersteig auf sie zu. Als sie die Wagentür geschlossen hatte und sich umdrehte, stand er zum zweiten Mal an diesem Abend vor ihr.
»Hallo, Dr. Marsh.« Mit seinem Tonfall und dem breiten Lächeln versuchte er, eine vermeintlich freudige Überraschung auszudrücken. »Sie wohnen also auch hier?«
»Äh, ja … Mr Sullivan.« Sie erinnert sich tatsächlich an meinen Namen, dachte Malachi. Was er nicht ahnte, war, dass Tia während der ganzen Fahrt im Taxi darüber nachgedacht hatte, dass sie ihn äußerst attraktiv fand.
»Es ist ein nettes Hotel. Guter Service.« Er drehte sich um, als wolle er ihr voraus zum Hoteleingang gehen, hielt dann aber inne. »Dr. Marsh, Sie halten mich hoffentlich nicht für aufdringlich, aber darf ich Sie vielleicht zu einem Drink einladen?«
»Ich …« Ihre Gedanken überschlugen sich. Während der Taxifahrt war sie in einem kleinen Tagtraum versunken und hatte sich vorgestellt, dass sie in dem Gespräch mit Malachi witzig und schlagfertig gewesen sei und der Abend spontan mit einer leidenschaftlichen Affäre geendet hätte. »Ich trinke eigentlich nicht«, stieß sie hervor.
»Ach nein?« Amüsiert blickte er sie an. »Nun, das schließt den ersten Annäherungsversuch aus, den ein Mann bei einer interessanten und attraktiven Frau vielleicht wagen könnte. Was würden Sie denn von einem kleinen Spaziergang halten?«
»Wie bitte?« Tia kam nicht mehr mit. Er konnte unmöglich sie meinen. Sie war normalerweise nicht der Typ Frau, auf den die Männer flogen, vor allem nicht, wenn sie so attraktiv waren.
»Einer der Reize Helsinkis ist, dass es im Sommer abends so lange hell bleibt.« Malachi nutzte ihre Verwirrung aus, um sie sanft am Arm zu ergreifen und vom Hoteleingang fortzuführen. »Es ist jetzt schon nach halb neun, und die Sonne strahlt immer noch so hell wie am Tag. Es wäre doch eine Schande, ein solches Licht zu vergeuden, oder nicht? Waren Sie schon am Hafen?«
»Nein, ich …« Verblüfft über die Wendung der Ereignisse blickte Tia zum Hotel zurück. »Ich sollte wirklich …«
»Müssen Sie morgen früh fliegen?« Malachi wusste, dass das nicht der Fall war, und fragte sich, ob sie ihn wohl anlügen würde.
»Nein. Nein, ich bleibe bis Mittwoch.«
»Na gut. Lassen Sie mich Ihre Tasche tragen.« Ohne eine Antwort abzuwarten, nahm er ihr die Aktentasche ab und hängte sich den Riemen über die eigene Schulter. »Es muss eine echte Herausforderung sein, in einem Land Vorträge zu halten, dessen Muttersprache man nicht spricht.«
»Ich hatte eine Dolmetscherin.«
»Ja, sie war sehr gut. Aber es ist trotzdem ziemlich viel Arbeit, oder? Sind Sie nicht auch erstaunt, wie groß das Interesse der Finnen an den Griechen ist?«
»Es gibt Korrelationen zwischen den griechischen Göttern und Mythen und den nordischen. Beides sind Gottheiten mit menschlichen Schwächen und Tugenden, es gibt Abenteuer, Sex und Betrug.«
Sofort verfällt sie wieder in einen belehrenden Tonfall, dachte Malachi. »Sie haben Recht«, bestätigte er. »Ich komme auch aus einem Land, in dem Mythen geliebt werden. Waren Sie jemals in Irland?«
»Einmal, als Kind. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.«
»Wie schade. Sie müssen unbedingt noch einmal hinfahren. Ist Ihnen warm genug?«
»Ja. Mir geht es gut.« Kaum hatte Tia es ausgesprochen, wurde ihr klar, dass sie wohl besser vorgegeben hätte zu frösteln. Sie merkte, dass sie vor lauter Verwirrung gar nicht darauf geachtet hatte, wo sie hingingen, und jetzt hatte sie keine Ahnung, wie sie zum Hotel zurückfinden sollte. Aber so schwierig konnte es wohl nicht sein.
Tia fiel auf, wie gerade und sauber die Straßen in dieser Stadt waren. Und obwohl es schon auf zehn Uhr abends zuging, waren sie voller Menschen. Das lag natürlich am Licht, diesem schönen, hellen Sommerlicht, das die Stadt mit einem warmen Schimmer überzog.
Tia hatte sich bis jetzt überhaupt noch nicht in Helsinki umgesehen. Sie hatte noch keinen Spaziergang gemacht, noch nicht einmal einen Einkaufsbummel unternommen oder irgendwo eine Tasse Kaffee getrunken.
Sie hatte sich in dieser Stadt genauso verhalten, wie sie es von New York gewohnt war – nämlich sich so lange in ihrem Nest verkrochen, bis die Pflicht rief und sie einen Termin wahrnehmen musste.
Tia erinnerte Malachi an eine Schlafwandlerin, die soeben aus der Trance erwacht. Er hielt sie immer noch fest untergehakt, hatte aber jetzt keine Bedenken mehr, dass sie ihm davonlaufen würde. Um sie herum waren so viele Menschen, dass sie sich vermutlich bei ihm sicher fühlte.
Sie kamen an einen Platz, wo Musik gespielt wurde. Dort war es noch belebter. Malachi lenkte Tia um die Menge herum in Richtung Hafen. Als sie am tiefblauen Wasser standen, auf dem rote und weiße Boote auf und ab tanzten, sah er sie zum ersten Mal lächeln.
»Das ist wunderschön.« Sie musste laut sprechen, um die Musik zu übertönen. »Einfach perfekt. Ich wäre gerne mit der Fähre von Stockholm hierher gekommen, aber ich hatte Angst, ich würde seekrank werden. Aber immerhin wäre ich dann auf der Ostsee seekrank geworden, das wäre doch schon etwas Besonderes gewesen, nicht wahr?«
Er lachte, und sie blickte ihn verlegen an. Sie hatte fast vergessen, dass sie sich mit einem Fremden unterhielt. »Das klingt albern, nicht wahr?«
»Nein, es klingt reizend.« Überrascht stellte er fest, dass er es auch genauso meinte. »Lassen Sie uns das tun, was fast alle Finnen um diese Uhrzeit tun.«
»In die Sauna gehen?«
Wieder lachte er. »Einen Kaffee trinken.«
Eigentlich war es gar nicht möglich. Eigentlich konnte sie nicht um elf Uhr abends vor einem belebten Café in der warmen Sonne sitzen, in einer Stadt, die Tausende von Meilen von zu Hause entfernt war. Und ganz bestimmt konnte sie nicht einem Mann gegenübersitzen, der so unglaublich gut aussah, dass sie das Gefühl hatte, sich ständig umsehen zu müssen, ob er nicht mit jemand anderem redete.
Sein dichtes braunes Haar wurde von der leichten Brise zerzaust und schimmerte in der Sonne. Er hatte ein schmales Gesicht mit Grübchen auf den glatt rasierten Wangen, und sein schöner Mund konnte sich zu einem Lächeln verziehen, das ihr Herz schneller schlagen ließ.
Malachi hatte dichte, dunkle Wimpern und ausdrucksvolle Augenbrauen. Vor allem jedoch seine Augenfarbe hatte es Tia angetan. Die Iris war dunkelgrün, wie Gras im Sommer, mit einem blassgoldenen Ring um die Pupille. Malachi sah sie beständig an, während er mit ihr redete. Nicht auf unangenehme, prüfende Art und Weise, sondern interessiert.
Natürlich war Tia auch schon von anderen Männern interessiert angeschaut worden. Sie war schließlich keine hässliche Frau. Aber in ihren neunundzwanzig Lebensjahren hatte sie noch nie ein Mann so angesehen, wie Malachi Sullivan es in diesem Moment tat.
Eigentlich hätte sie nervös sein müssen, war es aber nicht. Nicht wirklich jedenfalls. Das lag sicher daran, dass er offensichtlich ein Gentleman war. Er sprach kultiviert und wirkte völlig gelassen. Der steingraue Anzug saß perfekt an seinem großen, schlanken Körper.
Ihrem Vater, der immer sehr viel Wert auf Kleidung legte, hätte er sicher gefallen.
Tia trank einen Schluck von ihrem entkoffeinierten Kaffee und überlegte, warum das Schicksal ihr wohl Malachi geschickt hatte.
Sie redeten wieder über die drei Parzen, aber das war ihr eigentlich nur recht. Es fiel ihr leichter, über Göttinnen zu reden als über persönliche Dinge.
»Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es tröstlich oder beängstigend finden soll, dass das Schicksal von drei Frauen bestimmt wird, noch bevor man seinen ersten Atemzug tut.«
»Und es geht dabei nicht nur um die Dauer des Lebens«, warf Tia ein. Sie zwang sich, keinen Kommentar darüber abzugeben, wie ungesund weißer Zucker ist, als er einen reichlichen Teelöffel davon in seinen Kaffee gab. »Sondern sozusagen auch um die Melodie. Das Gute und das Böse in Ihnen. Die Parzen verteilen alles gerecht, und es liegt an jedem Einzelnen, was er daraus macht.«
»Dann ist also nicht alles vorherbestimmt?«
»Jede Handlung ist ein Willensakt oder drückt im Gegenteil das Fehlen des Willens aus. Und jede Handlung hat Konsequenzen. Zeus, der Göttervater und zugleich ein Frauenheld, warb um Thetis. Die Moiren prophezeiten, ihr Sohn würde berühmter, vielleicht sogar mächtiger werden als Zeus selbst. Und Zeus, der sich an seine Schwierigkeiten mit seinem eigenen Vater erinnerte, hatte Angst davor, dieses Kind zu zeugen, und gab Thetis auf.«
»Es ist dumm von einem Mann, eine Frau aufzugeben, nur weil er nicht weiß, was die Zukunft bringen kann.«
»Es hat ihm auch nichts genutzt, weil Thetis von Peleus doch noch einen Sohn bekam, Achill. Wenn Zeus seinem Herzen statt seinem Ehrgeiz gefolgt wäre, Thetis geheiratet und ein Kind gezeugt hätte, dann wäre sein Schicksal vielleicht anders verlaufen.«
Malachi wusste nicht, was anschließend mit Zeus geschehen war, hielt es aber für klüger, nicht zu fragen. »Also hat er sein Schicksal selbst gewählt, indem er seine eigenen dunklen Seiten auf das noch nicht empfangene Kind projizierte.«
Ihr Gesicht hellte sich bei seinem Kommentar auf. »So könnte man es ausdrücken. Man könnte auch sagen, dass die Vergangenheit ausstrahlt. Jedes Mal, wenn man einen Finger ins Wasser taucht, bilden sich Kreise, und sie gehen in diejenigen über, die danach kommen. Generation für Generation.«
Sie hat hübsche Augen, dachte er. Sie waren von einem klaren Blau. »Mit den Menschen ist es doch genauso, oder nicht?«
»Ich glaube schon. Das ist eines der Kernthemen meines Buches. Wir können dem Schicksal zwar nicht entkommen, aber wir können viel dazu beitragen, es selbst zu prägen, es zu unserem Vorteil oder Nachteil zu verändern.«
»Mir scheint, ich habe meinem Schicksal eine vorteilhafte Wendung gegeben, indem ich diese Reise gerade jetzt angetreten habe.«
Tia merkte, dass sie schon wieder errötete, und führte ihre Tasse zum Mund, um es zu verbergen, »Sie haben noch gar nicht erzählt, in welcher Branche Sie tätig sind.«
»Schiffe.« Das kam der Wahrheit nahe. »Ein Familienunternehmen, das bereits seit einigen Generationen existiert. Eine schicksalsträchtige Entscheidung.« Er sagte es beiläufig, beobachtete sie dabei aber wie ein Falke seine Beute. »Wenn Sie bedenken, dass mein Ururgroßvater einer der Überlebenden der Lusitania war.«
Überrascht blickte Tia ihn an. »Wirklich? Das ist ja seltsam! Mein Ururgroßvater kam auf der Lusitania um.«
»Ach, tatsächlich!« Malachi versuchte, erstaunt zu klingen. »Das ist ja ein seltsamer Zufall. Ob sie sich wohl gekannt haben, Tia?« Er berührte ihre Hand, und als sie sie nicht wegzog, ließ er seine Hand eine Weile lang dort ruhen. »Langsam beginne ich wirklich an das Schicksal zu glauben.«
Während sie zum Hotel zurückgingen, überlegte Malachi, ob er die Parzen noch einmal ansprechen sollte. Aber schließlich beschloss er, seine Ungeduld zu zügeln. Wenn er die Statuen zu früh erwähnte, würde sie vielleicht merken, dass ihre Begegnung gar kein Zufall, sondern kühle Berechnung war.
»Haben Sie morgen schon etwas vor?«
»Morgen?« Tia konnte kaum fassen, dass sie heute Abend etwas unternommen hatte. »Nein, eigentlich nicht.«





























