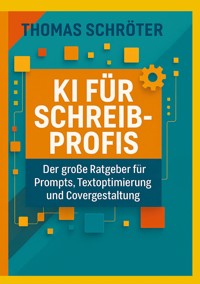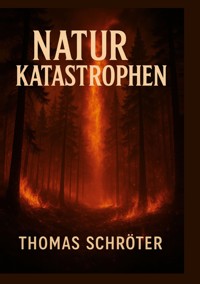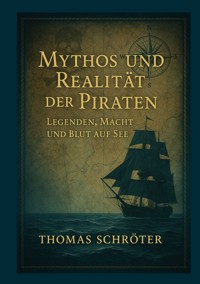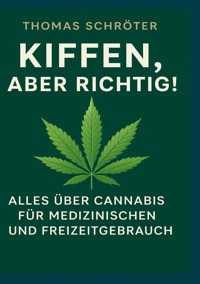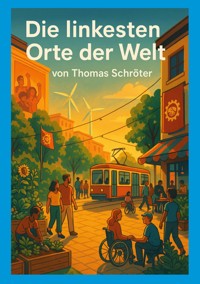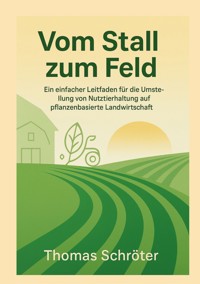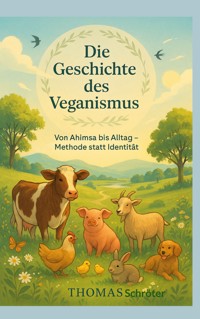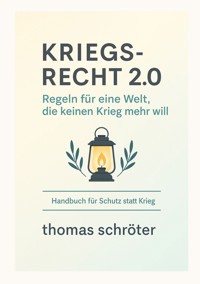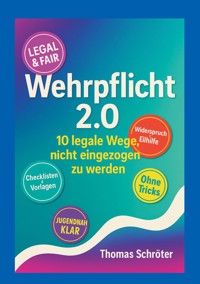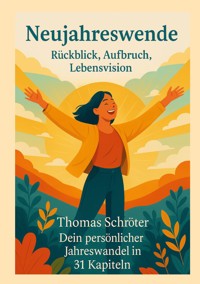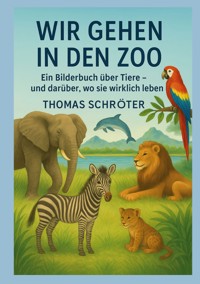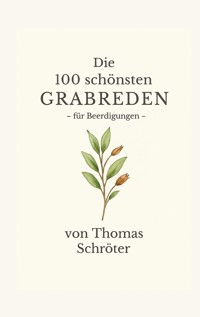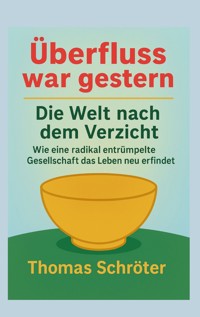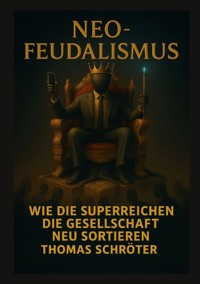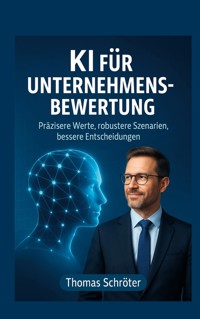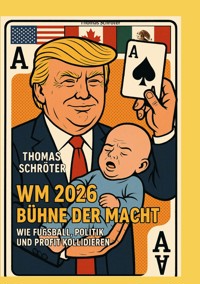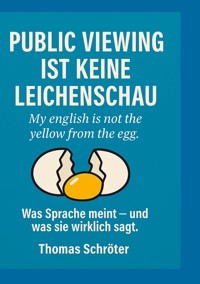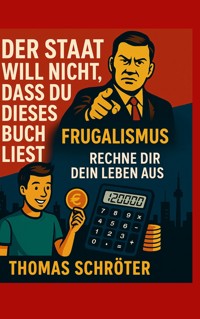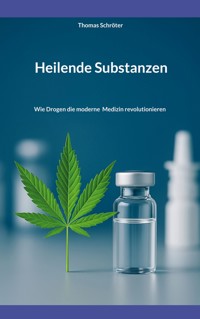
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Heilende Substanzen ist ein aufrüttelndes, fundiertes und zugleich tief persönliches Sachbuch über die neue Rolle psychoaktiver Substanzen in der modernen Medizin. Es verbindet wissenschaftliche Evidenz mit gesellschaftlicher Analyse und stellt die drängende Frage, ob wir bereit sind, alte Vorurteile hinter uns zu lassen, um neuen therapeutischen Möglichkeiten Raum zu geben. Das Buch erklärt verständlich und faktenbasiert, wie Substanzen wie Cannabis, Psilocybin, MDMA, LSD, Ketamin oder sogar Nikotin und Koffein medizinisch wirken können und wo ihre Risiken liegen. Es beleuchtet die neurobiologischen Mechanismen ebenso wie politische Barrieren, historische Stigmatisierung und aktuelle Forschungsergebnisse. Der Autor, selbst mit den Widersprüchen zwischen heilender Erfahrung und gesellschaftlichem Tabu konfrontiert, führt durch 20 Kapitel voller Wissen, Tiefe und Relevanz stets mit dem Ziel, einen differenzierten, verantwortungsvollen und humanen Umgang mit Drogen in Medizin, Therapie und Gesellschaft zu fördern. Ein Buch für alle, die sich für evidenzbasierte Psychiatrie, moderne Schmerztherapie, Suchtforschung und die Zukunft der Heilkunst interessieren. Und für alle, die wissen wollen, warum es Zeit ist, das Wort Droge neu zu denken.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 60
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rechtlicher Hinweis
Alle Personen und Handlungen in diesem Werk sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen sowie existierenden Organisationen, Orten oder Begebenheiten ist rein zufällig und unbeabsichtigt.
Dieses Werk ist ein Produkt der Fiktion. Es dient ausschließlich der Unterhaltung und Information und stellt keine Form der Rechtsberatung, medizinischen Beratung, psychologischen Beratung oder einer anderen professionellen Beratung dar. Die in diesem Buch dargestellten Technologien, wissenschaftlichen Konzepte oder gesellschaftlichen Entwicklungen sind spekulativ und dienen der Erzählung.
Der Autor übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung der in diesem Werk enthaltenen Informationen entstehen könnten.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1 Was sind „Drogen“? – Begriffe, Klassifikationen, Missverständnisse
Kapitel 2 Von Ritualen zu Rezepten – Die kulturgeschichtliche Rolle psychoaktiver Substanzen
Kapitel 3 Wie Drogen wirken – Neurobiologie, Rezeptoren, Signalwege
Kapitel 4 Zulassung und Evidenz – Wie Medikamente in die Medizin gelangen
Kapitel 5 Zwischen Rausch und Therapie – Suchtmodelle im Wandel
Kapitel 6 Cannabis – Schmerztherapie, Geriatrie und gesellschaftlicher Umbruch
Kapitel 7 Psilocybin – Depression, Angst und das größte Psilocybin-Forschungsprojekt Europas
Kapitel 8 LSD – End-of-Life-Angst, Clusterkopfschmerzen und Mikrodosierung
Kapitel 9 MDMA – PTSD, Empathie und der Weg zur therapeutischen Zulassung
Kapitel 10 Ketamin und Esketamin – Suizidprävention und schnelle Hilfe bei Depression
Kapitel 11 Opiate und Opioide – Schmerzmittel zwischen Segen und Epidemie
Kapitel 12 Stimulanzien – ADHS, Leistungsdruck und Missbrauchsrealitäten
Kapitel 13 Alkohol, Nikotin, Koffein – Die unterschätzten legalen Substanzen
Kapitel 14 Neue psychoaktive Substanzen (NPS) – Forschungslücke und Risiken
Kapitel 15 Ethnobotanik und experimentelle Therapien – Ayahuasca, Iboga, 5-MeO-DMT
Kapitel 16 Kontextfaktoren – Set, Setting und Placebo als Wirkverstärker
Kapitel 17 Integration und Nachsorge – Die Bedeutung therapeutischer Begleitung
Kapitel 18 Rechtlicher Status und internationale Regulierung – Ein Flickenteppich der Gesetzgebung
Kapitel 19 Risiken, Nebenwirkungen und Missbrauchspotenzial – Eine differenzierte Betrachtung
Kapitel 20 Zukunft der Psychopharmakotherapie – Visionen, Innovationen, Kontroversen
Schlusswort
Vorwort
Es gibt Themen, bei denen die Worte stocken, bevor man sie ausspricht. „Drogen“ gehört zweifellos dazu. In Gesprächen, Artikeln, politischen Reden – das Wort ist beladen mit Angst, Vorurteilen, Verboten. Es steht für Kontrollverlust, Abhängigkeit, Absturz. Selten für Hoffnung. Noch seltener für Heilung.
Ich schreibe dieses Buch nicht aus wissenschaftlicher Distanz allein, sondern auch aus persönlicher Nähe. Ich habe selbst erfahren, was es bedeutet, mit einer Substanz in Berührung zu kommen, die einerseits gesellschaftlich stigmatisiert ist – und andererseits einen medizinischen Nutzen entfaltet, den kein klassisches Mittel je erreicht hatte. Zwischen diesen beiden Polen bewegt sich dieses Buch.
Die Frage, ob und wie sogenannte „Drogen“ im medizinischen Kontext helfen können, ist längst keine hypothetische mehr. Weltweit forschen Universitäten, Kliniken und private Institute an neuen Wegen der Behandlung von psychischen und körperlichen Erkrankungen – mit Substanzen, die jahrzehntelang pauschal als gefährlich und illegal galten. In dieser Forschung steckt nicht nur therapeutisches Potenzial, sondern auch ein gesellschaftlicher Auftrag: endlich differenziert, offen und evidenzbasiert über ein Thema zu sprechen, das zu lange von ideologischen Grabenkämpfen geprägt war.
Dieses Buch ist mein Versuch, diese Diskussion auf ein neues Fundament zu stellen. Es vereint wissenschaftliche Genauigkeit mit persönlicher Motivation. Es soll informieren, erklären, einordnen – aber auch irritieren, infrage stellen, neue Perspektiven eröffnen.
Denn wenn eine Substanz in der Lage ist, einem Menschen Linderung zu verschaffen, wo alle anderen Mittel versagen – dann ist es nicht die Substanz, die in Frage steht. Es ist unser Umgang mit ihr.
Thomas Schröter
Kapitel 1
Was sind „Drogen“? – Begriffe, Klassifikationen, Missverständnisse
Das Wort „Droge“ ruft spontan Bilder hervor: eine zerkratzte Aluminiumfolie, eine Spritze, eine zusammengesunkene Gestalt im U-Bahnhof. In der Alltagssprache steht „Droge“ fast ausschließlich für illegale Substanzen und deren missbräuchlichen Konsum. Doch diese Alltagsvorstellung hat mit der wissenschaftlichen Bedeutung des Begriffs nur wenig gemein. Wer über Drogen sprechen will – ernsthaft, differenziert, medizinisch –, muss sich zuerst von diesem engen Verständnis lösen.
Aus pharmakologischer Sicht ist eine Droge jede Substanz, die physiologische Funktionen im Körper verändert. Diese Definition umfasst nicht nur Cannabis, LSD oder Heroin, sondern auch Koffein, Alkohol, Nikotin, Schmerzmittel, Antidepressiva – ja sogar Zucker und Sauerstoff, wenn man es streng betrachtet. Doch natürlich wäre eine solch weite Definition analytisch wenig hilfreich. Deshalb hat sich im medizinischen und rechtlichen Sprachgebrauch eine funktional-differenzierende Sichtweise etabliert.
Medizinisch spricht man von „Drogen“ meist im Zusammenhang mit Wirkstoffen pflanzlichen Ursprungs – etwa in der Pharmazie, wo der Begriff Droge die getrockneten Pflanzenteile bezeichnet, aus denen Medikamente hergestellt werden. In der klinischen Pharmakologie hingegen werden Wirkstoffe nach ihrer Wirkung auf das zentrale Nervensystem klassifiziert: sedierend, stimulierend, halluzinogen, analgetisch, anxiolytisch oder antidepressiv. Innerhalb dieser Klassifikation spielt es zunächst keine Rolle, ob ein Stoff als „Droge“ im umgangssprachlichen Sinne gilt oder nicht.
Juristisch dagegen ist entscheidend, ob eine Substanz unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG), das Arzneimittelgesetz (AMG) oder andere Regulierungen fällt. So ist Cannabis in Deutschland unter bestimmten Umständen verschreibungsfähig, Psilocybin dagegen nach wie vor verboten – obwohl beide Substanzen psychoaktiv sind und medizinisches Potenzial besitzen. Das Kriterium ist also nicht pharmakologisch, sondern gesetzgeberisch – oft historisch bedingt und politisch geprägt.
Diese Unschärfe zwischen alltagssprachlichem, medizinischem und juristischem Begriff macht den Diskurs über Drogen so anfällig für Missverständnisse. Wer über die therapeutische Wirkung von MDMA spricht, muss sich mit denselben Vokabeln auseinandersetzen wie jemand, der über Partydrogenmissbrauch diskutiert. Wer LSD als Hilfsmittel in der Traumatherapie untersucht, nutzt denselben Begriff wie eine Boulevardzeitung auf der Suche nach Schlagzeilen.
Ein weiteres Missverständnis liegt in der moralischen Aufladung des Begriffs. Während Alkohol und Nikotin gesellschaftlich weitgehend akzeptiert sind – trotz erwiesener Gesundheitsgefahren –, gelten viele illegalisierte Substanzen pauschal als gefährlich, zerstörerisch und medizinisch nutzlos. Diese Sichtweise ignoriert nicht nur die wissenschaftliche Datenlage, sondern verstellt auch den Blick auf therapeutische Chancen. Es ist bezeichnend, dass viele der heute untersuchten psychoaktiven Stoffe jahrzehntelang auf der Grundlage von Angst, Vorurteilen und politischen Interessen verboten waren – nicht auf der Basis von medizinischen Kriterien.
In diesem Buch wird der Begriff „Droge“ deshalb differenziert verwendet. Er bezieht sich nicht auf einen moralischen oder legalen Status, sondern auf die pharmakologische Wirksamkeit im zentralen Nervensystem. Eine „Droge“ ist hier eine Substanz, die Bewusstsein, Stimmung, Wahrnehmung oder Verhalten verändert – unabhängig davon, ob sie gesellschaftlich akzeptiert oder gesetzlich erlaubt ist.
Diese begriffliche Klarheit ist notwendig. Denn wer sich auf die Suche nach dem heilenden Potenzial psychoaktiver Substanzen macht, muss zuerst verstehen, wie tief die Verzerrung reicht – und wie dringend wir eine neue, fundierte Sprache brauchen, um über diese Wirkstoffe zu sprechen.
Kapitel 2
Von Ritualen zu Rezepten – Die kulturgeschichtliche Rolle psychoaktiver Substanzen
Wenn man den Blick zurückwendet, zeigt sich: Die Idee, mit bewusstseinsverändernden Substanzen zu heilen, ist keineswegs neu. Im Gegenteil – sie ist eine anthropologische Konstante. In beinahe allen bekannten Kulturen der Welt wurden psychoaktive Pflanzen und Pilze genutzt, lange bevor es moderne Diagnosen, Leitlinien oder Zulassungsverfahren gab. Der Unterschied zur heutigen Medizin liegt nicht im „Ob“, sondern im „Wie“.