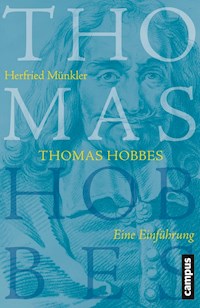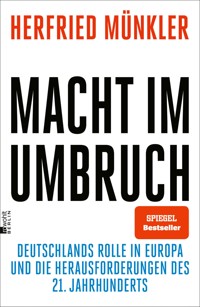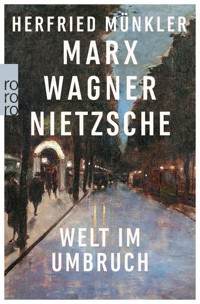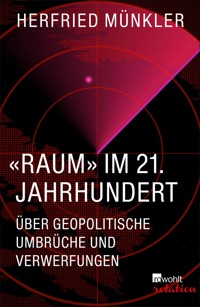10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die beiden Weltkriege haben den politischen Globus geprägt – aber das Wesen von Krieg und Gewalt selbst hat sich seither gewandelt. Herfried Münkler zeichnet diese kulturelle wie politische Evolution nach: So begünstigte gerade das Verschwinden von Imperien neue, endlose Kleinkriege – die teilkollabierten Gebiete im Nahen Osten etwa gründen auf dem Machtvakuum, das das untergegangene Osmanische Reich hinterließ. Die Soldaten solcher Konflikte sind heute weniger in Armeen als in kleinen Trupps formiert, deren brutalste Spielart der terroristische Einzelkämpfer ist. Auch die geopolitischen Konfliktlinien verlaufen nur noch selten entlang physischer Grenzen, sondern vielmehr zwischen konkurrierenden Werten, zwischen Demagogie und Aufklärung, Arm und Reich, zwischen Datenschutz und Datenspionage in künftigen Cyberkriegen. Nicht zuletzt aus diesen Gründen plädiert Herfried Münkler, der sich einmal mehr als ein Meister der Zeitdiagnostik erweist, vehement für eine echte geopolitische Strategie des Westens. Ein Buch, das uns die neuen Formen der Gewalt und die Welt von heute besser begreifen lässt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 526
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Herfried Münkler
Kriegssplitter
Die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Was bedeutet Krieg in unserer Zeit? Herfried Münklers glänzende Analyse der Gewalt.
Die beiden Weltkriege haben den politischen Globus geprägt – aber auch das Wesen von Krieg und Gewalt selbst hat sich seither gewandelt. Herfried Münkler zeichnet diese kulturelle wie politische Evolution nach: So begünstigte gerade das Verschwinden von Imperien neue, endlose Kleinkriege – die teilkollabierten Gebiete im Nahen Osten etwa gründen auf dem Machtvakuum, das das untergegangene Osmanische Reich hinterließ. Die Soldaten solcher Konflikte sind heute weniger in Armeen als in kleinen Trupps formiert, deren brutalste Spielart der terroristische Einzelkämpfer ist. Auch die geopolitischen Konfliktlinien verlaufen nur noch selten entlang physischer Grenzen, sondern vielmehr zwischen konkurrierenden Werten, zwischen Demagogie und Aufklärung, Arm und Reich, zwischen Datenschutz und Datenspionage in künftigen Cyberkriegen. Nicht zuletzt aus diesen Gründen plädiert Herfried Münkler, der sich einmal mehr als ein Meister der Zeitdiagnostik erweist, vehement für eine echte geopolitische Strategie des Westens. Ein glänzend geschriebenes Buch, das uns die neuen Formen der Gewalt und die Welt von heute besser begreifen lässt.
Über Herfried Münkler
Herfried Münkler, geboren 1951, ist Professor für Politikwissenschaft an der Berliner Humboldt-Universität und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Mehrere seiner Bücher gelten mittlerweile als Standardwerke, etwa «Die neuen Kriege» (2002), «Imperien» (2005) und «Die Deutschen und ihre Mythen» (2009), das mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet wurde. Herfried Münklers vielgelobte Darstellung des Ersten Weltkriegs, «Der Große Krieg» (2013), wurde zum Bestseller.
Inhaltsübersicht
Einleitung
Die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert
Die Angst vor einem großen Krieg ist nach Europa zurückgekehrt; die Ursache dafür sind weniger der nun schon seit Jahren andauernde Bürgerkrieg in Syrien und die zeitweilig überraschenden Erfolge der Milizen des Islamischen Staats in der Levante, sondern vor allem das aggressive Agieren Russlands gegen die Ukraine, nachdem diese sich zu Beginn des Jahres 2014 in einem Umsturz aus dem Gefolgschaftsverhältnis zu Russland gelöst hat. Sobald Russland im Spiel ist, werden Erinnerungen an den Ost-West-Konflikt und die einstigen Empfindungen des Bedrohtseins wach. Das macht den Unterschied zu dem sehr viel blutigeren und grausameren Bürgerkrieg in Syrien aus. Die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und der von Russland massiv unterstützte Separatistenkrieg im Donbass haben die Zuversicht, dass es in Europa keine Kriege mehr geben werde, schwer gedämpft. Jedenfalls ist die mehr als zwei Jahrzehnte umfassende Zeitspanne, während der sich in Europa die Friedensdividende unbesorgt konsumieren ließ, vorerst zu Ende gegangen, und keiner kann sagen, ob sie jemals in dieser Form wieder zu haben sein wird.
Das Ende der sicherheitspolitischen Unbesorgtheit ist mit einer Revitalisierung von Politiktheorien verbunden, deren Zeit kurz davor noch abgelaufen zu sein schien: Theorien über die Konkurrenz der großen Mächte, Modelle ihrer Fähigkeit, Macht zu projizieren, dazu Vorstellungen von Einflusszonen und Konzepte der Geopolitik. Vor allem mit den skizzierten Befürchtungen und Ängsten hat sich das bis vor kurzem noch als vergangen angesehene 20. Jahrhundert wieder bemerkbar gemacht: In Frage steht, ob es, wie einige Historiker meinten, tatsächlich «das kurze 20. Jahrhundert» gewesen ist, es also als zusammengehörige Epoche von 1914 bis 1989/90 gesehen werden kann. Die von dem Krieg in der Ostukraine ausgehende Sorge gipfelt in der Befürchtung, dass das Ende der Ost-West-Konfrontation doch nicht der Anbruch einer Ära verlässlichen Friedens in Europa war, sondern wir nun in Konstellationen hineingeraten, in denen sich die Gewalt von der europäischen Peripherie her allmählich ins Zentrum hineinfrisst.
Die enttäuschte Erwartung, dass es eine Ära verlässlichen Friedens geben werde, hat sich freilich auf eine bemerkenswert eurozentrische Weltwahrnehmung gestützt – nach 1989/90 hatten die Kriege weltweit ja keineswegs aufgehört. Im Gegenteil: Zahlenmäßig haben sie im globalen Rahmen zeitweilig sogar zugenommen, und ihre Intensität war des Öfteren größer als die der vorangegangenen Stellvertreterkriege zwischen Ost und West – zumal dann, wenn man die Exzesse des Tötens in Ruanda und im Ostkongo als Kriege begreift. Der Völkermord in Ruanda etwa hatte eine größere Gewaltintensität als schrecklichste Kriege, und der Konflikt im Ostkongo ist mit viereinhalb Millionen Toten der mit der höchsten Opferzahl seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Auch der Krieg in Afghanistan, der bis zum Abzug der Roten Armee vom Hindukusch als einer der vielen Stellvertreterkriege des Kalten Krieges geführt worden ist,[1] ging 1989/90 nicht wirklich zu Ende; er wurde unter veränderten Bedingungen weitergeführt, zeitweise auch mit deutscher Beteiligung, mit der Folge, dass sich die deutschen Streitkräfte strukturell tiefgreifend transformiert haben. Aber dieser Krieg in Afghanistan wurde, sieht man von den Erregungsphasen nach Anschlägen auf Bundeswehrsoldaten einmal ab, hierzulande zu keinem wirklichen Thema im öffentlichen Diskurs. Dafür war Afghanistan geographisch zu weit entfernt; es herrschte die Auffassung vor, wenn man die Truppen von dort abziehe, sei das Problem «für uns» gelöst. Dass Deutschland auch am Hindukusch verteidigt werde, wie es der damalige Verteidigungsminister Peter Struck einmal formulierte, wollte ohnehin kaum einer so recht einsehen. Unausgesprochen stand im Hintergrund die Vorstellung, wenn sich der Westen aus den Konflikten in aller Welt entschlossen heraushalte, würden sich diese nach einiger Zeit schon von selbst regeln.
Die verschärfte Variante einer Weltsicht, wonach nicht Eingreifen, sondern Heraushalten und Zuwarten der Schlüssel zum Friedlicherwerden der Welt seien, besteht in der Auffassung, dass fast alle Kriege eine Folge der US-amerikanischen Interventionspolitik seien; dem liegt die stillschweigende Annahme zugrunde, dass es überall eine starke Präferenz für den Frieden gebe und vorhandene Konflikte friedlich beigelegt werden könnten, wenn die USA sich nicht in alles einmischen würden. Das war und ist jenseits der unterschiedlichen Bewertungen dieser Kriege durch die politischen Positionen die vorherrschende Sichtweise einer postheroischen Gesellschaft, die ihre eigenen Dispositionen generalisiert und sie anschließend als gleichsam natürliches Verhalten der Menschen begreift. Frei nach Hegel: Wer die Welt durch die Brille des Postheroischen anschaut, den lächelt sie auch friedlich an. Wer die Welt dagegen aus einer notorisch belligerenten Grundhaltung heraus betrachtet, der sieht sie mit Kriegen und kriegerischen Konflikten übersät, in die man umgehend eingreifen müsse, um sie zu beenden und Ordnung zu schaffen.
So einfach ist es nicht, und deshalb soll hier eine andere, eine dritte Auffassung entwickelt werden, wonach die Entstehung postheroischer Dispositionen an gesellschaftlichen Voraussetzungen hängt, die politisch nur sehr begrenzt beeinflussbar sind.[2] Die Beobachtungen, die wir bezüglich unserer selbst machen, sind deshalb auch nicht generalisierbar; vielmehr lassen sich in anderen Weltregionen starke Gruppen identifizieren, die Krieg wollen, weil sie davon profitieren. Das ist eines der zentralen Elemente in der Theorie der Neuen Kriege. Die Neuen Kriege, so eine der Beobachtungen, enden darum zumeist nicht von selbst, sondern es bedarf dazu eines Dritten, der entweder als Vermittler oder als Friedenserzwinger auftritt. Die Theorie der Neuen Kriege widerspricht darin den Grundüberzeugungen der postheroischen Gesellschaft, und das ist sicherlich einer der Gründe, warum sie so kontrovers diskutiert worden ist.[3]
Ist also alles nur eine Frage der Perspektive, wie der Kulturwissenschaftler Bernd Hüppauf meint?[4] Ja und nein. Tatsächlich konnte sich die Vorstellung von einer mehr als zwanzigjährigen Friedensperiode in Europa nur entwickeln und durchsetzen, weil die jugoslawischen Zerfallskriege der neunziger Jahre mit über zweihunderttausend Toten im übrigen Europa schlichtweg verdrängt wurden. Zwar hat der Balkan für die europäische Identität stets eine eher randständige Rolle gespielt, aber dass er in Europa liegt und zur europäischen Geschichte gehört, lässt sich wohl kaum bestreiten. Zeitweilig hat das Entsetzen über die Grausamkeiten und Gewaltexzesse gegen die Zivilbevölkerung in Bosnien die europäische Öffentlichkeit durchaus beschäftigt. Das von serbischem Militär und Freiwilligenverbänden an Bosniern verübte Massaker von Srebrenica wurde zum Symbol für das Scheitern der UN-Politik auf dem Balkan und zu einer Blamage der Europäischen Union, die nicht in der Lage war, unmittelbar «vor ihrer Haustür» für Frieden und die Einhaltung der Menschenrechte zu sorgen.[5] Erst das massive Eingreifen des US-amerikanischen Militärs hat die Kriege in Bosnien-Herzegowina und im Kosovo dann beendet beziehungsweise die Bereitschaft erzwungen, diese zu beenden.
Vermutlich hat all dies – die europäische Blamage, das Scheitern der Vereinten Nationen und schließlich der Einsatz der US-Luftwaffe – dazu geführt, dass die jugoslawischen Zerfallskriege aus dem kollektiven Gedächtnis der Europäer sehr schnell verschwunden sind beziehungsweise verdrängt wurden. Solches Vergessen und Verdrängen ist weder neu noch überraschend: Die Konstruktion einer Epoche als einer durch bestimmte Merkmale gekennzeichneten Zeitspanne beruht fast immer auf der Ausblendung dessen, was nicht in das Epochenbild passt, das man entworfen hat oder entwerfen will. Das gehört zu den Strategien, mit denen wir uns Orientierung und Gewissheit in der politischen Welt verschaffen. Gelegentlich wird die so vorgenommene Komplexitätsreduktion aber auch zum Selbstbetrug. Bei der friedenspolitischen Selbstbeschreibung der Europäer und ihrer geschichtspolitischen Fixierung auf die beiden Weltkriege könnte das der Fall sein. Umso wichtiger sind eine nüchterne Bestandsaufnahme des Kriegsgeschehens seit dem Ende der achtziger Jahre und ein kritischer Blick auf die Zeit zwischen 1914 und 1945 in europäischer wie in globaler Hinsicht. Beides soll hier versucht werden. Dabei kommt dem Ersten Weltkrieg als «Epochenzäsur» eine besondere Bedeutung zu. Demgemäß wird er hier auch häufiger und intensiver thematisiert als der Zweite Weltkrieg.
Bei einer historisch informierten Betrachtung der Kriege an der europäischen Peripherie fällt auf, was die jugoslawischen Zerfallskriege, die Kriege im Kaukasus von Tschetschenien bis Georgien und den jetzigen Krieg in der Ostukraine verbindet: Sie finden alle in einem postimperialen Raum statt, der aus dem Zerfall der alten Großreiche Mittel- und Osteuropas, dem Habsburgerreich und dem russischen Zarenreich, hervorgegangen ist und in dem es nicht zu einer konsolidierten Nationalstaatsbildung gekommen ist. Vielmehr entstanden hier erneut multiethnische und multireligiöse «Reiche», im einen Fall Sowjetrussland beziehungsweise seit 1924 die Sowjetunion und im anderen Fall das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg die Bundesrepublik Jugoslawien, denen es über längere Zeit gelang, die ethnischen und religiösen Konflikte zu dämpfen, nicht aber sie zu beseitigen. So tauchten sie mit dem Zerfall der «Reiche» wieder auf oder trugen zu deren Zerfall bei. Letzten Endes gehört auch die Ukraine in diesen Raum; ihr ist es nach 1991 nicht gelungen, eine erfolgreiche Nationenbildung zu durchlaufen, sondern die ethnisch, konfessionell und nicht zuletzt auch lingual zentrifugalen Kräfte wurden zum Ansatzpunkt eines separatistischen Bürgerkriegs, der Russland die Gelegenheit zur Realisierung geopolitischer Projekte (Krim) bot. Wer die historische Tiefe dieses Krisen- und Kriegsraums vom mittleren Balkan bis zum Kaspischen Meer ausloten will, stößt zwangsläufig auf die Ergebnisse und Folgen des Ersten Weltkriegs. Das gilt im Übrigen in ähnlicher Weise auch für die Kriege in dem zweiten postimperialen Raum an der europäischen Peripherie, nämlich dem zwischen Syrien und dem Irak, zwischen Libyen und dem Jemen.
Es geht in diesem Buch jedoch nicht um eine Gesamtdarstellung der Kriegsgeschichte der letzten hundert Jahre auf der Grundlage einer ordnenden These; vielmehr werden widersprüchliche Entwicklungen beobachtet, die einerseits Zonen eines stabilen Friedens hervorgebracht und andererseits zur Entstehung eines den Globus umspannenden «Gürtels» diffuser Kriege geführt haben – eines Kriegsgürtels, der von Südamerika (dort vor allem Kolumbien) über Afrika (von Mali und Nigeria bis nach Somalia) reicht, dann sich über große Teile der arabischen Welt (über den Jemen und Syrien, den Irak und Libyen) nach Norden spannt und vom augenblicklich pazifizierten mittleren Balkan über die Schwarzmeerregion bis zum Kaukasus erstreckt, der Afghanistan und Pakistan umfasst und in der südostasiatischen Inselwelt allmählich zerfasert. Von hybriden Kriegen ist die Rede, weil diese Kriege sich dem binären Ordnungssystem entziehen, wie es im Europa der Frühen Neuzeit von der spanischen Völkerrechtsschule und dem Niederländer Hugo Grotius entwickelt worden ist: Dieses System der binären Begrifflichkeit hatte durch die Kontrastierung zweier Konstellationen – bei prinzipieller Ausschließung einer dritten – Ordnung hergestellt: Krieg oder Frieden, Staatenkrieg oder Bürgerkrieg, Kombattanten oder Nonkombattanten – ein Drittes gibt es nicht. Und tatsächlich hat die Ordnung der völkerrechtlichen Begriffe in ihrer strukturierenden Übersichtlichkeit auf die politische Ordnung eingewirkt und dafür gesorgt, dass man diese an der Vorgabe der Begriffe ausgerichtet hat.
Die hybriden Kriege sind hingegen dadurch gekennzeichnet, dass das binäre Ordnungssystem auf sie nicht angewandt werden kann und in ihnen auch keine Rolle spielt: Zwar sind es zumeist innergesellschaftliche Kriege, um die es dabei geht, freilich Kriege mit einer starken Tendenz zur Grenzüberschreitung, und wenn sich daraus keine zwischenstaatlichen Kriege entwickeln, so liegt das zumeist daran, dass die Staaten, in denen solche Kriege wüten, failed beziehungsweise failing states sind, die zur Führung zwischenstaatlicher Kriege nicht in der Lage sind. Aufgrund ihres grenzüberschreitenden Charakters, der häufig mit den kolonialen Grenzziehungen zu tun hat, die quer durch die Stammesgebiete verlaufen, spricht man auch von transnationalen Kriegen, die ein Mittleres zwischen Staaten- und Bürgerkriegen oder, vielleicht präziser, eine Mischform aus beidem darstellen. Das ordnungsschaffende tertium non datur der binären Struktur ist aus diesen Kriegen somit verschwunden; sie werden zu einer Herausforderung der Weltordnung, weil sie deren grundlegende Prinzipien in Frage stellen.
Das gilt ebenfalls für die binäre Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden, bei der die Grenzüberschreitung durch Rechtsakte – Kriegserklärung und Friedensschluss – geregelt war. Dadurch war eindeutig, in welchem der beiden politischen Aggregatzustände man sich befand: im Krieg oder im Frieden, und welche Handlungen infolgedessen zulässig und welche verboten waren. Das ist bei den Neuen Kriegen nicht der Fall: Es gibt weder Kriegserklärung noch Friedensschluss, dafür immer wieder Erklärungen und Abkommen, mit denen die Gewaltanwendung zeitweilig ausgesetzt oder reduziert wird, um dann doch wieder zu eskalieren. Es ist schwierig, genau festzulegen, wann einer dieser Kriege begonnen hat, und noch schwieriger ist es, ihn zu beenden oder auch nur sein definitives Ende zu konstatieren. Man weiß nicht, woran man ist. Eine Folge dessen ist, dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, mit wem man es zu tun hat: mit einer Kriegs- oder mit einer Friedenspartei.
Um es zu konkretisieren: Die Europäer haben im Ukrainekrieg wirtschaftliche Sanktionen gegen Russland verhängt, weil sie zu dem Ergebnis gekommen sind, dass es sich bei der russischen Regierung um eine Kriegspartei handelt; gleichzeitig hat sich die russische Seite selbst jedoch als Friedensakteur präsentiert, der auf beide Konfliktparteien besänftigend einzuwirken versuche. Nun muss man das nicht glauben, und es gibt hinreichend Belege dafür, dass das auch nicht der Fall war. Um den Krieg indes zu beenden beziehungsweise den offenen Krieg in einen eingefrorenen Konflikt zu verwandeln, haben die Europäer die Russen beim Wort nehmen müssen und sie in den Minsker Verhandlungen behandelt, als ob sie eine Friedenspartei wären. Darin hat sich in anderer Weise wiederholt, was Regierungen von Ländern verschiedentlich tun, wenn sie mit Partisanengruppen, Rebellenorganisationen oder Terrornetzwerken, denen sie eigentlich die politische Anerkennung verweigern, Verhandlungen aufnehmen – und ihnen durch diese Verhandlungen die gerade erst verweigerte Anerkennung erteilen. Der Krieg in der Ostukraine ist so geführt worden, dass solche Verhandlungen möglich und erforderlich waren; in jedem Fall aber handelt es sich dabei um einen Zustand zwischen offenem Krieg und fortbestehendem Frieden, weshalb man auch von einem hybriden Krieg spricht. Der Begriff steht hier für die Außerkraftsetzung der durch binäre Begriffe geschaffenen Ordnung von Krieg und Frieden.
Die Binarität der Begriffe, Rechtszustände und politischen Konstellationen hat in Europa nicht nur eine politische Ordnung geschaffen, sondern auch die Evolution der Gewalt gesteuert. Sie hat dazu beigetragen, dass die Herstellung von Kriegführungsfähigkeit immer teurer wurde, was zur Folge hatte, dass gleichzeitig die Zahl der kriegführungsfähigen Akteure immer kleiner wurde: Von den Städten und Adelsverbänden ging sie am Ende des Mittelalters und zu Beginn der Neuzeit auf die Territorialstaaten über, von diesen sodann auf die Bündnissysteme der großen Mächte, bis zuletzt in der Zeit der Ost-West-Konfrontation nur noch zwei Supermächte gemeinsam mit ihren jeweiligen Verbündeten in der Lage waren, einen großen Krieg zu führen.[6] Dieser Krieg wäre freilich, wenn er geführt worden wäre, mit dem Ende der menschlichen Zivilisation gleichbedeutend gewesen.
Das war eine Konstellation, aus der eine doppelte Evolutionsperspektive erwuchs: in der nördlichen Hemisphäre die Idee von der dauerhaften Sicherung eines globalen Friedens, jedenfalls eines politischen Ordnungszustands, in dem es keine zwischenstaatlichen Kriege mehr gibt und militärische Gewalt nur noch zum Zwecke der Beendigung von Gewaltexzessen eingesetzt wird – wo auch immer auf dem Erdball. Diese Richtung der Gewaltevolution verband sich bei den meisten europäischen Staaten mit dem Projekt, die Vereinten Nationen zu stärken und sie mit dem Auftrag zu versehen, aus dem Militär eine globale Polizei zu machen. Im Anschluss an den Militärsoziologen Morris Janowitz nenne ich das die Konstabularisierungsperspektive.[7] Die andere Evolutionsrichtung der Gewalt seit der drohenden Selbstauslöschung der Menschheit bei Führung eines großen (nuklearen) Krieges ist die Aufrechterhaltung von Kriegführungsfähigkeit in Form von kleinen Kriegen, sogenannten low intensity wars; in diesen nehmen substaatliche Akteure das Heft des Handelns in die Hand, und die Staaten verlieren das Monopol der Kriegführungsfähigkeit. Der Kriegs- und Militärhistoriker Martin van Creveld hat diese Evolution der Kriege als für das 21. Jahrhundert dominant bezeichnet.[8]
Beide Entwicklungsprognosen, die auf den ersten Blick in unterschiedliche Richtung weisen und als einander entgegengesetzt angesehen werden können, passen letztlich doch gut zusammen, jedenfalls dann, wenn man die low intensity wars als challenge und das konstabularisierte Militär als response ansieht. Das aber heißt, dass die Vorstellungen von Verbrechen und Krieg, die voneinander separiert und gegeneinander konturiert zu haben eine der Leistungen des europäischen Kriegsvölkerrechts war, zunehmend ineinanderfließen und an ihre Stelle die Unterscheidung zwischen einem schurkenhaften und einem Ordnung schaffenden Gebrauch der Kriegsgewalt tritt. Man kann eine solche Entwicklung in der Rhetorik amerikanischer Politiker beobachten, in der diejenigen, gegen die das US-Militär in Marsch gesetzt wird, als «Schurken» oder «Achse des Bösen» firmieren.[9] Die offene Frage dabei ist, wer über den Begriff des «Schurken» verfügt, wer also das Recht beziehungsweise die Stärke besitzt, andere politische Akteure als «Schurken» einzustufen und nach den Vorgaben des Kriminalitätsparadigmas gegen sie Krieg zu führen.
Das Problem bei der Ersetzung des Kriegs- durch das Kriminalitätsparadigma besteht darin, dass Recht und Stärke nicht in derselben Rechnung aufgehen; die Beauftragung der Vereinten Nationen, konkret: des Sicherheitsrats, darüber zu entscheiden, wer ein Schurke ist und wie gegen ihn vorgegangen wird, endet entweder in einer Selbstblockade des Sicherheitsrats, weil eine der fünf Vetomächte die Entscheidung blockiert – oder aber der Schurkencharakter eines Staates oder einer politischen Gruppierung wird konsensuell festgestellt, es findet sich jedoch keiner, der die Polizeiaufgabe übernimmt, weil er damit keinen ihm allein zufallenden Nutzen verbindet. Alternativ dazu ist eine Rhetorik der politisch Starken vorstellbar, die alle, die ihnen im Weg stehen oder missliebig sind, nach ihrem Gutdünken als Schurken bezeichnen und mit dieser «Legitimation» im Rücken gegen die so Bezeichneten Krieg führen und diesen Krieg als Kriminalitätsbekämpfung ausgeben. In der Politik der USA lassen sich während der letzten zwei, drei Jahrzehnte Indikatoren für eine solche Entwicklung ausmachen. Sicher ist jedenfalls, dass die herkömmliche Unterscheidung zwischen Krieg und Frieden zunehmend verwischt wird. Von den Wohlstandszonen des Nordens aus werden immer wieder polizeiförmige Militäroperationen an der Peripherie durchgeführt – so wie umgekehrt von den Krisenzonen und Kriegsräumen an der Peripherie aus gelegentlich Angriffsoperationen in die Wohlstandszonen hinein erfolgen – zumeist in Form von Terroranschlägen.
Es gibt also eine Reihe von Indikatoren, die nahelegen, dass die Ära des klassischen Staatenkrieges zu Ende geht oder bereits zu Ende gegangen ist. Im historischen Rückblick hat es den Anschein, als seien die beiden Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts die letzten großen Kriege dieses Typs gewesen, wobei beide bereits mit Elementen des innergesellschaftlichen Krieges verbunden waren: im Ersten Weltkrieg eher dadurch, dass auf den zwischenstaatlichen Krieg, der die Ordnung vieler Staaten bis ins Zentrum hinein erschüttert hatte, eine Reihe von innergesellschaftlichen Kriegen folgte, von denen der russische Bürgerkrieg zwischen 1918 und 1922 nicht nur der härteste und grausamste,[10] sondern auch der politisch folgenreichste gewesen ist. Im Zweiten Weltkrieg sind innergesellschaftliche Kriege in vielen Regionen zeitgleich mit dem zwischenstaatlichen Krieg geführt worden, und diese Gleichzeitigkeit hat – neben dem Umstand, dass der Krieg seitens der Deutschen im Osten als Weltanschauungskrieg geführt wurde – zu einer beispiellosen Intensivierung der Gewalt beigetragen. Das ändert jedoch nichts daran, dass auch der Zweite Weltkrieg von seiner Form her ein zwischenstaatlicher Krieg war, was noch einmal daran deutlich wird, wie er beendet wurde: durch die Unterzeichnung von Kapitulationsurkunden. Zudem hat sich durch die Steigerung der Zerstörungsintensität erwiesen, dass der Krieg als Austragungsmodus konträrer politischer Vorstellungen in bislang ungekannter Weise selbstzerstörerisch wirkte. Eigentlich hatte sich das bereits im Ersten Weltkrieg gezeigt, und der forcierte Friedenswille der zwanziger Jahre war der politische Ausdruck dessen. Dann aber haben die totalitären Ideologien den Krieg noch einmal als Mittel ins Spiel gebracht, um «Wahrheiten» durchzusetzen, Territorien zu erobern und Gesellschaften zu transformieren. Der Ausgang des Zweiten Weltkriegs steht auch für das Scheitern dieser totalitären Kriegsvorstellung, und das gilt mit Abstrichen auch für die Sowjetunion, die zwar Territorium erobert hat, bei der Durchsetzung ihrer «Wahrheit» jedoch ebenso steckengeblieben ist wie bei der Transformation der Gesellschaft und der Schaffung eines neuen Menschen.
Aber damit ist der Krieg nicht verschwunden, sondern er hat sich gewandelt und eine neue Gestalt angenommen. Dieser Gestaltwandel wird im Buch eingehend behandelt. Zuvor jedoch soll es um den Ersten Weltkrieg und dessen «Ort» in der Geschichte des Krieges, aber auch in der Gesellschaftsentwicklung gehen – sowie um die Frage, ob der Zweite Weltkrieg ein «Weltordnungskrieg» gewesen ist. Das ist auch eine der leitenden Fragestellungen für den Teil des Buches, der sich den Neuen Kriegen, der «Kriegführung» mit Kampfdrohnen, den jüngsten Kriegen in der Ostukraine sowie in Syrien und im Nordirak widmet. Weil nicht nur bei der Festlegung von Kriegszwecken, sondern auch bei der Vermeidung und Verhinderung von Kriegen geopolitische Fragen eine herausgehobene Rolle spielen, geht es am Schluss um veränderte Raumvorstellungen der Politik, in denen Territorien und Grenzen an Relevanz verloren haben und Strömungskontrolle zum zentralen Imperativ geworden ist. Diese veränderte Vorstellung vom Raum und der Kontrolle (anstatt Beherrschung) des Raumes dürfte sich, so die These dieses Teils des Buchs, in den kommenden Jahrzehnten auch auf die Art des Krieges auswirken.
Teil I
Die großen Kriege des 20. Jahrhunderts
1. Der Sommer 1914 als weltgeschichtliche Zäsur
Wer sich an der Vergangenheit orientiert, um sich in seiner Gegenwart zurechtzufinden, kommt nicht ohne historische Interpunktionen aus: Man sucht nach Einschnitten in der Zeit, durch die sich Epochen voneinander trennen lassen, Neues gegen Altes abgegrenzt werden kann. Sicherlich gibt es fließende Übergänge, bei denen die Zeitgenossen gar nicht merken, dass sich etwas grundlegend verändert hat; wirklich sinnfällig sind nur die Zäsuren, die sich mit einem einschneidenden Ereignis oder einem Epochenjahr verbinden. 1945, das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Teilung Europas zwischen Ost und West, war ein solches Epochenjahr; 1989, der Fall der Mauer, der Zusammenbruch des Ostblocks und das Ende des Kalten Krieges, war ein weiteres. Aber war 1914, der Beginn des Ersten Weltkriegs, auch ein Epochenjahr?
Es gibt einige, die das bezweifeln und stattdessen die weltgeschichtliche Zäsur auf das Jahr 1917 datieren, das Jahr, in dem die USA in den großen europäischen Krieg eintraten, während gleichzeitig in Russland zwei Revolutionen stattfanden, deren zweite die weltpolitische Agenda für sieben Jahrzehnte grundlegend verändern sollte.[11] Der Kriegseintritt der Vereinigten Staaten, die der eigentliche Sieger im Ersten Weltkrieg waren – insofern es ihnen als einziger der am Krieg beteiligten Großmächte gelang, aus dem militärischen Sieg politische Macht und ökonomische Prosperität zu schlagen –, hat die Dominanz und Vorherrschaft Europas beendet. Und der Sieg der Bolschewiki in Moskau und Petrograd leitete eine Epoche der revolutionären Heilserwartung ein, in der sich die Politiker und die politischen Intellektuellen mehr denn je zuvor als Verfasser von Zukunftsentwürfen begriffen, als die alles entscheidenden Gestalter des individuellen wie gesellschaftlichen Lebens. Diese Epoche endete, als sich die zähe Macht der Verhältnisse dem gestalterischen Elan der politischen Avantgarden endgültig als überlegen erwies. Die Avantgarden hatten von der Schaffung einer neuen Welt und eines neuen Menschen geträumt.[12] Die Künstler, die Maler und Bildhauer, Lyriker und Schriftsteller, haben diesen Traum verwirklicht: Sie schufen ein neues Bild der Welt und des Menschen. Aber die sozialen und politischen Avantgarden sind gescheitert. Der Sowjetkommunismus und seine Filiationen in Ostasien, Lateinamerika und im subsaharischen Afrika haben gewaltige Energien mobilisiert – und zumeist nur ausgebrannte, erschöpfte Gesellschaften zurückgelassen.
Sollten wir darum nicht doch den Sommer 1914 als das Ende des alten Europa und das Jahr 1917 als Beginn einer neuen Epoche in der Weltgeschichte begreifen? Die Zäsur, die der Erste Weltkrieg in der Geschichte darstellt, wäre dann nicht ausschließlich auf seinen Beginn zu datieren, sondern würde sich über seinen gesamten Verlauf erstrecken, und dabei würde die Eskalation der Gewalt eine ausschlaggebende Rolle spielen. Das ist für große, einschneidende Kriege typisch: dass bei ihrem Beginn nicht abzusehen ist, wie lange sie dauern und welche langfristigen Folgen sie haben werden. Das war bei der Rebellion der böhmischen Stände gegen die kaiserlichen Statthalter in der Prager Burg im Jahre 1618 so, also bei Beginn des Dreißigjährigen Krieges, und das gilt auch für die Intervention der preußischen und österreichischen Heere gegen das revolutionäre Frankreich, der dann mehr als zwei Jahrzehnte lang immer neue Kriegszüge folgten – danach waren die politischen Verhältnisse in Europa fundamental andere.
Als der Historiker Eric Hobsbawm die Formel vom «langen 19. Jahrhundert» prägte, hat er dessen Beginn auf das Jahr 1789 und das Ende auf das Jahr 1914 datiert, also eine historische Einheit vom Beginn der Französischen Revolution bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs behauptet. Hobsbawms Epochenzäsuren sind vom Feuilleton wie von der Wissenschaft bereitwillig übernommen worden.[13] Warum eigentlich? Hätte es nicht nähergelegen, das Ende dieser mit einer bürgerlichen Revolution begonnenen Epoche auf 1917 zu datieren, als eine sozialistische Revolution erfolgreich war? Oder wenn man die Kriegsgeschichte zum Maßstab der Epochenbrüche machen wollte: Wäre dann nicht 1815 mit dem Wiener Kongress und der dort geschaffenen Friedensordnung Europas das angemessenere Datum für den Beginn einer Epoche gewesen, die 1914 mit der Zerstörung dieser Ordnung endete?
Zur Schaffung historischer Epochen gehört nicht nur die Sinnfälligkeit von Zäsuren, sondern auch die Plausibilität von Ligaturen, die Beschreibung von Zusammenhängen, die über Unterbrechungen hinweggreifen und Ereignisse, die manchem als Zäsur erscheinen mögen, in die Kontinuität einer Epoche bringen. Derlei Ligaturen lassen sich sozialgeschichtlich, kulturgeschichtlich, mentalitätsgeschichtlich, aber auch politikgeschichtlich herstellen. Letzteres ist sicherlich am anspruchsvollsten und kompliziertesten, weil hier nach der Kontinuität und Dauer von Strukturen und Ordnungsmustern Ausschau gehalten werden muss, die in ständigem Wandel begriffen sind. Die Politikgeschichte ist das genuine Feld der Veränderung. Wer in ihr nach Zäsuren sucht, wird schnell fündig; wem es um Ligaturen geht, der muss sehr genau hinschauen.
Die Festlegung von Zäsuren und die Behauptung von Ligaturen der Geschichte sind nicht zuletzt darum so heikel, weil sich in ihnen immer auch unser politisches Selbstverständnis mitsamt den darin eingelassenen Zukunftserwartungen niederschlägt. Wir ordnen die Geschichte nicht nur nach ihrem tatsächlichen Verlauf, sondern auch gemäß den uns je beschäftigenden Erwartungen und Befürchtungen. Die von uns in die Geschichte eingebrachten Interpunktionen sind nie bloß das Ergebnis objektivierender Beobachtung, sondern reflektieren immer auch unsere Enttäuschungen oder die aufrechterhaltene Hoffnung, dass sich die Dinge doch noch in unserem Sinne entwickeln könnten. Die zahllosen deutschen Intellektuellen, die den Kriegsausbruch von 1914, kaum dass er erfolgt war, als eine welthistorische Zäsur feierten, von dem Romancier und Essayisten Thomas Mann über den Philosophen Max Scheler bis zu dem Soziologen Georg Simmel,[14] taten dies nicht zuletzt deswegen, weil sie hofften, in der neuen Zeit würden die negativen Erscheinungen der zurückliegenden Jahrzehnte verschwinden: der vorherrschende Materialismus, die Dominanz des Geldes, das sich von einem Mittel zum Zweck des Lebens gewandelt hatte, und nicht zuletzt die sich immer stärker bemerkbar machende Erosion der sozialen Gemeinschaften. Die Intellektuellen sollten sich gründlich täuschen: Der Krieg hat all das, was sie zum Verschwinden gebracht wissen wollten, nur noch verstärkt – jedenfalls wenn man die Entwicklung über einen längeren Zeitraum betrachtet. Sie haben ihre politischen und kulturellen Hoffnungen auf den Kriegsausbruch projiziert und damit dem Krieg einen Sinn zugeschrieben, eine Sinnstiftung vorgenommen, die ihn rechtfertigte und «heiligte».
Im Unterschied dazu haben die französischen und englischen Intellektuellen das Jahr 1914 weniger als einen Bruch denn als Kontinuität der Geschichte dargestellt. Der Lebensphilosoph Henri Bergson hat in einem Vortrag in der Académie française gleich nach Kriegsausbruch diese Argumentationsrichtung vorgegeben: Es gehe in diesem Krieg darum, die Zivilisation gegen die Barbarei zu verteidigen.[15] Bergson stellte den Krieg damit in eine lange Kontinuitätslinie der Geschichte, die mit der Verteidigung des Römischen Reichs gegen die germanischen Völkerschaften ihren Anfang genommen habe. 1914 war für ihn keine Zäsur, sondern ein weiteres Kapitel im endlosen Kampf um die Selbstbehauptung der lateinischen Zivilisation gegen die aus dem Osten, den Steppen Asiens oder den Wäldern Germaniens, andringenden Horden der Barbaren. Man kann Thomas Manns vieldiskutierte Kontrastierung der «Tiefe» deutscher Kultur mit der «Oberflächlichkeit» französischer Zivilisation nicht verstehen, wenn man sie nicht als Reaktion auf Bergsons Deutung des Krieges im Sinne einer Verteidigung der Zivilisation gegen die Barbarei begreift. Bergson hatte eine Sinnstiftung vorgegeben: die Verteidigung der lateinischen Zivilisation gegen die periodisch aus dem Nordosten andrängenden Barbaren; Thomas Mann setzte eine konträre Sinnstiftung dagegen: die Verteidigung der deutschen Kultur gegen die französische Zivilisation. Der Krieg der Waffen wurde von Anfang an begleitet von einem Krieg der Worte.
Die Briten bezeichneten die Deutschen, ganz ähnlich wie Bergson, als «Hunnen», die man abwehren und zurückwerfen müsse. Zu dieser Benennung hatte freilich Kaiser Wilhelm II. das Seine beigetragen, als er im Jahre 1900 bei der Verabschiedung der zur Niederschlagung des chinesischen Boxeraufstands entsandten Marineinfanterie in Bremerhaven erklärte, die deutschen Soldaten sollten sich in China Respekt verschaffen wie weiland die Hunnen unter ihrem König Etzel.[16] Es war das unbedachte Gerede des Kaisers, das die Deutschen in der britischen Wahrnehmung zu Hunnen gemacht hatte. Zu dieser «Hunnifizierung» der Deutschen gehörte im Übrigen, dass es einem römisch geführten Abwehrbündnis Mitte des 5. Jahrhunderts auf den Katalaunischen Feldern gelungen war, den hunnischen Vorstoß zu stoppen und zurückzuschlagen. Auch das eine Kontinuitätslinie, die als sinnstiftend herausgestellt wurde.
Man kann die Zuschreibung des Barbarischen auf den Einmarsch der Deutschen in das neutrale Belgien zurückführen und auf die Übergriffe deutschen Militärs auf die belgische Zivilbevölkerung, wofür später dann die Formel von der «Vergewaltigung Belgiens» stand;[17] man kann aber auch vermuten, dass die westlichen Intellektuellen das Barbarische der Deutschen vor allem deswegen betonten, weil ihre eigenen Länder, Frankreich und Großbritannien, mit dem zarischen Russland verbündet waren, das in der Vorstellungswelt der Westeuropäer eigentlich der klassische Ort des Barbarischen war. Zwei Jahrzehnte zuvor wäre ein solches Bündnis noch undenkbar gewesen, als die liberalen, demokratischen und revolutionären Traditionen des Westens als politische wie kulturelle Antithese zu den repressiv-autoritären Strukturen Ost- und Mitteleuropas galten – verkörpert vom russischen Zarentum. Durch die Bezeichnung der Deutschen als Barbaren oder Hunnen wurde eine Kontinuität im Kampf für die Zivilisation imaginiert, die einen tiefen bündnispolitischen Bruch verbergen sollte. Zugleich wurde damit überdeckt, dass in der Bündnispolitik Frankreichs und Großbritanniens die Geopolitik ein größeres Gewicht bekommen hatte als wertepolitische Bindungen oder ideologische Nähe. Entscheidend war die Chance, den ungeliebten Konkurrenten Deutschland in die Zange zu nehmen.
Von den konkurrierenden Selbstdeutungen der europäischen Intellektuellen einmal abgesehen – in welcher Hinsicht war das Jahr 1914 denn wirklich eine weltgeschichtliche Zäsur? Immerhin hatte eine Reihe kluger Beobachter schon lange vor Kriegsausbruch gemutmaßt, dass ein großer Krieg nicht nur die politischen Verhältnisse umstürzen, sondern auch die gesellschaftliche Ordnung und das kulturelle Selbstverständnis der Europäer von Grund auf verändern werde. Kleinere Kriege, lokal und zeitlich begrenzt, wie im Fall der italienischen und der deutschen Einigungskriege, konnte Europa wohl verkraften, aber nicht einen großen Krieg, der den gesamten Kontinent erfasste und sich über viele Jahre hinzog. Vor einem solchen Krieg hatten nicht nur Friedrich Engels und August Bebel auf Seiten der Sozialisten gewarnt, sondern auch der polnische Bankier Johann Bloch und der englische Journalist Ralph Norman Angell aus einer ökonomisch-liberalen Perspektive sowie Helmuth von Moltke d.Ä., der legendäre Sieger von Königgrätz und Sedan, die überragende Autorität in den militärischen Kreisen Europas.[18] Dementsprechend hatten sich die Generalstäbe beider Seiten darum bemüht, ihre Pläne auf einen kurzen Krieg mit schnellen Entscheidungsschlachten auszurichten. Als im Herbst 1914 diese Pläne gescheitert waren, der Waffenstillstand ausblieb und die Industrieproduktion auf langfristige Kriegserfordernisse umgestellt werden musste, war den klügeren unter den Akteuren und Beobachtern klar, dass sich Europa im Innern wie auch in seiner weltpolitischen Rolle grundstürzend wandeln würde. Intuitiv lagen die deutschen Intellektuellen mit der Annahme einer Zäsur also richtiger als die englischen und französischen Autoren, die eher von einer Kontinuität der geschichtlichen Verläufe ausgegangen waren.
In Kriegen werden keine wirtschaftlichen Werte geschaffen, sondern exzessiv verbraucht – in der Hoffnung auf einen politischen Mehrwert, den man bei Kriegsende einkassieren will. Mit der Industrialisierung des Krieges ist dieser forcierte Ressourcenverbrauch noch einmal gesteigert worden, das heißt, dass immer mehr öffentliches und privates Vermögen durch den Krieg aufgezehrt wurde. Das Jahr 1914 und die ihm folgenden vier Kriegsjahre wurden zur politischen Tragödie des europäischen Bürgertums, das den Krieg als Chance zur Erlangung politischer Hegemonie gesehen und sich bei dem Versuch, diese Chance wahrzunehmen, wirtschaftlich und sozial ruiniert hat.[19] Vor allem aber hat dieses Bürgertum im Verlauf des Krieges seinen politischen Kompass verloren: Statt die gesellschaftliche und politische Mitte zu besetzen, hat es sich politisch nach rechts bewegt. Damit kam eine Polarisierung in Gang, der in vielen europäischen Ländern in den zwanziger und dreißiger Jahren nicht nur die Demokratie, sondern auch der Rechtsstaat zum Opfer fielen. Erst etliche Jahrzehnte später ist es den Europäern gelungen, wieder die politischen Optionen zu eröffnen, die 1914 verlorengegangen sind.
Die Zäsur von 1914 war, so, wie sie hier thematisiert wurde, das Ergebnis politischer Entscheidungen, bei deren Zustandekommen fast immer der Zufall seine Hand im Spiel hatte. Alles hätte, wenn das eine oder andere Ereignis nicht stattgefunden hätte oder die politisch Verantwortlichen es anders bewertet hätten, auch ganz anders kommen können. Darf man einer Ereigniskette, bei der der Zufall eine solche Rolle gespielt hat, tatsächlich den Charakter einer weltgeschichtlichen Zäsur zusprechen? Die Frage ist zu bejahen. Zäsuren in der Zeit werden von den Akteuren meist nicht erstrebt, sie sind das nichtintendierte Ergebnis des Zusammenwirkens vieler Faktoren.
1914 endet auch eine Ära des Fortschrittsoptimismus, die unter anderem darin ihren Ausdruck gefunden hatte, dass sie den Krieg als eine immer bedeutungsloser werdende Form von Konfliktregelung und Ressourcenverteilung ansah. Die militärische Gewalt, so die vorherrschende Erwartung, würde immer mehr durch industrielle Arbeit abgelöst. Man vertraute auf ein allmähliches Verschwinden des Krieges aus der Geschichte oder doch zumindest darauf, dass er an die Ränder der «zivilisierten Welt» abgedrängt würde, weil die Industriegesellschaften Europas inzwischen viel zu verwundbar geworden waren, um noch große Kriege wie die zwischen 1618 und 1648 oder zwischen 1792 und 1815 zu führen. Obendrein war spätestens mit der industriellen Revolution klar, dass Arbeit sehr viel mehr Werte schuf, als im Krieg zu erbeuten war. Dieser Fortschrittsoptimismus ist 1914 folgenreich zerstört worden; Gewalt wurde nun wieder als politische Potenz angesehen. Es hat ein knappes Jahrhundert gedauert, bis die Europäer wieder an dem Punkt angekommen sind, an dem sie sich vor 1914 schon einmal befunden haben. Insofern kann man das Epochenjahr 1914, zumindest für einige Bereiche, als eine Zäsur, freilich eine mit Revisionsoption, bezeichnen.
2. Die Eskalation der Gewalt: Von der Julikrise 1914 zur Politik der «revolutionären Infizierung»
Die in Deutschland immer wieder kaskadenartig geführte Kriegsschulddebatte zum Ersten Weltkrieg, in deren Zentrum seit Anfang der sechziger Jahre die Thesen des Hamburger Historikers Fritz Fischer stehen,[20] hat den politischen Blick auf den Krieg von 1914 bis 1918 und seine Folgen eher verstellt als geweitet. Vor allem hat sie die Beschäftigung mit dem Krieg auf dessen Vorgeschichte und die Julikrise von 1914 fokussiert, mit der Folge, dass der Verlauf des Krieges ebenso wie die in ihm zusammenfließenden macht- und geopolitischen Konflikte kaum thematisiert wurden. Die Nichtbeschäftigung mit dem Krieg selbst hat dazu beigetragen, dass die Gewaltförmigkeit der europäischen Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wesentlich auf das Machtstreben der deutschen Eliten zurückgeführt und als eine moralische Herausforderung der Deutschen begriffen wurde. Beides hat seine Berechtigung: Die deutschen Eliten haben beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs wie bei der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs eine verhängnisvolle Rolle gespielt – freilich auf eine so unterschiedliche Weise, dass man die zwei Fälle sorgfältig auseinanderhalten muss. Wer mit Blick auf 1914 und 1939 von einer Kontinuität der deutschen Eliten spricht – was man mit guten Gründen tun kann –, hat sich bereits von dem Differenzierungserfordernis verabschiedet: Er hat die Einzelfallprüfung durch die Beobachtung von Elitenkontinuität ersetzt.
Aber damit beginnen schon die Einwände und Einschränkungen: Dass die Kontrolle der Eliten eine wesentlich politische und weniger eine moralische Forderung ist, wird dadurch verdunkelt, dass die Auseinandersetzung mit den Kriegsursachen von 1914 als Schuld- und nicht als Verantwortungsdebatte geführt worden ist. Und bei aller Verantwortung, die den deutschen Eliten für den gewaltsamen Verlauf des 20. Jahrhunderts zukommt, ist doch auch festzuhalten, dass deren Agieren vor 1914 ein anderes war als vor 1939. Genau das ist gegen Fritz Fischer einzuwenden: dass er die Intentionalität, mit welcher der Weg in den Krieg 1939 beschritten wurde, in die Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs hineinprojiziert und damit eine Kontinuität der deutschen Politik konstruiert hat, die es so nicht gegeben hat. Insofern hat es des australisch-britischen Historikers Christopher Clark bedurft, um die von Fischer und seinen Schülern vorgenommene Versiegelung der Sicht auf den Ersten Weltkrieg aufzubrechen.[21]
Für eine Wiederentdeckung des Krieges als «Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts» (George F. Kennan) genügt es freilich nicht, bei den Kriegsursachen stehen zu bleiben; man muss den weiteren Kriegsverlauf untersuchen, und zwar im Hinblick auf die politischen wie die strategischen Entscheidungen und deren jeweilige Folgen. Die Neubeschäftigung mit dem Ersten Weltkrieg, seinen Anfängen und seinem Verlauf, ist also keineswegs von antiquarischem Interesse, sondern wir können daraus lernen. Sie eröffnet ein politisches Feld, das für die Bewältigung der Herausforderungen des 21. Jahrhunderts von einiger Relevanz sein kann. Das dürfte auch die Ursache für das zeitweilig große Interesse am Ersten Weltkrieg gewesen sein mitsamt der Frage, ob sich rund hundert Jahre nach Kriegsausbruch wiederholen könne, was sich 1914 ereignet hat.
Das erste Konfliktfeld des Krieges: Der Kampf um die europäische Hegemonie
Der Erste Weltkrieg gehört zu den Kriegen der europäischen Geschichte, die nicht nur zu Grenzverschiebungen, sondern auch zu einer neuen Ordnung der politischen Räume und einer veränderten Normstruktur der Politik geführt haben. Darin ist er den napoleonischen Kriegen und dem Dreißigjährigen Krieg vergleichbar; diese Analogie ist die Grundlage dafür, dass der Krieg von 1914 bis 1918 zusammen mit dem von 1939 bis 1945 als ein weiterer Dreißigjähriger Krieg bezeichnet worden ist.[22] Die Dimension des Krieges stand freilich nicht von vornherein fest; er ist erst in seinem Verlauf zu dem geworden, als was er anschließend in die Geschichte eingegangen ist. Die Analyse des Krieges hat also zu klären, wie ein Konflikt, von dem zunächst erwartet wurde, er werde sich auf den Balkan beschränken und ähnlich wie die Balkankriege von 1912 und 1913 verlaufen, zum Weltkrieg werden konnte.
Die politische Konstellation der Vorkriegszeit ist durch drei große Konflikte gekennzeichnet. Der erste dieser Konflikte – als «großer Konflikt» dadurch definiert, dass er wie ein Magnet die politischen Akteure sortierte und zu einer Pro- oder Kontra-Entscheidung zwang – war der Gegensatz zwischen Frankreich und Deutschland, der sich seit 1871, seit dem Frankfurter Frieden, um die Frage drehte, ob Elsass-Lothringen zu Deutschland oder zu Frankreich gehörte. Im Prinzip war der Deutsch-Französische Krieg von 1870/71, der mit der Gründung des Deutschen Reichs im Spiegelsaal von Versailles endete, auch eine Revision einiger Folgen des Dreißigjährigen Krieges beziehungsweise der Festlegungen im Friedensvertrag von Münster und Osnabrück, durch die das Elsass sowie die lothringischen Bistümer Metz, Toul und Verdun endgültig zu Frankreich gekommen waren.[23] Aber der Streit um Elsass-Lothringen war nur Teil eines viel weitreichenderen Konflikts, bei dem es letzten Endes um die Hegemonie in West- und Mitteleuropa ging: Welche Großmächte in der europäischen Pentarchie hatten in den politisch entscheidenden Fragen das Sagen, und welche mussten eher zuhören? Dieser Konflikt wiederum hatte eine noch größere historische Tiefe als der um Elsass-Lothringen, und einige Historiker beider Seiten führten ihn bis auf die Teilung des karolingischen Reichs im 9. Jahrhundert zurück, wodurch er naturalisiert und zur «Erbfeindschaft» gesteigert wurde.
Seit dem politischen Aufstieg der Nationsidee Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts hatte der deutsch-französische Gegensatz zusätzlich an Intensität gewonnen: Auf der einen Seite stand die napoleonische Idee einer Beherrschung West- und Mitteleuropas von Paris aus, was auf eine machtpolitische Durchdringung des deutschsprachigen Raums hinauslief; dagegen stand das geopolitische Ordnungsmodell der Mitte, bei dem Deutschland das politische Zentrum bildete und alle Fäden in Berlin zusammenliefen. Seit der Industriellen Revolution wurden diese konträren politischen Ordnungsmodelle noch durch das wirtschaftliche Interesse an entsprechenden Einflusssphären ergänzt. Der Zugriff auf Rohstoffe und die Sicherung von Absatzgebieten spielten dabei die Hauptrolle, und das führte dazu, dass der zunächst auf Elsass-Lothringen begrenzte Konflikt sich auf den afrikanischen Kontinent ausweitete. Es ging nun nicht mehr nur um Macht, sondern auch um Vermögen und Reichtum.
Die stärkste Dynamik bezog der Konflikt jedoch aus den nationalen Identifikationen, die weit über die Kalküle der politischen und wirtschaftlichen Akteure hinausgingen. Die unterschiedlichen, zum Teil gegensätzlichen Interessen beider Seiten hätten sich durchaus in eine politische und wirtschaftliche Kooperation überführen lassen, bei der das Nullsummenspiel des Gegeneinanders in eine Win-win-Konstellation der Zusammenarbeit verwandelt worden wäre. Bei den nationalen Identifikationen war derlei nicht möglich. Die Identifikation mit dem Nationalen war vor allem in den bürgerlichen Mittelschichten verbreitet, und die Zeit vor dem Krieg war durch deren politischen Einflussgewinn gekennzeichnet. Eine am nationalen Interesse orientierte Politik wurde durch Vorstellungen von nationalem Ruhm und nationaler Ehre überlagert. Der Sammelbegriff für all dies lautete «Prestige» – in sämtlichen deutsch-französischen Krisen vor dem Ersten Weltkrieg ging es darum. Prestige aber war beides zugleich: eine der wichtigsten Währungen der internationalen Politik und ein Selbstbewusstseinspolster der nationalen Identifikation. Das verlieh den Konflikten ihre Schärfe und machte ihren Verlauf unkalkulierbar.
Gleichwohl war der deutsch-französische Konflikt um die europäische Hegemonie im Frühsommer 1914 bloß latent und keineswegs akut. Nur seinetwegen wäre der Krieg im Sommer 1914 nicht ausgebrochen. Im Rückblick kann man sich eine politische wie wirtschaftliche Entschärfung des Konflikts nach Art der deutsch-französischen Aussöhnung in der Ära Adenauers und de Gaulles ein halbes Jahrhundert später durchaus vorstellen. Dass diese Aussöhnung erst nach zwei großen Kriegen möglich war, ist kein zwingendes Argument. Ansätze in diese Richtung hat es bereits vor 1914 gegeben: Deutschland als die führende Industriemacht des Kontinents mit einem beträchtlichen Kapitalhunger und Frankreich als notorischer Kapitalexporteur hätten durchaus eine Fülle von für beide Seiten profitablen Kooperationschancen gehabt. Woran es mangelte, war das notwendige gegenseitige Vertrauen, dass dies in Form einer gleichberechtigten Kooperation und nicht in Gestalt einer Hegemonie stattfinden werde.
Dabei haben der rasante Aufstieg Deutschlands und der relative Abstieg Frankreichs eine erhebliche Rolle gespielt. Hinzu kam eine Entwicklung, die sich politisch kaum beeinflussen ließ: In Frankreich hatte sich seit den 1890er Jahren, statistisch betrachtet, eine Umstellung von der Drei-Kind- auf die Zwei-Kind-Familie vollzogen, während es in Deutschland vorerst bei der Drei-Kind-Familie blieb. Die Folge war, dass die Bevölkerungsentwicklung beider Länder, die sich in der Vergangenheit weitgehend die Waage gehalten hatte, einen unterschiedlichen Verlauf nahm: Frankreich fiel zurück, Deutschland zog davon.[24] Was für die deutsche Seite die militärischen Einkreisungsängste waren, war auf französischer Seite die Sorge, auf längere Sicht bevölkerungs- und damit machtpolitisch marginalisiert zu werden.
Frankreich hat anstelle der Kooperation mit Deutschland das Bündnis mit Russland gesucht, und aus diesem auf geostrategischen Konstellationen – und nicht auf gemeinsamen Werten – begründeten Bündnis erwuchs in Deutschland eine Einkreisungsfurcht, die in die politische Direktive mündete, der «Ring der Einkreisungsmächte» müsse unbedingt aufgesprengt werden – durch einen Präventivkrieg, so die einen; durch eine die Gegensätze innerhalb der Entente verstärkende Politik, so die anderen. Die «karolingische Option», nämlich eine enge Kooperation zwischen Deutschland und Frankreich, geriet damit immer weiter aus dem Blick. Der Zeitdruck, unter den sich die deutsche Politik gesetzt sah, wuchs kontinuierlich; dem stand die Sorge der Franzosen gegenüber, dass die Russen es sich anders überlegen und wieder auf ihre traditionelle Nähe zu Deutschland beziehungsweise Preußen setzen könnten. In der Julikrise von 1914 haben diese Ängste und Befürchtungen die Entscheidungen beider Akteure bestimmt.[25]
Das zweite Konfliktfeld des Krieges: Das Ringen um eine neue Weltordnung
Bei dem zweiten großen Konfliktfeld der Vorkriegszeit kamen zwei längerfristige Entwicklungen zusammen: der relative Abstieg Großbritanniens als «Weltpolizist» und das absehbare Ausscheiden einiger europäischer Staaten aus der Riege der großen Mächte. Zu den Einkreisungsängsten, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Donaumonarchie sowie in Italien die politischen Wahrnehmungsmuster bestimmten, kamen somit Niedergangsängste hinzu, die vor allem in Österreich-Ungarn, aber auch in Großbritannien und Russland virulent waren. Großbritannien hatte, um gegenüber der deutschen Kriegsflotte in der Nordsee die Oberhand zu behalten, einen Teil seiner Seestreitkräfte aus der Karibik und dem nördlichen Pazifik abgezogen, woraufhin die USA und Japan Positionen einnahmen, die über Jahrhunderte von den Briten gehalten worden waren.[26] Russland wiederum befürchtete, dass es nach der Niederlage im Krieg gegen Japan (1904/05) von den anderen Großmächten nicht mehr ernst genommen werde, und diese Befürchtung bestimmte die russische Politik seit der bosnischen Annexionskrise von 1908.[27] Es ging um die Frage, wer in der Weltordnung des 20. Jahrhunderts welche Rolle spielen würde. Der damit verbundene Zeitdruck war geringer als bei den Einkreisungsängsten, aber auch die Niedergangsängste setzten die Politik unter erheblichen Handlungszwang.
Die politische und ökonomische Globalisierung stellte die überseeische Vorherrschaft der fünf europäischen Großmächte in Frage. Seit der im 18. Jahrhundert erfolgten Neubesetzung des Kreises der fünf Großmächte, als Schweden und Spanien ausschieden, hatte sich die Pentarchie von Großbritannien, Frankreich, dem Habsburgerreich, Preußen beziehungsweise Deutschland und Russland herausgebildet. Die napoleonischen Kriege hatten diese Struktur zeitweilig erschüttert, aber der Wiener Kongress hatte sie im Wesentlichen wieder hergestellt.[28] Großbritannien kam dabei infolge seiner geostrategisch besonderen Situation, seiner Insellage, die Rolle des «Züngleins an der Waage» zu, was darauf hinauslief, dass die Briten der Garant (und zugleich Profiteur) des europäischen Gleichgewichts waren, das sie durch bündnispolitische Zurückhaltung und eine vorausschauende Politik des Balancierens immer wieder austarierten. Gleichzeitig reichte die britische Machtentfaltung über Europa hinaus und bildete die Grundlage einer globalen (Handels-)Ordnung. Aber die Rolle, die den Briten im 18. und 19. Jahrhundert zugefallen war, wurde durch den kolonialpolitischen Aufstieg Frankreichs im 19. Jahrhundert und das wachsende russische Interesse an der Beherrschung Zentralasiens herausgefordert. Die Faschoda-Krise von 1898 war der Höhepunkt der britisch-französischen Rivalität bei der Aufteilung des subsaharischen Afrikas. Diese Rivalität war auch in den Kriegen des 18. Jahrhunderts um Nordamerika und während der napoleonischen Zeit von großer Bedeutung gewesen.
Die Formel vom «Great Game» wiederum bezog sich auf die Konkurrenz zwischen dem russischen Bären und dem britischen Löwen, was die Vorherrschaft im Grenzbereich zwischen Zentral- und Südasien anlangte. Das waren die klassischen geopolitischen Konflikte, mit denen die Briten zu tun hatten. Neu hinzu kam die wirtschaftliche Herausforderung durch die Deutschen und die USA, die beide inzwischen bei zentralen Wirtschaftsindikatoren, wie etwa der Stahlproduktion, aber auch im Elektromaschinenbau und in der chemischen Industrie, die Briten überholt hatten. Es war unübersehbar, dass Großbritannien die Rolle, die es bald zwei Jahrhunderte lang gespielt hatte, im 20. Jahrhundert nicht mehr in der bisherigen Form würde wahrnehmen können. Wer aber würde an seine Stelle treten? Oder würde das multipolare System Europas auf die neue Weltordnung ausgedehnt werden? Und wer würde dann dazugehören? Es waren solche Fragen, die vor 1914 die europäischen Großmächte und in wachsendem Maße auch die USA und Japan in Unruhe versetzten.
In seinem bereits erwähnten Buch «Griff nach der Weltmacht» hat Fritz Fischer die These vertreten, das Deutsche Reich habe die Position einer Weltmacht angestrebt. Das aber ist allzu einfach gesehen. Wenn die deutsche Politik über Weltmacht nachdachte, dann nicht über «die» Weltmacht, sondern einen Anteil daran. Fürst Bülow, der Vorgänger Bethmann Hollwegs im Amt des Reichskanzlers, hatte von einem «Platz an der Sonne» gesprochen, keineswegs von der Beherrschung aller Plätze oder der Schlüsselposition bei deren Zuweisung. Aber einen angemessenen Platz wollte Deutschland schon eingeräumt bekommen, und dieser Anspruch sollte durch den Bau einer Kriegsflotte untermauert werden, die für Großbritannien ein Risiko darstellte.[29]
Globaler Einfluss erwuchs aus Seeherrschaft, wie dies der amerikanische Admiral Alfred Thayer Mahan dargelegt hatte,[30] und sowohl Wilhelm II. als auch Admiral Alfred von Tirpitz, der den Bau der Kriegsflotte vorantrieb, waren Mahanisten. In machtpolitischer Hinsicht war es ein für die deutsche Seite verhängnisvoller Fehler, dem Konflikt mit Frankreich um die innereuropäische Hegemonie noch den globalpolitischen Konflikt mit Großbritannien hinzuzufügen. Das Problem einer Überforderung ließ sich auch durch sprachliche Kraftmeiereien, wie etwa die Wendung «Viel Feind, viel Ehr», nicht aus der Welt schaffen. Reichskanzler Theobald von Bethmann Hollweg hatte dieses Problem erkannt und deswegen seit 1911 auf eine Politik der Entspannung gegenüber den Briten gesetzt.[31] Andererseits war das zu einer Industriemacht aufgestiegene Deutschland auf offene Seewege angewiesen, und angesichts der ökonomischen Konkurrenz mit den Briten und zahlreicher deutschenfeindlicher Äußerungen aus Großbritannien bezweifelte man, dass man es mit einem fairen «Weltpolizisten» zu tun hatte. Dazu war Großbritannien inzwischen selbst viel zu sehr unter Druck geraten. So hatte es im Welthandel auf die Durchsetzung des Stempels «Made in Germany» gedrängt, um deutsche Produkte als minderwertig zu kennzeichnen; als daraus das Gegenteil wurde, zeigte das nur allzu deutlich, wie sehr die britische Vormachtposition inzwischen gefährdet war. Der Konflikt zwischen Großbritannien und dem Deutschen Reich wurde durch deutsche Großmannssucht und britische Niedergangsängste angeheizt.
Seit 1911 ließen die deutschen Anstrengungen im Wettrüsten zur See nach: nicht nur weil Bethmann Hollweg auf einen Ausgleich mit den Briten setzte, sondern auch weil im Deutschen Reich die begrenzten finanziellen Mittel für die militärische Rüstung[32] wieder stärker aufs Heer konzentriert werden mussten; angesichts einer Verlängerung der Militärdienstzeit in Frankreich von zwei auf drei Jahre und der gewaltigen Heeresvergrößerungen in Russland sah man sich dazu gezwungen, mehr für die Rüstung der Landstreitkräfte zu tun. Hinzu kam die Befürchtung, man könne sich auf den Dreibundpartner Italien nicht mehr verlassen; damit fehlten die zwölf italienischen Divisionen, die im Aufmarschplan gegen Frankreich für die Elsassfront vorgesehen waren. Die seitens des Generalstabs geforderte Heeresvergrößerung, die nur zu einem Teil bewilligt wurde, sollte den absehbaren Ausfall der italienischen Divisionen ausgleichen. Das Wettrüsten zu Lande in den Jahren vor Kriegsausbruch ging somit keineswegs allein von Deutschland aus. Insgesamt reagierten die Deutschen eher auf die Rüstungsanstrengungen ihrer Kontrahenten, als dass sie von sich aus den Rhythmus der Rüstungsrunden vorgaben. Nur beim Bau der Kriegsflotte war das zeitweilig anders, und das hatte das Verhältnis zu den Briten dauerhaft verschlechtert.
In ihrer Rolle als «Weltpolizist» sahen sich die Briten aber nicht nur durch Deutschland herausgefordert; auch die USA und Japan artikulierten ihren Anspruch auf Teilhabe an der globalen Macht immer offener und nachdrücklicher. In der künftigen Weltordnung, das war zu Beginn des 20. Jahrhunderts klar, würden mit ihnen zumindest zwei nichteuropäische Mächte eine zentrale Rolle spielen – was wiederum hieß, dass einige europäische Mächte einen gravierenden Macht- und Reputationsverlust würden hinnehmen müssen. Dass es als Erstes das Habsburgerreich treffen würde, war offensichtlich – aber wer sollte der Zweite oder gar Dritte sein? Russland, das im Russisch-Japanischen Krieg von 1904/05 als erste europäische Macht einen großen Krieg gegen eine nichteuropäische Macht verloren hatte? Oder Frankreich, das infolge des seit 1890 zu beobachtenden Rückgangs der demographischen Reproduktionsrate übermäßige Anstrengungen unternehmen musste, um weiterhin mitzuhalten? Oder womöglich doch Deutschland, das zwar von seiner Wirtschaftsmacht und seinem Bevölkerungswachstum her gesehen eine wichtige Rolle spielte, aufgrund der geopolitischen Lage aber nur begrenzten Zugang zu den Weltmeeren hatte und von Russland und Frankreich «in die Zange» genommen werden konnte?
Die Ungewissheit bezüglich der künftigen Weltordnung ließ den damaligen Akteuren die diversen Konflikte dramatischer vorkommen, als dies dem heutigen Betrachter angemessen erscheint. Es herrschte eine gewisse Nervosität bei der Beurteilung der politischen Lage und der sich daraus ergebenden Optionen.[33] Freilich änderte die Dynamik im Ringen um eine Position in der globalen Ordnung nichts daran, dass der deutsch-britische Konflikt – ebenso wie die hegemonialpolitische Konkurrenz in Europa zwischen Deutschland und Frankreich – im Sommer 1914 nicht akut, sondern allenfalls latent war. Die Lage hatte sich in globalpolitischer Hinsicht während der zwei, drei Jahre vor Kriegsausbruch entspannt. Ihretwegen ist der Krieg im Sommer 1914 nicht ausgebrochen.
Das dritte Konfliktfeld des Krieges: Die Zukunft der multinationalen und multireligiösen Imperien des Ostens
Das Bemerkenswerte an diesem dritten Konfliktfeld ist, dass der in ihm relevante Gegensatz, der entscheidend zum Ausbruch des Krieges beigetragen hat, mit den Bündnissen während des Krieges nicht deckungsgleich war, sondern zu ihnen querstand: Es ist der Gegensatz zwischen Nationalstaat und Imperium, zwischen einem politischen Gebilde mit klar umrissenen territorialen Grenzen, die mit der identitätspolitischen Vorstellung von der Nation und deren Ausdehnung möglichst kongruent sein sollen, also dem Nationalstaat, und einem räumlich sehr viel flexibleren Ordnungsmodell, in dem weder nationale beziehungsweise ethnische Zugehörigkeiten noch das religiöse Bekenntnis für die politische In- oder Exklusion relevant sind – dem Ordnungsmodell des Imperiums.[34] Die Idee des Nationalstaats ist in Europa in aufeinanderfolgenden Schüben von Westen nach Osten vorangeschritten, und im Ersten Weltkrieg hat sich die Ordnung des Nationalstaats im Hinblick auf Loyalität, Mobilisierungsfähigkeit und Opferbereitschaft seiner Bürger den multinationalen, multireligiösen und multilingualen Imperien als überlegen erwiesen. Die drei großen Imperien Mittel- und Osteuropas sowie des Vorderen Orients, das Habsburgerreich, das Reich der russischen Zaren und das Osmanische Reich, sind im Verlauf des Krieges zerfallen oder zerschlagen worden. Dagegen hat das Deutsche Reich, wiewohl 1918 einer der Kriegsverlierer, dort, wo es sich als Nationalstaat verstanden hat, den Krieg überstanden und ist nicht in die Teile zerfallen, aus denen es ein knappes halbes Jahrhundert zuvor zusammengefügt worden war. Der Erste Weltkrieg war hinsichtlich seiner Ergebnisse auch ein Sieg des nationalstaatlichen über das imperiale Ordnungsmodell.
Im Bereich der multinationalen Imperien Mittel- und Osteuropas sowie des Vorderen Orients zog der Krieg nicht nur Grenzverschiebungen nach sich, wie das im Westen der Fall war, sondern hier entstand eine grundlegend neue Ordnung, die sich in einigen Fällen am westeuropäischen Modell des Nationalstaats und in anderen an den Vorgaben einer Nationen wie Religionen übergreifenden Ordnung orientierte. Diese übergreifende Ordnung wurde nun aber nicht mehr durch einen Herrscher als Symbol und Inbegriff der imperialen Ordnung zusammengehalten, vielmehr durch politische Ideen und Visionen. Ein Beispiel für die Nationalstaatsbildung war Polen, während die Zusammengehörigkeitskonstruktion des Südslawentums im Fall des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen oder die Idee des proletarischen Internationalismus als Klammer der Sowjetunion für Letzteres standen. Politische Stabilität ist in diesem Raum dadurch nicht erreicht worden. Aber das war erst das Problem der Nach- beziehungsweise Zwischenkriegszeit.
Die ordnungspolitische Idee einer Kongruenz von Nationalität und Staatlichkeit war bei der Entstehung des Ersten Weltkriegs jedoch insofern von Bedeutung, als sie die Motive der Attentäter von Sarajewo prägte, die zur Schaffung eines großserbischen Nationalstaats beitragen und das Habsburgerreich als multinationale Ordnungsmacht des westlichen Balkans zerstören wollten. Die Regierung in Wien sah in dem Attentat auch einen Angriff auf ihr politisches Prestige und die pax austriaca auf dem Westbalkan und entschied sich für einen militärischen Schlag gegen Serbien, der dann zum Zündfunken für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde.
Die Weltkriegsforschung hat die Bedeutung dieses Attentats lange Zeit heruntergespielt, indem sie es im Anschluss an eine von dem griechischen Historiker Thukydides getroffene Unterscheidung als bloßen «Anlass» bezeichnete und die eigentliche «Ursache» des Krieges im ersten oder zweiten der hier skizzierten Konfliktfelder suchte: in der europäischen Hegemonialkonkurrenz oder im globalen Ringen um Macht und Einfluss. Die ausschlaggebende Rolle, die der dritten Konfliktdimension, dem Kampf um die Vormacht in Mittel- und Südosteuropa sowie in Kleinasien und im arabischen Raum, zukam, wurde weithin übersehen. Erst der Historiker Christopher Clark hat den Blick wieder auf die Rolle Serbiens und Österreich-Ungarns bei der Entstehung des Ersten Weltkrieges zurückgelenkt, und Sean McMeekin hat das im Hinblick auf Russland und dessen Begehrlichkeiten gegenüber dem Osmanischen Reich getan.[35] Bei diesem Paradigmenwechsel dürften die jugoslawischen Zerfallskriege der 1990er Jahre eine wichtige Rolle gespielt haben. Angesichts dieser Kriege, die räumlich wie zeitlich freilich beschränkt blieben und nicht weiter eskalierten, stellte sich retrospektiv die Frage, ob Vergleichbares nicht auch im Sommer 1914 möglich gewesen wäre.[36]
Kriege, die in Europa ausgebrochen waren, räumlich und zeitlich zu begrenzen gehörte zu den grundlegenden politischen Imperativen des 19. Jahrhunderts. Die italienischen und die deutschen Einigungskriege sind nach der Direktive geführt worden, dass der Krieg nach Möglichkeit in einer einzigen großen Schlacht entschieden sein müsse, sodass im Anschluss an diese «Entscheidungsschlacht» die politisch Verantwortlichen mit Friedensgesprächen beginnen konnten. So sollte verhindert werden, dass sich Dritte einmischten, was in jedem Fall zu einer Ausweitung des Krieges geführt hätte. Das ist selbst im Krimkrieg gelungen, als Großbritannien und Frankreich zugunsten des angeschlagenen Osmanischen Reichs intervenierten und dem russischen Expansionsdrang in den östlichen Balkan und zu den Meerengen zwischen Schwarzem Meer und Ägäis (zeitweilig) einen Riegel vorschoben. Hätten Preußen und Österreich, die traditionellen Verbündeten Russlands im Kampf gegen «den Westen», sich in diesen Krieg verwickeln lassen, so hätte daraus leicht ein «Weltkrieg» in der Mitte des 19. Jahrhunderts werden können. Aber Preußen und Österreich hielten sich heraus, und so blieb der Krieg im Wesentlichen auf die Krim begrenzt.
Man kann diese Lokalisierungsdirektive der europäischen Politik auch bei drei Kriegen in der unmittelbaren Vorgeschichte des Ersten Weltkriegs beobachten: 1911 beim Libyenkrieg, als Italien die türkischen Besitzungen auf der gegenüberliegenden Mittelmeerküste angriff und die Provinzen Tripolitanien und Cyrenaika zur italienischen Kolonie Libyen machte; 1912 im Ersten Balkankrieg, als einige Balkanmächte, motiviert durch die militärische Schwäche der Türken im Krieg gegen Italien, über die verbliebenen Besitzungen des Osmanischen Reichs auf dem östlichen Balkan herfielen und diese eroberten; und 1913, als die Sieger des Vorjahres miteinander in Streit gerieten und um die Aufteilung der Beute und die Vormachtposition auf dem Balkan Krieg führten. In allen drei Fällen gelang es, die Kriege zu beenden, bevor weitere Parteien, insbesondere eine der europäischen Großmächte, eingriffen. Warum war das im Sommer 1914 anders?
Der Sommer 1914: Die Zusammenführung der drei Konfliktfelder durch den Schlieffenplan
Es wäre im Sommer 1914 die Aufgabe vor allem der deutschen, aber auch der britischen Politik gewesen, das kataklysmische Zusammenströmen der drei hier beschriebenen Konfliktfelder zu verhindern. Eigene Fehleinschätzungen und auch strukturelle Rahmenbedingungen haben dazu geführt, dass das Gegenteil der Fall war. Die Briten haben die Dynamik der neuerlichen Balkankrise unterschätzt, sie waren mit dem Irlandproblem beschäftigt, und als sie merkten, dass die Dinge auf dem Balkan auf einen großen Krieg zuliefen, und sich als Vermittler ins Spiel brachten, war es bereits zu spät, denn jetzt glaubte man in Wien, sich nicht mehr ohne schwerwiegenden Prestigeverlust auf Verhandlungen mit Serbien einlassen zu können. In Berlin wiederum wollte man Österreich-Ungarn als dem einzigen Verbündeten, den man noch hatte, einen solchen Prestigeverlust nicht zumuten. Also ließ man das britische Vermittlungsangebot ins Leere laufen.
Dass Berlin eine Vermittlung durch die Briten ablehnte, hatte auch mit dem Misstrauen zu tun, das während der britisch-russischen Verhandlungen über eine Marinekonvention erwachsen war.[37] Und zweifellos zeigte sich in der Distanz gegenüber London auch die Enttäuschung darüber, dass die deutschen Entspannungsbemühungen bei den Briten nicht auf die Gegenliebe gestoßen waren, die man in Berlin erwartet hatte; im Gegenteil, man glaubte, eine im Kern gegen Deutschland gerichtete Außenpolitik Großbritanniens beobachten zu können.[38] Ausschlaggebend für das neue Misstrauen dürfte nicht einmal so sehr der Inhalt der Marinekonvention gewesen sein als vielmehr die Art und Weise, wie die Briten auf eine entsprechende deutsche Nachfrage reagierten. Gegenstand der Marinekonvention war unter anderem, dass durch den Sund in der Ostsee eingelaufene britische Großkampfschiffe die Anlandung russischer Marine